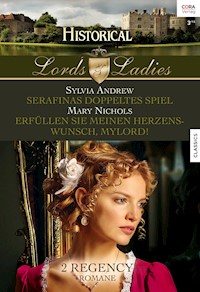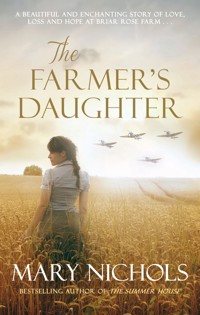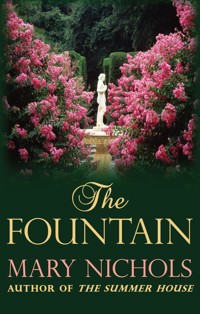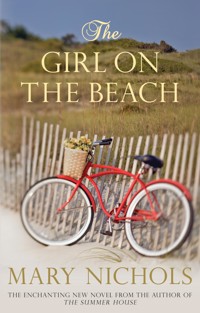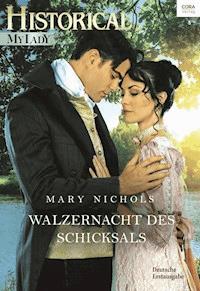4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical MyLady
- Sprache: Deutsch
In heißer Liebe entbrennt Duncan Stanmore, Marquis of Risley, zu der schönen Schauspielerin Madeleine Charron. So tief sind seine Gefühle, dass er sie nicht zu seiner Mätresse, sondern zu seiner Ehefrau machen möchte. Ein unmögliches Vorhaben, das in der besten Gesellschaft Londons einen Skandal heraufbeschwören würde! Doch dann verrät ihm die Dame seines Herzens ein kühnes Geheimnis, das ihrer Liebe trotz der Standesunterschiede eine Chance geben könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mary Nichols
Wird die Liebe siegen?
IMPRESSUM
WIRD DIE LIEBE SIEGEN? erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© 2003 by Mary Nichols Originaltitel: „A Lady Of Consequence“ erschienen bei: Mills & Boon ltd., London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe MYLADY ROYALBand 26 - 2003 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg Übersetzung: Roy Gottwald
Abbildungen: Harlequin Books S.A.
Veröffentlicht im ePub Format in 09/2015 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733763350
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
PROLOG
1817
Madeleine war die Letzte, die noch in der Küche stand und ihr Arbeitspensum zu Ende bringen musste. Alle anderen Dienstboten hatten ihre Aufgaben erledigt und waren gegangen. Zum Schluss hatte die Köchin, ehe sie den Raum verließ, gesagt: „Spute dich, oder du wirst nicht fertig, bis es wieder Zeit zum Aufstehen ist.“ Diese Bemerkung hatte nicht dazu beigetragen, Madeleine aufzumuntern.
Die Herrschaft hatte ein Abendessen gegeben, und es war Madeleine unverständlich, dass zwölf Anwesende eine solche Menge an Abwasch verursachen konnten – Teller, Vorlegeplatten, Schüsseln, Gläser und Besteck, ganz zu schweigen von den Töpfen und Pfannen, in denen die Speisen zubereitet worden waren. Die Gäste waren gegangen. Eine Stunde zuvor hatte Madeleine die Kutschen abfahren hören. Lord und Lady Bulford, ihr Sohn, der Ehrenwerte Henry Bulford, und die beiden Töchter des Hauses, Hortense und Annabel, hatten sich in ihre Räumlichkeiten zurückgezogen. Ihnen war es gleich, dass noch jemand vom Personal auf war und sich abplagte.
Nachdem Madeleine fertig gespült hatte, richtete sie die Frühstückstabletts für die jungen Damen her, füllte Wasser in die Kessel und belegte das Feuer im Herd mit Asche. Es war die letzte Pflicht, die ihr vor dem Schlafengehen zufiel. Hätte die Mutter nicht bei einem Unfall auf so tragische Weise das Leben verloren, wäre Madeleine nicht genötigt gewesen, diese Sklavenarbeit zu verrichten. Arabella Cartwright war beim Einkaufen in der Oxford Street von einem Fuhrwerk überrollt worden. Sie war eine sehr gute Näherin gewesen, und Madeleine hätte denselben Beruf ergriffen, wäre die Mutter ihr erhalten geblieben.
Jedermann hatte von einem Unglück gesprochen, für das niemand verantwortlich zu machen war. Am Tag des Begräbnisses jedoch hatte Madeleine zwei Nachbarinnen äußern hören, dass der junge Herr, der die Kutsche gelenkt hatte, viel zu schnell gefahren sei und man ihn auspeitschen müsste, weil er so durch die belebte Straße gerast war. Er war jedoch ein Adliger und obendrein betrunken gewesen. Das allein schien Rechtfertigung genug dafür zu sein, dass ein neunjähriges Kind plötzlich ohne die Mutter dagestanden hatte.
Leider hatte Madeleine auch keinen Vater mehr. Sie hatte ihn nie gekannt. Daher war sie in das Heim in der Monmouth Street gebracht worden, in dem Kriegswaisen Aufnahme fanden. Sie nahm an, dass jemand der Leitung erzählt haben musste, ihr Vater sei Soldat gewesen. Sie konnte nicht beurteilen, ob das stimmte, da die Mutter nie über ihn geredet hatte. Als sie zwölf Jahre und damit alt genug zum Arbeiten war, hatte man sie in die Bedford Row Nummer sieben zu Lady Bulford geschickt.
Seither war die Küche in der Residenz Ihrer Ladyschaft ihre Welt. Zwei Jahre stand sie jetzt im Dienst, in denen jeder neue Tag wie der vorhergehende war. Nichts unterbrach die Routine. Außer den anderen Dienstboten, die Madeleine ihrer Herkunft wegen mit Herablassung behandelten, hatte sie niemanden, mit dem sie hätte reden können. Aber es war schließlich nicht ihre Schuld, dass sie im Waisenhaus gewesen war. Abgesehen von ein paar Stunden am Sonntagnachmittag, wenn sie im Park spazieren ging, verließ sie das Haus nur selten. Dann gab sie vor, eine Dame zu sein, die nichts Besseres zu tun hatte, als hübsch auszusehen, um die Aufmerksamkeit eines jungen Kavaliers auf sich zu lenken, der ihr ein so luxuriöses Leben bieten würde, wie die Bulfords es führten.
Dauernd hielt die Köchin ihr vor, sie würde zu oft träumen. Aber was hätte sie anderes tun können, als sich ein schöneres Dasein vorzustellen? Madeleine hockte vor dem noch warmen Ofen, starrte auf die niedergebrannten Holzscheite und sehnte sich nach einem Wunder.
Ein Geräusch erschreckte sie. Sie drehte sich um und sah den Ehrenwerten Mr Henry Bulford in Nachthemd und Morgenmantel in der offenen Tür stehen. Hastig richtete sie sich auf.
„Wer sind Sie?“, wollte er wissen.
„Ich heiße Maddy, Sir.“
„Das ist ein ungewöhnlicher Name.“ Henry lächelte, und sein Blick drückte plötzliche Belustigung aus. Madeleine fand, er sei ein sehr gut aussehender junger Mann.
„Das ist die Abkürzung von Madeleine“, erklärte sie. Seit ihrer Ankunft im Haus seiner Eltern war sie jedoch immer nur Maddy gerufen worden.
„Wie lange sind Sie hier schon beschäftigt?“
„Bereits den ganzen Tag.“
„Das meinte ich nicht. Ich möchte wissen, wie lange Sie schon bei uns im Dienst sind.“
„Seit zwei Jahren, Sir. Kann ich etwas für Sie tun?“
„Oh, ja“, antwortete er und musterte sie. „Oh, ja. Das können Sie.“
„Und was?“
Er lachte. „Ich wollte mir ein Glas Milch holen, weil ich nicht einschlafen kann.“
Sie ging an ihm vorbei in die Vorratskammer, wo die Milch in einem Krug auf dem kalten Fußboden stand. „Könnten Sie sie warm machen?“, fragte Mr Bulford. „Angewärmt wäre es besser.“
Madeleine goss etwas Milch in einen Topf und fachte das Feuer neu an, derweil Mr Bulford sie beobachtete.
„Wissen Sie, dass Sie sehr hübsch sind?“, äußerte er.
„Nein.“ Sie spürte sich erröten, und das lag nicht an der vom Ofen ausgehenden Wärme. „So etwas sollten Sie nicht sagen, Sir.“
„Warum nicht? Es ist die Wahrheit. Ich wette, hinter Ihnen sind viele junge Burschen her.“
„Nein, Sir. Noch bin ich nicht alt genug dafür, selbst wenn man ihnen erlauben würde, mir nachzustellen.“ Nach Madeleines Ankunft bei Lady Bulford hatte die Baronin unmissverständlich klargemacht, dass sie kein Techtelmechtel unter dem Personal wünsche. Obwohl Madeleine damals nicht verstanden hatte, was Ihre Ladyschaft meinte, hatte sie sich in der Zwischenzeit mehr Menschenkenntnis erworben, vor allem, was das Benehmen des starken Geschlechts betraf. Ihre Mutter wäre schockiert gewesen, hätte sie gewusst, wie manche Männer sich aufführten.
„Wie alt sind Sie?“
„Vierzehn.“
„Du meine Güte! Für Ihr Alter sind Sie fabelhaft entwickelt. Offensichtlich werden Sie hier sehr gut ernährt.“
Madeleine fühlte sich nicht bemüßigt, Mr Bulford zu sagen, dass sie sich mit den Resten vom Tisch der Herrschaft und dem der anderen Dienstboten begnügen musste. Sie goss die angewärmte Milch in ein Glas und händigte es Mr Bulford aus. „Bitte sehr, Sir. Ich hoffe, Sie können einschlafen, wenn Sie es ausgetrunken haben.“
„Oh, ich bin sicher, dass die Milch mir helfen wird. Gehen Sie bald zu Bett?“
„Ja, wenn ich den Topf gereinigt und das Feuer ausgemacht habe.“
„Gute Nacht, Maddy.“
„Gute Nacht, Sir.“
Mr Bulford verließ die Küche, das Glas Milch in der Hand. Madeleine streute Asche auf das Feuer. Wie eigenartig, dass der Sohn des Hauses sie zur Kenntnis genommen und obendrein geäußert hatte, sie sei hübsch. Sie fragte sich, ob es zutraf. Ihre Mutter hatte dasselbe behauptet, ihr schöne Kleider genäht und ihr das Haar gebürstet, bis es seidig glänzte. Aber das war vor langer Zeit gewesen, und nun trug sie die übliche Dienstbotenuniform und war abends zu müde, um mehr zu tun, als sich das verschmutzte Haar zu kämmen. Wenn doch nur …
Wenn doch die Mutter noch da wäre! Dann würde Madeleine mit ihr in der kleinen Wohnung über der Näherei leben, die Arabella eingerichtet hatte und die ihnen ein einigermaßen anständiges Leben ermöglichte. Sie würde lernen, wie man Kleider, Mäntel, hübsche Weißwäsche und Hüte herstellte. Die Mutter hatte gesagt, sie wolle sich einen Namen als eine der bekanntesten Schneiderinnen der Stadt machen, damit die Damen der Oberschicht sich bei ihr drängten, um von Madame Charron und ihrer charmanten Tochter eingekleidet zu werden. Der Familienname lautete zwar Cartwright, doch Arabella hatte gemeint, Charron klänge eindrucksvoller.
Erschöpft schleppte Madeleine sich die Hintertreppe zu ihrer auf dem Dachboden gelegenen kleinen Kammer hinauf. Der Raum war der am wenigsten komfortable unter den Behausungen, in denen die weiblichen Dienstboten ihrem Status entsprechend untergebracht waren.
Fünf Minuten später, nachdem sie sich zu Bett begeben hatte, hörte sie jedoch jemanden die Stiege heraufkommen. Zunächst achtete sie kaum auf das Geräusch, weil sie annahm, dass ein Hausmädchen aus der Küche zurückkehrte, wo es sich ein Glas Wasser geholt hatte. Als die Schritte jedoch vor ihrer Kammer anhielten, setzte Madeleine sich ruckartig auf und spürte das Herz bis zum Hals schlagen.
Die Tür wurde geöffnet, und der Sohn des Hauses, der nur sein Nachthemd anhatte, schaute sie lächelnd an. „Erschrecken Sie nicht, meine Liebe“, sagte er, schloss die Tür hinter sich und kam auf sie zu. Madeleine war so verblüfft, dass sie ihn nur sprachlos anstarren konnte. „Ich kann immer noch nicht einschlafen.“
„Möchten Sie, dass ich Ihnen noch ein Glas Milch hole?“, fragte sie und dachte daran, dass es ihr wohl genauso ergehen würde, wenn er sie weiter auf Trab hielt.
„Nein, meine liebe Madeleine“, erwiderte er, setzte sich zu ihr aufs Bett und ergriff ihre Hand, die vom vielen Seifenwasser rot und rissig war. Das schien ihm jedoch nicht aufzufallen. „Ich glaube, ich könnte zur Ruhe kommen, wenn ich mich neben Sie lege.“
„Sir!“ Sie war verwirrt, bestürzt und irgendwie auch seltsam aufgeregt. Das Herz klopfte ihr zum Zerspringen, und sie gab einen halb erstickten Laut von sich.
Mr Bulford lächelte. „Sie sind so warm und schön. Sie haben den Körper einer Göttin, und ich kann kein Auge zutun, weil ich ständig an Sie denken muss. Ich möchte Sie berühren, Ihre zarte, rosige Haut streicheln, Sie liebkosen und küssen.“ Er beugte sich vor, nahm ihren Kopf zwischen die Hände und gab ihr einen Kuss. Seine Lippen waren weich und feucht, und sein Atem roch nach Alkohol. Mit seinen Händen glitt er Madeleine über den Leib, zerrte ihr das Nachthemd über die Knie und drückte ihr die Beine auseinander.
Plötzlich begriff sie, dass das, was zu tun er vorhatte, falsch war. Die Vorsteherinnen im Waisenhaus hatten ihr viel über die fleischlichen Gelüste der Männer erzählt und sie immer wieder davor gewarnt, sich hinzugeben, bevor sie einen Ehering trug. Man hatte ihr gesagt, das sei die schlimmste aller Sünden, und ihr Beispiele von Kindern vorgehalten, deren Mütter nie verheiratet gewesen waren. Solche Kinder wurden Bastarde genannt, und man bekam einen solchen Bankert, wenn man sich vor der Hochzeitsnacht mit einem Mann einließ.
Madeleine selbst war von einigen dieser Frauen als Bastard bezeichnet worden. Sie hatten behauptet, ihre Mutter sei nicht mit ihrem Vater, wer immer er war, vermählt gewesen. Um sie zum Schweigen zu bringen, hatte sie dann wütend erwidert, er sei ein Held gewesen und im Kampf für sein Vaterland gestorben. Nun wurde sie jäh gewahr, dass auch das Gerede der Dienstboten kein hohles Geschwätz war. Sie hatte keine Wahnvorstellungen und erlebte auch nicht die Erfüllung einer Sehnsucht, sondern einen Albtraum.
„Nein!“, schrie sie auf und versuchte, sich Mr Bulfords Griff zu entziehen. „Das dürfen Sie nicht tun!“
„Nein?“, fragte er und warf sich auf sie, sodass sie unter ihm auf die Matratze gedrückt wurde. „Es steht Ihnen nicht zu, meine liebe Madeleine, mir zu sagen, was ich tun darf und was nicht. Ich mache, was mir gefällt. Sie sind eine Angestellte und müssen meinen Wünschen nachkommen. Sie wollen doch nicht ohne Empfehlungsschreiben aus dem Haus gewiesen werden, nicht wahr?“
„Sie würden das doch nicht wirklich …?“, flüsterte sie ängstlich.
„Doch, sicher. Aber ich werde davon absehen, wenn Sie ein braves Mädchen sind.“ Er vergrub das Gesicht zwischen ihren Brüsten.
„Ich bin ein braves Mädchen“, erwiderte sie und bemühte sich, von Mr Bulford wegzukommen. „Bitte, lassen Sie mich los.“
Er schaute sie an. „Wenn ich mit Ihnen fertig bin“, äußerte er. Sein Ton hatte grimmig entschlossen geklungen, und das bestärkte sie in ihrem Widerstand. Hätte er ihr weiterhin Komplimente gemacht, ihr Koseworte zugeraunt und sie sanft berührt, wäre sie ihm womöglich erlegen. Ihre Sehnsucht, von jemandem geliebt, zärtlich behandelt und als Mensch betrachtet zu werden, war so groß, dass sie vielleicht aufgehört hätte, sich zu sträuben. Da Mr Bulford jedoch nicht daran gewöhnt war, dass ihm etwas versagt wurde, geriet er in Wut, und das machte auch Madeleine zornig.
Mit letzter Kraft rammte sie ihm das Knie in den Schritt und hörte ihn vor Schmerz aufschreien. Als er vom Bett sprang, nutzte sie die Gelegenheit, rannte zur Tür und riss sie auf. Sie floh in den Korridor und die Treppe hinunter, um sich in der Küche in Sicherheit zu bringen. Sie erreichte jedoch nicht einmal das untere Geschoss, da sie mit Lord Bulford zusammenprallte, der, weil er wissen wollte, was der Lärm zu bedeuten habe, sein Bett verlassen hatte und ihr auf dem Treppenpodest entgegenkam.
„Wo brennt es?“, brüllte er, während er den Gürtel seines Morgenmantels verknüpfte.
„Ich … ich habe keine Ahnung“, stammelte Madeleine.
„Was ist dann hier los?“
„Ihr Sohn befindet sich in meiner Kammer“, sagte sie, ohne an die Folgen zu denken, die diese Erklärung zeitigen konnte. „Er hat versucht … Er hätte nicht …“
„Mein Sohn? Machen Sie sich nicht lächerlich, Sie impertinentes Frauenzimmer! Was sollte er von Ihnen wollen?“
„Was ist los, George?“ Lady Bulford, die sich ebenfalls eine Robe de chambre angezogen hatte, gesellte sich hinzu.
„Diese unverschämte Person hat Henry bezichtigt, zu ihr ins Zimmer gekommen zu sein.“
Ihre Ladyschaft musterte Madeleine und verzog verächtlich die Lippen. „Sie ist offensichtlich nicht bei Trost. Ich nehme an, sie hat schlecht geträumt oder einen Lakai für Henry gehalten. Falls sie Männer bei sich ein und aus gehen lässt, so bleibt uns nur …“
„Ich habe niemanden in meiner Kammer empfangen“, entgegnete Madeleine, obwohl es sich nicht gehörte, die Herrschaft zu unterbrechen. „Ihr Sohn ist unaufgefordert zu mir gekommen. Glauben Sie, ich würde ihn nicht erkennen, wenn ich ihn sehe? Erst kam er zu mir in die Küche, weil er ein Glas Milch haben wollte. Das habe ich ihm gegeben, und dann hat er gewartet, bis ich ins Bett gegangen bin. Schließlich ist er zu mir gekommen …“
„Du lieber Gott! Welche Unverfrorenheit!“, wandte Lady Bulford sich an ihren Gatten. „Als ob Henry einen solchen Niemand wie dieses Wesen eines zweiten Blicks würdigen würde! Was hoffen Sie mit diesem Märchen zu erreichen?“, wandte sie sich wieder an Madeleine. „Wollen Sie Geld?“
„Nein, Mylady. Ich will nur, dass man mir erlaubt, ins Bett zurückzukehren. Ich will nicht, dass jemand ohne meine Erlaubnis bei mir hereinkommt.“ Sie hatte sehr betont gesprochen, wie es ihr von der Mutter beigebracht worden war. „Bitte, sagen Sie Ihrem Sohn, dass seine Avancen mir unwillkommen sind.“
„Bei Gott, das reicht! Ich will nichts mehr hören“, schäumte Seine Lordschaft. Vor Entrüstung war sein Gesicht rot angelaufen. „Sie wollen zurück ins Bett? Und mit wem, wenn ich fragen darf?“
„Mit niemandem. Ich bin müde, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe …“
„Oh, falls Sie sich über zu viel Arbeit beklagen, dann lässt sich dem leicht Abhilfe schaffen“, fiel Lady Bulford Madeleine ins Wort. „Sie können Ihre Sachen packen und das Haus auf der Stelle verlassen. Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt.“
„Ich habe nichts Falsches getan.“
„Ungerechtfertigte Anschuldigungen gegen meinen Sohn zu erheben und sich über zu viel Arbeit zu beklagen ist falsch genug. Schließlich weiß alle Welt, dass ich eine rücksichtsvolle Herrin bin.“
„Und es ist genauso falsch, mitten in der Nacht nur im Nachthemd durchs Haus zu rennen“, fügte Seine Lordschaft hinzu und ließ den Blick lüstern über Madeleine schweifen.
„Das habe ich nur getan, weil ich vor Ihrem Sohn geflohen bin.“
„Dann verschwinden Sie, und zwar für immer. Sie können heute Nacht noch bleiben. Ich erwarte jedoch, dass Sie morgen, wenn ich zum Frühstück herunterkomme, nicht mehr im Haus sind.“
„Aber wohin soll ich denn gehen, Mylord?“
„Das ist nicht meine Sorge. Gehen Sie dahin zurück, wo Sie hergekommen sind. Und rechnen Sie nicht mit einem Empfehlungsschreiben.“
„Ich bitte Sie, Mylord …“
„Genug! Es gibt keine Debatte. Gehen Sie mir aus den Augen, ehe ich Sie auf der Stelle aus dem Haus werfen lasse.“
Madeleine kehrte in ihre Kammer zurück, stellte erleichtert fest, dass der unwillkommene Besucher verschwunden war, und ließ sich schluchzend aufs Bett fallen. Sie weinte sich die Seele aus dem Leib und fragte sich, warum niemand ihr Glauben schenkte. Das war ungerecht. Wohin sollte sie gehen? Wie sollte sie in Zukunft leben? An wen konnte sie sich wenden? Ins Waisenhaus konnte sie nicht zurück. Dafür war sie schon zu alt. Vielleicht musste sie nun ins Armenhaus.
Wenn Mr Bulford auch nur eine Spur von Anstand hatte, dann würde er zugeben, was er getan hatte, und sie dadurch von aller Schuld freisprechen. Sie wusste jedoch, dass das nicht passieren würde. Er gehörte zur Oberschicht, zu den Leuten, die mehr Geld hatten, als sie im Leben ausgeben konnten. Und dank ihres Reichtums dachten sie, sich so aufführen zu können, wie sie wollten. Mr Bulford war genau wie der vornehme junge Herr, der ihre Mutter überfahren hatte. Menschen wie Madeleine waren die Niedrigsten der Unterschicht und zählten nichts.
Langsam verwandelte sich ihr Elend in Zorn, und die Wut machte sie stark. Sie würde sich nicht einschüchtern lassen. Sie war so gut wie diese Leute, sogar besser, und würde ihnen eines Tages beweisen, dass sie mit ihr rechnen mussten. Eines Tages würde sie ihnen zeigen, dass sie ihnen überlegen war. Eines Tages würde sie von ihnen als ihresgleichen anerkannt werden müssen. Falls sie bis dahin einigen Adligen auf die Zehen treten musste, ließ sich das nicht ändern. Umso besser, wenn es die von Mr Bulford wären. Sie hatte keine Vorstellung davon, wie sie sich an ihm und seinen Standesgenossen rächen würde, auch nicht, wie lange es dauern mochte, aber nichts und niemand sollte sich ihr dabei in den Weg stellen. Sie würde ihre Träume wahr machen und eines Tages eine große Dame sein.
1. KAPITEL
1827
Der letzte Akt endete unter donnerndem Applaus. Die Schauspieler bekamen mehrere Vorhänge, doch jeder von ihnen wusste, dass die Zuschauer in Wirklichkeit nur Miss Madeleine Charron sehen wollten. Die Welt des Theaters lag ihr zu Füßen. Alle jungen Herren der Hautevolee und auch etliche, die nicht mehr ganz so jung waren, vergötterten sie. Zu ihnen zählte auch Duncan Stanmore, der Marquess of Risley.
„Ich weiß nicht, was ich mehr bewundere – ihr Aussehen oder ihr schauspielerisches Talent“, sagte er zu Benedict Willoughby, bevor er sich wie alle anderen Zuschauer mit ihm erhob, Beifall klatschte und „Bravo!“ rief. „Beides ist ganz außergewöhnlich.“
„Falls du ein Auge auf Miss Charron geworfen haben solltest, wirst du eine bittere Enttäuschung erleben“, erwiderte der Freund. „Im Gegensatz zu ihresgleichen ist sie sehr wählerisch.“
„Das sagst du nur, weil sie sich in der letzten Woche geweigert hat, mit dir zu soupieren.“
„Nein, überhaupt nicht“, entgegnete Benedict gekränkt, während man sich zum Ausgang begab. „Ich bin nicht der Einzige, den sie enttäuscht hat. Sie hat allen Bewunderern einen Korb gegeben. Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass sie in der letzten Woche mit Sir Percival Ponsonby im Park ausgefahren sein soll. So wählerisch kann sie also nicht sein.“
„Er ist ein netter alter Gentleman, der keiner Fliege etwas zu Leide tun könnte.“
„Ich habe nicht gesagt, dass er das tun würde. Du musst jedoch zugeben, dass er ein verknöcherter alter Kerl ist. Ich schätze ihn auf wenigstens sechzig Jahre. Und wie lächerlich er sich anzieht!“
„Er ist gut betucht und weiß, wie man eine Frau behandeln muss. Und er hatte stets ein Faible für Schauspielerinnen. Sie wissen seine Höflichkeit zu schätzen und fühlen sich bei ihm sicher. Aber Miss Charrons Beziehung zu ihm wird nicht von langer Dauer sein. Er ist ein eingefleischter Junggeselle.“
„Großer Gott! Du spielst doch nicht mit dem Gedanken, dich als zukünftigen Gatten ins Spiel zu bringen?“
„Sei kein Narr, Benedict. Das kommt überhaupt nicht infrage. Mein verehrter Vater würde einen Tobsuchtsanfall bekommen. Aber ich werde Miss Charron zum Abendessen ausführen.“
„Ja, du musst ihr nur deinen Titel nennen und dein Vermögen unter die Nase reiben, damit sie dir zu Füßen sinkt.“
„Ich werde mit ihr soupieren, ohne das eine oder das andere auch nur zu erwähnen.“
„Wann?“
„Innerhalb der nächsten Woche. Darauf wette ich fünfundzwanzig Pfund.“
„Abgemacht.“
Man betrat die Straße. Ein Blumenmädchen stand neben seinem Korb und bot den jungen Männern, die mit ihren Begleiterinnen zu ihren Kutschen gingen, Sträußchen an. Duncan hielt bei der jungen Frau an, entnahm seiner Couverttasche einige Guineen und warf sie mehrmals auf der offenen Hand hoch. „Ich kaufe alle Blumen“, sagte er und ließ das Geld in den Korb fallen. „Bringen Sie sie zum Bühneneingang, und geben Sie sie für Miss Charron ab.“
„Soll ich eine Nachricht übermitteln, Sir?“, fragte das Mädchen schmunzelnd.
„Nein. Geben Sie nur die Blumen ab. Und bringen Sie Miss Charron morgen Abend, übermorgen Abend und an jedem Abend bis zum Ende der Woche alle Ihre Sträuße.“ Duncan holte mehr Geld aus der Börse und warf es zu den bereits im Korb liegenden Münzen. Dann wandte er sich an den Freund: „Komm, Benedict. Ich lade dich zu White’s ein, und nach dem Essen können wir Karten spielen.“
„Willst du nicht zum Bühneneingang gehen?“
„Warum? Soll ich mich ans Ende der langen Schlange anderer Verehrer stellen, die hoffen, von Miss Charron bemerkt zu werden? Nein, auf keinen Fall.“
Benedict zuckte mit den Schultern. Er war das seltsame Benehmen des Freundes gewohnt. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Club.
Am Ende der Woche wurde ein an Miss Madeleine Charron adressiertes Päckchen im Theater abgegeben. Es enthielt eine einzelne diamantbesetzte Girandole und ein Billett, auf dem nur stand:
Den anderen Ohrring bekommen Sie, wenn Sie am Montag mit mir dinieren. Nach der Vorstellung wird meine Kutsche vor dem Bühneneingang auf Sie warten.
Die Nachricht war nicht signiert. Sie sollte Madeleines Neugier wecken, und genau das tat sie. Madeleine war daran gewöhnt, Blumen zu bekommen, die ihr jedoch im Allgemeinen in der Hoffnung auf das Vorrecht, sie ausführen zu dürfen, von ihren Bewunderern übergeben wurden. Manchmal waren auch schwärmerische Liebesbriefe beigefügt oder überschwängliche Gedichte. Aber niemals hatte ein Unbekannter ihr etwas geschickt. Es war äußerst ungewöhnlich, dass er ihr an jedem Abend der Woche eine Fülle von Blumen hatte überbringen lassen und schließlich einen Ohrring, der so außerordentlich schön war, dass sein Anblick ihr die Sprache verschlug. Der mysteriöse Gentleman hob sich sehr von ihren anderen Verehrern ab.
„Er muss sehr reich sein“, meinte Madeleines Freundin Marianne, nachdem sie die Girandole gesehen hatte. Sie war mittleren Alters und eine sehr gute Schauspielerin, die einmal, vor noch nicht allzu vielen Jahren, die gesamte Hautevolee eine Saison lang glauben gemacht hatte, sie sei eine höchst vermögende Dame. „Bist du sicher, dass du keine Ahnung hast, wer der Absender ist?“
„Ja.“
„Wirst du mit ihm dinieren?“
„Das weiß ich noch nicht. Er ist anscheinend sehr von sich selbst überzeugt.“
„Inwiefern ist das von Belang? Zweifellos bedeutet das, dass er adlig ist. Und auf einen Adligen hast du es doch abgesehen, nicht wahr?“
Nachdem Madeleine vor Jahren als Näherin zum Ensemble gekommen war, hatte Marianne sich mit ihr angefreundet. Später, nachdem sie in kleineren Rollen aufgetreten war, hatte Marianne ihr Schauspiel- und Sprechunterricht gegeben, damit man sie auch noch in der letzten Reihe des Zuschauerraums hörte, und sie gelehrt, wie sie sich auf der Bühne bewegen und gestikulieren musste, welchen Ausdruck sie ihren Augen zu geben hatte, damit sie ihre Rolle ausfüllte, ohne ihr Innerstes preiszugeben. Sie hatte ihr auch beigebracht, bei Gesprächen zuzuhören, unterschwellige Andeutungen zu bemerken, Untertöne wahrzunehmen und das Benehmen der Leute zu beobachten, damit sie als Schauspielerin den Rang erreichte, den sie mittlerweile innehatte.
Madeleine wiederum hatte ihr zum Ausgleich anvertraut, sie hege den geheimen Wunsch, eine vornehme Dame zu sein. Darüber hatte Marianne sich lustig gemacht, denn schließlich heirateten Herren aus der feinen Gesellschaft keine Schauspielerin. Die Freundin hatte ihr zu verstehen gegeben, wie schwierig es sein würde, jemanden aus den gehobenen Kreisen zu finden, der sich mit Madeleine vermählte. Im Allgemeinen sah die Hautevolee auf Leute vom Theater herab, und im Übrigen war es nicht unbedingt erstrebenswert, eine Dame der Gesellschaft zu sein, weil damit eine Menge unliebsamer Verpflichtungen verbunden waren.
„Außerdem wirst du feststellen, dass die Eltern eines jungen Mannes dir alle möglichen Hindernisse in den Weg legen“, hatte Marianne hinzugefügt. „Falls sie in der guten Gesellschaft auch nur irgendeine Bedeutung haben, werden sie sich mit allen Mitteln gegen dich wehren. Sie werden ihrem Sohn eine Frau zur Gattin aussuchen. Etwas anderes ist es natürlich, falls du es auf einen älteren Herrn abgesehen hast, einen Witwer vielleicht, der Kinder hat.“
Bei dieser Vorstellung hatte Madeleine missmutig das Gesicht verzogen. „Nein, das kommt nicht infrage. Ich möchte, dass die Leute mich beneiden, zu mir aufsehen und mich ernst nehmen. Ich will ein großes Haus führen und viel Personal haben. Niemand soll es wagen dürfen, die Nase über mich zu rümpfen oder mich als etwas Selbstverständliches zu betrachten.“
„Du hast hohe Ansprüche, Maddy. Ich gebe dir den guten Rat, das zu nehmen, was dir geboten wird, und es zu genießen, ohne gleich nach den Sternen zu greifen.“
Wenngleich Marianne um Madeleines Ehrgeiz wusste, kannte sie doch den Grund dafür nicht. Ihr war nicht bekannt, dass die Freundin von Wut auf die Aristokratie getrieben wurde, die sie jedes Mal überkam, wenn sie an Mr Bulford und seine herzlosen Eltern dachte. Der Groll auf den Adel war seit damals nicht geringer geworden. In den ersten schweren Jahren hatte Madeleine ihren Drang nach Rache genährt. Nein, Rache konnte es nicht sein, denn Mr Bulford hatte inzwischen den Titel geerbt und war mit einer hochnäsigen Frau verheiratet, um die Madeleine ihn nicht im Mindesten beneidete. Eines Abends hatte sie ihn und seine Gattin bei einem Theaterfest gesehen und war nicht von ihm erkannt worden. Aber warum hätte er auch in der schönen Schauspielerin, von der London im Sturm erobert worden war, die blasse, dünne Küchenmagd erkennen sollen, der er sich einst aufzuzwingen versucht hatte?
Inzwischen war viel Zeit vergangen. Manche der Ereignisse in den vergangenen Jahren waren so schrecklich gewesen, dass Madeleine sich wünschte, sie vergessen zu können. Sie konnte die Erinnerung daran jedoch nicht verdrängen und fühlte sich in ihrer Entschlossenheit nur noch bestätigt. Sie hatte jeden Schlag überlebt, den das Schicksal ihr versetzt hatte, manchmal jedoch geglaubt, nicht mehr ertragen zu können. Sie war beinahe Hungers gestorben, hatte gebettelt und sogar gestohlen, worauf sie nicht stolz war, bis sie endlich Arbeit als Näherin gefunden hatte. Stundenlang hatte sie angestrengt sticheln müssen, in schäbigen Unterkünften gewohnt und sich die Finger wund gearbeitet, und alles für einen Hungerlohn.
Ihr Ehrgeiz war durch die Notwendigkeit, sich den Lebensunterhalt verdienen zu müssen, etwas gedämpft worden, aber nicht restlos geschwunden. Vor drei Jahren hatte sie eines Tages auf dem Heimweg ein dringend benötigtes Kostüm im Drury Lane Theatre abgeben müssen. Wenn dort eine große Aufführung vorbereitet wurde, half ihre Vorgesetzte manchmal bei der Anfertigung von Bühnengewändern aus.
Bei dieser Gelegenheit hatte das gesamte Ensemble nach einer erfolgreichen Vorstellung in einem herrschaftlichen Palais gefeiert. Mr Lancelot Greatorex, der Theaterdirektor, hatte Madeleine durch seine seltsame Kleidung und überschwängliche Gestik fasziniert. Angesichts ihrer Neugier hatte er wissen wollen, ob sie Schauspielerin sei.
„Oh, nein!“, hatte sie geantwortet.
„Wieso wissen Sie das so genau?“
„Nun, im ganzen Leben habe ich noch nie eine Bühne betreten, Sir.“
„Das ist nicht von Belang. Sie müssen nicht auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten, um eine Rolle zu spielen. Wir alle tun das von Zeit zu Zeit auch im Alltag. Wollen Sie mir sagen, dass Sie keine Träume und nie vorgegeben haben, jemand anderer zu sein?“
„In diesem Licht habe ich das bisher nicht gesehen.“
„Sie haben eine gute Aussprache. Was tun Sie, um sich Ihr Brot zu verdienen?“
„Ich bin Näherin“, hatte Madeleine geantwortet.
„Beherrschen Sie Ihr Handwerk gut?“
„Ja, Sir. Das Kostüm, das ich Ihnen brachte, habe ich fast ganz allein genäht.“
„Geht Ihnen die Arbeit schnell von der Hand?“
Madeleine nickte.
„Wie viel verdienen Sie?“
„Sechs Pfund im Jahr, Sir.“
Mr Greatorex hatte gelacht. „Der Impresario kann Ihnen das Doppelte geben.“
„Oh! Ich glaube nicht, dass ich schauspielern kann.“
„Das verlange ich nicht von Ihnen. Schauspielerinnen gibt es wie Sand am Meer, aber gute Näherinnen sind Mangelware. Möchten Sie sich dem Ensemble anschließen? Es käme uns zupass.“
Madeleine hatte nicht mit der Zusage gezögert. Das farbige Leben unter Theaterleuten hatte sie gereizt, und ihr im Unterbewusstsein schlummernder Ehrgeiz war geweckt. Wenn sie es zu etwas bringen und eine Stellung erreichen wollte, zu der sie nicht geboren war, hätte sie keinen besseren Ort finden können, um das zu erlernen.
Also hatte sie als Schneiderin angefangen, hatte genäht, gestopft und gebügelt. Danach war sie Marianne Doubledays Garderobiere geworden, hatte mit ihr geplaudert, von ihr gelernt und sehr viel erfahren. Madeleine hatte eine rasche Auffassungsgabe und war wissbegierig. Nachdem festgestellt worden war, dass sie lesen konnte, hatte man sie zur Souffleuse ernannt, denn wer hätte, wenn jemand aus dem Ensemble krank war, dessen Text besser gekannt als sie? Und so war aus ihr die Schauspielerin Madeleine Charron geworden.
Sie fragte sich, ob ihr das genügte, ob ihr Traum erfüllt worden sei oder ob sie noch immer den brennenden Wunsch habe, eine vornehme Dame zu sein, und zwar im normalen Leben, nicht auf der Bühne. Sie überlegte, ob sie diese Rolle spielen könne oder ob sie, wie Marianne gesagt hatte, nach den Sternen griffe. Sie lächelte die Freundin an. „Du meinst also, ich sollte nicht mit meinem unbekannten Verehrer ausgehen?“
Marianne zuckte mit den Schultern. „Das bleibt dir überlassen. Du musst dich zu nichts verpflichten. Die Einladung erstreckt sich nur auf das Abendessen, auf sonst nichts.“
„Und ich versichere dir, dass ich dem Gentleman auch nichts erlauben werde.“
Madeleine hatte mit zahllosen jungen Herren diniert und deren Gesellschaft genossen, sich indes jedes Mal, ehe sie mit einem von ihnen ausgegangen war, gefragt, ob er derjenige sei, der ihren Traum wahr machen würde. Ehe der Abend jedoch vorüber gewesen war, hatte sie gewusst, dass ihr Kavalier nicht der Mann war, den sie suchte.
Dafür gab es viele Gründe. Keiner der Schmeichler hatte einen Titel getragen, der ihr genehm gewesen wäre. Entweder war der Bewunderer ihr zu jung oder zu alt gewesen. Oder er war hässlich, sodass sie unansehnliche Kinder von ihm bekommen hätte. Mal hatte er übertrieben Konversation gemacht, mal war er ihr nicht anregend genug gewesen. Einige der Verehrer waren Trottel, andere hatten bei ihr den Eindruck hinterlassen, ihr einen Gefallen zu tun, wenn sie sie zum Essen einluden. Manche waren verheiratet gewesen und hatten mehr von ihr erwartet, als sie zu geben bereit war. Sie wollte nicht die Mätresse irgendeines Mannes sein.
„Pass aber auf, dass man dich nicht für unnahbar hält.“
„Sei unbesorgt, meine liebe Marianne. Du hast mich gut unterwiesen.“
Am Montagabend gab Madeleine sich mit ihrem Aussehen die größte Mühe und verbrachte mehr Zeit als sonst damit, vor dem Spiegel zu sitzen, sich abzuschminken und ihr dunkelbraunes Haar zu bürsten, ehe sie es zu einer Titusfrisur aufsteckte. Dann machte sie sich daran, eine Abendrobe auszuwählen. Sie war stolz auf ihren guten Geschmack. Da sie Schneiderin war, noch dazu eine sehr gute, hatte sie zwar wenige, aber elegante Abendtoiletten, die aus den besten Stoffen gemacht waren, die sie sich leisten konnte. Es vermittelte ihr ein gutes Gefühl zu wissen, dass sie sich mit den Damen, die glaubten, gesellschaftlich über ihr zu stehen, äußerlich messen konnte.
Sie zog ein tief dekolletiertes blaues Seidenkleid an, verzichtete auf ihren Schmuck, da der größte Teil davon nur aus Imitaten bestand, und befestigte lediglich die Girandole. Dann legte sie sich den dunkelblauen Samtumhang um und begab sich auf die Straße.
Bis auf den Nachtwächter war das Theater menschenleer, und sie rechnete beinahe damit, niemanden mehr vorzufinden, als sie auf die Straße trat. Es wäre ihre Schuld gewesen, wenn sie ihren Verehrer nicht mehr angetroffen hätte, da sie ihn hatte warten lassen. Sie hätte sich kaum darüber ärgern können, wenn er heimgefahren wäre. Aber die Kutsche stand noch da. Vom Insassen war nichts zu sehen. Vielleicht hatte er einfach nur die Chaise hergeschickt, um Madeleine dort hinbringen zu lassen, wo er sich aufhielt. Sie war unschlüssig, ob diese Möglichkeit ihr genehm sein würde.
Plötzlich streckte jemand eine Hand, in der er das baumelnde Gegenstück zum Ohrring hielt, durch die offene Wagentür, und Madeleine hörte einen Mann leise lachen. „Wenn Sie herkommen, meine Liebe, befestige ich die Girandole an Ihrem Ohr. Schön, wie Sie sind, machen Sie im Moment jedoch einen etwas unausgeglichenen Eindruck.“
„Haben Sie Angst, Sir, Ihr Gesicht zu zeigen?“, fragte Madeleine.
„Überhaupt nicht.“ Der Wagenschlag wurde weiter aufgedrückt. Ein Mann in eleganter Abendgarderobe sprang auf die Straße und kam auf sie zu. Er war jung, aber kein Jüngling mehr. Sie schätzte ihn auf ungefähr fünfundzwanzig Jahre. Sein Krawattentuch wurde von einer Diamantnadel gehalten. Als er den Zylinder abnahm und sich verneigte, sah Madeleine, dass er dunkles Haar hatte. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, bemerkte sie einen amüsierten Ausdruck in seinen braunen Augen. Er hatte eine wohlgeformte Nase und einen gut geschnittenen Mund. Er lächelte. „Hier bin ich. Ihr Sklave, Madam, bereit, Ihre Wünsche zu erfüllen.“
„Und wie soll ich Sie anreden?“
„Stanmore, Miss Charron. Duncan Stanmore. Zu Ihren Diensten, Madam.“
Der Name war ihr vertraut, wenngleich sie trotz angestrengten Überlegens nicht herausfinden konnte, wann und wo sie ihn gehört hatte. Höflich neigte sie den Kopf. „Guten Abend, Mr Stanmore.“
„Ich würde gern im Hotel Reid mit Ihnen soupieren“, erwiderte er. „Ist Ihnen das recht?“
„Ich nehme an, dass ich, wenn ich einverstanden bin, zur Belohnung die andere Girandole bekomme, nicht wahr?“
„Oh, sie gehört Ihnen, ob Sie nun mitkommen oder nicht“, sagte Duncan leichthin. „Es wäre nicht richtig, Sie damit ködern zu wollen. Das ist nicht mein Stil.“ Er verneigte sich erneut. „Es wäre mir jedoch eine Ehre, wenn Sie mit mir dinieren würden.“
„Gut, ich willige ein.“
Er lachte erfreut auf und wirkte plötzlich viel jungenhafter, ohne dadurch im Mindesten an Format zu verlieren. Auf dem Weg zur Kutsche bemerkte Madeleine, dass der Wagenschlag mit einem Wappen verziert war. Marianne hatte also recht. Der Mann war kein gewöhnlicher Sterblicher.
Er half Madeleine in die Berline und vergewisserte sich, dass sie es bequem hatte. Dann wies er den Kutscher an, zum Hotel Reid zu fahren, und stieg ein.
Das Hotel war seiner Küche wegen berühmt und ein bei Theaterleuten und Theaterbesuchern gleichermaßen beliebter Treffpunkt. Daher war es gut besucht. Sobald der Maître d’Hotel den Gentleman an Madeleines Seite erblickt hatte, näherte er sich eifrig. „Guten Abend, Mylord. Ihr Tisch ist reserviert.“
Duncan lächelte. „Vielen Dank, Mr Bundy. Ich wusste, ich kann mich auf Sie verlassen.“