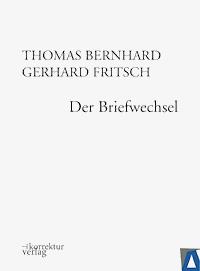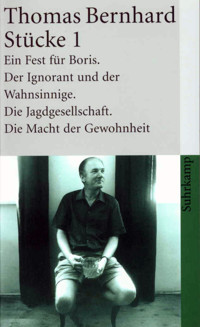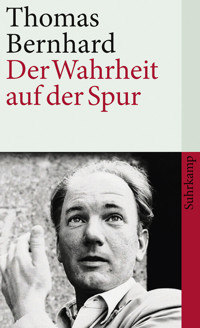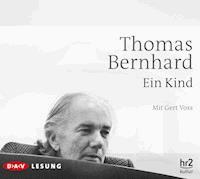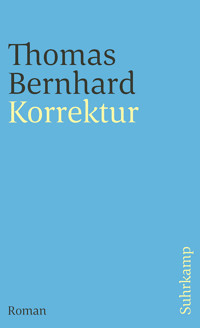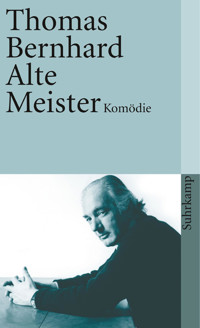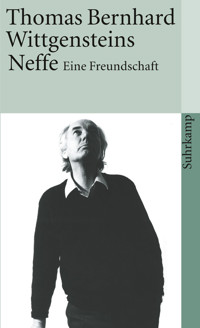
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit seiner 1982 vorgelegten Arbeit über die Geschichte einer Freundschaft führt Bernhard seine Autobiographie, die Beschreibung seiner Kindheit und Jugend in fünf Bänden, weiter in die Jahre 1967 bis 1979. Bei einem Sanatoriumsaufenthalt vertiefte sich seine Freundschaft mit Paul Wittgenstein, die in leidenschaftlichen Diskussionen über Musik begonnen hatte. Paul Wittgenstein, der Neffe Ludwig Wittgensteins, maturierte am Theresianeum in Wien und studierte danach Mathematik. Seit seinem 35. Lebensjahr brach seine Nervenkrankheit immer wieder durch. Anfänglich finanziell sehr gut gesichert durch die Reichtümer einer der reichsten Familien Österreichs, verschenkte er sein Vermögen unbekümmert an Freunde und Arme, bis er selber in Armut dahinvegetierte. In seinen letzten Lebensjahren vereinsamte er mehr und mehr, nur noch mit seinem Freund Thomas Bernhard verbunden. Bernhards Notizen sind zum Bericht der Sterbegeschichte des Paul Wittgenstein geworden. Zwölf Jahre hindurch hatte er das Sterben seines Freundes beobachtet. Und durch diese Beobachtung hat sich auch die Selbstbeobachtung Thomas Bernhards verschärft – so daß durch den Porträtierten auch das Bild des Porträtisten starke Konturen gewinnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Thomas Bernhard
Wittgensteins Neffe
Eine Freundschaft
Suhrkamp Verlag
Zweihundert Freunde werden bei meinem Begräbnis sein
und du mußt an meinem Grab eine Rede halten.
Neunzehnhundertsiebenundsechzig legte mir auf der Baumgartnerhöhe eine der im dortigen Pavillon Hermann unermüdlich tätigen geistlichen Schwestern meine gerade erschienene Verstörung, die ich ein Jahr vorher in Brüssel in der rue de la croix 60 geschrieben habe, auf das Bett, aber ich hatte nicht die Kraft, das Buch in die Hand zu nehmen, weil ich ein paar Minuten vorher erst aus einer mehrstündigen Narkose aufgewacht war, in die mich jene Ärzte versetzt hatten, die mir den Hals aufschnitten, um aus meinem Brustkorb einen faustgroßen Tumor herausoperieren zu können. Ich erinnere mich, es war der Sechstagekrieg und als Folge meiner radikal an mir vorgenommenen Cortisonbehandlung entwickelte sich mein Mondgesicht, wie von den Ärzten gewünscht; während der Visite kommentierten sie dieses Mondgesicht auf ihre witzige Art, die selbst mich, der ich, nach ihrer eigenen Aussage, nur noch Wochen, im besten Fall Monate zu leben hatte, zum Lachen brachte. Im Pavillon Hermann gab es ebenerdig nur sieben Zimmer, an die dreizehn oder vierzehn Patienten erwarteten in ihnen nichts anderes als den Tod. Sie schlürften in hauseigenen Schlafröcken auf dem Gang hin und her und verschwanden eines Tages auf immer. Jede Woche einmal tauchte der berühmte Professor Salzer, die größte Kapazität auf dem Sektor der Lungenchirurgie im Pavillon Hermann auf, immer in weißen Handschuhen und mit einem ungeheuer respekteinflößenden Gang, beinahe lautlos umschwirrt von den geistlichen Schwestern, die ihn, der sehr groß und sehr elegant war, in den Operationssaal geleiteten. Dieser berühmte Professor Salzer, von welchem sich die Klassepatienten operieren ließen, weil sie alles auf seine Berühmtheit setzten (ich selbst hatte mich vom Oberarzt der Station operieren lassen, einem untersetzten Bauernsohn aus dem Waldviertel), war ein Onkel meines Freundes Paul, eines Neffen des Philosophen, dessen Tractatus logico-philosophicus heute die ganze wissenschaftliche, mehr noch die ganze pseudowissenschaftliche Welt kennt und gerade als ich auf dem Pavillon Hermann lag, lag mein Freund Paul auf dem Pavillon Ludwig an die zweihundert Meter weiter, welcher aber nicht, wie der Pavillon Hermann, zur Lungenabteilung und also zur sogenannten Baumgartnerhöhe gehörte, sondern zur Irrenanstalt Am Steinhof. Auf dem Wilhelminenberg mit seiner ungeheueren Ausdehnung im Westen von Wien, der seit Jahrzehnten in zwei Teile geteilt ist, eben in den für die Lungenkranken, der kurz als Baumgartnerhöhe bezeichnet wird und der mein Areal war und in den für die Geisteskranken, den die Welt als Am Steinhof kennt, der kleinere als Die Baumgartnerhöhe, der größere als Am Steinhof, haben die Pavillons männliche Vornamen. Es war schon ein grotesker Gedanke, meinen Freund Paul ausgerechnet im Pavillon Ludwig zu wissen. Wenn ich den Professor Salzer sah, wie er, ohne einen Seitenblick, auf den Operationssaal zustrebte, dachte ich jedesmal daran, daß mein Freund Paul seinen Onkel immer wieder abwechselnd ein Genie oder einen Mörder genannt hat und ich dachte beim Anblick des Professors, ging er nun in den Operationssaal hinein, oder kam er aus diesem heraus, geht nun ein Genie hinein oder ein Mörder, kommt ein Mörder heraus oder ein Genie. Von dieser medizinischen Berühmtheit ging für mich eine große Faszination aus. Ich hatte ja bis zu meinem Aufenthalt im Pavillon Hermann, der auch heute noch ausschließlich der Lungenchirurgie vorbehalten und vor allem auf die sogenannte Lungenkrebschirurgie spezialisiert ist, schon viele Ärzte gesehen und alle diese Ärzte auch, weil es mir schließlich zur Gewohnheit geworden war, studiert, aber der Professor Salzer hatte schon gleich vom ersten Augenblick an, in welchem ich ihn gesehen habe, alle diese Ärzte in den Schatten gestellt. Seine Großartigkeit in jeder Beziehung war für mich absolut undurchschaubar gewesen, er bestand für mich nur aus dem, den ich, wenn ich ihn beobachtete, gleichzeitig bewunderte und aus Gerüchten. Der Professor Salzer soll, so auch mein Freund Paul, viele Jahre ein Wunderwirker gewesen sein, Patienten ohne die geringste Chance sollen die Salzersche Operation um Jahrzehnte überlebt haben, andere wieder sollen ihm, wie mein Freund Paul immer wieder behauptete, infolge eines plötzlichen unvorhergesehenen Wetterumschwungs unter dem nervös gewordenen Messer gestorben sein. Wie auch immer. Der Professor Salzer, der tatsächlich eine Weltberühmtheit gewesen war und dazu auch noch ein Onkel meines Freundes Paul, hatte mich gerade deshalb nicht operieren dürfen, weil von ihm für mich eine solche ungeheuere Faszination ausgegangen ist und auch, weil seine absolute Weltberühmtheit mir nichts als einen heillosen Schrecken eingejagt hatte, in welchem ich mich letztenendes auch durch das, was ich von meinem Freund Paul über seinen Onkel Salzer gehört hatte, für den biederen Oberarzt aus dem Waldviertel und gegen die Kapazität aus dem Ersten Bezirk entschieden hatte. Auch hatte ich während der ersten Wochen meines Aufenthaltes im Pavillon Hermann immer wieder beobachtet, daß genau jene Patienten die Operation nicht überlebt haben, die der Professor Salzer operiert hatte, eine Unglücksperiode der Weltberühmtheit vielleicht, in welcher ich aufeinmal naturgemäß vor ihm Angst gehabt und mich für den Waldviertler Oberarzt entschieden habe, was, wie ich heute sehe, sicher ein Glück gewesen ist. Solche Spekulationen aber sind zwecklos. Während ich selbst den Professor Salzer jede Woche mindestens einmal, wenn auch zuerst nur durch den Türspalt gesehen habe, hat ihn mein Freund Paul, dessen Onkel der Professor Salzer schließlich gewesen war, die vielen Monate, die er auf dem Pavillon Ludwig gewesen war, nicht ein einziges Mal gesehen, obwohl, wie ich weiß, der Professor Salzer wußte, daß sein Neffe im Pavillon Ludwig untergebracht war und es wäre, so dachte ich damals, für den Professor Salzer sicher ein Leichtes gewesen, die paar Schritte vom Pavillon Hermann zum Pavillon Ludwig hinüber zu gehen. Die Gründe, die den Professor Salzer abgehalten haben, seinen Neffen Paul aufzusuchen, sind mir nicht bekannt, vielleicht waren es gravierende, vielleicht war es aber auch nur der Grund der Bequemlichkeit gewesen, der ihn an einem Besuch bei seinem Neffen hinderte, der, während ich zum ersten Mal auf dem Pavillon Hermann gelegen bin, schon oft im Pavillon Ludwig untergebracht war. Jährlich mindestens zweimal in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens hatte mein Freund, immer von einem Augenblick auf den anderen und jedes Mal unter den fürchterlichsten Umständen in die Irrenanstalt Am Steinhof gebracht werden müssen, mit den Jahren in immer kürzeren Abständen immer wieder auch in das sogenannte Wagner-Jauregg-Krankenhaus bei Linz dann, wenn er in Oberösterreich, in der Nähe des Traunsees, wo er geboren und aufgewachsen war und wo er bis zu seinem Tod in einem alten, immer schon der Familie Wittgenstein gehörenden Bauernhaus ein Wohnrecht besessen hat, von einem Anfall überrascht worden war. Seine Geisteskrankheit, die nur als eine sogenannte Geisteskrankheit bezeichnet werden darf, war schon sehr früh aufgetreten, etwa, als er fünfunddreißig gewesen war. Er selbst hat darüber nur spärlich berichtet, aber es ist nicht schwer, sich aus allem, das ich von meinem Freund weiß, einen Begriff auch von der Entstehung dieser seiner sogenannten Geisteskrankheit zu machen. Schon in dem Kind Paul war diese sogenannte Geisteskrankheit, die niemals genau klassifiziert worden ist, angelegt gewesen. Schon das Neugeborene war als ein geisteskrankes geboren worden, mit jener sogenannten Geisteskrankheit, die den Paul dann lebenslänglich beherrscht hat. Mit dieser seiner sogenannten Geisteskrankheit lebte er bis zu seinem Tod dann auf das selbstverständlichste so, wie
die andern ohne eine solche Geisteskrankheit leben. An dieser seiner sogenannten Geisteskrankheit hat sich die Hilflosigkeit der Ärzte und der medizinischen Wissenschaften insgesamt auf das deprimierendste bewiesen. Diese medizinische Hilflosigkeit der Ärzte und ihrer Wissenschaft hat dieser sogenannten Geisteskrankheit des Paul immer wieder die aufregendsten Bezeichnungen gegeben, aber naturgemäß niemals die richtige, weil sie dazu nicht befähigt war in ihrer Kopflosigkeit und alle ihre Bezeichnungen, diese sogenannte Geisteskrankheit meines Freundes betreffend, hatten sich immer wieder als falsch und als geradezu absurd herausgestellt und eine hat die andere immer wieder auf die beschämendste, gleichzeitig deprimierendste Weise aufgehoben. Die sogenannten psychiatrischen Ärzte bezeichneten die Krankheit meines Freundes einmal als diese, einmal als jene, ohne den Mut gehabt zu haben, zuzugeben, daß es für diese wie für alle anderen Krankheiten auch, keine richtige Bezeichnung gibt, sondern immer nur falsche, immer nur irreführende, weil sie es sich letztenendes, wie alle anderen Ärzte auch, wenigstens durch immer wieder falsche Krankheitsbezeichnungen leichter und schließlich auf mörderische Weise bequem gemacht haben. Alle Augenblicke sagten sie das Wort manisch, alle Augenblicke das Wort depressiv und es war in jedem Fall immer falsch. Alle Augenblicke flüchteten sie (wie alle anderen Ärzte!) in ein anderes Wissenschaftswort, um sich (nicht aber den Patienten!) zu schützen und abzusichern. Wie alle anderen Ärzte verschanzten auch die den Paul behandelnden sich hinter der lateinischen Sprache, die sie zwischen sich und ihrem Patienten als einen unüberwindlichen und undurchdringlichen Wall aufrichteten mit der Zeit wie ihre Vorgänger seit Jahrhunderten nur zu dem alleinigen Zweck der Vertuschung ihrer Inkompetenz und der Vernebelung ihres Scharlatanismus. Als eine tatsächlich unsichtbare, aber doch wie keine andere undurchdringliche Mauer schieben sie das Lateinische zwischen sich und ihre Opfer schon gleich zu Beginn ihrer Behandlung, deren Methoden in jedem Fall nur die unmenschlichen und die mörderischen und die tödlichen sein können, wie wir wissen. Der psychiatrische Arzt ist der inkompetenteste und immer dem Lustmörder näher als seiner Wissenschaft. Mein ganzes Leben habe ich vor nichts mehr Angst gehabt, als in die Hände von psychiatrischen Ärzten zu fallen, gegen die alle anderen, ja letztenendes auch immer nur unheilbringenden Ärzte, doch viel weniger gefährlich sind, denn die psychiatrischen sind in unserer heutigen Gesellschaft noch vollkommen unter sich und immunisiert und nachdem ich ihre an meinem Freund Paul so viele Jahre skrupellos praktizierten Methoden habe studieren können, fürchtete ich mich vor ihnen mit einer noch viel intensiveren Furcht. Die psychiatrischen Ärzte sind die tatsächlichen Teufel unserer Zeit. Sie betreiben ihr abgeschirmtes Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes auf die unverschämteste Weise unangreifbar, gesetz- und gewissenlos. Als es mir schon möglich gewesen war, aufzustehen und ans Fenster zu gehen und schließlich sogar auf den Gang und mit allen übrigen gehfähigen Todeskandidaten vom einen Ende des Pavillons zum andern und wieder zurück, und ich schließlich eines Tages sogar aus dem Pavillon Hermann hinausgetreten war, versuchte ich, bis zum Pavillon Ludwig zu kommen. Ich hatte meine Kräfte aber gehörig überschätzt und mußte schon vor dem Pavillon Ernst Halt machen. Ich mußte mich auf die dort an die Mauer geschraubte Bank setzen und mich zuerst einmal wieder beruhigen, um überhaupt selbständig wieder zum Pavillon Hermann zurückgehen zu können. Liegen die Patienten wochenlang oder gar monatelang im Bett, so überschätzen sie absolut ihre Kräfte, wenn sie wieder aufstehen können, sie nehmen sich ganz einfach zu viel vor und werden unter Umständen durch eine solche Dummheit wieder um Wochen zurückgeworfen, viele haben sich bei einem solchen urplötzlichen Unternehmen schon den Tod, dem sie zuerst durch eine Operation entgangen sind, erst recht geholt. Obwohl ich ein routinierter Kranker bin und mein ganzes Leben mit meinen mehr oder weniger schweren und schwersten, letztenendes immer sogenannten unheilbaren Krankheiten zu leben gehabt habe, bin ich doch immer wieder in einen Krankheitsdilettantismus zurückgefallen, habe Dummheiten gemacht, unverzeihliche. Zuerst ein paar Schritte, vier oder fünf, dann zehn oder elf, dann dreizehn oder vierzehn, schließlich zwanzig oder dreißig, so solle der Kranke handeln, nicht gleich aufstehen und hinaus und fort, was ja meistens tödlich ist. Aber der monatelang eingesperrte Kranke drängt in diesen Monaten hinaus und kann den Augenblick, da er das Krankenzimmer verlassen darf, nicht mehr erwarten und gibt sich naturgemäß nicht mit ein paar Schritten auf den Gang zufrieden, nein, er tritt ins Freie und bringt sich selbst um. So viele sterben, weil sie zu früh hinausgegangen sind, nicht weil die ärztliche Kunst versagt hat. Man kann den Ärzten alles vorwerfen, aber im Grunde wollen sie natürlich nichts anderes, als den Zustand ihrer Patienten verbessern, sind sie noch so indolent, ja gewissenlos und gar stumpfsinnig, aber der Patient muß das Seinige dazutun, er darf die Bemühungen der Ärzte nicht untergraben, indem er zu früh aufsteht (oder zu spät!) oder zu früh hinausgeht und zu weit. Ich war damals absolut zu weit gegangen, der Pavillon Ernst war ja schon zu weit gewesen. Ich hätte schon vor dem Pavillon Franz umkehren sollen. Aber ich wollte ja unbedingt meinen Freund sehen. Erschöpft, vollkommen außer Atem, saß ich auf der Bank vor dem Pavillon Ernst und blickte durch die Baumstämme auf den Pavillon Ludwig. Wahrscheinlich hätte man mich, der ich ja lungenkrank, aber nicht geisteskrank bin, gar nicht in den Pavillon Ludwig hineingelassen, dachte ich. Den Lungenkranken war es strengstens verboten, ihr Areal zu verlassen und das der Geisteskranken aufzusuchen, umgekehrt auch. Es war zwar das eine von dem andern durch hohe Gitter abgetrennt, aber diese Gitter waren zum Teil so verrostet, daß sie nicht mehr dicht waren, überall waren große Löcher in den Gittern, durch die man leicht von dem einen Areal in das andere wenigstens kriechen konnte und ich erinnere mich, daß jeden Tag Geisteskranke im Areal der Lungenkranken gewesen sind, umgekehrt immer Lungenkranke im Areal der Geisteskranken, aber damals, als ich zum erstenmal versuchte, vom Pavillon Hermann aus zum Pavillon Ludwig zu kommen, wußte ich noch nichts von diesem alltäglichen Verkehr zwischen dem einen und dem andern Areal. Die Geisteskranken im sogenannten Lungenareal waren mir später eine tagtägliche Vertrautheit, am Abend mußten sie von den Wärtern eingefangen werden, in Zwangsjacken gesteckt, mußten sie mit Gummiknüppeln, wie ich mit eigenen Augen gesehen habe, aus dem Lungenareal in das der Geisteskranken zurückgetrieben werden, das ging nicht ohne erbärmliche Schreie ab, die mich bis in die nächtlichen Träume hinein verfolgten. Die Lungenkranken verließen ihr Areal in Richtung auf das der Geisteskranken ja doch nur aus Neugierde, weil sie sich jeden Tag etwas Sensationelles erhofften, das ihren fürchterlichen Alltag der tödlichen Langeweile und der immer gleichen Todesgedanken verkürzen sollte. Und tatsächlich täuschte ich mich nicht, ich kam auf meine Rechnung, wenn ich das Lungenareal verließ und zu den Geisteskranken ging, die überall, wo man ihrer ansichtig werden konnte, ihre Nummern abzogen. Möglicherweise getraue ich mich später in einer anderen Schrift noch eine Beschreibung jener Zustände in der Geisteskrankenabteilung zu machen, deren Zeuge ich gewesen bin. Jetzt saß ich auf der Bank vor dem Pavillon Ernst und dachte, daß ich eine ganze Woche werde warten müssen, um einen zweiten Versuch machen zu können, zum Pavillon Ludwig zu kommen, denn daß ich an diesem Tag nu
r noch umkehren konnte in den Pavillon Hermann, war klar. Ich beobachtete von der Bank aus die Eichhörnchen, die überall in dem riesigen, von hier aus endlos scheinenden Park umherhuschten auf die Bäume hinauf und von den Bäumen herunter und die vor allem anderen nur eine einzige Leidenschaft zu haben schienen: sie schnappten die überall auf dem Boden liegenden, von den lungenkranken Patienten weggeworfenen Papiertaschentücher und rasten mit ihnen auf die Bäume. Überall liefen sie mit den Papiertaschentüchern im Maul, aus jeder in jede Richtung, bis man in der Dämmerung nurmehr noch die hin- und herhuschenden weißen Punkte der Papiertaschentücher sehen konnte, die sie im Maul hatten. Ich saß da und genoß diesen Anblick, an den ich naturgemäß meine aus dieser Beobachtung wie von selbst entstandenen Gedanken knüpfte. Es war Juni und die Fenster des Pavillons waren offen und in einem tatsächlich kontrapunktisch genial entworfenen und schließlich auch komponierten Rhythmus husteten die Patienten aus diesen Fenstern in den beginnenden Abend hinaus. Ich wollte die Geduld der Schwestern nicht auf die Spitze treiben und stand auf und ging zum Pavillon Hermann zurück. Nach der Operation, dachte ich, kann ich tatsächlich wieder besser, ja tatsächlich sehr gut atmen, das Herz ist frei, aber ich hatte doch keine guten Aussichten, das Wort Cortison und die an dieses Wort gekettete Therapie verdüsterten mein Denken. Aber ich war nicht unbedingt den ganzen Tag hoffnungslos. Ich wachte hoffnungslos auf und versuchte, dieser Hoffnungslosigkeit zu entkommen und ich entkam ihr auch bis gegen Mittag. Am Nachmittag stellte sich die Hoffnungslosigkeit wieder ein, gegen Abend verschwand sie wieder, in der Nacht, wenn ich aufwachte, war sie naturgemäß mit der größten Rücksichtslosigkeit wieder da. Da die Ärzte die Patienten, die ich schon sterben gesehen hatte, genauso behandelten wie mich und mit ihnen die gleichen Wörter gewechselt und also die gleichen Reden geführt hatten, auch die gleichen Scherze gemacht, dachte ich, mein Weg wird mehr oder weniger kein anderer sein als der Weg jener schon Weggestorbenen. Sie starben auf dem Pavillon Hermann unauffällig, ohne Geschrei, ohne Hilferufe, völlig lautlos meistens. In der Frühe stand ihr leeres Bett auf dem Gang, das frisch überzogen wurde für den nächsten. Die Schwestern lächelten, wenn wir an ihnen vorbeigingen, unser Wissen störte sie nicht. Manchmal dachte ich, warum will ich den Gang, den ich zu gehen habe, aufhalten, warum füge ich mich nicht genauso in diesen Gang, wie alle andern? Wozu die Anstrengung beim Aufwachen, nicht sterben zu wollen, wozu? Natürlich frage ich mich auch heute noch oft, ob es nicht besser gewesen wäre, nachzugeben, denn dann wäre ich sicher innerhalb der kürzesten Zeit meinen Gang gegangen, ich wäre innerhalb weniger Wochen gestorben, da bin ich ganz sicher. Aber ich starb nicht und lebte und lebe noch heute. Daß mein Freund Paul zur gleichen Zeit auf dem Pavillon Ludwig gewesen war wie ich auf dem Pavillon Hermann, wobei er ja die erste Zeit, die ich auf dem Pavillon Hermann gewesen war, nicht gewußt hatte, daß ich jetzt auf dem Pavillon Hermann lag, was ihm dann aber doch eines Tages die Geschwätzigkeit unserer gemeinsamen Freundin Irina, die abwechselnd uns beide besuchte, verraten hatte, betrachtete ich als ein gutes Omen. Ich wußte, daß mein Freund immer mehrere Wochen oder Monate in Steinhof war schon seit vielen Jahren, und daß er jedesmal wieder hinausgekommen ist und so dachte ich, werde auch ich wieder hinauskommen, wenn auch er mit mir überhaupt nicht zu vergleichen war, in keiner Hinsicht, aber ich bildete mir ein, ich bliebe ein paar Wochen oder Monate da und käme wieder hinaus, wie er. Und schließlich war dieser Gedanke nicht falsch gewesen. Nach vier Monaten hatte ich schließlich die Baumgartnerhöhe wieder verlassen können, ich war nicht gestorben, wie die andern, er war längst draußen. Auf dem Weg vom Pavillon Ernst zum Pavillon Hermann machte ich mir aber doch noch immer ganz entschiedene Todesgedanken. Ich glaubte nicht, den Pavillon Hermann lebend verlassen zu können, dazu hatte ich zuviel im Pavillon Hermann gesehen und gehört und ich selbst fühlte in mir alles, nur keinen Hoffnungsschimmer. Die Dämmerung machte es nicht leichter wie man glaubt, sondern schwer und beinahe unerträglich. Ich ließ mich, nachdem mich die diensthabende Schwester zur Rede gestellt und über mein verantwortungsloses Verhalten, ja mein ganz dummes Verbrechen aufgeklärt hatte, ins Bett fallen