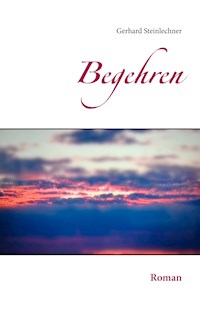Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Geh' hin, wo der Pfeffer wächst!", war die freundliche Form der im Alltag häufiger gebrauchten Aufforderungen "Schleich dich!" und "Verschwind'!". Dort, wo Rudi Huber aufwuchs, hatte er keinen Platz, um sein Leben zu finden. Ein Zufall führt ihn auf eine Insel, die ihm der Ort wird, an dem er sein Dasein formen kann. Ein junger Mann ermächtigt sich, seine Existenz zu gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Warten auf Laura
Woher
Rudis Tagebuch
Wachstumsschmerzen
Das dreizehnte Schuljahr
Wohin
Ein langer Sommer
Das schwedische Tagebuch
"Italie."
Rückkehr auf die Insel
Wie ein normales Leben
Sechs Jahreszeiten und mehr
Casa Fausta e Rolfo
Epilog
Laura in der Welt
Prolog
Warten auf Laura
Bis das Signalhorn des Fährschiffes ertönen wird, das seine Ankunft ankündigt, sobald es um das südliche Kap der Insel biegt, um sein Anlegen an der Mole von Scari einzuleiten, kann ich mich noch auf die Terrasse von Faustas Haus setzen. Es bleibt genügend Zeit, wenn ich mich bei diesem Ton mit dem Fahrrad auf den Weg mache, hinunter zum sogenannten Hafen, um rechtzeitig ihre Tochter abzuholen.
Traurig betrachte ich den alten Zitronenbaum, der seine letzten Früchte trägt. Zitronenbäume können sehr alt werden und sterben, wenn sie das auf natürliche Weise tun, an ihrer Überfülle. Sobald ihr Lebenszyklus an sein Ende kommt, tragen diese Pflanzen eine Unmenge Früchte. Dieser Baum, der mir, während der vielen Jahre meines Aufenthaltes, seine Früchte schenkte, blühte zuletzt in gewaltigen Trauben und erfüllte die Luft, weit die Straße hinauf, mit einer schier unerträglichen Süße. Die Früchte, die zuvor über das ganze Jahr verteilt reiften, kamen diesmal alle auf einmal. Viele Äste drohen unter ihrem Gewicht zu brechen. Diese unermessliche Üppigkeit des Todes gleicht dem Prunk sizilianischer Beerdigungen.
Bereits gestern montierte ich den Anhänger an das, inzwischen vom Salz der Meeresluft leicht angerostete Fahrrad. Laura wird viel Gepäck mitbringen. Zwei Tage zuvor kündigte sie mir ihre Ankunft an und die Absicht, "für immer" bei mir bleiben zu wollen. Bis zu diesem Anruf wusste ich von ihrem Plan, im Herbst dieses Jahres mit ihrem Freund Marco in London ein Studium an der LSE zu beginnen. Diese Absicht zerschlug sich wohl, wenn sie ihn nun "nie wieder" treffen will, wie sie schluchzend mitteilte. Worin im Detail die Ursache für diese Entscheidung lag, wurde mir bei diesem Gespräch, das von vielen Tränen begleitet und manchem Schluchzen unterbrochen wurde, nicht klar. Ich werde den Grund erfahren, sobald sie angekommen ist. Vermutlich im Zusammenhang mit dieser Dramatik hatte sie auch Streit mit ihrer Mutter, was Laura den weiteren Aufenthalt in Rom unmöglich machte, wie sie mir erbost mitteilte. Spätestens in vier Wochen wird sich herausstellen, wie bedeutsam der Streit mit Fausta tatsächlich ist und was Lauras Aufenthalt "für immer" bedeutet. Dann wird auch ihre Mutter auf die Insel kommen. Das kann ein turbulenter Sommer werden.
Nachdem Laura ihren Besuch angekündigt hatte, begann ich mit der Übersiedlung meiner Habseligkeiten in mein eigenes Haus, das wenige Schritte den leicht ansteigenden Hang hinauf liegt. Lauras Besuch ist in diesem Jahr der erste eines der Mitglieder der Familie. Ostern lag im Kalender sehr früh und die Vorbereitungen auf die Prüfungen für Lauras Schulabschluss banden sie und ihre Mutter in Rom. Seit vielen Jahren wohne ich in ihrem Haus, auch wenn Fausta nicht anwesend ist. Das Haus Onetti hat gegenüber meinem eigenen mehrere Vorteile, weshalb ich auch ohne sie gerne hier wohne. Es ist größer und hat ein zusätzliches Stockwerk, von dem sich ein freier Blick auf das Meer und den Strombolicchio eröffnet. Bei ihm handelt es sich um einen erkalteten Schlot des Vulkans, aus dessen Kegel die ganze Insel besteht. Er ragt einige hundert Meter vor der Küste fünfzig Meter senkrecht aus dem Meer und setzt sich, an die zweitausend Meter tief, ebenso steil unter der Wasseroberfläche fort. An seiner Spitze wurde ein Leuchtturm errichtet, der in der Dämmerung regelmäßig seine nächtliche Arbeit aufnimmt und, so sein Lichtstrahl nicht durch die Holzlamellen der Fensterbalken daran gehindert wird, die Zimmer des oberen Stockwerkes durchstreift.
Dieses Haus hat, im Vergleich mit meinem, die bessere technische Ausstattung, verfügt über Waschmaschine, elektrischen Herd und eine erheblich größere Terrasse, von der man durch die Zitronenbäume auf das Meer sehen kann. Ich will Laura in ihrer Entscheidung nicht beeinflussen, wie sie ihre Wohnsituation gestalten möchte. Im vergangenen Sommer wohnten wir, mehrere Wochen lang, sogar zu viert im Haus, Laura, Marco, Fausta und ich. Dieses für mich ungewohnt quirlige Leben hatte unerwartete Reize. Nur während der Zeit, in der auch Freunde der Jungen hier wohnten, zogen Fausta und ich in mein Haus. Wieder einmal Mal bewährte sich die Entscheidung, die Mauer zwischen den beiden Grundstücken zu einem großen Teil stehen zu lassen. Ein breiter Durchgang blieb offen, der so angelegt ist, dass kein Sichtkontakt zwischen den Häusern besteht. Die verbliebene Mauer wurde von mir ausgebessert, ergänzt und wo nötig, auch erhöht, sodass man sich nahe ist und trotzdem ungestört sein kann. Gestern bezog ich wieder das Bett im eigenen Haus, dem ich nie den Charakter eines Wohnstudios genommen habe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich umgehend wieder zurückkehre, doch Laura soll selbstständig ihre Entscheidung treffen. Der Weg ist nur wenige Meter kurz.
Mir wird die Zeit lang und ich beschließe zur Anlegestelle zu fahren, ohne das Signal des Schiffes abzuwarten. Nach der Abfahrt aus dem Hafen von Milazzo hatte Laura mitgeteilt, dass ihre Anreise bis dahin zeitgerecht erfolgt war, der Flug von Rom nach Catania annähernd pünktlich ankam und der Transfer zur Fähre und die Abfahrt wie vorgesehen funktionierten. Es scheint keinen Grund für eine Verspätung zu geben.
Die abschüssige Straße ist derart eng, dass ich mit dem Fahrradanhänger nahezu die ganze Breite der Fahrbahn einnehme. Spätestens ab der Einmündung der Via Vittorio Emanuele III. in die Via Roma benötige ich viel Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit der Bremsen, denn ich muss das Tempo des Fahrzeugs auf die Geschwindigkeit von Fußgängern reduzieren, obwohl das Gefälle immer steiler wird. Bereits ein Passant, oder eine Person, die aus einem Hauseingang tritt, führt zu einer gefährlichen Situation. Aus dem Fehlen von Gegenverkehr schließe ich, dass die Fähre bisher nicht eintraf.
An der Mole sehe ich Gruppen von Einwohnern und Hotelangestellte im Gespräch, jedoch keine Mitarbeiter der Schifffahrtslinie, die für den ordnungsgemäßen Ablauf des Entladens und den problemlosen Zustieg zum Schiff sorgen sollen. Ungeordnet stehen ein paar Kleinfahrzeuge herum. Für übliche Transportfahrzeuge sind die meist schmalen Gassen nicht geeignet und nur die Ape, die dreirädrigen Kleintransporter, haben eben noch Platz für die Durchfahrt.
Die draußen fehlenden Arbeiter finde ich in einem der Container, die an der Anlagestelle aufgestellt sind. Dieser dient den Molenarbeitern, von Hafenarbeitern kann hier wohl nicht gesprochen werden, als Garderobe und Kantine. Die Türe ist geöffnet und die Anwesenden blicken auf den Bildschirm eines Fernsehgerätes, das zeigt, wie Muamar-al-Gaddafi, das Staatsoberhaupt Lybiens, die Treppen seines Staatsflugzeugs hinabschreitet. Gekleidet in eine einfache, braune Galabia wird er von großgewachsenen, schwerbewaffneten Frauen begleitet.
"Das sind die berühmten Amazonen-Sklavinnen des Diktators," klärt einer der Arbeiter die Anwesenden auf. "Die sind keine geeignete Begleitung für die abendliche Gruppenunterhaltung mit dem Ministerpräsidenten", setzt ein anderer fort. "Dafür sind sie zu kräftig, zu groß und zu alt. Heute gibt es kein Bunga-Bunga mit kleinen Mädchen."
Der Fernsehsprecher weist darauf hin, dass der Ministerpräsident heute seinen Gast nicht am Flughafen empfängt. Ein zweiter Kommentator merkt an, dass diese Zeremonien bei den bisherigen Besuchen ohnehin missglückt warenund peinlich gerieten, was wohl der entscheidende Grund für die Abwesenheit sei. Im Fernsehbild erscheint Berlusconi bei einem früheren Empfang, wie er den Rücken zum rechten Winkel gebeugt, seine berühmten weißen Zähne entblößt, den Mund auf den Handrücken seines Gastes drückt. "Vorsicht, der beißt", ruft einer der Zuseher im Container. Dieser Handkuss sei damals von der internationalen Presse als eines demokratisch gewählten Staatschefs gegenüber einem Diktator unwürdig bezeichnet worden, beendet der Kommentator seine Bemerkungen zu den Bildern.
Ein weitere missglückter Empfang fand im Vorjahr statt, setzt der Nachrichtensprecher fort. Das Bild zeigt Gaddafi, wie er in einer Uniform das Flugzeug verlässt, die mit Tressen und Troddeln behängt und zahlreichen Medaillen bestückt ist. An der Uniform ist deutlich erkennbar ein altes, in Rot gerahmtes Bild befestigt, auf dem ein alter Mann in Beduinenkleidung und mit schweren Ketten gefesselt, zu sehen ist. Es handelt sich um ein Bild von Omar-al-Mukhtar, dem von den Italienern hingerichtete Helden des lybischen Widerstandes gegen deren Besatzung. Eine provokante Inszenierung, bei der es Berlusconi erkennbar schwer fiel, diese, wie gewohnt, weg zu grinsen.
Ich frage einen der Angestellten der Schifffahrtslinie nach der Ursache der Verspätung der Fähre. Es sei ein Problem mit dem Antrieb aufgetreten, das derzeit in Lipari behoben werde. Das ist alles, was ich erfahre, ehe er sich wieder dem Fernseher zuwendet. Ich gehe zum Ausgang. Mich interessiert nicht, was hier berichtet wird. Für mich ist das alles abstoßend und ich will lieber draußen auf das Schiff warten. Im Hinausgehen höre ich noch, dass der "Rais aus Libyen" am Tag nach seiner Ankunft eine Privatvorlesung über den Islam halten würde, vor fünfhundert, vorzeigbaren Jungfrauen, die volljährig sein müssen, jedoch nicht älter als fünfundzwanzig Jahre sein durften. Privatvorlesung heißt in diesem Fall, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bemerkt der Kommentator.
Mein Bedarf an Politik, oder was auch immer die Welt dafür hält, ist für lange Zeit gedeckt. Ich verlasse den Container, wende mich in die der Mole entgegengesetzte Richtung und schlendere dorthin, wo früher, vor Errichtung der befestigten Anlegestelle, die Passagiere ausgeschifft wurden. Die Krümmung der Insel bringt mich aus Sichtbereich und Hörweite der Mole. Am Abhang des Vulkans stehen noch einzelne Häuser, dann ist die Besiedlung dieses Teils der Insel zu Ende. Die Landschaft geht in einen schroffen, erkalteten Lavastrom über, der jedoch im Gegensatz zum Abhang am entgegengesetzten Ende der Siedlung mit dichtem Gestrüpp bewachsen ist. Der schmale Strand aus kleinkörnigem Granulat, entstand durch pausenlose Arbeit des Meeres an der erstarrten Lava. Am Ende des Strandes, zum Abhang hin, liegen mehrere bunte Fischerboote kieloben, in deren Schatten ich mich setze. Eine Weile folgt mein Blick den Wellen, wie sie sanft am Strand auslaufen. Heute sind sie kein Anlass, das Anlegen des Schiffes zu behindern. Dies ist bei hohem Seegang auch heute noch wiederholt der Fall. Kürzlich geschah es wieder, dass ein Kapitän die herrschenden Kräfte der Natur unterschätzte, oder dem Drängen ausstiegswilliger Passagiere nachgab, und eines der Schnellboote, die inzwischen einen großen Teil des Personenverkehrs durchführen, schweren Schaden nahm. Passagiere und Besatzung mussten in einer aufwendigen Rettungsaktion mit der Hilfe eines Hubschraubers gerettet werden, ehe das Schiff sank.
Die Mole liegt vor den Wellen ungeschützt und ist im letzten Teil auf Schwimmern befestigt. Eine wetterfeste Anlegestelle, oder gar der Bau eines Hafens, war bisher an keiner Stelle möglich. Die Insel ist ein einziger Vulkankegel, der eintausend Meter aus dem Meer herausragt und unter Wasser weitere zweitausend Meter abfällt. Damit ist dieser Vulkan beinahe ebenso hoch wie der geschwisterliche Ätna, den man im Winter bei klarer Sicht, dank seiner Schneedecke am Horizont erkennen kann. Es gibt hier keine seichte Stelle, die weit genug ins Meer hinausragt, um festen Untergrund zu finden, um darauf etwas befestigen zu können. Diese unsicher anzufahrende Mole ist jedoch eine Verbesserung der bisherigen Möglichkeit anzulanden.
Damals, als ich die Insel kennenlernte, ankerte das Schiff, das die Passagiere brachte, rund hundert Meter vor Land. Die Mannschaft senkte ein Fallreep an die Wasseroberfläche und erwartete die Ruderboote der Fischer, welche die ausstiegswilligen Passagiere an Land brachten. Der Einstieg in die kleinen Fischerboote war eine wackelige Angelegenheit. Sie tanzten manchmal ungestüm auf den Wellen und es bedurfte der unterstützenden Hände sowohl vom schwankenden Boot aus als auch die des helfenden Matrosen am schmalen Fallreep. Es folgte eine ebenso schaukelnde Fahrt zum Land, um nach einem Ruck, als das Boot auf Grund lief, mit einem Sprung an sicheres Land zu gelangen.
Wieder denke ich an Laura. Sie wird Trost benötigen. Ihre Lebensplanung für die nächsten Jahre scheint gescheitert. Menschen in ihrem Alter erleben derartige Ereignisse existentiell und haben noch wenig Erfahrung mit der Tatsache, dass das Leben in einem Widerstreit von Wünschen und ihre Erfüllung ständig bedrohenden Daseinszwängen stattfindet. Glück ist nur in der Verdünnung durch Melancholie zu erhalten. Nicht Resignation, sondern Wehmut ist das bemessende Gefäß, das in Folge der Lebenserfahrung mit dem Glück einhergeht, um ein Zuviel zu verhindern. Die Melancholie bemisst dann die Intensität des Glücksgefühls, das eine Ausnahme im Leben darstellt. Die Existenz des Menschen ist eine Abfolge von Katastrophen und seine Aufgabe ist es, die Folgen zu gestalten und, wenn möglich, zu bewältigen. Zumeist gelingt es jedoch nur, sie ertragen zu lernen, es sei denn, man betrügt sich selbst und findet sich in der verlogenen Gesellschaft der Selbstgerechten wieder. Seit vielen Jahren ist es die Obsorge für die Häuser und den Garten, die Nähe zum Versorgen, Wachsen und Vergehen, die mich daran hindern mich selbst allzu wichtig zu nehmen.
Im Laufe der Zeit erlernte ich, das Meer zu riechen, das Jod in der Luft, wenn starker Westwind die Wellen auftürmt und diese Partikel als ihren Bestandteil über die Insel fegen. Diese Luft riecht anders, als die, die sich während des Sommers über die Insel legt, ehe es zu regnen beginnt. In diesem Fall habe ich den Eindruck, dass die Pflanzen in der Erwartung des lange ersehnten Wassers alle Poren öffnen, um es in Empfang zu nehmen. Sie reagieren auf eine Veränderung in der Zusammensetzung der Luft. Feuchtigkeit allein kann dies nicht auslösen. Auf der Insel herrscht oft hohe Luftfeuchtigkeit, auf die die Pflanzen nicht auf dieselbe Weise reagieren. Dieser Geruch ist nicht so würzig, wie nach dem Regen, wenn die Kräuter und Gräser auf die Fülle reagieren, und unterscheidet sich von dem, der entsteht, nachdem ich selbst für die Bewässerung sorgte.
Es ist ein Geruch von Erwartung. Seit ich gelernt habe, ihn zu verstehen, kann ich mich zuverlässig auf seine Botschaft verlassen, die Bewässerung der Pflanzen einstellen und die Abdeckungen über den Wassersammlern und dem kleinen Teich, den ich vor Jahren mit Hilfe einer Plane anlegte, abnehmen. Diesen Sonnenschutz fertige ich aus Spanischem Rohr, um die Verdunstung der Wasservorräte während der vielen Tage ohne Regen zu verringern. Mein Geruchssinn täuscht mich niemals, jedoch die Dauer, bis sich die ersten, dicken Regentropfen einstellen, kann ich nicht erriechen. Gelegentlich gieße ich die empfindlichen Tomaten und Kräuter noch einmal selbst.
Hoshi, der sich in vielen Fragen magischer Natur als kompetent erwies, überzeugte mich nicht zweifelsfrei mit seiner Antwort auf meine Frage nach dem Ursprung dieser Fähigkeit, wenn er meint, dass ich in der Gunst des Gottes Äolus stünde, der mir diese besondere Gabe zum Geschenk gemacht habe. Hoshi selbst, obwohl in der Nähe vieler Götter und Geister stehend, sei selbst nicht in der Lage, den bevorstehenden Regen zu riechen.
Äolus, der dem Archipel namengebende Gott, war einer der wenigen Götter, die Odysseus wohlgesonnen waren und dessen hilfreiches Geschenk, die in einem Sack gebändigten Winde, ihn und seine Gefährten beinahe nach Hause brachte. Die Gefährten vermuteten jedoch Gold darin und öffneten gierig den Sack, bereits in Sichtweite der Heimat. Die widrigen Winde fuhren wieder heraus und schickten Odysseus und seine Gefährten auf weitere Irrfahrt.
In meiner Erinnerung finde ich keinen Hinweis, dass diese Winde im Epos auch Gerüche trugen, wie sie es auf dieser Welt tun. Ganz abwegig ist Hoshis Gedanke nicht.
Hoshi wanderte vor vielen Jahren aus Japan ein und wohnt in einem Haus, das etwas entfernt von meinem Haus liegt, den Abhang des Vulkankegels hinauf. Seit vielen Jahren ist uns zur Gewohnheit geworden, dass ich ihn bei Neumond und klarer Sicht besuche. Dann sitzen wir bis zur Morgendämmerung am flachen Dach seines Hauses und beobachten die Galaxis, wie sie sich bewegt. Natürlich wissen wir, dass wir die Bewegung der Galaxien mit freiem Auge nicht erkennen können. Wir sehen, wie sich uns, durch die Drehung der Erde, eine Bewegung der Gestirne vermittelt. Bei diesen Beobachtungen erzählt Hoshi Geschichten der Sternbilder, die aus unterschiedlichen Kulturen stammen. Manchmal raucht er zu viel von seinem Zeug, das er mir nie anbot und das ich aus Unkenntnis der Zusammensetzung auch nicht angerührt hätte. Dann verstand ich seine Geschichten zum Morgen hin nicht mehr. In anderen Nächten ist die Ursache der Tee, den Hoshi zubereitet. Einmal trank ich eine Tasse davon und habe an die folgenden Stunden keine Erinnerung mehr. Seither nehme ich für diese Nächte mein eigenes Getränk mit. Alkohol ist auf dem Dach nicht erwünscht, denn diese Nacht ist für Hoshi eine Art heilige Zeit, oder auch das Dach ein sakraler Ort. So genau verstehe ich das nicht. "Alkohol hat einen schmutzigen Geist", sagt Hoshi, obwohl er bei längerem Schlechtwetter dem Schnaps, der aus Kaktusfrüchten gewonnen wird, gerne zuspricht.
Für mich ist der Gedanke an Homers Odyssee nicht zu weit hergeholt. Kurz vor meinem ersten langen Aufenthalt auf der Insel absolvierte ich die Matura. Auf der Liste der Bücher, die zu lesen uns in den Jahren davor aufgetragen wurde, stand dieser Text und im Unterschied zu manchen anderen Titeln, mit denen ich mich nur in Form von Inhaltsangaben beschäftigte, las ich dieses Werk zur Gänze. Die mir wohl wollende Lehrerin bemerkte diese Tatsache bei einer Prüfung und kündigte mir an, dass sie bei der mündlichen Reifeprüfung aus diesem Werk eine Frage stellen würde. Diese Dichtung Homers kommt mir in den Sinn, wenn ich über mögliche mythische Gründe für meinen Verbleib auf der Insel nachdenke. Nicht die Irrfahrt des griechischen Helden beschäftigt meine Gedanken, vielmehr sind es die Aufgaben die Odysseus bei seiner Heimkehr zu erfüllen hatte, um Frieden zu finden. Bei seinem Besuch in der Unterwelt hatte ihm der blinde Seher Teiresias geweissagt, dass er vor der Rache Poseidons, dessen Sohn Polyphem Odysseus geblendet hatte, nur Ruhe fände, wenn er nach seiner Rückkehr an einem ausgewählten Ort ein Opfer bringe. Dazu müsse er ein Ruder schultern und so weit in die Welt gehen, bis er zu Menschen komme, die nicht vom Meer wüssten, ihre Speisen ohne Salz zu sich nähmen und weder Schiffe noch Ruder kannten, das sie für eine Schaufel hielten.
Eine Weissagung für den Ort meines künftigen Zuhause hätte für mich anders gelautet:
"Finde einen Ort, von dessen Gipfel du nur Meer siehst, dessen Speisen mit dem Salz dieses Meeres gewürzt werden und an dem die schaufelförmigen, hölzernen Gegenstände zum Bewegen von Booten verwendet werden. Wenn du dort Schweiß und Samen opferst, wirst du die Feinde deiner Seele, Ausweglosigkeit und Verlassen-Sein, befrieden."
In meiner Erinnerung finde ich keine Situation, in der ich mich dazu entschied, zu bleiben. Es war dies das Ergebnis eines umgekehrten Prozesses. Ich bin so lange geblieben, da es keinen Grund gab, fortzugehen. Der Besitz eines Hauses war es nicht, der mich hier band. Das könnte ich mit großem Gewinn verkaufen. Sogar die Bewohner vergaßen, dass ich nicht von hier stamme, obwohl es anfangs so offensichtlich war. Nun gehöre ich zu hier.
Woher
Rudis Tagebuch
1. Woche
Diese Heft ist das Eigentum von Rudi Huber. Wer immer ohne meine Zustimmung in dieses Heft hineinschaut, muss damit aufhören. Sofort! Was hier drinnen steht, geht nur mich etwas an. Ich weiß nicht einmal, ob ich selbst darin lesen werde, aber das ist meine Sache. Ist das jetzt klar!
Unsere Deutsch-Professorin hat gesagt, dass wir uns in diesem Aufgabenheft darum bemühen sollen, in schöner Sprache zu schreiben, als würden wir dies für einen besonderen Menschen tun, obwohl kein fremder Mensch darin lesen soll. Wir wären auch für uns selbst besondere Menschen, weshalb wir uns anstrengen sollen. Sie sprach davon, dass es in unserem Alter zur persönlichen Reifung beitrage, wenn wir unsere Gedanken und Erlebnisse aufschreiben, sie sagte reflektieren. Zumindest einmal die Woche müssen wir unsere Gedanken in dieses Heft eintragen. Seltsam ist, dass sie sagte, dies sei eine Hausaufgabe und wird als solche gewertet, obwohl sie die nie lesen will. Wir sollen das für uns machen, weil wir dann als Menschen reifer werden, was immer das sein soll, ein reifer Mensch. Das Nächste, was sie sagte, war noch seltsamer: wir würden geläutert aus dem Reifungsprozess hervorgehen, den das Schreiben eines Tagebuches bewirke. Dann las sie uns ein paar Stellen aus solchen Tagebüchern vor. Wer sie geschrieben hat, weiß ich nicht mehr, weil ich mir zuerst die Mitschrift der Deutschstunde von einem der Streber ausborgen muss, damit ich nachschauen kann. Die schreiben immer alles mit, was die Prof sagt, aber die können Steno. Das kann ich nur lesen. Ich habe das nur gelernt, damit ich abschreiben kann, aber schreiben kann ich das nicht.
So, jetzt weiß ich nicht mehr, an welcher Stelle ich gewesen bin. Ha! Aufschreiben hat doch etwas Gutes. Jetzt kann ich nachsehen, wo ich mit meinen Gedanken war, als das mit dem Steno angefangen hat. Jetzt hab ich's wieder: wegen der Tagebücher. Diese Gedanken, die die Prof vorgelesen hat, gefielen mir gut, weil denen ist es genauso ergangen wie mir. Sie hatten bei der Vorstellung großes Unbehagen, eine andere Person liest ihre Eintragungen. Nur, als sie zwei Stellen von Frauen oder Mädchen vorlas, wollte ich nicht zuhören. Das war echt peinlich und die waren echt arg. Ein paar von uns haben zu murren begonnen. "Wir sind eine Bubenschule, uns muss man solche Mädchensachen nicht vorlesen", haben sie gesagt. Die Prof sagte, dass man sich beim Lesen von solchen Tagebüchern gut in andere Menschen einfühlen kann. Ich will mich in kein Mädchen einfühlen. Das ist ziemlich daneben. Außerdem sagte sie, dass kein anderer Mensch das Tagebuch lesen darf, außer man erlaubt es. Jetzt liest sie aber der ganzen Klasse aus solchen Tagebüchern vor. Bei mir ist das anders, wenn da irgendwer hineinschaut, dann bringe ich den um!
Nun wurden das doch ein paar Zeilen. Ich hatte die Absicht, nur einen Satz zu schreiben, um in der Schule nicht lügen zu müssen, wenn ich gefragt werde, ob ich etwas schrieb.
2. Woche
Heute sollen wir von unserer Familie erzählen, aber da gibt es bei mir nicht viel zu erzählen. Mein Vater ist bei einem Arbeitsunfall gestorben, als ich noch ein kleines Kind war. Er war sofort tot, erzählte man mir. Sein Name war Rudolf, wie meiner, aber Mammamarie hat ihn Rudi genannt. Die anderen haben nur "der Rote" zu ihm gesagt, und die meisten Menschen im Ort meinten das nicht freundlich. Mammamarie und ich sind bei denen "das Weib des Roten und ihr Balg". Uns das ins Gesicht zu sagen, dafür sind sie zu feige, aber deren Kinder heißen uns so und woher haben die das, als von ihren Eltern. Als die Mutter, die mich geboren hat, nicht mehr da war und mein Vater allein mit mir dastand, hat sich Mammamarie um uns gekümmert. Sie ist eine weitschichtige Cousine vom Papa. Mammamarie ist nicht meine echte Mutter. Die ist kurz nach meiner Geburt gestorben. Im Kindbett, sagten sie.
Zu meinem Vater sagten sie auch "krummer Hund". Mein Vater wuchs in einer Schmiede am Ende eines Seitentals von Hann auf. Diese Schmiede gehörte bereits den Vorvätern und mein Vater sollte als Erstgeborener diesen Beruf übernehmen. Deshalb half er seinem Vater immer wieder bei der Arbeit. Als er vierzehn Jahre alt war, fiel ihm ein Werkstück auf den Fuß und zermatschte ihm die Zehen. Die Zehen waren weg und die Knochen bis zur Mitte des Fußes Brei. Seither ging er krumm und bekam deshalb den Spitznamen "krummer Hund", was nicht sehr freundlich ist. Mammamarie hat gesagt: "Hauptsåch sunst is a gråd gwåchsn, drinna, draußn a." Lange Zeit wusste ich nicht, was sie meinte.
Weil er ganz unten nicht vollständig war, konnte ihn der Führer auch nicht zum Kriegführen gebrauchen, genauso wenig wie sein Vater in der Schmiede. Er konnte kein Gewicht mehr tragen, weil er so wackelig auf den Beinen war. Auch konnte er keine schweren Gegenstände heben. Das ist in einer Schmiede wichtig, sagte Mammamarie zu mir.
Den Betrieb übernahm dann der nächstjüngere Bruder und mein Vater wurde Gleisarbeiter bei der Bahn in Hann, weil er sich beim Metall gut auskannte. Als Streckengeher war es egal, wie lange er dafür braucht. Hauptsache er konnte sehen, wenn ein Geleis brüchig wurde und ausgetauscht werden musste. Außerdem war es gut, wenn er langsam und bedächtig war. Dadurch schaute er genauer hin, auf die Geleise.
Später machte er im Eisenbahnzentrum, in Hofn, eine Schulung und wurde Weichenwart. Dafür bekam er eine Draisine, weil er wichtiger geworden war und schneller sein musste. Strecke ging dann ein anderer, während er dorthin fuhr, wo Probleme gemeldet wurden. Der Vater hatte jetzt eine schöne Dienstkleidung und ihn verband mit seinen Geleisen und den Kollegen bei der Eisenbahn eine große Zusammengehörigkeit. Liebe hätte er nie gesagt, die verband ihn auch nicht mit der Sozialistischen Partei, die dann verboten war. Es war eine störrische Zuneigung, mehr zu den Menschen, weniger zur Organisation. Vorsichtig war er, als die Nazi da waren, nicht nur die aus Deutschland, sondern auch die Tausendprozentigen von hier. Mir ist nicht klar, woher ich das alles weiß, ob mir der Vater das alles erzählte oder später Mammamarie. Onkel Fritz war es sicher nicht, der hat sogar jetzt noch Angst vor allem, sogar vor der eigenen Meinung, sagt Mammamarie.
In meiner Erinnerung gehören der Vater und die Eisenbahn zusammen. Selbst nach dem Badetag, klebte der Geruch nach Teer, die Ausdünstung der Bahnschwellen, immer noch an ihm, als würde seine Haut ihn ausatmen. Einmal, an einem freien Tag, durfte ich ihn begleiten. Ich weiß nicht, ob es ein Sonntag war, denn ein Eisenbahner hat an unterschiedlichen Tagen frei. Im Schicht- und Radldienst kommt man leicht durcheinander, denn die Eisenbahn muss an jedem Tag fahren und auch jede Nacht. Immer hat jemand Dienst, damit alles funktioniert und nichts passiert. An diesem Tag zeigte mir mein Vater, wie eine Weiche gebaut ist und wie sie zwischen den Geleisen arbeitet, damit ein Zug von einer Fahrspur auf eine andere wechseln kann. Sie ist eine schlichte, jedoch absolut perfekte Erfindung, in der unterschiedliche Bauteile, Zungen und führungslose Stellen zusammenspielen müssen, damit eine Weiche ihre Aufgabe erfüllen kann. Das ganze komplizierte System der Eisenbahn ist beim Wechsel eines Geleises vom Ineinandergreifen des zukünftig führenden Geleises mit dem ersten Räderpaar abhängig. Im Vergleich mit den über ihn hinweg donnernden Lokomotiven und Waggons, bestimmt dieser kleine Teil Halt und Richtung. Mein Vater sagte, dass dies der Beweis sei, dass menschlicher Erfindungsgeist nicht nur dem Töten und Zerstören dienen könne, sondern fähig sei, die Materie im Dienste der menschlichen Entwicklung zu beherrschen. Nach diesem Satz wurden Vaters Augen trüb und er dachte wohl daran, wie viele Menschen mit Hilfe dieser Technik in ihren Tod gekarrt wurden. Diesen Satz werde ich mein Leben lang nicht vergessen und dabei immer diese Eisenbahnweiche im Sinn haben, die mir mein Vater zeigte und erklärte.
Nun ist mir noch eine Erinnerung an den Vater eingefallen. Manchmal, wenn er sich am Sonntagnachmittag mit seinen Freunden im Parteiheim zum Bauernschnapsen verabredete, durfte ich ihn begleiten, obwohl Mammamarie jedes Mal laut mit ihm schimpfte. Er sei kein gutes Vorbild für mich, wenn er mich dorthin mitnehme, wo viel geraucht, Alkohol getrunken und um Geld Karten gespielt werde. Papa spielte auch mit Mammamarie Zweierschnapsen, ohne Alkohol und nicht um Geld, sondern um die Ehre. Er durfte zu Hause nicht rauchen, weil man den Gestank nicht mehr aus den Möbeln und den Kästen hinausbekam. Mit nur einer Gegnerin benötigte Papa nicht viel Konzentration, um zu gewinnen, weshalb ich auf seinem Schoß sitzen durfte und kiebitzen. Hatte Papa in seinen Stichen eine für den Sieg ausreichende Punkteanzahl erreicht, rief er "Genug" und verlagerte seinen Oberkörper. So ich nicht darauf vorbereitet war, geriet ich aus dem Gleichgewicht. Wenn der Vater dazu noch seine Beine ausstreckte, rutschte ich hinunter. Wenn er auch noch bei seinem gesunden Fuß die Zehen ausstreckte, fiel ich mit Schwung zu Boden. Hob Papa jedoch die Zehen an, wurde die Fahrt gestoppt und er begann mit dem Bein zu wippen. Indem ich mich daran festhielt, konnte ich mitschaukeln. Bis heute höre ich das glückliche Glucksen, das ich dabei ausstieß. Ich hatte meinen Vater sehr gerne.
3. Woche
Das Zentrum meines Geburtsortes liegt auf einer Gesteinsformation, die vom Gletscherfluss der Eiszeit nicht weggeschliffen wurde. Das haben wir in Geographie gelernt. Sie erhebt sich über dem Tal des Flusses, das sich, nach dem Durchbruch der Felsen der letzten Ausläufer des Alpenhauptkammes und ihrem Granit, von der bisher von West nach Ost gerichteten Bahn, nun gegen Norden wendet. Im Kalk und Schiefer fanden die Gletscherströme geringeren Widerstand und sie bildeten ein Becken, ehe sie in einem neuerlichen Durchbruch den nächsten Gebirgsstock in zwei Teile zwangen.
Ein Teil des Ortes liegt oben, auf dem Gebirgsvorsprung, und zwar das Gemeindeamt, die Kirche, die Bezirksverwaltung, das Finanzamt, die Wirtschaftskammer, die Bauernkammer und der Tennisplatz. Unten am Fluss, ständig vom Hochwasser bedroht, befinden sich der Bahnhof, die Fabriken, die neuen Gemeindewohnungen und das Gewerkschaftshaus. Oben wurde alsbald kein Platz mehr gefunden für die vielen neuen Bewohner. Die wurden unten angesiedelt. Und unten waren auch die Lager für die Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg, Außenstellen des Konzentrationslagers Mauthausen: das Nordlager für die sowjetischen Soldaten, das Südlager für alle anderen, und die Kaserne für die zumindest eintausend Bewacher. Der obere Teil heißt Obermarkt und der andere Untermarkt, die bis 1936 Hann-Markt und Hann-Land hießen. Es gibt immer noch eine Bürgermusikkapelle und eine Bauernmusikkapelle.
Als Kind verbrachte ich den Großteil des Sommers im Schwimmbad, inzwischen verdiene ich mir in den Sommerferien durch Arbeit etwas Taschengeld und habe dafür nicht mehr viel Zeit. Das Schwimmbecken hat mit fünfundzwanzig Meter Breite und fünfzig Meter Länge olympische Ausmaße. Das alte, kleinere Bassin haben die Nationalsozialisten für ihre Wachmannschaften so ausgebaut. Das Becken hat eine Abteilung für Kleinkinder und Nichtschwimmer, das durch ein Metallgitter vom Bereich mit zunehmender Tiefe des Wassers bis hin zum Fünf-Meter-Sprungturm, mit einer Wassertiefe von ebenso fünf Metern, getrennt ist. Diese Menge an Wasser muss aus hygienischen Gründen zumindest zwei Mal pro Badesaison komplett entleert und neuerlich, mit dem Wasser eines in unmittelbarer Nähe vorbeifließenden Gebirgsbaches, frisch gefüllt werden. Das langsame Absinken des Wasserspiegels ist für uns Kinder und Jugendliche immer ein besonderes Ereignis und der Bademeister hat lautstark alle seine Autorität einzusetzen, um uns vor Verletzungen zu bewahren, wenn wir, trotz Verbotes, in den bereits entleerten Bereichen des Schwimmbeckens, auf dem grünen Algenbewuchs des Bodens, waghalsige Rutschmanöver durchführen. Sobald das entleerte Becken gereinigt ist, beginnt das neuerliche Einfließen des eiskalten Wassers, was mehrere Tage dauert. Auch das bereits befüllte Schwimmbecken ist nur zögerlich, anfangs allein von den besonders Kälteerprobten, zu benützen. Die Temperatur des Wasser muss von der Sonne allmählich, und, wie böse Menschen behaupten durch Kinderpipi etwas schneller, auf eine erträgliche Höhe gebracht werden. Dreimal täglich wird an einer Tafel an der Kassa der aktuelle Messwert der Luftund der Wassertemperaturen vermerkt. Wir beobachten diesen Vorgang mit großer Aufmerksamkeit, ehe ab dem angezeigten Wert von siebzehn Grad Celsius, ohne weitere Verzögerung, unsere üblichen Aktivitäten wieder aufgenommen werden können.
Am Rande des Weges zum Schwimmbad befindet sich eine Stele mit seltsamen, uns unbekannten Schriftzeichen und einem roten Stern als Krönung. Bei einem Ausflug unserer Hauptschulklasse fragte ein Schüler, was dies bedeute. "Daran sind die Russen schuld", antwortete der Lehrer. "Das mussten wir aufstellen, sonst hätten wir die Russen nie mehr aus dem Land bekommen."
4. Woche
Einen ersten Blick in die weite Welt ermöglichte mir eine mehrbändige Enzyklopädie, über deren Ankauf sich Mammamarie viele Jahre lang ärgerte. Sie war einem Verkäufer an der Haustüre auf den Leim gegangen, als er, angeblich war er ein armer Student, ihr eine Bestellung mit Ratenzahlung aufschwatzte. Monatelang musste sie den zu zahlenden Betrag von den ohnehin nur knapp ausreichenden Geldern für die Haushaltsführung absparen. Als ich in der Schule den sorgsamen Umgang mit Büchern gelernt hatte und dafür nur frisch gewaschene Hände verwendete, durfte ich in diesen großen Bänden selbständig blättern. Dabei wurde regelmäßig überprüft, dass ich keine Eselsohren hinterließ, indem ich Seiten knickte. Wenn ich dann am Küchentisch saß und in den ersten Jahren nur die kleinen schwarz-weißen Fotografien betrachtete, verlor ich mich in der weiten Welt. Der Grand Canyon in den USA, eine Gruppe kleingewachsener Waldbewohner aus Zentralafrika, eine Herde Elefanten vor dem Kilimandscharo, eine japanische Familie bei einer religiösen Zeremonie und viele weitere Fotografien begleiteten meine Weltreisen. Viele Abbildungen verstand ich erst als ich mit den Schuljahren auch die begleitenden Erläuterungen lesen konnte. Zuvor musste ich während meiner Ausflüge den Hinweis überwinden, Mammamarie habe für solche Sachen keine Zeit, weil zu viel Arbeit zu tun sei, ehe sie sich doch zu mir setzte und den einen oder anderen erklärenden Text vorlas. Als sie mich konzentriert in dem Buch blättern sah und gelegentlich komplizierte Begriffe mehrmals hintereinander laut vor mich hersagen hörte, hatte die früher unnütze Ausgabe einen Sinn gefunden. "Alkohol macht dumm und Wissen ist Macht", sagte sie und eine Investition in die Ausbildung ihres Ziehsohnes würde ihm später ein besseres Leben möglich machen, hoffte sie.
Mammamarie trägt im Alltag nur Kittelschürzen, die selbst durch wiederholtes Waschen weder Form noch Farbe zu verlieren scheinen. Ein strapazierfähiges Material, nennt sie es. Nur am Sonntag trägt sie Rock und Bluse, um mit mir zu Onkel Fritz zum Mittagessen zu gehen. Die Kirche betritt sie nur, wenn ein ihr nahe stehender Mensch katholisch begraben werden wollte und sie dabei anwesend sein musste. Für derartige Anlässe hat sie ein schwarzes Kostüm mit gleichfarbigem Hut, das jedoch nach Mottenkugeln riecht. Der Geruch ist nicht weg zu kriegen, obwohl das Kostüm bereits Tage vor dem Anlass aus dem Kasten gehängt wird.
Mammamarie nimmt sich tagsüber selten die Zeit, um sich zu setzen. Beim Stricken und Nähen, auch beim Schälen von Erbsen und Bohnen, geht es nicht anders, die übrige Zeit ist sie in Bewegung. Ihre Gefühle sind selten nahe der Oberfläche, jedenfalls die positiven. Zorn und Wut dringen da eher durch. Selbst wenn, was selten der Fall ist, Besuch am Tisch sitzt, wuselt sie herum und fragt ständig, was benötigt wird. Dabei kann sie sprechen, beinahe ohne Luft zu holen.
Mammamarie ist eine sparsame Frau. Sie muss mit dem wenigen Geld, das sie verdient und das sie für mich bekommt, gut haushalten. Onkel Fritz ist, als mein nächster männlicher Verwandter, mein Vormund und bekommt auch meine Waisenrente und irgendein Geld für den Tod meiner Geburtsmutter ausbezahlt. Dieses Geld gibt er an Mammamarie weiter. Sie nimmt von diesem Geld nur dann, wenn für mich ungeplante Kosten entstehen oder im Rahmen meiner Ausbildung Extraausgaben zu tätigen sind. Den Rest legt sie für mich auf ein Sparbuch, das ich bekommen soll, wenn ich volljährig werde.
Mammamarie strickt Schals, Handschuhe, Mützen und Pullover. Wird eines von denen löchrig oder auch zu klein, weil ich schon wieder gewachsen bin, darf ich sie sorgsam auftrennen und anschließend die Wollfäden zu einem Knäuel wickeln. Diese Stoffbälle dienen wieder als Material für neues Strickwerk. Je unterschiedlicher die Farben der Stoffballen sind, desto bunter wird das Ergebnis ihrer Arbeit. Meine Winterbekleidung ähnelt inzwischen der im Farbfernsehen im Schülerheim gezeigten Mode, wie sie in San Francisco und London getragen wird. Nur im Fall, dass das Strickwerk verschenkt, oder aus einem anderen Grund in Farbe und verwendetem Material gleichmäßig werden muss, wird neue Wolle gekauft. Diese ist in ihrer handelsüblichen Form nicht mit Handarbeit zu verarbeiten und muss zuvor aufgerollt werden. Für diese Aufgabe sitze ich dann Mammamarie auf Armlänge gegenüber. Ich halte das Wollbündel über meine ausgestreckten Arme und Mammamarie rollt das eine Ende des Fadens, Umdrehung nach Umdrehung, zu einem neuen Knäuel auf, das sie beim Stricken neben sich liegen lassen kann. Der Faden über den Zeigefinger locker geführt, wickelt sich das Knäuel im Laufe der Arbeit ab. Die langen Nadeln klappern und an der Bewegung ihrer Lippen kann ich erkennen, wie sie mitzählt, um Reihen und Anzahl der Maschen einzuhalten, damit sie nicht, nach einem Fehler, mehrere Maschen oder gar Reihen auftrennen muss.
Ich liebe die Nähe, die entsteht, wenn wir uns gegenseitig mit den Knien berührend, von Angesicht zu Angesicht sitzen. Mammamarie erzählt mir dabei Märchen und Sagen, und als ich älter wurde, Geschichten von meinem Vater und Tratsch aus dem Ort. Ich kam meiner Mammamarie nur noch dann körperlich so nahe, wenn ich mir wegen eines Fehlverhaltens eine Ohrfeige einfing. An eine Geschichte über meine leibliche Mutter kann ich mich nicht erinnern, über die wurde nie gesprochen.
5. Woche
Im nächsten Schuljahr komme ich in die achte Klasse und werde in einem Zweibettzimmer wohnen. Das ist für die ältesten zwei Jahrgänge vorgesehen. Derzeit schlafe ich noch in einem Vierbettzimmer. Bis auf einen Mitbewohner, der im zweiten Jahr ausziehen musste, nachdem seine Eltern nach Kärnten übersiedelten, und ein neuer dazukam, blieben wir so, wie wir am Anfang zusammengesteckt wurden. Obwohl es sehr wenig Platz gibt und wir gelegentlich aufeinander gereizt sind, kommen wir ganz gut miteinander aus. Man erfährt, wie die anderen leben. Alle drei haben zu Hause ein eigenes Zimmer. So etwas habe ich noch nie gehabt.
Mammamarie war immer die Hausbesorgerin für die vier großen Mietshäuser, die der Gemeinde im Obermarkt gehören. Als Papa noch am Leben war, hatten wir zwei Zimmer unter dem Dach. Eine Wohnküche, in der mein Bett stand. Papa und Mammamarie schliefen im Schlafzimmer, in dem auch der Kleiderkasten stand, damit unser Gewand nicht nach dem Küchendunst roch. Wie dann Papa tot war, mussten wir in eine Ein-Zimmerwohnung in den Keller umziehen. Das machte Mammamarie sehr zornig, weil die Wohnung so klein war, dass sie einige von den wenigen Sachen, die wir hatten, in einem Kellerabteil unterstellen musste. Als ich dann in den Stimmbruch kam, hat Onkel Fritz bei der Gemeinde durchgesetzt, dass wir wieder eine Wohnung mit einem eigenen Schlafzimmer bekamen. Aber die Küche war so klein, dass kein Platz für ein Bett war und wir einen Vorhang durch das Schlafzimmer ziehen mussten.