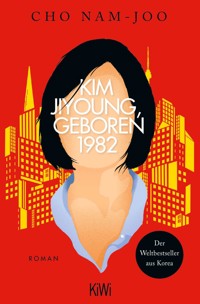19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die koreanische Bestsellerautorin Cho Nam-Joo widmet sich in diesem Entwicklungsroman einem Frauenleben, das geprägt ist von Armut und der immensen Scham, mit Mitte 30 noch unverheiratet zu sein. Manis Familie lebt in einem der ärmsten Stadtteile von Seoul. Ihr Vater arbeitet in einem Imbiss und ihre Mutter ist erwerbslos. Als kleines Mädchen träumte Mani davon, rhythmische Sportgymnastin zu werden, inspiriert durch Fernsehbilder der Olympischen Spiele 1988 in Seoul. Als Kind fängt sie mit dem Turnen an, muss aber schnell einsehen, dass sie im Vergleich zu anderen kein Talent hat. Sie wird ein einfaches, unerfülltes Leben führen, auch geprägt von der Demütigung, mit Mitte dreißig noch keine eigene Familie zu haben. Die Nachricht von der Stadtteilsanierung lässt die Immobilienpreise in die Höhe schießen, gleichzeitig erfährt Manis Familie zufällig, dass die Sanierung abgeblasen werden solle. Als ein Fremder ihr Haus kaufen will, ist die Familie uneins darüber, ob sie diesem gutmütigen Mann die Wahrheit sagen oder ihn täuschen soll. Ihr ganzes Leben lang haben sie sich an das Prinzip der Ehrlichkeit gehalten. Welche Entscheidung werden sie treffen, wenn sie vor dem größten Dilemma ihres Lebens stehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cho Nam-Joo
Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Cho Nam-Joo
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Cho Nam-Joo
Cho Nam-Joo war neun Jahre lang als Drehbuchautorin fürs Fernsehen tätig. Ihr Roman »Kim Jiyoung, geboren 1982« hat sich weltweit über zwei Millionen Mal verkauft und war auch in Deutschland ein großer Bestseller. Cho Nam-Joo lebt in Korea.
Jan Henrik Dirks promovierte an der Seoul National University in Theaterwissenschaft und lehrt nun an der Gachon University und am Literature Translation Institute of Korea. Er übersetzt Romane und Sachliteratur und wurde 2015 für die Übersetzung des Romans »Vaseline-Buddha« von Jung Young Moon mit dem Daesan Literary Award ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Was bedeutet es, als alleinstehende, arbeitslose Frau Mitte dreißig in Seoul zu leben? Ein Roman, der die prekäre Lage und die Probleme des koreanischen Mittelstandes und von alleinstehenden Frauen porträtiert. Er erzählt vom Träumen und Scheitern, vom Hoffen auf eine bessere Zukunft und von der Aussichtslosigkeit vieler Menschen angesichts steigender Immobilienpreise und einer sich immer schneller drehenden Welt.
Inhaltsverzeichnis
Auch das geht einst vorüber
Ein grausamer Winter
Da habe ich gesagt, ich möchte turnen
Keine leichte, aber eine glückliche Zeit
Leute, die immer nur nach oben wollen
Der scharlachrote Stempel auf meinem Hintern
Hier und da blinkende Lichter, wie geheime Signale
Der Mann, der freundlich lachte, als er den Lauch sah
Szene im Mondlicht
Auch das geht einst vorüber
Man kann dem menschlichen Gedächtnis nur dankbar sein. Manchmal fühlt sich die Erinnerung an die unerfreulichen Dinge und an eine von Armut geprägte Kindheit regelrecht romantisch an. So ist das mit »vergangenen Dingen«. Man kann mit einem Lachen darüber sprechen, man kann verzeihen, man kann sie als Andenken verpacken. Und doch würde es einen schaudern, wenn man gesagt bekäme, man solle noch einmal in jene Zeit zurückkehren. Natürlich habe ich meine Armut nicht vollkommen hinter mir gelassen. Armut lässt man nicht so einfach hinter sich. Zumindest die armen Leute, die ich kenne, sind heute genauso arm wie früher. Leider zählt auch meine Familie dazu. Nur dass es schon Zeiten gegeben hat, in denen alles noch dicker kam, und andere, in denen wir etwas freier atmen konnten.
Mit der menschlichen Urteilskraft ist es nicht allzu weit her. Bisweilen meint man, man hätte sich verändert, dabei ist das, was sich verändert hat, nur die Gruppe derer, mit denen man sich vergleicht. Ob ich die jetzige Zeit später als diejenige in Erinnerung haben werde, in der ich »noch ärmer« war, oder als die, in der ich »noch nicht so arm« war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall aber wird auch diese Zeit eines künftigen Tages Vergangenheit sein.
Es muss irgendwo in Arabien oder in Persien gewesen sein. Jedenfalls in einem Land im Mittleren Osten, da gab es wohl einmal einen König, dessen Leben war ein wahres Wechselbad der Gefühle, ein wildes Auf und Ab von Freud und Leid. Eines Tages erließ er einen besonderen Befehl an seine Untertanen. Man solle ihm etwas bringen, das es ihm ermögliche, seine Freude unter Kontrolle zu halten, wenn er fröhlich sei, und nicht von Trübsal verzehrt zu werden, wenn er traurig sei. Der König, dieser verfluchte Kerl … Die Untertanen zerbrachen sich Tag und Nacht den Kopf. Und schließlich brachte man dem König einen Ring. Auf dem stand eingraviert:
Auch das geht einst vorüber.
Es kommt in letzter Zeit immer wieder vor, dass ich glücklich bin. Dann denke ich daran. Auch das geht einst vorüber. Und auch, dass ich plötzlich traurig werde, geschieht immer wieder. Dann denke ich ebenfalls daran. Auch das geht einst vorüber.
Irgendjemand hat einmal das Drama seines Lebens in sieben Akte unterteilt, aber so vielfältig und bunt war mein Leben nicht. Wenn man es unbedingt unterteilen wollte, kämen vielleicht am Ende drei Akte dabei heraus. Mein Leben in Seoul als Teil der armen Unterschicht wäre der erste Akt. Der zweite Akt, in einem Vorort von Seoul, in der unteren Mittelschicht, wird nun bald beginnen. Der erste Akt meines Lebens, lang und langweilig, scheinbar nicht enden wollend, geht nun zu Ende. Wenn die heutige Nacht vorüber ist, werde ich diese Wohnung, in der ich seit meiner Geburt beinahe vierzig Jahre lang gelebt habe, verlassen.
Ich ordne nach und nach das Gepäck. Sechsunddreißig Jahre – um genau zu sein – habe ich in diesem Haus gelebt. Und seit ich sieben Jahre alt war, in diesem Zimmer, in dem sich seitdem nie etwas verändert hat. In den Ecken haben sich zusammen mit dem Staub allerlei Erinnerungen und Geheimnisse angesammelt.
Nun habe ich alle Schubladen aus dem Schreibtisch herausgezogen, der mir gleichzeitig auch als Schminktisch und zur Aufbewahrung von Kleinkram gedient hat. Ganz hinten in der Schublade, wo man mit den Fingern sonst gar nicht hinkommt, befinden sich, immer wieder nachgekauft und doch immer wieder verschüttgegangen, schwarze Haarbänder und Haarspangen, Lipgloss und blaue Wimperntusche. Es gab Zeiten, da war violette, blaue und grüne Wimperntusche in Mode. Nachdem ich mich mutig zu ihrem Kauf entschlossen und sie anschließend sorgfältig aufgetragen hatte, sah ich aus, als hätte mir jemand ein blaues Auge verpasst, weshalb ich sie später nie wieder verwendet habe. Ich habe gedacht, ich hätte sie weggeworfen, und nun finde ich sie hier wieder, na so was. Und sosehr ich mich auch abmühe, der Inhalt der Dose ist mittlerweile so verkrustet, dass sich ihr Deckel nicht mehr öffnen lässt.
Dann, über dem Schreibtisch auf dem Bücherregal, Romane in alten Taschenbuchausgaben mit weiß verblichenem Rücken. Ringbücher mit dem Bild einer langhaarigen Frau auf dem Umschlag. Damals war gemunkelt worden, ein an Leukämie erkranktes japanisches Mädchen habe für das Bild Modell gestanden. Und die Schulzeitungen aus der Oberstufe. Ich nehme eine Ausgabe heraus und blättere die Seiten in einem Schwung durch. Staub steigt empor wie Zigarettenqualm, und zwei längst abgelaufene Sammelfahrkarten für den Bus fallen aus dem Regal.
Neben dem Schreibtisch die Kommode mit den drei Schubladen. Auf der Kommode, dort, wo immer die Bettdecken abgelegt wurden, ein altes Abziehbild, so groß wie ein Flaschendeckel, zur Hälfte abgekratzt, zur Hälfte noch immer, inzwischen fleckig geworden, auf der Kommode klebend. Darauf abgebildet eine Zeichentrickfigur aus meiner Kindkeit. Ein Fantasiewesen mit gelbem borstigem Fell. Wer war das noch? Ich will mit dem Raumschiff fliegen! Und eine Prinzessin sein! Komm herbei und mach sie wahr, unsere Wünsche groß und klein! Richtig. Psammead. Psammead, die Sandfee, die jeden Tag einen Wunsch erfüllt. Damals hatte ich viele Wünsche. Wenn mich allerdings heute jemand fragen würde, was ich mir wünsche, würde mir die Antwort nicht leichtfallen. Was wünsche ich mir mit sechsunddreißig Jahren …
Ich öffne das verrostete Fenster, um den Himmel zu sehen, aber das dreistöckige Gebäude nebenan verdeckt ihn fast völlig, bis auf ein kleines rechteckiges Stückchen, nicht größer als meine Hand. Eine Träne fällt aus meinem Auge. Dies war alles an Himmel, an Besinnung, an Hoffnung, was mir vergönnt war. Wie oft habe ich in diesem Haus meinen Reis gegessen, meine Notdurft verrichtet und mich ausschimpfen lassen.
So wie im Leben anderer gewöhnlicher Leute auch hatte es in meinem Alltag nichts gegeben, was besonders schön oder erinnernswert gewesen wäre, doch nun denke ich mit Wehmut an all diese Momente zurück.
Ein grausamer Winter
Es flimmerte vor meinen Augen, und dann rann mir etwas Heißes über die Lippen.
»Oh je! Mani! Du blutest aus der Nase!«, rief Hyeseon.
Erschrocken kamen die anderen Kinder herbeigelaufen. Ich leckte mir über die Lippen und schmeckte etwas Salziges. Ich wischte mit dem Handrücken unter meiner Nase entlang und sah es nun mit eigenen Augen. Blut, da kam wirklich Blut.
Jumi, bei der wir uns getroffen hatten, war ins Badezimmer gelaufen, hatte einen langen Streifen Klopapier abgerissen und zusammengewickelt und kam nun damit angelaufen. Das Klopapier fühlte sich genauso kratzig an wie das bei uns zu Hause. Jumi formte kleine Kügelchen, stopfte sie mir in die Nase und zog dann mit voller Kraft an meinem Pferdeschwanz, so dass mein Kopf nach hinten gerissen wurde. Ich schrie erschrocken auf. Und schloss dann leicht die Augen. Das Blut rann mir nun in den Hals. Oktober 1988. Das erste Nasenbluten meines Lebens. Durch meine geschlossenen Augenlider drang orangefarben das Licht der strahlenden Sonne, und ich hörte, wie das aufgeregte Geplapper meiner Freundinnen nach und nach verschwamm und sich allmählich entfernte. Ein Traum, ja, es war, als träumte ich. Ich schluckte mein Nasenblut herunter.
Da hörte ich, wie jemand lachte. Eines der Mädchen hatte begonnen, und es dauerte nicht lange, und der ganze Haufen war am Gackern. Nicht eine von ihnen hatte sich Sorgen um mich gemacht.
»Seoul to the World, the World to Seoul!«
Die Stimme, die Aussprache, die Stille, die diesen Satz umgab, der anschließend ausbrechende Jubel. An alles erinnere ich mich. Ich war damals gerade einmal acht Jahre alt und es ist fast dreißig Jahre her, aber ich erinnere mich genau. Denn als ich die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele sah, geschah es zum ersten Mal in meinem Leben, dass ein männliches Wesen mein Herz höherschlagen ließ.
Er war ein Jahr jünger als ich. Und wie er dort in strahlend weißem Sportdress, in T-Shirt und kurzen Hosen, auf dem Kopf eine niedliche Mütze mit rosafarbenem Schirm, quer über den hellgrün leuchtenden Rasen lief, da klopfte er an meine Brust, öffnete den Riegel all meiner zwölf Rippenpaare und drang direkt in mein Herz. Der Junge mit dem rollenden Reifen. Mit ihm begann meine Sehnsucht nach jüngeren Männern.
Damals gab es noch ein Land, das sich Sowjetunion nannte, und Deutschland war noch nicht vereinigt. Die Welt war geteilt in zwei Blöcke, die unterschiedlichen Werten folgten und einander nicht anerkannten. Die Olympiade in Moskau war von den Ländern des Westens, die in Los Angeles von den Warschauer-Pakt-Staaten boykottiert worden. So nahmen nach diesen »halben« Spielen an der Olympiade von Seoul nun so viele Länder teil wie nie zuvor. Die Spiele wurden ein großer Erfolg, und der Herbst 1988 war heißer als der Sommer zuvor.
An viele Athleten erinnere ich mich noch. An Carl Lewis und Ben Johnson, die beiden Rivalen, an das Tischtennis-Traumdoppel Yang Yeongja und Hyeon Jeonghwa, an die Sprinterin Florence Griffith-Joyner mit den knallbunten Fingernägeln und der wehenden Löwenmähne, und vor allem an Turnerinnen wie Elena Shushunova und Daniela Silivas, die kaum älter waren als ich. Eines Abends im Oktober fiel nach einem prächtigen Feuerwerk der Vorhang der Spiele von Seoul, wir jedoch fieberten weiter.
Wir versammelten uns, wenn die Eltern nicht zu Hause waren, in der Wohnung und machten Kunstturnen – wenn man das so nennen konnte. Sobald das Training begann, tauschten wir unsere Röcke gegen weiße Strumpfhosen und unsere Hosen gegen Unterwäsche. Unterhemden und Unterhosen lagen allerdings nicht sehr eng am Körper, und wenn wir im Winter dreilagige Thermo-Unterhemden anziehen mussten, schlug sich das in empfindlichen Punktabzügen in der B-Note nieder, was Hyeseon schließlich, obwohl mitten im Winter, dazu veranlasste, einfach alles auszuziehen und nur in Unterhose zu turnen.
Hyeseon war eigentlich in allem gut. Bei Gummitwist war es nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass sie auf das Band getreten wäre. Beim Seilspringen mochte sie noch so sehr aus der Puste geraten, sie blieb doch nie hängen, und beim Gonggi-Spiel, bei dem man Steine mit dem Handrücken auffängt, bog sie nicht nur ihre Finger elegant nach oben, sondern schürzte gleichzeitig auch immer ihre Lippen, ohne dass ein Stein zu Boden fiel. Ihr Erfolg beruhte weniger auf angeborenem Bewegungstalent als vielmehr auf eisernem Willen. Vom Lernen abgesehen, hängte sie sich überall voll rein.
So etwas wie Dehnübungen gab es bei uns nicht. Einen Spagat hatte nie jemand von uns gemacht, und so beschränkten wir uns zunächst weitgehend auf Rolle vor- und rückwärts, verbogen unseren Hals und hüpften munter auf und ab. Manchmal übertrieben wir es auch ein wenig und humpelten dann prompt am nächsten Tag mit einer Oberschenkelzerrung umher. Suyeon, die in der Anfangsphase mit besonderem Geschick geglänzt hatte, verletzte sich am Nacken und musste das Training aussetzen. So waren wir bei unseren Turntreffs nur noch zu fünft. Oft trafen wir uns zum Trainieren bei Jumi, weil die Zimmer in ihrer Wohnung besonders groß und ihre Eltern als Geschäftsleute besonders häufig nicht zu Hause waren. Und einmal in der Woche fand eine richtige Bewertungsrunde statt.
Es war der Tag der Zwischenbeurteilung. Ich hockte, ein Ringbuch mit Katzenmotiv in der Hand, in Jumis Schlafzimmer und notierte die Punktzahlen, und Hyeseon stand in der diagonal gegenüberliegenden Ecke, beide Arme nach oben gestreckt und tief Atem holend. Ganz so, wie es die echten Turnerinnen auch taten, reckte sie den Hals, blickte einmal kurz mit stolzem Blick in die Luft und stampfte kräftig mit dem Fuß auf. Das sollte offenbar ein doppelter Handstützüberschlag seitwärts werden. Ich kam mit meinen Notizen bis »doppelter Hand…«, als Hyeseon sich bereits in der Ausführung des dritten Rades befand. Nun war das Schlafzimmer von Jumis Eltern zwar nicht gerade klein, aber für drei Räder hintereinander reichte es dann doch nicht ganz, zumal ich nicht nach hinten ausweichen konnte. Hyeseon krachte zuerst gegen die Wand und dann mit dem Fuß voll auf meine Nase. So bescherte sie mir das erste Nasenbluten meines Lebens.
Ich dachte natürlich, die Nase sei gebrochen, aber die Röntgenuntersuchung ergab, dass alles in Ordnung war. Als meine Mutter mir einen Eisbeutel auf die prall geschwollene Nase legte, schimpfte sie so ausgiebig mit mir, dass es für ein Jahr gereicht hätte.
»Deine Mutter hatte nicht mal Geld für ein Hochzeitsfoto! Aber die Frau Tochter genehmigt sich Fotos wie diese, die nicht mal von der Versicherung übernommen werden. Hübsche Fotos kann man ja wenigstens noch irgendwie verwenden. Aber ein Foto nur mit schwarzen Knochen drauf? Na, vielleicht später als Totenporträt[1]. Obwohl, man müsste ja wenigstens was drauf erkennen können. Nur Knochen, da weiß ja keiner, dass du das bist. Das Gratulationsgeld der Trauergäste können wir dann auch vergessen. Mach nur so weiter, du!«
Es war ein solcher Wortschwall, dass ich im Einzelnen nicht verstand, was sie sagte, aber dass sie mit mir schimpfte, war mir schon klar. Ich lag auf dem Rücken, den Kopf leer, sah nach oben und zählte die sich überlappenden Vierecke des Musters an der Zimmerdecke. Mein Vater sagte:
»Nicht Gratulationsgeld, sondern Kondolenzgeld.«
Der Nasenknochen war heil, aber der Bluterguss verschwand nicht so leicht. Mama sagte, ich solle zu Hyeseon gehen und wenigstens die Kosten für die Arztbehandlung einfordern, aber dass man für einen kleinen Unfall beim Spielen die Arztkosten erstattet bekommen wollte, schien mir schon als Kind irgendwie unangemessen. Auch Mama musste das gewusst haben. Deswegen war sie wohl auch selbst nicht hingegangen. Einmal begegneten wir Hyeseons Familie auf dem Markt. Mama hielt mich fest bei der Hand, zitternd, wutentbrannt, ohne ein Wort zu sagen. Hyeseons Mutter wusste offenbar nichts von meiner Verletzung, denn sie machte große Augen, drückte mir ganz sachte den Zeigefinger auf Stirn und Nase und fragte, was denn passiert sei. Der Fleck, zunächst violett, färbte sich allmählich rot, dann grün, dann gelb und war nach einer Weile schließlich verschwunden.
Auch nach meiner Verletzung setzten wir unser Training unbeirrt fort. Für den dreifachen Handstützüberschlag seitwärts hatte es Punktabzug geben müssen, aber Hyeseons Ehrgeiz, mit dem sie locker drei Erdumrundungen geschafft hätte, war ungebrochen und suchte nach immer neuen Herausforderungen. Da kein geeigneter Ball für Ballgymnastik vorhanden war, trieb Hyeseon irgendwo einen Handball auf. Der hatte die richtige Größe und lag uns Kindern gut in der Hand. Auch besaß er, wie wir feststellten, als wir ihn auf den Boden prellten, das richtige Gewicht und eine gute Spannung. Die böse Vorahnung, dass mit diesem Ball etwas ganz schrecklich schiefgehen würde, hatte ich von Anfang an gehabt, und folgerichtig zerdepperte Hyeseon damit auch sofort die Neonbeleuchtung im Schlafzimmer von Jumis Eltern. Nicht dass sie den Ball erst aufgeprellt oder beim Fangen verfehlt hätte. Nein, sie hatte ihn mit aller Kraft in Richtung Zimmerdecke geschleudert, um dann eine Rolle vorwärts zu machen, wobei der Ball, nach sattem Aufprall an der Leuchtstoffröhre, wieder heruntergekommen und hinter ihr hergekullert war und die Leuchtstoffröhre ihrerseits noch einen Moment lang an der Decke gezittert, sich dann aber von dort oben verabschiedet hatte, um schließlich am Fußboden in tausend Stücke zu zerschellen. Diesmal war es Jumi, die von ihrer Mutter etwas zu hören bekam. Dabei war doch Hyeseon für die kaputte Lampe verantwortlich gewesen, aber den Ärger bekamen wir schließlich alle.
Als wir uns also unsere Standpauke abgeholt hatten und nun auf dem Weg nach Hause waren, wurde auch ich Hyeseon gegenüber ein wenig pampig.
»Mag sein, dass du ein gewisses Talent für Bewegung hast, aber Entfernungen einzuschätzen ist, glaub ich, nicht unbedingt deine Stärke.«
»Ich hatte als Kind mal eine ganz schlimme Erkältung, und seitdem hör ich nicht mehr so gut.«
Was sollte das denn heißen? Als Hyeseon mein fragendes Gesicht sah, blieb sie etwas genervt stehen und erklärte:
»Weißt du denn nicht, dass sich im Ohr das Organ für Raumwahrnehmung befindet? Und was hatte ich damals, als ich so schlimm erkältet war? Eine Nasennebenhöhlenentzündung! Davon kriegt man schlechte Ohren. Hör mal, was ich dir jetzt sage, ist ein Geheimnis. Das sage ich nur dir. Auf dem rechten Ohr höre ich immer noch nichts.«
»Ähm … Wirklich?«, fragte ich.
Weil sie mir nun doch etwas leidtat – beileibe nicht, um sie auf die Probe zu stellen, sondern weil sie mir wirklich leidtat –, fragte ich dies so leise, dass ich es selber kaum hören konnte, so leise, als hätte ich es eigentlich nur im Kopf gedacht. Hyeseon meinte sofort:
»Ja, nee, hör ich nicht.«
Ich hatte damals rechts von ihr gestanden. Ich vermute, dass das, was sie früher gehabt hatte, wahrscheinlich eine Mittelohrentzündung gewesen war. Wahrscheinlich hatte sie sagen wollen, dass dadurch die Bogengänge in ihrem Ohr verletzt worden seien und sie deswegen ihren Gleichgewichtssinn verloren habe. Ob man infolge einer schlimmen Mittelohrentzündung Gleichgewichtsstörungen bekommen kann, weiß ich nicht, aber dass eine Nasennebenhöhlenentzündung nichts mit dem Sinn für Raumwahrnehmung zu tun hat, steht fest. Außerdem glaube ich, dass Hyeseon auf dem rechten Ohr sehr gut hören konnte.
Die Disziplin »Ball« wurde uns verboten. In der darauffolgenden Woche wirbelte Hyeseon mit der Plastikschnur, die sie anstelle eines Gymnastikbandes mitgebracht hatte, so schwungvolle Schleifen in die Luft, dass Jumi einen langen, tiefen Kratzer in ihrem hübschen weißen Gesicht davontrug, der allmählich verschorfte und aussah, als sei er von den Krallen einer Katze verursacht worden. Die Disziplin »Band« war fortan auch verboten. Wieder eine Woche später zerlegte Hyeseon mit einem misslungenen Wurf des Hula-Hoop-Reifens die Drachenbaum-Pflanze in Jumis Wohnung. Dafür bekamen wir von Jumis Mutter, gerecht verteilt, je zwei Schläge auf den Rücken und ein gehöriges Donnerwetter, bevor wir hinausgeworfen wurden. Bei Jumi durften wir nun nicht mehr trainieren. Eine so schöne, große Wohnung aber gab es sonst nirgends.
Von da an trafen wir uns meist auf dem Hinterhof der Schule. Es wehte nun bereits ein kalter Wind, und so trugen wir dicke Mäntel. So sauber unser Radschlag auch ausgeführt sein mochte, besonders elegant wirkte es nicht. Ständig klimperten irgendwelche Münzen aus unseren Jackentaschen, oder unsere Gesichter verhedderten sich in Kapuzen oder Schals. Das Ganze wirkte eher drollig. Außerdem mussten wir Handschuhe tragen, weil uns ständig kleine Steinchen und Zweige in die Handflächen stachen.
»So geht das irgendwie nicht«, sagte Hyeseon eines Tages traurig, als sie wieder einmal alle Münzen aufsammelte, die ihr aus der Tasche gefallen waren. Jumi brach plötzlich in Tränen aus. Wenn ich so zurückdenke, war es ein sehr kalter Winter damals, als ich acht Jahre alt war.
Beinahe hätte ich die Station verpasst, an der ich aussteigen musste. Überhaupt nichts zu tun und überhaupt nichts zu denken, ist schwieriger, als man meint. Huscht irgendetwas an einem vorüber, folgt man ihm unwillkürlich mit den Augen, und auch beim leisesten Geräusch spitzt man wie ein Tier instinktiv die Ohren. Wenn ich mich innerlich auffordere, nichts zu denken, und deshalb immer wieder denke: »Bloß nichts denken, bloß nichts denken«, falle ich oftmals tatsächlich irgendwann in einen vollkommen gedankenlosen Zustand. Und immer, wenn ich mit der U-Bahn nach Hause fahre, sitze ich einfach nur da und döse vor mich hin.
Erst nachdem ich mit der Rolltreppe nach oben gefahren und aus dem U-Bahnhof nach draußen gegangen war, nahm ich meinen MP3-Player aus der Tasche. Dreieckig, zehn Jahre alt. Gekauft von meinem ersten Monatsgehalt, als ich, nachdem ich den Universitätsabschluss in der Tasche hatte und mich um des Prestiges willen von einer renommierten Restaurantkette als Praktikantin hatte ausnutzen lassen, dann dort gekündigt und eine Zeit lang ominöse Arbeiten in einer veritablen Briefkastenfirma verrichtet und nicht einmal Geld dafür bekommen hatte, anschließend in allen möglichen Aushilfsjobs tätig gewesen war und endlich eine Anstellung und meine erste offizielle Arbeitsstelle gefunden hatte – in sehr bescheidenem Rahmen, in einem Unternehmen, in dem man von firmeninternen Regeln oder Bestimmungen noch nie etwas gehört hatte, wo Sozialleistungen ein absolutes Fremdwort waren und die Arbeitsplatzstruktur auf drei Grundbedingungen beschränkt war: Chef, Angestellter, Schreibtisch. Der MP3-Player, ein kleines Geschenk an mich selbst, als Belohnung dafür, meine nicht immer einfache Jugend und die nicht gerade kurze Phase des Umherirrens so tapfer durchgestanden zu haben – nein, das war er nicht gewesen, sondern ich hatte ihn ganz einfach gekauft, weil ich auf dem nervigen und langweiligen Weg zur Arbeit und nach Hause wenigstens ein bisschen Musik hatte hören wollen.
Assistant Manager Song, der ein paar Jahre zuvor in diese Firma gewechselt war, hatte sich beim Anblick meines MP3-Players halb schlapp gelacht. »Wahahahaha!« Ungelogen. Wa-ha-ha-ha-ha. So hatte er sich beömmelt.
»Es gibt also echt noch Leute, die mit so was rumlaufen! Frau Go, Sie sind ja der helle Wahnsinn. Kann man das Teil auch aufladen?«
»Da ist eine AA-Batterie drin.«
Da holte Song unvermittelt sein Handy aus der Tasche und begann, mir Musik vorzuspielen. Na klar. Song, der mit seiner dicken Hornbrille aussah wie Jo Youngnam. Der sich die Krawatte zweimal um den Hals wickelte. Der sich nach dem Mittagessen nicht die Zähne putzte, sondern stattdessen nur Kaugummi kaute.
Auch wenn er als Assistant Manager formal den gleichen Rang hatte wie ich, war ich eindeutig länger in der Firma als er. Und ich hatte genau mitbekommen, dass er unmittelbar nach dem Pinkeln seine Reiswickel mit ungewaschenen bloßen Händen aß. Und dass er an allen nur erdenklichen Orten auf den Boden rotzte.
Aber ich schaffte es nicht, den Mund aufzumachen. Wenn ich mich abends schlafen legte, würde ich wieder daran denken. Würde meine Bettdecke wegkicken und mir sagen, wie ungerecht das alles sei. Und mich fragen, weshalb ich es wieder nicht hinbekommen hatte, ihm Konter zu geben. Song hatte keine Manieren. Gewohnheitsmäßig gab er hirnrissiges Zeug von sich, besonders mir gegenüber. Wenn du mir noch ein einziges Mal so kommst, setzt es was, dachte ich und übte sogar allein vor dem Spiegel. Aber wenn ihm vor lauter Geläster wieder einmal der Geifer aus dem Mund tropfte, bekam ich entweder Schluckauf oder Schockstarre. Wenn er nur nicht so gesabbert hätte. Außerdem hatte er die Angewohnheit, vor jungen Frauen den Mund leicht zu öffnen und sich dann mit der Spitze von Daumen und Zeigefinger langsam über den Mundwinkel zu wischen. Vor mir tat er dies selbstverständlich nicht. Dieser Wichser.
Ich habe zehn Jahre lang in einem Architekturbüro gearbeitet, verstehe aber nicht das Geringste vom Bauen oder von Gebäudeplanung. Ich war im Team für allgemeine Angelegenheiten, gab Geld heraus, wenn man mir Quittungen reichte, und nahm Quittungen entgegen, wenn ich Geld herausgab, sorgte einmal im Monat für die exakte Überweisung des Monatsgehaltes, überprüfte gewissenhaft, ob eingegangenes Geld korrekt eingegangen war, und erstattete dem Chef darüber jeweils Bericht. Wenn es hieß, dass ein gutes Grundstück zu erwerben sei, fuhr ich manchmal auch anstelle des Chefs hin, um es zu begutachten. Dann schoss ich viele Fotos und brachte die gewünschten Unterlagen mit. Zuerst dachte ich, dass dies irgendetwas mit der Firma zu tun hätte, aber in Wirklichkeit ging es um private Immobilieninvestitionen des Chefs. Es hieß, er habe mit diesen Grundstücken eine Menge Geld verdient.
Im Team für allgemeine Angelegenheiten waren wir immer zu zweit. Vor sieben Jahren hatte Assistant Manager Kim, die etwas älter war als ich, in der Firma aufgehört, weil sie ein Kind bekam, und so war ich von da an nicht mehr »Miss Go«, sondern »Assistant Manager Go«, und es wurde eine neue »Miss Kim« eingestellt. Ich fragte mich, ob auch ich, wenn ich selbst irgendwann heiraten würde und Kinder bekäme, kündigen würde. Nachdem Frau Kim gegangen und die jüngere Kollegin gekommen war, machte ich mir so meine Gedanken, die allerdings, aus heutiger Perspektive, vollkommen überflüssig waren. Ich blieb unverheiratet. Um ehrlich zu sein, nicht aus Überzeugung, sondern zwangsläufig. Ich hätte schon gerne geheiratet, aber außer sieben verheirateten Männern und vier alten Jungesellen, die keine Freundin hatten und auch unmissverständlich erkennen ließen, weshalb dies so war, gab es in der Firma einfach niemanden, den ich hätte treffen können.
Von da an war ich »Assistant Manager Go«. Und, auch wenn es mir leidtat, »Miss Kim« blieb weiterhin »Miss Kim«. Nach etwa zwei Jahren begann Miss Kim, ihrem Unmut darüber Luft zu machen.
»Sag mal, läuft das hier so, dass man auch nach zehn Jahren oder hundert Jahren immer noch ›Miss Kim‹ bleibt? Wenn ich mit Geschäftspartnern zu tun hab, ist mir das total peinlich. Und vor den Kunden auch.«
Dazu fiel mir nicht viel ein. Aber ich war ja immerhin »Assistant Manager«. Vielleicht war es aus einer Art Minderwertigkeitskomplex heraus, jedenfalls hatte ich das Gefühl, als zielten ihre Worte im Grunde auf mich ab. Dass die vorige Frau Kim wegen ihrer Schwangerschaft gekündigt hatte und ich dadurch Assistant Manager geworden war, wusste auch Miss Kim. Offenbar hatte sie es bei einem Firmenessen von irgendwem gehört. Danach war es, so hatte ich den Eindruck, immer wieder vorgekommen, dass sie mir gegenüber sehr genervt auftrat. Natürlich war auch das nur ein Gefühl von mir.
Dies bedeutete durchaus nicht, dass ich mich nicht angestrengt hätte. Ich schlug dem Chef auch einmal vor, ob er mich nicht vielleicht zu »Sektionsleiterin Go« und Miss Kim zu »Assistant Manager Kim« ernennen könne, ohne Gehaltserhöhung, einfach so, dachte ich, als kleine Motivation, um unsere Arbeitsmoral und unsere Effizienz ein wenig anzukurbeln.
»Hm, na gut, können wir machen. Ach, Assistant Manager Go, sagen Sie doch bitte Miss Kim Bescheid, sie soll mal kurz zu mir kommen.«
Nette Antwort. Miss Kim hat im letzten Herbst geheiratet und gleichzeitig in der Firma aufgehört. Auf sie folgte »Miss Song«. Und ich blieb »Assistant Manager Go«. Ich malte mir schon aus, wie ich auf meinem Platz hocken bleiben würde, angewurzelt wie eine uralte knorrige Bergkiefer, während neben mir Miss Kim, Miss Lee, Miss Park, Miss Choi und Miss Schlagmichtot einen lustigen Reigen vollführten. Das machte mich depressiv. Noch depressiver allerdings machte mich, dass ich entlassen wurde. Im Winter 2015. Diese grausame Zeit werde ich so schnell nicht vergessen.
Mehr als dreißig Jahre lang bin ich diese steile Straße hinauf- und hinuntergekraxelt. Und während dieser dreißig Jahre hat sie sich ungefähr einhundertvierunddreißigmal verändert. Mal wurde sie breiter, dann wieder schmaler, dann wieder breiter, dann wurden Häuser gebaut, dann welche abgerissen, dann wieder welche gebaut. Es wurden Bäume ausgerissen, Geländer angebracht, noch mehr Strommasten aufgestellt und noch mehr Stromleitungen an ihnen aufgehängt. Eines aber hat sich nie verändert: dass dieser Weg für mich trotz wachsender Körpergröße und Schrittlänge stets lang und ermüdend war.
Dass unser Viertel zu den ärmsten in Seoul gehörte, konnte man sich an fünf Fingern ausrechnen. Die Quote von Jugendlichen, die von zu Hause ausrissen, war hier am höchsten, die derjenigen Schüler, die auf die Oberstufe gingen, am niedrigsten. Und auch wenn es hierzu keine Statistiken gab, stand doch fest, dass die Vielfalt der Beilagen auf dem abendlichen Essenstisch, die Anzahl der Schuhpaare pro Person und die Häufigkeit, mit der man ein Bad nahm, hier am geringsten waren. Das Viertel S-dong, ein typisches Seouler »Mondviertel«, kleine Häuschen auf steilen Hügeln, »dem Mond nahe«, mein Zuhause.
Solche Mondviertel gab es früher viele. Sadang-dong, Samgye-dong, Donam-dong, Dowon-dong, Jeonnong-dong, Bongcheon-dong … Und eben S-dong. Je mehr so ein Viertel dann noch verwaltungstechnisch aufgespalten wurde in Teilbezirk 1-dong, 2-dong, 3-dong und so weiter, desto miserabler lebte es sich dort, hieß es. Unsere Adresse war 7-dong, aber weil es mir widerstrebte zu sagen, ich käme aus dem »siebten Teilbezirk«, sagte ich immer einfach nur »S-dong«. Das allein sagte ja auch schon alles.