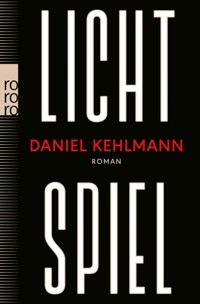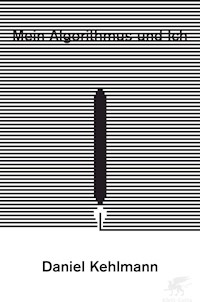9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie geht ein Romancier mit Historie und Erfindung um? Hat der Roman als Gattung Zukunft? Welche eigenen Werke würde man auf eine einsame Insel mitnehmen? Und ist «Der Herr der Ringe» große Literatur? Mit eigenen und fremden Büchern beschäftigt sich Daniel Kehlmann in diesen Essays, mit Autoren aus Europa und Amerika, mit dem Handwerk des Schreibens und dem Abenteuer des Lesens. «Kehlmann ist nun eindeutig ein Leser nach Borges-Art: ein grandioser Überblicker.» (Süddeutsche Zeitung) «Daniel Kehlmanns Bücher verströmen den irritierenden Reiz von Meistern wie Nabokov oder Proust.» (Stern) «Daniel Kehlmann scheint alles zu können.» (Neue Zürcher Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Daniel Kehlmann
Wo ist Carlos Montúfar?
Über Bücher
Inhaltsverzeichnis
Wo ist Carlos Montúfar?
Gott begrüßt seine Opfer. Über Voltaire
Die Chronik der Heuchelei. Stendhal: Rot und Schwarz
Setz deinen Fuß auf meinen Nacken! Über Leopold von Sacher-Masoch
Boden ohne Blut. Knut Hamsun: Auf überwachsenen Pfaden
Erfundene Schlösser aus echtem Stein. Über J.R.R. Tolkien
Wollust, Sorglosigkeit und Mut. Louis-Ferdinand Céline: Reise ans Ende der Nacht
Der Gast aus der Zukunft. Über Isaiah Berlin
Holden, die Enten, die Kinder. J.D. Salinger: Der Fänger im Roggen
Der Zwang zum Happy-End. Kurt Vonnegut: Suche Traum, biete mich
Wohin alles entschwunden ist. John Updike: Rabbit, eine Rückkehr
Verschwitzte Intellektuelle. Tom Wolfe: Hooking Up. Neuigkeiten aus dem Weltdorf
Wovon wir reden, wenn wir von Autorschaft reden. Raymond Carver: Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden
Schätzenswert, aber kein Goethe. Harold Bloom: Genius. Die hundert bedeutendsten Autoren der Weltliteratur
Vorwärts, das ist irgendwo. Milan Kundera: Jacques und sein Herr
Die Tränenlieferanten kommen näher. Über Georg Kreisler
Der Mai begann fürchterlich. Helmut Kraussers Tagebücher
Ironie und Strenge
Eigene Bücher lesen
Nachweise
Wo ist Carlos Montúfar?
Als ich zum erstenmal die Göttinger Sternwarte betrat, war ich mit meinem Roman Die Vermessung der Welt fast fertig. Eine meiner Hauptfiguren hatte hier gelebt und gearbeitet, und ich war überrascht, wie beklommen es mich machte, ihr auf einmal so nahe zu sein. In meinem Buch war der Mann, der diese Räume bewohnt hatte, zwar ein Genie, aber auch ein passionierter Bordellbesucher, ein desinteressierter Familienvater und ein Monstrum an schlechter Laune. Wäre er noch am Leben gewesen, so hätte keine ausgefeilte ästhetische Theorie mich schützen können – nicht vor einer Verleumdungsklage, nicht vor seinem Zorn.
Die Sternwarte ist ein imposanter klassizistischer Wissenschaftstempel des frühen neunzehnten Jahrhunderts. Ihre Kuppel allerdings ist reine Verzierung und läßt sich nicht aufklappen, die Teleskope richtete man durch schießschartenartige Öffnungen neben dem Eingangstor auf den Himmel. Drinnen führt eine Treppe in des ehemaligen Direktors Wohnräume. Das berühmte Ölbild von Carl Friedrich Gauß mit seiner schwarzen Samtkappe hängt hier im Original und ist, aber das erscheint einem bei bekannten Gemälden oft so, erstaunlich klein. Daneben steht die legendäre Telegraphenanlage, die er erfunden hatte, um sich mit seinem in der Stadtmitte arbeitenden Kollegen zu unterhalten.
Ein Erzähler operiert mit Wirklichkeiten. Aus dem Wunsch heraus, die vorhandene nach seiner Vorstellung zu korrigieren, erfindet er eine zweite, private, die in einigen offensichtlichen Punkten und vielen gut versteckten von jener ersten abweicht. Der lange Traum, schrieb Schopenhauer, sei unterbrochen von kurzen, und das sei am Ende alles; für einen Erzähler ist die lange Geschichte unterbrochen von kurzen, und was ihn nervös macht, ist nicht deren substantielle Gleichartigkeit, sondern deren Vermischung, also jede Verletzung der Grenzen. Zum Beispiel die unerwartete Konfrontation mit einer sehr realen Maschine, entwickelt von jemandem, den er in manchen Augenblicken bereits für seine eigene Erfindung hielt.
In einer Szene gegen Ende meines Romans taucht diese Telegraphenanlage auf. Professor Gauß, alt geworden und gebrechlich, steht am Fenster und schickt Signale hinaus, halb mit seinem Mitarbeiter Weber sprechend, halb mit sich selbst, zugleich auch mit der im Lauf seines Lebens bestürzend angewachsenen Welt der Verstorbenen. Mit diesem Apparat jedoch, das zeigte mir in der Sternwarte ein einziger Blick, waren Gespräche unmöglich. Das Ausschlagen der Empfangsnadel war so schwach, daß man durch ein Fernrohr auf eine Skala starren mußte. Das wieder bedeutete, daß der Sendende zuvor einen Boten zum Empfänger zu schicken hatte, um anzukündigen, wann er mit der Übermittlung beginnen werde – fürwahr eine Monty-Python-Konstellation. Noch in Gauß’ Zimmer, zwischen Empfangsgerät, Fenster und Ölbild, beschloß ich, bei meiner Version zu bleiben.
Vielleicht mißtrauen deshalb so viele Menschen, denen es bei Büchern auf Tatsachen ankommt, dem historischen Erzählen. Man liest und kann dabei nie den Verdacht loswerden, daß das Gelesene nicht stimmt. So in etwa hatte ich es schon im Studium gelernt, im Einführungsproseminar bei Dr.S.Historische Romane, hatte er im Brustton der Überzeugung gesagt, sollten wir Germanisten besser meiden, sie seien unzuverlässig und trivial.
Alle?
Alle, antwortete Dr.S.Man lebe im Heute, und wer sich anderen Zeiten zuwende, verfalle dem Eskapismus.
Dr.S. hatte hervorquellende Augen, schlechte Haut und ein Alkoholproblem. Bei den Prüfungen verließ er zwar den Raum, damit wir voneinander abschreiben konnten; allerdings nicht aus Nettigkeit, wie wir später herausfanden, sondern weil er hoffte, bessere Ergebnisse seiner Studenten würden ihm eine Beförderung eintragen. Dr.S. war ein trauriger Mensch, er las ungern, und so besonders im Heute schien er nicht zu leben. Aber seine Überzeugungen waren unerschütterlich.
Und Tolstoi, fragte eine russische Studentin.
Ja wie, fragte Dr.S.Wieso Tolstoi?
Wegen Krieg und Frieden.
Aber das sei doch kein historischer Roman. Als Tolstoi den geschrieben habe… Dr.S. zögerte, auf diesem Gebiet fühlte er sich nicht daheim. Er war Experte für Wiener Nachkriegsliteratur: ernste neodadaistische Poesie, geschrieben von den Söhnen von Wehrmachtssoldaten. Als Tolstoi den geschrieben habe, sei ja noch neunzehntes Jahrhundert gewesen!
Tolstoi habe, sagte die Studentin schüchtern, Krieg und Frieden mehr als fünfzig Jahre nach den Napoleonischen Kriegen verfaßt.
Eben, sagte Dr.S., das sei lange her. Damals hätten die Dinge anders gelegen.
An dieses Verdikt erinnerte ich mich noch genau, als ich Jahre später selbst versuchte, einen in nicht mehr ganz naher Vergangenheit spielenden Roman zu schreiben. Vielleicht hätte ich es nie gewagt ohne das Vorbild einiger Werke, die Dr.S.’ eherner Regel widersprachen: Thomas Manns Lotte in Weimar natürlich, John Fowles’ Die Geliebte des französischen Leutnants, E.L.Doctorows Ragtime, John Barths Der Tabakhändler und Thomas Pynchons Epos über Aufklärung, Wissenschaft und Wahn, Mason & Dixon. Ein ganzer Seitenstrom der Moderne unternimmt es, Dogmen wie das von Dr.S. ad absurdum zu führen, also nicht bloß Geschichten, sondern Geschichte zu erzählen und das scheinbar Unseriöse dieses von der Trivialliteratur okkupierten Genres für Spiele mit Fakten und Fiktionen zu nützen. Immer schon hat die Gattung des Romans, wirksamer vielleicht als irgendeine andere, bestehende Meinungen untergraben – und eine der wirksamsten Arten, das zu tun, besteht darin, sich die Vergangenheit neu zu erzählen und von der offiziellen Version ins Reich erfundener Wahrheit abzuweichen.
Ein Beispiel für solch ein Erfinden von Wahrheit und zugleich eine der gelungensten Annäherungen an eine vergangene Epoche ist Stanley Kubricks Film Barry Lyndon, die minutiöse Rekonstruktion einer versunkenen Welt, nicht durch den Blick auf das, was von ihr geblieben ist, sondern auf das Vergänglichste an ihr, nicht durch das Herausstreichen dessen, was wir noch mit ihr gemeinsam haben, sondern durch strikte Betonung des Trennenden. Die Entscheidung für die größtmögliche Akkuratesse ist auch eine für die stärkste Künstlichkeit; denn natürlich (eine Erfahrung, die jeder Recherchierende macht) kommen auf jedes bekannte Detail mehrere Dutzend, über die man nicht genug wissen kann – und die man also erfinden muß, um sie zu kennen. Einem Filmemacher stellt sich dieses Problem noch drastischer als einem Romancier: Der Schriftsteller kann sich um vieles herummogeln, doch der filmische Blick auf jede Einzelheit ist total und vollständig, ohne eine Grauzone der Vagheit. Der in dieser Form vielleicht nie wieder erreichte Anschein von Authentizität rührt bei Kubrick daher, daß sein Film eben nicht das reale Leben des achtzehnten Jahrhunderts abzubilden versucht, sondern dessen Widerspiegelung in der Kunst. Wo er Alltagsbegebenheiten schildert, wirken sie wie zum Leben erwachte Kupferstich-Genreszenen, seine Landschaften sind Watteau-Gemälden nachempfunden, die Innenaufnahmen, gefilmt mit NASA-Spezialobjektiven bei Kerzenlicht, zeigen das Schattenspiel und die übersteigerten Hell-Dunkel-Kontraste der Interieurs von Wright of Derby, die Orgienszenen scheinen in ihrer schematischen Abstraktheit geradewegs auf Hogarths Bilderzyklus The Rake’s Progress zurückzugehen. Hier ist nichts spontan und schon gar nichts realistisch; sogar die Buchvorlage Thackerays ist ja bereits ein historischer Roman über eine Zeit, die sein Verfasser nicht selbst erlebt hatte. Jede Szene spricht aus, daß Kunst im wesentlichen Abstraktion und Stilisierung ist; und nie war sie das mehr als im achtzehnten Jahrhundert, und auf keine Weise nähert man sich diesem besser als durch den konsequenten Verzicht auf Unmittelbarkeit. Ein Ansatz, der seine Parallele in Thomas Pynchons eigens für Mason & Dixon erfundenem Englisch hat: ein Kunstidiom, das so weder 1750 noch sonst irgendwann gesprochen wurde, angereichert durch Anachronismen, burleske Neuprägungen und den über alle Stränge schlagenden Gestaltungswillen eines Sprachformers, der den Leser gerade durch die Unverschämtheit seiner Fälschungen näher an eine untergegangene Form des Sprechens, ja an das Phänomen der Historizität aller Sprache bringt, als philologische Akribie es je könnte.
Als ich begann, meinen Roman über Gauß, Humboldt und die quantifizierende Erfassung der Welt zu schreiben, über Aufklärer und Seeungeheuer, über Größe und Komik deutscher Kultur, wurde mir schnell klar, daß ich erfinden mußte. Erzählen, das bedeutet, einen Bogen spannen, wo zunächst keiner ist, den Entwicklungen Struktur und Folgerichtigkeit gerade dort verleihen, wo die Wirklichkeit nichts davon bietet – nicht um der Welt den Anschein von Ordnung, sondern um ihrer Abbildung jene Klarheit zu geben, die die Darstellung von Unordnung erst möglich werden läßt. Gerade wenn man darüber schreiben will, daß der Kosmos chaotisch ist und sich der Vermessung verweigert, muß man die Form wichtig nehmen. Man muß arrangieren, muß Licht und Schatten setzen. Besonders die Darstellung meiner zweiten Hauptfigur, des wunderlichen Barons Alexander von Humboldt, jener Kreuzung aus Don Quixote und Hindenburg, verlangte nach Übersteigerung, Verknappung und Zuspitzung. Hatte er in Wirklichkeit eine eher undramatische Rundreise von über sechs Jahren Dauer gemacht, so mußte ich, um davon erzählen zu können, nicht nur sehr viel weglassen, sondern Verbindungen schaffen und aus isolierten Begebenheiten zusammenhängende Geschichten bauen.
So verwandelte ich den Assistenten des Barons, den treuen und vermutlich eher unscheinbaren Botaniker Aimé Bonpland, in seinen aufmüpfigen Widerpart. In Wirklichkeit war Humboldt meist inmitten einer sich ständig verändernden Gruppe gereist: Adelige und Wissenschaftler gesellten sich dazu, solange sie Lust und Interesse hatten, von den Missionsstationen kam der eine oder andere Mönch eine Strecke mit. Nur sehr kleine Teile der ungeheuren Distanz legte Humboldt tatsächlich alleine mit Bonpland zurück. Mein Humboldt aber und mein Bonpland, das wußte ich von Anfang an, würden sehr viel Zeit zu zweit verbringen. Mein Bonpland würde lernen, was es hieß, sich in Gesellschaft eines uniformierten, unverwüstlichen, ständig begeisterten und an jeder Kopflaus, jedem Stein und jedem Erdloch interessierten Preußen durch den Dschungel zu kämpfen. Also mußte ich auf Carlos Montúfar verzichten.
Der Sohn des Gouverneurs von Quito hatte sich den beiden Anfang 1802 angeschlossen, ein Teenager, der die Gelegenheit zu einer Grand Tour ergriff, wie sie sich ihm nicht noch einmal bieten würde. Er war bei der Besteigung der Vulkane Pichincha und Chimborazo dabei, er kam mit zu Präsident Jefferson in die Vereinigten Staaten, er begleitete Humboldt nach Europa und wohnte sieben Jahre bei ihm in Paris. Dann ging er zurück ins neugegründete Ecuador, um sich am Freiheitskampf zu beteiligen, wurde nach wenigen Monaten von den Spaniern gefaßt und standrechtlich erschossen. Gerüchte besagten, daß Humboldt wegen Carlos den vierten Teil seines Reiseberichtes verbrannt habe. Aber was der Baron auch zu verbergen hatte und was immer in Wahrheit zwischen den beiden vorgefallen war – in meiner Version hatte ein dritter Begleiter nichts verloren. Wie Don Quixote und Sancho, Holmes und Watson, Waldorf und Statler sollten meine Reisenden ein verschworenes, streitendes Paar sein. Viele Dutzend Menschen mochten mit Humboldt den Kontinent durchstreift haben, aber meine Dramaturgie verlangte, daß er und Bonpland, umgeben bloß von den Randfiguren wechselnder Führer, miteinander allein blieben.
«Ich entschloß mich, die historischen Ereignisse als Rohmaterial zu nehmen für einen Roman, in dem ich völlig frei Situationen verändern, umformen und erfinden konnte, wobei ich den historischen Hintergrund nur als Ausgangspunkt benutzen würde, um zu schaffen, was dem Wesen nach eine Fiktion, eine literarische Erfindung sein würde.» So Mario Vargas Llosa über seinen Roman Der Krieg am Ende der Welt, in dem er, gestützt auf den Bericht des brasilianischen Schriftstellers Euclides da Cunha, die Geschichte des Bürgerkriegs in der Provinz Sertão gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts neu erzählt. «Ich beschloß, den vier historischen Episoden, den vier Militärexpeditionen zu folgen und einige der historischen Persönlichkeiten als literarische Gestalten zu verwenden, aber ihre Biographien nicht zu beachten und nur das frei zu übernehmen, was ich für meine Zwecke als brauchbar ansah.» Vargas Llosa benützt nicht nur da Cunhas epochales Werk über den Krieg als Quelle, er läßt da Cunha auch auftreten, und zwar als tragikomische Figur: kurzsichtig, ständig niesend, furchtsam, unheldenhaft und halbblind. Er wird von den Insurgenten gefangen und erlebt ihre letzten Wochen im Hauptquartier Canudos mit. Nur: seine Brille ist zerbrochen. Er ist Augenzeuge, und doch sieht er nichts; er erlebt die Ereignisse aus nächster Nähe, aber so verschwommen, daß er sich keinen Reim auf sie machen kann. Dem Inferno entkommen, widmet er sein Dasein der Aufgabe, zu rekonstruieren, was er erlebt hat, und wird durch seine Nachforschungen allmählich zum einzigen Menschen des Landes, der versteht, was damals im Sertão vor sich gegangen ist.
Im streng historischen Sinn stimmt nichts davon. Euclides da Cunha war kein Kriegsgefangener, er war nicht kurzsichtig, und ob er häufig nieste, ist nicht bekannt. Er war auch nicht gerade ängstlich, sondern focht mehrere Duelle aus, deren letztes er nicht überlebte. Vargas Llosa aber geht es um das Motiv des Nichtbegreifens in all seinen Variationen; wie dem kurzsichtigen Journalisten das Dabeigewesensein nichts nützt, so würde es auch dem Roman nichts nützen, an den Fakten von da Cunhas Biographie zu kleben. Der Krieg am Ende der Welt ist eine Studie über den Umstand, daß die bestimmenden Teile der Gesellschaft einander nicht kennen: Die Regierung glaubt, hinter dem Aufstand stünden adelige Grundbesitzer, weil sie das Phänomen der fanatischen Frömmigkeit der Landlosen nicht begreift, welche mit der Ausrufung der Republik das Reich Satans kommen sehen. Intellektuelle halten diese Bewegung für eine linke Revolution und verstehen nicht, warum gerade die Kirche die vermeintlichen Revolutionäre gegen das Militär unterstützt, für dessen Offiziere der Feldzug wiederum ein willkommener Anlaß ist, gegen den Adel vorzugehen, von dem sie irrtümlich denken, er hätte noch Einfluß und Macht. Die Kurzsichtigkeit des Journalisten im Zentrum all dessen wird zur Chiffre dafür, daß die Wahrheit, wenn überhaupt, erst im nachhinein und aus der Entfernung sichtbar wird und daß das Erzählen, im Unterschied zur Geschichtsschreibung, anderes verlangt als Treue zu den Tatsachen.
Dieser Unterschied zwischen dem bloß faktisch Richtigen und dem Wahren, den jeder historische Roman berührt, steht auch im Zentrum von J.M.Coetzees Neuerzählung der Geschichte von Robinson und Freitag, Mr.Cruso, Mrs.Barton und Mr.Foe. In Coetzees Fassung ist noch eine dritte Person mit auf der Insel: Susan Barton, die an der Küste angeschwemmt und später mit den beiden Männern gerettet wird. Cruso, wie der Einsiedler hier heißt, stirbt auf dem Schiff; zurück in England, sucht Susan den Schriftsteller Foe auf (der mit Daniel Defoe Biographie und Werke teilt), um ihm ihre Erlebnisse zu erzählen, damit er diese aufschreibt und zu einer Geschichte macht. Sie weiß, sie selbst kann das nicht: «Geben Sie mir die Substanz wieder, die ich verloren habe, Mr.Foe: das ist meine inständige Bitte. Denn obwohl meine Geschichte die Wahrheit wiedergibt, gibt sie nicht die Substanz der Wahrheit (ich sehe das klar, wir brauchen uns da nichts vorzumachen). Um die Wahrheit in ihrer ganzen Substanz zu erzählen, muß man Ruhe haben und einen bequemen Stuhl fern von jeder Ablenkung, und ein Fenster, durch das man schauen kann; und dann die Fertigkeit, Wellen zu sehen, wenn man Felder vor Augen hat, und die tropische Sonne zu spüren, wenn es kalt ist; und an den Fingerspitzen die Worte, um mit ihnen die Vision festzuhalten, bevor sie entschwindet. Von alledem habe ich nichts, Sie aber haben alles.» Die Pointe des hintergründigen Romans bleibt unaufgelöst und erschließt sich nur dem Leser, der begreift, daß die Geschichte vom Einsiedler Robinson zwar Weltruhm erlangen wird, Susan Barton aber in ihr nicht mehr vorkommt. Die Umformung des Stoffs zur Geschichte, die Foe auftragsgemäß unternimmt, besteht eben darin, daß er Susan aus ihr eliminiert – wie ich es mit dem armen Carlos Montúfar tun mußte.
Humboldts Bericht von seinem, Bonplands und Montúfars Versuch, am 23.Juni 1802 den Chimborazo zu besteigen, ist eine nüchterne Aufzählung der Fakten, die scheinbar keine Fragen offenläßt, verfaßt im typischen Souveränitätston der Expeditionsbeschreibungen des achtzehnten Jahrhunderts, dem Ton des selbstgewissen Europäers auf Forschungs- oder Eroberungsreise: neugierig, doch von den Strapazen unberührt, diszipliniert, kühl, aloof. In diesem Ton berichtete Samuel Johnson von der schottischen Hebridenwildnis, in diesem Ton tauschten Livingstone und Stanley ihren sprichwörtlich gewordenen Gruß in der Wildnis aus, und erstV.S.Naipaul brachte ihn aus den ehemaligen Kolonien zurück ins Mutterland, als er sich seiner bediente, um die britische Provinz zu schildern.