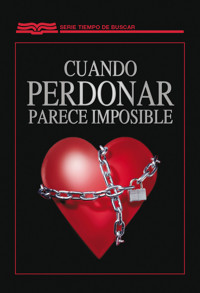Tim Jackson
Wohlstandohne Wachstum– das Update
Grundlagen für einezukunftsfähige Wirtschaft
Herausgegeben von derHeinrich-Böll-Stiftung
Aus dem Englischenvon Eva Leipprand
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Titel der Originalausgabe »Prosperity without Growth. Foundations for the Economy of Tomorrow«© 2016 Tim Jackson, veröffentlicht bei RoutledgeAll Rights ReservedAuthorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group
Deutsche Erstausgabe© 2017 oekom verlag MünchenGesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Über die Herausgeberin: Die Heinrich-Böll-Stiftung ist eine politische Stiftung für grüne Ideen und Projekte. Weitere Informationen unter: www.boell.de
Lektorat: Laura Kohlrausch, oekom verlag; Linda Geßner, kultur.workKorrektorat: Petra KienleSatz: Markus Miller, München
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehalten978-3-96006-184-7
Diese Ausgabe ist Zac, Tilly und Lissy gewidmet: weil Ihr wegen dieses Buches so oft auf mich verzichten musstet; in der Hoffnung, dass Ihr dafür eines Tages etwas aus diesem Buch zurückbekommt.
»Es ist jetzt eure Welt, nutzt die Zeit. Seid Teil von Gutem und lasst Gutes zurück«
The Eagles (»Long Road out of Eden«, 2007)
Inhalt
Liste der Abbildungen
Dank
Vorwort der Herausgeber
Geleitwort zur Neuauflage
1 Die Grenzen des Wachstums
2 Der verlorene Wohlstand
3 Wohlstand neu definieren
4 Das Wachstumsdilemma
5 Der Mythos Entkopplung
6 Das »stahlharte Gehäuse« des Konsumismus
7 Gedeihen – in Grenzen
8 Grundlagen für die Wirtschaft von morgen
9 Auf dem Weg zu einer »Postwachstums«-Makroökonomie
10 Der progressive Staat
11 Bleibender Wohlstand
Anmerkungen
Literatur
Liste der Abbildungen
1.1 Globaler Warenpreisindex, 1992–2015
2.1 Vergleich von Staatsschulden und Schulden des privaten Sektors in den USA, 1955–2015
2.2 Übersicht über das Produktivitätswachstum in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, 1950–2015
3.1 Pro-Kopf-Einkommen und der Indikator echten Fortschritts (GPI)
3.2 Subjektives Wohlbefinden (SWB) und Pro-Kopf-Einkommen
4.1 Lebenserwartung bei der Geburt und Pro-Kopf-Einkommen
4.2 Kindersterblichkeit unter fünf Jahren und Pro-Kopf-Einkommen
4.3 Durchschnittliche Bildungsjahre und Pro-Kopf-Einkommen
4.4 Lebenserwartung in wirtschaftlichen Krisenzeiten
5.1 Jährliche Intensitäten der Kohlendioxidemissionen, 1965–2015
5.2 Jährliche Kohlendioxidemissionen nach Weltregionen, 1965–2015
5.3 Vergleich der Kohlendioxidemissionen in reicheren und ärmeren Ländern, 1965–2015
5.4 Der materielle Fußabdruck der OECD-Länder, 1990–2014
5.5 Globale Trends in der Ressourcenproduktion, 1990–2014
5.6 Kohlendioxidintensitäten: Stand heute und wie für die CO2-Ziele erforderlich
6.1 Der »Motor des Wachstums« in Marktwirtschaften
7.1 Verschuldung der Haushalte und deren Sparraten in Großbritannien, 1990–2016
7.2 Eine evolutionäre Landkarte des menschlichen Herzens
8.1 Treibhausgasintensität versus Beschäftigungsintensität in verschiedenen Sektoren
9.1 Aufstieg und Fall des Wachstums der Arbeitsproduktivität in Großbritannien
9.2 Die stabilisierende Rolle einer antizyklischen öffentlichen Ausgabenstrategie
10.1 Gesundheitliche und soziale Vorteile von Gleichheit
Dank
Bei der Arbeit an diesem Buch, in der ursprünglichen Fassung und der überarbeiteten Ausgabe, haben mich viele Menschen hilfreich unterstützt. Ihnen allen bin ich zu großem Dank verpflichtet.
Die Idee für das Buch ist bei einem Gespräch mit Jonathan Porritt entstanden, der zehn Jahre lang Leiter der Regierungskommission für Sustainable Development war. Kurz nach meiner Ernennung zum Wirtschaftsbeauftragten der Kommission im Jahr 2004 haben wir uns zusammengesetzt, um meine Rolle in der Kommission zu diskutieren. Wir trafen uns in einem Café in Westminster, beide in Eile zwischen anderen Terminen. Es war ein sehr kurzes Treffen, sicher nicht länger als zwanzig Minuten. Aber es legte die Richtung meiner Arbeit für mehr als zehn Jahre fest. Seine Unterstützung für einen Bericht, der die Grundlagen des herrschenden ökonomischen Paradigmas in Frage stellen sollte, war vorbehaltlos und unerschütterlich. Bis heute profitiere ich immens von seiner Klugheit und Erfahrung.
Ebenso wichtig war der Geist der Kameradschaft unter den Kolleginnen und Kollegen der Kommission, sowohl während der Niederschrift als auch nach der Veröffentlichung. Die Mitglieder der Kommission wie auch des Sekretariats schenkten mir großzügig ihre Zeit; sie nahmen an Workshops teil, steuerten kritische Kommentare bei und begutachteten Entwürfe. Victor Anderson, Jan Bebbington, Bernie Bulkin, Lindsey Colbourne, Anna Coote, Peter Davies, Stewart Davis, Sue Dibb, Sara Eppel, Ian Fenn, Ann Finlayson, Tess Gill, Alan Knight, Tim Lang, Andrew Lee, Andy Long, Alice Owen, Elke Pirgmaier, Alison Pridmore, Anne Power, Hugh Raven, Tim O’Riordan, Rhian Thomas, Jacopo Torriti, Joe Turrent, Kay West und Becky Willis gehören zu denen, die mir während der ganzen Zeit unermüdlich mit Rat und Tat zur Seite standen.
Besonderer Dank gebührt denen, die unmittelbar zu einer Reihe von Workshops beigetragen haben, die die Kommission zwischen November 2007 und April 2008 zum Thema Wohlstand veranstaltete. Dazu gehören: Simone d’Alessandro, Frederic Bouder, Madeleine Bunting, Herman Daly, Arik Dondi, Paul Ekins, Tim Kasser, Miriam Kennet, Guy Liu, Tommaso Luzzati, Jesse Norman, Avner Offer, John O’Neill, Tom Prugh, Hilde Rapp, Jonathan Rutherford, Jill Rutter, Zia Sardar, Kate Soper, Steve Sorrell, Nick Spencer, Derek Wall, David Woodward und Dimitri Zenghelis.
Viel Inspiration für die Thesen des Buches habe ich durch die herzliche Zusammenarbeit mit zahlreichen Freundinnen und Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen gewonnen, die ich in den letzten zehn Jahren genossen habe. Es ist ein besonderes Privileg, dass ich während der Arbeit an dem Buch drei große Forschungskooperationen an der Universität von Surrey leiten durfte: die Research Group on Lifestyles, Values and the Environment (RESOLVE), die Sustainable Lifestyles Research Group (SLRG) und seit kurzem das Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP). Sie haben das intellektuelle Fundament geliefert, auf dem so viel an Erkenntnis aufgebaut wurde.
Mein persönlicher Dank gilt zahlreichen Kolleginnen und Kollegen an der Universität von Surrey und anderswo, die an diesen Projekten teilnahmen und sie unterstützten. Alison Armstrong, Tracey Bedford, Kate Burningham, Phil Catney, Mona Chitnis, Ian Christie, Alexia Coke, Geoff Cooper, Will Davies, Rachael Durrant, Andy Dobson, Angela Druckman, Birgitta Gatersleben, Bronwyn Hayward, Lester Hunt, Aled Jones, Chris Kukla, Matt Leach, Fergus Lyon, Scott Milne, Yacob Mulugetta, Kate Oakley, Ronan Palmer, Debbie Roy, Adrian Smith, Steve Sorrell, Andy Stirling, Sue Venn, David Uzzell, Bas Verplanken und Rebecca White gehören zu denen, mit denen mich nicht nur ein gemeinsames Programm, sondern auch ein intellektuelles Denken verband, das immer offen und fruchtbar war, selbst, wenn wir in Einzelheiten einmal unterschiedlicher Meinung waren.
Unsere gemeinsame Forschungsarbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die unermüdliche und freundliche Mithilfe unserer verschiedenen Unterstützerteams: Wendy Day, Marilyn Ellis, Claire Livingstone und Moira Foster müssen allesamt erwähnt werden. Besonderer Dank geht an Gemma Birket für ihre zentrale Rolle bei der Organisation eines manchmal wirklich abenteuerlichen Terminkalenders und für ihre Fähigkeit, angesichts von Stürmen aller Art eine unglaubliche Ruhe zu bewahren.
In der Folge der ersten Ausgabe erfuhr ich derart breite Unterstützung von so vielen Kollegen und Freunden, dass ich hier unmöglich alle aufzählen kann. Von den unwahrscheinlichsten Orten nahmen Leute Verbindung mit mir auf, und die Wärme, mit der sie mein Buch aufnahmen, bleibt mir eine wichtige Hilfe bei der Einschätzung und Weiterentwicklung dieser Arbeit. Von dem Leiter der Sterbeklinik, der zwischen meiner Kritik des Konsumismus und den Problemen der Menschen in seiner Obhut Parallelen zog, bis zu der Augustinernonne, die mir in ihrem Brief von den Ansichten des Thomas von Aquin zum Gemeinwohl erzählte; von dem Wirtschaftsprofessor, der sich bei mir bedankte, weil ich ein Tabu brach, das er nie verstanden hatte, bis zu der Großmutter, die ihre Kinder bereits in den 1960er-Jahren nach den Prinzipien eines einfachen Lebensstils erzogen hatte; von den Schülerinnen und Schülern und Studierenden an der Universität, die mich zu Vorträgen einluden, bis zu Investmentmanagern, die bereit waren, zuzuhören und ihre Meinung zu ändern: Diese persönlichen Reaktionen bedeuteten mir mehr als die vielen tausend Seiten wissenschaftlicher Analyse und Kritik an den Grenzen der »Entkopplung«.
Ich will nicht versäumen, zumindest einige namentlich zu erwähnen, auf deren intellektuellen Beitrag in den sechs Jahren seit der ersten Ausgabe ich auf keinen Fall hätte verzichten können. Ideen, Podien und Zeit teilte ich unter anderem mit Charlie Arden-Clarke, Alan Atkinson, Mike Barry, Nathalie Bennet, Catherine Cameron, Isabelle Cassiers, Bob Costanza, Ben Dyson, Ottmar Edenhofer, Marina Fischer-Kowalski, Duncan Forbes, John Fullerton, Ralf Fücks, Connie Hedegaard, Colin Hines, Andrew Jackson, Giorgos Kallis, Astrid Kann Rasmussen, Roman Krznaric, Satish Kumar, Michael Kumhof, Christin Lahr, Phillippe Lamberts, Anthony Leiserowitz, Caroline Lucas, Joan Martinez-Alier, Jaqueline McGlade, Dennis Meadows, Dominique Meda, Peter Michaelis, Meinhard Miegel, Ed Milliband, Frances O’Grady, Hermann Ott, Kate Power, Fabienne Pierre, Paul Raskin, Kate Raworth, Bill Rees, Johan Rockström, Gerhard Schick, François Schneider, Juliet Schor, Thomas Sedlacek, Gus Speth, Achim Steiner, Pavan Sukhdev, Any Sulistyowati, Adair Turner, Barbara Unmüßig, Adam Wakeling, Joan Walley, Steve Waygood, Ernst von Weizsäcker, Anders Wijkman und Rowan Williams. Natürlich haben sich ihre Ansichten nicht immer restlos mit meinen gedeckt. Und doch war ihre intellektuelle Leidenschaft eine so starke Ressource, dass ich ihnen aufrichtigen Dank schulde.
Ich danke Tommy Wiedmann, Tomas Marques, Neeyati Patel, Janet Salem, Heinz Schandl und den Kolleginnen und Kolleginnen bei CSIRO, SERI und UNEP für ihre großzügigen Beiträge zu meinem überarbeiteten Entkopplungskapitel. Es ist interessant zu sehen, wie viel sich in dieser Debatte in den letzten zehn Jahren getan hat. Wenn ich mir in Erinnerung rufe, was für ein Kampf das vor acht Jahren war, brauchbare Daten zum materiellen Fußabdruck zusammenzusuchen, dann sind diese Beiträge das außerordentliche Zeugnis eines unglaublich wertvollen internationalen Forschungsprogramms. Heute ist die Argumentation, was die Rolle des Handels bei der Verschleierung der Ressourcenabhängigkeit reicher Länder betrifft, allgemein akzeptiert, was nicht zuletzt diesen versammelten Arbeiten zuzuschreiben ist.
Sehr persönlich bin ich Peter Victor zu Dank verpflichtet, dessen intellektuelle Begleitung meine eigene Entwicklung in den letzten sieben Jahren entscheidend beflügelt hat und eine Quelle der Inspiration war für diese zweite Auflage. Dass Peter und ich bei der Entwicklung einer »Postwachstumsökonomie« zu einer gemeinsamen Sicht gekommen sind, war ein zusätzliches positives Ergebnis der Tatsache, dass er schon früh an meiner SDC-Arbeit beteiligt war. Dass wir so viele andere Interessen gemeinsam hatten, war eine unerwartete Dreingabe. Besonderen Dank auch an Peters Frau, Maria Paez Victor, die unsere wochenlangen Gespräche mit ruhigem Gleichmut ertrug, nicht ohne immer wieder mit ihrer wunderbar scharfen Kritik am westlichen Kapitalismus dazwischenzugehen.
Ich hatte das Glück, während der Produktion von Wohlstand ohne Wachstum nicht nur mit einem, sondern gleich mit drei separaten Redaktionsteams zu arbeiten: zuerst mit Kay West, Rhian Thomas und Andy Long bei der SDC; dann mit Jonathan Sinclair-Wilson, Camille Bramall, Gudrun Freese, Alison Kuznets und Veruschka Selbach bei Earthscan; und jetzt mit Neil Boon, Andy Humphries, Cathy Hurren, Rob Langham, Laura Johnson, Umar Masood, Adele Parker and Nikky Twyford bei Routledge. Ihnen allen schulde ich großen Dank für ihre Sachkenntnis, Sorgfalt im Detail und ihr geduldiges Verständnis.
Und schließlich möchte ich meiner Partnerin Linda immerwährende Dankbarkeit aussprechen; ihre persönliche und professionelle Unterstützung hat mir angesichts der unerwarteten Herausforderungen der letzten Jahre ungemein viel Kraft gegeben. Besonders dankbar bin ich dafür, dass wir beide Freude daran haben, einfach nur so zu gehen: an Flüssen entlang, durch Wälder und Täler, auf die Berge hinauf. Die besten Gedanken kommen einem beim Gehen, wie Satish Kumar mir einmal erzählte (das hat er vielleicht von Nietzsche).
Vorwort der Herausgeber
Mit dieser Fortsetzung seines erfolgreichen Buches Wohlstand ohne Wachstum aktualisiert Tim Jackson seine brillante Kritik unseres Wirtschaftssystems und erweitert sie um neue Erkenntnisse und Aspekte. In den Händen halten wir erneut eine schonungslose Analyse, die den ökologischen und sozialen Preis unseres auf Wachstum basierenden Wohlstandsmodells benennt.
Zusehends erleben wir, dass der Kapitalismus und die Art und Weise, wie er Ungerechtigkeit und soziale Spaltungen erzeugt, die Demokratie gefährdet. Auch diesen Zusammenhang beschreibt Jackson in seinem Buch; und er zeigt uns darüber hinaus, wie eng die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Dimensionen unseres Lebens miteinander verwoben sind. Jede »ökologische Makroökonomik«, deren Elemente auch Jackson ansatzweise beschreibt, wird nicht umhinkönnen, diese Verwobenheit in den Blick bzw. in ein neues Denken für eine andere Ökonomik aufzunehmen.
Seit Jackson 2011 in seiner ersten Kritik an unserem Wachstumsmodell das Dilemma, dass diesem zugrunde liegt, beschrieb, sind wir seiner Überwindung nicht nähergekommen: Wie wir wirtschaftliche und damit auch politische Stabilität erhalten und gleichzeitig in den ökologischen Grenzen bleiben können, wissen wir auch heute nicht wirklich. Trotz allen Fortschreitens der erneuerbaren Energien rund um den Globus emittieren wir so viel wie noch nie – und zwar von Kohlenstoff bis Müll aller Art.
Wirtschaftswachstum, wie wir es kennen, ist ökologisch nicht zukunftsfähig. Durch unsere Produktions- und Konsummuster verbrauchen wir viel zu viele Ressourcen, heizen das Klima an und zerstören kontinuierlich Ökosysteme. Mit technischem Fortschritt können wir zwar die Arbeitsproduktivität und auch die Ressourceneffizienz erhöhen. Doch soll das nicht in massenhafter Arbeitslosigkeit und in einer Rezessionsspirale münden, braucht es bislang Wachstum und Massenkonsum.
Mit der Digitalisierung hat die nächste technologische Revolution begonnen; sie veranschaulicht ganz aktuell das Wachstumsdilemma: Mit der Automatisierung werden ganz verschiedene Arbeitsbereiche, eben nicht nur die der Industriearbeit, sondern auch der Dienstleistungsbranche von Arbeitsplatzverlusten betroffen sein. Wie werden wir damit umgehen? Wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität, das wird – so die klassische Ökonomietheorie – nur mit mehr Wachstum zu erhalten sein. Effizienz und technologischer Fortschritt sind zugleich Ergebnis und Treiber von Wirtschaftswachstum. Doch wir wissen, dass die Entkoppelung der Wirtschaftsleistungen vom Ressourcen- und Materialverbrauch nach wie vor ein Mythos ist. Die Industrie 4.0 – so auch die deutsche Forschungsministerin – wird eine drastische Nachfrage nach wirtschaftsstrategischen Rohstoffen nach sich ziehen.
Doch in einer begrenzten Welt kann kontinuierliches Wachstum nicht funktionieren. Die planetarischen Grenzen sind in vielen Bereichen schon überschritten, in anderen bald erreicht. Wir brauchen deshalb dringend eine breite gesellschaftliche Debatte über Auswege aus der Wachstumsfalle. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich auch der Umgang und das Nachdenken über die Gegenwart und die Zukunft von Technologien. Welche sind zukunftsfähig und menschlich zugleich? Wie sind und bleiben sie demokratisch kontrollierbar?
Das Ei des Kolumbus gibt es nicht, und wir sollten uns nicht von der Illusion leiten lassen, dass wir es vielleicht doch finden könnten. Aber Ideen für den nötigen Wandel, neue Praktiken und alternative Wirtschaftsweisen entstehen allerorten. Tim Jackson gibt in seinem Buch zu all diesen Herausforderungen wesentliche Denkanstöße. Viele Menschen auf der Welt teilen seine Analyse, dass das derzeitige Modell unseres Wirtschaftens keine Zukunft haben kann und seinen utopischen Gehalt zu verlieren beginnt.
Langsam dämmert uns auch in Deutschland, dass unsere Vorreiterrolle in Sachen Umweltschutz und ökologischer Politik vielleicht doch nur eine Illusion ist, wenn auch im Jahr 2016 die CO2-Emissionen gestiegen sind und unser Ressourcenverbrauch bei vierzig Tonnen pro Kopf und Jahr liegt, wo doch höchsten sechs Tonnen einigermaßen gerecht und nachhaltig wären.
Die Abhängigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft vom Wachstum ist immens. Diese strukturellen und systemischen Zwänge deckt Tim Jackson auf; und er beschreibt, wie schwierig und komplex ein Weg aus der Wachstumsfalle ist. Diesen Umstand nutzen nationalistische und rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker für sich aus, beschwören ein diffuses Modernisierungsversprechen und leugnen den Klimawandel und die Ressourcenknappheit. Ohne Konflikte, ohne hartes Aushandeln und ohne Widerstand wird es jedenfalls keine soziale und ökologische Transformation geben.
Wie sieht eine Wirtschaft aus, die die Menschenrechte und die planetarischen ökologischen Grenzen achtet, globale Gerechtigkeit und ein Leben in Würde für alle Menschen ermöglicht? Die Antwort auf diese Frage muss wieder demokratisch diskutiert und ausgehandelt werden. Auch Tim Jackson stellt diese Frage und gibt Anstöße für mögliche Antworten. Ich schätze mich glücklich, ihn als Mitstreiter an unserer Seite zu haben, und wünsche diesem Buch sehr viele Leserinnen und Leser.
Berlin, im Frühjahr 2017
Barbara UnmüßigVorstand der Heinrich-Böll-Stiftung
Geleitwort zur Neuauflage
»Ökonomen sind Geschichtenerzähler und Gedichteschreiber.«
D. McCloskey1
Am Abend des 27. März 2009 – es war ein Freitag – wehte ein kalter Wind und es nieselte leicht, als ich von der Arbeit nach Hause ging. Es war eine lange Woche gewesen, und als mein Telefon klingelte, fühlte ich mich so müde, dass ich schon überlegte, ob ich überhaupt drangehen sollte. Ich wusste aber, dass mich ein paar Journalisten noch zu erreichen versuchten, um mit mir über meinen Bericht für die britische Regierungskommission für Sustainable Development (SDC) zu sprechen. Dieser Bericht sollte am Montag darauf veröffentlicht werden.2
Wohlstand ohne Wachstum? (zum Fragezeichen komme ich gleich) entstand aus einer über einen langen Zeitraum hinweg durchgeführten Untersuchung zum Verhältnis von Wohlstand und Nachhaltigkeit, die ich für den SDC leitete. Im Zentrum der Untersuchung stand eine ganz einfache Frage: Was kann Wohlstand in einer Welt der ökologischen und sozialen Grenzen bedeuten?
In der konventionellen Sichtweise geht man davon aus, dass wirtschaftliche Expansion zu steigendem Wohlstand führt. Höhere Einkommen bedeuten mehr Lebensqualität. Diese Gleichung klingt vertraut und selbstverständlich. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass der materiellen Expansion auf einem endlichen Planeten zwangsläufig irgendwo Grenzen gesetzt sind. Eine wachsende Bevölkerung mit unersättlichen materiellen Ansprüchen ist schwer vereinbar mit der endlichen Natur unserer Heimat Erde.
Angesichts dieser Grenzen bleiben uns nur zwei Möglichkeiten. Wir müssen entweder Schritt für Schritt den materiellen Gehalt aus dem Prozess der wirtschaftlichen Ausdehnung hinauszwingen, sodass wir unsere Volkswirtschaften weiter am Wachsen halten können, ohne den Planeten zu ruinieren, oder wir müssen lernen, wie man zu Wohlstand findet, ohne dabei auf wirtschaftliches Wachstum zu bauen.3
Keiner der beiden Wege ist leicht. Und auch die Wahl zwischen beiden ist nicht einfach. Kontrafaktische Annahmen verschleiern die einfache Logik. Physik, Ökonomie, Politik, Soziologie und Psychologie – alle erheben Anspruch, sich an der Argumentation zu beteiligen. Damit das alles trotzdem einen Sinn ergibt, braucht man die Bereitschaft, überlieferte Weisheiten zu hinterfragen, und den festen Vorsatz, gewohnte Axiome zu meiden. Zudem muss man auch bis zu einem gewissen Grad für die Möglichkeit politischen und gesellschaftlichen Wandels offen sein.
Als ich an jenem Abend nach Hause ging, war mir bewusst, dass aus unserer Arbeit eine ziemlich komplexe Geschichte hervorgegangen war. Und kontrovers war sie auch. Mehr als 60 Jahre lang hatte die Nachkriegspolitik steif und fest behauptet, dass es auf die Größe der Wirtschaft ankommt; dass Mehr immer besser ist. Nun ist die Feststellung, Qualität sei manchmal besser als Quantität, nicht gerade revolutionär. Aber die Vermittlung einer solchen Botschaft war auf jeden Fall eine heikle Aufgabe, selbst zum günstigsten Zeitpunkt. Und günstig war der Zeitpunkt gerade wirklich nicht.
Die Woche der Veröffentlichung fiel mit dem G20-Gipfel zusammen – dem zweiten, der je abgehalten wurde; Gastgeber war die britische Regierung in London. In den Nachwehen der schlimmsten Finanzkrise der jüngeren Geschichte war das informelle Ziel des Gipfels, die Wirtschaft wieder zu beleben. Eine Presseverlautbarung, die in aller Höflichkeit das Wachstum in Frage stellte, war vielleicht nicht die beste Methode für eine Regierungskommission, in den oberen Rängen Freunde zu finden.
Wie heikel das alles war, war uns durchaus bewusst. Von dem Augenblick an, als wir ankündigten, eine Untersuchung zum Verhältnis von Wachstum und Nachhaltigkeit durchzuführen, regnete es skeptische Kommentare auf die Kommission. Ich erinnere mich an eine öffentliche Versammlung, in der ein offizieller Vertreter des Finanzministeriums, als er von dem Vorhaben erfuhr, aufstand und uns vorwarf, wir wollten »wieder zurück und in Höhlen leben«.
Angesichts der schwierigen Situation hatte sich bereits die Titelfindung als kompliziert erwiesen. Meine Kolleginnen und Kollegen in der Kommission waren allesamt hocherfahrene, unabhängig denkende Menschen, die keinerlei Problem damit hatten, ihre Ansicht zu vertreten, wenn strittige Themen auf dem Tisch lagen. Da wir alle hinter der Argumentationslinie des Berichts standen, hatte sich, gemessen an unseren sonstigen Beratungen, eine noch nie dagewesene Solidarität entwickelt. Was den Titel betrifft, gab es aber doch Unbehagen unterschiedlichen Grades.
Ohne das Fragezeichen (mein ursprünglicher Vorschlag) kündigte Wohlstand ohne Wachstum ein Manifest für den Wandel an. Im damaligen Klima von Angst und Besorgnis war das aber schon fast ein Spiel mit dem Feuer. Verschiedene Alternativen wurden vorgeschlagen. Ob wir das Wort »Wachstum« irgendwie modifizieren könnten? Wäre »jenseits« vielleicht besser als »ohne«? Könnten wir vielleicht auch mit einem ganz anderen Titel leben – insgesamt weniger provozierend? Keiner dieser Vorschläge war wirklich zufriedenstellend.
Das Fragezeichen stellte einen Kompromiss dar. Es hatte den Vorteil, den Ton etwas zu mildern, ohne die Wucht der Arbeitsergebnisse ganz auszublenden. In dieser Form war der Titel eine Einladung zu einer wichtigen Debatte, vielleicht der wichtigsten Debatte unserer Zeit, ohne jedoch den Ausgang schon vorwegzunehmen: Kann eine Gesellschaft gedeihen, ohne dass die Wirtschaft unentwegt wächst? Schließlich akzeptierten unsere Sponsoren im Ministerium den Kompromiss, unter der Bedingung, dass wir ihn probeweise einem der Berater des Ministers vorlegten.
Es klingt vielleicht merkwürdig, dass eine unabhängige Kommission einen derartigen Aufwand treiben muss, um die Ängste ihrer Geldgeber zu beruhigen. Das ist aber Realpolitik. Wer vollkommene Unabhängigkeit will, muss auf dem freien Markt publizieren. Will man Einfluss haben, muss man gelegentlich auf seine Geldgeber Rücksicht nehmen. Deshalb braucht man noch lange nicht immer nur das zu sagen, was die Minister hören wollen. Will man aber seine Rolle als Berater behalten, sollte man vor den Stieren in der politischen Arena lieber doch nicht allzu viele rote Tücher schwenken.
Unsere Position als »kritischer Freund« der britischen Regierung beruhte auf einer fragilen Vertrauensbasis zwischen Berater und Auftraggeber. Beim Abfassen des Berichts hatten wir unsere Ergebnisse den betroffenen Regierungsabteilungen in jeder Phase vorgestellt und die Tragweite diskutiert. In diesem letzten Stadium des Verfahrens gaben wir dem Büro des Premierministers nun praktisch die Möglichkeit, gegen den Titel ein Veto einzulegen.
Die Antwort, die zurückkam, war beruhigend. »Meiner Meinung nach spielt es keine Rolle, was für einen Titel Sie dem Bericht geben«, sagte der Referent. »Gut«, dachten wir. Im festen Vertrauen, dass wir alle notwendigen Schritte eingehalten hatten, setzten wir unsere Pressemittteilungen auf, entwarfen eine PR-Strategie, informierten Journalisten; dabei versuchten wir die Feinheiten der Debatte so gut wie möglich zu vermitteln, ohne die Geduld der Medien überzustrapazieren. Auch dies gehört zur Maschinerie der politischen Beratung.
In dem Augenblick, als an jenem feuchtkalten Märzabend das Telefon klingelte, lag das alles schon mehr oder weniger hinter mir. Und abgesehen von der Bearbeitung der einen oder anderen Presseanfrage sah ich ein ruhiges Wochenende vor mir, einen Hort relativer Stille, bevor es dann am Montag früh losgehen würde mit einem Interview für BBC Today. Ich entschied mich, den Anruf anzunehmen.
»Downing Street ist total ausgerastet«, bellte eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Die Stimme klang feindselig. Das war eindeutig nicht der Journalist, mit dem ich gerechnet hatte, und auch nicht die erwartete Mitteilung. Ich erkannte den Anrufer aber sofort. Es war genau der Mann, der bis dahin unser engster Verbündeter in der Regierung gewesen war, ein wichtiger Geldgeber des SDC und begeisterter Unterstützer unserer Arbeit. Innerhalb von Sekunden war klar, dass nichts mehr wie vorher war.
Die täuschend einfache Antwort des Referenten aus der Downing Street Nummer 10 (dem britischen Regierungssitz) war genau das gewesen: eine Täuschung. Wie sich herausstellte, saß der betreffende Referent gerade in einem Flugzeug nach China, als Prosperity without Growth? (mit dem versöhnlichen Fragezeichen) unangekündigt auf dem Schreibtisch des Premierministers landete. Wenige Tage später würden die G20-Führer in London zusammenkommen, um »das Wachstum wieder anzukurbeln«. »Was habt ihr euch bloß dabei gedacht?« brüllte unser ehemaliger Verbündeter.
Im Rückblick betrachtet war das eine gute Frage. Waren wir so naiv gewesen, zu glauben, man könne ungestraft derart fundamentale Fragen stellen? Vielleicht. Hatten wir die Doppeldeutigkeit in dem aus der Downing Street erhaltenen Rat übersehen? Offensichtlich. Hatten wir überstürzt gehandelt, als wir ein derart sensibles Veröffentlichungsdatum wählten? Möglicherweise. Es war natürlich schon ziemlich gewagt, einen Bericht mit einem solchen Titel genau in der Woche des G20-Treffens herauszugeben. Was hat es aber für einen Sinn, wenn man eine starke politische Botschaft hat und sich nicht traut, sie den Menschen zu überbringen, für die sie gedacht ist?
War es ein Fehler, das Wort Wachstum überhaupt zu verwenden, im Kontext des Finanzchaos, mit dem die G20-Führer zu kämpfen hatten? Ganz sicher nicht. In dem Augenblick, in dem es nicht mehr erlaubt ist, die grundlegenden Voraussetzungen eines Wirtschaftssystems zu hinterfragen, das ganz offensichtlich nicht funktioniert, ist der Moment erreicht, wo die politische Freiheit endet und die kulturelle Unterdrückung beginnt. Es ist auch der Moment, in dem die Chancen für Veränderung signifikant, vielleicht sogar endgültig, beschnitten werden.
Downing Street war eindeutig anderer Ansicht. Und zu dieser späten Stunde konnte ich wenig tun, um unseren durchgedrehten ehemaligen Verbündeten zu beruhigen. Die Pressesperre galt bis Montag früh. Aber der Bericht war längst draußen. Selbst wenn wir gewollt hätten, gab es jetzt kein Zurück mehr. Ich äußerte eine höfliche Entschuldigung und ging nach Hause. Später sprach ich noch mit einem Journalisten. Wir unterhielten uns lange und mit unerwarteter Begeisterung; das Gespräch endete mit dem Versprechen einer Titelgeschichte über den Bericht im Großformat.
Am Montag, dem 30. März, stand ich morgens um halb sechs auf und war kurz darauf auf dem Weg zu den BBC-Studios in der Universität von Surrey, um das Interview für das Today-Programm zu machen. Während mir das Wort »ausrasten« immer noch durch den Kopf ging, versuchte ich, mir in etwa vorzustellen, was das für ein Sturm der Entrüstung sein würde, der nun losbrach.
Und wieder wurden meine Überlegungen durch einen Telefonanruf unterbrochen. Keine wütenden Stimmen diesmal, nur eine schlichte Nachricht. Das Interview war abgesagt. Der Sendeleiter entschuldigte sich. Es war eine wichtige Geschichte dazwischengekommen, die den Wahlkreis von Kirkcaldy und Cowdenbeath in Schottland betraf, den Wahlkreis des Premierministers. Nun musste eben diese Geschichte ins Programm.
Verwundert, aber nicht übermäßig besorgt ging ich in mein Büro auf dem Campus, wo ich die Morgennachrichten durchging. Übers Wochenende hatte die Regierung angekündigt, dass die Dunfermline Building Society zerschlagen und verkauft werden sollte. Trotz des Widerstands des Dunfermline-Aufsichtsrates, der sich als Opfer von Zweckmäßigkeitserwägungen sah, war im Rahmen der Bestimmungen eines neuen Bankgesetzes eine Vereinbarung durchgepeitscht worden, mit dem erklärten Ziel, helfend auf die Finanzkrise zu reagieren. Die Bank of England würde die risikobehafteten Vermögenswerte übernehmen und was übrigblieb sollte eine andere Bank aufkaufen. Verluste an Arbeitsplätzen waren wohl unvermeidlich. Davon lagen manche (wie sich dreieinhalb Jahre später herausstellte) tatsächlich in Cowdenbeath, dem Wahlkreis des Premierministers. Das also war die Geschichte, die uns die Schau gestohlen hatte.4
Im Lauf der Woche entwickelte sich das, was als frustrierender Rückschlag begonnen hatte, zunächst verwirrend und dann nachgerade bizarr. Es gab keine begeisterte Titelgeschichte im Großformat. Das Today-Programm kam nicht mehr auf unser Thema zurück. Auch von anderen Radio- oder Fernsehsendern kam nichts. Es gab überhaupt nirgendwo eine Berichterstattung. Eine verdeckte Erwähnung in einem Artikel über den Grünen Stimulus war alles, was Prosperity without Growth? bis Anfang April 2009 in den nationalen Medien an Wirkung hinterlassen hatte.
*****
Sieben Jahre später sitze ich hier Ende Mai in der warmen Nachmittagssonne und denke darüber nach, was das doch für eine außergewöhnliche Reise bis heute war. Rückblicke sind immer heilsam. Ich erinnere mich an den ersten Satz des titelgebenden Erzählers in dem Film Der Mittler (The Go Between): »Die Vergangenheit ist ein anderes Land«, sagt er. »Dort macht man alles anders.«
Ohne das Internet, denke ich, hätte diese Reise vielleicht nie angefangen. Zwischen einer Regierung, die nicht wollte, und den Medien, die nichts begriffen, schien das Schicksal von Prosperity without Growth? besiegelt: Es würde im Nichts verschwinden. Irgendwann aber, nach dem unheimlichen Schweigen, das auf den »Launch« folgte, fingen die Leute an, den Bericht von der SDC-Website herunterzuladen.
Innerhalb kurzer Zeit war er so oft heruntergeladen worden wie kein anderer Bericht in der Geschichte der Kommission. Allmählich tröpfelten Einladungen zu Diskussionen und Arbeitsberichten herein. Bedauerlicherweise nicht von unseren Geldgebern bei der Regierung. Zunächst auch nicht von den zu erwartenden Sympathisanten. Das Interesse kam stattdessen von einer kuriosen Mischung eher ungewöhnlicher Verdächtiger. Anti-Armuts-Aktivisten, Vermögensverwalter, Glaubensgemeinschaften, Verbraucherorganisationen, Theatermanager, Ingenieure, Erzbischöfe, Diplomaten, Museen, Literaturgesellschaften und auch das eine oder andere Mitglied der königlichen Familie. Aus dem Tröpfeln wurde sehr bald eine Flut – eine Flut, die bis heute noch nicht wirklich nachgelassen hat.
Sechs Monate nach seinem Fehlstart wurde eine überarbeitete Version des SDC-Berichts bei Earthscan veröffentlicht, einem kleinen unabhängigen Verlag mit langjährigem Engagement für Literatur aus dem Bereich Ökologie. Jonathan Sinclair Wilson, der Geschäftsleiter von Earthscan, hatte den SDC-Bericht kurz nach seinem Erscheinen gelesen und sah viel früher als ich, dass darin das Potenzial für ein Buch steckte.
Sein Vertrauen wurde belohnt. Innerhalb der ersten paar Wochen nach Erscheinen war die erste Auflage vergriffen und es wurde bereits über die erste von später dann 17 Übersetzungen in andere Sprachen verhandelt. Anfang 2010 war Prosperity without Growth nicht länger ein umstrittener Regierungsbericht, der von der Ungnade seiner Geldgeber getroffen dahindümpelte, sondern ein unerwartet populäres Buch mit einer überraschend aufgeschlossenen Leserschaft.
*****
Eine der größten Überraschungen war das internationale Echo auf das Buch. Im Ausland war es vielleicht noch populärer als zu Hause. In Frankreich und Belgien brachte es sich in die lebhafte Debatte rund um die Veröffentlichung von Arbeiten der Sarkozy-Kommission zur Messung sozialen Fortschritts ein. In Deutschland leistete es einen Beitrag zur Einsetzung einer offiziellen Enquetekommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität«. Im Jahre 2011 legte die Bundeszentrale für Politische Bildung das Buch neu auf und machte es zu Bildungszwecken frei verfügbar.5
Das Interesse war auch nicht auf die fortgeschrittenen Volkswirtschaften beschränkt. Zu den 17 fremdsprachigen Übersetzungen zählten auch Ausgaben in Chinesisch, Koreanisch, Litauisch und brasilianischem Portugiesisch.
Ein junger Ökonom aus Indonesien lud mich zu einem Gespräch mit einer Gruppe von Regierungswirtschaftlern ein, die an der Entwicklung eines »hundertjährigen« Planes für die Provinz Papua beteiligt waren. Ich hatte meine Bedenken, in einem Land mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 3.500 Dollar wirtschaftliches Wachstum in Frage zu stellen, und sagte ihm das auch.
Der Gedanke, zu einer Diskussion um einen hundertjährigen Plan beizutragen, war aber irgendwie doch zu verlockend. Also verbrachte ich einen halben Tag mit der Gruppe in einer Skype-Konversation. Ihre Prämissen waren einfach: Wir haben reiche natürliche Ressourcen, eine enorme Entwicklungsaufgabe und den Wunsch, unsere eigene Vorstellung von Wohlstand zu schaffen und nicht einfach den zerbrochenen Traum des Westens auszuleihen. Wie können wir das hinbekommen?
Im November 2013, bei einer UN-Konferenz in New York, hielt ich vor einem internationalen Publikum eine zwanzigminütige Grundsatzrede über das »Wachstumsdilemma«. Die Debatte dauerte vier Stunden. Anschließend an meine »Provokation« wandte sich der Moderator an eine Ministerin aus Ecuador. »Ist die Wachstumsdebatte nur eine Luxusangelegenheit der Länder, die bereits Wachstum hinter sich haben?«, wollte er wissen. Die Antwort war ein entschiedenes Nein. »Wenn Wachstum bedeutet, einen Zustand in der Gesellschaft zu erreichen, in dem Eigensucht und Konsum die Grundlage sind, dann wollen wir nicht wachsen«, antwortete meine Mitdiskutantin auf dem Podium. »Das Modell, das wir vorschlagen, basiert nicht auf Konsum, sondern auf Solidarität, auf nachhaltiger Entwicklung, auf einem Wandel des Wachstumsparadigmas«, erklärte sie.6
Das ecuadorianische Konzept des buen vivir hat derart auffallende Übereinstimmungen mit dem Wohlstandskonzept im ursprünglichen Bericht, dass ich mich sofort davon angezogen fühlte. Umgekehrt war das wahrscheinlich genauso. Vier Stunden später, in einem leicht surrealen, postmodernen Moment, kam die gesamte Abordnung des Parlaments von Ecuador zu mir und wollte sich mit mir zusammen für einen Post auf Instagram fotografieren lassen.7
Die britische Regierung war zutiefst unglücklich mit ihren lästigen Beratern. Die Kommission selbst wurde ein frühes Opfer des Wachstumsstrebens. Lob von offizieller Seite gab es nicht; stattdessen hatte sich aber ein geradezu unstillbarer Wunsch ganz normaler Menschen offenbart, auf der ganzen Welt und in fast allen Schichten, den höchst gefährlichen Mythos genauer unter die Lupe zu nehmen, auf dem die moderne Gesellschaft beruht: dass nämlich eine Ausdehnung der menschlichen Aktivitäten auf dem Planeten Erde bis ins Unendliche möglich sei. Viele merkten, wie hanebüchen diese bequeme Geschichte war.
Irgendwann gab ich auf, die Intensität dieser Debatten oder die ganz unerwartete Reaktion auf das Buch berechnen oder erklären zu wollen. Allmählich wurde mir klar, dass es sich hier ganz einfach um eine Diskussion handelte, deren Zeit gekommen war. Oder genauer gesagt: deren Zeit wiedergekommen war.
Bei einem Treffen am ungarischen Plattensee richtete ein bärtiger Amerikaner eine Kamera auf mein Gesicht und ich hörte den Auslöser klicken. Das ist für unser Schwarzes Brett, sagte er. Er stellte sich als Dennis Meadows vor, Mit-Autor des einflussreichen Berichts Grenzen des Wachstums an den Club of Rome, der vor fast vierzig Jahren veröffentlicht worden war. Am nächsten Tag schenkte er mir eine signierte Erstausgabe des Buches, mit der Bemerkung, das sei das letzte Exemplar, das er noch hatte.
Die Veteranen jener frühen Debatten waren überglücklich, dass sich endlich eine Regierungskommission der Fragen angenommen hatte, die sie ihr ganzes Leben lang gestellt hatten. Es war aber keineswegs eine Debatte aus alten Zeiten. In Vortragssälen überall in Europa versammelten sich Jung und Alt zu Hunderten, begierig, sich mit einem offiziellen Bericht zu befassen, der es gewagt hatte, das Unsagbare auszusprechen. Ich fühlte mich etwas beschämt und oft auch irgendwie überwältigt.
Besonders bewegend waren die Studierenden der Wirtschaftswissenschaft, von denen viele geduldig auf den Stufen des Hörsaals saßen, manchmal sogar hinter mir auf dem Podium, und auf die Chance warteten, sich an der Debatte zu beteiligen. Danach sprachen sie mich dann auf den Fluren an.
»Wie kommen wir denn an so eine Wirtschaftswissenschaft?«, fragten sie. »Wir studieren jetzt schon fast drei Jahre, und noch nie sind diese Themen in unseren Kursen behandelt worden.« Ich verwies sie dann auf die Klassiker: Hermann Dalys Steady State Economics, Fred Hirschs Social Limits to Growth und den ursprünglichen Bericht Grenzen des Wachstums. Alles Texte, die ihnen ihre Professoren längst hätten vorstellen müssen.
Manche Studenten legten die Thesen gleich ihren Dozenten vor. Darin lag eine Logik, aber auch eine gewisse Ironie. Denn wenn es irgendetwas gibt, von dem ein Wirtschaftsprofessor etwas verstehen sollte, dann ist es das Gesetz von Angebot und Nachfrage; und wenn diese jungen Leute nun anfingen, eine andere Wirtschaftswissenschaft nachzufragen, würden ihre Professoren sie früher oder später auch anbieten müssen.
Meist waren diese Diskussionen rational, intelligent und freundlich. Gelegentlich gab es ein paar Durchgedrehte am Rande. Das gibt es immer, wenn wirklich Redefreiheit herrscht. Und in ganz wenigen Fällen gab es auch einmal Zorn und Wut. Die Stimmen der Entrechteten und Enteigneten melden sich selten ohne eine Spur von Groll.
Ehrlich gesagt konnte einem dieser Groll auch manchmal Angst machen. Die Bedrohung war da zum Beispiel in den Straßen von Kopenhagen zu spüren. Es war der Tag einer riesigen öffentlichen Demonstration für »Klimagerechtigkeit«. Zornige junge Aktivisten, in Schwarz gekleidet, traten den Polizeiketten entgegen, offensichtlich darauf aus, dass sich der zerbrechliche Morgen in sinnloser Gewalt auflöste.
Fünf Jahre später wurde ich in Chile, wo ich eingeladen war, auf einer Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen zu sprechen, von unzufriedenen Jugendlichen mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt; diese Jugendlichen hatten offensichtlich nicht das Gefühl, Chiles aufblühende Wirtschaft wirke sich irgendwie auf die Verbesserung ihrer Lebensumstände aus, und flüchteten sich deshalb in die Gewalt.
In Griechenland, auf dem Höhepunkt der Austeritätspolitik, nahm ich an einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung teil, bei der der Saal voll mit wütendenden Männern und Frauen war, die sich lautstark gegen »sittenwidrige Schulden« wehrten und für »Schuldenerlass oder Forderungsverzicht« kämpften, für Aufschub egal welcher Art, damit Griechenland sich wieder von den Knien erheben konnte.8
Für mich ist das genau der Grund, warum die Wachstumsdebatte so wichtig ist. Kritische Diskussionen von der Tagesordnung zu verbannen und den Status quo festzuklopfen, wird die bevorstehenden ökologischen, sozialen und finanziellen Herausforderungen nicht lösen. Viel eher führt es zu Zwietracht, Wut und am Ende Gewalt.
Als ich Griechenland besuchte, war Austerität zum hässlichen Schlagwort für das massive Anziehen der Fiskalpolitik im Nachklang der Finanzkrise überall in Europa geworden. Geschäfte waren geschlossen, Schaufenster mit Brettern vernagelt; Abfälle, zerrissene Pappkartons, weggeworfenes Bettzeug der Obdachlosen und wütende politische Slogans verschandelten die Straßen in Europas Hauptstädten.
Am vorletzten Tag meiner Griechenlandreise ging ich vom Hotel in den Hafen von Piräus hinunter und nahm die Fähre nach Hydra; die Insel hatte ich als Student vor vielen Jahren einmal kurz besucht. Als wir in den weitgeschwungenen Bogen einfuhren, den der natürliche Hafen bildet, schien es einen Augenblick so, als hätte sich eigentlich gar nichts geändert.
Die weißen Häuser schmiegten sich wie eh und je an die ausgedörrten Abhänge der Hügel, die Boote mit ihren leuchtenden Farben tanzten wie immer auf dem funkelnden Wasser. Am Kai mischten sich Touristen mit Einheimischen, als die Fähre ihre Passagiere an Land absetzte. Eine schmale ältere Frau bot auf einem Pappschild Übernachtungsgelegenheiten an. Alles machte einen recht vertrauten Eindruck.
Bei näherem Hinsehen waren aber doch Unterschiede auszumachen. Im Yachthafen gab es mehr (und größere) Schiffe als in meiner Erinnerung; und wenn man die Klientel in den Cafés an der Hafenmole genauer betrachtete, dann war das Handy allgegenwärtig. Dennoch blieb der Kontrast zwischen dem wütenden Chaos von Athen und der surrealen Schönheit der Insel bestehen.
Von einem Aussichtspunkt hoch über dem Hafen schaute ich über die Terrakottadächer hinaus auf das azurblaue Leuchten der Ägäis und genoss die Wärme der Novembersonne auf meinem Rücken. Für einen Augenblick fühlte sich das wie Wohlstand an.
Das Gefühl war aber so flüchtig wie die Winterwärme. Die Suche nach realen Utopien endet immer wieder in Sackgassen, und so war das hier auch. Als Ikone griechischer Schönheit besitzt Hydra nach wie vor eine gewisse poetische Anziehungskraft. Als Modell für Wohlstand allerdings ist sie ganz und gar nicht geeignet.
Die kahlen Hügel, die sich über dem Hafen von Hydra erheben, waren einst mit üppiger grüner Vegetation überzogen, dank der natürlichen Wasserquellen, die der Insel ihren Namen gaben. Der Reichtum, der aus ihrer Stellung als maritimer Hochburg quellte, trocknete nun genauso aus wie die Hügel.
Selbst die Kontinuität, die ich am Anfang wahrzunehmen glaubte, gab es nicht wirklich. Die Bevölkerung von Hydra hatte um fast ein Drittel abgenommen, seit ich das letzte Mal hier gewesen war, und dass die Insel noch nicht gänzlich exklusiver Spielplatz für die Reichen geworden ist, war im Wesentlichen der heruntergekommenen Fähre zu verdanken, die mich in etwa einer Stunde über das kalte mondbeschienene Meer zurück nach Athen bringen würde.9
*****
Die Vergangenheit ist ein anderes Land. Dort macht man alles anders. Die Zuversicht, mit der die Führer der Welt glaubten, es sei möglich, das Wachstum wieder anzukurbeln; die Überzeugung, Business-as-usual warte gleich hinter der nächsten Ecke, um sofort zurückzukehren; selbst der rechtschaffene Zorn, der mir damals in jener regnerischen Märznacht aus dem Telefon entgegenschallte – all das hat jetzt etwas Seltsames an sich, wie aus einer anderen Welt.
Inzwischen ist sehr viel deutlicher geworden, in welchem Ausmaß unsere Volkswirtschaften aus dem Gleichgewicht geraten sind. Wie hoch verschuldet, wie abhängig von verkrachten Träumen. Wie völlig konträr zu der empfindlichen Ökologie des Planeten. Wie tief in Ungleichheit versunken. Und wie zerstörerisch die politischen und sozialen Konsequenzen dieser Ungleichheit sein konnten. In meinem eigenen Land stand Brexit nun für den Angstschrei derer, die vom System abgehängt wurden.
Es ist ja nicht so, dass man nicht versucht hätte, die Dinge in Ordnung zu bringen. Zuerst durch Finanzspritzen und Rettungsaktionen. Dann durch Austeritäts- und Geldpolitik. Dass man aber die Architekten des Chaos belohnte, während man den Ärmsten und Schutzlosesten die sozialen Investitionen entzog, hat die Probleme nur verschärft. Wo wir uns neuen Wohlstand erhofften, fanden wir steigende Unsicherheit, immer höhere Verschuldung und wachsende Ungleichheit.
Nicht alle diese Bemühungen dienten nur der Aufrechterhaltung des Status quo. Manche wiesen die Welt auch in eine bessere Richtung. Seit der Krise wurden Investitionen in erneuerbare Energie weltweit um 60 Prozent erhöht und innerhalb der letzten zehn Jahre verdreifacht. Ein ganzer neuer Katalog von Zielen nachhaltiger Entwicklung wurde ausgehandelt, um den Fortschritt auf dem Weg in eine bessere Welt messen zu können. Und entgegen aller Erwartungen hat der Pariser Klimagipfel im Dezember 2015 die politische Entschlossenheit verstärkt, das Thema Klimawandel nun endlich anzupacken.10
Einiges davon gibt Grund zur Hoffnung, anderes aber auch Anlass zu noch tieferen Ängsten. Einerseits sind unsere Diskussionen über den Fortschritt viel offener und nachdenklicher geworden, als wir uns das noch vor sieben Jahren hätten träumen lassen. Andererseits sind die Spannungen überall in der Gesellschaft viel stärker spürbar geworden. Manchmal hat man das Gefühl, gleich um die Ecke lauere eine neue Barbarei, die bereits am Kern der Gesellschaft nagt und die Humanität bedroht.
Was kann Prosperity without Growth den Menschen überhaupt noch sagen in dieser veränderten und unsicherer gewordenen Welt? Haben die Forderungen des Buches noch etwas mit der Politik von heute zu tun? Sind seine Rezepte und Anregungen noch relevant? Oder war der Regierungsbericht, der seinen Geldgebern so viel Sorgen bereitete, nichts als eine kleine Laune des Zeitgeists, eine vorübergehende Kuriosität eines nun in weite Ferne entschwebten Landes?
Das waren die Fragen, die ich mir stellte, als ich den Plan einer revidierten Fassung in Erwägung zog. Zunächst ging ich davon aus, das Buch könne mehr oder weniger so bleiben, wie es war – einige Grafiken auf den neuesten Stand bringen, ein paar Literaturhinweise ergänzen, den Rest aber mehr oder weniger beibehalten. Schließlich hatte ich die Argumentation unzählige Male vorgetragen und tue das immer noch. Ich kannte sie in- und auswendig.
Aber ich hatte mich geirrt. Als ich den alten Text noch einmal las, merkte ich, wie viel sich geändert hatte. Das Gefühl, ich hätte in den Jahren dazwischen immer wieder die gleichen Argumente präsentiert, entsprach nicht ganz den Tatsachen. Im Lauf der Zeit hatte ich sie angepasst. Die Sache selbst hatte sich entwickelt und verändert. Ich hatte mich verändert. Die Welt hatte sich verändert. Eine einfache Bearbeitung mit nur leichten Korrekturen würde dieser neuen Situation nicht gerecht werden. Und so kam es, dass ich an immer mehr Stellen den Text neu zu schreiben begann.
Ganz klar verändert hatte sich zum Beispiel der geografische Rahmen. Den ursprünglichen Bericht hatte ich für die britische Regierung erstellt. Mit einer breiten internationalen Leserschaft hatte ich gar nicht gerechnet. Diesmal hatte ich beim Schreiben diese Leserschaft im Blick. Was die Schlussfolgerungen betrifft, so beziehen sie sich nach wie vor hauptsächlich auf die fortgeschrittenen Volkswirtschaften des Westens. Die Analysen jedoch und die Beispiele sind jetzt eher international gehalten.
Das erste Kapitel habe ich umgeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, zur Frage der Grenzen seien tiefergehende Argumente erforderlich. Zu oft hatte ich mit Menschen diskutiert, die der Meinung waren, ich hätte mich über die Bedeutung von Grenzen zu leicht hinweggesetzt, oder mit solchen, die das Konzept der Grenzen grundsätzlich ablehnten. Ich wollte mich klarer dazu äußern, wo wir Grenzen ernst nehmen sollten und wo unsere Möglichkeiten liegen, sie zu umgehen.
Ich fand, dass ich Kapitel 2, das Kapitel über die Finanzkrise, fast komplett neu schreiben musste. Zu viel war in der Zwischenzeit passiert. Seltsamerweise hat meine ursprüngliche Schlussfolgerung – dass nämlich die eigentliche Ursache der Krise im Streben nach Wachstum selbst lag – die Zeit überdauert. Die Belege dafür sind allerdings nun noch schlagkräftiger als vor sieben Jahren. Und die Auswirkungen sind gewaltiger als je zuvor.
Manches hat sich auch nicht geändert. Allmählich wurde mir klar, dass es in fast jedem Gespräch, das ich in den Jahren dazwischen geführt hatte, um immer das gleiche beständige Element des Buches ging: das, was ich das »Wachstumsdilemma« genannt hatte. Es mag ja sein, dass wirtschaftliches Wachstum nicht nachhaltig ist; aber ist es denn nicht glasklar, dass das Gegenteil oder das Fehlen von Wachstum genauso wenig wünschenswert ist?
War das nicht genau die Geschichte bei der Veröffentlichung? Bei der Geschichte über die Krise? Über die tiefsitzende Angst der Politiker? Das Gefühl der Bedrohung in den Straßen von Kopenhagen? Meine Erfahrung in Chile? Die Wut in Griechenland? Eine Wut, die sich seit meinem kurzen Besuch dort noch verschärfen sollte. Weder ich als Person noch die Griechen selbst konnten damals vorhersehen, dass noch Schlimmeres in petto war.
Der Yachthafen von Hydra sollte sehr bald Teil des mit der Troika vereinbarten Notverkaufs von 50 Milliarden Euro werden, der Bedingung für die dritte Rettungsaktion war, zusammen mit dem griechischen Postwesen und dem Netzwerk von Thermalquellen. Wenn so die Strafe für ein Land aussah, dem es nicht gelungen war, zu wachsen, wie konnte dann noch irgendjemand daran zweifeln, dass Wachstum eine dringende und reale Notwendigkeit war?11
In Wirklichkeit lag die Ursache für das unglückliche Schicksal Griechenlands natürlich in einer Reihe erheblich komplexerer Umstände begründet, wozu nicht zuletzt ein Geflecht aus Geldpolitik und Schulden gehörte, das systematisch eine Minderheit belohnt und die Mehrheit bestraft hat. Hier zeigte sich – wieder einmal – das Dilemma derer, die in diesem Netz gefangen sind: Die Beute geht an den Gläubiger und die Letzten beißen die Hunde.
Auf dem ganzen Weg oder auch in den unzähligen Diskussionen, an denen ich teilgenommen habe, ist mir nichts untergekommen, was die Wirkkraft dieses Dilemmas geschmälert oder seine Bedeutung für unsere gemeinsame Zukunft verringert hätte. Ganz im Gegenteil, die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen ich die Wirkung des Dilemmas beobachten konnte, haben seine Bedeutung in meinen Augen noch verstärkt. Es bleibt Fundament der Untersuchung auch in dieser zweiten Auflage.
Dagegen habe ich das Thema Entkopplung in Kapitel 5 komplett neu aufgearbeitet. Schon allein dort, wo sich die Wissenschaft einig ist, hat sich viel entwickelt. Ich brauchte fast einen Monat, um die Daten auf den jüngsten Stand zu bringen und die Berechnungen neu zu erstellen. Das Ergebnis war hochinteressant. Die Logik war ähnlich, aber die Herausforderung ging noch tiefer. Manche hatten ja gedacht, ich hätte das Ausmaß der nötigen Entkopplung zu hoch angesetzt; und nun hatte der wissenschaftliche Fortschritt in der Zwischenzeit ergeben, dass ich eher untertrieben hatte. Grünes Wachstum wird nicht leichter sein, als ich behauptet hatte – es wird schwerer sein, als irgendeiner jemals glauben wollte.
Es geht bei dieser zweiten Auflage aber nicht nur darum, die Größenordnung neu zu kalibrieren und die Aufgabe neu zu stellen. Die Absicht war auch, die Logik neu zu formulieren und die Änderungsvorschläge deutlicher zu machen. Letzteres war immer Ziel des Buches gewesen: nicht nur die Probleme zu diagnostizieren oder die Katastrophe zu beklagen, sondern die Dimensionen einer neuen Wirtschaftswissenschaft abzustecken, die auf einer schlüssigeren Version von Wohlstand basiert. Einige der ursprünglichen Absichten sind in der Zwischenzeit zwangsläufig in Vergessenheit geraten.
Ein Buch wird oft auf seinen Titel reduziert. Jene zwei einfachen Wörter »ohne« und »Wachstum« – so unschuldig sie für sich genommen sind, so niederschmetternd wirken sie zusammen – brachten dem Buch sehr viel Aufmerksamkeit. Sie lenkten aber auch manchmal von seinen Prognosen ab.
Die Vorschläge klarer zu gestalten und zu erweitern, war die wichtigste Veränderung in dieser zweiten Auflage. Dabei hatte ich das Glück, mich ausgiebig auf neue Forschungsergebnisse stützen zu können. Vieles stammt aus meiner eigenen ertragreichen Zusammenarbeit mit anderen, insbesondere mit Peter Victor, und in jüngster Zeit durch das neue Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity. Manches stammt auch aus neuen Erkenntnissen im Bereich des Finanzwesens, der Makroökonomie und des Wesens des Geldes selbst.12
Mithilfe dieser neuen Einsichten konnte ich etwas deutlicher ausarbeiten, was ich mittlerweile die Wirtschaft von morgen nenne (Kapitel 8): eine klarere und konstruktivere Rolle für die Unternehmen, Investitionen, für die Arbeit, die Geldversorgung und für den öffentlichen Sektor. Und es ist mir besser als vorher gelungen, die Umrisse einer neuen makroökonomischen Synthese festzuschreiben (Kapitel 9); einer Synthese, die uns über unsere strukturelle Abhängigkeit von ständig steigendem Konsum hinausbringt und nachhaltigeren und gerechteren Wohlstand liefert.
Die Überarbeitungen kosteten mich mehr – viel mehr – Zeit als erwartet, aber das Buch ist dadurch besser geworden. Seine grundlegenden Erkenntnisse sind die gleichen geblieben: Beim guten Leben auf einem endlichen Planeten kann es nicht nur um das Konsumieren von immer mehr Dingen gehen. Und genauso wenig um das Anhäufen von immer mehr Schulden.
Bei Wohlstand, wenn man ihn richtig versteht, geht es um die Qualität unseres Lebens und unserer Beziehungen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinschaften und um unser Gefühl für individuelle und kollektive Sinngebung. Diese überarbeitete Fassung zeigt noch deutlicher, dass die Wirtschaftswissenschaft im Dienste einer solchen Vision eine konkrete, definierbare und sinnvolle Aufgabe darstellt.
Wie sich aus den lateinischen Wurzeln des englischen Wortes prosperity ergibt, geht es bei Wohlstand um Hoffnung. Hoffnung für die Zukunft, Hoffnung für unsere Kinder, Hoffnung für uns selbst. Eine Wirtschaftswissenschaft im Dienst der Hoffnung ist eine Aufgabe, für die sich weiterhin zu arbeiten lohnt.
Tim Jackson, im Juni 2016
1 Die Grenzen des Wachstums
»Wer glaubt, exponentielles Wachstum könnte in einer endlichen Welt unendlich weitergehen, ist entweder ein Wahnsinniger oder Wirtschaftswissenschaftler.«
Kenneth Boulding, 19731
Wohlstand ist wichtig. Wohlstand bedeutet Erfolg und Wohlbefinden. Wohlstand bedeutet, dass es uns und den Menschen, die uns wichtig sind, gut geht. »Wie geht’s?«, fragen wir unsere Freunde und Bekannten. »Wie steht’s?« In solchen kleinen Alltagsgesprächen geht es um mehr als nur belanglose Grüße. Sie offenbaren ein wechselseitiges Interesse für das Wohlbefinden des anderen. Dass die Dinge gut laufen, ist ein allgemein menschliches Anliegen.
Was das für »Dinge« sind, die gut laufen sollen, wird im Einzelnen oft gar nicht erklärt. »Gut. Und wie geht es dir?« antworten wir instinktiv. Wir agieren nach einem bekannten Drehbuch. Wenn der andere nicht lockerlässt, reden wir vielleicht über unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Arbeit. Oft gibt man mit Erfolgen an. Gelegentlich gesteht man auch Enttäuschungen ein. Gegenüber Freunden, denen wir vertrauen, lassen wir uns vielleicht verführen, unsere Träume und Zukunftshoffnungen offen zu legen.
Selbstverständlich gehört zu dem Gefühl, dass die Dinge gut laufen, auch die Erwartung dazu, dass das ebenso für die Zukunft gilt. Man wird wohl kaum sein Leben mit Zufriedenheit betrachten, wenn man weiß, dass morgen alles in die Brüche geht. »Ja, es geht mir gut, danke. Morgen melde ich Konkurs an.« Das würde keinen Sinn machen. Die Zukunft ist enorm relevant. Wir machen uns natürlich Gedanken darüber, was die Zukunft bringen wird.
Der Wohlstand des Einzelnen wird aber auch, wie wir wissen, durch gesellschaftliche Missstände beeinträchtigt. Dass es mir persönlich noch gut geht, ist ein geringer Trost, wenn Familie, Freunde und Gesellschaft sich allesamt in ernsten Notlagen befinden. Mein eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen der Menschen um mich herum sind miteinander verwoben, manchmal sogar unauflöslich.
Zugespitzt formuliert lässt sich diese Sorge füreinander als eine Vision menschlichen Fortschritts verstehen. Wohlstand verspricht das Ausmerzen von Hunger und Obdachlosigkeit, das Ende von Armut und Ungerechtigkeit, die Hoffnung auf eine sichere und friedvolle Welt. Und diese Vision ist nicht nur aus altruistischen Gründen von Bedeutung; sie ist oft auch eine Bestätigung dafür, dass unser eigenes Leben einen Sinn hat.
Die Tatsache, dass gesellschaftlicher Fortschritt möglich ist, gibt uns das tröstliche Gefühl, dass alles immer besser wird – wenn nicht immer für uns selbst, dann doch wenigstens für die, die nach uns kommen. Eine bessere Gesellschaft für unsere Kinder. Eine gerechtere Welt. Eine Welt, in der auch die weniger vom Glück Begünstigten eines Tages aufblühen können. Wenn ich nicht an eine solche Perspektive glauben kann, woran soll ich dann glauben? Welchen Sinn kann ich dann in meinem Leben erkennen?2 In diesem Sinne ist Wohlstand eine Vision, die wir alle gemeinsam haben. Sie spiegelt sich in unseren täglichen Ritualen. Entsprechende Überlegungen beeinflussen auch die Welt der Politik und Gesellschaft. Die Hoffnung auf einen Wohlstand dieser Art liegt im Zentrum unseres Lebens.
So weit so gut. Wie aber kann Wohlstand erreicht werden? Wenn es keine gangbare Möglichkeit gibt, Hoffnung Wirklichkeit werden zu lassen, dann bleibt Wohlstand eine Illusion. Worauf es ankommt, sind überzeugende, belastbare Mechanismen, mit denen sich Wohlstand herstellen lässt. Und dabei geht es aber um mehr als eine reine Mechanik des Wohlergehens. Dass die Mittel, mit denen wir unser gutes Leben gestalten, vertretbar sind, ist Teil des Kitts, der die Gesellschaft zusammenhält. Geht die Hoffnung verloren, erlischt auch jede Art von Gemeinschaftsgefühl. Gute Sitten geraten in Gefahr. Hier den richtigen Mechanismus zu finden, ist essenziell.
Es gehört zu den wesentlichen Aussagen des Buches, dass wir bislang bei dieser Aufgabe scheitern. Unsere Technologien, unsere Wirtschaftsform und unsere sozialen Ziele sind allesamt schlecht auf eine sinnvolle Ausformung von Wohlstand abgestimmt.
Die Vorstellung von gesellschaftlichem Fortschritt, die uns antreibt – basierend auf der ständigen Ausweitung materieller Bedürfnisse – lässt sich ganz grundsätzlich nicht halten. Und das Scheitern bedeutet nicht nur, dass es uns nicht gelingt, unsere Utopien zu verwirklichen. Es geht viel tiefer: Während wir es uns heute gut gehen lassen, untergraben wir systematisch die Grundlage für das Wohlergehen morgen. Während wir uns um unser eigenes Wohlergehen kümmern, gefährden wir die Chancen für andere. Wir laufen tatsächlich Gefahr, jegliche Hoffnung auf dauerhaften Wohlstand für alle zu verspielen.
Dieses Buch soll aber keineswegs als Tirade wider das Versagen der Moderne verstanden werden. Und genauso wenig als Klage über die Hinfälligkeit der conditio humana. Zweifellos gibt es einige Rahmenbedingungen, die der Aussicht auf dauerhaften Wohlstand im Wege stehen. Dazu könnten die Existenz ökologischer Grenzen und die Einschränkungen in Bezug auf Ressourcen gehören, vielleicht auch bestimmte Aspekte der menschlichen Natur. Es ist ein zentrales Anliegen der vorliegenden Untersuchung, Bedingungen dieser Art Rechnung zu tragen.
Vorrangiges Ziel des Buches ist es, brauchbare Auswege aus der größten Zwickmühle unserer Zeit zu finden: wie wir nämlich die Hoffnung auf ein gutes Leben mit den Grenzen und Zwängen eines endlichen Planeten in Einklang bringen können. Die folgende Analyse konzentriert sich vor allem darauf, eine glaubwürdige Vorstellung davon zu entwickeln, was ein gutes Leben für die menschliche Gesellschaft in diesem Kontext bedeutet; und die Dimensionen einer belastbaren Wirtschaftswissenschaft zu etablieren, die sich diesem Ziel verschrieben hat.
Wohlstand als Wachstum
Im Mittelpunkt dieses Buches steht eine sehr einfache Frage: Wie kann Wohlstand in einer endlichen Welt aussehen, deren Ressourcen begrenzt sind und deren Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte voraussichtlich zehn Milliarden Menschen überschreiten wird?3 Haben wir eine angemessene Vorstellung von Wohlstand für eine solche Welt entwickelt? Ist diese Vorstellung glaubwürdig angesichts dessen, was wir bisher schon über ökologische Grenzen wissen? Was können wir tun, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen?
Die übliche Antwort auf diese Fragen besteht darin, Wohlstand in ökonomischen Begriffen zu definieren und ständig steigende Einkommen zu fordern, damit dieser Wohlstand erreicht wird. Höhere Einkommen bedeuten wachsende Möglichkeiten, reicheres Leben, eine verbesserte Lebensqualität für diejenigen, die davon profitieren. So jedenfalls hört man das überall.
Diese Formel setzt Wohlstand (fast buchstäblich) in eine Steigerung dessen um, was Ökonomen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf nennen, also das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Person. Vereinfacht gesagt ist das BIP ein Maß für die gesamte »Wirtschaftstätigkeit« einer Volkswirtschaft; oder genauer, des Geldwerts der Güter und Dienstleistungen, die innerhalb einer bestimmten Nation oder Region produziert und konsumiert werden. Wirtschaftliches Wachstum findet dann statt, wenn das BIP im gesamten Wirtschaftsbereich steigt – normalerweise mit einer bestimmten »Wachstumsrate«.4
Man sollte anmerken, dass ein steigendes BIP nur dann zu steigendem Einkommen (also BIP pro Kopf) führen wird, wenn die Wirtschaft stärker als die Bevölkerung wächst. Wenn die Bevölkerung expandiert, jedoch das BIP konstant bleibt, wird das Einkommensniveau sinken. Umgekehrt werden die Einkommen, wenn das BIP steigt, aber die Bevölkerung gleich bleibt (oder sinkt), noch schneller steigen. Generell muss das BIP mindestens so schnell wie die Bevölkerung steigen, um nur das Durchschnittsniveau der Haushaltseinkommen zu halten.
Wie wir später sehen werden, gibt es gute Gründe, zu hinterfragen, ob ein solch grober Maßstab wie das BIP pro Kopf tatsächlich ausreicht, um wirklichen Wohlstand widerzuspiegeln. Zunächst einmal bildet es aber ganz gut ab, was man normalerweise darunter versteht. Grob gesagt betrachtet man steigenden Wohlstand als mehr oder weniger gleichbedeutend mit steigenden Einkommen, die nach üblichen Vorstellungen durch anhaltendes Wirtschaftswachstum erreicht werden.
Dies ist natürlich einer der Gründe, warum fast das ganze letzte Jahrhundert über Wirtschaftswachstum das mit Abstand wichtigste politische Ziel war, und zwar auf der ganzen Welt. Und für die ärmsten Nationen der Welt ist dieses Rezept natürlich nach wie vor sehr attraktiv. Will man das Thema Wohlstand wirklich sinnvoll angehen, muss man auf jeden Fall die Not der weltweit mehr als drei Milliarden Menschen berücksichtigen, die immer noch von weniger als fünf Dollar am Tag leben.5
Greift aber dieselbe Logik auch bei den reicheren Nationen, dort, wo die Grundbedürfnisse im Wesentlichen gedeckt sind und der Überfluss der Konsumgüter den materiellen Wohlstand kaum noch steigert und möglicherweise sogar das gesellschaftliche Wohlergehen beeinträchtigt? Wie kommt es, dass wir, obwohl wir schon so viel haben, immer noch hungrig sind nach mehr? Wäre es nicht vielleicht besser, in den entwickelten Volkswirtschaften das rücksichtslose Wachstumsstreben zu stoppen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, die verfügbaren Ressourcen gerechter zu verteilen?
Sind in einer Welt mit endlichen Ressourcen und engen ökologischen Grenzen, in einer Welt, die immer noch gekennzeichnet ist durch »Inseln des Wohlstands« inmitten von »Ozeanen der Armut«6, für die bereits reichen Länder stetig steigende Einnahmen wirklich nach wie vor legitime Ziele aller Hoffnungen und Erwartungen? Oder gibt es nicht vielleicht einen anderen Weg hin zu einer nachhaltigeren, gerechteren Form des Wohlstands?
Auf diese Frage werden wir immer wieder zurückkommen und sie dabei aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Es soll aber hier schon in aller Deutlichkeit festgestellt werden, wie das auch Bouldings Bemerkung zu Beginn des Kapitels andeutet, dass für die meisten Ökonomen schon allein die Vorstellung von Wohlstand ohne Wachstum ein rotes Tuch ist. Wachstum des BIP gilt als derart selbstverständlich, dass Unmengen von Papier vollgeschrieben worden ist über die Frage, worauf dieses Wachstum beruht, wer es am besten befördert und was zu tun ist, sollte es nicht mehr erfolgen.
Sehr viel weniger wurde darüber geschrieben, warum wir es überhaupt brauchen. Aber das unablässige Streben nach mehr, das hinter den traditionellen Vorstellungen von Wohlstand steckt, besitzt durchaus so etwas wie einen intellektuellen Unterbau.
Zusammengefasst geht die Argumentation etwa folgendermaßen: Das BIP beziffert den wirtschaftlichen Wert der auf dem Markt gehandelten Güter und Dienstleistungen. Wenn wir nun immer mehr Geld für immer mehr Waren ausgeben, dann deshalb, weil wir ihnen Wert beimessen. Wir würden ihnen keinen Wert beimessen, würden sie nicht gleichzeitig unsere Lebensqualität verbessern. Deshalb kann es gar nicht anders sein, als dass eine stetige Zunahme des Pro-Kopf-BIP die Lebensqualität verbessert und den Wohlstand steigert.
Diese Schlussfolgerung ist genau deshalb verkehrt, weil Wohlstand nicht von vornherein gleichbedeutend ist mit Einkommen und Reichtum. Steigender Wohlstand ist nicht automatisch das Gleiche wie wirtschaftliches Wachstum. Mehr muss nicht immer besser sein. Aber zumindest findet sich hier eine Erklärung dafür, warum wir derart hartnäckig an der »Kleinen großen Zahl« festhalten: dem BIP.7
Es klingt vielleicht seltsam, aber der Begriff Wohlstand (prosperity) wird noch gar nicht so lang primär über Geld definiert. In seiner ursprünglichen Bedeutung hatte er mehr damit zu tun, dass sich das Leben gut entwickelte: in Übereinstimmung mit (lateinisch pro-) den Hoffnungen und Erwartungen (speres). Wohlstand bedeutete ganz einfach das Gegenteil von Not oder Elend.8 Die Gleichsetzung von steigendem Wohlstand mit Wirtschaftswachstum ist ein Kurzschluss und eine vergleichsweise moderne Deutung, eine Deutung, die mittlerweile heftig unter Beschuss geraten ist.
Einer der Vorwürfe gegen das Wachstum lautet, dass es seine Wohltaten im besten Falle ungleich verteilt. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung verdient weniger als sieben Prozent des Gesamteinkommens. Das eine Prozent an der Spitze verdient dagegen etwa 20 Prozent des Welteinkommens und besitzt fast die Hälfte des globalen Reichtums. Riesige Ungleichheiten – eine reale Wohlstandsdifferenz, ganz gleich, welche Maßstäbe man anlegt – charakterisieren den Unterschied zwischen Arm und Reich. Ein solches Missverhältnis ist furchtbar, schon aus ganz grundsätzlich humanitärer Sicht. Es produziert überdies wachsende soziale Spannungen: reales Elend in den am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen, die sich auf die Gesellschaft als Ganzes negativ auswirken.9
Merkwürdigerweise scheint dieses Missverhältnis sich immer mehr zu verschärfen. Nach dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ist die Ungleichheit bei den Einkommen heute größer als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Im Lauf von weniger als einem halben Jahrhundert hat das reichste eine Prozent der Bevölkerung seinen Teil am Einkommen mehr als verdoppelt. In den Entwicklungsländern wuchs die Einkommensungleichheit in den letzten zwei Jahrzehnten um elf Prozent. Selbst innerhalb der hochentwickelten Volkswirtschaften ist die Ungleichheit um neun Prozent höher als noch vor 20 Jahren.10
Während die Reichen immer reicher wurden, stagnierten die Realeinkommen der Mittelschicht in den westlichen Ländern bereits lange vor der Finanzkrise. Es ist auch durchaus schon die These vertreten worden, dass steigende Ungleichheit einer der Gründe für die Krise gewesen sei. Wachstum hat den Lebensstandard der besonders Bedürftigen keineswegs gehoben, ganz im Gegenteil; es hat in den letzten fünf Jahrzehnten einen großen Teil der Weltbevölkerung seinem Schicksal überlassen. Vor allem in den letzten Jahren ist der Reichtum zu den wenigen Glücklichen hinaufgesickert.11
Fairness (beziehungsweise das Fehlen von Fairness) ist nur einer der Gründe, warum man die herkömmliche Wohlstandsdefinition hinterfragen sollte. Ein anderer ist, dass – zumindest ab einem bestimmten Punkt – das ständige Streben nach wirtschaftlichem Wachstum das Glück der Menschen nicht mehr steigern kann und vielleicht sogar beeinträchtigt. So paradox diese Behauptung auch scheinen mag, so kann sie sich doch auf eine lange Ideengeschichte in Philosophie, Religion, Literatur und Kunst berufen. Und im letzten Jahrzehnt hat sie eine überraschende politische Wiedergeburt erlebt.
Selbst vor der Finanzkrise, als es noch so aussah, als trage uns die Wirtschaft alle zusammen in eine immer lichtere Zukunft, gab es verstörende Hinweise auf eine wachsende »soziale Rezession« in den hochentwickelten Volkswirtschaften. Eine neue Politik des Glücks oder Wohlbefindens begann konventionelle Ansichten von gesellschaftlichem Fortschritt in Frage zu stellen, in armen wie in reichen Ländern. In Ecuador hat sie im Konzept des buen vivir eine offizielle Form gefunden, verankert in der Verfassung des Landes. Die Wurzeln des buen vivir liegen in der indigenen Vorstellung des sumak kawsay