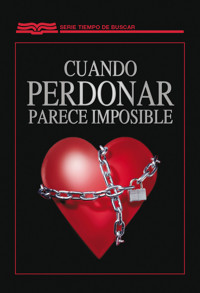Prolog
»Geschichte, auch wenn sie reißend schmerzt, lässt sich nicht ungeschehen machen. Blickt man ihr aber ins Auge mit Mut, muss sie kein zweites Mal geschehen.«
Maya Angelou, 19931
»Was war, Prolog ist, und was kommtAn meiner und an deiner Rolle liegt.«
William Shakespeare, 16102
»Die Welt beginnt zu beben«, schrieb der Soziologe Peter Berger, »sobald das Gespräch, das sie trägt, ins Stocken gerät.« Das Jahr 2020 hat diese unbequeme Wahrheit zweifellos bestätigt. Das uns tragende Gespräch geriet nicht einfach nur ins Stocken. Es machte eine abrupte Kehrtwende und schlug uns ins Gesicht. Ein harter Schlag. Kein Wunder also, dass sich die Welt auch heute noch ziemlich schwankend anfühlt.3
Dabei ist doch alles so gut gelaufen. In der dritten Januarwoche 2020 ging die Sonne strahlend auf über der höchstgelegenen Stadt Europas. Das Morgenlicht tauchte die schneebedeckten Gipfel in wunderbaren Glanz, golden schimmerten die Berge vor einem tiefblauen Alpenhimmel. Die Natur in all ihrer Pracht. Die perfekte Kulisse für die alljährliche Zusammenkunft der Privilegierten und Mächtigen. Der Premierminister und Milliardäre. Der Limousinen und Helikopter. Das 50. Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos stand kurz vor der Eröffnung.
»Es ist eine einzige Sause«, verriet mir mein Gastgeber, als er mich am Vortag spät nachts an der kleinen Bahnstation abholte und in meine Unterkunft brachte. Ein gemietetes Apartment ein wenig abseits von der Stadt, mit Blick auf die Berge. »Es ist ein Dschungel«, sagte sein Begleiter. Und wir alle lachten etwas gequält.
Unsere Führungsriege kennt die Regeln dieses Spiels. Sie weiß intuitiv, dass es bei diesem protzigen Festzug darum geht, sich von der besten Seite zu zeigen. Es steht immer viel auf dem Spiel. Das Scheinwerferlicht muss edle Anzüge und aalglatte Frisuren zum Glänzen bringen. Die Exerziergruppen müssen einander ausstechen. Die Rhetorik muss genau auf die eigentümlichen Kämpfe des Tages abgestimmt sein. Die Sonne hat keine andere Wahl, als pflichtbewusst auf die Rechtschaffenen herabzuscheinen. Der ganze Aufzug darf keinen Raum für Zweifel lassen. Die Berge müssen auf ewig besiegeln, was in den Kellern der Geschichte ausgehandelt wurde: Mehr erzeugt mehr; Macht erzeugt Macht; Wachstum erzeugt Wachstum. Wer da hat, dem wird gegeben.
Seit fünf Jahrzehnten jetten sie jetzt schon in diesen schillernden Urlaubsort und schwören dem großen Gott des Wachstums die Treue. Ob es schneit oder die Sonne scheint, ob das Wetter gut ist oder schlecht, ihre Aufgabe war immer kristallklar: die Schwachen aufzurichten und die Ängstlichen zu ermutigen. Wo immer der Zweifel sein Drachenhaupt erhebt, ihn zu erschlagen. Wirtschaftswachstum ist einfach ein Akt des Vertrauens. Solange wir dran glauben, wird es auch kommen. Alles wird gut, und alles wird gut, und überhaupt wird alles gut.4
Und es gibt jede Menge Drachen. Das war in diesem Jahr nicht anders. Europa machte sich wegen des aufkommenden Populismus Sorgen. Australien war von den Buschfeuern geplagt, die immer noch durch seinen langen »schwarzen Sommer« wüteten. Die Vereinigten Staaten waren wegen des Handelskrieges mit China nervös. Fast alle machten sich plötzlich Sorgen wegen des Kohlendioxids. Der Klimawandel war im diesjährigen Kampf um die Aufmerksamkeit der Überraschungssieger. Die Schulstreiks von 2019 hatten die Angelegenheit endlich nach ganz oben auf die Forumsliste langfristiger Wachstumsrisiken geschoben.
Das war eine Premiere. Entgegen allen Widrigkeiten kam es in Davos zu einem breiten – wenn auch nicht ganz einstimmigen – Konsens, dass es nun doch an der Zeit sei, etwas zu unternehmen, bevor Überschwemmungen und Buschfeuer – oder auch diese lästigen Aktivisten, die den Strom der Limousinen in die Stadt und aus der Stadt heraus immer wieder blockierten – den Zug der Weltwirtschaft mitsamt allen Mitläufern entgleisen lassen.
»Wir müssen die Ungeduld der Jugend positiv und konstruktiv aufnehmen«, riet Angela Merkel der Konferenz. Damit spielte sie natürlich auf die erstaunliche Führungsstärke der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg an, die zum zweiten Mal hier in der Stadt war und mit der außergewöhnlichen Klarsicht einer Prophetin den Mächtigen sagte, was Sache ist. Eine unerwartete Anführerin. Die Einfachheit ihrer Botschaft zog in diesem Jahr eine ganz neue Generation von Aktivisten auf ein Schlachtfeld, auf dem sie sich überhaupt nicht auskannten. Sie sahen sich trotzig und voller Ehrfurcht um. Die deutsche Kanzlerin war nicht die Einzige unter den alten Hasen, die ihnen gerührte Sympathie entgegenbrachte.
Aber nicht jeder war beeindruckt. »Ist sie hier der Chefökonom oder was? Ich bin ganz verwirrt«, witzelte Stephen Mnuchin, der US-Finanzminister, über Greta Thunberg, was er vermutlich umgehend bereute. »Sie soll erstmal auf’s College gehen und Wirtschaft studieren; danach kann sie wiederkommen und uns alles erklären.« Sackgasse, Stephen. Mach’s nicht noch schlimmer.5
Aber das konnten sie natürlich nicht – es nicht noch schlimmer machen. Der damalige US-Präsident Donald Trump war fest entschlossen, diesen Unsinn in den erweiterten Kontext eines unvergänglichen Dogmas zu stellen. »Um die Chancen von morgen ergreifen zu können, müssen wir diesen ewigen Untergangspropheten und ihren apokalyptischen Prognosen eine Absage erteilen«, verkündete er. »Sie sind die Nachfolger der schwachsinnigen Wahrsager von gestern.« Unser Held blickt über die weite Landschaft auf ihn gerichteter Gesichter hinweg, auf den Horizont endloser Möglichkeiten. Irgendwo sitzt wahrscheinlich ein Redenschreiber, der sehr zufrieden in sich hinein lächelt. Das Leben ist einfach nur ein zweitklassiger Film aus Hollywood.6
Das Paradies ist ein Land, das aus Pioniermentalität geformt wird. Niederbrennen, aufgraben, draufbauen. Fortschritt ist eine Baustelle. Noch sieht es dort vielleicht etwas chaotisch aus, aber die Shoppingmeilen und Eigentumswohnungen von morgen werden ein glorreicher Anblick sein. Alle, die an dieser Vision zweifeln, sollen zugrunde gehen. Die Schulkinder, die Klimastreikenden, die Anhänger von Extinction Rebellion: Die können sich alle zum Teufel scheren. Nieder mit den Nachfolgern der schwachsinnigen Wahrsager von gestern. Verpflichtender Optimismus ist heute angesagt. Und das blendend Offensichtliche wird aus dem Diskurs der Macht getilgt.
Der Schnee über Davos wird jedes Jahr dünner. Die alpine Skisaison ist heute einen Monat kürzer als im Jahr 1971, als Klaus Schwab das Forum gründete. Das Klima wandelt sich. Das Eis schmilzt. Eine Million Arten stehen vor der Auslöschung. Wir verschieben das ökologische Gleichgewicht mit völlig unvorhersehbaren Folgen. Manchmal auf eine Art und Weise, die sich als tödlich erwiesen hat. Der endliche Planet, den wir unsere Heimat nennen, wird durch die massive Ausweitung menschlicher Aktivitäten vielleicht unwiderruflich verändert. Alles unter dem verführerischen Banner des Fortschritts. Aber bitte, macht uns bloß nicht auf diese Tatsachen aufmerksam. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, sie aus unserem Gesichtsfeld fernzuhalten.7
Auf der gleichen Davos-Bühne kam es zu einer weiteren aufschlussreichen Situation. Der frisch gewählte Kanzler von Österreich hatte seine Redezeit für die Aufforderung genutzt, Europa solle innovativer werden, dynamischer, mehr nach vorne schauen. Mit seinen 33 Jahren war Sebastian Kurz soeben zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren zum jüngsten Staatsoberhaupt der Welt gewählt geworden. Er geißelte den »Pessimismus« der älteren europäischen Volkswirtschaften und lobte die Dynamik der jüngeren, »hungrigeren« Ökonomien. In Anlehnung an die Pionierrhetorik forderte er erneuerten Optimismus, mehr Innovation, schnelleres Wachstum. Nichts, was wir nicht schon mal gehört hätten.
Später in der Diskussion allerdings legte Kurz ein kurioses Bekenntnis ab. »Ich hab’ unlängst eine Diskussion erlebt, da ist über die Postwachstums-Gesellschaft philosophiert worden«, erklärte er dem Publikum. »Und ob es nicht auch eigentlich gut für ein Land sein kann, wenn es mal kein Wirtschaftswachstum mehr gibt, wenn die Zufriedenheit trotzdem vorhanden ist. Und wär’ es nicht überhaupt besser, die Zufriedenheit der Bevölkerung zu messen und nicht das Wirtschaftswachstum …« Der junge Mann trug das sehr gewinnend vor, ein leichtes Lächeln spielte um seine Lippen. Einen Augenblick lang war man versucht zu glauben, dass endlich doch eine vernünftigere Politikergeneration ans Ruder gekommen ist. Dass sich jetzt etwas ändern wird. »Das klingt alles immer so schön und so romantisch«, sagte er mit einem wissenden Augenzwinkern. »Ich kann nur sagen (…) Zufriedenheit zahlt keine Pensionen!«8
Kurz hatte die Postwachstums-Gesellschaft nur ins Gespräch gebracht, um sie sofort als substanzlose utopische Idee abzutun, die jeder Realität entbehre. Innerhalb weniger Wochen allerdings erschien diese leichtfertige Verleugnung wie eine ausrangierte Weisheit von gestern. Das Ende des wärmsten Januarmonats seit Beginn der Aufzeichnungen hielt eine harte Lektion bereit. Selbst im privilegierten Davos wussten nur wenige davon. Ein paar überängstliche Naturen hegten vielleicht schon einen heimlichen Verdacht. Ein paar skrupellose Politiker hatten bereits ihr Insiderwissen eingesetzt, um ihr persönliches Vermögen aus der Gefahrenzone finanziellen Zusammenbruchs herauszuholen. Die meisten aber wussten nichts oder wollten nichts wissen. Niemand dort hätte das Ausmaß der tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erschütterung absehen können, die gerade über eine arglose Welt hereinzubrechen begann. Während Trump noch seine Neue-Horizonte-Lobrede hielt, kämpfte im Zentralkrankenhaus von Wuhan ein junger chinesischer Arzt namens Li Wenliang um sein Leben.9
Weniger als einen Monat zuvor hatte Li die Welt auf einen neuen, unbekannten und überraschend virulenten Erregerstamm des Coronavirus aufmerksam gemacht, der in einem tiermarktbesetzen Teil der Stadt ausgebrochen war. Er war für seine schmerzlichen Bemühungen rundweg gerügt worden. Zwei Wochen später würde er tot sein: einer der Helden auf der alarmierend exponentiellen Kurve einer eskalierenden Pandemie. Li sollte der erste von vielen unnötigen und absolut vermeidbaren Todesfällen sein, die bei der Versorgungsarbeit anderer ihr Leben ließen.10
Innerhalb weniger Wochen würde die gesamte Weltwirtschaft in eine existenzielle Krise stürzen. Verweigerung würde zu Verwirrung führen. Verwirrung würde sich in Praktizismus verwandeln. Praktizismus sollte alles auf den Kopf stellen. Normalität verflüchtigte sich mehr oder weniger über Nacht. Geschäfte, Wohnhäuser, Gemeinden, ganze Länder gingen in den Lockdown. Selbst die Fixierung auf das Wachstum trat kurzfristig hinter der Dringlichkeit zurück, das Leben der Menschen zu schützen. Wir wurden unsanft daran erinnert, worauf es im Leben am meisten ankommt, und erhielten eine Geschichtsstunde darüber, wie Volkswirtschaft aussieht, wenn Wachstum komplett wegfällt. Und eines wurde sehr schnell klar: Das lässt sich mit nichts vergleichen, was die moderne Welt bislang gesehen hat.
Irgendwann werden wir bestimmt eine Terminologie entwickeln, mit der sich unsere Welt besser beschreiben lässt. Sprache lehnt sich oft ein bisschen zu eng an den Gegenstand ihrer Beobachtung an. Zufriedenheit kann die Währung der Renten von morgen sein, oder auch nicht. Bis dahin werden unsere Sichtweiten neu kalibriert sein. Unser Vorstellungsvermögen wird sich erneuert haben. Wir werden in der Lage sein, eine Zukunft für unsere Wirtschaft zu artikulieren, die frei von den Fesseln ist, die unsere Kreativität an die Sprache eines überholten Dogmas binden.
Derzeit allerdings ist »Postwachstum« ein Begriff und eine Gedankenwelt, auf die wir noch nicht verzichten können; selbst inmitten eines Umbruchs sind wir immer noch vom Wachstum besessen. Postwachstum ist eine Form des Nachdenkens darüber, was passieren könnte, wenn es mit dieser Besessenheit vorbei ist. Es lädt uns ein, neue Horizonte für gesellschaftlichen Fortschritt zu erkunden. Es weist die Richtung in ein unkartiertes Terrain, in unerforschtes Gelände, in dem Fülle nicht in Dollars gemessen und Erfüllung nicht durch unerbittliche Anhäufung materiellen Reichtums bestimmt wird. Es zeigt Wege auf, der gnadenlosen Expansion zu entkommen.
Es erlaubt uns zu verstehen, dass der Kapitalismus selbst bloß eine zeitbedingte Erscheinung ist, ein sich nur mit Mühe am Leben erhaltender Rest alter Daseinsformen; nicht die eine unverrückbare, unveränderbare Wahrheit, die zu sein er sich anmaßt. Noch während ich dieses Buch schrieb, wurde der Kapitalismus buchstäblich zerlegt, Stück für Stück, in einem zunehmend staunenswerten Bemühen, Leben zu retten und Normalität zu erhalten. Das Jahr der Pandemie zeugte von dem außergewöhnlichsten Experiment in Nicht-Kapitalismus, das wir uns vorstellen können. Wir wissen jetzt, dass so etwas nicht nur machbar ist; unter bestimmten Umständen ist es lebensnotwendig. Ziel dieses Buches ist es, die Möglichkeiten zu vermitteln, die uns in diesem flüchtig erblickten Hinterland erwarten.
Wie wollen wir leben? ist eine Einladung, uns von den gescheiterten Glaubenssätzen der Vergangenheit zu befreien. So wie die Dichterin und Bürgerrechtsaktivistin Maya Angelou seinerzeit das amerikanische Volk eingeladen hat. Postwachstum ist eine Sprache, mit der wir diese Aufgabe beginnen können. Ihr Zweck im Moment ist es, uns zu helfen, ganz ehrlich über unsere Lage nachzudenken. Ihre tiefere Aufgabe ist es, unseren Blick zu heben; die Altlasten einer ausgedienten Wirtschaftswissenschaft abzulegen. Und auf eine ganz neue Weise zu erkennen, wie menschlicher Fortschritt aussehen könnte. Bald wird man Begriffe wie Postwachstum nicht mehr brauchen. Heute gibt uns diese Idee Kraft, unsere Lippen vom gestrigen Mantra zu befreien und uns eine neue Vorstellung von morgen zu bilden.
Kapitel 1
Der Mythos vom Wachstum
»Wir stehen am Beginn eines Massenaussterbens.Und Sie reden über nichts anderes als über Geld undMärchen vom ewigen Wachstum.«
Greta Thunberg, September 20191
»Viel zu sehr und viel zu lange haben wir persönliche Qualitäten und gemeinschaftliche Werte über der bloßen Anhäufung materieller Dinge vernachlässigt.«
Robert F. Kennedy, 19682
St. Patrick’s Day, 17. März 1968. Es war ein für die Jahreszeit milder Sonntagabend. In der Nachtluft lag schon ein Hauch von Frühling, als Senator Robert F. Kennedy aus New York in Kansas eintraf. Er hatte gerade an diesem Tag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 1968 angekündigt. Um für die Demokraten nominiert zu werden, würde er sich gegen den amtierenden Präsidenten Lyndon B. Johnson durchsetzen müssen. Senator gegen Präsident; Demokrat gegen Demokrat: Das versprach ein harter Kampf zu werden, und Kennedy war sich seines Erfolgs keineswegs sicher.3
Umso erstaunlicher war der Empfang, der ihn und seine Frau Ethel erwartete, als sie über die Gangway herab den Boden von Kansas City betraten: Einige Tausend Anhänger hatten die Polizeiabsperrung durchbrochen und stürmten über die Rollbahn auf die beiden zu. »Los, Bobby, los!«, riefen sie und verlangten eine Rede. Nichts war vorbereitet und ein Megafon gab es auch nicht. Sportlich warf Kennedy ein paar Sätze in den Wind, als er merkte, dass er kaum zu verstehen war. »Das war meine allererste Wahlkampfrede«, sagte er, »und jetzt Applaus!« Er klatschte in die Hände, die Zuhörer ebenfalls, und alle lachten. Das sah nach einem vielversprechenden Anfang für einen Präsidentschaftswahlkampf aus.
Der Senator war noch merklich nervös, als er am nächsten Morgen in der Kansas State University (KSU) eintraf, um seine erste offizielle Wahlkampfrede zu halten. Adam Walinsky, sein Redenschreiber, hatte sie für den Anlass sorgfältig ausgearbeitet. Der erste Eindruck ist immer wichtig. Niemand im Kampagnenteam konnte seine Wirkung vorhersagen. Kansas war einer der konservativsten Bundesstaaten, dem Establishment und der amerikanischen Flagge treu ergeben. Es war wahrscheinlich der letzte Ort, an dem man mit Sympathie für Robert F. Kennedys Antikriegsbotschaft rechnen konnte.
Um gleich beim Einstieg zu punkten, eröffnete er die Rede mit einem Zitat von William Allen White, dem ehemaligen Herausgeber einer Zeitung hier in Kansas. »Wenn unsere Hochschulen und Universitäten keine [Studierenden] heranziehen, die Randale machen und rebellieren, die das Leben mit der ganzen visionären Kraft der Jugend angehen, dann stimmt etwas nicht mit unseren Hochschulen«, sagte er. »Je mehr Aufruhr in unseren Universitäten, desto besser für die Welt von morgen.« Es war ein aufrichtiger Appell an die Generation, die die Anti-Vietnam-Protestbewegung aus den Ghettos heraus auf die Gelände liberaler, bürgerlicher Universitäten in ganz Amerika gebracht hatte. Die Studenten waren begeistert. Kennedys Eröffnungssalve wurde mit »freudigem Getöse« begrüßt.4
Die Erregung war mit Händen zu greifen. Die Studierenden im Saal – zum Teil auf den Dachbalken hockend – bejubelten seinen Rundumschlag gegen den Vietnamkrieg, seine Verachtung für die Johnson-Regierung und seinen Ärger über die mangelnde Moral der zeitgenössischen US-Politik im In- und Ausland. Das war kein vorsichtiges Eröffnungsgeplänkel einer sorgfältig austarierten Präsidentschaftskampagne. Das war Sprengstoff. Die Rede wurde besser aufgenommen, als irgendjemand zu hoffen gewagt hatte. Augenzeugen beschreiben, wie ein Journalist – der Fotograf Stanley Tettrick vom Look Magazine –, umzingelt von der Masse, versucht, sich mitten im Tumult auf den Füßen zu halten, und in den Saal schreit: »Wir sind in Kansas, im gottverdammten Kansas! Er wird das voll durchziehen!«5
Bobby Kennedy sollte es nicht bis zum Schluss »durchziehen«, die Geschichte hatte es anders bestimmt. Aber niemand wusste das am Eröffnungstag dieses verhängnisvollen Präsidentschaftswahlkampfes. Das Team war in Ekstase. Die Kampagne war auf den Weg gebracht. Die Journalisten hatten ihre Story; und die Medienberichterstattung würde ihrem Kandidaten keinen Schaden zufügen können. Es war große Erleichterung zu spüren, als sich das Gefolge zur zweiten Rede des Tages auf den Weg machte, bei dem großen sportlichen Rivalen der KSU, der University of Kansas (KU).
Walinsky nutzte die kurze Fahrt, um die Rede, die er für die zweite Veranstaltung vorbereitet hatte, schnell nochmal umzuschreiben. Sie war ursprünglich als eher ruhiger und ausgewogener Vortrag geplant, um den Senator auch von seiner nachdenklichen, intellektuellen Seite zu zeigen. Eine Passage, die für uns besonders interessant ist, drehte sich um den Nutzen und Missbrauch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – also die Kennziffer, mit der Wirtschaftswachstum gemessen wird. Für eine Wahlrede war das ein eher ungewöhnliches, schwer zugängliches Thema. Ein Zeugnis für die Radikalität von Kennedys politischer Vision. Um ein Haar hätte die Passage die Revision der Rede nicht überlebt.
Kennedy war überrascht und beglückt von der begeisterten Reaktion auf seine Rede am Morgen und wollte für den Nachmittag mehr davon. Er wies seinen Redenschreiber an, den nüchternen Teil loszuwerden und dem Vortrag ein bisschen von der Schärfe des Vormittags zu geben. Das Ergebnis könnte man mit etwas Nachsicht als Mischmasch bezeichnen: Abschnitte aus früheren Reden verwoben mit Anekdoten und ab und zu einem gut platzierten Scherz. Durch Zufall blieb die Passage zum BIP im Text. Diese kleine Laune des Schicksals sollte für das vorliegende Buch eine enorme Rolle spielen – und im Übrigen auch für das Leben seines Autors, der zu der Zeit, als das alles geschah, noch ein Kind war.6
Zur Bedeutung des Mythos
Jede Kultur, jede Gesellschaft hält an einem Mythos fest, nach dem sie lebt. Unser Mythos ist der des Wachstums. Denn solange die Wirtschaft wächst, fühlen wir uns sicher und in der Vorstellung bestärkt, dass das Leben besser wird. Wir glauben, dass wir Fortschritte machen – nicht nur als Individuen, sondern auch als Gesellschaft. Wir leben in der Überzeugung, dass die Welt von morgen ein noch strahlenderes Leben für unsere Kinder und für deren Kinder bereithält. Wenn das Gegenteil passiert, macht sich Ernüchterung breit. Unsere Stabilität ist von Zusammenbruch bedroht. Der Horizont verdüstert sich. Und die Macht dieser Dämonen – so real sie in einer derart wachstumsabhängigen Wirtschaft auch sein mögen – wird noch bedrohlicher, wenn wir dazu das Vertrauen an das Herzstück unseres tragenden Narrativs verlieren: den Mythos des Wachstums.
Ich benutze das Wort »Mythos« hier im positivsten Sinne. Mythen sind wichtig. Narrative tragen uns. Sie schaffen unsere Gedankenwelten und formen unser gesellschaftliches Gespräch. Sie legitimieren politische Macht und bekräftigen den Gesellschaftsvertrag. Sich einem Mythos zu verschreiben, ist nicht grundsätzlich falsch. Wir alle tun das in der einen oder anderen Form, implizit oder explizit. Aber die Macht des Mythos anzuerkennen, bedeutet nicht immer, sie stillschweigend hinzunehmen. Manchmal arbeiten die Mythen für uns, manchmal auch gegen uns.
Wenn sie sich dauerhaft halten, dann hat das einen Grund. Das Wirtschaftswachstum hat außergewöhnlichen Reichtum hervorgebracht. Es hat Millionen aus der Armut befreit. Allen, die reich genug sind und vom Glück begünstigt, hat es ein Leben in unvorstellbarem Komfort, in Vielfalt und Luxus eröffnet. Es hat Möglichkeiten geschaffen, die sich unsere Vorfahren unmöglich hätten vorstellen können. Es hat den Traum vom sozialen Fortschritt vorangebracht. Ernährung, Medizin, Obdach, Mobilität, Flugreisen, Vernetzung, Unterhaltung: Dies sind nur einige der vielfältigen Früchte des Wirtschaftswachstums.
Die massive Explosion der Wirtschaftstätigkeit hat aber auch die Natur in beispielloser Weise verwüstet. Wir verlieren Arten schneller als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wälder werden dezimiert. Lebensräume gehen verloren. Lebensnotwendiges Ackerland ist von weiterer wirtschaftlicher Expansion bedroht. Die Instabilität des Klimas untergräbt unsere Sicherheit. Brände verzehren ganze Landstriche. Der Meeresspiegel steigt. Die Ozeane versauern. Der Reichtum, nach dem wir streben, wurde zu einem unbezahlbaren Preis erkauft. Der Mythos, der uns getragen hat, ist im Begriff, uns zu vernichten.
Ich habe nicht vor, hier noch einmal alle diese Auswirkungen aufzuzählen oder ihre Schäden zu dokumentieren. Dazu gibt es bereits viele ausgezeichnete Berichte und Bücher. »Seit mehr als dreißig Jahren ist die Wissenschaft kristallklar«, wie Greta Thunberg die UN-Klimakonferenz 2019 erinnerte. Aus ihren Worten wurde ein kulturelles Mem. Sie regten sogar zu künstlerischen und musikalischen Interpretationen an, die ein viel breiteres Publikum erreichen, als es Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen je möglich wäre. Die eindeutigen Fakten, auf denen sie gründen, sind auf unzähligen Seiten akribischer Arbeit dokumentiert.7
Ich möchte lieber Gretas tiefergehende Herausforderung aufgreifen. Hinter den »Märchen vom Wirtschaftswachstum« liegt eine komplexe Welt, die unsere Aufmerksamkeit erfordert. Diese Märchen sind in den Handlungsleitfaden der modernen Wirtschaft einprogrammiert, und zwar schon seit Jahrzehnten. Sie verzerren weiterhin unsere Vorstellung von sozialem Fortschritt und verhindern ein tieferes Nachdenken über die Bedingungen des Menschseins.
Vereinfacht gesagt, lautet die These dieses Buches, dass ein gutes Leben nicht die Erde kosten muss. Materieller Fortschritt hat unser Leben verändert – in vielerlei Hinsicht zum Besseren. Aber das Besitzen kann auch eine Last sein, die der Freude der Zugehörigkeit im Weg steht. Wer besessen ist vom Produzieren, findet nicht die Erfüllung, die das Herstellen von Dingen gewährt. Der Zwang, konsumieren zu müssen, kann die einfache Leichtigkeit des Seins untergraben. Bei der Wiederentdeckung von Wohlstand geht es weniger um Verzicht als um Chancen.
Dieses Buch befasst sich mit den Bedingungen, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Es möchte herausfinden, welches Potenzial wir für ein Leben haben, das besser, reicher, erfüllender und nachhaltiger ist als bisher. Das Ende des Wachstums ist nicht das Ende gesellschaftlichen Fortschritts. Die materielle Expansion vom Thron zu stoßen, bedeutet nicht, menschlichen Wohlstand aufzugeben. Eine andere (bessere) Welt ist möglich. Spätestens seit Kansas ist das klar.
Als Kennedy in der Halle des Basketball-Teams der University of Kansas ankam, war die Atmosphäre wie aufgeladen. Weit über zwanzigtausend Menschen standen dicht gedrängt in der Arena: Studierende und Belegschaft, Journalistinnen und Kommentatoren, die auch auf das Spielfeld überquollen, sodass um Kennedy an seinem hölzernen, mit Mikrophonen gespickten Pult nur ein kleiner Kreis frei blieb.
Er eröffnete seine Rede mit einem vermutlich eher spontanen Scherz. »Eigentlich bin ich gar nicht hier, um eine Rede zu halten«, witzelte er. »Ich bin hier, weil ich von der Kansas State University komme und euch alle ganz lieb grüßen soll. Im Ernst. Sie reden dort über nichts anderes als, wie gern sie euch haben.« Die Rivalität zwischen den beiden Spitzenuniversitäten von Kansas war legendär. Das traditionelle Turnier zwischen den beiden Basketball-Teams – der »Sunflower Showdown« – wurde seit 1907 mit harten Bandagen ausgetragen. Die Arena brach in lautes Gelächter aus. Er hatte sie schon gewonnen und konnte es deshalb wagen, ihnen eine kleine Lektion in Makroökonomie anzubieten.8
Eine kleine Lektion in Makroökonomie
Ganz einfach ausgedrückt ist das Bruttoinlandsprodukt ein Maß für die Größe der Wirtschaft eines Landes: Wie viel wird produziert, wie viel wird verdient und wie viel wird im gesamten Land ausgegeben. Gerechnet wird selbstverständlich in Geldwert: Dollars, Euros, Yuan und Yen. Das BIP ist die übergeordnete Maßeinheit innerhalb eines komplexen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die seit 1953 den internationalen Standard liefert, um die Wirtschaftsleistung eines Landes zu messen. Diese Form der Berechnung wurde während des Zweiten Weltkriegs entwickelt, nicht zuletzt, weil die Regierungen sich Klarheit darüber verschaffen mussten, wie viel sie für ihre Kriegsanstrengungen ausgeben konnten.9
Bereits 1968 galt die Größe des BIP dann fast überall als Indikator für politischen Erfolg. Die Herausbildung der Gruppe der Sieben (G7) in den frühen 1970ern und der Gruppe der Zwanzig (G20) in den 1990ern zementierte seine Bedeutung. Diese eine Zahl wurde zum allerwichtigsten Gradmesser für Politik auf der ganzen Welt. Seit mehr als einem halben Jahrhundert gilt das BIP nun als konkurrenzloses Äquivalent für gesellschaftlichen Fortschritt. Umso außergewöhnlicher also, am Eröffnungstag eines Präsidentschaftswahlkampfs eine kritische Analyse des Begriffs geboten zu bekommen.
Als Kennedy anfing, über Wirtschaft zu sprechen, wurde die Menge ruhiger, erzählte mir Walinsky; die Aufmerksamkeit galt nun dem Inhalt der politischen Vision ebenso wie der Rhetorik des Senators. Sein Argument war bestechend einfach. Die Statistik, in die wir so viel Vertrauen setzen, zählt einfach die falschen Sachen. Sie beinhaltet zu viel »Schlechtes«, das unsere Lebensqualität beeinträchtigt, und schließt zu viel »Gutes« aus, das für uns wirklich wichtig ist. Das BIP »rechnet Luftverschmutzung und Zigarettenwerbung mit ein und Krankenwagen, die das Gemetzel auf unseren Autobahnen bereinigen«, erklärte Kennedy seiner Zuhörerschaft in der University of Kansas:
Es erfasst Spezialschlösser für unsere Türen und die Gefängnisse für die Leute, die diese Schlösser knacken. Es erfasst die Zerstörung der Mammutbäume und den Verlust unserer Naturwunder infolge wüster Zersiedlungen. Es erfasst Napalm und Atomsprengköpfe und Panzerwagen für die Polizei, mit denen sie die Unruhen in unseren Städten niederkämpft. Es erfasst Whitmans Gewehr und Specks Messer und auch die Fernsehprogramme, die Gewalt verherrlichen, damit man unseren Kindern dann Spielzeug verkaufen kann.10
Und während das BIP fälschlicherweise alle diese Dinge als Gewinn für uns einstuft, gibt es zahlreiche Aspekte unseres Lebens, die auf der Liste schlichtweg fehlen. Die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Die Beiträge derer, die keinen Lohn erhalten. Die Arbeit derer, die sich um die Jungen und die Alten zu Hause kümmern. Was es nicht erfasst, ist »die Gesundheit unserer Kinder, die Qualität ihrer Erziehung oder ihre Freude beim Spielen«. Es übersieht »die Schönheit unserer Poesie … die Klugheit unserer öffentlichen Debatten … Die Integrität unserer Beamten«.
Einen Politiker zu finden, der sich so ausdrückt, wäre heute noch schwerer als damals. Mehr denn je hat uns die Sprache des Wachstums im Griff. Die Politik hat sich immer weiter von Anstand, Integrität und Gemeinwohl entfernt. Dafür ist auch unsere Fixierung auf das BIP verantwortlich. Diese einzelne Zahl »misst weder unseren Verstand noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unsere Bildung, weder unser Mitgefühl noch unsere Treue zu unserem Land«, schloss Kennedy. »Kurz gesagt misst es alles außer dem, was das Leben lebenswert macht.« Am Ende dieser kritischen Bemerkungen machte er eine kurze Pause. Das Publikum begann zu klatschen. Nicht so euphorisch wie vorher, erinnerte sich Walinsky. »Der Applaus klang jetzt ernsthaft, nachdenklich. Aber man hatte den Eindruck, es könnte den ganzen Tag so weitergehen.«
Es ist schwer zu vermitteln, wie extrem Kennedys Bemerkungen damals aus der Reihe fielen. In den späten 1960er-Jahren wuchs die US-Wirtschaft jedes Jahr um rund fünf Prozent. Man ging davon aus, dass sich diese Wachstumsraten ewig so weiterentwickeln. Genau darauf baute auch die Wirtschaftswissenschaft auf. Und doch stand hier ein Politiker, nicht irgendeiner, sondern einer, der sich darum bewarb, Präsident der größten Volkswirtschaft der Erde zu werden, und zog die heiligste Parole des Kapitalismus in Zweifel: die unablässige Anhäufung von Reichtum.11
Einfach die »Geschäftigkeit« der Wirtschaft zu messen und das dann Fortschritt zu nennen, das war nie der Weg zu dauerhaftem Wohlstand und wird es auch niemals sein. So lautete die ungeschminkte Botschaft, die Robert F. Kennedy den Studentinnen und Studenten von Kansas so wortgewaltig mit auf den Weg gab. Diese Rede diente später allen BIP-Kritikern als Vorlage und hat bis zum heutigen Tag nichts an Gültigkeit verloren.12
Die Story dahinter
Dieser Tag in Kansas hat mich lange fasziniert, insbesondere nachdem jemand vor rund zwanzig Jahren in irgendeinem Keller einen Livemitschnitt der Rede ausgegraben hatte. Ich war ergriffen von der historischen Bedeutung der Aufzeichnung für die Debatte, die immer noch eher am Rande geführt wurde. Mit den Jahren betrachtete ich ihre Existenz zunehmend als selbstverständlichen Teil der Diskussion. Robert F. Kennedys Worte flossen quasi in das Alltagsvokabular derer ein, die dem Wirtschaftswachstum oder seinen Messinstrumenten kritisch gegenüberstehen.
Ich ertappte mich aber immer wieder bei der Frage, woher er wohl seine Ideen hatte. Wie fand so etwas wie eine Postwachstums-Kritik den Weg in die Wahlkampfrede eines Präsidenten, zu der Zeit und an dem Ort? Was brachte diesen Mann damals dazu, in diesem Moment so ein Insiderthema anzusprechen und dann eine derart gegenkulturelle Position einzunehmen? Könnte ich das herausfinden, würde ich vielleicht dahinterkommen, warum es mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert hat, bis die Ideen selbst auch nur annähernd ernst genommen wurden. Und warum sie immer noch großenteils missachtet werden.
Bei einer Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Rede teilte ich zufällig ein Podium mit Kerry Kennedy, der Gründerin der Robert F. Kennedy Stiftung für Menschenrechte und Robert F. Kennedys Tochter. Ich wollte unbedingt herausfinden, ob sie mehr über die Ursprünge seiner Bedenken zum Wirtschaftswachstum wusste als ich. Aber sie war noch ein Kind, als ihr Vater Kansas besuchte. Und obwohl sie mit ihrem Lebenswerk, dem Einsatz für Menschenrechte, sein Erbe weiterführte, war sie mit den Feinheiten des BIP nicht vertraut. Vor unserer Begegnung, sagte sie, sei ihr die Bedeutung dieser Rede gar nicht bewusst gewesen.
Unser Gespräch war für mich aber der Anlass, den Kontakt zu Adam Walinsky zu suchen, um seine Sicht der Dinge zu erfahren. Er war sofort bereit, mir einen tieferen Einblick zu gewähren, und machte unmissverständlich klar, dass nicht er es war, der als Ideengeber fungierte. Der Inhalt kam immer vom Redner selbst. »Ich habe die Reden geschrieben und die Worte ausgewählt«, sagte er. »Aber die Beispiele hat alle RFK selbst ausgesucht: Das waren Themen, über die er gesprochen hatte, seit wir in den Senat kamen. In der ganzen Rede ging es im Grunde darum, was für ein Land wir seiner Meinung nach sein sollten. Es ging um seine Vision von Amerika und was wir anstreben sollten.«
Kleinere Nachforschungen förderten zwei weitere, entscheidende Hinweise zum intellektuellen Hintergrund der Rede zutage. Der eine führte in den amerikanischen Liberalismus Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, der die Unzufriedenheit einer Gesellschaft zu erforschen begann, die auf Konsumismus aufgebaut ist. Der andere verwies auf die erstaunliche Wirkung des 1962 veröffentlichten Buches von Rachel Carson, Der stumme Frühling. Dieses Werk gilt seit jeher als Initialzündung für die moderne Umweltbewegung. Mit Sicherheit hatte es Einfluss auf die Kennedys. Robert F. Kennedys Bruder, der Präsident John F. Kennedy, hatte Carson in ihrem Schreibprozess durchweg unterstützt und ihr nach dem Erscheinen, gegen den heftigen Widerstand der Industrie, öffentlich den Rücken gestärkt.
Die Grundlage für das »aufkeimende Umweltbewusstsein« der Regierung John F. Kennedys wurde durch eine Rede von William O. Douglas gelegt. Douglas war Richter am Verfassungsgericht und einer von Johns engen Beratern in dem erfolgreichen Wahlkampf von 1960. Robert F. Kennedy und Douglas waren seit den 1950ern befreundet und hatten zusammen Wanderungen durch die Wildnis unternommen. Roberts Liebe zur Natur rührte zumindest teilweise daher, dass er mit ihr vertraut war. Douglas war ein williger Verbündeter im Kampf, das politische System stärker nach ökologischen Gesichtspunkten auszurichten. »Das Bewahren der Werte, die die Technologie zerstören wird … ist in der Tat die neue Eroberungsgrenze« erklärte er auf einer Wildniskonferenz in San Francisco.13
Diese Haltung spiegelte sich auch bei den amerikanischen Liberalen wider. In der Debatte, die zunehmend Fahrt aufnahm, ragten zwei intellektuelle Persönlichkeiten besonders heraus. (Einer von beiden im wahrsten Sinne des Wortes: Der Ökonom John Kenneth Galbraith war mehr als zwei Meter groß.) Galbraith hatte in seinen Schriften bereits scharfe Kritik an den zweifelhaften Beglückungen des Konsumismus geübt. In der meistzitierten Passage aus seinem Bestseller Gesellschaft im Überfluss (1958) schreibt er:
Die Familie, die mit ihrem rot-violetten Auto inklusive Klimaanlage, Servolenkung und Bremskraftverstärker einen Ausflug macht, fährt durch schlecht asphaltierte Städte, überall verunstaltet durch Abfall, bröckelnde Häuser, Werbetafeln und Leitungsmasten, die längst unterirdisch verlegt sein sollten.14
Sein Harvard-Kollege und ehemaliger Nachbar Arthur Schlesinger hatte sich in ähnlicher Weise über die Obszönität angeberischen Reichtums inmitten zunehmenden öffentlichen Elends geäußert. In seiner Streitschrift The Future of Liberalism von 1956 beklagte er Folgendes:
Konsumgüter werden immer raffinierter und luxuriöser und kommen uns schon zu den Ohren heraus; gleichzeitig aber wird alles andere schlechter: Unsere Schulen sind zunehmend überfüllt und heruntergekommen, die Lehrer erschöpft und schlecht bezahlt, die Spielplätze immer voller, die Städte schmutzig, die Straßen zunehmend verstopft und dreckig, die Nationalparks verwahrlost und die Polizei zunehmend überarbeitet und unzureichend ausgebildet.15
Beide, Galbraith wie Schlesinger, arbeiteten während John F. Kennedys Regierungszeit als Berater für die Kennedys. Die Grundlage für eine Kritik am BIP war also durch zwei wichtige kulturelle Debatten der damaligen Zeit gelegt worden, die beide kritisch mit dem amerikanischen Traum umgingen – die eine aus sozialen, die andere aus ökologischen Gründen. Am Ende des Tages bleibt die Inspiration für Robert F. Kennedys Rede an der Universität von Kansas aber doch das Produkt der Erfahrung, Einsicht und Empfindung eines einzelnen Mannes. Mehr muss man dazu wahrscheinlich gar nicht sagen.
»Es ist nicht alles in Ordnung«
Fast so kurios wie die Geschichte hinter der Rede von Kansas ist ihr bleibendes Vermächtnis. Vieles darin ist für uns unmittelbar relevant. In weiten Teilen ging es um eine tiefere, eher philosophische Auseinandersetzung mit der Natur des menschlichen Fortschritts. Was sich jedoch in den folgenden Jahrzehnten als besonders hartnäckig erwies, war ein Aspekt der Rede, der weniger philosophischer als technischer Natur war. Jenseits der ganzen Rhetorik war da ein klar definierbares Messproblem. Der von den Regierungen angewandte Hauptindikator für wirtschaftlichen Erfolg ist fehlerhaft.
Das Messen ist ein herrlich technisches Thema. Ist der verwendete Maßstab für den Zweck geeignet oder nicht? Spielen seine Unzulänglichkeiten eine Rolle? Kann man sie beheben? Welche Anpassungen könnten wir vornehmen, damit sie besser funktionieren? Die Variablen der Messungen würde man leichter reparieren können als unsere Fixierung auf das Wachstum selbst. Hier gab es einen Raum, in dem selbst die ängstlichen Zeitgenossen weitgehend risikofrei mit Robert F. Kennedys Einsichten flirten konnten, ohne sich gleich den tieferen Herausforderungen zu stellen, die darin enthalten waren. Zugegebenermaßen brauchten sie eine Weile, bis sie bei der Party auftauchten. Aber schließlich trafen doch ein paar unerwartete Gäste ein.
Das Programm der Europäischen Kommission BeyondGDP 2007 und die High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (HLEG) 2014 machten klar, wie gerne wir uns mit den technischen Fragen des Messens beschäftigen. Selbst dem World Economic Forum ist es gelungen, positiv über Alternativen zum BIP zu sprechen. Im Lauf der Zeit wurden Kennedys Worte selbst irgendwie Kult. Immer und immer wieder wurden sie zitiert – nicht nur von »Wahnsinnigen, Idealisten und Umstürzlern«, sondern gelegentlich sogar von modernen Präsidentschaftskandidaten und konservativen Premierministern.16
Diskussionen über Messinstrumente schaffen einen Raum für echte politische Innovation in einer Debatte, die sich trotzdem noch schwertut, die ideologische Hülle des Wachstums abzuwerfen. So unterschiedliche Länder wie Bhutan, Neuseeland, Finnland und Schottland haben begonnen (in den meisten Fällen erst in jüngster Zeit), neue Methoden zur Messung des Fortschritts zu entwickeln. Einige dieser Initiativen führen sogenannte »Satellitenkonten«, die die Herrschaft des BIP nicht wirklich infrage stellen. Andere versuchen ernsthaft, die Alternativen in Wirtschaftspolitik und Haushaltsentscheidungen zu integrieren.17
Debatten dieser Art sind wichtig. Das Messen ist wichtig. »Wenn wir das Falsche messen, werden wir das Falsche tun«, erklärte der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, Co-Vorsitzender der OECD-Gruppe. »Wenn unsere Messungen uns sagen, dass alles in bester Ordnung ist, obwohl das gar nicht stimmt, dann werden wir selbstgefällig«, sagte er kürzlich. »Und es sollte klar sein, dass trotz der Zuwächse beim BIP und obwohl die Krise von 2008 ein ganzes Stück weit hinter uns liegt, eben nicht alles in bester Ordnung ist.«18
Und doch ist die Kritik am Wachstum selbst, der eigentliche Postwachstums-Refrain, der sich durch Kennedys Rede zieht, viel weniger erprobt. Jahrzehntelang wurde sie von der vorherrschenden Politik praktisch ignoriert. Mithilfe des Aktivismus von Jugendlichen bekam sie größere Präsenz. Aber selbst jetzt noch wird sie meist als kuriose Abweichung von der Norm abgetan, die ganz offensichtlich im Widerspruch zur Mainstreamdebatte stünde. Das Lächeln von Kurz in Davos sprach Bände. Erst ignorieren sie dich. Dann lachen sie. Bis wir plötzlich unsanft darauf gestoßen werden, dass es Zeit ist, sich der Realität zu stellen.
Die stationäre Wirtschaft
Zu der Zeit, als Kennedy in Kansas sprach, bereitete ein junger Agrarökonom namens Herman Daly gerade die Veröffentlichung seines ersten großen wissenschaftlichen Aufsatzes vor, an dem er seit 1965 gearbeitet hatte. Das Hauptargument in »On Economics as a Life Science« ging dahin, dass sich Ökonomie und Biologie letztendlich mit der Untersuchung ein und desselben Gegenstands beschäftigen: mit dem Prozess des Lebens selbst.
Das ist eine Haltung, die genau den Kern der Argumente trifft, die ich in diesem Buch entwickeln möchte. Ein Appell an die Ökonomen, zu begreifen, dass die Wirtschaft kein von der natürlichen Welt getrennter, noch nicht einmal abtrennbarer Teil ist, sondern eine »hundertprozentige Tochtergesellschaft« der Umwelt. Daly hielt sich gerade in Brasilien auf, als er seine Arbeit beim angesehenen Journal of Political Economy einreichte, ohne Zugriff auf adäquate Büroausstattung. Sein Manuskript war lediglich eine Rohfassung mit handschriftlich angebrachten Korrekturen. Zu seiner Überraschung wurde der Artikel sofort angenommen. Die Druckfassung erschien im Mai 1968, gerade mal zwei Monate nach Kennedys Kritik am BIP.19
Das Timing war so auffällig, dass ich mich unweigerlich fragte, ob Daly von der Rede Kennedys wusste oder irgendetwas mit ihr zu tun hatte. Nach allem, was er mir erzählt hat, wurde er aber erst viel später auf sie aufmerksam. Mit den Ideen, die Kennedy unmittelbar beeinflussten – Carsons Der stumme Frühling und die Arbeiten der amerikanischen Liberalen – war er aber natürlich vertraut. Insbesondere Galbraiths Buch Gesellschaft im Überfluss hatte einen enormen Einfluss auf ihn, als er noch ein junger Student der Wirtschaftswissenschaften war.20
In den Jahren nach der Veröffentlichung des Artikels »On Economics as a Life Science« begann Daly, den neuen Wissenschaftszweig immer mehr zu konkretisieren, der als ökologische Ökonomie bekannt wurde. Im Zentrum seiner Untersuchung stand die Frage nach der Größenordnung. Wie sollte die menschliche Wirtschaft einfach weiterwachsen können, wenn doch die Dimensionen des Planeten unbestreitbar endlich waren? Im Grunde war das gar nicht möglich, so sein Argument. In den frühen 1970er-Jahren veröffentlichte er die Grundlagen dessen, was er dann »stationäre Wirtschaft« nannte – definiert als eine Wirtschaft mit konstantem Kapitalstock und konstanter Bevölkerung. Der entscheidende Punkt ist, dass der Kapitalstock klein genug sein muss, damit der Material- und Energiefluss, der zu seiner Erhaltung benötigt wird, innerhalb der Tragfähigkeit des Planeten bleibt. Andernfalls würde dieser irgendwann zusammenbrechen. Es war »eine Erweiterung des demographischen Modells einer stationären Bevölkerung, um den Bestand physischer Artefakte mit einzubeziehen«, schrieb er 1974. Der gleiche Grundgedanke »findet sich in den Erörterungen [des Ökonomen] John Stuart Mill zum stationären Zustand der klassischen Ökonomie«.21
Hier kommen wir nun zu einem der merkwürdigsten Aspekte kultureller Mythen. Jede Kultur ist gegenüber ihrer eigenen mythischen Natur blind. Wir sind dazu bestimmt, innerhalb der Blase zu leben. So wie Jim Carrey als Truman Burbank in Peter Weirs Film The Truman Show: Alles wirkt ganz real. Die Lebensgewohnheiten und die Grenzen unserer Welt scheinen unwandelbar. Innerhalb der Blase ist Wachstum eine Norm, an der nicht zu rütteln ist, und das Konzept eines stationären Zustands wirkt wie geistesgestörte Verirrung. Zoomt man sich mal für einen Moment heraus, dann verkehren sich die Rollen komplett ins Gegenteil. Einer der Gründerväter der Wirtschaftswissenschaft hatte schon vor über 150 Jahren über die Postwachstums-Ökonomie geschrieben.
John Stuart Mill bekundete einen tiefen Widerwillen gegenüber der Gesellschaft, die da plötzlich auf dem Höhepunkt der Industriellen Revolution um ihn herum aus dem Boden schoss. »Ich bin überhaupt nicht angetan von dem Lebensideal der Leute, die diesen ständigen Kampf ums Weiterkommen für den Normalzustand unseres Daseins halten; die denken, dieses Herumtrampeln, Niedermachen, die Ellbogen ausfahren und sich gegenseitig auf die Füße treten, also das, was unser Gesellschaftsleben derzeit ausmacht, sei das Los, das sich die Menschheit am sehnlichsten wünscht«, schrieb er in seinem 1848 erschienenen Werk Grundsätze der politischen Ökonomie. Was den stationären Zustand selbst betrifft, so räumte er ein: »Ich kann ihm nicht die ungeteilte Abneigung entgegenbringen, mit der er generell von den Politökonomen der alten Schule betrachtet wird.« Ganz im Gegenteil, meinte er, »ich neige zu der Überzeugung, dass er insgesamt eine beträchtliche Verbesserung unserer gegenwärtigen Situation darstellen würde.«22
Mit anderen Worten stellte der große klassische Ökonom Folgendes fest: Eine Postwachstums-Welt könnte für uns alle ein reicherer, nicht ärmerer, Ort zum Leben sein. Und es ist genau diese Vision einer Welt, die reicher, gerechter und befriedigender ist – die Mill erspäht, Kennedy gefordert und Daly entwickelt hat –, aus der dieses Buch seine Inspiration bezieht.
Die Reise in diesem Buch
Unsere vorherrschende Vision sozialen Fortschritts beruht fatalerweise auf einer falschen Versprechung: dass es immer mehr geben wird, und zwar für alle. Geschmiedet im Schmelztiegel des Kapitalismus ist dieser Gründungsmythos inzwischen in bedrohlicher Auflösung begriffen. Das erbarmungslose Streben nach ewigem Wachstum hat uns ökologische Zerstörung, finanzielle Gebrechlichkeit und gesellschaftliche Instabilität gebracht.
Hat der Mythos überhaupt jemals seinen Zweck erfüllt? Das ist nicht ganz klar. Sein fatales Missverständnis liegt in der Annahme, »mehr« sei immer »besser«. Dort, wo noch Mangel besteht, hat diese Behauptung ihre Berechtigung – zumindest bedingt. Wo aber bereits Überfluss herrscht, liegt sie kategorisch falsch. Im Kern des Kapitalismus lassen sich zwei entscheidende Schwächen ausmachen: Die eine ist die Unfähigkeit, zu erkennen, wann diese Schwelle erreicht ist. Die andere ist die Unwissenheit darüber, wie wir aufhören sollen, wenn es so weit ist.
Diese Fehler sind so tief im System verwurzelt, dass es nicht einfach ist, ihnen zu entkommen. Es gibt keinen magischen Trick, der uns bequem aus der Falle katapultiert, ohne die Grundlagen unserer eigenen kulturellen Überzeugungen zu erschüttern. Das Ziel dieses Buches ist es, sich dieser Aufgabe zu stellen. Indem ich die dem Kapitalismus eingeschriebenen Annahmen aufspalte und die tieferliegenden Prämissen neu formuliere, möchte ich die Grundlagen für ein Postwachstums-Narrativ neu aufstellen.
Der Weg führt mitten durch die Windungen der Ideengeschichte. Diese Geschichte wurde von einigen außergewöhnlichen Menschen geschaffen. Ihr Leben und ihre Anstrengungen bieten uns eine Möglichkeit, Theorie in Erzählungen zu verankern. Wenn wir ihnen respektvoll zuhören, können sie uns leiten. In diesem Kapitel war unser Leitstern natürlich Robert F. Kennedy, ehemaliger US-Justizminister und hoffnungsvoller Präsidentschaftskandidat im Wahlkampf 1968. Während sich das Buch entfaltet, wird die Gruppe der Mitwirkenden allmählich größer werden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Charaktere ausgewählt habe oder sie mich. Ich könnte auch nicht mit Gewissheit sagen, dass ich die Richtung ihrer Erzählung bestimmt habe. Während des Schreibens lockten mich ihre Stimmen unnachgiebig weg von meinen anfänglichen, eher einfacheren Zielen und zwangen mich in komplexere Fragestellungen, die ich ursprünglich nicht ansprechen wollte. Diese Frauen und Männer wurden meine intellektuellen Gefährtinnen und Gefährten. Immer wieder habe ich mich in ihrem Leben und ihren Bestrebungen verloren – nicht zu viel, hoffe ich. Aber doch intensiv genug, um gelegentlich in diesen bestimmten Grenzbereich zu gelangen, in dem Unerwartetes passieren kann. Meistens war es so.
Mir ist durchaus bewusst, dass für die Umsetzung dieser Reise Tausende von Begleiterinnen und Begleitern infrage kommen. Dass ich auch andere hätte auswählen können, versteht sich von selbst. Dass hier auch Stimmen fehlen, war nicht zu vermeiden. Letztendlich ist dies kein Buch der Antworten. Es ist ein Buch der Fragen. Mit einigen vorsichtigen Anregungen, die sich daraus ergeben. Ein anderes Buch, an einem anderen Tag (oder in einem anderen Jahr) geschrieben, hätte vielleicht mit einer ganz anderen Besetzungsliste aufgewartet. Ich wage mir vorzustellen, dass es trotzdem bei einem ähnlichen Zielort angekommen wäre.