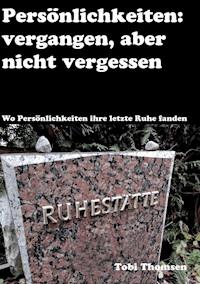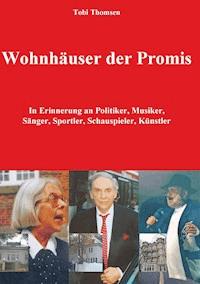
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Etwa 82 Millionen Menschen leben in Deutschland, darunter etwa 10.000 prominente Persönlichkeiten. Einige sorgen als TV-Moderator für gute Laune, verkünden als Sprecher Nachrichten, moderieren Radiosendungen, holen Titel in verschiedenen Sportarten nach Deutschland oder prägen beispielsweise als Architekten die Stadtbilder. Nicht zu vergessen Politiker, die in Deutschland die politische Richtung vorgeben und das Land regieren. Mit seinen 16 Bundesländern und 295 Landkreisen bietet Deutschland wunderschöne Platze, sich häuslich niederzulassen. In einer Auswahl von 206 Kurzbiografien werden in diesem Buch interessante Persönlichkeiten vorgestellt, die in Deutschland ihre einstigen Wohn- und Wirkungsstätten hatten. Von Schauspieler Hans Albers über Gerda Gmelin, Witta Pohl, Roger Cicero, Helmut Schmidt, Hellmuth Karasek, Vadim Glowna, Otto Sander, Evelyn Hamann, Helmut Schmidt, Willy Brandt bis zu TV-Journalist Peter von Zahn. Das Buch fuhrt den Leser kreuz und quer durch Städte Deutschlands: von Glücksburg im Norden bis Grunwald im Suden, sowie Berlin im Osten und Köln im Westen des Landes. Das Buch soll an die 206 ausgewählten Persönlichkeiten erinnern. Sie haben etwas für Deutschland getan. Direkt und indirekt. Mit diesem Buch soll ihnen etwas postum zurückgegeben werden."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wo Persönlichkeiten ihren Wohnsitz hatten
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Guido Westerwelle, 27. Dezember 1961 bis 18. März 2016 (Politiker)
Karl-Heinz von Hassel, 8. Februar 1939 bis 19. April 2016 (Schauspieler)
Edgar Bessen, 11. November 1933 bis 2. Februar 2012 (Schauspieler)
Alexandra, 19. Mai 1942 bis 31. Juli 1969 (Sängerin)
Rudi Carrell, 19. Dezember 1934 bis 7. Juli 2006 (Showmaster)
Mick Werup, 16. November 1958 bis 7. Januar 2011 (Schauspieler)
Evelyn Hamann, 6. August 1942 bis 28. Oktober 2007 (Schauspielerin)
Witta Pohl, 1. November 1937 bis 4. April 2011 (Schauspielerin)
Dieter Pfaff, 2. Oktober 1947 bis 5. März 2013 (Schauspieler)
Rolf Dittmeyer, 27. April 1921 bis 17. Mai 2009 (Unternehmer)
Diether Krebs, 11. August 1947 bis 5. Januar 2000 (Schauspieler, Komiker)
Eva Maria Bauer, 21. Oktober 1923 bis 17. Mai 2006 (Schauspielerin)
Axel Cäsar Springer, 2. Mai 1912 bis 22. September 1985 (Verleger)
Günter Pfitzmann, 8. April 1924 bis 30. Mai 2003 (Schauspieler)
Rex Gildo, 2. Juli 1936 bis 26. Oktober 1999 (Schlagersänger, Schauspieler)
Götz George, 23. Juli 1938 bis 19. Juni 2016 (Schauspieler in Theater und Film)
Inge Meysel, 30. Mai 1910 bis 10. Juli 2004 (Schauspielerin)
Grit Berthold, 1936 bis 2016 (Buchautorin)
Hans Albers, 22. September 1891 bis 24. Juli 1960 (Schauspieler)
Peter Martin Hetzel, 19. Dezember 1960 bis 29. Juni 2014 (Literaturkritiker)
Wolfgang Gruner, 20. September 1926 bis 16. März 2002 (Schauspieler)
Ernst Barlach, 2. Januar 1870 bis 24. Oktober 1938 (Schriftsteller)
Horst Frank, 28. Mai 1929 bis 25. Mai 1999 (Schauspieler)
Brigitte Mira, 20. April 1910 bis 8. März 2005 (Schauspielerin)
Ilse Werner, 11. Juli 1921 bis 8. August 2005 (Schauspielerin, Schlagersängerin)
Joachim Richert, 11. April 1938 bis 20. März 2007 (Schauspieler)
Gerda Gmelin, 23. Juni 1919 bis 14. April 2003 (Schauspielerin)
Gyula Trebitsch, 3. November 1914 bis 12. Dezember 2005 (TV-Produzent)
Vadim Glowna, 26. September 1941 bis 24. Januar 2012 (Schauspieler)
Roger Cicero, 6. Juli 1970 bis 24. März 2016 (Pop- und Jazzmusiker)
Otto Sander, 30. Juni 1941 bis 12. September 2013 (Schauspieler)
Edith Hancke, 14. Oktober 1928 bis 4. Juni 2015 (Schauspielerin)
Chantal de Freitas, 1967 bis 2013 (Sängerin, Schauspielerin)
Jörg Pleva, 23. Juni 1942 bis 14. August 2013 (Schauspieler, Synchronsprecher)
Willy Brandt, 18. Dezember 1913 bis 8. Oktober 1992 (Politiker)
James Last, 17. April 1929 bis 9. Juni 2015 (Musiker, Bandleader)
Helga Feddersen, 14. März 1930 bis 24. November 1990 (Schauspielerin)
Bert Kaempfert, 16. Oktober 1923 bis 21. Juni 1980 (Musikproduzent)
Joachim Fuchsberger, 11. März 1927 bis 11. September 2014 (Schauspieler)
Siegfried Lenz, 17. März 1926 bis 7. Oktober 2014 (Autor, Schriftsteller)
Gerty Molzen, 30. Januar 1906 bis 31. August 1990 (Schauspielerin)
Werner Veigel, 9. November 1928 bis 2. Mai 1995 (Nachrichtensprecher)
Hans Rosenthal, 2. April 1925 bis 10. Februar 1987 (Entertainer, Moderator)
Heidi Kabel, 27. August 1914 bis 15. Juni 2010 (Volksschauspielerin)
Henry Vahl, 26. Oktober 1897 bis 21. Juli 1977 (Volksschauspieler)
Hans Mahler, 15. August 1900 bis 25. März 1970 (Theaterschauspieler)
Frank Jacobsen, 10. Dezember 1964 bis 18. Juni 2014 (Schauspieler)
Friedhelm Mönter, 22. November 1946 bis 18. Februar 2009 (Moderator)
Rudolph Moshammer, 27. September 1940 bis 14. Januar 2005 (Modedesigner)
Herbert Lichtenfeld, 16. Juni 1927 bis 11. Dezember 2001 (Fernsehautor)
Manfred Steffen, 28. Juni 1916 bis 22. Januar 2009 (Schauspieler)
Heinz Erhardt, 20. Februar 1909 bis 5. Juni 1979 (Schauspieler, Komiker)
Wolfgang Borchert, 20. Mai 1921 bis 20. November 1947 (Schriftsteller)
Hildegard Krekel, 2. Juni 1952 bis 26. Mai 2013 (Schauspielerin)
Erwin Seeler, 29. April 1910 bis 10. Juli 1997 (Fußballspieler)
John Olden, 3. Oktober 1918 bis 12. September 1965 (Regisseur, Filmproduzent)
Detlev von Liliencron, 3. Juni 1844 bis 22. Juli 1909 (Lyriker, Bühnenautor)
Hans von Borsody, 20. September 1929 bis 4. November 2013 (Schauspieler)
Johann Adolph Hasse, 25. März 1699 bis 16. Dezember 1783 (Komponist)
Karen Friesicke, 11. April 1962 bis 25. Dezember 2015 (Schauspielerin)
Uwe Friedrichsen, 27. Mai 1934 bis 30. April 2016 (Schauspieler)
Richard von Weizsäcker, 15. April 1920 bis 31. Januar 2015 (Politiker)
Gerhard Schröder, 3. März 1921 bis 22. Januar 2012 (Intendant des NDR)
Klausjürgen Wussow, 30. April 1929 bis 19. Juni 2007 (Schauspieler)
Johannes Brahms, 7. Mai 1833 bis 3. April 1897 (Komponist)
Joachim Wolff, 22. Juli 1920 bis 30. November 2000 (Schauspieler, Sprecher)
Fritz Klein, 23. März 1937 bis 2. Dezember 2014 (Sportjournalist)
Monica Bleibtreu, 4. Mai 1944 bis 13. Mai 2009 (Schauspielerin)
Karl-Heinz Köpcke, 29. September 1922 bis 27. September 1991 (Sprecher)
Dietmar Mues, 21. Dezember 1945 bis 12. März 2011 (Schauspieler)
Hellmuth Karasek, 4. Januar 1934 bis 29. September 2015 (Literaturkritiker)
Karina Kraushaar, 9. April 1971 bis 5. März 2015 (Schauspielerin)
Gisela Trowe, 5. September 1922 bis 5. April 2010 (Schauspielerin)
Rosamunde Pietsch, 2. Februar 1915 bis 18. Mai 2016 (Hamburgs erste Polizistin)
Hannelore Schmidt, 3. März 1919 bis 21. Oktober 2010 (Naturforscherin)
Harald Juhnke, 10. Juni 1929 bis 1. April 2005 (Schauspieler)
Hermann Lause, 7. Februar 1939 bis 28. März 2005 (Schauspieler)
Peter von Zahn, 29. Januar 1913 bis 26. Juli 2001 (Rundfunksprecher)
Will Quadflieg, 15. September 1914 bis 27. November 2003 (Schauspieler)
Jürgen Roland, 25. Dezember 1925 bis 21. September 2007 (Regisseur)
Marcel Reich-Ranicki, 2. Juni 1920 bis 18. September 2013 (Literaturkritiker)
Wolf-Dietrich Berg, 17. Mai 1944 bis 26. Januar 2004 (Schauspieler)
Uwe Barschel, 13. Mai 1944 bis 10. Oktober 1987 (Politiker)
Beate Uhse, 25. Oktober 1919 bis 16. Juli 2001 (Unternehmerin)
Willy Millowitsch, 8. Januar 1909 bis 20. September 1999 (Schauspieler)
Harry Rowohlt, 27. März 1945 bis 15. Juni 2015 (Autor, Schauspieler)
Günter Willumeit, 10. Dezember 1941 bis 17. Oktober 2013 (Humorist)
Tony Sheridan, 21. Mai 1940 bis 16. Februar 2013 (Musiker)
Larry Evers, 18. April 1951 bis 25. Mai 2014 (Musiker)
Hans Hartz, 22. Oktober 1943 bis 30. November 2002 (Sänger)
Peter Frankenfeld, 31. Mai 1913 bis 4. Januar 1979 (Entertainer, Schauspieler)
Heinz Weiss, 12. Juni 1921 bis 20. November 2010 (Schauspieler)
Konrad Adenauer, 5. Januar 1876 bis 19. April 1967 (Politiker)
Ronny, 10. März 1930 bis 18. August 2011 (Schlagersänger, Komponist)
Peter Struck, 24. Januar 1943 bis 19. Dezember 2012 (Politiker)
Wolfgang Rademann, 24. November 1934 bis 31. Januar 2016 (Fernsehproduzent)
Helmut Schmidt, 23. Dezember 1918 bis 10. November 2015 (Politiker)
Christa Siems, 28. Mai 1916 bis 27. Mai 1990 (Volksschauspielerin)
Emil Nolde, 7. August 1867 bis 13. April 1956 (Maler, Grafiker)
Günter Lüdke, 22. August 1930 bis 3. Mai 2011 (Schauspieler, Sprecher)
Max Greger, 2. April 1926 bis 15. August 2015 (Musiker, Big-Band-Leader)
Henning Schlüter, 1. März 1927 bis 20. Juli 2000 (Schauspieler)
Alfred Hause, 8. August 1920 bis 14. Januar 2005 (Dirigent, Kapellmeister)
Günter Grass, 16. Oktober 1927 bis 13. April 2015 (Schriftsteller, Maler)
Lonny Kellner-Frankenfeld, 8. März 1930 bis 22. Januar 2003 (Schauspielerin)
Otto Ernst, 7. Oktober 1862 bis 5. März 1926 (Schriftsteller)
Egon Monk, 18. Mai 1927 bis 28. Februar 2007 (Schauspieler, Filmregisseur)
Mareike Carrière, 26. Juli 1954 bis 17. März 2014 (Schauspielerin)
Max Schmeling, 28. September 1905 bis 2. Februar 2005 (Profi-Boxer)
Hans Leip, 22. September 1893 bis 6. Juni 1983 (Schriftsteller, Maler)
Alfred Schnittke, 24. November 1934 bis 3. August 1998 (Komponist)
Rolf Bohnsack, 3. März 1937 bis 8. August 2009 (Volksschauspieler)
Ernst Rowohlt, 23. Juni 1887 bis 1. Dezember 1960 (Verleger)
Annemarie Schradiek, 23. Oktober 1907 bis 2. März 1993 (Schauspielerin)
Ida Dehmel, 14. Januar 1870 bis 29. September 1942 (Frauenrechtlerin)
Marion Gräfin Dönhoff, 2. Dezember 1909 bis 11. März 2002 (Journalistin)
Richard Dehmel, 18. November 1863 bis 8. Februar 1920 (Schriftsteller)
Dorothea Ackermann, 12. Februar 1752 bis 21. Oktober 1821 (Schauspielerin)
Max Brauer, 3. September 1887 bis 2. Februar 1973 (Politiker)
Ottmar Schreiner, 21. Februar 1946 bis 6. April 2013 (Politiker)
Willem Fricke, 10. August 1928 bis 24. Juli 2009 (Schauspieler)
Hildburg Freese, 26. August 1915 bis 16. Juni 2002 (Schauspielerin)
Albert Ballin, 15. August 1857 bis 9. November 1918 (Reeder)
Gorch Fock, 22. August 1880 bis 31. Mai 1916 (Schriftsteller)
Gustaf Gründgens, 22. Dezember 1899 bis 7. Oktober 1963 (Schauspieler)
Domenica Niehoff, 3. August 1945 bis 12. Februar 2009 (Prostiuierte)
Casper Voght, 17. November 1752 bis 20. März 1839 (Kaufmann)
Lothar Hemshorn, 29. April 1924 bis 24. Oktober 2012 (Kaufmann)
Werner Riepel, 18. Mai 1922 bis 18. August 2012 (Schauspieler)
Ida Ehre, 9. Juli 1900 bis 16. Februar 1989 (Schauspielerin, Regisseurin)
Kurt Sieveking, 21. Februar 1897 bis 16. März 1986 (Politiker)
Ernst Thälmann, 16. April 1886 bis 18. August 1944 (Politiker)
Fritz Schumacher, 4. November 1869 bis 5. November 1947 (Architekt)
Jens Scheiblich, 2. November 1942 bis 25. Dezember 2010 (Schauspieler)
Konrad Ernst Ackermann, 1. Februar 1712 bis 13. November 1771 (Schauspieler)
Helmuth Gmelin, 21. März 1891 bis 18. Oktober 1959 (Schauspieler)
Jürgen Pooch, 21. Mai 1943 bis 18. August 1998 (Volksschauspieler)
Walther Blohm, 25. Juli 1887 bis 12. Juni 1963 (Werftbesitzer, Flugzeugbauer)
Jürgen Fehling, 1. März 1885 bis 14. Juni 1968 (Theaterregisseur, Schauspieler)
Gerd Bucerius, 19. Mai 1906 bis 29. September 1995 (Verleger, Politiker)
Hubert Fichte, 21. März 1935 bis 8. März 1986 (Schriftsteller, Ethnograph)
Fritz Höger, 12. Juni 1877 bis 21. Juni 1949 (Baumeister, Architekt)
Philipp F. Reemtsma, 22. Dezember 1893 bis 11. Dezember 1959 (Unternehmer)
Oskar, 24. Februar 1922 bis 3. Juli 2006 (Zeichner, Karikaturist und Maler)
Hilde Sicks, 25. November 1920 bis 31. Juli 2007 (Schauspielerin)
Elisabeth Goebel, 9. Mai 1920 bis 5. April 2005 (Schauspielerin)
Ivo Hauptmann, 9. Februar 1886 bis 28. September 1973 (Maler)
Hans Henny Jahnn, 17. Dezember 1894 bis 29. November 1959 (Schriftsteller)
Rolf Liebermann, 14. September 1910 bis 2. Januar 1999 (Komponist)
Peter Rühmkorf, 25. Oktober 1929 bis 8. Juni 2008 (Schriftsteller)
Roger Willemsen, 15. August 1955 bis 7. Februar 2016 (Publizist, Moderator)
Hans Apel, 25. Februar 1932 bis 6. September 2011 (Politiker)
Ingeburg Herz, 23. Februar 1920 bis 30. September 2015 (Unternehmerin)
Justus Brinckmann, 23. Mai 1843 bis 8. Februar 1915 (Jurist, Museumsdirektor)
Gustav Mahler, 7. Juli 1860 bis 18. Mai 1911 (Komponist)
Johann Hinrich Wichern, 21. April 1808 bis 7. April 1881 (Theologe)
Max Lohfing, 20. Mai 1870 bis 9. September 1953 (Kammersänger)
Carl von Ossietzky, 3. Oktober 1889 bis 4. Mai 1938 (Journalist, Schriftsteller)
Michael Jary, 24. September 1906 bis 12. Juli 1988 (Komponist)
Carsten Diercks, 8. August 1921 bis 2. November 2009 (Dokumentarfilmer)
Harry Meyen, 31. August 1924 bis 14. April 1979 (Schauspieler, Regisseur)
Helga Diercks-Norden, 6. April 1924 bis 12. Juli 2011 (Journalistin, Politikerin)
Henning Voscherau, 13. August 1941 bis 24. August 2016 (Politiker)
Ernst von Klipstein, 3. Februar 1908 bis 22. November 1993 (Schauspieler)
Eva Rühmkorf, 6. März 1935 bis 22. Januar 2013 (Politikerin)
Hubertus Wald, 2. Februar 1913 bis 26. Februar 2005 (Unternehmer, Mäzen)
Peter Beil, 9. Juli 1937 bis 13. April 2007 (Schlagersänger, Komponist)
Ernst Grabbe, 26. Februar 1926 bis 8. Februar 2006 (Schauspieler)
Hans Freundt, 14. März 1892 bis 28. Januar 1953 (Schauspieler, Radiomoderator)
Hermann Rockmann, 26. Mai 1917 bis 16. August 1997 (Radio- und TV-Reporter)
Willy Fritsch, 27. Januar 1901 bis 13. Juli 1973 (Schauspieler)
Jens-Werner Fritsch, 27. November 1947 bis 28. Januar 1995 (Schauspieler)
Erich Klabunde, 20. Februar 1907 bis 21. November 1950 (Journalist)
Hildegard Wulff, 7. Januar 1898 bis 23. Juli 1972 (Sonderpädagogin)
Anita Rée, 9. Februar 1885 bis 12. Dezember 1933 (Malerin)
Erich Ziegel, 26. August 1876 bis 30. November 1950 (Schauspieler, Regisseur)
Julius Kobler, 21. April 1866 bis 22. Juni 1942 (Schauspieler, Regisseur)
Otto Lüthje, 17. Mai 1902 bis 23. Januar 1977 (Schauspieler, Hörspielsprecher )
Sexy Cora, 2. Mai 1987 bis 20. Januar 2011 (Pornodarstellerin, Schauspielerin)
Wolfgang Kieling, 16. März 1924 bis 7. Oktober 1985 (Schauspieler)
Uwe Hacker, 1. März 1941 bis 18. November 1995 (Schauspieler)
Karl-Otto Maue, 1. November 1946 bis 4. Juli 2008 (Journalist, Redakteur)
Peter Schulz, 25. April 1930 bis 17. Mai 2013, (Politiker, Jurist)
Hermann Friedrich Messtorff, von 1854 bis 1915 (Kaufmann)
Kurt Adolf Körber, 7. September 1909 bis 10. August 1992 (Unternehmer)
Hanne Mertens, 13. April 1909 bis 23. April 1945 (Schauspielerin)
Claus Arndt, 16. April 1927 bis 10. Februar 2014 (Politiker)
Werner Hackmann, 17. April 1947 bis 28. Januar 2007 (Politiker, Sportfunktionär)
Hermann Distel, 5. September 1875 bis 15. August 1945 (Architekt)
Curd Jürgens, 13. Dezember 1915 bis 18. Juni 1982 (Schauspieler)
Hanno Edelmann, November 1923 bis 13. Juli 2013 (Maler, Grafiker, Bildhauer)
Hermann Schnabel, 29. März 1921 bis 9. Juni 2010 (Unternehmer, Philatelist)
Lonzo, 29. September 1952 bis 13. November 2001 (Musiker)
John Jahr, 20. April 1900 bis 8. November 1991 (Verleger)
Heini Kaufeld, 19. Juli 1920 bis 6. Mai 1996 (Schauspieler, Regisseur)
Drafi Deutscher, 9. Mai 1946 bis 9. Juni 2006 (Sänger, Musikproduzent)
Ralf Arnie, 14. Februar 1924 bis 19. Januar 2003 (Komponist, Liedtexter)
Hans Tügel, 21. August 1894 bis 26. August 1984 (Schauspieler, Regisseur)
Wilken F. Dincklage, 21. August 1942 bis 18. Oktober 1994 (Musiker, Moderator)
Horst Michael Neutze, 17. November 1923 bis 19. November 2006 (Schauspieler)
Herbert Weichmann, 23. Februar 1896 bis 9. Oktober 1983 (Politiker)
Hans-Dietrich Genscher, 21. März 1927 bis 31. März 2016 (Politiker)
Arno Schmidt, 18. Januar 1914 bis 3. Juni 1979 (Schriftsteller)
Elsbeth Weichmann, 20. Juni 1900 bis 10. Juli 1988 (Politikerin)
Friedrich Chrysander, 8. Juli 1826 bis 3. September 1901 (Musikwissenschaftler)
Klaus Brunnstein, 25. Mai 1937 bis 19. Mai 2015 (Informatiker, Politiker)
Hanne Darboven, 29. April 1941 bis 9. März 2009 (Konzeptkünstlerin)
Hein ten Hoff, 19. November 1919 bis 13. Juni 2003 (Boxer)
Lotte Koch, 9. März 1913 bis 7. Mai 2013 (Schauspielerin)
Lale Andersen, 23. März 1905 bis 29. August 1972 (Sängerin, Schauspielerin)
Max Herz, 3. Juli 1905 bis 12. Mai 1965 (Unternehmer, Kaufmann)
Inhalt
Vorwort
Ackermann,
Dorothea
Ackermann,
Konrad
Adenauer,
Konrad
Albers,
Hans
Alexandra
Andersen,
Lale
Apel,
Hans
Arnie,
Ralf
Arndt,
Claus
Ballin,
Albert
Barlach,
Ernst
Barschel,
Uwe
Bauer,
Eva-Maria
Beil,
Peter
Brahms,
Johannes
Brand,
Willy
Brinckmann,
Justus
Brunnstein,
Klaus
Berg,
Wolf-Dietrich
Berthold,
Grit
Bessen,
Edgar
Bleibtreu,
Monica
Blohm,
Walther
Bohnsack,
Rolf
Borchert,
Wolfgang
Borsody,
Hans von
Brauer,
Max
Bucerius,
Gerd
Carrell
.
Rudi
Carrière,
Mareike
Chrysander,
Friedrich
Cicero,
Roger
Cora,
Sexy
Darboven,
Hanne
Dehmel,
Ida
Dehmel,
Richard
Dittmeyer,
Rolf
Dönhoff,
Marion
Deutscher,
Drafi
Diercks,
Carsten
Diercks-Norden,
Helga
Dincklage,
Wilken F.
Distel,
Hermann
Edelmann,
Hanno
Ehre,
Ida
Erhardt,
Heinz
Ernst,
Otto
Evers,
Larry
Feddersen,
Helga
Fichte,
Hubert
Fock,
Gorch
Frank,
Horst
Frankenfeld,
Peter
Freitas,
Chantal de
Frese,
Hildburg
Freundt,
Hans
Fricke,
Willem
Friedrichsen,
Uwe
Friesicke,
Karen
Fritsch,
Jens-Werner
Fritsch,
Willy
Fuchsberger,
Joachim
Genscher,
Hans-Dietrich
George,
Götz
Gildo,
Rex
Glowna,
Vadim
Gmelin,
Gerda
Gmelin,
Hellmuth
Goebel,
Elisabeth
Grabbe,
Ernst
Greger,
Max
Gruner,
Wolfgang
Gründgens,
Gustaf
Hacker,
Uwe
Hackmann,
Werner
Hamann,
Evelyn
Hancke,
Edith
Hartz,
Hans
Hasse,
Johann Adolf
Hassel,
Karl-Heinz von
Hauptmann,
Ivo
Hause,
Alfred
Hemshorn,
Lothar
Herz,
Ingeburg
Herz,
Max
Hetzel,
Peter Martin
Hoff,
Hein ten
Höger,
Fritz
Jacobsen,
Frank
Jahnn,
Hans Henny
Jahr,
John
Jary,
Michael
Juhnke,
Harald
Jürgens,
Curd
Kabel,
Heidi
Kaempfert,
Bert
Karasek,
Hellmuth
Kaufeld,
Heini
Kellner,
Lonny
Kieling,
Wolfgang
Klabunde,
Erich
Klein,
Fritz
Klipstein,
Ernst von
Kobler,
Julius
Koch,
Lotte
Köpcke,
Karl-Heinz
Körber,
Kurt Adolf
Kraushaar,
Karina
Krekel,
Hildegard
Krebs,
Diether
Last,
James
Lause,
Hermann
Lenz,
Siegfried
Liliencron,
Detlef von
Leip,
Hans
Lichtenfeld,
Herbert
Liebermann,
Rolf
Lohfing,
Max
Lonzo
Lüthje,
Otto
Lüdke,
Günter
Mahler,
Gustav
Mahler,
Hans
Maue,
Karl-Otto
Mertens,
Hanne
Messtorff,
Hermann-Friedr.
Meyen,
Harry
Meysel,
Inge
Millowitsch,
Willy
Mira,
Brigitte
Mönter,
Friedhelm
Molzen,
Gerty
Monk,
Egon
Moshammer,
Rudolph
Mues,
Dietmar
Neutze,
Horst Michael
Niehoff,
Domenica
Nolde,
Emil
Olden,
John
Oskar
Ossietzky,
Carl von
Pfaff,
Dieter
Pfitzmann,
Günter
Pietsch,
Rosamunde
Pleva,
Jörg
Pohl,
Witta
Pooch,
Jürgen
Quadflieg,
Will
Ree,
Anita
Reemtsma,
Philipp F.
Richert,
Joachim
Riepel,
Werner
Rockmann,
Hermann
Roland,
Jürgen
Ronny
Rosenthal,
Hans
Rowohlt,
Ernst
Rowohlt,
Harry
Rühmkorff,
Eva
Rühmkorf,
Peter
Sander,
Otto
Seeler,
Erwin
Schadieck,
Annemarie
Scheiblich,
Jens
Schlüter,
Henning
Schmeling,
Max
Schmidt,
Arno
Schmidt,
Hannelore
Schmidt,
Helmut
Schnabel,
Hermann
Schnittke,
Alfred
Schreiner,
Ottmar
Schröder,
Gerhard
Schulz,
Peter
Schumacher,
Fritz
Sheridan,
Tony
Sieks,
Hilde
Siems,
Christa
Sieveking,
Kurt
Springer,
Axel
Steffen,
Manfred
Thälmann,
Ernst
Trebitsch,
Gyala
Trowe,
Gisela
Tügel,
Hans
Uhse,
Beate
Vahl,
Henry
Veigel,
Werner
Voght,
Casper
Voscherau,
Henning
Wald,
Hubertus
Weichmann,
Elsbeth
Weichmann,
Herbert
Weiss,
Heinz
Weiszäcker,
Richard von
Werner,
Ilse
Werup,
Mick
Westerwelle,
Guido
Wichern,
Johann Hinrich
Willemsen,
Roger
Willumeit,
Günter
Wolff,
Joachim
Wulff,
Hilde
Wussow,
Klausjürgen
Zahn,
Peter von
Ziegel,
Erich
Ortsregister
Personenregister
Bildnachweis
Literatur / Quellenangaben
Schlusswort
Weitere Bücher des Herausgebers
Vorwort
In Deutschland wohnen etwa 82 Millionen Menschen, darunter etwa 10.000 prominente Persönlichkeiten. Einige sorgen als TV-Moderator für gute Laune, verkünden als Sprecher Nachrichten, moderieren Radiosendungen, holen Titel in verschiedenen Sportarten nach Deutschland oder prägen beispielsweise als Architekten die Stadtbilder. Nicht zu vergessen Politiker, die in Deutschland die politische Richtung vorgeben und das Land regieren. Mit seinen 16 Bundesländern und 295 Landkreisen bietet Deutschland wunderschöne Plätze, sich häuslich niederzulassen.
In einer Auswahl von 206 Kurzbiografien werden in dem Buch „Wohnhäuser der Promis – In Erinnerung an Politiker, Musiker, Sänger, Sportler, Schauspieler, Künstler“ interessante Persönlichkeiten vorgestellt, die in Deutschland ihre einstigen Wohn- und Wirkungsstätten hatten. Von Schauspieler Hans Albers über Witta Pohl, Evelyn Hamann, Roger Willemsen, Götz George, Helmut Schmidt, Willy Brandt bis zu Hörfunk- und TV-Journalist Peter von Zahn. Das Buch führt den Leser kreuz und quer durch Städte Deutschlands: von Glücksburg im Norden bis Grünwald im Süden, sowie Berlin im Osten und Köln im Westen des Landes. Das Buch soll an die 206 ausgewählten Persönlichkeiten erinnern. Sie haben etwas für Deutschland getan – direkt und indirekt – mit diesem Buch soll ihnen etwas postum zurückgegeben werden. In Berlin gibt es 3.093 Gedenktafeln, die an Persönlichkeiten erinnern. Sie haben herausragende Leistungen für oder in Berlin erbracht. Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, Rio Reiser, Konrad Adenauer oder beispielsweise Hans Rosenthal zählen zu den Personen, an die mit der Berliner Gedenktafel erinnert wird.
Die etwa 40 mal 60 Zentimeter großen porzellanfarbenen Tafeln hängen zumeist an den ehemaligen Wohn- oder Geburtshäusern der Protagonisten. In anderen Städten Deutschlands sind es nur wenige Hinweisschilder beziehungsweise Gedenktafeln. In Hamburg beispielsweise hängt an dem Geburtshaus von Hans Albers ein Schild, genauso wie an dem Geburtshaus von Wolfgang Borchert. Andernorts hingegen gibt es keine oder nur wenige Gedenktafeln. Dabei hinterlassen die Menschen auf ihrer Odyssee durch die Jahrtausende eine Vielzahl von Spuren, die an das eigene Leben und Wirken erinnern sollen. Zum Beispiel an alltägliche oder außerordentliche Ereignisse, aber auch an herausragende Persönlichkeiten aus Unterhaltung, Sport, Politik oder Wirtschaft.
In langer Tradition stehen Gedenken und Erinnern und werden bis heute in verschiedenen Formen dargestellt: Ob als Höhlen- und Felsmalerei, als Pyramide, auf Friedhöfen als Gedenkstein oder -stätte, als Skulptur oder Plastik, als Denkmal oder Mausoleum. Nach Berliner Vorbild könnten in naher Zukunft vielleicht auch in Hamburg, München, Köln, Frankfurt oder in welcher Stadt auch immer mehr von solchen Gedenktafeln aufgestellt werden. Natürlich nur, wenn der Hauseigentümer damit einverstanden ist. Aber Argumente und Gründe gibt es sicher viele: In Erinnerung an großartige Persönlichkeiten, die sich in Deutschland durch hervorragende Leistungen in verschiedenen Bereichen hervorgehoben haben. 206 von ihnen werden auf den folgenden Seiten vorgestellt. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten in Form von Kurzbiografien, warum genau diese Protagonisten zu den Persönlichkeiten gehören und womit sie sich verdient gemacht haben.
Guido Westerwelle, 27. Dezember 1961 bis 18. März 2016 (Politiker)
Guido Westerwelle war ein deutscher Politiker: von 1983 bis 1988 war er Vorsitzender der Jungen Liberalen, wurde mit nur 32 Jahren 1994 FDP-Generalsekretär (bis 2001) und war 2001 bis 2011 Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP). Guido Westerwelle war zudem 2006 bis 2009 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. In den Jahren 2009 bis 2013 war er Bundesaußenminister. In den ersten beiden Jahren der schwarz-gelben Koalition, bis zu seinem Rücktritt vom Amt des FDP-Chefs, war er auch Vizekanzler (Stellvertreter der Bundeskanzlerin). Im Bundestagswahlkampf 2002 reiste der gelernte Rechtsanwalt mit einem knallgelben „Guidomobil“ durch die Lande. Sogar in der damals viel diskutierten Fernsehshow „Big Brother“ (RTL) trat er auf. Dass etablierte Kreise ihn zum Spaßpolitiker stempelten, scherte Guido Westerwelle damals nicht. Der Politiker hatte das Ziel, für die FDP 18 Prozent der Wählerstimmen zu erreichen – diese Ziel erreichte er nicht. Westerwelle kämpfte jahrelang gegen Leukämie – am 18. März hat er den Kampf gegen die Krankheit unerwartet verloren. „Wir haben gekämpft. Wir hatten das Ziel vor Augen. Wir sind dankbar für eine unglaublich tolle gemeinsame Zeit. Die Liebe bleibt“, wird sein Mann Michael Mronz auf der Homepage der Westerwelle Foundation, eine Stiftung die er 2013 gründete, zitiert. Darunter wurde ein Selfie von dem glücklichen Paar veröffentlicht. Privat lebte Guido Westerwelle in einer Wohnung am Rande des Stadtwalds von Köln. Auf dem Klingelschild waren seine Initialien G.W. zu lesen.
Die Grabstätte von Guido Westerwelle auf dem Friedhof Melaten in Köln.
In diesem Mehrfamilienhaus in der Fürst-Prückler-Straße 16 in Köln hatte Guido Westerwelle (Foto rechts) seine Wohnung. Er hatte einen schönen Ausblick auf den Stadtwald Kölns.
Guido Westerwelle, Fürst-Pückler-Straße 16, Köln-Braunsfeld
Karl-Heinz von Hassel, 8. Februar 1939 bis 19. April 2016 (Schauspieler)
Karl-Heinz von Hassel wurde am 8. Februar 1939 in Hamburg geboren und absolvierte zunächst eine Kaufmannsausbildung. Parallel nahm er Schauspielunterricht. Sein Mentor erkannte das Talent von Karl-Heinz von Hassel, es folgten ab 1960 zahlreiche Engagements an verschiedenen Theatern (Düsseldorf, Hannover, Essen). Ab 1966 war er regelmäßig im Fernsehen zu sehen („Old Shaky“, „Die fünfte Kolonne“, „Mord in Frankfurt“, „Marinemeuterei 1917“, „Das Wunder von Lengede“). Dem Fernsehpublikum wurde Karl-Heinz von Hassel als beharrlich und eher unspektakulär ermittelnder Kommissar Edgar Brinkmann in den Tatort-Filmen des Hessischen Rundfunks bekannt. Stets korrekt gekleidet, als Markenzeichen trug er eine Fliege. Er ermittelte von 1984 bis 2001 in insgesamt 28 Folgen – nachdem er bereits zuvor in den 1970er Jahren als Täter, Opfer oder Assistent in der ARD-Reihe „Tatort“ mitgewirkt hatte.
Er verkörperte einen eher klassischen Verhörspezialisten und Schreibtischarbeiter – im Gegensatz zu aktionsorientierten Ermittlern wie Götz George oder Klaus J. Behrendt. In den letzten Jahren als Kommissar wurde die steife Körperhaltung von Hassels mit starken Rückenschmerzen begründet, an denen Brinkmann litt.
Generell verkörperte von Hassel als Rollentypus immer wieder Offiziere, fand sich aber auch oft in der Rolle des Industriearbeiters besetzt.
Karl-Heinz von Hassel starb in der Nacht zum 19. April 2016 im Alter von 77 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Hamburg. Er lebte bis zu seinem Tod im Stadtteil Ottensen in Hamburg, unweit vom Donnerspark und der Elbe entfernt.
In diesem Mehrfamilienhaus in der Großen Brunnenstraße 7 in Hamburg hatte Karl-Heinz von Hassel seine Wohnung.
Karl-Heinz von Hassel, Große Brunnenstraße 7, Hamburg-Ottensen
Edgar Bessen, 11. November 1933 bis 2. Februar 2012 (Schauspieler)
Sein Tod hat nicht nur viele Hamburger, sondern Fernsehzuschauer aus ganz Deutschland betroffen gemacht: Edgar Bessen. Der stets menschlich gebliebene Charakterdarsteller war seit den 1970er Jahren in zahlreichen TV-Serien und Fernsehfilmen zu sehen. Ob im „Hafenkrankenhaus“, „Großstadtrevier“, dem Sozialdrama „Wilhelmsburger Freitag“, „Dem Täter auf der Spur“, „Tatort“, „St. Pauli Landungsbrücken“, „Achtung Zoll“ oder der Krimireihe „Schwarz Rot Gold“ – Bessen verkörperte Haupt- und Nebenfiguren als Charakterdarsteller.
In zwölf Folgen spielte Edgar Bessen von 1985 und 1987 den Kommissar Glockner in der Kinder-Fernsehserie „Ein Fall für TKKG“. Sein „Zweites Zuhause“ allerdings war das Ohnsorg-Theater, dem Bessen knapp 20 Jahre lang angehörte. Dort stand der sympathische Schauspieler mit Heidi Kabel (Seite →) und Henry Vahl (Seite →) auf der Bühne, spielte sich als Bauernknecht, Liebhaber, Komiker oder fleißiger Mensch in die Herzen der Zuschauer. In einer Presseerklärung anlässlich seines Todes teilte das Ohnsorg-Theater mit: „Es gab kein Rollenfach, in dem sich Edgar Bessen nicht zu Hause fühlte.“ Edgar Bessen liebte die Hansestadt Hamburg und betonte stets, dass er als Sohn der Küste das flache Land und die Nähe zum Wasser bräuchte, um sich wohlzufühlen. Mehr als 30 Jahre lang wohnte er mit seiner Frau Heidi in einer Villa im Stadtteil Poppenbüttel in Hamburg. „Grotenbleken“ ist eine schöne, ruhige Wohngegend, unweit der Villa von Freddy Quinn und dem Alstertal, sowie dem großen Alsterdorfer Einkaufszentrum entfernt. An spielfreien Abenden gingen Edgar und Heidi Bessen öfter am Alstertal spazieren oder machten einen Abstecher nach Wellingsbüttel zum historischen Torhaus, in dem Edgar Bessen bereits mit zahlreichen Lesungen aufgetreten ist.
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg.
In dieser Stadtvilla wohnte Edgar Bessen bis zu seinem Tod im Jahr 2012.
Der beliebte Schauspieler wurde auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Das Foto links zeigt seine Grabstätte.
Edgar Bessen.
Edgar Bessen, Grotenbleken 41, Hamburg-Poppenbüttel
Alexandra, 19. Mai 1942 bis 31. Juli 1969 (Sängerin)
„Accordéon“, „Mein Freund, der Baum“, „Zigeunerjunge“ oder „Zwei Gitarren“ – mit diesen Liedern verzauberte Alexandra bis Ende der 1960er Jahre Millionen von Deutsche. Im damals zum Deutschen Reich gehörenden Memelland wurde sie geboren. Alexandra hatte entscheidende Jahre ihres Lebens im Stadtteil Rothenburgsort im Osten Hamburgs verbracht. Auf einem damaligen Schrottplatz auf der gegenüber liegenden Straßenseite campierten damals Zigeuner, die sie zu dem Titel „Zigeunerjunge“ inspirierte. Dort entstanden auch erste Fotoaufnahmen der Sängerin Alexandra, die mit bürgerlichem Namen Alexandra Doris Nefedov hieß. Sie begann ihre Ausbildung und arbeitete fleißig, jobbte und kellnerte, um ihren Lebenstraum, Sängerin und Schauspielerin zu werden, zu verwirklichen. In dem Hochhaus am Rothenburgsorter Marktplatz 5 lebte die erfolgreiche Sängerin. 1963 brachte sie ihren Sohn Alexander in Hamburg zur Welt. Erst drei Jahre später gelang ihr der Durchbruch zu einer steilen Karriere. Mehrfach trat Alexandra im Fernsehen auf („Hitparade“, „Musik aus Studio B“ oder beispielsweise „Die Aktuelle Schaubude“). Gewohnt hat Alexandra bis 1960 in einem Mehrfamilienhaus im Knooper Weg 163 in Kiel, danach zog sie nach Hamburg. Im Herbst 1968 kaufte sie eine Eigentumswohnung in der Baldurstraße 73 im Bezirk Nymphenburg in München – ihre Hamburger Wohnung behielt sie aber als Zufluchtsort in den Norden bis zu ihrem Tode. Am 31. Juli 1969 dann das traurige Ende einer beispielhaften Karriere: sie verunglückte tödlich bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Albersdorf und Tellingstedt (Kreis Dithmarschen) in Schleswig-Holstein. Sie wurde unter ihrem Künstlernamen Alexandra auf dem Westfriedhof in München beigesetzt.
Foto rechts: Gedenkstein an der Unfallstelle in Tellingstedt.
In diesem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rothenburgsort in Hamburg lebte Sängerin Alexandra (Foto rechts).
Alexandra, Rothenburgsorter Marktplatz 5, Hamburg-Rothenburgsort
Rudi Carrell, 19. Dezember 1934 bis 7. Juli 2006 (Showmaster)
„Lass dich überraschen“ oder „Am laufenden Band“ – mit diesen zwei Sendungen verbinden die meisten vorwiegend älteren Fernsehzuschauer Rudi Carrell. Vierzig Jahre lang hat der gebürtige Holländer deutsche Fernsehgeschichte. Vieles, was heute im Flimmerkasten zu sehen ist, wäre ohne ihn undenkbar. Viele aktuelle Fernseh-Formate gäbe es ohne ihn nicht. Er moderierte „Die Rudi Carrell Show“, „Herzblatt“, „Rudis Tagesshow“, „Rudis Urlaubsshow“ oder auch „Rudis Hundeshow“. Noch heute werden zahlreiche Ausschnitte in Wiederholungen gezeigt. Ein Beleg dafür, dass seine Ideen, Gags und Einfälle zeitlosen Charakter haben. Zu seinen größten Erfolgen zählte auch die satirische Talkshow „7 Tage, 7 Köpfe“ (mit Jochen Busse als Moderator), in der Rudi Carrell von 1996 bis 2002 als festes Ensemble-Mitglied auftrat. Danach trat er gelegentlich in der Sendung auf. „Das ist einfach Wahnsinn und wieder einer der größten Erfolge meines Lebens. Wir haben mehr Zuschauer als Harald Schmidt in einer Woche“, sagt Carrell in einem Interview. Rudi Carrell legte bereits bei seiner ersten Show im Fernsehen großen Wert auf optische Gags. Diesen Grundsatz hielt er bis zu seinem Lebensende bei. So bestand er in „7 Tage, 7 Köpfe“ darauf, dass in jeder Ausgabe mindestens ein solcher Gag vorkommen sollte.
Rudi Carrell trat auch als Schlagersänger in Erscheinung. Sein bekanntestes Werk wurde „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ – eine Coverversion des Liedes „City of New Orleans“, welches 1975 erschien. In diesem Jahr kaufte sich Rudi Carrell das Rittergut Wachendorf, ein zwölf Hektar großes Grundstück mit altem Baumbestand und Bauernhof in Syke, Stadtteil Wachendorf, das etwa 500.000 Deutsche Mark kostete. Dort lebte er bis zu seinem Tod zurückgezogen. Er starb am 7. Juli 2006 gegen Mittag im Alter von 71 Jahren im Klinikum Bremen-Ost. Am 9. Juli 2006 fand im engsten Familienkreis eine Trauerfeier statt. Carrell wurde auf dem Friedhof im niedersächsischen Heiligenfelde (Syke) beigesetzt. Das Urgestein des deutschen Fernsehens trat damit für immer von der Show- und Lebensbühne ab.
Das Anwesen von Rudi Carrell. Hier lebte der Showmaster von 1975 bis 2006.
Die Grabstätte von Rudi Carrell.
Rudi Carrell, Heisterort 11, Syke (Wachendorf)
Mick Werup, 16. November 1958 bis 7. Januar 2011 (Schauspieler)
Durch die Familienserie „Diese Drombuschs“ wurde Mick Werup, der mit bürgerlichem Namen Jürgen Marvin hieß, zum Fernsehstar. Nach seiner Schauspielausbildung, die er 1981 erfolgreich in Hamburg absolvierte, erhielt er mehrere Fernseh- und Theaterengagements. Ob „TKKG“, „Der Alte“ oder „Der Fahnder“ – er verkörperte verschiedene Charaktere. Den bekanntesten Charakter setzte Mick Werup allerdings von 1983 bis 1992 in 31 Folgen als Polizist Chris Drombusch in „Diese Drombuschs“ um. Im Jahr 1992 schied Werup auf eigenen Wunsch aus der Serie aus. Die von ihm gespielte Figur starb den Serientod. Bereits Mitte der 1990er Jahre fasste Mick Werup den Entschluss, sich nach und nach aus dem Fernsehgeschäft zurück zu ziehen. Es folgten zwar vereinzelnd Gastauftritte in „Ein Fall für Zwei“ mit Rainer Hunold und Claus Theo Gärtner (1996) oder zum Beispiel „Felix – Ein Freund fürs Leben“ (1997), aber 1998 hatte er seinen letzten Fernsehauftritt in „Der Fahnder“ (1998). Werup soll für einige Jahre nach Indien ausgewandert sein, kehrte aber in seine Heimatstadt Hamburg zurück. Dort lebte er in einem Mehrfamilienhaus in der Amandastraße 44 in Eimsbüttel. An der Türklingel stand sein bürgerlicher Name Marvin. Am 7. Januar 2011 wurde er auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses tot aufgefunden. Er beging Selbstmord. Mick Werup wurde auf dem Friedwald in der Lüneburger Heide (bei Bispingen) beigesetzt.
In diesem Mehrfamilienhaus in der Amandastraße 44 im Stadtteil Eimsbüttel in Hamburg lebte Schauspieler Mick Werup in den letzten Jahren seines Lebens zurückgezogen.
Mick Werup, Amandastraße 44, Hamburg-Eimsbüttel
Evelyn Hamann, 6. August 1942 bis 28. Oktober 2007 (Schauspielerin)
Als Fernsehschauspielerin und Charakterdarstellerin war Evelyn Hamann vielen Zuschauern bekannt: Sie spielte unter anderem die Haushälterin Carsta Michaelis der Familie Brinckmann in der „Schwarzwaldklinik“, die Klatschtante Thea Knoll in „Der Landarzt“ und verkörperte eine überaus eifrige Sekretärin eines Hauptkommissars in „Adelheid und ihre Mörder“. Zudem spielte Hamann auch Theater, produzierte Hörbuch-Reihen und gab Lesungen. Unvergessen auch die zahlreichen Sketche an der Seite des begnadeten Humoristen Loriot.
Am 6. August 1942 wurde Evelyn Hamann in Hamburg geboren, wuchs in einer Musikerfamilie auf. Ihr Vater war Konzertmeister des NDR Sinfonieorchesters, ihre Mutter war Sängerin und Musikpädagogin. Ihr Großvater war in Berlin als Konzertmeister tätig. Auch ihr Bruder verdiente sein Geld mit Musik: er war als Professor tätig. Die beliebte Schauspielerin hielt es privat hanseatisch diskret. Interviews mit Journalisten gab sie höchst selten, über rote Teppiche flanierte sie kaum und über ihr Privatleben gab sie nach außen nur wenig bekannt. Evelyn Hamann lebte zurückgezogen in ihrer Dachgeschosswohnung im Nonnenstieg 26 in Harvestehude in Hamburg, kaufte in benachbarten Geschäften am Eppendorfer Baum öfter ein. Aber selbst ihre Nachbarn bekamen die Schauspielerin eher selten zu sehen. Oftmals wurde sie zu Dreharbeiten per Fahrdienst abgeholt. Nach kurzer schwerer Krankheit starb sie für die Öffentlichkeit unerwartet am 28. Oktober 2007 im Alter von 65 Jahren im Kreis ihrer Angehörigen. Sie wurde auf dem Alten Friedhof in Hamburg-Niendorf beigesetzt.
In dieser Dachgeschosswohnung im Nonnenstieg 26 in Hamburg lebte Evelyn Hamann.
Das Grab von Evelyn Hamann (Foto oben).
Evelyn Hamann, Nonnenstieg 26, Hamburg-Harvestehude
Witta Pohl, 1. November 1937 bis 4. April 2011 (Schauspielerin)
Als „Mutter Drombusch“ hat sie sich in die Herzen von Millionen Fernsehzuschauern gespielt: Witta Pohl. In ihrer langen Schauspielkarriere ist sie in viele Rollen geschlüpft. Aber für die Mehrheit der Fernsehzuschauer ist sie bis zu ihrem Tod am 4. April 2011 in Hamburg die „Mutter Drombusch“ geblieben. In der populären ZDF-Serie „Diese Drombuschs“ gab sie in den 1980er Jahren die resolute Ehefrau an der Seite von Siegfried „Sigi” Drombusch (gespielt von Hans-Peter Korff). Eine Rolle, die ihr wie auf den Leib geschrieben war.
Beliebtheit erlangte Witta Pohl aber auch mit Gastrollen in der Krimireihe „Schwarz Rot Gold“ (darin spielte sie die Ehefrau des Zollfahnders Zaluskowski), „Der Alte“, „Tatort“ und weiteren Fernsehserien. Eine großartige Hauptrolle besetzte Witta Pohl in der Serie „Happy Birthday“. Dort verkörperte sie die verwitwete Marie Linnebrink. Für diese Familienserie hatte Witta Pohl übrigens auch die Idee. Aus ihrem Privatleben ist bekannt, dass Witta Pohl in erster Ehe mit Karl Maldeck verheiratet war. Es folgte eine zweite Ehe mit dem Schauspieler Charles Brauer, aus der zwei Kinder hervor gegangen sind. Mit Brauer stand sie im Jahr 1966 in dem Fernsehfilm „Geibelstraße 27“ auch gemeinsam vor der Kamera. Für ihre Hilfsaktionen für Menschen in Osteuropa, Afrika und Sri Lanka erhielt Witta Pohl 2005 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. 1993 wurde sie mit der Goldenen Kamera für ihren beispielhaften Einsatz für Kinder in Not ausgezeichnet. Sie wohnte jahrelang in der Brabandstraße 63a in Alsterdorf. Im Alter von 73 Jahren hat die Hamburgerin im April 2011 ihren schwersten Kampf verloren: Sie erlag einer Leukämieerkrankung. Sie wurde auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg in der Nähe der Kapelle 8 beigesetzt. Ihr kleines Haus in der Brabandstraße 63a wurde 2013 abgerissen. In dem Haus 59a hatte ihr Verein „Kinderluftbrücke“ seinen Sitz.
In dem Haus 59a hatte der Verein „Kinderluftbrücke“ von Witta Pohl seinen Sitz.
Witta Pohl, Brabandstraße 63a, Hamburg-Alsterdorf
Dieter Pfaff, 2. Oktober 1947 bis 5. März 2013 (Schauspieler)
Eine traurige Nachricht wurde am 6. März 2013 verkündet: Der beliebte Schauspieler Dieter Pfaff ist tot. Er starb im Kreise seiner Familie an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung am Morgen des 5. März in seinem Haus in Hamburg. Der aus vielen TV-Serien wie „Der Fahnder“, „Der Dicke“ und „Bloch“ bekannte Charakterdarsteller litt seit längerem an Lungenkrebs. Lutz Marmor, ARD-Vorsitzender und Intendant des NDR: „Wahrhaftig, beharrlich, einfühlsam und von einzigartiger Präsenz: So war Dieter Pfaff als Schauspieler. Diese Eigenschaften machten ihn unverwechselbar. Dieter Pfaff war der ARD und dem NDR eng verbunden. Mit seinem Tod verliert das deutsche Fernsehen eine wichtige Persönlichkeit“, hieß es in einer Presseerklärung. Dieter Pfaff blieb bei allem Erfolg menschlich, gesellte sich in der Mittagspause vorbildlich zu den Komparsen an einen Tisch. Wenige Wochen vor seinem Tod hieß es in einer Pressemitteilung, dass Dieter Pfaff bald wieder als Anwalt Gregor Ehrenberg in der Serie „Der Dicke“ in Hamburg vor der Kamera stehen werde. Gerne hätte der Autor dieses Buches darüber berichtet...Dieter Pfaff lebte jahrelang in der Lessingstraße im Stadtteil Uhlenhorst in Hamburg, später zog er mit seiner Familie in ein Mehrgenerationenhaus im Hohenzollernring in den Hamburger Stadtteil Ottensen. In seiner Freizeit und auf dem Filmset sang Dieter Pfaff und begleitete sich dabei oftmals auf einer Gitarre. In der Unterhaltungssendung „Inas Nacht“ (NDR Fernsehen) interpretierte Pfaff im Jahr 2010 die Titel „All Along the Watchtower“ und „Ring of Fire“. Er engagierte sich mehrere Jahre als UNICEF-Sonderbotschafter gegen den weltweiten Einsatz von Kindersoldaten und übernahm die Patenschaft für mehrere Kinder.
Schauspieler Dieter Pfaff als Gast in der NDR Talkshow.
Am 5. März 2013 schloss der beliebte Schauspieler für immer seine Augen. Damit hat Deutschland einen hervorragenden Menschen verloren, der sich wegen seines Gewichtes immer wieder selbst auf die Schippe nahm.
In diesem Haus lebte Schauspieler Dieter Pfaff.
Dieter Pfaff, Hohenzollernring 22, Hamburg-Ottensen
Rolf Dittmeyer, 27. April 1921 bis 17. Mai 2009 (Unternehmer)
Rolf Dittmeyer war ein deutscher Unternehmer im Bereich Früchte und Fruchtsäfte und Gründer der Getränkemarken „Valensina“ und „Punica“. In den 1950er Jahren baute Rolf Dittmeyer gemeinsam mit dem Unternehmen „Edeka“ eine Einkaufsorganisation für den deutschen Lebensmittelhandel auf und stellte ab 1960 verschiedene Zitrussäfte in Marokko und Südafrika her. 1966 gründete Dittmeyer die Marke „Valensina“ und hob 1978 den Fruchtnektar „Punica“ aus der Taufe. Als Firmeninhaber wirkte Rolf Dittmeyer auch als Werbegesicht in verschiedenen Spots mit und wurde schließlich als “Onkel Dittmeyer“ in der Fernsehwerbung bekannt. „Onkel Dittmeyer“ zählte zu den größten Getränkeherstellern Deutschlands, der jahrelang der Fernsehnation die Vorteile seiner sonnengereiften Apfelsinen näher brachte. Mit seinen Fruchtsäften war Rolf Dittmeyer von 1972 bis 1984 Exklusivlieferant der Olympischen Spiele. Ab 1979 begann Dittmeyer, an der spanischen Atlantikküste die größte Orangenplantage Europas aufzubauen. Rolf Dittmeyer hatte eine Villa in Andalusien, in Hamburg hatte er ein Anwesen im Tristanweg 7 im Stadtteil Rissen. In einer reetgedeckten Villa lebte er sehr zurück gezogen hinter hohen Gartenhecken. Er starb am 17. Mai 2009.
Die Grabstätte des Unternehmers Rolf Dittmeyer auf dem Friedhof Nienstedten in Hamburg.
In diesem reetgedeckten Haus im Tristanweg 7 im Hamburger Stadtteil Rissen lebte Unternehmer Rolf Dittmeyer.
Rolf Dittmeyer, Tristanweg 7, Hamburg-Rissen