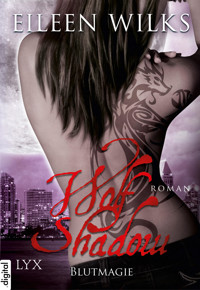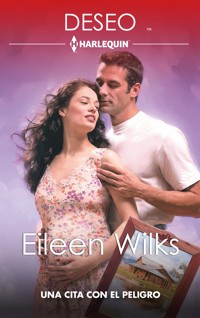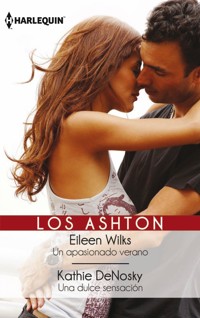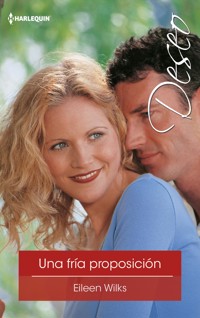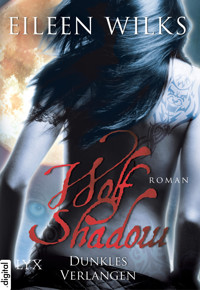
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wolf-Shadow-Reihe
- Sprache: Deutsch
FBI-Agentin Lily Yu und ihr Gefährte, der Werwolf Rule Turner, werden vom Geheimdienst engagiert, um Politiker zu entlarven, die ein Bündnis mit Dämonen eingegangen sind. Da geschieht ein grausamer Mord, der nur von einem Dämon verübt worden sein kann. Lily bittet die Agentin Cynna Weaver und den Magier Cullen Seabourne um Hilfe. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, während die vier versuchen herauszufinden, wer hinter den dämonischen Angriffen steckt. Im Laufe der Ermittlungen kommen sich Cynna und Cullen näher, und schon bald entwickelt sich eine Leidenschaft zwischen den beiden, die ganz eigenen Gesetzen folgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Vorwort
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Nachwort
Impressum
DunklesVerlangen
Roman
Ins Deutsche übertragen von Stefanie Zeller
Lieber Leser,
vor drei Monaten traf ich Rule Turner das erste Mal. Dabei kommt es mir vor, als sei es schon viel länger her. Ich könnte jetzt ganz schnulzig behaupten, mein Leben habe erst begonnen, als sich unsere Blicke in dieser Nacht im Club Hell trafen. Aber dann würde ich lügen. Auch bevor ich Rule kennenlernte, hatte ich ein Leben – mit Höhen und Tiefen und sicher nicht perfekt, aber ein Leben.
Doch jetzt ist in meinem Leben fast nichts mehr so, wie es einmal war. Deswegen fühlt es sich auch so an, als wäre sehr viel mehr Zeit vergangen als drei Monate.
Früher war ich bei der Mordkommission. Ich wollte nie etwas anderes tun – zumindest nicht, seit ich im Alter von acht Jahren herausgefunden hatte, dass es Monster wirklich gibt und dass sie aussehen wie du und ich. Jetzt arbeite ich für das FBI, in der Einheit 12 der MCD – das ist die Magical Crimes Division –, und ich bin auf Lebenszeit an den Prinz des Clans der Nokolai gebunden.
Vor zwei Monaten ermittelte ich in einem Mordfall, dem ersten an der Westküste seit Jahrzehnten, in dem ein Werwolf der Täter war – Pardon, ein Lupus. Zuerst sah es so aus, als wäre Rule Turner mein Hauptverdächtiger, aber sehr schnell wusste ich, dass er es nicht gewesen sein konnte. Doch es dauerte eine Weile, bis ich herausfand, wer wirklich dahintersteckte. Eine verrückte Telepathin, ein charismatischer Sektenführer und eine uralte Möchtegerngöttin hatten sich zusammengetan, um alle Lupi in den Vereinigten Staaten zu vernichten, und es war ihnen egal, ob bei ihrem Versuch, das Land zu übernehmen, auch ein paar Menschen dran glauben mussten.
Wir haben sie aufgehalten. Mit „wir“ meine ich Rule und mich und ein paar andere, wie meine Großmutter – die dann nach China gereist ist, um dort eine Art persönliche Pilgerreise zu unternehmen. Was mir gar nicht behagt. Eine Woche, bevor ich (buchstäblich) durch die Hölle ging, brach sie auf.
Denn ich tötete die Telepathin. Da sie ihrerseits alles darangesetzt hatte, mich zu töten, hatte ich keine andere Wahl. Aber dem Sektenführer gelang die Flucht, und mit ihm verschwand ihr Stab. Dieser Stab war an die Göttin gebunden, die wir nicht beim Namen nennen. Also galt es jetzt, den Stab zu finden und ihn zu zerstören, und dazu mussten wir erst einmal Harlowe, den Sektenführer, ausfindig machen.
Wir fanden ihn, aber die Geschichte nahm keine gute Wendung. Harlowe starb, zusammen mit einigen anderen. Ich wurde in zwei Hälften geteilt, und eine Hälfte von mir wurde in die Dämonenwelt geschleudert.
Und mit mir zusammen auch Rule. Na ja, mit dieser Hälfte von mir.
Verlangen Sie nicht von mir, dass ich Ihnen erkläre, wie das möglich ist. Vielleicht könnte es Cullen – Rules Freund, der Zauberer –, aber ich würde Ihnen nicht raten, ihn darum zu bitten. Der Mann sieht aus wie die leibhaftige Sünde, aber wenn er anfängt, von Ritualen und Zaubersprüchen zu reden, hört er sich an wie ein verrückter Professor.
Danach wurde alles sehr verwirrend. Weder die eine noch die andere Hälfte wusste, dass es die jeweils andere gab. Die Hälfte, die in der Hölle war – oder in Dis, wie die dort Lebenden den Ort nennen –, hatte keine Erinnerungen mehr. Sie hatte Rule an ihrer Seite, doch der war in seiner Wolfsgestalt gefangen. Der Teil von mir, der noch auf der Erde war, wusste wegen des Bandes der Gefährten, dass Rule am Leben war, doch es war gar nicht so einfach, ihn zu finden. Schließlich gelang es einigen der Priesterinnen der Lupi – die Rhejs genannt werden – zusammen mit Cullen, ein kleines Höllentor zu öffnen, was fast so kriminell ist wie Massenmord. Durch dieses Tor gingen dann ich, Cullen, Cynna und ein grässlicher Gnom namens Max, um Rule zurückzuholen.
Dis ist in Regionen unterteilt, und jede wird von einem Fürsten oder von einer Fürstin regiert. Die Möchtegerngöttin war in eine dieser Regionen eingedrungen, indem sie ihren Avatar geschickt hatte; einen Avatar müssen Sie sich vorstellen wie ein Gefäß, aus dem das meiste von dem, was die Person ausmacht, ausgegossen wurde, um Platz zu machen für die Göttin – um einen Pakt mit der dort herrschenden Fürstin zu schließen. Doch sie zerstritten sich, und der Dämon fraß den Avatar, verfiel dem Wahnsinn, und plötzlich fanden sich meine beiden Hälften mitten in einem Krieg in der Hölle wieder.
Als sie feststellten, dass es dort Drachen gibt, waren beide Ichs sehr überrascht.
Als nämlich mein anderes Ich und Rule von einem Drachen aufgegriffen wurden, dachten wir zuerst, wir würden nun bald eines nicht allzu schönen Todes sterben. Doch dann stellte sich heraus, dass dieses Zusammentreffen unser Glück gewesen war. Denn der Drache wusste, wie wir wieder zurück in unsere Welt gelangen konnten – ich und mein anderes Ich natürlich und alle anderen –, zusammen mit ihm und zwanzig seiner riesigen, wunderschönen und lebensgefährlichen Freunde.
Ganz unversehrt sind wir nicht aus der Hölle entkommen. Die Behörden taten einfach so, als sei es unmöglich, ein Höllentor zu öffnen. Deswegen bekamen wir also keinen Ärger. Und darüber hinaus verschwand das Höllentor, sobald wir zurückgekehrt waren. Aber Rule wäre fast gestorben, und ich … ich kenne jetzt Dinge, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie möglich sind. Der Tod ist nicht so absolut, wie ich immer geglaubt habe.
Und die Drachen? Sie verschwanden so spurlos, dass manche Leute von einem Marketinggag für einen Film sprachen. Immerhin geschah das alles in Kalifornien.
Das nun ist die Geschichte von dem, was passiert ist, nachdem wir alle nach Hause zurückgekehrt sind – ungefähr so wie Dorothy und Co. aus dem Zauberer von Oz. Ich wette, Sie glauben, dass nach ihrer Rückkehr für Dorothy und ihre Freunde eitel Sonnenschein geherrscht hat.
Aber vergessen Sie nicht: In Kansas ist man auch nicht sicherer als in Oz. Schließlich hat dort der Tornado zugeschlagen.
Lily Yu
Prolog
20. Dezember, 02.52 Uhr (GMT)
Ein Stück außerhalb von Miller’s Dale in Derbyshire schlichen sich zwei angehende Naturforscherinnen aus dem Cottage, in dem sie wohnten. Natürlich durften Julie und Marnie nachts das Haus eigentlich nicht verlassen, aber sie hofften, dass ihre Mutter es nicht erfahren würde. Wenn sie mit den „Mädels“ aus gewesen war, schlief sie immer besonders tief. Heute Nacht hatten sie vor, die beiden Mustela erminea zu finden, die sie gestern gesehen hatten, und sie zu fotografieren.
Marniezumindest war überzeugt, dass es Hermelinspuren gewesen waren. Aber zu ihrem Ärger wies Julie ihre Schwester immer wieder darauf hin, dass sie ebenso gut von einem Mustela nivalis stammen konnten – dem des Lateinischen nicht Mächtigen auch als das Gemeine Wiesel bekannt. Beide hatten fünf Zehen und waren nachtaktiv, aber man konnte Wiesel auch tagsüber finden.
Und sie hatten auch ein weißes Fellbüschel entdeckt. „Das könnte von einem Hasen stammen“, sagte Julie zum fünften oder sechsten Mal.
„Das war kein Hasenfell.“
„Woher weißt du das?“
„Ich weiß es einfach.“ Im Stillen musste Marnie sich eingestehen, dass sie es nicht mit Sicherheit wusste, aber es wäre einfach zu schön, wenn sie den schönen Verwandten des Wiesels in seinem weißen Pelz aufspüren würden.
Möglich wäre es. Hermeline waren nicht so selten, und Millers Dale war nicht nur mit einem oder zwei, nein gleich mit drei Naturschutzgebieten in der Nähe gesegnet: Priestcliffe Lees und Station Quarry, die beide dem Derbyshire Naturalists’ Trust, dem Bund der Naturforscher von Derbyshire, gehörten, und Monk’s Dale, dem staatlichen Naturschutzgebiet. Die ganze Gegend, der sogenannte Peak District, war mit Wanderwegen verseucht und wimmelte nur so von Touristen und anderen Schädlingen.
Jetzt aber waren keine Wanderer unterwegs. Der goldene Mond stand tief am Horizont wie ein pummeliger Kobold. Bald würden sie Vollmond haben. In dem hellen Licht hatten die Mädchen keine Mühe, ihren Weg auf dem Pfad zu finden, der am River Wye entlangführte. Ihr Atem stieg blass auf in der stillen Luft. Marnie stopfte die Hände in die Taschen und spürte ihre sperrige neue Nikon. Sie hatte fast hundert Bilder geschossen, nur um die richtige Belichtungszeit, die richtige Blende und den richtigen ISO-Wert für Nachtaufnahmen herauszufinden. Sie hatte alles vorher eingestellt. Sollten sie tatsächlich einen Hermelin sehen, musste sie nur noch auf den Auslöser drücken.
Doch manchmal kommt es anders als geplant. Die Mädchen hatte erst die Hälfte des Gebietes durchstreift, in dem sie die Spuren ausgemacht hatten, als sie ein sanftes Schimmern bemerkten. Es kam aus einem kleinen Wäldchen zu ihrer Linken.
„Irgendein Dummkopf hat ein Feuer brennen lassen“, sagte Julie.
„Vielleicht.“ Licht flackert nicht wie ein Feuer. „Sieht eher aus wie eine Taschenlampe.“
„Es bewegt sich nicht, oder? Los, lass uns mal nachschauen.“
Marnie hüpfte von einem Fuß auf den anderen. Am liebsten hätte sie weiter nach dem Hermelin gesucht … aber wenn das Licht tatsächlich von einem verlassenen Lagerfeuer herrührte, musste es gelöscht werden. „Na gut. Aber sei leise, vielleicht sind es Teenager.“
Die Mädchen waren geübt darin, sich leise zu bewegen, damit sie nicht wilde Tiere aufschreckten, aber unter den Bäumen war es sehr viel dunkler. Trotzdem erreichten sie die kleine runde Lichtung in der Mitte des Wäldchens, ohne allzu viele Geräusche zu machen. Dann aber blieben sie wie angewurzelt stehen … und gingen gleich darauf hinter einem Baum in Deckung.
In dem Feenring waren Feen.
Zumindest dachte Marnie, dass es Feen seien, obwohl niemand mehr eine Fee gesehen hatte seit … nun, seit einer Ewigkeit. Aber sie waren klein, so klein, dass sie ihr wohl im Stehen kaum bis zum Knie gereicht hätten … wenn sie gestanden hätten. Und sie hatten große, wirklich sehr große Schmetterlingsflügel. Und sie schimmerten hell. Die wunderschönen blassen kleinen Körper strahlten ein sanftes Licht aus, als bestünden sie aus Leuchtdioden.
Was sie sehr deutlich sehen konnten, weil sie nämlich nackt waren. Und sie machten … nun, sie hatte schon gesehen, wie Tiere es taten, aber nicht Wesen, die so sehr aussahen wie richtige Menschen.
Marnie zerrte ihre Kamera aus der Tasche und schaltete sie ein. Sie drückte auf den Auslöser und schickte ein Gebet gen Himmel. Dann knipste sie noch einmal. Und noch einmal.
„Sie haben Sex!“, flüsterte Julie schockiert.
Marnie kniff sie, um sie zum Schweigen zu bringen, aber es war schon zu spät. Eine von den Feen – eine Frau mit gelben Flügeln, auf denen große braune Punkte waren – hielt inne bei dem, was sie gerade mit dem Mann mit den rötlichen Flügeln tat. Sie sagte etwas, sehr schnell.
Marnie staunte. Die kleine Fee hatte Zähne. Spitze Zähne, wie eine Katze.
Ein paar von den anderen lachten. Eine zwitscherte noch ein paar Worte, dann sahen sie sich alle erschrocken um. Ein klitzekleiner Mann mit blauen Flügeln schrie auf und zeigte auf den Baum, hinter dem Marnie und Julie sich versteckten.
Die größte Frau, eine schlanke Rothaarige mit Flügeln, deren Farbe an die Abenddämmerung erinnerte, hob die Hände über den Kopf. Mit scharfer Stimme, als befehle sie jemandem etwas, rief sie ein paar Worte. Sie war laut, lauter, als man es von jemand so Kleinem erwartet hätte. Sie ballte die winzigen Hände zu Fäusten.
Dann waren sie auf einmal alle verschwunden, und es wurde dunkel unter den Bäumen.
Die Mädchen bekamen Schelte, weil sie sich aus dem Haus geschlichen hatten, aber das machte ihnen nichts aus. Marnie verkaufte ihre Fotos an das Lokalblatt und anschließend an einen Nachrichtendienst. Und irgendwann verzieh sie ihrer Schwester, dass diese ihren großen Mund aufgemacht und die Feen verschreckt hatte.
19. Dezember, 20.52 Uhr (Ortszeit)
20. Dezember, 02.52 Uhr (GMT)
Los Lobos hockte gefährlich nah am Rand der bergigen Küste von Michoacán in Mexiko, wo die Bergspitzen der Sierra Madre del Sur sich so eng zusammendrängten, dass es aussah, als müssten sie in den Pazifik stürzen. Der winzige Pueblo erstreckte sich zu beiden Seiten an einer der wenigen holprigen Straßen, die in die Berge führten – wie eine Schlange, die ihre Asphalthaut nach sieben Kilometern abstieß und sich dann erleichtert ins schützende Dämmerlicht wand. Auf den Schotterweg, der von dort aus weiterführte, wagten sich nur Esel oder Leute, denen der Unterboden ihres Fahrzeugs nicht am Herzen lag.
Es gab keinen Gasthof und kein Hotel im Dorf, aber Señora de Pedrosa, die Witwe des alten Enrique, hatte ein freies Schlafzimmer, nachdem sie erst einmal den drittältesten Enkel vor die Tür gesetzt hatte – denn der würde es auch ein paar Tage bei seinem Bruder und seiner Schwägerin aushalten. Das Zimmer hatte sie an einen Fremden vermietet, der jetzt dort schlief – und von der Dunkelheit träumte.
Cullen fuhr aus dem Schlaf hoch. Einen Moment lang wusste er weder, wo er war, noch ob es Tag war oder Nacht, aber er nahm Licht wahr. Er konnte sehen.
Nicht, dass es viel zu sehen gegeben hätte. Der Schlaf hatte ihn übermannt, während er an dem kleinen Tisch saß, den seine Vermieterin ihm großzügig überlassen hatte. Den Kopf auf den Armen, war er eingenickt.
Was für ein langweiliger Traum. Doch nicht so langweilig wie der neulich. Er hatte gehofft, dass er nicht mehr aus seinem Unterbewusstsein hochsteigen würde, nun, da er ein Nokolai war, aber offenbar war ihm dieses Glück nicht vergönnt.
Cullen richtete sich auf, rieb sich mit beiden Handflächen über das Gesicht und drehte sich in der Taille, um seine Wirbelsäule zu lockern. Anscheinend gingen die durchwachten Nächte und die Wanderungen durch den Dschungel nicht spurlos an ihm vorbei. Wie viel Uhr war es eigentlich?
Er nahm das Telefon, das, weitab von irgendeinem Funkturm, eher eine Uhr war als ein Kommunikationsmittel. Das leuchtende Display informierte ihn darüber, dass jetzt eigentlich nicht die rechte Zeit zum Schlafen war. Nun, jetzt war er wach.
Was hatte ihn aufgeweckt?
Er runzelte die Stirn. Der Traum? Aber bis jetzt war er nie aufgewacht von diesem Traum. Er horchte, schnüffelte, aber er hörte oder roch nichts Ungewöhnliches …
Dann spürte er es wieder. Etwas kitzelte an seinen Schutzschilden, sanft wie eine Feder.
Instinktiv zog er sie enger. Was zum Teufel …?
Dann lächelte er. Natürlich. Jemand hatte ihn bemerkt und versuchte nun, ihn abzuwehren. Wer sonst könnte es sein als die, die er suchte?
Seine Hand fuhr zur Brust, wo die längere seiner beiden Halsketten baumelte. Er öffnete den Beutel – Leder, mit Seide bezogen – und leerte ihn aus. Einen Augenblick lang drehte er den Gegenstand zwischen seinen Fingern, genoss das Gefühl.
Er war hart und glatt wie Glas und hatte die Form eines großen Blütenblatts. Die Ränder waren so scharf, dass er ihn nur ganz vorsichtig anfasste. Im Tageslicht, das wusste er, würde er dunkelgrau schillern, als wäre er mit öligem Wasser überzogen. Aber jetzt konnten seine Augen ihn kaum ausmachen.
Doch Cullen war nicht nur auf seine Augen angewiesen, um zu sehen. Und die Blendung, die man ihm kürzlich zugefügt hatte, die aber inzwischen verheilt war, hatte seinen anderen Blick nur noch schärfer gemacht. Mit diesem Blick sah er Farben, lebendige, leuchtende Farben. Blau für Wasser, Silber für Luft, Braun für Erde. Rote, gelbe, grüne Funken – alle Farben der Magie tanzten durcheinander. Aber darunter … unter all diesen Farben lag tiefstes Purpur, so dunkel, dass es fast schwarz war.
Purpur, die Farbe der Andersblütigen. Was er in den Händen hielt, stammte von der ältesten magischen Art, von der, die reiner war als alle anderen. Möglicherweise, dachte Cullen, als er jetzt mit dem Daumen darüberstrich, hatte seit vier- oder fünfhundert Jahren niemand mehr so etwas in der Hand gehalten.
Eine Drachenschuppe, erst vor so kurzer Zeit von ihrem Besitzer abgestoßen, dass seine Magie darin noch lebendig war.
Ein Drache, der vielleicht auf der Suche nach Cullen war, so wie Cullen auf der Suche nach ihm war – wenn auch aus anderen Gründen. Er grinste in der Dunkelheit, während sich seine Hand um die scharfen Kanten seines Schatzes schloss.
20. Dezember, 10.52 Uhr (Ortszeit)
20. Dezember, 02.52 Uhr (GMT)
Achtzig Kilometer außerhalb von Chengdu in der Provinz von Sichuan, China, erklomm eine alte Frau einen Berg, einen recht niedrigen Berg, zugegebenermaßen, obwohl der Pfad steil anstieg. Im Winter nahmen nur wenige diesen Pfad, aber heute fiel kein Schnee. Die Sonne stand am Himmel wie ein glänzender Kiesel.
Sie war nicht allein. Fünf weitere Menschen folgten ihr in einigem Abstand. Vielleicht waren sie nicht so versessen darauf wie sie, den taoistischen Tempel am Ende des Pfades zu erreichen. Die Kälte verärgerte Madam Li Lei Yu, denn sie zeigte ihr, dass sie älter wurde und einmal sterben würde. Auf der anderen Seite jedoch hatte sie diese Pilgerreise eben gerade deswegen unternommen, sowohl diese Wanderung den verdammten Berg hinauf als auch die Reise zurück in ihr Heimatland.
Nachdem sie in Chengdu angekommen war, hatte sie erfahren, dass der Mann, wegen dem sie gekommen war – ein Mönch –, letztes Jahr gestorben war. Sie war böse auf An Du. Hätte er damit nicht noch ein bisschen warten können? Zwar würde sie jetzt sein Grab besuchen, aber sie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass sie es am liebsten so schnell wie möglich hinter sich gebracht hätte.
Als es passierte, war sie noch sechshundert Meter vom Gipfel entfernt und nicht mehr in Sichtweite der anderen. Es war kein Schwindelanfall, obgleich sie nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Sie wurde nicht blind oder taub, obwohl ihr grau vor Augen wurde und ihr Gehör schwand. Etwas Starkes und Fremdes fegte durch sie durch, blies ihre Sinne aus wie Kerzen und ließ sie durch die Realität gleiten wie auf Eis.
Als sie auf dem Rücken liegend wieder zu sich kam, schien die Sonne immer noch, ihre Begleiter waren immer noch hinter der Wegbiegung, und auf ihren Lippen lag ein Name, der seit vierhundert Jahren nicht mehr laut ausgesprochen worden war.
Auch jetzt sprach Li Lei den Namen nicht aus. Aber er klang in ihrem Inneren und sprach von einer Zukunft voller Schrecken und Freude, Erinnerung und Wandel. Einige Atemzüge lang rührte sie sich nicht und wartete darauf, dass ihr Herz seinen regelmäßigen Schlag wieder aufnahm. Und darauf, dass sie begriff, was geschehen war und was es bedeutete.
„Dann“, flüsterte sie, „ist er also zurückgekommen.“
Und wie lange war er schon zurück, bevor der Wind durch sie hindurchgeweht war und seinen Namen geflüstert hatte? Ihr Blick verfinsterte sich.
Als sich Stimmen näherten, stand sie auf. Sie zuckte zusammen – es sah ja schließlich keiner –, weil ihre Hüfte schmerzte. Es hatte eine Zeit gegeben, als ein kleiner Sturz wie dieser … nun, das war jetzt nicht wichtig. Sie war alt, und aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte ihr Schöpfer beschlossen, dass Altersschwäche zum Leben dazugehörte. Wenn man damit haderte, wurde es nur noch schlimmer.
Trotzdem brummte sie nun leise vor sich hin, auch wenn es an niemand Bestimmten gerichtet war, als sie den Pfad zurückging.
Die anderen kamen um die Biegung, hinter ihrem Führer. Er war ein kleiner, agiler Mann um die vierzig, dem es gar nicht gefallen hatte, dass sie vorausgelaufen war. Er hatte sogar tatsächlich geglaubt, er könnte sie zurückhalten. Das Ehepaar hinter ihm kam aus Peking, die beiden jungen Männer irgendwo aus Guizhou.
Li Lei Yu wusste nicht, warum die anderen sich gerade heute dazu entschlossen hatten, diesen Berg zu besteigen, und es interessierte sie auch nicht. Ihr Interesse galt einzig und allein einer Person in der Gruppe, einer Frau mittleren Alters, die ganz hinten stand. Sie achtete nicht auf die Fragen und Zurechtweisungen des Führers, als sie sich den Weg zu ihrer Begleiterin bahnte. Li Qins liebes, aber hässliches Gesicht war gelassen wie immer, und ihre Stimme war immer noch so überraschend schön wie damals, als sie sich das erste Mal getroffen hatten. „Haben Sie den Gipfel erreicht und sind nun zurückgekommen, um uns den Weg zu weisen, Madam?“
Das war Li Qins Sinn für Humor. Es war offensichtlich, dass nur ein Weg zum Gipfel hinaufführte. „Ich habe keine Lust mehr, ins Leere zu reden. Das ist zu einseitig. Wir gehen jetzt.“
Gehorsam wandte sich Li Qin um und begann, den Pfad hinunterzugehen. „Gehen wir zum Hotel zurück?“
„Nein. Nach Hause.“
„Ah.“ Schweigend folgte ihr Li Qin.
„Du tust es schon wieder“, murmelte Li Lei. „Das ist sehr unschön.“
„Ich habe nichts gesagt.“
„Du denkst sehr laut.“ Ein paar Minuten lang stiegen sie weiter schweigend bergab, bis sie widerstrebend sagte: „Ich gebe es ja zu. Du hattest recht. China ist nicht länger meine Heimat.“
Sanft antwortete Li Qin: „Das habe ich nicht gesagt.“
Nicht wörtlich, nein. Sie hatte gesagt, dass Li Lei ihrer Ansicht nach in China nicht das finden würde, was sie suchte. Aber es lief auf dasselbe hinaus, denn Li Lei sehnte sich nach Heimat. Nach Heimat und danach, Menschen wiederzusehen, von denen doch so viele schon nicht mehr lebten.
Aber nicht alle. Sie blieb stehen und wandte sich um, um ihrer alten Freundin in die Augen zu sehen. „Ich habe etwas gefunden, nach dem ich nicht gesucht habe. Oder es hat mich gefunden.“ Sie holte langsam Luft und atmete wieder aus. „Die Wende. Die Wende ist gekommen, Li Qin.“
Li Qin sog die Luft ein, so leise, dass selbst Li Leis Ohren das Geräusch kaum vernahmen. Ihre Augen weiteten sich. Sie war nun ganz und gar nicht mehr gelassen.
1
19. Dezember, 09.52 Uhr (Ortszeit)
20. Dezember, 02.52 Uhr (GMT)
Das National Symphony Orchestra hatte mit seiner Aufführung des „Messias“ von Händel um halb neun begonnen, und der Chor brachte gerade das „Halleluja“ zu Ende, als der Tenor sich in einen Wolf verwandelte.
Bis dahin hatte Lily Yu den Abend genossen. Was sie nicht erwartet hatte, nachdem sie die neuesten Informationen über die Ermittlungen erhalten hatte. Und davor hatte sie sich mit der Frage herumschlagen müssen, was sie anziehen sollte. Lily hatte nichts gegen schicke Kleidung. Ihr Schrank zu Hause war gut gefüllt, hauptsächlich mit Jacken für die Arbeit und dergleichen, aber ihre wenigen schicken Sachen hatte sie mitgenommen nach D.C. Der Auftrag erforderte es. Ihr Lieblingskleid aus schwarzer Seide hatte sie also dabei, und was machte es schon, wenn sie es bereits viermal getragen hatte? Mit Schwarz konnte man nichts falsch machen, vor allem wenn das Kleid aussah, als hätte man es ihr auf den Leib geschneidert.
Was auch stimmte. Ihre Kusine Lynn war gerade dabei, sich ein Geschäft als Schneiderin aufzubauen.
Was ihr fehlte, war ein Mantel. Ein schicker Mantel, um genau zu sein. Nur einen Tag, nachdem ihr Flugzeug auf dem Boden von Reagan International Airport aufgesetzt hatte, hatte sie sich bei Land’s End eine Jacke gekauft, aber die konnte sie ja wohl kaum über ihr schwarzes Seidenkleid ziehen.
Lily war nur vorübergehend in Washington, D.C. Tagsüber besuchte sie Spezialkurse beim FBI im nahe gelegenen Quantico, und abends ging sie auf Partys. Die Partys waren Arbeit, kein Vergnügen. Sie war jetzt zwar FBI-Agentin, Mitglied der geheimnisvollen Einheit Zwölf in der Magical Crimes Division, aber im Moment an den Secret Service „ausgeliehen“ worden. In dem Fall, wegen dem sie hier war, waren dem FBI die Hände gebunden: Ein Dämon hatte einem Kongressabgeordneten einen Handel angeboten.
Und der Abgeordnete hatte es gemeldet. Was andere, denen das Gleiche passiert war – dessen waren sie sich ziemlich sicher –, nicht getan hatten.
Sie mussten unbedingt herausfinden, ob irgendein Kongresstyp oder ein hochgestellter Beamter mit Blut auf der gestrichelten Linie unterschrieben hatte, aber Lily hasste die Rolle, die sie bei den Ermittlungen spielte – vor allem, weil es ihr nicht erlaubt war, wirklich zu ermitteln. Auch mit Informationen war man sehr sparsam umgegangen. Der Secret Service nahm den ersten Teil seines Namens viel zu ernst, und die meisten von ihnen mochten die Unit nicht oder vertrauten ihr nicht.
Viele Leute dachten so über Magie. Das war einer der Gründe, warum Lily ihre eigene Gabe so lange geheim gehalten hatte.
Lily war eine Berührungssensorikerin; ihre Gabe war sehr selten. Magie hatte keine Wirkung auf sie, aber sie spürte sie auf der Haut und war in der Lage, die Art und manchmal auch die Quelle auszumachen. Jahrelang waren Berührungssensoriker dazu benutzt worden, andere, die eine Gabe hatten, und Andersblütige, die unerkannt bleiben wollten, zu outen. Eigentlich sollte die Zeit der Verfolgung nun vorüber sein, aber das Vorurteil verschwand nicht einfach mit den offiziellen Sanktionen.
Lily hatte nie jemanden geoutet. Punkt. Die Arbeit, die sie jetzt für den Secret Service machte, kam dem sehr nah, aber es war etwas anderes, ob man einen Pakt mit einem Dämon schloss und Hexerei ausübte oder ob man sich einmal im Monat in einen Wolf verwandelte. Lily verstand das. Außerdem wollten die da oben nicht, dass irgendetwas von diesen Ermittlungen an die Öffentlichkeit drang, und sie hatte eine perfekte Tarnung für ihre Partybesuche. Rule verbrachte viel Zeit in D.C., wo er für sein Volk Lobbyarbeit machte. Im Moment setzte er – oder vielmehr sein Vater – sich für den Gesetzentwurf zur Bürgerrechtsreform ein. Die Verhandlungen des Ausschusses hatten sich festgefahren, aber es gab noch Hoffnung.
Also hatte sie Hände geschüttelt, gelächelt und dabei einen Berater, ein Mitglied des Repräsentantenhauses und einen hohen Beamten gefunden, auf deren Haut orangefarbene Spuren gewesen waren. Sie waren befragt worden, und obwohl Lily bei diesen Befragungen nicht dabei gewesen war, sah es so aus, als würden sie bald herausfinden, wer den Dämon hierhergebracht hatte, damit der diesen Handel anbieten konnte.
Heute Nachmittag dann hatte man ihr gesagt, dass die Akte geschlossen würde. Der Verdächtige hätte gestanden, indem er sich umgebracht hatte. Er war sogar so umsichtig gewesen, eine Nachricht zu hinterlassen. Nun sah es so aus, als würde sie Weihnachten nach Hause fliegen können.
Eigentlich sollte sie sich darüber freuen. Schade, dass sie selten so fühlte, wie sie eigentlich sollte.
Ihr Zuhause war San Diego, wo das Wetter wenigstens vernünftig war. Dort wurde Wasser nicht fest, es sei denn, man tat es ins Gefrierfach. Und es fiel auch nicht oft vom Himmel, und ganz bestimmt nicht in Form von eisigen Kugeln, wie hier in der letzten Nacht.
Das war ein Schock für sie gewesen. Sie hatte immer gedacht, in Virginia wäre es warm.
Als sie gestern aus Quantico zurückgekommen war, hatte ein Mantel auf ihrem Bett gelegen, ein langer schwarzer Mantel aus einer teuren Mischung aus Wolle, Seide und Kaschmir. Ein außerordentlich warmer und luxuriöser Mantel, an dessen Kragen eine billige rote Schleife steckte … und auf dem ein dicker roter Kater seine Haare verteilte.
Schnell hatte sie Dirty Harry heruntergehoben, sehr zu seinem Missfallen.
Harry war eine von Rules Extravaganzen. Da sie nicht gewusst hatten, wie lange sie in Washington bleiben würden, hatte Rule darauf bestanden, den Flug für den Kater zu bezahlen. Das Komische war, dass er und Harry sich nicht einmal besonders mochten, aber Rule betrachtete Harry als Lilys Familienangehörigen. Also war Harry mit ihnen zusammen in der ersten Klasse geflogen, auch wenn er die Ehre nicht sehr zu würdigen gewusst hatte. Natürlich war er in seiner Tragekiste gewesen und hatte Beruhigungsmittel bekommen – ebenso zu seinem wie zu ihrem Wohl.
„Ich hatte keine Zeit, ihn einzupacken“, hatte Rule gesagt, der hinter ihr ins Zimmer getreten war.
„Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir uns unsere Geschenke Heiligabend überreichen und nicht vorher.“ Sie wollte streng klingen, aber die Art, wie sie über den Stoff des Mantels strich, hatte den Eindruck möglicherweise wieder zunichtegemacht.
Seine Mundwinkel hatten gezuckt. „Ich konnte nicht mehr warten. Vergib mir. Mir macht es nichts aus, dich zittern zu sehen und zu hören, wie du dich über das Wetter beschwerst. Daran habe ich mich inzwischen gewöhnt, und deine Lippen sind sehr hübsch, wenn sie blau anlaufen. Aber ich weiß, wie sehr du Verschwendung hasst, und da es so aussieht, als würden wir den großen Tag nun doch in Kalifornien verbringen …“
Sie verdrehte die Augen und brachte ihn mit einem Kuss zum Schweigen. Dann hatte sie ihm die Karten für das heutige Konzert überreicht, ihr eigenes vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, sodass sie sich nicht mehr darüber beschweren konnte, dass er mit seinem Geschenk so vorgeprescht war.
Und eigentlich hatte sie sich auch gar nicht beschweren wollen. Der Mantel war wunderschön.
Dieser wunderschöne Mantel lag jetzt, zehn Minuten vor zehn, über ihren Schultern, als das „Halleluja“ seinem Höhepunkt entgegenstrebte. Sie warf einen Blick auf den Mann an ihrer Seite.
Er sah gut aus. Lily begann, sich daran zu gewöhnen. Sie selber hatte sich auch ganz nett zurechtgemacht, aber Rule in einem Smoking war ein echter Hingucker. Das lag nicht nur an einer einzelnen Sache, dachte sie. Seine Gesichtszüge waren wohlgeformt, aber nicht perfekt: Die Lippen ein wenig schmal, die Nase ein bisschen schief, genauso wie sein Lächeln. Die Wangenknochen waren scharf geschnitten, genauso wie die Augenbrauen, die so dunkel waren wie sein Haar.
Im Moment saß er vollkommen still da, den Kopf leicht schief gelegt, ganz auf die Musik konzentriert.
Gut. Sehr gut.
Die Magie, die dafür sorgte, dass Lupi so schnell heilten, war bei Rule besonders stark ausgeprägt. Er hatte sich schnell wieder erholt von der Operation, die nötig gewesen war, nachdem ein Dämon ihn in Stücke gerissen hatte. Aber etwas in ihm war nicht geheilt. Er schwieg zu häufig und zögerte oft, bis er lächelte.
Trauerte er? Vermisste er sie … die andere Lily? Die, die sowohl fort als auch hier war?
Die Sänger sangen davon, dass es keinen Verlust gebe. Dass der Tod, wie die Buddhisten behaupteten, nur eine Illusion sei. Lily wünschte, sie könnte sich entspannen und sich von der Melodie treiben lassen. Aber dies war nicht ihre Art von Musik.
Aber es war die von Rule.
Er hatte ihr gesagt, dass seine Art Musik liebt, aber genauso gut könnte man sagen, dass Texaner Football lieben oder Katzen Thunfisch. Sie wusste jetzt, dass die meisten Lupi zumindest ein Instrument spielten und dass alle gut singen konnten. Das absolute Gehör war eher die Regel als die Ausnahme.
Das war der Grund, warum sie nun hier war, warum sie die Karten gekauft hatte. Außerhalb des Bettes hatte sie Rule schon lange nicht mehr so bei der Sache gesehen …
… nicht seitdem wir zusammen an dem steinigen Strand gesessen und den Drachen gelauscht haben.
Sie blinzelte. Freude, Trauer und ein Hauch von Eifersucht flackerten auf und erloschen wieder, zusammen mit der Erinnerung. Nie gelang es ihr, es festzuhalten, dieses Flüstern ihres anderen Ichs. Wie der Flaum von Pusteblumen schwebten sie manchmal durch ihren Geist und quälten sie mit dem, was noch nicht ganz verloren war.
Fast glaubte sie, sie könnte hören, wie die Drachen die heraufziehende Nacht besangen. Fast.
Sie schreckte auf.
Magie zuckte und blitzte über jeden Zentimeter ihrer nackten Haut, eine Welle roher Kraft, als wenn eine Tür sich geöffnet hätte und nun der Wind hineinblies. Ihr Herz stockte, und als sie den Atem einsog, prickelte Magie ihren Hals hinunter, etwas, was bisher noch nie passiert war.
Dann war es vorbei, wie eine magische Windhose, die weitergezogen war. Sie drehte sich um, um es Rule zu sagen.
Seine Augen waren schwarz. Nicht nur dunkel, sondern ganz schwarz. Das Weiße war verschwunden. Die Augen eines Tieres. An seinem Kiefer zuckte ein Muskel, und seine Hände hatten die Armlehnen des Stuhls so fest gepackt, dass es ein Wunder war, dass er sie nicht auseinandergebrochen hatte.
„Alles in Ordnung?“, fragte sie erschrocken.
Er sah sie aus blinden schwarzen Augen an. „Gib mir einen Moment“, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Jemand schrie. Zuerst dachte sie, es wäre wegen Rule, aber gleich darauf folgte ein zweiter Schrei, und dieses Mal kam er von der Bühne.
Sie wandte den Blick dorthin und sah noch die letzten Sekunden der Verwandlung.
Wahrscheinlich wusste niemand sonst im Publikum, was da gerade vor sich ging. Es war unmöglich, das Bild zu beschreiben – ein Riss in der Wirklichkeit, in dem Formen vor- und wieder zurückglitten, wie ein Möbiusband auf Speed.
Aber Lily sah so etwas nicht zum ersten Mal. Sie wusste, was hier passierte. Sehr bald würde auf der Bühne ein Werwolf stehen. Und dieser Werwolf würde verwirrt und verängstigt sein. Was sich nicht gut mit verwirrten und verängstigten Menschen vertrug.
Lupus, rief sie sich in Erinnerung, als sie sich erhob und an den Menschen vorbeiging, die neben ihr in der Reihe gesessen hatten. Nicht Werwolf. Heutzutage musste man sie Lupi im Plural und Lupus im Singular nennen. „Polizei“, fuhr sie einen bulligen Mann an, der aufgestanden war, um zu sehen, was auf der Bühne vor sich ging. „Setzen Sie sich hin.“
Er gehorchte. Sie trat in den Gang hinaus. Auf der Bühne herrschte das reinste Chaos. Sänger stolperten blindlings übereinander, Musiker ergriffen die Flucht. Der Dirigent hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Er schrie das Orchester an, wenn auch nicht in Englisch.
Schnell warf sie einen Blick zurück zu Rule. Er hatte sich nicht bewegt. Der Drang, sich zu verwandeln, war wohl zu stark, vermutete sie. Wenn er in seiner Konzentration nur einen Moment nachließe, würde er den Kampf verlieren. Und dann hätten sie es mit zwei Wölfen zu tun, die den Menschen Angst einjagen würden.
Sie war nicht bewaffnet. Bei einem Abend im Kennedy Center wäre ein Schulterhalfter nicht das passende modische Accessoire gewesen, daher hatte sie es im Auto gelassen.
Das war wahrscheinlich ohnehin kein Problem, das mit einer Schusswaffe zu lösen war. Sie rannte den Gang hinunter zur Bühne. Auch andere Leute im Publikum waren jetzt aufgestanden. Es würde nicht lange dauern, bis aus der Verwirrung Panik würde und sie alle auf die Notausgänge zustürmten.
„Polizei!“, schrie sie jetzt. „Setzen Sie sich alle hin und bleiben Sie ganz ruhig. Sie sind nicht in Gefahr.“ Wenigstens gab es keinen Orchestergraben. Sie stemmte sich hoch auf die Bühne – nicht sehr graziös in ihrem kurzen Rock, aber das war nicht zu ändern. Der Chor hatte auf einem Treppenaufbau hinter dem Orchester gestanden. Die meisten Stufen waren jetzt leer, nur einige Menschen kletterten noch hastig herunter. Am Ende der höchsten Reihe lag eine Frau stöhnend am Boden.
Aber um den Wolf herum war niemand. Er stand am Fuß der Stufen, ein großes Tier, aber kleiner als Rule in seiner Wolfsgestalt. Rötliches Fell. Das Nackenfell gesträubt. Die Zähne gefletscht.
Der Dirigent schrie ihn an.
„Idiot“, murmelte sie leise und hastete mit großen Schritten zu ihm hin und packte ihn an der Schulter. „Seien Sie still.“
Er wandte sich um, die Augenbrauen fuhren nach oben, der Mund formte sich zu einem überraschten O.
„Sie schreien einen Wolf an. Das mag er nicht.“ Obwohl unter dem Fell und hinter dem Knurren ein Mann war, schien der Wolf im Moment die Oberhand zu haben.
„Aber er hat die Aufführung ruiniert! Er hat alles ruiniert!“
„Das ist nicht seine Schuld. Wie heißt er?“
„Was? Wie er heißt? Warum?“
„Sagen Sie mir einfach, wie er heißt.“
„Paul. Paul Chernowich.“
„Okay. Die Leute sind in Panik ausgebrochen. Eine Person ist verletzt.“ Sie deutete zu der Frau auf dem Boden. „Sorgen Sie dafür, dass sie medizinische Hilfe bekommt. Sie da.“ Sie wandte sich an eine Frau, die einfach dastand und den Wolf mit offenem Mund anstarrte, offenbar zu geschockt, um die Flucht zu ergreifen. Sie war jung, hatte dunkle Haare und war mindestes zur Hälfte asiatischer Abstammung. In der einen Hand baumelte ihre Violine, in der anderen der Bogen. „Spielen Sie etwas.“
Die Frau drehte sich zu ihr um. „W… wie bitte?“
„Spielen Sie etwas. Irgendetwas. Das wird die Leute beruhigen.“ Und auch den Wolf, hoffte sie. „Lupi tun Frauen nichts“, fügte sie hinzu. „Ihnen wird nichts passieren.“
Die Frau warf erst einen Blick auf den Wolf, dann auf die Menge und sah dann wieder Lily an. Ihre Augen zeigten, dass sie zu verstehen begann. Ihre Mundwinkel hoben sich. „Ein Solo“, murmelte sie. „Warum nicht?“ Sie trat nach vorn auf die Bühne, legte die Violine unter das Kinn, ließ den Boden für einen dramatischen Moment über den Saiten schweben und begann zu spielen.
Die süßen Töne einer Bach-Sonate erklangen.
Lily wandte sich dem Wolf zu. Er sah sich um, die Nackenhaare immer noch aufgerichtet, aber er knurrte nicht mehr. Gut. Sie fragte sich, warum er nicht einfach davongelaufen war. Wäre das nicht der natürliche Impuls gewesen? „Paul.“ Sie sprach mit fester, aber nicht lauter Stimme. Er würde sie hören. „Du bist durcheinander. Du weißt nicht, was passiert ist, nicht wahr?“
Er sah sie an und suchte dann die Umgebung mit den Augen ab.
Wonach suchte er? Nach dem, der ihm das angetan hatte, vielleicht. „Ich weiß nicht, wer dich zu der Verwandlung gezwungen hat, aber du bist nicht unmittelbar in Gefahr.“ Sie trat einen Schritt näher. Wo war Rule? Kämpfte er immer noch gegen die Verwandlung an? „Wir kennen uns nicht, aber ich bin sicher, du hast von mir gehört. Ich bin Lily Yu, Rules Auserwählte. Rule Turner, vom Clan der Nokolai.“
Er sah sie direkt an und knurrte.
„Okay, vielleicht bist du kein Nokolai. Aber du würdest einer Auserwählten nichts tun.“ Das sagte sie sehr entschieden, obgleich der Anblick seiner Zähne, seines gesenkten Kopfes und der aufgestellten Nackenhaare ihr Herz schneller schlagen ließ. Sie hob das kleine Amulett hoch, das sie um den Hals trug. „Du weißt, was das ist. Eure Dame …“
Ein Schuss ertönte. Sie wirbelte herum, und ihre Hand fuhr instinktiv an die Stelle, wo normalerweise ihre Waffe war.
Ein uniformierter Polizist stand im Gang, die Beine gespreizt, die Waffe auf sie gerichtet.
Der Wolf rannte an Lily vorbei, so schnell, dass es kaum zu sehen war, direkt auf den Idioten mit der Waffe zu.
Bis Rule sich auf ihn warf.
Lily wusste nicht, wo er hergekommen war. Er schien einfach vom Himmel gefallen zu sein. Und er war in Menschengestalt, verdammt, was ihn kaum in die Lage versetzte, mit einem zweihundert Pfund schweren Wolf zu ringen! Das Knäuel aus Mann und Wolf wälzte sich hin und her und blieb schließlich am äußersten Rand der Bühne liegen. Rule war unten. Die Kiefer des Wolfs öffneten sich und schnappten nach Rules Kehle …
Die Rule noch weiter entblößte, indem er den Kopf zurücklegte. Jemand schrie.
Vielleicht war es sie dieses Mal.
Der Wolf erstarrte. Seine Zähne waren an Rules Kehle, aber er rührte sich nicht. Nach einem schrecklich langen Moment zog er das Maul zurück. Er schnüffelte an Rules Kinn und seine Brust hinunter und schaute dann in sein Gesicht. Sie hätte schwören können, dass sie Misstrauen sah in seinem Blick.
„Ni culpa, ne defensia“, sagte Rule.
Langsam zog sich der Wolf zurück, und Rule konnte sich aufsetzen.
Zitternd atmete Lily ein. Die Violinistin ging von einer Sonate in die andere über, verlangsamte von Allegro auf Adagio. Die Musik schwebte von der Bühne hinaus in das Publikum, wie Schaum auf einer sich zurückziehenden Welle.
Das uniformierte Arschloch legte wieder seine Waffe an.
2
19. Dezember, 21.52 Uhr (Ortszeit)
20. Dezember, 02.52 Uhr (GMT)
Cynna Weaver stand an einer Straßenecke in Washington D.C., die niemals in einem Touristenführer oder auf einem Wahlkampffoto auftauchen würde. Eigentlich waren Temperaturen über null angekündigt worden, aber sie hatte den starken Verdacht, dass es mittlerweile Minusgrade hatte. Sie stopfte die Hände in die Taschen ihrer Bomberjacke. Sie hatte an ihre Jacke gedacht, an ihren Zimmerschlüssel, an ihr Telefon, an ihre Brieftasche und an ihre Waffe. Aber nicht an eine Mütze oder an Handschuhe. Wie dumm von ihr.
Sie wusste nicht, wo sie war. Das war mehr als peinlich, wenn man bedachte, welche Gabe sie hatte. Irgendwo im Südosten von D.C.; irgendwann war sie in die Green Line umgestiegen, aber sie konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wo sie ausgestiegen war. Oder warum.
Wahrscheinlich wegen Anacostia, dachte Cynna und ließ den Blick schweifen. Was nur bewies, wie wenig sie ihrem Unterbewusstsein trauen konnte, aber ihrem Bewusstsein fiel zurzeit auch nicht viel ein, außer: Mach, dass du hier wegkommst.
Sie entschied sich für irgendeine Richtung und ging los.
Ihre derzeitige Unterkunft war nicht viel anders als die Hotelzimmer, in denen sie abgestiegen war, seit sie vor sieben Jahren begonnen hatte, in dem Spiel von Recht und Ordnung ständig die Seiten zu wechseln. Das Zimmer hatte ein anständiges Bett, Kabelfernsehen, heißes Wasser, und es wirkte vollkommen unpersönlich. Nachdem sie ihren Burger, den sie beim Zimmerservice bestellt hatte, zur Hälfte aufgegessen hatte, hatte sie es nicht mehr ausgehalten.
Dabei wusste sie gar nicht, was ihr eigentlich zu schaffen machte. Das unpersönliche Zimmer? Die zu persönlichen Träume, die sie quälten? Oder die Träume, die sie nicht mehr hatte … diese sturen Mistkerle, dachte sie böse. Obwohl sie sie schon lange nicht heimgesucht hatten, warfen die Träume immer noch ihre Schatten.
Was auch immer dieses Mal der Grund gewesen sein mochte, sie wusste, wie sie sich danach fühlte. Und doch hatte sie das Gefühl nie benennen können. Sie wusste nur, dass sie etwas tun musste, wenn es wieder zuschlug. Irgendetwas. Als sie noch jung und dumm gewesen war, hatte das bedeutet, Party zu machen. Heute versuchte sie, sich körperlich zu verausgaben.
Heute Abend war sie in die Metro gestiegen und hatte dann angefangen, zu laufen. Unglücklicherweise war sie viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, ihren Gedanken in ihrem Hamsterrad hinterherzujagen, als dass sie auf den Weg geachtet hätte. Als sie endlich aus ihrer dummen, selbst verschuldeten Trance aufgewacht war … Nun, das hier war nicht die schlimmste Straße, in der sie je gewesen war, aber beinah. Und sie kannte ein paar wirklich schlimme Ecken.
Ein Truck fuhr langsam an ihr vorbei, die Fenster heruntergelassen, die Musik auf volle Lautstärke, sodass sie den Bass durch die Sohlen ihrer Reeboks wummern spürte. Einer der Blödmänner auf dem Rücksitz steckte den Kopf aus dem Fenster und machte ihr ein Angebot, das sie nur zu gerne ablehnte. Was sie auch tat, indem sie eine Zeichensprache benutzte, die an jeder Highschool in Amerika verstanden worden wäre.
Nicht sehr professionell, aber sie war ja auch nicht aus beruflichen Gründen hier. Sie war hier, weil … nein, wirklich, ihr fiel kein einziger vernünftiger Grund ein.
Direkt vor ihr, über einer zerschrammten Tür, summte ein Neonschild, auf dem schlicht Bar stand. Die Tür ging auf, und Rap-Musik quoll heraus, dazu der Duft von Gras. Zwei junge Männer in Cargohosen kamen hinterher. Einer von ihnen geriet ins Stolpern und kicherte. Der andere sah sie an.
Oje.
„He du“, sagte er leise. „Was machs du’n hier? Is wohl nich deine Gegend.“
Es war keine freundliche Frage. Dafür war sein Blick zu leer.
Leute aus der Mittelschicht hatten viele Vorurteile über Gegenden wie diese. Sie dachten, jeder hier nähme Drogen und verdiente seinen Lebensunterhalt als Dealer, Zuhälter oder Nutte und sobald man den Fuß in dieses Viertel setzte, würde man überfallen oder vergewaltigt.
Wie die meisten Vorurteile waren auch diese falsch. Die Menschen, die hier lebten, wurden nicht jedes Mal überfallen, sobald sie die Straße hinuntergingen, und die meisten hassten Gewalt und Verbrechen noch viel mehr als jede Familienmutter, die sich die Kurzfassung auf CNN ansah. Aber eine Frau allein, nachts, die nicht aus dieser Gegend stammte …
Cynna blieb stehen und ließ die Schultern kreisen, um sie zu lockern. Sie ließ ein bisschen Energie in eines der Tattoos auf ihrem Unterarm fließen, aber sie ließ den Reißverschluss ihrer Jacke geschlossen, um nicht in Versuchung zu kommen, wegen einem von diesen Idioten ihre Waffe zu ziehen. Ruben würde ausrasten, wenn sie jemanden erschießen würde. „Verpiss dich.“ Hau ab, Jungchen.
„Hör ma die da an!“ Der andere richtete sich auf, immer noch grinsend. „Die weiße Tussi hat ’ne ganz schön große Klappe. Ist wohl scharf auf schwarzes Fleisch?“
„Vielleicht isse weiß, vielleicht auch gelb.“ Er ließ seine toten Augen über ihren Körper wandern. „Schwer zu sagen mit dem ganzen Gekritzel aufm Gesicht.“
„Ich bin kariert.“ Sie schickte noch mehr Energie an den Zauber auf ihrem rechten Arm. „Wissen eure Mamas, dass ihr Jungs so spät noch draußen seid?“
Er trat einen Schritt vor. „Vielleicht find ich ja raus, was du bist.“
Der wollte es wirklich wissen. Das Blut rauschte durch Cynnas Adern. Sie verlagerte ihr Gewicht auf die Fußballen und öffnete ihre Schutzschilde.
Die plötzliche Energiewelle ließ sie taumeln. Was, zum Teufel …?
Die Türen der Bar öffneten sich wieder, und ein weiterer junger Schwarzer trat heraus. Er war dünn wie eine Schlange und größer als die ersten beiden. „Du hältst den Verkehr auf, Mann“, sagte er und gab dem, der gekichert hatte, einen Stoß. „Los, beweg dich.“
Gehorsam trat der andere zur Seite. „Jo-Jo checkt die weiße Tussi. Mal sehn, ob ihre Fotze so blond ist wie ihre Haare. Schwer zu sagen, wo sie das ganze Gesicht vollgemalt hat.“
Der Neuankömmling warf ihr einen Blick zu. Dann gab er seinem Freund eine Kopfnuss. „Blödmann!“
Jo-Jo fuhr wütend herum. „Was soll der Scheiß?“
„Das is ’ne Dizzy.“
Der Zweite schnaubte. „Diese Dizzys bringen’s nicht. Reißen bloß das Maul auf.“
„Manche haben’s in sich.“ Der große junge Mann musterte sie. Hinter diesen Augen war Leben – und ein funktionierendes Gehirn. „So wie sie.“
Jo-Jo guckte mürrisch drein. „Kannst du jetzt hellsehen, oder was?“
„Arschloch. Guck sie doch an. Du willst sie bespringen, ja? Und sie wartet bloß, hat keine Angst. Sie will, dass du’s versuchst.“ Zum ersten Mal sprach er sie jetzt direkt an. „Jo-Jo ist ’n Arsch, und Patch hier tut nix, der ist bloß dumm.“
Sie hielt seinen Blick einen Moment lang fest, dann nickte sie knapp. „Okay.“
Die drei machten Platz, damit sie weitergehen konnte – der Große und Jo-Jo standen ruhig da, Patch wedelte mit dem Arm. Sie ging an ihnen vorbei, ohne sie anzusehen – mit genügend Selbstvertrauen war die Schlacht schon fast gewonnen –, aber sie blieb wachsam, falls der zugedröhnte Jo-Jo seine Meinung doch noch ändern sollte.
Nichts geschah.
Auch gut, sagte sie sich. Normalerweise gab ihr „Finger weg“-Zauber jedem einen ordentlichen Schlag, der versuchte, sie anzufassen. Aber aus irgendeinem Grunde hatte sie plötzlich unter außergewöhnlich viel Strom gestanden. Wenn sie den Zauber benutzt hätte, hätte sie einen von diesen beiden Idioten möglicherweise ernsthaft verletzen können.
Apropos Strom … Sie ging noch ein paar Straßen weiter und blieb dann stehen. Sie murmelte einige Worte, konzentrierte sich einen Moment lang, ein Teil der überschüssigen Energie floss auf ihrer Haut entlang zu einem Muster, das als Speicherzelle diente. Aber dort konnte sie nicht alles aufnehmen. Es war zu viel Energie.
Sie drückte die Handfläche gegen die Backsteine des nächstgelegenen Gebäudes und entlud nach und nach den Rest. Dabei musste sie an Cullen denken. Ihm hätte es sicher gefallen, den Rest an Energie aufzunehmen.
Der Mann raubte ihr den letzten Nerv. Auch weil ihr bei dem Gedanken an ihn immer ganz anders wurde. Und das hätte seinem dicken, fetten Ego sicher sehr gut gefallen. Wenn er es je erfahren würde, was selbstverständlich niemals geschehen würde. Aber er war so eingebildet, zu glauben, dass sie jedes Mal scharf wurde, wenn sie an ihn dachte, was er dagegen nicht tat, weil er sicher nie einen Gedanken an sie verschwendete. Aber falls doch …
Lass das, sagte sie sich. Sie sollte lieber herausfinden, woher diese Energie gekommen war. Magie schwebte nicht einfach frei herum und wartete darauf, dass irgendjemand, der auch nur eine klitzekleine Gabe hatte, sie aufsaugte.
Nicht, dass Cynnas Gabe klein gewesen wäre. Sie versuchte, sich nichts darauf einzubilden, aber sie war die stärkste Finderin des Landes. Außerdem kannte sie sich mit Zauberei aus. Theoretisch konnte jeder, der über eine Gabe verfügte, Zauberei anwenden, aber die meisten taten es nicht. Entweder sie fanden niemanden, der es ihnen richtig beibrachte, oder sie hatten kein Interesse, keine Geduld oder kein Geschick, so wie manche einfach kein Talent für Mathe hatten.
So wie sie. Cynna war schlecht in Mathe. Aber für Zauberei hatte sie ein Händchen; dann war sie mit Leidenschaft bei der Sache und hatte viel Geduld.
Die Luft war kühl und nass geworden. Es war noch kein richtiger Nieselregen, nur eine klamme Feuchtigkeit, die das Licht der Straßenlampen verschwimmen ließ und die kalt auf ihren Wangen lag. Ein wunderbares Wetter, um drin im Warmen zu bleiben, da, wo ehrbare Bürger jetzt ohne Zweifel waren – gemütlich und kuschelig zu Hause, vielleicht mit einem Feuer im Kamin und einem Glas Wein in der Hand.
Nun, das Feuer würde sie jetzt nicht so schnell herzaubern können, aber ein Glas Wein hörte sich gut an. Etwas Prickelndes vielleicht. Ein paar Straßen weiter war eine viel befahrene Kreuzung. Sie würde sich ein Taxi nehmen, zurück zum Hotel fahren und sich etwas vom Zimmerservice bringen lassen. Selbst nach Jahren im Wohlstand fand sie Zimmerservice immer noch aufregend. Vielleicht würde das ihr Gefühl von Enttäuschung vertreiben.
Um Himmels willen. Enttäuschung? War sie etwa auf der Suche nach einer Schlägerei gewesen?
Ja. Das war es. Das war der Grund, warum sie im übelsten Viertel der Stadt gelandet war.
Verdammt, verdammt, verdammt. Wann würde sie es endlich lernen? Missmutig starrte Cynna auf ihre Füße und ging schneller.
Manche Menschen konnten ohne Probleme zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie arbeitete daran, aber wenn es hart auf hart kam und nicht genug Zeit war, alles gründlich zu durchdenken, dann hatte sie nicht den richtigen Instinkt. Aufgrund ihrer Persönlichkeit, fehlerhaft wie sie nun einmal war, entschied sie sich immer eher dafür, den Mistkerl umzulegen, als die andere Wange hinzuhalten.
Nicht, dass sie herumlaufen und ständig Leute umlegen würde. Das war bisher nur zweimal passiert, und beide Male war es Notwehr gewesen. Das Büro hatte entschieden, dass sie beim zweiten Mal richtig gehandelt hatte. Aber sie wussten nur von dem zweiten Mal.
Nun, Abel Karonski wusste von beiden Malen. Er war sowohl Freund als auch Kollege, und vor einigen Jahren hatte sie ihm die ganze Geschichte erzählt. Möglicherweise hatte er es Ruben gesagt, aber es tauchte in keiner offiziellen Akte auf. Sie hatte es nachgeprüft.
Sie liebte Schlägereien. Vor allem in Nächten wie diesen, wenn das namenlose Gefühl sich seinen Weg durch ihr Innerstes krallte und sich wie Stacheldraht darumwand, dann gab es nur zwei Dinge, die sie wirklich wollte: Kämpfen oder Sex.
So gingen gute Menschen nicht mit ihrer schlechten Laune um.
Sie blieb an der Ampel stehen und schaute finster drein. Hier, ein paar Straßen weiter, machte die Gegend einen besseren Eindruck. Die vier Straßenecken dieser Kreuzung waren eingenommen von einem mexikanischen Restaurant, einer Autowaschanlage, einem Secondhandladen und einem Lebensmittelladen.
Okay. Sie holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Wenn sie schon keine Kontrolle darüber hatte, was sie tun wollte, würde sie wenigstens das kontrollieren, was sie tat. Lass den Wein, schlaf lieber ein bisschen. Sie könnte in dem 7-Eleven ein Telefonbuch ausleihen, ein Taxi rufen und den Fahrer den Weg zurück zum Hotel suchen lassen.
Als sie die Straße zur Hälfte überquert hatte, sah sie die Kirche.
Sie befand sich am anderen Ende der Straße, von dem 7-Eleven durch eine Reihe kleinerer Geschäfte und einem großen Parkplatz getrennt. Wahrscheinlich ist sie so spät abends geschlossen, sagte sie sich.
Aber so spät war es noch nicht. Erst kurz nach zehn. Und auf dem Parkplatz standen Autos. Sobald sie die andere Straßenseite erreicht hatte, schlugen ihre Füße diese Richtung ein.
Wahrscheinlich ist es keine katholische Kirche, sagte ihre Stimme der Vernunft.
Wahrscheinlich nicht. Aber es konnte auch nichts schaden, nachzusehen. Sie hatte ja schließlich nichts Wichtiges zu tun … he, sieh mal an. Da waren Leute.
Die Seitentür hatte sich geöffnet. Ein älteres und ein jüngeres Paar traten heraus, gefolgt von einer kleinen Gruppe spanisch aussehender Menschen, was sie allerdings nicht mit Sicherheit sagen konnte, weil alle sich wegen des Wetters gut eingemummt hatten. Der Letzte trug eine schwarze Soutane.
Er sah aus wie ein Priester. Und jetzt war sie auch nah genug, um das Schild lesen zu können: Kirche zu Unserer Lieben Frau.
Ha. Was sagst du nun, Stimme der Vernunft?
Fröhlich sagten sich die Menschen Gute Nacht. Wagentüren schlugen zu, und Autos setzten aus dem Parkplatz zurück. Aber ein älteres Paar schien noch nicht gehen zu wollen. Sie standen unter einem schmalen Vordach bei der Seitentür, und die Frau redete wie wild auf den Priester ein, von Blumen und Tischen und wie viele Gäste kommen würden.
Die Vorbereitungen für eine Hochzeit. Deswegen waren sie so spät noch hier gewesen. Vielleicht hatte sie doch das Zeug zum Detective.
Als Cynna näher kam, hörte sie, wie der Mann seiner Frau sagte, sie solle Vater Jacobs nun ins Haus gehen lassen, im Freien sei es eiskalt. Einer nach dem anderen bemerkten sie sie und verstummten. Die Frau packte den Arm ihres Mannes und riss die Augen auf. Er spielte den Beschützer, indem er Cynna einen drohenden Blick zuwarf.
Wenigstens würden diese Leute sie nicht vergewaltigen wollen. „Vater Jacobs?“, sagte sie zögernd.
Trotz der Soutane sah er eher aus wie ein Ministrant als wie ein Priester. Er hatte ganz helle flachsblonde Haare, seine Haut hatte die Farbe von altem Pergament und war jetzt von der Kälte leicht gerötet. Sein Lächeln war überraschend süß. „Ja? Kann ich Ihnen helfen?“
„Ich hatte gehofft … ich weiß, es ist spät, aber würden Sie mir die Beichte abnehmen?“
Drinnen roch es nach Holz, Weihrauch und Blumen. Der Betschemel war hart. Cynna hätte um den Sichtschutz herumgehen und sich auf einen gepolsterten Stuhl setzen können, aber sie zog schmerzende Knie einer Beichte von Angesicht zu Angesicht auf jeden Fall vor.
Sie bekreuzigte sich. Sie wünschte, sie hätte gewartet, um in ihre Heimatkirche in Virginia zu gehen. Dieser Priester kannte ihre Geschichte nicht.
Leise kam seine Stimme von der anderen Seite der Trennwand. „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Einsicht in deine Sünden und in seine Barmherzigkeit.“
Am besten war es wohl, mit dem Einfachen zu beginnen. „Vergib mir Vater, denn ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte war vor … äh … fünf Wochen, und ich habe fünf Sonntagsmessen versäumt. Bei der ersten war es nicht meine Schuld, weil es dort keine Kirche gab.“ Tja, in der Hölle gab es wirklich einen Mangel an Kirchen. „Die anderen Male … war ich zu beschäftigt. Okay“, sagte sie, „das ist eine schwache Entschuldigung. Aber ich möchte gern erst beichten, bevor ich die heilige Kommunion empfange, und ich glaube, ich habe es zu lange aufgeschoben.“
Er wartete.
„Äh … ich habe einen Mann begehrt. Eigentlich zwei Männer, aber einer von ihnen ist vergeben, also zählt das nicht. Damit muss ich einfach fertig werden, verstehen Sie? Aber der andere …“
„Haben Sie Ihrem Begehren nachgegeben?“
„Nein. Aber ich wollte es. Ich bin nicht verheiratet oder anderweitig gebunden“, fügte sie hinzu. „Und er auch nicht.“ Noch eine Untertreibung. „Also würden wir kein Gelübde brechen, wenn wir … äh … Sie wissen schon.“
„Sex kann ein freudiger Ausdruck der Liebe innerhalb des Sakraments der Ehe sein. Außerhalb dieser Verbindung ist es vor allem ein selbstsüchtiger Akt, Vergnügen, das primär aus egoistischen Gründen gesucht wird.“
Das war eines der Themen, bei denen sie und die Kirche nicht einer Meinung waren. Cynna verstand nicht, was an Sex so falsch sein sollte. Früher vielleicht hatte Sex außerhalb der Ehe schlimme Folgen gehabt, und Enthaltsamkeit war sinnvoll gewesen, aber heutzutage?
Natürlich sagte Vater Michaels, dass es vermessen sei, ihre eigene Argumentation über die gesammelte Weisheit von Gottes heiliger Kirche zu stellen. Er hatte wahrscheinlich recht, aber Cynna fand, sie müsste ihre eigene Einstellung dazu finden. „Ich bin schuldig, weil ich stolz gewesen bin. Und wütend. Und …“ Ihr Herz hüpfte in ihrer Brust und begann zu hämmern, als wenn sie etwas einen Berg hinaufschieben würde. „Es ist nicht leicht zu sagen.“
„Haben Sie eine bestimmte Handlung im Sinn? Eine, die sie besonders bedrückt?“
„Ja genau.“
„Ist es eine lässliche Sünde oder eine Todsünde?“
„Ich weiß es nicht.“ Das war das Problem.
„Ich habe ihre Tattoos bemerkt. Waren Sie früher eine Dizzy?“
Wie die meisten Menschen, bezeichnete er den Straßenkult mit seinem Spitznamen. Nur wenige kannten den richtigen Namen der Bewegung: die Msaidiza. In Suaheli bedeutete das Helfer.
„Nicht mehr, seit ich in der Kirche bin.“
„Haben Sie andere Formen von verbotener Magie praktiziert, oder sind Sie sonst irgendwie mit Aberglauben in Berührung gekommen?“
Die Frage war heikel. Vater Michaels sagte, dass die Einstellung der Kirche zu Magie so verworren war, dass man praktisch ein Konklave einberufen müsste, bevor man einen Zauber ausführen dürfte. Er hatte ihr geraten, ihre Fähigkeiten als Waffe zu betrachten – und ihre Gabe und ihre Zauberkraft ausschließlich zur Selbstverteidigung einzusetzen oder in Ausübung ihrer Pflicht und nur, wenn es eindeutig dem Gemeinwohl diente. „Ich denke, in diesem Punkt habe ich ein reines Gewissen“, sagte sie nach einer Weile, „das ist es nicht, was mich bedrückt.“
Er wartete.
Sie holte tief Luft und brachte es heraus. „Ich habe getötet.“
Stille.
„Keine Menschen. Scheiße. Tut mir leid, Vater. Das klingt ganz falsch. Ich meine, ich habe Dämonen getötet.“
Dieses Mal dauerte die Stille länger. Endlich sagte er: „Sind Sie sicher, dass es Dämonen waren, die Sie getötet haben?“
Wenigstens sagte er ihr nicht, dass sie verrückt war. Sie nahm es ihm nicht übel, dass er fragte. Jeder wusste, dass Dämonen die Grenze nicht überschreiten konnten, wenn sie nicht gerufen wurden, und fehlerfreie Beschwörungsrituale waren heutzutage äußerst selten. Seit der sogenannten Säuberung. Wie so viele Dinge, die „alle“ wussten, war auch das falsch, aber das konnte dieser Priester nicht wissen.
In der Hölle allerdings waren Dämonen nicht ganz so selten. „Ähem … ich bin bei der MCD, müssen Sie wissen. Beim FBI. Und … es tut mir leid, aber über Einzelheiten kann ich nicht sprechen, nicht einmal mit einem Priester. Aber es wurden dabei Dämonen getötet.“
„Das ist keine Sünde, wenn die Tat nicht aus Böswilligkeit geschah“, sagte er freundlich. „Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird es nicht mehr als ein Gnadenakt an sich angesehen, sie zu vernichten, aber es sind seelenlose Wesen.“
Sie seufzte. Das war die Reaktion, die sie erwartet hatte. „Danke, Vater.“
Er redete noch ein wenig mit ihr und legte ihre Buße fest. Er fügte hinzu, dass er noch eine Weile in seinem Büro sein würde und sie sich im Altarraum aufhalten könne.
Cynna verstand den Wink. Sie setzte sich auf eine Kirchenbank, um mit dem Vaterunser zu beginnen, aber ihre Gedanken schweiften immer wieder ab.
Wenn man Dämonen tötete, waren sie tot. Die, die sie erschossen hatte, hatten ihr und den anderen noch viel schlimmere Dinge antun wollen, daher bereute sie nicht, was sie getan hatte. Das war es nicht. Aber trotzdem hatte sie das Gefühl, dass es nicht richtig war. Wenn sie keine Seele hatten, hatten sie auch kein Moralempfinden. Sie wussten nicht, was das Böse war, und konnten sich daher auch nicht für das Gute entscheiden. Ohne eine Seele hätten sie auch keine Chance auf ein Leben nach dem Tod.
Machte es das nicht noch schlimmer, sie zu töten?
Und warum hatte Gott die Welt so eingerichtet?
Sie rutschte auf ihrer Bank hin und her. Den Allmächtigen infrage zu stellen gehörte sich wohl nicht für eine gute Katholikin, aber sie war erst spät in die Kirche eingetreten und zum Teil aus selbstsüchtigen Motiven. Gläubige waren gegen Besessenheit geschützt.
Aber natürlich wusste jeder, dass es so etwas wie Besessenheit nicht mehr gab.
Verdammt. Sie hing immer noch ihren Gedanken nach, anstatt Buße zu tun. Vielleicht würde es mit dem Gegrüßet seist Du, Maria besser klappen. Mit Maria fühlte sie sich wohler als mit dem allmächtigen Vater.
„Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade …“
„Mein Kind.“
Die Stimme klang wie Kirchenglocken und Wind, wie das sanfte Schlagen der Wellen in der Nacht und wie der Jagdschrei der Eule. Und doch war es eine menschliche Stimme. Weiblich. Es war auch eine echte Stimme – ein Ton, der durch Schwingungen der Luft entstand –, keine Gedankensprache … und doch war ihr, als würde sie auch in ihrem Inneren klingen.
Ehrfurcht. Zum ersten Mal verstand Cynna die Bedeutung dieses Wortes. Lange wagte sie weder, sich zu bewegen noch zu atmen, in der Hoffnung, die Stimme würde noch einmal zu ihr sprechen. Endlich sagte sie: „M… Maria?“
„Nein.“ Das Wesen, dessen Anwesenheit sie spürte, war belustigt, aber doch freundlich. „Ich war viele, aber diese nicht. Ich bin schon dein, Cynna. Bist du mein?“
Sie antwortete, ohne nachzudenken und ohne Furcht: „Ich weiß nicht. Wer bist du?“
„Wenn du es weißt, wirst du deine Wahl treffen. Aber jetzt geh und suche deine Freunde. Beeil dich. Du wirst gebraucht.“