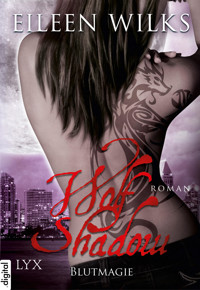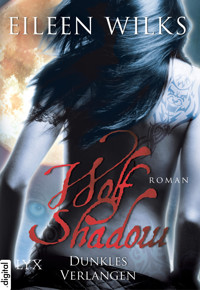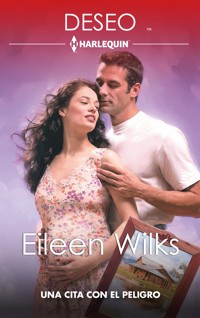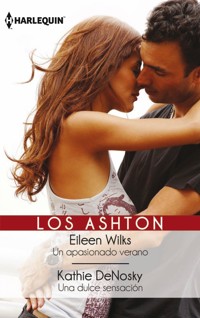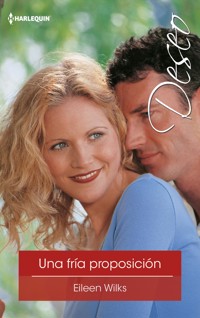9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wolf-Shadow-Reihe
- Sprache: Deutsch
Agentin Lily Yu und ihr Verlobter, der Werwolfprinz Rule Turner, müssen sich wegen eines magischen Vorkommnis vor dem Senat von Washington, D.C. verantworten. Da wird der radikal gegen Magie eingestellte Senator, der die Anhörung leitet, überraschend ermordet. Eine Katastrophe braut sich zusammen, die nicht nur das Volk der Lupi, sondern das ganze Land bedroht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
EILEEN WILKS
Wolf Shadow
TÖDLICHER ZAUBER
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Stefanie Zeller
Dieses Buch widme ich mit Freuden meiner Tochter Katie und ihrem wundervollen Verlobten Matt.
Ich bin wunschlos glücklich.
1
Als sie den Geist sah, befand sich Lily Yu gerade auf dem Schießstand der FBI-Zentrale.
Der Ohrenschutz hielt ihre Ohren warm, doch an den nackten Armen war ihr kalt. Den linken Arm hielt sie gerade ausgestreckt und ruhig, der rechte tat weh und zitterte. Mit ihm hatte sie gerade einige Schüsse abgegeben, bevor sie die Hand gewechselt hatte. Das war dumm gewesen. Wenn sie mit der Linken angefangen hätte, würde ihr der immer noch geschwächte Arm jetzt nicht so zusetzen. Denn um die neue Glock auf Höhe ihres Führungsauges zu bringen, musste sie den rechten Arm auf eine Weise drehen, die den verletzten Bizeps protestieren ließ.
Und er protestierte oft. Der Oberarmknochen war zwar wieder verheilt, und die Eintrittswunde hatte sich glatt geschlossen, aber die Austrittswunde war größer, unebener und rau. Einmal zerstörte Muskelmasse wuchs nicht wieder nach.
Doch bei Lily machte sie eine Ausnahme. Ihre Muskelmasse kam wieder, wenngleich langsam.
Leichter Schwefelgeruch lag in der Luft. Durch den Gehörschutz hörte sie dumpf die Schüsse, die ihr Nachbar auf der anderen Seite der Trennwand in regelmäßigen Abständen abfeuerte. Sie spürte das Kitzeln von Fell und Kiefernadeln im Bauch – der Grund, warum der zertrümmerte Knochen so schnell wieder zusammengewachsen war und ihr Muskel sich nach und nach regenerierte, obgleich dies eigentlich unmöglich war – und hatte das Gefühl, aufstoßen zu müssen.
Fünfzehn Meter vor ihr zog etwas Andersartiges wie ein Schleier über ihre durchlöcherte Zielscheibe.
Es war weiß. Vielleicht dachte sie deswegen sofort an einen Geist. Milchig, aber nicht durchsichtig, schwebte das Gebilde wie dreidimensionales Reispapier auf einer Diagonalen durch ihr Sichtfeld. Rauch war es nicht, dazu waren die Ränder zu klar umrissen. Die Form erinnerte an die eines Menschen, aber es hatte kein Gesicht. Auch als es wie auf einem steten Luftzug näher wehte, war es nicht deutlich zu erkennen – vier Glieder und ein Rumpf mit menschlichen Proportionen, die Einzelheiten verschwommen wie eine verwischte Kreidezeichnung.
Es kam direkt auf sie zu. Furcht ließ Lilys Rücken erstarren und ihre Augen weit werden.
Im Näherkommen streckte das gesichtslose Etwas seine Hand aus – ja, es war eindeutig eine Hand. Während der Rest der Gestalt undeutlich blieb, war diese Hand überaus plastisch, als hätte ein Künstler jedes noch so winzige Detail vom Daumenballen über die Handlinien bis hin zu den Fältchen an den Knöcheln herausgearbeitet. Am vierten Finger dieser Hand steckte ein Ring.
Ein goldener Ring. An der linken Hand, die mit der Handfläche nach oben zeigte. Flehend.
Lilys Herz raste und schmerzte, so heftig wurde sie von Mitleid gepackt.
Die milchige Gestalt verweilte kurz in ihrem Schweben. Dann, als sei sie schließlich doch nichts anderes als Rauch, wurde sie von einem Windhauch zerstreut und war verschwunden.
2
Amerika war keine klassenlose Gesellschaft.
Die gab es natürlich nirgendwo. Nirgendwo, wo auch Menschen wohnten. Menschen dachten ebenso hierarchisch wie Werwölfe, fand Lily. Sie gaben es nur nicht zu. Offiziell waren die Vereinigten Staaten eine Leistungsgesellschaft: Wer Talent hatte, sich anstrengte oder Außergewöhnliches leistete, schaffte es, so hieß es, bis ganz nach oben.
Möglicherweise stimmte das auch, wenn man davon ausging, dass Geld gleich Kompetenz war. Doch dieser Meinung war Lily nicht. Denn diese hübsche Metrik ließ eine weitere Komponente unberücksichtigt, die die Klassenzugehörigkeit mitbestimmte: Schönheit. Eine Frau, die über beides verfügte, dachte sie, als sie den Reißverschluss ihrer Jeans zuzog, wirkte möglicherweise kalt, weil sie sich isoliert fühlte und anderen Frauen mit Argwohn begegnete. Oder sie war eine hochnäsige Zicke.
Eventuell würde sie heute herausfinden, was von beidem auf die Frau ihres Chefs zutraf. Nach ihrer einzigen Begegnung im letzten Frühjahr neigte Lily dazu, sie für eine Zicke zu halten, doch es war nur ein sehr kurzes Zusammentreffen gewesen. Vielleicht lag sie ja falsch. Schließlich hatte Ruben sich für Deborah entschieden und war bei ihr geblieben. Außerdem war sie Lehrerin in der siebten Klasse, also …
»Bist du sicher, dass es ein Geist war?«
»Natürlich nicht.« Für einen Moment sah Lily rot – das Rot des Stretchpullis, den sie sich gerade über den Kopf zog. Dann sah sie wieder die grauen Wände und das helle Holz des Schlafzimmers und den Mann, mit dem sie dieses Schlafzimmer teilte. »Wie kann ich mir sicher sein? Ich bin kein Medium.«
»Aber es sah aus wie ein Geist.« Rule setzte sich auf das Bett, um sich die Schuhe anzuziehen. Als er den Kopf senkte, fiel sein nerzbraunes Haar nach vorn und verbarg sein Gesicht. Der Termin für den selbst für seine Verhältnisse längst fälligen Haarschnitt hatte schon festgestanden, bevor er vom Unterausschuss aufgefordert worden war, »seine Fachexpertise vom letzten März näher zu erläutern« – woraufhin er ihn sofort wieder abgesagt hatte.
Aus Widerspruchsgeist, nicht aus Zeitmangel. Die Aufforderung kam von einem erzkonservativen Senator, der hoffte, Rule mit unangenehmen Fragen so in Bedrängnis bringen zu können, dass dieser sich zu Aussagen hinreißen ließ, die er dann für seine Zwecke verwenden konnte. Daher wollte Rule unbedingt den Eindruck vermeiden, er habe sich die Haare schneiden lassen, nur um irgendwelchen konservativen Vorstellungen über gepflegtes Aussehen zu genügen.
»Weiß und milchig. Es schwebte. Ja, es sah aus wie ein Geist.« Als sie sich an das Mitleid erinnerte, das sie empfunden hatte, schnürte es Lily die Kehle zu. Das Wesen hatte etwas von ihr gewollt. Etwas gebraucht.
Geister, sagte sie sich entschieden, sind keine Menschen. Das hatte ihr einmal jemand erklärt, der es wissen musste. Was immer dieses Stück Ektoplasma gewollt hatte, es war an die Falsche geraten. Sie konnte ihm nicht helfen.
Lily drehte sich um, um sich im Spiegel zu begutachten. Hinter sich konnte sie Rule sehen. Die alten Sportschuhe – keine Socken –, die er gerade zuband, passten zu den abgewetzten Jeans mit dem Loch im Knie. Und seltsamerweise ebenso zu dem hauchdünnen schwarzen Kaschmirpullover, der vermutlich so viel wie eine Rate für den Toyota, den Lily endlich abbezahlt hatte, gekostet hatte. »Ich weiß, Ruben sagte ›zwanglos‹, aber …«
»Meinst du, Jeans sind zu zwanglos?«
»Nein, dich meine ich nicht. Du siehst gut aus.« Rule sah auch in zerrissenen Jeans und einem Kaschmirpullover wie ein Filmstar aus. Lily nicht. Zum einen besaß sie keinen Kaschmirpulli. Zum anderen verglich sich keine Frau, die noch bei Verstand war und wollte, dass es so blieb, mit Rule Turner. Denn der sah selbst in Kaugummipapier gut aus.
Er stand auf und ließ die weißen Zähne auf eine Art blitzen, die ihr immer noch durch Mark und Bein ging. »Du kannst doch nicht in einem Blazer bei einem Barbecue auftauchen, Lily.«
»Das wäre zu steif.«
»Was bedeutet, dass du auf dein Schulterholster verzichten musst.«
»Das weiß ich.«
»Du trägst ein Knöchelholster, nicht wahr?«
»Natürlich.« Darin steckte eine kleine, kurzläufige Beretta, die ihr ursprünglich einmal Rules Vater geliehen hatte. Als Isen sie ihr dann hatte schenken wollen, hatte sie nicht protestiert. Reichweite und Zielgenauigkeit konnte man von einer kurzläufigen Waffe nicht erwarten, doch ihre Mannstoppwirkung war gut. Eine ausgezeichnete Notfallwaffe.
Die Glock, mit der sie vorhin trainiert hatte, war jetzt ihre Hauptwaffe. Der Griff lag gut in der Hand, was immer ein Kriterium war, wenn man kleine Hände hatte. Die Reichweite stimmte, ebenso wie die Zielgenauigkeit, und mit der richtigen Munition war sie sehr wirksam. Aber trotzdem war sie nicht zu vergleichen mit ihrer SIG. Die war zu Hause in Kalifornien, begraben unter mehreren Tonnen Erde und Fels. Sie vermisste sie.
Aber egal, die hätte sie ohnehin nicht zur Grillparty ihres Chefs mitgenommen. Mit gerunzelter Stirn musterte sie sich im Spiegel. Dies war das erste Mal, dass sie privat zu den Brooks eingeladen war, und sie wollte einen guten Eindruck machen.
Die Jeans waren ganz annehmbar. Der Pulli … irgendetwas stimmte daran nicht. Rot stand ihr, daran konnte es also nicht liegen. Das Material war dehnbar, saß aber nicht zu eng für eine Party bei ihrem Vorgesetzten. Und auch der Ausschnitt war nicht zu tief. Er zeigte gerade genug Haut, um zu signalisieren »Ich bin privat hier, nicht dienstlich«. Aber die Haut sah irgendwie nackt aus.
Sie trug das toltoi nicht. Das war es.
Das toltoi war ein Talisman, den der Clan ihr überreicht hatte, als sie Rules Auserwählte wurde – als Symbol dafür, dass ihre Dame sie für ihn ausgesucht hatte. Zuerst hatte Lily geglaubt, die Dame der Lupi sei eine Göttin, nur ein Mythos, nicht real. Doch die Dame war so real wie ein Sonnenaufgang. Oder ein Kinnhaken. Und die Lupi beteten sie nicht an, sie dienten ihr.
Letzte Woche war die Kette durch einen dummen Zufall gerissen, und jetzt hatte sie Angst, den Talisman zu verlieren. Deswegen hatte sie ihn in San Diego einem Goldschmied gegeben, der mit Metall und mit Erdmagie vertraut war, damit er ihn in einen Ring einfasste. Das toltoi selbst hatte keine besonderen magischen Kräfte, aber es war auch nicht neutral. Es hatte … irgendetwas. Etwas, das Lily zu ihrem großen Ärger nicht benennen konnte. Aber was immer es war, es musste mit Achtung behandelt werden.
Und zu diesem Pullover fehlte eine Halskette. Sie trat vor ihren Schrank.
Lily mochte es, wenn alles an seinem Platz war. Die Armbänder lagen in dem Silberkästchen auf der Kommode. Daneben die Ohrringe in einer Dose aus Acryl. Halsketten hingen im Schrank in diesen Hängedingern. Sie fischte in einer der Taschen des Hängedings.
»Ein Schießstand ist schon ein komischer Ort, um einen Geist zu sehen, findest du nicht?« Sie zog eine doppelreihige Kette aus kleinen schwarzen Perlen heraus. »Und da ich bisher noch nie einen gesehen habe und daher nicht weiß, wie einer aussieht, kann ich mich nur auf Hörensagen verlassen.«
Rule trat hinter sie. »Normalerweise sind sie doch an den Ort gebunden, wo sie gestorben sind, oder nicht? So viele Leute, die auf einem Schießstand gestorben sind, wird es wohl nicht geben.«
»Das will ich hoffen«, sagte sie trocken. »Aber sie können auch an einen Gegenstand statt an einen Ort gebunden sein. Außerdem gibt es Geister, die gegen die Regeln verstoßen. Habe ich zumindest gehört.« Nachdenklich betrachtete sie die Kette, legte sie dann zurück und nahm stattdessen ein Halsband aus polierten Holzperlen in die Hand. »Kannst du das bitte für mich zumachen?«
»Nein, das nicht.« Er nahm ihr das Band aus der Hand. »Vielleicht ist dein Geist an eine der Waffen auf dem Stand gebunden.«
»Es ist nicht mein Geist.« Lily hatte einen Geist gehabt oder so etwas Ähnliches wie einen Geist – einen Teil ihrer Seele, von einer Lily, die gestorben war. Einen Teil, zu dem sie monatelang keinen Kontakt gehabt hatte, doch das war jetzt vorbei. Jetzt war sie wieder ein Ganzes. Stirnrunzelnd blickte sie über die Schulter zu Rule. »Und ich mag das Halsband.«
»Das Holz sieht wunderbar auf deiner Haut aus, aber bevor du dich entscheidest, sieh dir das mal an.« Sie spürte, wie er ihr leicht mit den Fingern über den Nacken strich, als er ihr etwas Kühles, Metallenes um den Hals legte.
Drei Reihen aus feinen Silber- und Kupferketten fielen in einer zarten Pracht hinunter bis zwischen ihre Brüste. Jede Reihe war mit einem weißen Stein besetzt. Die Kette war hinreißend und ausgefallen und nichts, das sie sich selbst gekauft hätte – nicht nur wegen des zweifellos hohen Preises. Große, schwere Ketten waren nichts für sie. Damit sah sie aus wie ein kleines Mädchen, das Verkleiden spielte.
Aber nicht mit dieser. Diese stand ihr. Einen der weißen Steine berührend, wandte sie sich um und hob das Gesicht, um in Augen von der Farbe von Zartbitterschokolade zu schauen. »Habe ich einen Anlass vergessen?«
»Sag nicht, du hast unser Elf-Monate-und-fünf-Tage-Jubiläum vergessen.«
Das brachte sie zum Lächeln. Sie hob sich auf die Zehenspitzen – er war eigentlich zu groß für sie, doch daran hatte sie sich gewöhnt – und gab ihm einen schnellen Kuss.
Zumindest hatte er schnell sein sollen. Dann aber war da die Haut seiner frisch rasierten Wange. Der saubere Duft seines Haares … Rule benutzte Babyshampoo, weil er keine künstlichen Duftstoffe ertrug. Und das zustimmende Grollen in seiner Brust, das sie genauso spürte wie hörte, als sie ihn mit der Zunge berührte.
»Ich freue mich schon darauf, dich ohne Pulli, BH und Jeans damit zu sehen …«
»Aber vermutlich nicht bei Rubens Barbecue.«
Er lächelte. Die Augen unter den dunklen geraden Brauen bekamen einen schläfrigen Blick. »Vermutlich nicht.«
»Aber es würde das Putzen zu Hause sehr erleichtern.« Das ließ sie an Toby denken, Rules Sohn, der letzten Monat verkündet hatte, fortan in Unterwäsche essen zu wollen, um Flecken auf seinen Kleidern zu vermeiden. Der Gedanke versetzte ihr einen kleinen Stich. »Manchmal hasse ich meine Arbeit.«
»Ich könnte schwören, dass du gerne grillst, ich weiß, du magst Ruben, und da du mit Leib und Seele Cop bist, verstehe ich nicht, was du gerade gegen deine Arbeit einzuwenden hast.«
»Ich wünschte, Toby könnte jetzt bei uns sein, und wir wären wieder zu Hause.«
»Ah. Ich auch.« Dieser Kuss war sanft; ob er als Trost oder als Zustimmung gedacht war, konnte sie nicht sagen. Sie hielten sich umschlungen, genossen den Moment. »Ich vermisse ihn, aber es ist nicht nur deine Arbeit, die uns hier in D.C. festhält. Ich hatte ja ebenfalls eine Einladung bekommen.«
»Bis wir erfuhren, dass ich aussagen muss, hatten wir eigentlich vor, Senator Bixton zu sagen, dass er uns mal kann.«
»Einflussreichen Senatoren würde ich niemals sagen, dass sie mich mal können, das versichere ich dir.« Er strich ihr glättend über das Haar, aber sein Blick flog zu seinem Handgelenk, zu der Armbanduhr, die mehr wert war als Lilys Auto. »Scott hat sich noch nicht gemeldet. Ich frage lieber mal nach, ob …« Er klopfte sich auf die Hosentasche und runzelte die Stirn.
»Dein Handy liegt unten auf dem Esstisch.«
»Danke.« Er ging zur Tür.
»Du wirst doch nicht einer dieser Männer, die ohne Hilfe nicht mal ihre Socken finden, oder?«
Da war es wieder, dieses Grinsen. »Lass dich überraschen.«
Kopfschüttelnd suchte Lily in der Schuhtasche nach den flachen Slippern, die sie letzte Woche im Ausverkauf in San Diego erstanden hatte. Zu Hause.
Dabei war es nicht so, als wäre Washington ihr gänzlich fremd. Seit ihrem Wechsel von der Polizei zum FBI letztes Jahr war sie schon einige Male hier gewesen, einmal sogar mehrere Monate, um eine verkürzte Ausbildung in Quantico zu absolvieren. Auch das Haus kannte sie. Das zweigeschossige Backsteingebäude in Georgetown gehörte Rules und zwei weiteren Clans gemeinsam. Im Laufe der Jahre war Rule hier immer wieder abgestiegen. Er war das öffentliche Gesicht seines Volkes, und in dieser Eigenschaft musste er auch Lobbyarbeit im Kongress betreiben.
Oder sich dumme Fragen von Politikern, die für die Kameras posierten, stellen lassen. So wie vorgestern – er hatte es mit dem ihm eigenen Elan gemeistert. Dass er unglaublich fotogen war, war dabei sicher kein Nachteil, aber PR lag ihm einfach. Deswegen befürchtete er auch, dass sein Erscheinen vor dem Unterausschuss als weiterer Anlass genutzt werden würde, weiterhin über den Gesetzesentwurf zur Bürgerrechtsreform zu debattieren – der seiner Ansicht nach ohnehin nicht mehr in diesem Jahr dem Senat zur Abstimmung vorgelegt würde.
Lilys Aussage war weniger freiwillig und fand vor einem anderen Ausschuss statt, in dem aber auch Senator Bixton saß. Wenigstens würde das Ganze nicht vor den Kameras von C-SPAN stattfinden, denn die Themen, über die sie befragt würde, waren alle streng vertraulich. Ihr Termin war erst am Montag. Bis dahin durfte sie immer noch hoffen, dass Ruben ein Wunder bewirkte und ihr der Auftritt erspart bliebe.
Lily schlüpfte in die Schuhe und ging zur Treppe. Die neue Kette fühlte sich kühl auf der Haut an.
Es war ein hübsches Geschenk, aufmerksam und elegant und schick, und sie war fest entschlossen, sich keine Gedanken darum zu machen, dass er es sich leisten konnte, mehr für sie auszugeben als sie für ihn … obwohl genau dieser Gedanke sie darauf brachte, warum das eigentlich so aufmerksame Geschenk ein Problem für sie darstellte.
In zwei Wochen und drei Tagen hatte Rule Geburtstag.
Oh, sie hatte ein Geschenk für ihn – ein maßgeschneidertes schwarzes Seidenhemd. Lilys Kusine Lyn war Schneiderin und Designerin. Letzten Monat hatte Lily heimlich eines von Rules Lieblingshemden zu Lyn gebracht, um Maß nehmen zu lassen. Das neue Hemd sollte eine dezente Stickerei auf dem Kragen haben: eine stilisierte Darstellung ihres toltoi.
Lupi konnten manchmal fürchterliche Chauvis sein. Für sie stand fest, dass Lily für Rule auserwählt worden war, doch nie kam ihnen der Gedanke, Rule könnte auch für sie auserwählt worden sein. Das aufgestickte toltoi war Lilys Art, darauf hinzuweisen.
Aber nur ein Geschenk, das reichte nicht. Sie brauchte etwas Amüsantes, Lustiges, Süßes. Je beeindruckender, desto besser. Und danach kam die Hochzeit, zwar erst im März, schön und gut, aber sie hatte keine Ahnung, was –
Sie war schon halb die Treppe hinunter, als ein stechender Schmerz an der Schädelbasis sie zwang, stehen zu bleiben. Au. Das war wirklich … vorbei. Sie blinzelte, schüttelte vorsichtig den Kopf und ging weiter. Seltsam, denn jetzt ging es ihr ja wieder gut. Und ein gelegentlicher Kopfschmerz war wohl kaum erwähnenswert. Wer weiß, welche Untersuchungen ein gewissenhafter Arzt mit ihr anstellen würde.
Nachdem sie vier Wochen lang krankgeschrieben gewesen war, hatte Lily die Arbeit jetzt wieder aufgenommen – mit reduzierter Stundenzahl, was ihr gründlich gegen den Strich ging. Abgesehen davon, dass ihr rechter Arm immer noch etwas kraftlos war, war sie absolut fit. Leider nahm ihr das niemand ab, ohne dass sie diese dummen Untersuchungen über sich ergehen ließ, die Fragen aufwerfen würden, auf die sie keine Antworten hatte. Denn über Clanmächte durfte ein Lupus nicht sprechen – niemals und unter keinen Umständen.
Rule war am Telefon in dem überladenen viktorianischen Wohnzimmer, dem Raum, den Lily am wenigsten im ganzen Haus mochte. »… vermutlich sind wir erst spät wieder zu Hause, also … ja, ich sage es ihr, aber da wir ja am Dienstag ohnehin kommen … natürlich. T’eius ven, Walt.« Er legte auf.
»Walt schon wieder.« Sie seufzte. »Ich habe das Telefon gar nicht klingeln gehört.«
»Es hat auch nicht geklingelt. Er rief an, während ich mit Scott sprach. Er bittet dich, ihn zurückzurufen, sobald du Gelegenheit dazu hast. Ich habe versucht, ihm verständlich zu machen, dass du die nicht haben wirst, da wir heute Abend erst spät wieder zu Hause sind, doch er scheint der Ansicht zu sein, dass es nicht bis Dienstag warten kann.«
»Worum geht es denn dieses Mal? Hat er das gesagt?«
»Um irgendwelche Wasserrechte.«
»Sehe ich aus, als würde ich mich mit Wasserrechten auskennen? Walt ist Anwalt, um Himmels willen, auch wenn er nicht mehr praktiziert. Er muss doch zehn Mal mehr als ich über Wasserrechte wissen.«
»Wichtig ist nicht, was du weißt, sondern das, was du in dir trägst.«
Sie seufzte. »Ich weiß.« Aber so hatte sie sich das nicht vorgestellt. Sie hängte sich die Handtasche über die Schulter. »Und wo ist Scott? Und José, wenn wir schon mal dabei sind?«
»Scott steckt im Stau, weil eine Ampel ausgefallen ist. José ist auf dem Dach. Er ist für Mark eingesprungen, der sich heute beim Sparring verletzt hat.«
»Ist es etwas Schlimmes?«
»Am schlimmsten ist wohl sein Stolz verletzt, aber José wollte ihn keine Schicht übernehmen lassen, bevor er nicht ganz wiederhergestellt ist.« Rules Handy piepste. Er warf einen Blick auf das Display. »Scott ist vor dem Haus.«
»Dann lass uns gehen.«
Seit letztem Monat hatte sich viel verändert.
Die beste und seltsamste Veränderung war die Tatsache, dass die Clans sich nicht mehr in den Haaren lagen. Von jetzt auf gleich war aller Streit beendet. Auf einmal misstraute man den Nokolai nicht mehr und war fest entschlossen, nun endlich das Großtreffen der Clans abzuhalten, gegen das sich einige Clans fast ein Jahr lang mit Händen und Füßen gewehrt hatten. Denn schließlich hatte die Dame höchstpersönlich es befohlen, indem sie ihnen durch die Rhejes aufgetragen hatte, sie sollten zusammenkommen, wenn »der Träger der zwei Mächte ruft« – und ihrer Dame widersprachen die Lupi nicht. Niemals. Doch aufgrund der Logistik und der Kosten, die damit verbunden waren, die Lupi aus aller Welt an einem Ort zusammenzubringen, konnte das Ganze nicht einfach über Nacht durchgeführt werden.
Die Lupi aus aller Welt … dieser Gedanke machte Lily zunehmend Kopfzerbrechen. War es nicht, als würden sie mit diesem Großtreffen ihren Feinden eine Einladung aussprechen, der diese kaum widerstehen konnten? »Hier sind wir – kommt und schlachtet uns ab.« Noch letztes Jahr, nachdem sie Harlow und der Azá das Handwerk gelegt hatten, wäre ein Großtreffen nicht so risikoreich gewesen. Damals hatte ihre Erzfeindin keine Handlanger gehabt, die jederzeit zuschlagen konnten. Doch jetzt … jetzt gab es Friar und Humans First.
Zwar konnte davon ausgegangen werden, dass Friar tot war, doch Lily glaubte nicht daran. Und selbst wenn sie sich irrte, war die von ihm gegründete Organisation weiterhin aktiv und gewann immer mehr an Einfluss. Nach Friars Tod – der laut Humans First eines Märtyrertodes durch dunkle Magie gestorben war – war die Anzahl der Mitglieder in die Höhe geschnellt. Dass er selbst sich der dunklen Magie bedient hatte, deren Opfer er geworden war, war, so wurde behauptet, eine Regierungslüge. Die meisten dieser Mitglieder würden sich zwar kaum mit der Waffe in der Hand auf Werwolfjagd begeben, aber es gab unter ihnen auch ein paar ganz schön Hartgesottene.
Als sie Rule von ihren Befürchtungen erzählt hatte, hatte er ihr zugestimmt … und dann gesagt, das Großtreffen müsse unter allen Umständen stattfinden. So stand es in der Überlieferung. Aus irgendeinem Grund, den die Dame vor dreitausend Jahren genannt hatte, musste das Großtreffen genau jetzt abgehalten werden.
Das verstand Lily nicht.
Andere Veränderungen waren weniger verwirrend, dafür umso ärgerlicher. In zwei Wochen würde ein Handwerkerteam des Leidolf-Clans kommen, um den Keller des Reihenhauses fertigzustellen, denn Rule wollte, dass ihre Wachen, mittlerweile zehn an der Zahl, nicht im Hotel schliefen, sondern bei ihnen im Haus. Die frei stehende Garage im Hinterhof hatte er mit einer Alarmanlage ausstatten lassen, damit Lily dort ihren Dienstwagen, einen Ford, parken konnte. Wenn sie das nicht wollte, gut – er würde ihr nicht vorschreiben, was sie zu tun hatte. Aber dann bliebe die Garage leer, denn er würde sie nicht nutzen. Für die Wagen, die er seinen Wachen zur Verfügung stellte, hatte er Plätze in einer Garage ein paar Häuserblocks entfernt gemietet. Wenn Rule seinen Wagen brauchte, schickte er einen der Wächter, um ihn zu holen. Da sie alle Lupi waren, rochen sie es, falls sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte.
Diese strengen Sicherheitsmaßnahmen waren so notwendig wie lästig. Doch nun stand Lilys Wagen in der Garage und Rules Mercedes nicht, weswegen sie das Haus durch die Vordertür verließen, unter den wachsamen Augen von José, der versteckt auf dem Dach Wache stand. In dem kleinen Garten hinter dem Haus, das wusste sie, patrouillierte Craig auf vier Pfoten.
Einer auf dem Dach, der die Straße überwachte. Einer auf der Erde, auf der Hinterseite des Hauses. Einer bei Rule. Leidolf und Nokolai abwechselnd. Zuerst waren sie nach Clans zu unterschiedlichen Schichten eingeteilt worden, doch das hatte Rule kürzlich geändert. Sie mussten als Team funktionieren, hatte er gesagt … was ja auch richtig war, doch Lily hätte erwartet, dass es Probleme gab, zumindest zu Beginn.
Als sie Rule daraufhin ansprach, hatte er die Augenbrauen hochgezogen. »Vielleicht vor einem Monat. Ein Krieg ändert vieles.« Er hatte recht behalten. Die Wächter der Leidolf und der Nokolai arbeiteten so reibungslos zusammen, als wären ihre Clans nicht einige hundert Jahre lang verfeindet gewesen.
»Wie sah dein Geist denn aus?«, fragte Rule, während sie die Tür hinter ihnen abschloss. Er stand mit dem Rücken zu ihr und ließ den Blick über die Straße schweifen.
»Es war nicht mein Geist.« Sie ließ die Schlüssel in ihre Handtasche fallen und begab sich zu dem Wagen, der in zweiter Reihe vor dem Haus geparkt war.
»Dann eben der Geist, der nicht deiner ist.«
»Eins achtundsiebzig groß, achtzig Kilo … wenn er einen echten Körper gehabt hätte und nicht einen aus Ektoplasma. Keine besonderen Kennzeichen. Kein Gesicht.«
Rules Brauen hoben sich. Er öffnete ihr die Wagentür. Das tat er gern. »Ein gesichtsloses Phantom?«
Sie lächelte. »Ja, tatsächlich.« Sie kletterte ins Auto und rutschte weiter.
Er folgte ihr. Scott ließ die Verriegelung einrasten.
Das war das, wusste sie, was Rule an den verschärften Sicherheitsmaßnahmen am wenigsten mochte: Er saß lieber selbst am Steuer. Doch andererseits wollte er die Hände frei haben, um im Fall eines Angriffs schnell reagieren zu können, deshalb hatte er jetzt einen Fahrer. Und Lily, die dieser Überwachung so gut wie nichts Gutes abgewinnen konnte, gab sich alle Mühe, sich damit zu arrangieren. Doch der Mangel an Privatsphäre machte ihr zu schaffen.
Sie begrüßte Scott und legte den Sicherheitsgurt an.
»Verheiratet, nehme ich an.«
»Ja, bald«, sagte er und nahm ihre Hand. »Nur noch fünf Monate.«
»Und ich hyperventiliere nicht einmal.« Rule zu heiraten, das war leicht. Die Hochzeit selbst war eine andere Geschichte, doch sie hatte schon eine To-do-Liste aufgestellt. Mehrere. »Aber ich meinte, dass der Geist verheiratet war, bis die ›Bis dass der Tod euch scheidet‹-Klausel in Kraft trat. Er oder sie trug einen Ring an der linken Hand.«
»Du hast einen Ring gesehen? Kein Gesicht, aber einen Ehering?«
»Als es nach mir griff, waren die Hände deutlicher zu sehen. Es war, als würde der Ring leuchten.« Sie überlegte. »Ich sollte wohl eher ›er‹ sagen, nicht ›es‹. Die Hände sahen aus wie die eines Mannes. Nicht jung, nicht alt, kein Handwerker.« Nein, es waren weiche Hände gewesen, daran erinnerte sie sich. Sauber und gepflegt. Schmale Hände, lange Finger, ordentlich gefeilte Nägel.
»Es wollte dich anfassen?« Rule klang besorgt.
»Dann löste es sich einfach auf.« Sie drückte seine Hand. »Entspann dich. Es – oder er – schien mir nicht feindlich gesonnen zu sein. Und selbst wenn er wütend gewesen wäre und in der Lage, mit etwas Körperlichem einzugreifen, was hätte er schon ausrichten können? Einen Stift nach mir werfen?«
»Ich erinnere mich an einen Widergänger, der ziemlich viel ausrichten konnte.«
»Den Widergänger konnte ich nicht sehen. Das hier aber schon, deshalb ist es unwahrscheinlich, dass es sich um einen Widergänger handelt.« Und noch aus anderen Gründen, die mit der Art zu tun hatten, wie Widergänger erschaffen wurden.
»Hmm.«
Rule stellte die eigentlich naheliegenden Fragen nicht. Er wusste, dass das, was sie gesehen hatte, kein Lichteffekt und keine Sinnestäuschung gewesen war. Und eine Illusion war ebenfalls ausgeschlossen. Lily war eine Berührungssensitive und damit in der Lage, Magie zu ertasten, doch sie konnte sie nicht einsetzen und war zudem immun gegen sie. Was immer sie gesehen hatte, es war real gewesen.
Scott setzte den Blinker. Lily tat so, als könnte er nicht alles hören, was sie sagten. Rule gelang das besser als ihr. Ihr Publikum auf dem Fahrersitz komplett ignorierend, spielte er mit ihren Fingern. Insbesondere mit dem, an dem sein Ring steckte. Für einen Mann, der jahrzehntelang moralische Vorbehalte gegen die Ehe und jegliche Form sexuellen Besitzanspruchs gehabt hatte, war er auffällig fasziniert von dem glänzenden Zeichen ihrer Zugehörigkeit.
Vielleicht hätte sie ihm auch einen Verlobungsring schenken sollen.
»Was ist denn so komisch?«, fragte er.
»Ich habe mir gerade deine Hand mit einem Diamanten am Ringfinger vorgestellt.«
Er blinzelte. Erstarrte. Und nickte dann. »Das ist eine gute Idee. Ich frage mich, warum ich nicht auch auf die Idee gekommen bin, einen Verlobungsring zu tragen.«
Er machte keinen Scherz. Es war ihm wirklich ernst. Sie beugte sich vor zu ihm und küsste ihn sanft. »Ich liebe dich.«
»Das höre ich gern.« Er ließ ihre Hand los und strich ihr mit gespreizten Fingern durchs Haar. »Sollen wir ihn gemeinsam aussuchen?«
»Den Verlobungsring, meinst du?«
»Vielleicht müssen wir extra einen anfertigen lassen.«
»Ähm … ja, vielleicht.« Es sei denn … »In San Francisco werden wir vielleicht eher fündig. Oder in Massachusetts.« Kauften Schwule sich gegenseitig Verlobungsringe? Warum wusste sie das nicht? Das einzige XY-Paar, das sie kannte, war den Bund in aller Eile eingegangen, aus Angst, die offizielle Genehmigung könnte zurückgezogen werden. Und sie hatten recht daran getan.
Rule lächelte, weil er sofort wusste, woran sie dachte. »Ich könnte Jasper fragen.«
»Jasper?«
»Den guten Freund deines Cousins Freddie. Sie sind vor Kurzem zusammengezogen.«
»Oh, diesen Jasper meinst du.« Lilys Cousin Freddie – wenngleich nur ein Cousin dritten Grades – hatte letzten Monat angefangen, für Rule zu arbeiten. Er kümmerte sich um einige der Investitionen des Leidolf-Clans und entlastete Rule dadurch sehr. Lily stand der Sache mit gemischten Gefühlen gegenüber. Freddie war zwar stets und immer ehrlich und kompetent – zumindest fand das Lilys Vater, und der musste es wissen. Aber über die Jahre hatte sie eine Aversion gegen ihn entwickelt, weil er sich durch nichts davon abbringen ließ, dass sie ihn eines Tages heiraten werde. »Ich habe Jasper nur zwei Mal getroffen. Ich wusste gar nicht, dass er –« Sie richtete sich auf. »Moment mal. Willst du damit etwa sagen, dass Freddie –«
»Das wusstest du nicht?«
»Freddie ist schwul?«, rief sie mit vor Empörung lauter Stimme. »Er hat mich ein Dutzend Mal gefragt, ob ich seine Frau werden will. Nicht, weil er wollte, wohlgemerkt, sondern weil seine Mutter es wollte … und meine. Und du erzählst mir, dass er schwul ist?«
Rule zuckte die Achseln. »Definier es, wie du willst. Er und Jasper –«
»Nur weil Jasper schwul ist, muss Freddie es nicht auch sein.« Denn wenn Freddie ihr einen Antrag nach dem anderen gemacht hätte, ohne auch nur einmal zu erwähnen, dass er Bananen mehr liebte als Pflaumen, hätte sie nun erst recht guten Grund sauer zu sein. »Das kannst du nicht mit Sicherheit wissen.«
»Wenn jemand mich attraktiv findet, merke ich das. Freddie ist vielleicht eher bi als schwul, aber ich bin sicher, dass er sich körperlich zu mir hingezogen fühlt.«
Weil er es roch. Das meinte er. Sie wusste, dass er weibliche Erregung riechen konnte. Dass es bei Männern nicht anders war, darüber hatte sie nie nachgedacht. »Ist das ein Problem für dich? Zu wissen, dass ein Mann bei deinem Anblick erregt wird?«
»Warum? Ich habe nie verstanden, warum menschliche Männer nervös oder gereizt darauf reagieren. Wie kann man sich daran stören, wenn man attraktiv gefunden wird, auch wenn man nicht in der Lage ist, das Kompliment zu erwidern?«
»Hierarchie.« Lily hatte ganz spontan geantwortet. Jetzt hielt sie inne, um nachzudenken, und fand, dass sie richtig damit lag. »Das ist zum Teil der Grund. Vielleicht zum großen Teil. Seit Jahrhunderten standen heterosexuelle Männer – insbesondere weiße heterosexuelle Männer hier im Westen – ganz oben in der Hackordnung. Von einem anderen Mann angebaggert zu werden, ist wie eine Beleidigung, denn das bedeutet, dass jemand deine Fähigkeiten als Platzhirsch anzweifelt.«
»Ah. Du bist klug. Ja, das stimmt. Welche privilegierte Gruppe gibt schon gerne ihren Status auf? Das würde den hysterischen Ton erklären, den manche Gruppierungen anschlagen, die gegen die Schwulenehe sind.«
Sie schnaubte. »Angst und Bigotterie brauchen keine Erklärungen. Es gibt sie einfach, so wie Verkehrsstaus und Steuern.«
»So kann man es auch sehen.« Er wickelte sich die Haarsträhne, mit der er gespielt hatte, um den Finger. »Wirst du deinem Cousin vergeben?«
»Irgendwann. Aber zuerst droht ihm eine Tracht Prügel.«
»Aber nicht zu fest. Er kümmert sich gut um die Finanzen der Leidolfs.«
»Ich werde daran denken. Du hast in letzter Zeit zu oft bis spät in die Nacht gearbeitet. Wenn die Nokolai nicht …« Sie brach ab, als er Scotts Hinterkopf einen vielsagenden Blick zuwarf. »Richtig.« Zwei Clanmächte, zwei Clans, zwei Wachmannschaften. Scott war ein Leidolf. Und vor einem Leidolf besprach man keine Angelegenheiten, die den Nokolai-Clan betrafen, auch wenn die beiden Mannschaften gut harmonierten.
Rule gab ihre Haarlocke frei. »Was diesen Geist betrifft, der nicht deiner ist – was hast du getan, nachdem er sich aufgelöst hat?«
»Natürlich gefragt, ob noch jemand ihn gesehen hat.«
Das amüsierte ihn. »Auf einem Schießstand für FBI-Agenten.«
»Ich musste es wissen, oder nicht? Außerdem weiß dort jeder, dass ich bei den Paranormalen arbeite.«
»Und hat ihn jemand gesehen?«
»Nein.« Was einige Fragen aufwarf.
3
Lily war immer froh, wenn sie im Oktober nach Washington musste. Im Sommer war es in D.C. glühend heiß und im Winter viel zu kalt, doch der Oktober war schön. Fast so schön wie in San Diego, wenngleich das Wetter nicht so beständig war. Außerdem war D.C. zugestandenermaßen viel grüner. Bei ihrem letzten Aufenthalt in der Hauptstadt war Lily endlich schwach geworden und hatte sich ein Paar Gummistiefel gekauft.
Nicht, dass sie sie heute für die Party brauchen würde. Einem Präkog durfte man wohl zutrauen, dass er sich ein Wochenende mit perfektem Wetter aussuchte.
Ruben Brooks, der Leiter der Einheit 12 der Magical Crimes Division des FBI, der Abteilung für magische Verbrechen, hatte nicht nur einfach eine Gabe. Seine seherischen Fähigkeiten waren erstaunlich. Er wohnte in Bethesda, einer Gegend, die sich kein Angestellter des FBI, egal wie hochgestellt er sein mochte, leisten konnte. Doch die Familie seiner Frau hatte Geld. Altes Geld, nicht moderne dicke Kohle, die Art von Reichtum, die von der Zeit wie Flusssteine zu Treuhänderfonds und Erbschaften glatt gespült wurde. Und das Haus der Brooks in Bethesda war ein Hochzeitsgeschenk ihrer Eltern gewesen.
Es hatte mehr Zimmer als die meisten Häuser, die Lily kannte, und war vollgestellt mit Antiquitäten, und doch wirkte es nicht protzig, sondern gemütlich. Das Grundstück und die Lage – beides trieb den Preis in astronomische Höhen. Bethesda war eben eine teure Gegend. Das Haus aus Stein und Holz, von dem aus es nur eine kurze U-Bahnfahrt bis ins Stadtzentrum war, stand auf drei Morgen Land und war umgeben von alten Bäumen. Die Anlage um das Haus war wunderschön – üppig und ideenreich gestaltet.
Eine Grillparty? Vielleicht, aber nicht in einer Umgebung, wie Lily sie gewohnt war.
Hier gab es sogar genug Platz für ein spontanes Softballspiel, um sich die Wartezeit bis zum Essen zu vertreiben. Als die Dämmerung sich herabsenkte, ließen sie sich an langen Gartentischen nieder, die auf dem Rasen aufgestellt waren. Die Gäste waren bunt gemischt: Agenten der Einheit mit ihren Lebens- und Ehepartnern oder Dates, normale FBIler und auch zahlreiche Gäste, die nichts mit dem FBI zu tun hatten. Ein paar der Ehepartner und Dates kannte Lily schon – wie zum Beispiel Margarita Karonski – ein Name wie ein Zungenbrecher. Karonskis Frau war ungefähr vierzig, hatte große Brüste, ein lautes Lachen, glänzendes schwarzes Haar und ein Diplom im Fach Elektrotechnik.
Alles war sehr auf Gleichheit bedacht. Lily aß Rippchen und Kartoffelsalat zusammen mit Rule, einer Lehrerin, einem anderen Agenten der Einheit, dem Leiter eines kleinen Priesterseminars, Rubens Sekretärin und dem Direktor des Statistischen Amtes.
Der Direktor und die Lehrerin waren, wie sich herausstellte, interessante Menschen, auch wenn sie sich bei einigen wichtigen Themen die Köpfe heiß redeten. Wie zum Beispiel Baseball. Nach dem Dessert blieben sie und die beiden am Tisch sitzen und debattierten weiter über Videobeweise.
»Lily Yu!«, brüllte jemand hinter ihr. »Es ist schon viel zu lange her!«
Lily drehte sich um. Ein Mann mit Einstein-Frisur, Benjamin- Franklin-Brille und arglosen braunen Augen in einem Nest aus Falten unter buschigen Brauen strahlte sie an. Er trug sackartige Shorts und Birkenstockschuhe. Und das nicht zu übersehende Bäuchlein bedeckte ein Hawaiihemd. »Dr. Fagin!«
»Fagin, meine Liebe, nur Fagin, es sei denn, Sie wollen es wie Sherry machen und mich Xavier nennen. Sonst stehe ich doch da wie ein herablassender Wichtigtuer, wenn ich Sie Lily nenne.«
Sie lächelte, schwang die Beine über die Bank und stand auf. »Annette und Carl«, wandte sie sich an ihre Tischnachbarn, »kennen Sie Dr. Xavier Fagin? Er arbeitet manchmal als Berater, ist aber eigentlich in Harvard –«
»Ich bin jetzt im Ruhestand. Letzten Monat bin ich nach D.C. gezogen.«
»Das wusste ich gar nicht. Es muss eine große Veränderung für Sie sein.«
»Leben heißt Veränderung.« Dazu lächelte er das freundlich unbestimmte Lächeln eines kauzigen alten Professors. Es war seine Art, weitere Nachfragen im Keim zu ersticken.
Lily verstand den Wink und ließ das Thema fallen. »Fagin, das sind Annette Broderick und Carl Rogers.«
»Annette kenne ich bereits. Erfreut, Sie wiederzusehen, meine Liebe.« Fagin wandte das freundliche Lächeln dem Direktor des Statistischen Amtes zu. »Und Sie sind Carl? Schön, Sie kennenzulernen. Ich fürchte, ich muss so unhöflich sein, Ihnen Lily zu entführen. In einer Forschungsangelegenheit.«
Lily musste lachen. »Forschung, ach so –«
»Sagen wir, es geht um ein Forschungsprojekt persönlicher Art. Es fällt mir schwer, Lily, dem Drang zu widerstehen, Sie einfach beim Arm zu nehmen und sanft wegzuziehen. Männer in meinem Alter kommen gewöhnlich mit einem solchen Benehmen straflos davon. Das ist eine der wenigen Annehmlichkeiten des Älterwerdens. Aber in Ihrem Fall –«
»Wäre das keine gute Idee.«
Dr. Xavier Fagin – ein B.A., M.A., MFA, Ph.D. und obendrein noch DDT, LOL und RAM, wer weiß, was noch? – war einer der führenden Experten für magische Geschichte in der Zeit vor der Säuberung. Er hatte den von der Präsidentin einberufenen Arbeitskreis geleitet, der sich mit den Folgen der Wende befasste. Dort hatte Lily seine Bekanntschaft gemacht. Zudem war er der einzige andere Berührungssensitive, den sie kannte. Dass es da besser war, wenn sie sich nicht die Hand schüttelten, hatten sie am eigenen Leib erfahren müssen.
»Ja, leider. Also muss ich auf Ihre Neugier setzen, um Sie wegzulocken, statt auf Ihre Nachsicht mit den Absonderlichkeiten eines alten Mannes. Ich habe gehört, Sie haben einen Geist gesehen?«
Sofort wollte Carl alles darüber wissen. Annette sagte, dass ihre Cousine Sondra eine leichte mediale Gabe habe und deshalb manchmal Geister sehe. Dass Lily ebenfalls diese Gabe besitze, habe sie gar nicht gewusst.
»Das ist ja auch nicht der Fall«, sagte Lily. »Deswegen ist die Sache ja so verwirrend.«
»Und deswegen«, sagte Fagin zu den anderen beiden, »möchte ich Lily ein oder zwei schrecklich persönliche Fragen stellen, die sie zweifellos nicht beantworten will, aber ich glaube, wenn ich sie zwei Minuten für mich habe, kann ich sie vielleicht zu einer Antwort bewegen.«
Nun war Lily doch neugierig geworden. Sie und Dr. Fagin schlenderten zu den Wannen, in denen Bier und Limonade auf der Terrasse kalt gehalten wurden. »Sie haben mit Rule gesprochen.«
»So ist es. Außerdem sammle ich Informationen und Berichte von Menschen, die keine Medien sind, die Geister gesehen haben oder angeben, sie gesehen zu haben.«
Ihre Augenbrauen wanderten höher. »Dann geht es also tatsächlich um ein Forschungsprojekt.«
Er winkte ab. »Aus rein persönlichem Interesse. Ich bezweifle, dass ich es je veröffentlichen werde. Zu viele der Berichte sind rein anekdotisch.«
»Und warum haben Sie ein persönliches Interesse an der Frage, wer Geister sieht?«
Er stieß einen langen Seufzer aus. »Ich nehme an, es ist nur fair, dass ich darauf antworte, wenn ich Sie nachher bitte, meine indiskreten Fragen zu beantworten. Vor fünfzehn Jahren habe ich den Geist meiner Mutter gesehen.«
»Oh.« Sie waren bei den Getränkewannen angekommen. Lily nahm sich eine Dose Diätcola und zog den Verschluss auf. »Da Sie kein Medium sind, muss es wohl die enge emotionale Bindung gewesen sein. Ich habe gehört, das gibt es manchmal.«
»Sie war nicht tot.«
Die Dose verharrte kurz auf halbem Wege zu Lilys Lippen. Erst dann nahm sie einen Schluck. »Dann könnte es … ich weiß nicht … eine Astralreise gewesen sein? Hatte sie eine Gabe?«
»Nein. Ich sah ihren Geist um fünf Minuten nach Mitternacht – eine ausgesprochen passende Zeit, nicht wahr? – und sie starb um zwölf Uhr neunundvierzig.«
Das verlieh der Geschichte eine unerwartete Wendung.
»Interessant ist auch«, fuhr er fort, »dass sie Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium hatte. Sie lebte zu diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren in einem Pflegeheim in Cambridge und hatte seit einem Jahr nicht mehr gesprochen. In dieser Nacht hielt ich mich hier in Washington auf, um mich mit einem, ähm, Mitglied der Regierung zu treffen, und schlief tief und fest in meinem Hotelzimmer. Plötzlich wachte ich auf und hatte das Gefühl, dass sich jemand über mich beugte … und da war sie. Sie trug ein blassblaues Nachthemd und einen Bademantel, wie damals, als ich noch klein war, und sie roch nach White Shoulders. Mein Vater schenkte ihr jedes Jahr zu Weihnachten White Shoulders, und sie trug den Duft jeden Tag bis zu seinem Tod. Danach nie wieder. Ihr Haar war braun und gelockt. Und die Brille, die sie die letzten vierzig Jahre ihres Lebens getragen hatte, war weg. So wie auch alle anderen Zeichen des Alterns… Sie deckte mich zu«, endete er schlicht. »Gab mir einen Kuss, lächelte, und dann war sie fort. Als ich mich umsah, fiel mein Blick auf den Wecker, dessen Anzeige in diesem Moment auf zwölf Uhr sechs wechselte.«
»Meine Güte.«
»Der Duft von White Shoulders war noch ein paar Minuten danach zu riechen.«
»Das ist ja unglaublich. Das war bestimmt …« Lily schüttelte den Kopf. Ihr fiel kein anderes Wort als »überwältigend« ein, um eine solche Erfahrung zu beschreiben. »Hat sie Sie tatsächlich zugedeckt? Ich meine, hat sich die Decke wirklich bewegt? Haben Sie den Kuss gespürt?«
»Beides Mal: nein. Ihre Handlungen hatten keine Wirkung auf die stoffliche Welt.«
»Aber Sie haben ihren Lieblingsduft gerochen.« Duft war stofflich, aber auch die Erinnerung an einen Duft konnte im Gehirn ausgelöst werden. Das war also kein Beweis, dass sie tatsächlich körperlich anwesend gewesen war. »Sie erwähnten die Farbe ihres Haars und ihres Nachthemdes. Sah sie aus, als wäre sie fest?«
»Fast.« Sein Ton wurde träumerisch. »Sie war ungewöhnlich klar und deutlich zu sehen, aber nicht ganz fest, nein. Ich wusste sofort, dass sie ein Geist war.«
»Und Sie sind sich sicher, was die Uhrzeit betrifft?«
»Wie ich schon sagte, ich sah, dass die Anzeige umsprang. Sobald sie verschwunden war, rief ich das Pflegeheim an und bat darum, nach ihr zu sehen. Man stellte fest, dass sie unter Atemnot litt, aber nach den Werten, anhand derer wir Leben feststellen, noch am Leben war. Von da an kümmerte sich medizinisches Fachpersonal um sie. Um zwölf Uhr neunundvierzig setzten Herz und Atmung aus.«
»Ein Geist, der vor dem Tod erscheint. Das habe ich noch nie gehört.« Sie überlegte. »Ist ein solcher Besucher wirklich ein Geist? Eine Bekannte, die ein hochbegabtes Medium ist, würde wohl sagen: Das hängt davon ab, wie wir den Begriff Geist definieren.«
»Ganz genau.« Er lächelte – wie der kleine Junge, der er gewesen war, damals, als eine Frau im blassblauen Nachthemd ihn jeden Abend zugedeckt hatte. »Damals begann ich mit meinem kleinen Hobby, Geistergeschichten zu sammeln. Zuerst war ich nach denen auf der Suche, die meiner eigenen ähnelten – und fand auch ein paar –, dann aber fing ich an, mich für die Frage zu interessieren, wie und warum Menschen ohne mediale Gabe Geister sehen. Sie tragen Achat.«
Sie blinzelte. »Ach ja?«
»Ihre Halskette. Die weißen Steine sind Achate. Haben Sie sie auch getragen, als Sie Ihren Geist gesehen haben?«
»Es ist nicht mein Geist.« Lily war es leid, das immer wieder zu hören. »Und nein, habe ich nicht.«
»Haben Sie sie angelegt, um sich vor dem Geist zu schützen?«
»Ich habe sie angelegt, weil Rule sie mir geschenkt hat. Heute Abend. Kurz bevor wir herkamen.«
Er schmunzelte. »Vielleicht verwechsle ich Ursache mit Zufall. Weißer Achat soll Träume und die Konzentration fördern. Aufgrund seiner Verbindung mit dem Kronenchakra glauben viele, dass er die spirituelle Kommunikation verbessert. Wieder andere tragen ihn als Schutz vor böswilligen oder verwirrten Wesen. Mit anderen Worten: Geistern.«
»Oh. Nun, wenn Rule nicht plötzlich eine präkognitive Gabe wie Rubens entwickelt hat, ist es reiner Zufall, dass ich die Kette heute Abend trage. Sie sagten, Sie hätten eine Theorie.«
»Und indiskrete persönliche Fragen. Diese hier ist allerdings nicht indiskret. Würden Sie mir bitte von dem Geist, den Sie gesehen haben, erzählen?«
Lily beschrieb ihn mit knappen Worten. »… Sie sehen, es war keine Erfahrung wie Ihre. Nebelartig, farblos, nur eine Gestalt, und soweit ich weiß, habe ich keine persönliche Verbindung zu dem Verstorbenen.«
»Hmmm. Sind Sie schon einmal gestorben?«
»Ich …« Ein paar Herzschläge lang wusste Lily nicht, was sie sagen sollte. Die Geschichte, die einem »Ja« folgen musste, war kompliziert und nicht für andere Ohren bestimmt, denn darin kam auch die Öffnung eines Höllentors vor. »Das ist keine Frage, die ich jeden Tag gestellt bekomme. Ich neige dazu, sie mit Ja zu beantworten, kann Ihnen aber keine Einzelheiten berichten.«
»Ausgezeichnet.« Er strahlte. »Die Geistersichtungen, die ich zusammengetragen habe, können in drei Kategorien aufgeteilt werden. In der ersten besteht eine enge Verbindung zwischen der Person und dem Geist. In der zweiten scheint der Geist selbst die Fähigkeit erworben zu haben, sich sichtbar zu machen. Aus irgendeinem Grund«, fügte er hinzu, »kommt das besonders häufig in England vor. Die dritte Kategorie jedoch besteht aus Menschen, die das erlebt haben, was man gemeinhin eine Nahtoderfahrung nennt.«
Lily nahm noch einen Schluck Diätcola. Sie fühlte sich unbehaglich und war zugleich fasziniert. »Ich habe guten Grund anzunehmen, dass meine, äh, meine Nahtoderfahrung …« Sie schüttelte den Kopf. »Nah« war das falsche Wort. Denn ein Teil von ihr war tatsächlich gestorben, doch dieser Teil war zu dieser Zeit von ihr körperlich getrennt gewesen. »Meine eigene Erfahrung hat mich dem Spirituellen geöffnet, könnte man sagen –«
»Fagin, lassen Sie doch die arme Lily … Oh, Pardon.« Deborah Brooks zog eine drollige Grimasse. »Ich habe Sie unterbrochen.«
»Von einer schönen Frau lasse ich mich immer gern unterbrechen.«
Und das war Deborah. Ihre Schönheit war eine klassisch englische, mit Haut wie Milch und weichem braunem Haar, das ihr gerade über die Schultern reichte. Große Augen, lange dichte Wimpern, ein herzförmiges Gesicht mit absolut symmetrischen Zügen. Männer würden sich nicht auf der Straße nach ihr umdrehen, nein, sie würden eilig nach einer Pfütze Ausschau halten, um ihren Umhang darüberzubreiten. Obschon sie sich aus Mangel an Umhängen in diesen Zeiten vermutlich damit begnügen mussten, ein T-Shirt zu benutzen, damit sie trockenen Fußes darüber gelangte.
Das absolut symmetrische Gesicht setzte ein zurückhaltendes Lächeln auf. »Danke.«
»Deborah!« Fagin stürzte sich auf sie wie ein freundlicher Bär, packte sie bei den Schultern und gab ihr einen lauten Kuss auf die Lippen. »Tun Sie das nicht!«
Deborah gab ein erschrockenes Lachen von sich. »Sie sind unmöglich!«
»Nein, nur verrückt. Ihre Mutter ist heute Abend nicht hier. Sie können das Kompliment annehmen, mich schlagen – aber nicht ins Gesicht, bitte! –, mir sagen: ›Ja, ich weiß‹, oder: ›Verziehen Sie sich endlich‹, oder aber mich bitten, mit Ihnen in die Karibik zu fliegen, um dort ein paar heiße Tage und wilde Nächte zu –«
Deborah lachte. »Oh, hören Sie auf. Für Letzteres bin ich zu beschäftigt; zu gehemmt, um jemandem zu sagen, dass er sich verziehen soll, und ich kann Ihnen ganz unmöglich zustimmen!«
»Mir ist nicht entgangen, dass Sie die Option mich zu schlagen, nicht ausgeschlossen haben.« Er tätschelte ihren Arm. »Braves Mädchen. Lily, ich überlasse Sie vorerst unserer Gastgeberin, behalte mir aber das Recht vor, Sie später noch einmal zu belästigen.«
»Danke für die Vorwarnung.«
Fagin schlenderte davon. Immer noch lächelnd, drehte sich Deborah zu Lily um. »Eigentlich wurde ich geschickt, um Sie zu holen. Rule möchte Ihnen gern jemanden vorstellen.«
Ganz automatisch warf Lily einen Blick zu dem fünfzehn Meter entfernten Swimmingpool hinüber. Damit verriet sie sich, auch wenn Deborah ihre Reaktion sicher nicht zu deuten wusste. Dass Lily stets wusste, wo Rule gerade war, war eine der praktischeren Eigenschaften des Bandes der Gefährten. Im Moment sprach Rule mit zwei Männern – der eine war groß und dunkelhäutig in Kakihose und gelbem Polohemd, der andere klein, schlank und dunkelhaarig mit einem kurzen Schnurrbart. Er trug Jeans, ein weißes Hemd und eine Sportjacke. Lily war sich ziemlich sicher, dass er beim Softball-Spiel noch nicht dabei gewesen war.
Es sah Rule gar nicht ähnlich, jemanden nach ihr zu »schicken«. Musste er etwa wieder einmal seinen Status herauskehren? »Croft kenne ich, also muss es der in der Sportjacke sein.«
»Dennis Parrott. Er ist Senator Bixtons Stabschef.«
Lily verzog das Gesicht.
»Ich weiß«, sagte Deborah mitfühlend, »aber es kann von Vorteil sein, wenn man seine Feinde auch privat kennt.«
Überrascht sah Lily sie an. »Sie sehen Dennis Parrott als Feind?«
Die weiche, blasse Haut färbte sich rosa. »Das hätte ich nicht sagen sollen.«
»Warum nicht?«
Deborah spitzte die Lippen. »Ich weiß nicht, aber es ist so. Fagin hat ein Talent, mich aus der Reserve zu locken, und dann kann mir immer etwas Unbedachtes entschlüpfen. Machen Sie sich keine Gedanken. Es stimmt, Rule möchte Ihnen Mr Parrott vorstellen, aber ich hatte noch einen anderen Grund, Sie zu sehen.« Sie holte Luft, als wollte sie einen Kopfsprung aus großer Höhe machen. »Ich wollte mich entschuldigen.«
»Entschuldigung angenommen, aber wofür entschuldigen Sie sich?«
»Für mein Benehmen, als wir uns kennenlernten. Ich …« Wieder wurden ihre Wangen rosig. »Ich wollte Ihnen nicht die Hand geben. Nicht mit Ihnen sprechen. Ich habe Ihnen nur zugenickt und bin weggelaufen. Sie müssen gedacht haben, ich wollte Sie brüskieren.«
Ja, genau das hatte sie gedacht.
»Es tut mir leid.« Deborah streckte ihr die Hand hin.
Lily ergriff sie und lächelte über das, was die Berührung ihr verriet. Und vor Erleichterung. Ruben hatte keine hochnäsige Zicke verdient. »Sie haben mich nicht brüskiert. Sie waren nur schüchtern.« Nicht nur misstrauisch oder sich selbst schützend – was beides erlernte Verhaltensweisen waren. Schüchternheit dagegen war angeboren.
»Der moderne Fachterminus lautet soziale Phobie, aber mir gefällt der alte Begriff besser. Ja, ich bin schüchtern.«
»Das ist sicher nicht einfach, wenn man Lehrerin ist.«
Ein plötzliches Lächeln erhellte ihr Gesicht. »Vor einer Klasse zu stehen, ist anders. Es hat mir sogar geholfen, mich ein wenig zu überwinden. Mittlerweile komme ich ganz gut klar, aber dann und wann kommt es einfach über mich, wie bei Ihnen. Dann quäle ich mich mit Vorwürfen, wie dumm oder kalt oder unfreundlich ich gewirkt haben muss. Schüchternheit ist eigentlich sehr selbstsüchtig, sehr nach innen gerichtet.«
»Das ist Trauer auch, aber wir werfen es niemandem vor, wenn er trauert.«
Deborah blinzelte. »Ich mag Sie«, sagte sie, als würde sie die Erkenntnis überraschen. Sie legte den Kopf schräg. »Als wir uns die Hände gaben, hatte ich eigentlich erwartet, dass Sie etwas zu meiner … nun ja, meiner kleinen Gabe sagen würden.«
»Ich spreche nicht über das, was ich bei einer Berührung empfinde, es sei denn, es gibt gute Gründe dafür. Manche Menschen mögen es nicht, dass andere etwas über ihre Gabe erfahren.« Erdmagie fühlte sich für Lily warm an, warm und sandig und langsam. Eine stark ausgeprägte Erdgabe war auch schwer, so als würden Erdreich und Gestein von unten gegen die sandige Oberfläche drücken. Deborahs Gabe war nicht stark, aber klar und deutlich erkennbar, ein Zeichen, dass sie ihre Gabe regelmäßig nutzte.
»Es ist mir ein wenig unangenehm, darüber zu sprechen«, gab Deborah zu, als sie sich auf den Weg zum Pool machten. »Es ist nicht so, dass meine Eltern orthodox sind. Sie sind eigentlich überhaupt nicht religiös, aber ich glaube, für sie ist Magie so etwas wie Schummeln. Auf jeden Fall ist es geschmacklos, etwas, über das man in der Öffentlichkeit nicht spricht. Ich wurde dazu erzogen, meine Fähigkeit geheim zu halten.«
»So wie ich.« Lily hatte gewusst, dass Ruben Jude war, doch sie hatte immer angenommen, er sei es eher durch seine Herkunft als durch seinen Glauben – vielleicht, weil das Thema Religion zwischen ihnen nie aufgekommen war. Dass Deborah in beiderlei Hinsicht jüdisch war, war ihr neu. »Als ich noch bei der Mordkommission war, habe ich verschwiegen, dass ich eine Sensitive bin. Zum einen, weil ich so erzogen wurde, zum anderen aber auch, weil ich Angst hatte, man könnte mich dazu benutzen, jemanden zu outen, verstehen Sie?«
Deborah nickte. »Torquemada.«
»Unter anderen, ja.« Sensitive waren vor, während und nach der Säuberung dazu benutzt worden, Andersblütige und von Magie »Verunreinigte« aufzuspüren. Der spanische Großinquisitor war einer der bekanntesten Sensitiven. Als Massenmörder wurde ihm zwar der Rang durch Hitler, Lenin und Pol Pot abgelaufen, aber er hatte sehr viel mehr gefoltert als die neun- oder zehntausend, die er auf dem Scheiterhaufen verbrannt hatte. »Es dauerte ein bisschen, bis ich mich daran gewöhnt hatte, mich nicht mehr zu verstecken, aber mir gefällt es so besser. Sehr viel besser.«
»Ich verstecke meine Gabe nicht. Ich rede nur nicht darüber.«
Lily warf ihr einen belustigten Blick zu.
Deborah schnitt ein Gesicht. »Ich nehme an, das kommt auf dasselbe heraus. Liegt Magie bei Ihnen in der Familie?«
»In der Familie meines Vaters ja, aber er selbst hat keine Gabe. Warum?«
»Oh, ich interessiere mich für Genetik. Insbesondere, nachdem wir herausgefunden haben, welche Wirkung die Abstammung von den Sidhe auf Ruben hat – zuerst hatte er diese Allergie, dann hat es ihm das Leben gerettet. Kennen Sie Arjenie Fox?«
»Natürlich.« Dass Arjenie die neue Gefährtin von Rules Bruder Benedict war – die einzige andere Auserwählte in Nordamerika –, musste natürlich unter allen Umständen geheim bleiben, aber Lily hatte Arjenie auch vorher schon gekannt. Sie arbeitete als Rechercheurin für das FBI.
»Ich war sehr überrascht, als sie nach Kalifornien zog. Aber wie sagt man doch: Wo die Liebe hinfällt … nicht wahr? Sie hat mir geholfen. Aus Gefälligkeit, in ihrer Freizeit«, ergänzte Deborah hastig. »Nicht während der Arbeitszeit und ohne Arbeitsmittel zu nutzen.«
Lily unterdrückte ein Lächeln. So wie sie Arjenie kannte, würde sie alle Mittel nutzen, die sie wollte. Sie hatte zwar feste moralische Grundsätze, doch die stimmten nicht unbedingt mit denen ihres Arbeitgebers überein. »Jetzt, da ich Ihre Gabe kenne, frage ich mich, wie viel von dem da« – Lily deutete auf den Garten – »Sie eigenhändig geschaffen haben. Eine wunderschöne Anlage. Meiner Erfahrung nach mögen es die meisten Erdbegabten gar nicht, wenn ihnen andere Leute ins Handwerk pfuschen.«
»Ich habe jeden Zentimeter Erde selbst bepflanzt«, sagte Deborah mit dem ganzen Stolz einer leidenschaftlichen Gärtnerin.
Offenbar durfte man Deborah keine Komplimente wegen ihres Aussehens machen. Das verschreckte sie. Aber wenn man ihren Garten lobte, blühte sie auf. »Das gefällt mir besonders«, sagte Lily, als sie zu einem runden, mehrstufigen Beet kamen. »Es sieht aus wie eine Hochzeitstorte oder eine Fontäne aus Pflanzen statt aus Wasser.« Sie blieb stehen und dachte nach. So spät im Jahr blühten die meisten Pflanzen nicht mehr, aber … »Ist das ein weißer Garten?«
»Oh, Sie sind auch Gärtnerin! Ja, ich liebe es, wenn die vielen weißen Blumen in der Dämmerung schimmern. Ich wünschte, Sie hätten sie vor einem Monat sehen können. Ich fürchte, selbst die Zimterle hat den Höhepunkt ihrer Blüte bereits überschritten.«
»Zimterle?«, fragte Lily. »Ich kenne mich nicht gut in der hiesigen Pflanzenwelt aus, aber ich dachte immer, sie blühe nur im Sommer.«
Ein verschmitztes Grübchen zeigte sich in Deborahs linker Wange. »Kann sein, dass es mir gelungen ist, sie zu überzeugen, länger zu blühen.«
»Da nenne ich mal einen nützlichen Trick. Den außerdem nicht viele Erdbegabte beherrschen.«
»Den hat mir ein Naturgeist beigebracht.«
Lilys Augenbrauen schossen in die Höhe. »Ein Naturgeist?«
»Sie besuchen mich manchmal. Ich glaube, sie finden mich interessant.«
»Ah.« Lily stellte fest, dass sie sich viel lieber weiter mit Deborah unterhalten würde, als sich bei Bixtons Stabschef lieb Kind zu machen. »Ich habe keinen eigenen Garten, aber meine Großmutter lässt mich in ihrem werkeln, wie ich will. Nichts ist beruhigender, als ein paar Quadratmeter Unkraut zu zupfen.«
»Genau. Aber Bermudagras –!« Deborah verdrehte die Augen. »Die Vorbesitzer des Hauses haben es gepflanzt. Sogar nach zwanzig Jahren finde ich noch Ausläufer, die ich ausgraben muss.«
»Ein hartnäckiges Zeug. Man nutzt es wohl auch in der chinesischen Landwirtschaft. Wer immer auf die Idee kam, Bermudagras sei eine Lösung –«
»– der hat noch nie einen Garten gestaltet, das ist sicher. Es breitet sich überall aus. Dann kennen Sie es aus Kalifornien?«
»Oh, das gibt es überall. Ich habe gehört«, sagte Lily düster, »dass man es sogar auf dem Grund des Grand Canyon gefunden hat. Was für eine Grassorte verwenden Sie für Ihren Rasen? Die kenne ich nicht aus Kalifornien.«
»Wiesen-Rispengras. Wenn man es nicht zu kurz mäht, ist es beinahe unkrautfrei.«
Zwanzig Minuten später begutachteten Lily und Deborah einen traurig aussehenden Rhododendron an einer östlichen Ecke der Rasenfläche in der Nähe des Waldes und plauderten über Mulch und Kompost und Wurzelfäule.
»… kein großes Problem in dem Teil des Landes, in dem ich wohne«, sagte Lily gerade. »Doch ich weiß, dass eine gute Entwässerung entscheidend ist. Aber wenn Sie den Boden schon mit Ihrer Magie aufgepeppt haben, dann könnte vielleicht eine andere Sorte Mulch –«
Ein klarer Tenor unterbrach sie trocken. »Ich hätte es wissen müssen.«
Deborah blickte über die Schulter zurück zu ihrem Mann. Wieder blitzte das Grübchen auf. »Lily gefällt der Garten.«
Ruben Brooks sah nicht aus wie ein Mann, der erst vor Kurzem einen Herzanfall erlitten hatte … der ihn beinahe das Leben gekostet hätte und der Grund für seine unbefristete Beurlaubung aus gesundheitlichen Gründen war. Ein Herzanfall, ausgelöst durch einen Zaubertrank, den ihm, wenn man Zeit und Gelegenheit bedachte, nur jemand aus dem FBI-Hauptquartier verabreicht haben konnte. Ein Verräter.
Heute Abend jedoch sah Ruben gesund aus. Zwar immer noch eher mager als schlank, Hakennase, zerzaustes Haar und eine Brille, die eher an einen Computerfreak als an einen Macher denken ließ. Doch er war nicht mehr so ausgemergelt. Und er saß nicht mehr im Rollstuhl. Als Lily ihm im letzten November zum ersten Mal begegnet war, hatte er an einer mysteriösen Krankheit gelitten, die zu fortschreitender körperlicher Schwäche führte. Diese Krankheit hatte er immer noch. Sie war genetisch bedingt und würde ihn sein ganzes Leben lang begleiten, doch heute wusste er, was sie auslöste und konnte diese Auslöser vermeiden … mehrheitlich. Eisen und Stahl ganz zu meiden war unmöglich.
Er lächelte sie fragend an. »Ich wusste gar nicht, dass Sie einen grünen Daumen haben. Sie haben doch gar keinen Garten.«
»Nein, aber wie ich Deborah schon sagte, darf ich mich in dem meiner Großmutter austoben.« Wenn sie Zeit dazu fand. Wenn sie in San Diego und nicht in Washington war.
»Schön, dass Sie Gelegenheit haben, sich schmutzig zu machen. Lily, bitte versuchen Sie sich Ihre Reaktion auf das, was ich Ihnen jetzt sage, nicht anmerken zu lassen. Wenn die anderen Gäste gegangen sind, würde ich gerne mit Ihnen und Rule sprechen. Wenn Sie bleiben könnten, ohne dass es auffällt … vielleicht kann Deborah ihnen den Ficus zeigen, der versucht, den Wintergarten in Beschlag zu nehmen. Dann könnten Sie im Haus bleiben, während die anderen sich verabschieden.«
Deborah seufzte schwach. »Es ist Zeit, nicht wahr?«
»Ich fürchte, ja.«
Lily lächelte und nickte, als hätte Ruben eine Bemerkung über das Wetter gemacht. Jetzt erst bemerkte sie, dass die Anzahl der Gäste abgenommen hatte, während sie mit Deborah gesprochen hatte. Ein halbes Dutzend Fragen schoss ihr durch den Kopf, doch sie stellte sie nicht. Wenn Ruben ihr hätte sagen können, was los war, hätte er es getan. »Okay.«
Obwohl er keine Gedanken lesen konnte und sie, wie sie glaubte, ihr Mienenspiel im Griff gehabt hatte, beantwortete er eine ihrer Fragen. »Es geht um den Krieg.«
4
Nur wenige Gäste waren noch da, als Rule sich auf den Weg zur Hintertür des Hauses machte. Bald war es so weit. Er empfand vor allem Erleichterung.
Dabei machte er sich keine Illusionen: Die nächste Stunde würde nicht einfach werden. Doch Lily würde es am härtesten treffen. Erst musste sie die Neuigkeiten verarbeiten, die Rule für sie hatte und dann nun ja, seine hasste es, wenn er Geheimnisse vor ihr hatte. Er hasste es auch und war nur allzu bereit, sich diese Last von den Schultern nehmen zu lassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!