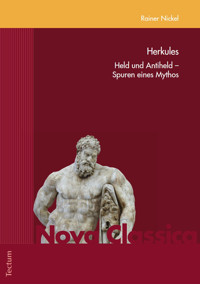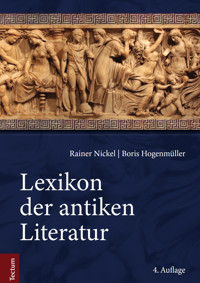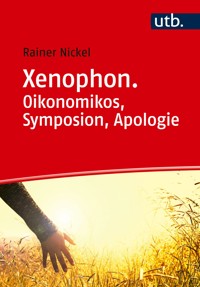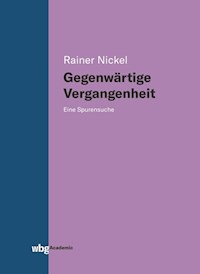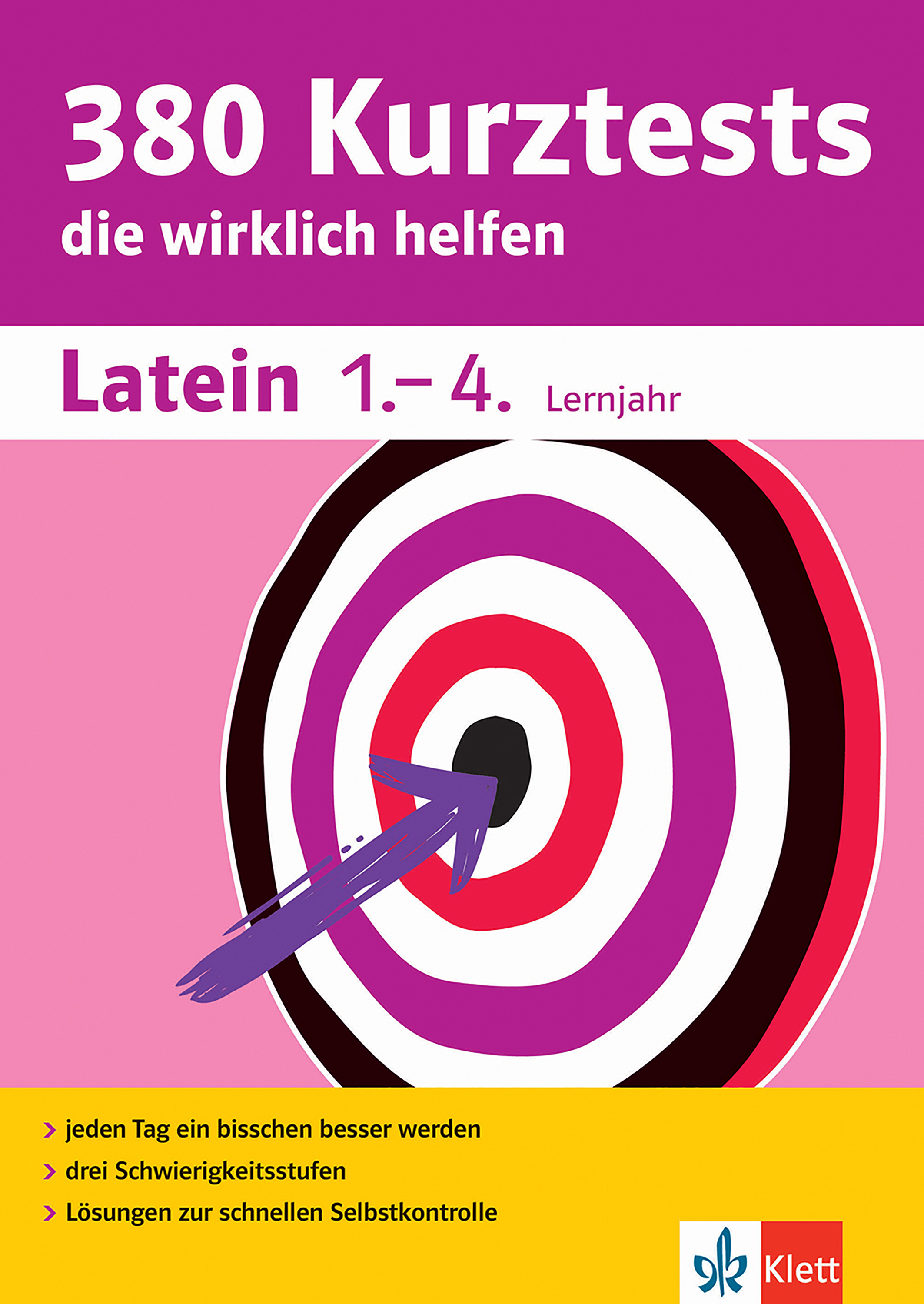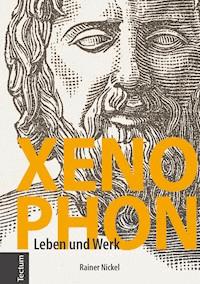
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Leben des um 425 v. Chr. geborenen Atheners Xenophon liest sich wie ein Abenteuerroman: Er erlebte die aufregendste Epoche der athenischen Geschichte, kannte Sokrates, Platon, Phaidon und Kyros persönlich und war darüber hinaus noch ein begeisterter Schriftsteller. Es ist nicht nur das bewegte Leben des Xenophon, das in seinen Bann zieht. Der antike Grieche darf auch als ein Begründer der Autobiographie gelten. Kaum verwunderlich also, dass Xenophon schon in der Antike zum Liebling des Lesepublikums wurde. Und heute noch bleibt er mit seinem politisch-ökonomischen Denken, seinen ethischen Grundsätzen sowie seinen Erfahrungen mit einer ressourcengerechten Nutzung von Grund und Boden aktuell und diskussionswürdig. Rainer Nickels detaillierte Auseinandersetzung mit Xenophon und seinen Schriften hilft, die Persönlichkeit des Atheners besser zu verstehen und dabei sowohl seinen interessanten Lebenslauf, seine kulturelle und literarische Umwelt, seine Arbeitstechniken und Absichten, sowie seine politischen Anschauungen kennenzulernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rainer Nickel
Xenophon
Rainer Nickel
Xenophon
Leben und Werk
Tectum Fachbuch
Rainer Nickel
Xenophon
Leben und Werk
© Tectum Verlag Marburg, 2016
ISBN 978-3-8288-6506-8
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3738-6 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: Holzschnitt von Xenophon,istockphoto.com© ZU_09
Satz, Layout, Coverdesign: Norman Rinkenberger | Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1Der Mensch
1.1Lebenslauf
1.2Anschauungen und Überzeugungen
2Das Werk
2.1Die einzelnen Schriften
2.1.1Die historischen Schriften
•Anabasis
•Hellenika
•Agesilaos
2.1.2Die pädagogisch-ethischen und die technologischen Schriften
•Kyrupädie
•Hieron
•Staat der Lakedämonier
•Poroi
•Hipparchikos
•Über die Reitkunst
2.1.3Sokrates und die sokratischen Schriften
•Memorabilien
•Oikonomikos
•Symposion
•Apologie
2.1.4Pseudo-xenophontische Schriften
•Kynegetikos
•Staat der Athener
2.2Vorlagen,Quellen,Arbeitsweise
2.3Literarische Gattungen
Ausblicke
Literaturverzeichnis
Register
1.AntikeNamen
2.Sachen
3.Stellen
Anhang zu Hellenika 6, 3, 6
Vorwort
Die vorliegende Darstellung basiert auf meinem 1979 in der Reihe „Erträge der Forschung“ bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt erschienenen Bericht über die Xenophon-Forschung. Nach fast 40 Jahren dürfte es sinnvoll sein, daran anzuknüpfen und einen Blick auf die weitere Entwicklung der Forschung zu werfen. Hans Rudolf Breitenbachs Xenophon-Monographie von 1966, die auch als RE-Artikel 1967 erschien, wird wiederum als Ausgangspunkt gewählt. Es hat sich gezeigt, dass einige der nach 1966 erschienenen Arbeiten nicht nur Breitenbachs Ansätze aufgriffen und fortentwickelten, sondern auch ganz neue in die Gegenwart führende Wege einschlugen.
Die Feststellung von W. E. Higgins (1977), dass sich Xenophons Denken und Handeln auf das spannungsreiche Verhältnis zwischen Individuum und Polis-Gemeinschaft konzentrierte, griff Christian Müller-Goldingen (2007) auf, indem er darauf hinwies, dass Xenophons Schriften von einer Vielzahl weiterer Spannungsfelder durchzogen sind: Praxis und Theorie, Tradition und Innovation, Nähe und Distanz, Historizität und Fiktionalität, Macht und Moral, poßnow und hÖdonhß, Führung und Gehorsam, Erwerb und Gebrauch, Reden und Handeln.
Dass Xenophon innerhalb dieser Spannungsfelder einen deutlichen „Trend zur Autobiographie“ erkennen lässt,1 zeigt sich daran, dass er sich nicht von seinem Werk distanzieren, sondern sich in ihm ausdrücken will. Daher ist es auch nicht sein höchstes Ziel, Sachverhalte objektiv zu schildern. Als ein homo narrans will er einfach nur erzählen, was ihm wichtig erscheint und was er selbst gesehen und erlebt hat.
Die vorliegende Darstellung möchte dazu beitragen, Xenophons Persönlichkeit zu verstehen und dabei nicht nur seinen Lebenslauf, seine kulturelle Umwelt, seine literarischen Voraussetzungen und Absichten und seine spezifischen Arbeitstechniken, sondern auch seine politischen Anschauungen und Überzeugungen kennen zu lernen. Zu diesem Zweck werden seine Schriften in ihrer Vielseitigkeit und Eigentümlichkeit charakterisiert.
Die grobe Einteilung in die drei Gruppen der (1) historischen Schriften, der (2) pädagogisch-ethischen und der technologischen Schriften und der (3) sokratischen Schriften dient der ersten Orientierung, ohne damit eine feste Zuordnung zu bestimmten literarischen Gattungen vorzunehmen. Auch einige knappe Hinweise auf die pseudo-xenophontischen Schriften werden nicht fehlen.
Die „Ausblicke“ am Schluss des Bandes geben Hinweise auf Themen, für die weiterhin noch Forschungsbedarf besteht.
Ich danke Boris Dunsch, Marburg, für wertvolle weiterführende Hinweise und Anregungen und für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts.
Rainer Nickel
1Mueller-Goldingen 2007, 42.
1 Der Mensch
1.1Lebenslauf
Edouard Delebècque hatte in seinem Essai sur la Vie de Xénophon (1957) versucht, Xenophons „materielles“ und „intellektuelles“ Leben darzustellen und zu veranschaulichen, wie sein bewegtes Schicksal sein Denken bestimmte. Seine Biographie lese sich wie ein Abenteuerroman. Müsse ein Mann wie Xenophon, der die aufregendste Epoche der athenischen Geschichte miterlebt und Männer wie Sokrates, Thukydides, Platon, Kallias, Phaidon, Antisthenes, Isokrates, Kritias, Theramenes, Thrasybulos, Kyros, Seuthes und Agesilaos persönlich kannte und außerdem ein begeisterter Schriftsteller war – müsse ein solcher Mann nicht faszinieren? Wenn man aber den Menschen kennen lernen wolle, dann könne man nicht umhin, sein schriftstellerisches Werk gründlich zu lesen, das die wichtigsten Informationen über den Autor selbst biete, wenn man von Diogenes Laërtius’ Hinweisen (2, 48–59) absehe. Man verzichte zu leichtfertig darauf, Xenophons Spuren zu folgen, weil sie angeblich unsichtbar seien, und gebe zu schnell auf, sie zu suchen. Es sei aber für das Verständnis zum Beispiel der Anabasis wichtig zu wissen, ob das Werk nun als Tagebuch während des Zuges der Zehntausend oder als Erinnerungsbuch im athenischen oder spartanischen Milieu geschrieben wurde, und um die ersten beiden Bücher der Hellenika zu verstehen, müsse man klären, ob sie vor oder nach der Expedition des Kyros oder vor, während oder nach dem Exil des Autors geschrieben worden seien.
Xenophons Schriften – das sei dabei zu beachten – seien allerdings nicht so sehr als historische Quellen anzusehen. Es komme dem Autor nicht darauf an, geschichtliche Fakten so objektiv wie möglich darzustellen; er wolle allenfalls seine Erinnerungen an diese festhalten. Aber gerade darum sei das Werk die beste Informationsquelle für das sich in ihm spiegelnde individuelle Leben des Autors.
In Delebècques Darstellung zeichnet sich etwa folgendes Bild ab: Xenophon erlebte zwei Jahrhunderte und zwei Welten. Er bildete einen „Bindestrich“ zwischen dem großen fünften Jahrhundert und dem beginnenden Abstieg Athens einerseits und der griechischen und der orientalischen Kultur andererseits. Er war nicht nur ideell der leidenschaftliche Anhänger Spartas, sondern auch der tapfere Soldat, der die Zehntausend aus Asien nach Hause zurückbrachte. Er war ungewöhnlich begabt, und es ist nicht verwunderlich, dass er Cäsar gefiel, der ja ebenso wie Xenophon zugleich ein Mensch des wissenschaftlichen Denkens und des Handelns war.
Aufgrund seiner politischen Ideen und seines Talents geriet er in die Nähe zu Thukydides und war von dessen Geschichtswerk fasziniert. Mit den ersten beiden Büchern seiner Hellenika sah er sich als Thukydides’ Nachfolger. Er stellte auf diese Weise eine geistige Verbindung zwischen dem großen Historiker und Sokrates her. Er erlebte das Ende des Peloponnesischen Kriegs und des Bürgerkriegs und die politischen Erschütterungen und die leidenschaftlichen Anfeindungen in Athen trotz der allgemeinen Amnestie.2 Die Polarisierung der Gegensätze brachten ihn in eine gefährliche Lage. Die Teilnahme an der Expedition des jüngeren Kyros, der das Eldorado versprach, wurde zu einer großen Illusion. Das ersehnte Leben im orientalischen Wunderland und die herausragende Position am Hofe eines Königs oder an der Spitze einer griechischen Kolonie blieben unerfüllte Wünsche. Xenophon wurde mit der bitteren Wirklichkeit der Niederlage, des Verrats und der Anarchie konfrontiert. Es genügte ihm aber nicht, seinen Willen zum Überleben zu beweisen. Er nutzte die Gelegenheit, Länder und Menschen kennen zu lernen, um erfüllt von seinen Eindrücken seinen Freunden in den Mauern von Athen davon zu erzählen. Die Quittung dafür war seine Verbannung. Sie wurde damit begründet – so Delebècque – , dass er einem Feind der Athener an der Seite gewisser unliebsamer Spartaner gedient habe. Das Exil dauerte 36 Jahre von 399–365, wenn es denn tatsächlich unmittelbar nach dem Kyros-Abenteuer begann. Er trat danach zunächst in spartanische Dienste und begann, den spartanischen Staat und die Disziplin seiner Menschen zu bewundern. Er beschrieb das spartanische System in seinem Staat der Lakedämonier. Die Spartaner überließen ihm ein Landgut in Skillus in der Nähe von Olympia. Allmählich aber gewann er eine kritischere Haltung gegenüber Sparta. Obwohl er den Feldherrn Agesilaos weiterhin bewunderte, äußerte er in der Anabasis Vorbehalte gegenüber der Außenpolitik und dem politischen Egoismus der Spartaner. Die Ruhe des Landlebens konnte er nicht lange genießen: Die peloponnesischen Söldner, die Veteranen der Zehntausend, die mit ihrer Beute aus dem Feldzug offenbar nicht haushalten konnten, beneideten ihn um seinen Wohlstand in Skillus und griffen ihn mit allen möglichen Vorwürfen an. Um diesen Söldnern zu antworten und sich zu rechtfertigen, verfasste er seinen Bericht über die Stiftung des Artemistempels in Skillus.3
Die Beziehungen zu Sparta verschlechterten sich. Xenophon kümmerte sich nun intensiver um die Erziehung seiner beiden Söhne Gryllos und Diodoros. Er unterrichtete sie in der Jagd, der Vorschule des Krieges, und lehrte sie das Reiten, um ihren Charakter zu stärken. Er führte sie in die Lehre des Sokrates ein, der wie er selbst ein Opfer athenischer Willkür geworden war. Doch bevor er über den Meister schreiben konnte, musste er ihn rechtfertigen. Die Apologie sollte den Philosophen als Idealgestalt zeigen, die alle Tugenden besaß – einschließlich des Patriotismus.
Er hielt auch im Exil Kontakt zu seinen athenischen Freunden. Das war schon durch die Nähe zu Olympia möglich. Nachdem er bereits in den ersten beiden Büchern der Hellenika seine historische Arbeit begonnen und mit der Anabasis eine Rechtfertigung seiner Teilnahme am Zug der Zehntausend gegen den persischen Großkönig verfasst hatte, konnte er nun Vorarbeiten zu den Memorabilien und zum Oikonomikos in Angriff nehmen. Er schrieb zuvor jedoch noch eine technische Schrift, die Reitkunst, und arbeitete weiter an den Hellenika – zum Ruhm des Agesilaos, des Befreiers der Griechen in Asien.
Als die Eleer nach Spartas Niederlage bei Leuktra ihr Territorium wieder in Besitz nahmen, musste Xenophon Skillus verlassen. Er ging nach Korinth. Seine kritische Haltung gegenüber Sparta brachte er im letzten Kapitel des Staates der Lakedämonier zum Ausdruck. Außerdem fügte er den Hellenika einige nicht mehr ganz so Sparta freundliche Kapitel (5, 2–4) hinzu, die „die Hybris des spartanischen Machtmissbrauchs“4 veranschaulichten. Hier zeigte er, dass er den Philolakonismus der Bücher 3 und 4 der Hellenika überwunden hatte.
Infolge personeller Veränderungen, durch Intervention seiner Freunde und aufgrund der langen Jahre, die den Anlass der Verbannung allmählich in Vergessenheit geraten ließen, erhielt Xenophon die Möglichkeit zur Rückkehr nach Athen. Er hatte mittlerweile die Sechzig überschritten und war für den Kriegsdienst zu alt geworden. Stattdessen ließ er seine Söhne in athenische Dienste treten. Dann kehrte er selbst ohne Groll und ohne den Gedanken an Rache nach Athen zurück. Diese Rückkehr war für ihn gleichsam eine zweite Geburt. In den letzten zehn Jahren seines Lebens widmete er sich mit jugendlichem Elan ausschließlich der Arbeit für seine Vaterstadt. Dort konnte er sein schriftstellerisches Werk einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Er vollendete die Reitkunst, den Oikonomikos, die Hellenika und die Memorabilien und verfasste das Symposion, die Kyrupädie und den Hieron. Nach dem Tod des Agesilaos versuchte er mit seinem Agesilaos die Öffentlichkeit auf die „persische Gefahr“ aufmerksam zu machen. Seine militärischen und finanzpolitischen Vorstellungen formulierte er im Hipparchikos und in den Poroi. Die Bücher 3 und 4 der Memorabilien waren laut Delebècque sein letztes Werk. Sie enthalten die Gedanken über die großen politischen und pädagogischen Fragen der Zeit.
Xenophons Lebensmitte, die Quelle seines Denkens und Handelns, waren die Freude am Kampf und an der Anstrengung in jeder Form und der Wille zum Widerstand gegen das Unglück. Er sah sich selbst nie als Opfer widriger Umstände. Darum ist er wohl auch zum Vorbild der Stoiker geworden: Die mittlere Stoa (Panaitios und Poseidonios) vertrat Gedanken über die Vorsehung und die Fürsorge der Götter, wie sie Xenophon bereits in den Memorabilien (bes. 1, 4 und 4, 3) formuliert hatte. Der römische Stoiker Musonius stand unter Xenophons Einfluss und übernahm typisch xenophontische Gedankengänge.5 Die Memorabilien haben Arrians Erinnerungen an den Stoiker Epiktet deutlich beeinflusst.6
Xenophon blieb Neuerungen gegenüber zurückhaltend und verteidigte auf den Gebieten der Religion, der Politik, der Literatur und der Erziehung traditionelle Wertvorstellungen. Aber wenn man von seinen religiösen Gedanken absieht, so hat er auf vielen Gebieten neue Einsichten vermittelt. Was die Erziehung betrifft, so war er der erste Verfechter eines Unterrichts in Geschichte und Kultur. Auf militärischem Gebiet war er der Schöpfer einer modernen Kavallerie.7 Er befürwortete die Einrichtung begrenzter Stützpunkte und wies auf die Vorteile des Überraschungsangriffs durch kleine und flexible, aber schlagkräftige Einheiten und auf die Risiken aufwendiger militärischer Operationen durch große militärische Verbände hin.
In der Literaturgeschichte darf er als ein Begründer der Autobiographie gelten. Er kann zudem den Anspruch erheben, ein Vater der praxisorientierten Politikwissenschaft zu sein, indem er die Polis in ihren Beziehungen zur übrigen Welt systematisch untersuchte. Um des besseren Verständnisses der Gegenwart willen pflegte er mit Beispielen aus der Geschichte zu argumentieren. Auf diese Weise wies er auf Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten hin. So kritisierte er die Isolation der griechischen Städte und sah ihre Zukunft in ihrer Vereinigung unter einem tüchtigen und gerechten Monarchen.
Sein Fehler war es vielleicht, dass er sich mit zu vielen Problemen auf zu vielen Gebieten befasste, ohne das jeweilige Terrain gründlich erforscht zu haben. Er glaubte in der Lage zu sein, ein haltbares Band zwischen Persern und Griechen und Sparta und Athen zu knüpfen und die innenpolitische Eintracht der Athener zu festigen. Auch wenn er die Probleme seiner Zeit nicht lösen konnte, so bewies er doch in schwierigen und gefährlichen Zeiten die Kunst des Überlebens. Seine Schriften beweisen Mut, vernünftigen Optimismus und Hoffnung auf eine Bewältigung widriger Umstände, die er mehr aus eigener Kraft als mit Hilfe der Götter überlebte.
Delebècques Xenophon-Biographie stützt sich – wie nicht anders zu erwarten – auf gesicherte Überlieferung einerseits und auf plausible, wenn auch schwer beweisbare Hypothesen andererseits. Das scheinbar so geschlossene und dadurch so überzeugende Xenophon-Bild darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Delebècque noch viele Fragen offen ließ. Selbst dort, wo er überzeugende Antworten gab, ist nicht auszuschließen, dass auch andere Lösungen denkbar sind. So bot zum Beispiel die zeitliche Fixierung der Geburt Xenophons immer wieder Anlass zu Meinungsverschiedenheiten.8 In der Anabasis (3, 1, 25) lieferte Xenophon selbst einen Anhaltspunkt: In einer Rede vor den Hauptleuten des Proxenos erklärte er, er sei alt genug, um die Führung nach Proxenos’ Tod zu übernehmen. Folglich kann er zu diesem Zeitpunkt nur jünger als Proxenos selbst gewesen sein, der als Stratege im Alter von ungefähr 30 Jahren umkam (Anabasis 2, 6, 20). Demnach fiele Xenophons Geburt in die Zeit zwischen 430 und 425. Delebècque hatte mit einigen weiteren Belegen für 426 plädiert, ohne den Ansatz 427, den Masqueray in der Introduction zu seiner Ausgabe der Anabasis (1930) vertrat, widerlegen zu wollen. Dass Xenophons Kindheit und Jugend in die Zeit des Peloponnesischen Krieges fielen – so auch neuerdings E. Schütrumpf 9 – dürfte nicht zu bezweifeln sein, und dass er etwa genau so alt war wie Platon, wird von Hesych bestätigt, der ihn als „Platons Mitschüler“ bezeichnet.
Hinsichtlich des Todesjahres stimmen Delebècque und Breitenbach weitgehend überein: Einen terminus post quem liefert Hellenika 6, 4, 37. Der hier genannte Tisiphonos von Pherai trat seine Regierung nach 358/357 an, und Poroi 5, 9 wurde nach 355, dem letzten sicher bestimmbaren Zeitpunkt in Xenophons Werk, verfasst. Demnach dürfte Xenophon einige Zeit nach 355 im Alter von etwas über 70 Jahren gestorben sein. Diese Datierung ist auch nach Schütrumpf nicht strittig.10
Dass Xenophon seine Vaterstadt Athen aufgrund der dort für ihn unerfreulichen innenpolitischen Verhältnisse verließ, um an der Expedition des jüngeren Kyros teilzunehmen, ist nicht infrage zu stellen.11 Ob diese Entscheidung jedoch zu seiner Verbannung geführt hat,12 ist nach wie vor nicht sicher, obwohl schon Pausanias (5, 6, 5), Diogenes Laërtius (2, 58)13 und Dion Chrysostomos (8, 1) die Auffassung vertraten, Xenophon sei aufgrund seiner Teilnahme an einem Feldzug gegen den persischen Großkönig verbannt worden, mit dem die Athener zu derselben Zeit gute Beziehungen pflegten. Diese hätten demnach den Bürger bestrafen müssen, der dem Heer des aufständischen Prinzen Kyros angehört hatte. Delebècque konnte den antiken Ansatz im Blick auf Anabasis 7, 7, 57 bestätigen. Denn hier heißt es, nach Beendigung des thrakischen Feldzugs sei allen deutlich gewesen, dass sich Xenophon zur Heimreise rüstete; denn Athen hatte ihn noch nicht verbannt. Hartmut Erbse14 wies darauf hin, dass der Autor so nicht hätte formulieren können, wenn die Verbannung erst fünf Jahre später – aufgrund der Teilnahme an der Schlacht bei Koroneia (394) – ausgesprochen worden wäre.
Ein besonderes Gewicht bei der Entscheidung zwischen 399 und 394 als Zeitpunkt der Verbannung kommt noch einer anderen Textstelle zu: Laut Anabasis 5, 3, 5–7 hatte Xenophon bei dem Tempelwächter Megabyzos Geld hinterlegt, das dieser ihm zurückgehen sollte, wenn er den Feldzug des Agesilaos gegen die Böotier glücklich überstanden habe (hün me?n auöto?w svjhq#). Wenn ihm, Xenophon, etwas zustoße, solle der Tempelwächter mit dem Geld das für Artemis vorgesehene Weihgeschenk anfertigen lassen. Und jetzt folgt der entscheidende Satz: eöpeidh? d’ eäfeugen15 oÖ Cenofvqn, katoikouqntow hädh auötouq eön Skillouqnti uÖpo? tvqnLakedaimonißvn oiökisjeßntow para? th?n ö Olumpißan jevrhßsvn aöfikneiqto Megaßbuzow eiöw öOlumpißan kai? aöpodißdvsin th?n parakatajhßkhn auötvq#. Würde man den ersten Teil des zitierten Satzes übersetzen mit „als Xenophon aber verbannt war ...“, dann müsste man die Verbannung auf die Zeit nach 394 beziehen, wie es Breitenbach und andere für richtig halten, zu denen auch Lendle gehört, der in seinem Anabasis-Kommentar,16 erklärt, dass der Koroneia-Hypothese „die größere Plausibilität“ zuzusprechen sei. Wenn man aber eäfeuge als Hinweis darauf versteht, dass Xenophon „davonkam“, weil er den Feldzug mit Kyros überlebte,17 kann man nicht ausschließen, dass er wegen des Kyros-Abenteuers 399 verbannt wurde, wie Erbse meint: „Xenophon ist ... nicht verbannt worden, weil er spartanischer Parteigänger war oder gar in offener Feldschlacht gegen Athens Verbündete focht, sondern weil er am Zug gegen den Perserkönig teilnahm ... und die hochverräterischen Pläne des Kyros wissentlich gefördert zu haben schien.“18
In seinen „Untersuchungen zur Einheit der Hellenika Xenophons“ vertritt auch Baden den Frühansatz der Verbannung, um damit den Spätansatz von Hellenika 1 und 2 zu stützen. Baden greift die Mitteilung des Diogenes Laërtius (2, 51) auf, dass Xenophon eöpi? Lakvnismv#q, als ein Sympathisant Spartas, verbannt wurde, weil er sich dem Spartafreund Kyros anschloss. Breitenbach hielt dem entgegen, in Athen habe niemand im Jahr 399 eöpi? Lakvnismv#q verbannt werden können. Denn zu diesem Zeitpunkt habe sich die Stadt gewissenhaft an die von Sparta auferlegten Friedensbedingungen gehalten.19 Damit wird jedoch nur ausgeschlossen, dass jemand 399 offiziell wegen Spartafreundlichkeit verbannt werden konnte. Es ist aber nicht gesagt, dass Lakvnismoßw auch wirklich der juristische Terminus für Xenophons Delikt war.
Es ist durchaus vorstellbar, dass beide Vorgänge – die Teilnahme an der Expedition des Kyros und an der Schlacht bei Koroneia an der Seite des Agesilaos – dazu geführt haben, gegen Xenophon das Verbannungsurteil zu verhängen. Dass außerdem noch Xenophons Zugehörigkeit zum Kreis um Sokrates den Befürwortern des Verbannungsurteils ein Argument geliefert haben könnte, ist nicht auszuschließen. Hinzu kam, dass er sich nach der Einladung durch den Thebaner Proxenos mit Sokrates beraten hatte (Anabasis 3, 1, 5). Dieser fürchtete, die Athener könnten Xenophon die Freundschaft mit Kyros eines Tages vorwerfen, weil er ja die Spartaner im Peloponnesischen Krieg unterstützt hatte. Hieraus geht eindeutig hervor, dass Xenophon, wie Sokrates es offen ausspricht, mit Konsequenzen für sein Verhalten rechnen musste, auch wenn die damalige athenische Politik im Zeichen des Lakvnismoßw stand.20
Xenophon teilte übrigens Sokrates’ Bedenken hinsichtlich der Empfindlichkeit des athenischen Demos nicht, weil er ihm eine derartige Engherzigkeit nicht zutraute. Deshalb fragte er in Delphi auch nicht, ob er am Kyros-Zug teilnehmen dürfe, sondern nur, wie er am glücklichsten reisen könne (Anabasis 3, 1, 7).
Nach Lendle ist Xenophons Entscheidung für die Teilnahme am Kyros-Zug dadurch begründet, dass Proxenos ihm versprach, ihn in den Freundeskreis des persischen Prinzen einzuführen. Das „musste für einen philosophisch gebildeten und weltoffenen Mann wie Xenophon ein überaus reizvoller Gedanke sein“. Daneben sei noch ein zweites Motiv in Betracht zu ziehen: „Xenophon hatte in den letzten Jahren des Peloponnesischen Krieges offenbar in der athenischen Reiterei gedient,21 auch unter den sogenannten ,Dreißig‘, deren Sympathisanten nach der Wiederherstellung der Demokratie 403 in Athen keinen leichten Stand hatten. Vielleicht wollte er also ohnehin gerne für eine Zeitlang aus Athen verschwinden und erhielt nun durch den Brief des Proxenos dazu eine gute Gelegenheit.“22
Trotz allgemeiner Amnestie blieben die Reiter, die unter den Dreißig gedient hatten, weiterhin den Anfeindungen der Demokraten ausgesetzt. Diese Situation wird durch Xenophons Bericht in den Hellenika (3, 1, 4) besonders anschaulich: Der Spartaner Thibron, forderte im Jahr 399 – einige Zeit nach dem Zug der Zehntausend – athenische Kavallerie für einen militärischen Einsatz an. Daraufhin schickten die Athener, die als Besiegte und Verbündete der Spartaner diesen Befehl auszuführen hatten, dreihundert Reiter, die unter den Dreißig gedient hatten. „Denn sie glaubten“, so schreibt Xenophon, „es könne nur ein Vorteil für die Demokratie sein, wenn jene die Stadt verließen und vernichtet würden.“ Der attische Demos konnte niemandem verzeihen, dass er dem Regime der Dreißig gedient hatte. „Wir haben also Grund zu der Annahme, dass dem jungen Aristokraten Xenophon im Jahre 401 der athenische Boden unter den Füßen recht heiß geworden ist. Er ergriff die sich bietende ... Gelegenheit, die Heimat zeitweilig zu verlassen.“23
Es spricht also vieles dafür, dass Koroneia 394 letztendlich nur den Ausschlag für ein Urteil gab, dass 399 schon hätte gefällt werden können, aber politisch nicht opportun erschien.
Was andere wichtige Ereignisse in Xenophons Leben betrifft, so datiert Breitenbach wie schon im Falle des Geburtsjahres vorsichtiger als etwa Delebècque. Für die Heirat mit Philesia und die Geburt der beiden Söhne Gryllos und Diodoros nennt er abweichend von Delebècque die Zeit zwischen 399 und 387. Dass Xenophon und Philesia zu Lebzeiten des Sokrates mit Aspasia ein Gespräch geführt haben sollten, wie es der Sokratiker Aischines nach Cicero (De inventione 1, 51 f.) darstellt,24 ist eine literarische Fiktion und für die Datierung von Xenophons Eheschließung nicht verwendbar.25
Delebècque datiert den Einzug in das Landgut in Skillus auf das Jahr 387. Nach Breitenbach und anderen könnte dies aber auch schon einige Jahre vorher erfolgt sein.26 Mit dem Sieg der Thebaner über die Spartaner in der Schlacht bei Leuktra 371 fand Xenophons Landleben in Skillus sein Ende. Auf das Ereignis folgte mit der Entsendung des Iphikrates in die Peloponnes 370/369 die Annäherung Athens an Sparta. Damit waren die äußeren Voraussetzungen gegeben, Xenophon die Rückkehr in seine Heimatstadt zu erlauben. Delebècque stützt sich auf die Nachricht des Istros (bei Diogenes Laërtius 2, 59), Xenophon sei auf Antrag desselben Archonten sowohl verbannt als auch zurückgerufen worden, – und datiert diesen Vorgang in die Zeit um 365. Nach Breitenbach soll die Rückberufung schon im Jahr 368/367 beschlossen gewesen sein.
Der Tod des Gryllos, der in einem Vorgefecht vor der Schlacht bei Mantineia 362 nach rühmlichem Kampf gefallen war,27 wurde in zahlreichen Enkomien verherrlicht. Xenophon soll mit einem Kranz geschmückt mit einer Opferhandlung beschäftigt gewesen sein, als ihm die Todesnachricht überbracht wurde. Daraufhin soll er die Kranz abgesetzt, dann aber gleich wieder aufgesetzt haben, als man ihm sagte, Gryllos sei als Held gefallen.28 In seinem Dialog Gryllos soll Aristoteles erwähnt haben, es hätten zahllose Autoren Preislieder und Grabinschriften auf Gryllos verfasst.29
Die Verherrlichung des Gryllos in vielerlei Formen und die Anekdoten über Xenophons Reaktion auf die traurige Nachricht beweisen, dass Xenophon gegen Ende seines Lebens ein berühmter Mann war, dem man mit großer Achtung begegnete.
Delebècque hebt hervor, dass alle Schriften Xenophons autobiographische Informationen bieten. Es gebe aber weitere Stellen in seinem Werk, die ein besonders anschauliches Selbstporträt des Autors zu zeichnen und auf diese Weise wertvolle Einblicke in sein Leben und Denken zu vermitteln scheinen. Schon Werner Jaeger deutete die Gestalt des Ischomachos im Oikonomikos als „ein zur Dichtung gesteigertes Selbstporträt des Verfassers“. Das Gespräch zwischen Ischomachos und Sokrates (7–21) solle verdeutlichen, was Xenophon unter Kalokagathie verstand: „Was sich uns hier als die echte Kalokagathie enthüllt, ist nichts anderes als das Leben eines vortrefflichen Landwirts, der seinen Beruf mit wahrer Freude und vollem Verständnis ausübt und das Herz auf dem rechten Fleck hat.“30
Das Xenophontische an dieser bäuerlichen Kalokagathie ist die Verbindung soldatischer und landwirtschaftlicher Tüchtigkeit und Pflichtauffassung. Das veranschaulicht nicht zuletzt auch der Name des idealen Landwirts: Ischomachos, „der standhafte Kämpfer“. Ivo Bruns lieferte für die Darstellung des Ischomachos eine psychologische Begründung: Xenophons Phantasie ergehe sich gern darin, breite, glänzende, wohlgeordnete Verhältnisse auszumalen. Weil es ihm persönlich so schlecht gegangen sei, weil sich seine Träume von Wohlstand und Einfluss, die er im Osten habe verwirklichen wollen, nicht erfüllt hätten, weil er sein Vaterland darüber verloren habe und seinen Landbesitz in Skillus wieder habe aufgeben müssen und weil er nirgends Gelegenheit gehabt habe, auf seine Umgebung positiv zu wirken, habe er sich mit der Ausmalung von Zuständen getröstet, die mit seiner eigenen kümmerlichen Lage merkwürdig kontrastierten: „Er denkt sich die Idealgestalt eines vornehmen Atheners aus, der von bester Familie ist, dazu reich an Kapitalien und Landbesitz. Er stellt sich vor, wie ein solcher Mann sein Leben einrichtet, was er tut von früh bis spät ... Er ist ein vorzüglicher Geschäftsmann, ein Landwirt, der nach den besten Methoden arbeiten lässt; als Gebieter über seine Sklaven ein humaner, äußerst verständiger Herr. Was er angreift, gedeiht, der Wohlstand wächst mit jedem Tage ... Auch als Bürger ist er tadellos. Keiner leistet der Stadt mehr wie er, als bereitwilliger Steuerzahler, als gewandter Soldat. Auch für seine geistige Ausbildung ist er besorgt. Er versucht zu reden und zu raten in allen Versammlungen ... Er unterstützt seine Freunde. Er ist ein vorzüglicher Gatte. Er ist fromm und ehrt die Götter mit glänzenden Opfern.“31
Keine dunkle Farbe sei in diesem Bild. Es sei mit Liebe und Bewunderung gezeichnet. Man merke Xenophon an, wie gern er der Mann gewesen wäre, den er schilderte. In der Tat: Er stellt sich hier wie in seinen anderen Schriften als ein homo narrans, ein „storytelling animal“, dar, dem das plausible Erzählen die Möglichkeit bietet, sich ein Leben zu schaffen, wo keines war oder ist,32 und eine schmerzhafte Vergangenheit positiv zu bewältigen.
Es steht außer Frage, dass er sich auch an anderen Stellen seines schriftstellerischen Werkes mittelbar und unmittelbar selbst porträtiert, seine Wünsche und Vorstellungen artikuliert oder autobiographische Elemente in seine literarischen Porträts einarbeitet. Dass er sich dabei nicht ungern hinter einem Pseudonym verbirgt, beweist nicht zuletzt die Publikation der Anabasis unter dem Namen des Themistogenes aus Syrakus (Hellenika 3, 1, 2).33 Es sind auch oft deutlich sprechende Namen, die vermuten lassen, dass Xenophon eigentlich sich selbst meint: Themistogenes, Ischomachos, Euthydemos. Der letztgenannte Name findet sich in den Memorabilien 4, 2, einem sehr sorgfältig komponierten Kapitel, in dem es dem Autor darauf ankommt, Sokrates’ Methode der Gesprächsführung zu veranschaulichen. Xenophon spricht hier von einem zunächst arroganten jungen Mann namens Euthydemos, der eine große Bibliothek besitzt, sich aufgrund seiner literarischen Kenntnisse seinen Altersgenossen überlegen fühlt und sich seines künftigen Erfolgs im öffentlichen Leben schon im voraus bewusst ist. Dabei erscheint dieser Euthydemos in Xenophons Darstellung gar nicht unsympathisch. Sokrates gewinnt ihn für ein Gespräch unter vier Augen, in dem er ihm erklärt, dass er in Wirklichkeit gar nichts weiß. Daraufhin ist er aber nicht etwa gekränkt wie viele andere, denen es ähnlich ging, sondern er schließt sich Sokrates an. Denn er lässt sich davon überzeugen, dass er von diesem Entscheidendes lernen könne. So ist die schon von Erbse34 geäußerte Vermutung nicht unbegründet, dass es sich bei Euthydemos in Wahrheit um Xenophon selbst, den „rasch zum Demos, das heißt zur Politik Drängenden“ (Euthy-demos), handle. Gigon35 meinte allerdings, dass sich hinter Euthydemos ebenso wie hinter Charmides (Memorabilien 3, 7) Alkibiades verstecke. Xenophon habe hier Gesprächsmotive aus Alkibiades-Dialogen anderer Sokratiker übernommen, aber den Namen Alkibiades verschwiegen, weil offenbar der Verkehr des Sokrates mit Alkibiades ein Hauptanklagepunkt des Polykrates gegen Sokrates war.36 Gaiser37, der Memorabilien 4, 2 gründlich interpretierte, stellte fest, dass sich Xenophon in diesem Kapitel teilweise an den Alkibiades des Aischines angeschlossen habe. Demnach wäre Memorabilien 4, 2 einer der Texte, mit deren Hilfe der Alkibiadesdes Aischines rekonstruiert werden könnte. Aber damit ist Erbses Vermutung, das Euthydemos-Gespräch spiele auf Xenophons eigene „Bekehrung“ an, nicht widerlegt. Denn es ist durchaus denkbar, dass sich Xenophon zur Stilisierung seiner eigenen „Bekehrung“ von einem Alkibiades eines anderen Autors hat anregen lassen.
Dass sich Xenophon an dieser Stelle der Memorabilien selbst ironisiert haben könnte, geht auch aus dem sich anschließenden Gespräch über die Bedeutung des apollinischen Gnvqji sauötoßn hervor (Memorabilien 4, 2, 24–30): „Sag mir, mein lieber Euthydemos, bist du schon einmal in Delphi gewesen?“ – „Ja, sogar schon zweimal, beim Zeus.“ – „Hast du denn irgendwo am Tempel die Inschrift ,Erkenne dich selbst‘ gesehen?“ – „Ja.“ – „Hast du dich denn nicht für die Inschrift interessiert oder hast du dich damit beschäftigt und versucht zu untersuchen, wer du denn eigentlich bist?“ – „Nein, beim Zeus, das allerdings nicht. Denn das glaubte ich ganz gut zu wissen. Ich wüsste ja wohl kaum etwas anderes, wenn ich mich selbst nicht kennen würde.“ – „Glaubst du denn, jemand würde sich selbst kennen, wenn er nur seinen eigenen Namen wüsste, oder vielmehr erst derjenige, der, wie die Pferdekäufer es machen, die ein Pferd, das sie kennen lernen wollen, nicht eher zu kennen glauben, als bis sie geprüft haben, ob es gehorsam oder ungehorsam, stark oder schwach, schnell oder langsam ist und was es sonst noch im Blick auf sein Potential als Pferd (pro?w th?n touq iÄppou xreißan) auszeichnet oder nicht, so auch sich selbst fragt, wie es mit seinem eigenen Potential als Mensch (pro?w th?n aönjrvpißnhn xreißan) aussieht, und seine Fähigkeiten, das heißt sein Wesen / seinen Charakter (dußnamiw), erkannt hat.“ – „So scheint es mir zu sein, dass derjenige der seine Fähigkeiten, das heißt sein Wesen / seinen Charakter, nicht kennt, sich selbst nicht kennt.“ – „Ist es demnach nicht klar, dass Menschen, wenn sie sich selbst kennen, die größten Vorteile haben, und wenn sie ein falsches Bild von sich haben, die größten Nachteile? Denn diejenigen, die sich selbst kennen, wissen, was für sie nützlich ist und durchschauen, was sie können und was sie nicht können. Denn sie tun, was sie verstehen und verschaffen sich dadurch alles, was sie brauchen, und es geht ihnen gut. Indem sie aber auf alles verzichten, wovon sie nichts verstehen, begehen sie keinen Fehler und vermeiden, dass es ihnen schlecht geht. Darum können sie auch die anderen Menschen einschätzen und sich durch das Potential der anderen (dia? thqw tvqn aällvn xreißaw) Vorteile verschaffen und Nachteile vermeiden. Diejenigen aber, die sich selbst nicht kennen und sich über ihr eigenes Wesen im unklaren sind, befinden sich den anderen Menschen und den anderen menschlichen Dingen gegenüber in einer ähnlichen Situation. Sie wissen nicht, was sie brauchen, was sie tun und womit sie sich gerade beschäftigen, sondern weil sie alle diese Dinge verfehlen, verlieren sie auch das Gute und setzen sich dem Schlechten aus. Denjenigen, die wissen, was sie tun, gelingt, womit sie sich beschäftigen, sie sind erfolgreich und anerkannt. Diejenigen, die ähnlich geartet sind, haben gern Umgang mit diesen. Die weniger Erfolgreichen wünschen sich deren Rat und Unterstützung. Sie erwarten von diesen, dass alles gut wird, und aus allen diesen Gründen lieben sie diese ganz besonders. Diejenigen aber, die nicht wissen, was sie tun sollen, die schlechte Entscheidungen treffen und denen misslingt, was sie versuchen, haben dadurch nicht nur große Nachteile, sondern geraten deshalb in Schande, werden ausgelacht und leben verachtet und ehrlos. Das siehst du auch an den Staaten: Diejenigen, die ihre Macht nicht richtig einschätzen und mit Stärkeren Krieg führen, werden entweder vernichtet oder versklavt.“ Darauf erwidert Euthydemos: „Du sollst es wissen, dass es mir jetzt vollständig klar ist und ich von der Notwendigkeit der Selbsterkenntnis überzeugt bin. Wo man aber mit der Selbstprüfung anfangen muss, darin schaue ich auf dich, ob du es mir wohl darlegen willst.“
An diesem Text ist eine Reihe typisch xenophontischer Topoi greifbar. Das Beispiel des Pferdekaufs signalisiert, dass Xenophon in ureigener Sache spricht, um die Selbsterkenntnis als die Voraussetzung für die richtige Einschätzung eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten zu definieren, mit denen man sich selbst und seinen Mitmenschen als nützlich erweisen kann – eben als ein „Euthydemos“.38
Auch an einer wichtigen Stelle in der Anabasis (2, 1, 12) verbirgt sich Xenophon hinter einem Pseudonym: Theopompos („der von Gott Gesandte“). Auf diesen Text sei hier etwas ausführlicher eingegangen, weil er ein sehr helles Licht auf den Charakter des jungen Xenophon wirft. Nach dem Tod des Kyros verging nur wenig Zeit, bis eine Delegation des Großkönigs und des Satrapen Tissaphernes vor dem Tor des griechischen Feldlagers erscheint, um die Kapitulation der griechischen Söldner zu verlangen. Zu dieser Delegation gehört auch ein Grieche: Phalinos aus Zakynthos, ein Berater des Tissaphernes.39 Die Unterhändler fordern die griechischen Feldherren auf, die Befehle des Großkönigs zu befolgen. Er sei der Sieger; denn er habe Kyros getötet. Die Griechen sollten unverzüglich ihre Waffen übergeben, um Schlimmeres zu vermeiden. Klearchos lehnt dies entschieden ab: Es sei nicht Sache des Siegers, seine Waffen auszuliefern. Proxenos ergänzt spöttisch, er wolle zuvor wissen, ob der Großkönig die Waffen als Siegesbeute oder als Geschenk unter Freunden betrachte. Phalinos erwidert im Auftrag des Artaxerxes:40„Der Großkönig ist zweifellos der Sieger, da er Kyros getötet hat. Wer könne ihm denn die Herrschaft streitig machen? Auch ihr seid jetzt sein Eigentum. Denn er hat euch mitten in seinem eigenen Land zwischen zwei Flüssen (Euphrat und Tigris), die man nicht überschreiten kann, in seiner Gewalt. Und er kann solche Massen von Menschen gegen euch in Marsch setzen, dass ihr diese, selbst wenn er euch die Gelegenheit dazu geben würde, niemals vernichten könntet.“
Zur allgemeinen Überraschung ergreift daraufhin ein gewisser Theopompos aus Athen alias Xenophon41 das Wort: „Phalinos, wie du siehst, besitzen wir im Augenblick nichts anderes als unsere Waffen und unsere Tapferkeit. Wenn wir unsere Waffen behalten, können wir mit Sicherheit unsere Tapferkeit beweisen.42 Wenn wir sie aber abliefern, müssen wir damit rechnen, unser Leben zu verlieren. Erwarte also nicht, dass wir euch unsere einzigen Güter kampflos überlassen. Mit diesen werden wir vielmehr sogar um euren Besitz kämpfen.“43
Diese selbstbewussten Worte – Xenophon zitiert sich hier selbst – passen zu der Initiative, die er einige Zeit später beweist, als er die Soldaten nach dem Verlust ihrer Führer aus ihrer Verzweiflung und Mutlosigkeit herausreißt und zum Handeln anspornt.44 Phalinos aber erwidert mit spöttischem Lächeln: „Du redest wirklich wie ein Philosoph, junger Mann, und du sagst hübsche Dinge, doch sei dir darüber im Klaren, dass du sehr unvernünftig bist, wenn du glaubst, eure Tapferkeit könne der Macht des Großkönigs überlegen sein.“45
Der Unterhändler besteht darauf, dass die griechischen Söldner ihre Waffen übergeben. Die Griechen weigern sich weiterhin. Aber der Großkönig scheint einlenken zu wollen und zu einem Waffenstillstandsvertrag bereit zu sein. Denn nach einiger Zeit trifft eine weitere persische Delegation ein, um die Verhandlungen zu beginnen.46
Erbse47 wies bereits darauf hin, dass man in mehreren Handschriften – vermutlich schon in der Antike – den vom Autor gewünschten Schluss gezogen und vermutet habe, dass der Athener Theopompos kein anderer als Xenophon selbst gewesen sei, der von Gott auf den Zug der Zehntausend geschickt und geleitet worden sei. Das wird auch dadurch wahrscheinlich gemacht, dass sich Xenophon von Anfang an unter göttlichen Schutz gestellt sieht, wie aus Anabasis 6, 1, 23 hervorgeht. Denn dort erzählt er, er habe, als er von Ephesos aus zu Kyros reiste, auf der rechten Seite einen schreienden Adler sitzen sehen. Der daraufhin um Rat gefragte Priester habe ihm eröffnet, das Zeichen bedeute Ruhm und hohe Stellung verbunden mit Mühe und Anstrengung (typisch xenophontisch: no pain, no gain).
Ein weiteres Beispiel für Xenophons literarische Selbstdarstellung: Münscher nahm im Anschluss an Schwartz an,48 Xenophon habe sich auch in dem armenischen Prinzen Tigranes (Kyrupädie 3, 1, 38–41) und seinem bewunderten Weisheitslehrer (Sokrates), selbst porträtiert, den der Vater (Athen) hinrichten ließ, weil er den Sohn „verderbe“ (diafjeißrei). Wenn Xenophon den weisen Lehrer vor seinem Tod zu Tigranes sagen lässt, er solle seinem Vater nicht grollen, da seine Tat nicht auf kakoßnoia, sondern auf aägnoia beruhe, dann spricht aus diesen Worten – nach Münscher – ein mit der Heimat versöhnter Xenophon, der den Athenern das Todesurteil gegen Sokrates anscheinend verziehen hat.
Gaiser (1977) bestätigt diese Übereinstimmung zwischen Sokrates und dem Weisheitslehrer der Kyrupädie. Er weist darauf hin, dass das Motiv des Verzeihens eine große Bedeutung für Xenophon hatte. Denn er habe damit nicht nur in den Auseinandersetzungen um den Tod des Sokrates zur Versöhnung aufrufen und Frieden stiften, sondern auch sein eigenes Verzeihen gegenüber Athen zum Ausdruck bringen wollen. Außerdem diene die Tigranes-Geschichte dem Zweck der Rehabilitierung des Autors als eines vorbildlichen und im politischen Streit vermittelnden Bürgers.
1.2 Anschauungen und Überzeugungen
Ein sprechendes Pseudonym – wie Theopompos – ist für Xenophon nicht nur ein Mittel diskreter Selbstdarstellung. Er bedient sich auch anderer Personen, um unter deren Namen seine Anschauungen und Überzeugungen mitzuteilen: Die Athener, die die wachsende Macht der Thebaner nicht mehr hinnehmen wollen, schicken eine Gesandtschaft nach Sparta, um den Lakedämoniern einen dauerhaften Frieden anzubieten (Hellenika 6, 3). Zuerst ergreift der prominente und wohlhabende Athener Kallias das Wort, der mit den Großen seiner Zeit – zum Beispiel mit Sokrates und vielen Sophisten – freundschaftlich verbunden war und in dessen Haus übrigens auch das xenophontische Symposion spielt: Es sei doch wohl eine Sache der Vernunft, bei kleineren Differenzen nicht gleich einen Krieg zu beginnen. Dann sei es doch kaum denkbar, dass man sich nicht auch friedlich einigen könnte. Mit einem mythologischen Friedenssymbol verleiht Kallias seinen Argumenten eine quasi-religiöse Weihe: Er erinnert an den athenischen Kulturbringer Triptolemos, durch den Demeter der Menschheit das Getreide schenkte und der bereits im frühen fünften Jahrhundert als Begründer der Landwirtschaft galt. Angesichts dessen sei ein Krieg geradezu ein Frevel an der göttlichen Gabe.
Es ist durchaus möglich, dass Xenophon bei der Formulierung dieser Hellenika-Stelle das zwischen 440 und 430 geschaffene Weihrelief aus Eleusis vor Augen hatte. Der Mythos von Demeter, Persephone und Triptolemos ist auch eine Versöhnungsgeschichte: Demeter versöhnt sich mit Hades und ist zufrieden damit, dass Persephone zwei Drittel des Jahres bei ihr sein darf. Die Mysterien sind eine Form der kollektiven Erinnerung, die den Menschen immer wieder bewusst macht, wie sie mit Hilfe gütiger Mächte aus einem primitiven Urzustand zu einer höheren Existenzform aufstiegen. Ovid verbildlicht in seinen Fasten (4, 393–416) diesen Aufstieg, indem er daran erinnert, dass die Menschen mit göttlicher Hilfe zu lernen begannen, die Erde zu kultivieren und ihr mit harter, aber friedlicher Arbeit wertvolle Nahrungsmittel abzuringen. Das Aufbrechen der Erde mit dem Pflug wird hier nicht als Frevel, sondern als Ursprungstat einer höheren Kulturstufe gedeutet, auf der der Mensch nicht vergessen darf, woher er kommt (und wohin er geht). Das ist der Sinn der wiederkehrenden religiösen Feier zu Ehren von Demeter / Ceres und Persephone / Proserpina, die den jungen, lernwilligen Triptolemos dazu ausersahen, den Segen der kulturschaffenden Tat auf der ganzen Erde zu verbreiten.
Kallias schließt mit Worten, die das Trauma des Peloponnesischen Krieges erkennen lassen: Wenn es wirklich ein göttliches Geschick sei, dass Kriege unter den Menschen entstünden, dann müsse man einen Krieg möglichst spät beginnen, d. h. nachdem man die Chancen der friedlichen Konfliktlösung vollständig ausgeschöpft habe, und möglichst schnell wieder beenden. Bemerkenswert bleibt, dass Xenophon, der Autor des Oikonomikos, mit der Erwähnung des Triptolemos-Mythos, wie er auf dem Eleusinischen Reliefstein abgebildet ist,49 multimedial für den Frieden wirbt.
Wenn Xenophon Kallias, den Experten für erfolgreiche Friedensverhandlungen (Hellenika 6, 3, 4), den Triptolemos-Mythos und die Eleusinischen Mysterien erwähnen lässt, bringt er zum Ausdruck, dass seine politische Überzeugung von der Notwendigkeit einer athenisch-spartanischen Verständigung auf dem Fundament des Glaubens an ein menschenfreundliches, friedfertiges und produktives Walten der göttlichen Mächte basiert, wie er es auch in den Gesprächen des Sokrates mit Aristodemos und Euthydemos veranschaulicht (Memorabilien 1, 4. 4, 2).
Nach den Worten des – xenophontischen – Kallias hält der rhetorisch versierte (eöpistrefh?w rÖhßtvr,Hellenika 6, 3, 7) Autokles eine spartakritische Rede, in der er den Spartanern vorhält, dass sie die Autonomie der griechischen Städte nicht respektierten.
Der dritte Redner der athenischen Gesandtschaft, Kallistratos, nimmt die vorwurfsvollen Worte seines Vorredners vorsichtig auf, indem er daran erinnert, dass in der Vergangenheit auf beiden Seiten Fehler gemacht worden seien. Dann jedoch tritt er energisch für eine Aussöhnung und ein Bündnis zwischen Athen und Sparta ein (Hellenika