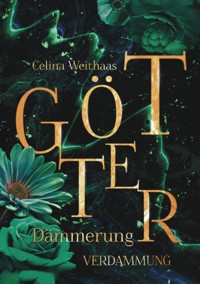2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Chroniken des Grauen Mannes
- Sprache: Deutsch
"Der arme Junge ist dir verfallen. Weiß er, dass du sein Todesurteil unterschreiben wirst?" Klickende Kameras. Vergessene Versprechen. Grausame Geheimnisse. Chrona springt in der Zeit und mit jeder Reise in eine andere Epoche, scheint ihr das eigene Leben mehr zu entgleiten. Um ihr perfektes Bild zu wahren, ist Chrona auf Hilfe angewiesen. Ausgerechnet der Graue Mann unterbreitet Chrona ein Angebot, das sie unmöglich ausschlagen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zehn Sekunden vor Mitternacht
© 2021 Celina Weithaas
2., vollständig überarbeitete Auflage 2021
Umschlaggestaltung und Design: Franziska Wirth
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-347-40009-2
ISBN e-Book: 978-3-347-40010-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die Chroniken des Grauen Mannes
Phase I:
Die Poison-Trilogie:
Dark Poison (Oktober 2018)
Cold Poison (Januar 2019)
Dead Poison (September 2019)
Die Jahreszeitentrilogie:
Spring (31. Dezember 2019)
Fall (31. Dezember 2020)
Winter (31. Dezember 2021)
Phase II:
Die Märchendilogie:
Erzähl mir Märchen (05. November 2019)
Märchen für Dich (01. Mai 2020)
Die Mitternachtstrilogie:
Fünf Minuten vor Mitternacht (02. September 2020)
Zehn Sekunden vor Mitternacht (21. April. 2021)
Vor Mitternacht (13. Oktober 2021)
Die Dämonentrilogie:
Fürchte mich nicht (21. April 2022)
Vergiss mich nicht (02. September 2022)
Verlass mich nicht (01. Mai 2023)
Die Götterdämmerungstrilogie:
Götterdämmerung - Verschwörung (05. November 2023)
Götterdämmerung - Verlockung (01. Mai 2024)
Götterdämmerung - Verdammung (02. September 2024)
Die Ich-Bin-Trilogie:
Ich bin Du (21. April 2025)
Du bist Ich (13. Oktober 2025)
Wer ich bin (21. April 2026)
Phase III:
Die Geschichte des Grauen Mannes:
Die Geschichte des Grauen Mannes oder Komm mit mir nach Gestern (02. September 2026)
Chronicles of Kings and Queens:
Blutzoll (01. Mai 2027)
Blutangst (05. November 2027)
Blutrache (01. Mai 2028)
Blutdurst (02. September 2028)
Blutmond (21. April 2029)
Blut-Matt (13. Oktober 2029)
Phase IV:
Die Foscor-Trilogie:
Laufe (31. Dezember 2027)
Bleibe (31. Dezember 2028)
Vergesse (31. Dezember 2029)
Erinnere (31. Dezember 2030)
Verdamme (31. Dezember 2031)
Erwache (31. Dezember 2032)
Phase V:
Die Trilogie von Gottes Tod:
Von verblühender Unschuld (21. April 2030)
Von leidendem Verrat (02. September 2030)
Von verzweifelter Liebe (01. Mai. 2031)
Die Ewigkeitsdilogie:
Endlicher Triumph (13. Oktober 2031)
Triumphale Ewigkeit (01. Januar 2032)
Das Ende:
Nun, da es das Ende ist (31. Dezember 2032)
Für unsere schwächsten Momente. Für unsere stärksten Entscheidungen. Ohne euch wären wir nicht die, die wir heute sind.
1
Anton hat sich mit dem Rücken an die kühle Mauer des Klostergartens gelehnt, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, während er mit geschlossenen Augen in der Sonne badet. Braune Strähnen fallen ihm in die Stirn. Für ihn ist es mein vierter Besuch. Vier Tage. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich auf unser Widersehen hinfiebere. Nacht für Nacht. Wie sehr ich mich zwischen tristen Studienmomenten und Episoden, in denen ich Achim vermisse, nach Anton sehne.
Dabei treten wir, in gewisser Weise, auf der Stelle. Ich habe ihm zwar einige Wörterbücher beschaffen lassen, die er erstaunlich ambitioniert durchgearbeitet hat in den neun Monaten, die für ihn vergangen sind, seit unserem Widersehen – seit seinem Tod –, trotzdem sind wir nicht einen Schritt weiter.
Ich benötige eine einzige Kleinigkeit von Anton und das ist die gleiche Kleinigkeit, die nutzlos um meinen Hals baumelt. Unser Kernproblem? Bis vor vier Besuchen wusste Anton weder, dass er ein Alchemist ist, noch, dass er die Fähigkeit besitzt, eine Substanz zu brauen, die mich vor den unwillkommenen Zeitreisen bewahrt. Bis vor neun Monaten, die in meinen vier Tagen für ihn vergangen sind, konnte er sich weder Zeitreisen vorstellen noch das Brauen von übernatürlichen Mixturen.
Als ich das erste Mal – für Anton das erste Mal – vor Antons Tür stand, hat er eine lange Zeit damit verbracht, beunruhigend offensichtlich darüber zu grübeln, wie groß die Strafe wäre, fände man eine waschechte Hexe in seinem Haus. Es hat mich Ewigkeiten gekostet, ihm zu erklären, dass ich keine Hexe bin und wir einander kennen. Nicht nur kennen. Dass er mich mag. Sehr. Und dass ich nicht zu ihm gekommen bin, um ihm Probleme zu bereiten.
Obwohl „erklären“ für diese absurde Situation vor seiner Tür deutlich zu hochgegriffen ist. Noch nie habe ich mich auf ähnliche Weise erniedrigt wie an diesen ersten zwei Aufeinandertreffen, bei denen ich versuchte, mich mit Händen, Füßen und Grimassen verständlich zu machen – in kaum mehr als der Hälfte der Fälle erfolgreich. Alles, was ich durch meine verzweifelten Kommunikationsbemühungen erreichte, war ein Anton, der zwischen Amüsement und Verzweiflung schwankte. Ähnlich wie ich. Mein frühneuzeitliches Deutsch ist katastrophal, sein Englisch bruchstückhaft und veraltet.
Die Wörterbücher haben uns geholfen. Dass Anton sie lesen konnte, grenzte an das erste Wunder. Das zweite war, dass meine Zimmermädchen ein Exemplar auftreiben konnten, das Mittelhochdeutsch in halbwegs modernes Englisch übersetzt. Ohne Antons Ambitionen meine Sprache zu lernen, wäre jede Hoffnung verloren gewesen. Nun haben wir uns zumindest eine Grundlage geschaffen, um zu streiten. Eine Beschäftigung, der wir nachgehen, wann immer wir nicht schweigen.
Seine Faszination mir gegenüber ist nach dem dritten Besuch abgeebbt. Er sei genervt von meinem verwöhnten Anspruchsdenken, sagte er. Anton benötigte mehrere Anläufe, damit ich überhaupt verstand, worauf er hinauswollte. Anton hatte einen Begriff für „verwöhnt“ genutzt, den ich bis dato nie gehört habe – vergenussmauseln – und Anspruchsdenken mit ansprechend Denken verwechselt. Aber er bemüht sich. Und ich tue es ebenso. Sowohl in Antons Epoche als auch in dem niveaulosen College, in dessen Gemäuern nicht nur langweilende Vorlesungen stattfinden, sondern auch, wann immer ich mein Zimmer betrete, ein Mädchen auf mich wartet, das eine schärfere Zunge hat, als gut für es ist.
Meine Zimmergenossin, die in erster Linie nützlich ist, um gähnend meine Hausaufgaben binnen von wenigen Stunden zu erledigen mit der nüchternen Bitte, ich solle sie mir durchlesen, falls der Professor von mir verlangen sollte, näher auf eines der Themen einzugehen.
Müsste ich wählen, ich würde die stinkenden Straßen aus Antons Zeit dem lebendigen College immer vorziehen. Weil hier jemand auf mich wartet, der mir nicht völlig egal ist. „Wie lange beliebt Ihr noch zu bleiben?“ Anton fährt sich durch das dunkle Haar. War es noch vor vier Besuchen perfekt geschnitten, gleicht es nun einem kleinen Chaos, das nur ein anständiger Friseur bezwingen kann. Einzelne Strähnen fallen Anton in die Augen und seine Frisur ähnelt eher einer geschmacklosen Mütze als einem tatsächlichen Schnitt.
„Wir haben uns auf das Du geeinigt gehabt.“ Ich verlagere das Gewicht auf den anderen Fuß. Es wäre ratsam eine Decke mitzunehmen, damit ich nicht viele Stunden meiner Nacht stehend verbringen muss.
Anton rollt gelangweilt die Augen. „Warum erlerne ich deine Sprech und du nicht meins?“ Der Nachteil an Wörterbüchern? Sie vermitteln die Grammatik kaum. Ich habe ihm dafür ein weiteres Nachschlagewerk geschenkt, gestern, aus Antons Sicht vor fast drei Monaten. Er hat mich mit einem Blick bedacht, so ungläubig, dass ich kurz mit dem Gedanken spielte, mich für mein Verhalten zu schämen.
„Warum du meine Sprache lernen sollst?“, vergewissere ich mich. Er nickt. „Weil mein Leben mir bereits genug Anforderungen stellt. Noch mehr Problematiken benötige ich nicht.“
Vor allem seit der Gala, auf der ich hätte anwesend sein sollen. Gestern Nacht fand die Nacht der Nächte statt. Die Königin aller Abende und die begehrteste Veranstaltung, die man sich ausmalen kann, im Herzen meines Landes. Frauen werden zu Damen und der ordinärste Herr zum Gentleman und sei es nur, um mit den bekanntesten und reichsten Personen der Welt zu konversieren.
Diese Gala ist ein Pflichttermin für jeden, der einen Ruf zu verlieren hat. Es sei denn, die Eltern sind fest davon überzeugt, dass ein Auftauchen auf dieser Veranstaltung weit verwerflicher wäre als das Fernbleiben.
Während sich die großen Köpfe meiner Zeit also trafen, habe ich mit Adriana und Casper Scrabble gespielt und auf Mitternacht gewartet. Die Quittung fand sich auf der Titelseite einer jeden Zeitung. Die Schlagzeilen haben mich schier überrollt.
„Trennungsschock – Warum Achim und Chrona getrennt sind.“
„Nacht der Wahrheit. Das Ende einer märchenhaften Beziehung“
„Chrona E.J.H. Clark erscheint nicht zum alljährlichen Festakt – Sind ihr ihre Fehltritte auf die Füße gefallen?“
„Achim Jameson legt den Arm um eine andere Frau!“
„Die Prinzessin der Börse ist nicht länger relevant“
„Die Trennung des Jahres – Nur hier gibt es die aktuellsten News!“ Diese letzte Schlagzeile hat mich tatsächlich dazu bewegt, mich hektisch durch den Artikel zu klicken. Natürlich ist mir überbewusst, dass weder Achim noch meine Eltern Informationen an die Presse kommen lassen würden, die meinem Ruf und damit auch ihrem schadet. Trotzdem war dort dieses eisige, krampfende Gefühl im Magen, das mir die Kehle zugeschnürt hat und mich angstvoll die Zeilen überfliegen ließ.
Letzten Endes wurde viel Aufheben darum gemacht, dass man Achim und mich das letzte Mal gemeinsam an meinem Geburtstag gesehen habe, obwohl sich danach einige Gelegenheiten für einen gemeinsamen Auftritt geboten hätten. Dass man Achim und mich nicht bei jeder Veranstaltung Seite an Seite sieht, das ist nichts Neues. So auch die schwachsinnige, reißerische Autorin, die letzten Endes nichts als ihre eigene Dummheit verriet.
Meine Hände haben dennoch gezittert, bis Adriana gegen die offene Zimmertür hämmerte. „In zehn Minuten sollten wir auf unseren Plätzen sitzen. Der Trottel wartet nicht gerne.“ Sie hatte mir ein keckes Grinsen zugeworfen und sich hollywoodreif am Türrahmen gerekelt. Ich hasse sie dafür, wie ihr Haar sich in makellosen Wellen über ihren Körper legt, bis hin zur Taille, in einem einzigen, atemberaubenden Fluss, golden schimmernd im frühen Tageslicht.
Anstatt einer Antwort griff ich nach dem Buch, das mir meine Zimmermädchen gebracht haben, und meinem iPad für die Notizen, aus denen Adriana meine Hausaufgabe schreiben wird. Meine Semesterarbeit. Adriana nimmt diese Bezeichnung nicht allzu ernst. Gut für mich.
„Du siehst wirklich ziemlich fertig aus. Hast du schlecht geschlafen?“, fragte Adriana mich. Ich schlafe nicht schlecht, sondern kurz. Mit dieser offensichtlichen Information belästigte ich Adriana nicht, sondern bedachte sie lediglich mit einem skeptischen Blick.
„Ich wüsste nicht, was dich das anginge.“
Adriana quittierte meine Aussage mit einem Schnauben. Tatsächlich ist das ihre häufigste Reaktion auf mich. Entweder sie verdreht die Augen oder schnaubt wie ein Pferd. Anstatt mich weiter mit Fragen zu löchern, auf die ich ohnehin nicht antworten würde, griff sie ungefragt nach meinem iPad und scrollte durch den Artikel.
„Darüber machst du dir Sorgen?“, fragte Adriana mich irgendwann ungläubig. „Die hat nicht einmal die Rechtschreibregeln drauf.“
„Diese Zeitung ist nicht allzu populär.“ Nicht, dass das eine Entschuldigung wäre.
Adriana rollte die Augen. „Selbst wenn sie wüsste, was in deinem Leben abgeht. Warum so panisch? Leute wie du können nicht gut mit der Wahrheit umgehen, oder?“ Das ist Schwachsinn und das sollte Adriana wissen. Die Arbeit meiner Eltern, das Studieren von Zahlen und Kursen, besteht aus nichts als Wahrheit und Berechnung, Statistik und Möglichkeit. Die Wahrheit ist mein Beruf. Nicht, dass Adriana das verstehen würde.
Oder Anton, der mich lediglich abschätzig mustert, als wäre ich Ungeziefer, das man sich von der Sohle kratzen muss. Das ist ein neuer Ausdruck an ihm. Das erste Mal habe ich diesen leichten Ekel in seinem Gesicht gesehen, als ich wenige Stunden zuvor vor Antons Tür aufgetaucht bin. Anton ist ein anderer Mann als der, den ich kennengelernt habe, als ich das erste Mal – für mich das erste Mal – vor seinem Haus aufgetaucht bin.
Als Anton mich – aus seiner Sicht – das erste Mal empfangen hat, habe ich das kleine Häuschen kaum wiedererkannt. Die Decke war stabil und mehrere Öllampen waren im Raum angebracht worden. Nicht, dass man sie bräuchte. Anstelle des Lochs war ein Fenster in die Wand eingelassen. Der kleine Innenraum war hell und gemütlich. Der Tisch schien frisch geschreinert und eine dampfende Tasse Tee stand dort. Bei meinem nächsten Besuch war von dieser schönen Wärme nichts mehr zu erahnen. Auf meine Frage, was geschehen sei, murmelte Anton nur haareraufend von Steuern und dem verdammten Fürsten.
Bei diesem ersten Besuch stand ein Bett in Antons Wohnraum, direkt neben dem Tisch, sogar ein kleiner, uriger Herd, den man heizt, indem man ein Feuer darunter legt.
Ich will es mir kaum eingestehen, aber ich habe mich wohlgefühlt. Dort, in seinem winzigen Haus. Zwischen seinem gemachten Bett und diesem Tisch. Mit der dampfenden Tasse Tee und dem hellen Sonnenlicht, das durch das Fenster fiel.
Heute bei meinem vierten Besuch – dem vierten Besuch seit Antons Tod – war der Wohnraum wie umgekrempelt oder, einfacher gesagt, wie ich ihn kenne. Leer mit einer kleinen Feuerstelle. Der Tisch steht in der winzigen Kammer daneben und dient dem Forschen und Sezieren. Anton hat über keine dieser Veränderungen ein Wort verloren. Nur seine Laune ist merklich gesunken. Wenn er die Mundwinkel noch etwas weiter nach unten zieht, dann hängen sie am Boden.
„Was kann du Probleme haben? Du machst welche.“ Abschätzig mustert er mich. Ich stelle mich meinen Problemen augenblicklich. Anton das zu erklären, wäre verschwendete Zeit.
„Ich habe dich um einiges eloquenter in Erinnerung. Wo ist dein Charme geblieben?“, frage ich Anton ruhig und lasse die Fingerspitzen über die kleine Mauer wandern. Moos schmiegt sich gegen meine Haut, haucht federleichte Küsse darauf. Das genieße ich am meisten an diesen Ausflügen: die frische Luft. Und obwohl ich hin und wieder das Donnern von Geschossen im Hintergrund erahnen kann, schaffen diese Unruhen es doch nicht, meinen Vorhang aus Entspannung zu zerreißen. Des Nachts schlafe ich nicht, des Nachts träume ich. Von einem Verlobten, der mich ebenso liebt wie ich ihn, Eltern, die mir meine kleinen Fehltritte – ein einziges Mal, nur ein einziges Mal – vergeben. Ich träume von einer Möglichkeit, dass diese Zeitreisen aufhören.
Ich sehne mich zurück in mein Leben vor dem ersten Zeitsprung. Zurück in Luxus und die Sicherheit der Zahlen und der menschlichen Psyche. Stattdessen zupfe ich ein Stück Moos von der Mauer und mache mir damit die Finger schmutzig.
„Beim Fürsten“, murrt Anton und fährt sich erneut durch das zerzauste Haar. Auf eine absurde Art steht es ihm. Es vervollständigt das Bild von dem verrückten Wissenschaftler. Ähnlich wie die Abendgarderobe mich ausmacht und zur Prinzessin über die Börse erhebt.
„Möchtest du mir davon erzählen?“ Eigentlich interessieren mich Antons Differenzen mit dem Fürsten nicht wirklich. Bevor ich vor vier Tagen hierhergekommen bin, haben mich Schuldgefühle überrollt wie ein Tsunami. Hätte ich Anton retten können? Irgendetwas unternehmen können? Inzwischen ist diese Dauerschleife von Selbstverfluchen und Vorwürfen verschwunden, ständig unterlegt von einer melancholischen, leicht verliebten Verzweiflung.
Meine kurze Verliebtheit in Anton hat sich mit seinen unangebrachten Sticheleien verflüchtigt. Ich nehme an, weil das hier nicht der Anton ist, den ich kenne, sondern ein fremder Junge, der sich nicht einmal anständig artikulieren kann. Mit Menschen wie ihm umgebe ich mich für gewöhnlich nicht und diese Ehre, dass ich es doch tue, weiß er nicht zu schätzen. Anton verhält sich wie ein Bauerntölpel, der meint, Alchemist werden zu können.
Über diese neuen Entwicklungen beschwere ich mich nicht. Der Beweis, dass Anton eines Tages zu diesem brillanten Mann werden wird, für den ich geschwärmt habe, hängt um meinen Hals und schmiegt sich gegen die kleine Kuhle über dem Schlüsselbein. Ich versuche, Anton so viel Selbstvertrauen wie möglich zu geben, um endlich diese Mixtur zu erhalten. Dieses Mittel, das mich davor bewahrt, aus meiner kleinen, zerfallenden Welt gerissen zu werden. Bedauerlicherweise lässt Anton sich Zeit. Sehr viel Zeit. „Nein.“ Seine Lider bleiben geschlossen. Mit schmalen Augen betrachte ich Anton, das dichte, braune Haar, den schönen Mund mit diesen unglaublichen Lippen, die erschreckend gut küssen können, die Arme, die viel stärker sind, als ich mir erklären kann. Es ist lächerlich, aber seine gerade Nase hat es mir am meisten angetan. Ich kann nicht sagen, warum. Im Endeffekt sind meine Schwärmereien ohnehin unwichtig. Anton ist ein Bauerntölpel des siebzehnten Jahrhunderts, dem ich eines Tages etwas bedeuten werde. Ich weiß nicht, ob ich auf den Tag hoffen soll, an dem sich Antons Haltung mir gegenüber ändert. An dem er mich mit anderen Augen betrachtet und mich wieder bei sich wissen will. Seine Gefühle für mich würden so viel verkomplizieren. Meine verkorkste Verlobung, Antons und mein Beisammensein in dieser Zeit. Meinen Wunsch nie mehr hierher zurückzukehren.
„Warum nicht?“ Wenn nicht einmal mehr Anton mit mir sprechen will, bin ich wohl ganz allein. Anton zuckt nur die Achseln, die Knöchel übereinandergeschlagen. Ich bewundere Anton für seine wütende Gelassenheit. Teils wirkt er wie ein sorgloser Junge, teils wie ein angespannter Schlägertyp, der am liebsten seine Faust in irgendjemandes Gesicht rammen würde. Nicht, dass Anton je Anstalten gemacht hätte, die Hand gegen mich oder irgendwen sonst zu erheben. Das ist nicht Antons Art. Und dafür schätze ich ihn. „Als ich dich zuvor getroffen habe, warst du um einiges gesprächiger“, merke ich an. Anton murmelt in seiner Sprache undeutlich vor sich hin.
Seufzend schließe ich die Augen und atme einfach nur ein. Die Luft um uns herum ist seltsam weich, wie die schüchternen Pfoten einer Katze, und versetzt mit dem Duft von allen möglichen Kräutern, von denen ich keine zwei benennen kann. Für gewöhnlich halte ich mich in wohlklimatisierten, nach Zitrusfrüchten oder Blumen duftenden Räumen auf, immer leicht versetzt mit dem Geruch von Wein und frisch zubereitetem Essen. Der Klostergarten des siebzehnten Jahrhunderts ist eine willkommene Abwechslung. Würde man hinter diesen Mauern mehr auf die Hygiene achten, ich würde mich tatsächlich wohl fühlen. So aber? Komme ich nicht umhin, die Erde unter meinen Fingerspitzen zu spüren, und mich zu fragen, was alles schon darüber gekrochen ist.
„Du sein lange hier schon“, stellt Anton fest. Durch meine langen Wimpern sehe ich zu ihm hinab. Ich versuche ihn einzuschätzen. Unmöglich. Antons Gesicht ist völlig entspannt. Gänzlich neutral. Ist er verärgert? Freut er sich über meine Gesellschaft? Bin ich ihm völlig egal?
„In ein paar Minuten werde ich wieder in meinem Bett liegen“, erwidere ich. Erschöpft blinzle ich in die Sonne. Mein neuer Tagesrhythmus ist ungesund. Früh um neun beginnt die erste Vorlesung, zu der Adriana mich Tag ein, Tag aus pflichtbewusst schleift. „Wissen schadet nie“, pflegt sie zu sagen, ganz gleich wie tief meine Augenringe sind. Zeit für einen Mittagsschlaf gibt es nicht. Während meine Zimmermädchen sich darum bemühen, meinen Kreislauf um die Mittagszeit herum mit Massagen, Maniküren und wohlriechender Körperlotion in Schwung zu halten, studiere ich die Kurse, schreibe meinen Eltern meine Prognosen und warte auf Antwort.
Nachmittags erwartet man von mir, dass ich mich unter das Volk mische und leichte Konversation mit Menschen halte, die nicht weiter denken, als bis zur nächsten Prüfung und auch nur diese Prüfungen im Sinn haben. Am Abend dann lasse ich mich zurechtmachen für das Schlafengehen, warte auf den Sprung in die Vergangenheit, verbringe bei Anton einige Stunden und bin frühestens gegen zwei Uhr morgens wieder in meinem Bett.
Seit vier Tagen geht das so. Es fühlt sich an wie eine unüberbrückbare Ewigkeit. Der Gedanke an die kommenden organisatorischen Schritte – meine Hochzeit, die Vorbereitung auf die Prüfungen, die Planung mehrerer Dinner, den selbstständigen An- und Verkauf von vielversprechenden Aktien – lässt mich auch in Antons Jahrhundert eine Massage wünschen. Meine Muskeln haben sich bereits vor einigen Tagen in unnachgiebigen Stahl verwandelt. Mit einer hohen Erwartungshaltung habe ich früh gelernt umzugehen. Aber Stress dieser Art? Unberechenbarer, womöglich mörderischer Stress? Er lässt mich wie ein kleines, hilfloses Kind fühlen, das mit verbundenen Augen versteckte Süßigkeiten im Minenfeld sucht. Sich der Gefahr bewusst, sich der Gefahr unbewusst.
„Müde siehst du aus.“ Anton hat die Augen endlich geöffnet und betrachtet mich mit schiefgelegtem Kopf. Auf seinen Wangen hat sich eine leichte Röte ausgebreitet. Ich schiebe sie auf die Sonne und nicht auf meine Anwesenheit. Er liegt schon viel zu lange hier, die Arme entspannt unter dem Kopf verschränkt.
„Das bin ich“, antworte ich ehrlich. „In letzter Zeit fehlt mir die Ruhe.“
„Warum?“ Er versucht ein ernsthaftes Gespräch zu beginnen? Die Stille scheint nicht nur für mich unerträglich zu sein. Wenn ich zurückdenke an unsere Wortgefechte, von denen ich nie auch nur eines gewonnen habe, kommt mir dieser Moment vor, als säße ich mit einem anderen Menschen in diesem Garten. Jemandem, der sich eigentlich gar nicht für mich interessiert. Dieses eine, kleine Wort, dieses Warum, beweist das Gegenteil und nimmt mir aus unerfindlichen Gründen eine kleine Last vom Herzen.
„Ich gehe aufs College. Und bin des Nachts hier.“ Ein Kloß bildet sich in meinem Hals, während ich Antons intensivem Blick ausweiche. „Und habe eine nervtötende Zimmerkameradin, die es vorzieht, ihre Zeit gemeinsam mit ihrem Freund in meinem Zimmer zu verbringen. Wenn ich an all die Termine denke, die in Zukunft auf mich zukommen, die Hochzeit, ein Abendessen mit Monsieur Depót, dann kommt es mir vor, als wüchse mir alles über den Kopf.“ Anton verzieht leicht den Mund. Ob ihn das, was ich ihm anvertraut habe, interessiert? Unmöglich einzuschätzen. Seine Augen sind wieder geschlossen, die Hände weiterhin hinter dem Kopf verschränkt. Schweigen.
Ich sollte ein neues Thema anschneiden, stattdessen lausche ich dem Klang der Insektenflügel. Bienen haben sich in den kelchförmigen Blüten einer blauen Blume niedergelassen, recken den gelb-schwarz gestreiften Po in die Höhe, die Flügel immer fleißig arbeitend. Sie erinnern mich an den Kolibri, den eine tschechische Kollegin bei sich zuhause hält. Wenn er aus einem Blütenkelch trinkt, schlagen die Flügel so schnell, dass sie zu einem grünlichen Regenbogen verschwimmen.
„Seist dich aufgeregt?“
Ich brauche kurz, um hinter die Bedeutung zu kommen. Ob ich aufgeregt bin?
„Weswegen sollte ich?“
„Die Hochzeit.“
Ich rümpfe die Nase. Oh ja, das Event des Jahrzehnts. Mutter hat mir die Gästeliste noch nicht vorgestellt, aber es wäre eine Beleidigung, wenn weniger als fünfhundert Menschen erscheinen. Alle, um mir und meinem Glück zuzujubeln.
Resigniert presse ich die Lippen aufeinander. Welchem Glück?
Es sollte unmöglich sein, aber Achim ist es gelungen: Er hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen mit nur einem einzigen, kleinen Satz. Wir werden uns mit dem Ehebund nicht häufiger sehen.
Für viele Mädchen mag die Hochzeit eine aufregende Herzensangelegenheit sein. Endlich bindet man den Mann an sich, ohne den man sich das Leben nicht mehr ausmalen will! Für mich war die Hochzeit nie romantisch ausgeleuchtet. Lediglich ein Freischein, um mehr Zeit mit Achim verbringen zu dürfen. Ich stehe im Fokus, die ganze Zeit über, und für gewöhnlich liebe ich an meinem Leben nichts mehr als diese Aufmerksamkeit. Als das Blitzlichtgewitter, die begeisterten Rufe. Der ein oder andere fällt vor Begeisterung in Ohnmacht, wenn ich vorbeischreite. Kameras sind ein Segen. Sie verkaufen und sie vermarkten. Nur für die Liebe scheinen sie eher eine Rezession zu sein als eine Expansion. Die Kameras lassen Liebe einfach nicht zu, ersticken sie wie ein kleines Pflänzchen im Keim.
Die Kameras, allgegenwärtig, sind der Grund dafür, dass Achim und ich uns selten sehen, selbstverständlich neben unseren öffentlichen Verpflichtungen. Eine falsch gelegte Hand reicht für die falschen Gerüchte. Plötzlich bin ich vor der Ehe schwanger, weil seine Finger über meinem Bauch ruhten, oder Achim anstandslos, weil die Hand etwas zu weit in Richtung meines Pos gerutscht ist. Jeder öffentliche Auftritt wird detailliert durchgegangen. Wie begegnen wir uns, wird ein Kuss folgen? Wie lang sollte der dauern?
Und genau wie wir unsere Liebe mühevoll inszenieren, tun wir es auch mit der Hochzeit. Sie wird kein Beweis ewiger Treue sein, sondern eine vertraglich fundierte Zusammenarbeit. Immerhin, ich werde das atemberaubendste
Kleid tragen, das je gesehen wurde. Achim und ich werden das strahlendste Paar sein und keine Zeitung wird es wagen, uns für diesen Tag nicht perfekt wirken zu lassen. Denn genau das werden wir sein und kein bisschen weniger. Wenn wir vor den Altar treten, wird niemand uns mehr als Rohdiamanten bezeichnen können. Geschliffener als unser Verhalten, unser Auftreten, existiert nichts auf der ganzen, weiten Welt.
„Sie wird pompös“, antworte ich knapp.
„Und das Herz?“ Das Herz? Ungläubig sehe ich Anton an. Er erwidert meinen Blick nicht. Ich habe Anton als niemanden kennengelernt, der die Zeit damit verbringt, über Gefühle zu sprechen. Die Forschung steht an erster Stelle.
„Die Menschen werden sich freuen“, sage ich eisig. „Die Vermählung wird live übertragen in Hundertzwanzig Ländern. Wir erwarten, dass sich noch einige mehr Rechte einholen werden. Es ist der Abschluss und Neubeginn einer unglaublich romantischen Geschichte.“ Die unter anderem beinhaltet, dass wir die meiste Zeit getrennt voneinander verbringen werden, kaum dass der Ehering an meinem Finger steckt. Nicht, dass das etwas Neues wäre.
Am Dienstag besuchten Achim und meine Eltern mich an diesem College. Im Ballsaal des altehrwürdigen, in den Armen des Efeus ruhenden Hauses, haben wir das abgewickelt, wovor ich mich am meisten fürchtete.
„Warum haltet ihr es für richtig, dass Achim und ich wenig Zeit miteinander verbringen?“, habe ich gefragt gehabt. Mutter hatte leise gelacht und die Hände um das Weinglas gelegt.
„Die Antwort steht dir ins Gesicht geschrieben“, sagte sie. „Eine erfolgreiche Ehe basiert niemals auf Liebe.“ Und egal wie ich diskutierte, argumentierte und konversierte, nicht ein Punkt in dem Ehevertrag wurde geändert. Ich habe meinen Eltern garantiert, dass ich diesen Vertrag beizeiten unterzeichnen werde. Und das war es. Danach hatten Achim und ich noch vier jämmerliche Minuten für uns. Das war genau die Zeitpanne, die benötigt wurde, um den Wagen vorzufahren.
„Wie geht es dir damit?“, hatte Achim mich allen Ernstes gefragt.
Ich zuckte die Schultern. „Das gleiche könnte ich dich fragen.“
„Es ist das Vernünftigste.“ Achim raufte sich das Haar und brachte die perfekte Frisur durcheinander. Das ist sein einziger Makel. Man weiß, dass ihn etwas bewegt, wenn die Frisur ruiniert ist. Abgekaute Fingernägel und aufgekratzte Hände gibt es bei ihm nicht.
„Verlange ich zu viel, wenn ich dich um einen Kuss bitte?“, habe ich Achim gefragt gehabt. Ein leises Lächeln umspielte seine Lippen und ließ mein Herz summen. Niemand lässt mich so aufgeregt und kribbelig fühlen wie Achim.
Er antwortete mir nicht, hauchte mir nur einen Kuss auf die Wange, der viel zu zart erschien. Viel zu warm, viel zu wertvoll.
„Pass auf dich auf, Liebste. Ich könnte es nicht ertragen, dich irgendwo zu verlieren. Oder irgendwann.“ Dabei ist er es doch, der sein Bestes tut, um mich fernzuhalten. Ich sagte Achim nicht, dass ich ihn liebe. Über solche Geständnisse freut man sich nicht. Nicht dort, wo ich zu Hause bin.
Der Chauffeur räusperte sich, als ich die Arme um Achims Hals schlang und das Gesicht an seiner Schulter vergrub. Wenn ich bei ihm bin und mir vorgaukeln kann, dass alles gut ist, kein Ehevertrag zwischen uns steht, dann verschwende ich keinen Gedanken an Anton. Egal wie intensiv und tief Anton mich fühlen lässt, Achim ist realer, greifbarer. Er ist mein künftiger Ehemann.
„Du es bedauerst.“
Pardon? Ich ziehe die Augenbrauen nach oben. „Wohl kaum.
Es gibt nichts Wertvolleres als eine geliebte Show.“
Anton schnaubt abfällig und verschränkt die Arme vor der Brust. Er wirkt abweisender, als ich ihn je erlebt habe. „Klingt traurig.“
Ich wünschte, mir würden die richtigen Worte einfallen. Ich will diese aufgesetzte Tragik meines aufgesetzten Lebens bestreiten, aber alles, was ich sagen könnte, klänge wie eine erbärmliche Entschuldigung. Und jemand wie ich bittet nicht um Verzeihung oder Verständnis. Jemand wie ich gewährt beides.
Kopfschüttelnd kommt Anton auf die Füße und bietet mir seine Hand an. „Spazieren?“ Womöglich sollten wir uns auf Einwortsätze einigen. Da kann grammatikalisch wenig schiefgehen. Mein Herz stolpert. Ich halte meine Miene starr. Ich hebe die Schultern und lasse den Blick durch den blühenden Garten schweifen. Die Äste der Bäume biegen sich unter den Früchten, die bald bereit für die Ernte sind. Ungeziefer summt und sirrt über die Pflanzen, die sich wie ein buntes Mosaik über den Boden legen und trister, brauner Erde einen Ausdruck von Lebensfreude geben. Die schmalen Wege durchschneiden die Beete penetrant und führen zu dem kleinen, in die Mauern eingelassenen Tor, auf das Anton deutet.
Raus, auf die Straßen. Ich werde sie nie wieder ohne die Toten sehen können, die an den Wänden lehnten, die skelettartigen Hände flehend ausgestreckt. Sobald ich das Pflaster an Antons Seite betrete, ist es mir unmöglich, ihn als den Jungen zu sehen, der mir hier seine Hand anbietet. Dort, auf dieser Straße, da hungert Anton, sieht mich aus Augen an, viel zu groß für das hohlwangige Gesicht und ohne jede Hoffnung, dass es besser werden könnte.
Er habe gekämpft, sagte Anton mir damals. Mit allem was er habe. Und das ganze Fürstentum hat gnadenlos verloren in einem Krieg, der sich über Jahrzehnte zog und nichts zurückließ als Asche, Tod, Verderben.
Trotz allem, trotz der finsteren, viel zu frischen Erinnerungen, mache ich Anstalten, seine Hand zu ergreifen. Wie ich Anton kenne, würde er andererseits den Garten ohne mich verlassen. Es ist seltsam, wie eine Berührung gleichzeitig so vertraut und doch fremd sein kann. Anton wirft mir ein Lächeln zu, das mir nicht bekannter sein könnte.
„Wohin dich willst?“
„Du“, verbessere ich ihn leise. Anton verzieht den Mund. Ich seufze. „Irgendwohin, wo es dir gefällt.“ Seine warmen Augen funkeln. Ich lasse mich von ihm mitziehen. Dabei sollte ich es sein, die die Menschen führt.
2
Als wir aus den schmalen Gassen heraustreten, erstarre ich mitten in der Bewegung. Die Terrasse. Das Bild, das für mich nur vier Tage zurückliegt, für Anton noch in die Zukunft geschrieben steht, brennt sich in meinen Geist. Ich starre hinunter auf das von Heide überzogene Tal, als wäre es der offene Schlund einer Schlange. Violette und grüne Gewächse ziehen sich in einem dichten Teppich über die sich leicht wellende Ebene, zittern im Wind und ahmen die sich kräuselnde See nach. Nichts davon hat etwas Grausames, Erschreckendes an sich.
Aber wie schön die Aussicht auch sein mag, ich komm nicht umhin ein tobendes, blutendes Meer zu sehen, matt schimmernd und stinkend im Sonnenschein. Auch dort zitterte die Oberfläche, als hielte man ein scharlachrotes Tuch in den Wind. Ich erinnere mich an die Perfektion dieser grausigen Bemalung. In dunklen Bächen griff das klebrige Rot nach den Hügeln und benetzte sie. Das Blut erstreckte sich, soweit das Auge reicht. Fast bis in den Himmel, um dort die Sonne zu Boden zu zwingen, in ihrem üblichen Niedergang.
Unwillkürlich stütze ich mich an einem Steinpfeiler ab. An ihm rankt sich eine Kletterpflanze mit gelben Blüten hinauf, die ich nicht benennen kann. Neugierig reckt sie den zarten Kopf zur warmen Sonne und strahlt mit ihr um die Wette. Vor vier Tagen war die Blume gestorben. Ein totes Skelett, kalt und verloren, lehnte an dem Pfeiler und deutete anklagend ins Nichts, die Knochen und Glieder für immer erstarrt. Ich sah auf leere Höhlen, nicht auf tanzende Blüten, und bleiche, menschliche Überreste, anstatt auf wippende Blätter.
Das Herz schlägt mir bis zum Hals, während ich versuche, dieses lachhafte Bild zu verdrängen. Es wird noch lange dauern, bis die Kletterpflanze verblüht und der Tod Einzug hält, Seite an Seite mit Pest und Niedergang.
Anton lehnt sich entspannt gegen das strahlende Geländer. Die Helligkeit entlockt dem Sandstein einen besonderen Glanz und nimmt diesem Ort – eigentlich ein eigenes, kleines Paradies – seine Bedrohlichkeit. Der Duft von Blumen liegt in der warmen Sommerluft. Die winzigen Blüten scheinen einfach überall zu sein, schlängeln sich um die Pfeiler und schmiegen sich gegen das Geländer, das Anton davon bewahrt in die Tiefe zu stürzen.
„Du hättest es mir damals nicht zeigen dürfen“, platzt es aus mir heraus. Stirnrunzelnd sieht Anton mich an. „Du meinst
was?“
„Was der Krieg aus dieser Stadt gemacht hat. Es ist schlichtweg …“ Ich verstumme. Sich über die Vergangenheit zu echauffieren, ist pure Zeitverschwendung. Für Anton ist noch nichts davon geschehen.
Seine Brauen rücken dicht zusammen. „Kampf bleibt Toren vor. Wir sind sicher.“
Ungläubig sehe ich Anton an. Das kann er doch nicht wirklich glauben!
Aber Anton wirkt so sicher und zuversichtlich, wie er sich so gegen eine der Säulen lehnt und auf die bunte Heide hinabschaut, dass ich einfach schweige. Der Krieg ist eine Gefahr, aber nicht unmittelbar. Ich kann mir kaum vorstellen, wie desillusionierend es für Anton gewesen sein muss, dass sein unzerstörbares Reich gefallen ist und die Männer hinter die Mauer kamen.
Die Sonnenstrahlen fangen sich in seinen braunen Haaren und geben ihnen einen honigfarbenen Glanz, während Anton mir ein kleines Lächeln zuwirft.
„Schön?“
Die Umgebung? Sie ist … überwältigend. Ich hebe die Schultern. „Es ist ganz passabel.“ Schön wird dieser Ort erst, wenn ich die grausigen Bilder vergesse. Und das kann ich nicht. „Ist das der hübscheste Ort der Stadt?“
Anton legt den Kopf leicht schief und zieht die Augenbrauen zusammen. Ich weiß nicht, was geschehen ist, bevor ich ihm das erste Mal begegnet bin, aber was auch immer es war, hat eine unbeschreibliche Ernsthaftigkeit auf sein Gesicht getrieben. Der Junge hier hat kaum etwas mit Anton gemein. Er ist nur das: ein Junge. Ein Junge ohne Erfahrung, Ernsthaftigkeit oder tieferem Charme. Wenn ich mir versuche auszumalen, wie er mich hier zusammenstutzt, komme ich nicht umhin, leise zu lachen. Was Anton wiederum mit einem unendlich lachhaften Heben der Augenbrauen quittiert.
Es ist schwer, den Tatsachen ins Auge zu blicken, aber ich habe Anton verloren in dieser Nacht vor drei, vier Tagen. Er kann hier vor mir stehen, aber ihm fehlt das, was ihn ausgemacht hat. Sein Charisma. Sein offensichtlicher Intellekt. Dieser Junge, dieser Anton, kann mir nicht das Wasser reichen. Nicht, dass Anton als mitteloser Alchemist dazu in der Lage gewesen wäre. Aber er war immerhin nützlich. Der Junge neben mir? Er kann kaum meine Sprache sprechen und ist mehr von Schmetterlingen als von mir fasziniert.
Ich habe das Gefühl, dass Anton versucht, vernünftig mit mir zu sprechen. Will er mir etwas über diesen Ort hier sagen? Sich über den sonnigen Nachmittag unterhalten? Mich fragen, warum ich ihm gegenüber von Tag zu Tag reservierter werde?
Die Sprachbarriere hält ihn davon ab. Vermutlich ist es besser so. Ich kann auf ins Nichts führende Gespräche verzichten, bei denen ich nicht einmal sicher weiß, ob mein Gegenüber mich wirklich versteht.
Mit einem sonnigen Lächeln auf den Lippen schwingt Anton sich auf die kleine Mauer und lässt die Beine nach unten baumeln. Wie alt mag er sein? Zwanzig? Einundzwanzig? Seine Gestik erinnert an einen Zehnjährigen. Dieses begeisterte Strahlen, die Leichtigkeit seiner Bewegungen. Anton sagte mir, er wäre durch einen kleinen Trick vom Schlachtfeld geflohen. Durch einen Schnitt quer über den Oberkörper, der es Anton unmöglich machte, weiter zu kämpfen, aber nichts als einen Blutzoll von ihm forderte.
Je länger ich Anton betrachte, desto mehr bezweifle ich, dass er bereits um sein Leben gekämpft hat. Dieser zähe Schatten ist verschwunden, der stets unter seiner Gelassenheit ruhte. Diese Gewissenhaftigkeit, seine Wortgewandtheit, mit der er sich ohne tiefere Probleme in meiner Zeit hätte artikulieren können.
Es ist absurd, mehr als das, geradezu krankhaft. Aber ich vermisse Anton, während ich neben ihm stehe. Ich vermisse seine bissige Art, sein kleines Lachen, das er mir wie zur Belohnung geschenkt hat. Wie er sich an die Wand eines jeden Gebäudes lehnte. Diese Lässigkeit, die ihn so sehr von Achim unterscheidet. Unterschieden hat. Nein, falsch. Unterscheiden wird.
Noch etwas, das absurd ist. Ich kenne Anton, aber er mich nicht. Verrückte Welt. Ich sehne mich zurück in die trügerische Sicherheit der Zahlen und Statistiken. Von mir aus auch zu dem ein oder anderen Juristen. Wenn es sein muss, diskutiere ich noch einmal mit Achim über unseren Ehevertrag.
Ich würde alles tun, um mich davon abzulenken, dass ich Anton ebenso sehr habe, wie ich ihn verloren habe.
„Prinzessin“, stößt er hervor und verdreht die Augen. Es klingt abfällig. Der Tonfall passt nicht zu Anton.
Ich verschränke die Arme vor der Brust und sehe in den Himmel. Er ist erschreckend blau. Wie das Eis, das die einfachen Menschen essen. Himmelblau, Schlumpfeis. Es gehört nicht zu dem, womit man jemanden wie mich verköstigt. Egal in welchem Alter. Nach diesem himmelblauen Eis hatten die Kinder auf den Straßen blaue Lippen, manchmal war die Farbe bis zu der Nasenspitze verschmiert. Sie haben gelacht, obwohl sie vollkommen lächerlich aussahen. Und meine Kindermädchen fanden diesen unschuldigen Anblick zu nahezu jeder Zeit „herzallerliebst“. Jedem das, was ihm gefällt.
„Mir würde auch einiges in den Sinn kommen, wie ich dich nennen könnte, und nichts davon wäre schmeichelhaft“, seufze ich. „Du solltest deine Vokabeln lernen, damit wir uns eines Tages angemessen unterhalten können.“ Ein Schmetterling lässt sich neben mir auf einer der Kletterpflanzen nieder und faltet die blütenweißen Flügel wie zum Gebet. Mein Herz zieht sich zusammen, während ich Anton beobachte. Das hier ist nicht mehr Anton. Und ich werde nie wieder den Luxus genießen können, mich in seiner Gegenwart aufzuhalten „Es ist kaum auszuhalten mit dir!“, platzt es aus mir heraus. „Ich kann nicht einmal anständig mit dir sprechen.“
Anton schenkt mir ein Lächeln. „Schlimmer als Prinzessin“, stellt er nüchtern fest. Augenrollend bringe ich Abstand zwischen uns. Er kann nichts dafür, dass wir in dieser Situation stecken. Er hat nur an einer Sache Schuld: und zwar daran, dass er gestorben sein wird. Anstatt zu laufen und weiter zu hoffen. Nein, er hat sich einfach ergeben. So wie es jeder Feigling getan hätte.
Wie konnte ich sein Verhalten in diesem Moment nur verstehen? Ich hätte Anton anschreien müssen, damit er verschwindet. Ich hätte ihn mit mir zerren sollen. Wenn ich
Anton einfach nicht losgelassen hätte, hätte ich ihn mit in meine Zeit nehmen können?
Wenn ich ihn jetzt aus dieser Situation reißen könnte, was würde mit der Zeit geschehen, die wir bereits miteinander verbracht haben? Ich brauche jemanden, der mich mental unterstützt in dem Irrsinn zwischen meiner selbstverliebten Zimmerkameradin und dem engmaschigen Ehevertrag.
„Ich bin mächtiger als jede Prinzessin, die du dir ausmalen kannst“, berichtige ich ihn.
Anton zuckt die Achseln. Mit dieser einen Geste ist sein unbesorgtes Lächeln der ernsten Miene gewichen. Fast verbissen ernst, aber mit Sicherheit nicht tiefgründig seriös wie ich ihn kannte. Bevor er sich den Kopf hat abschlagen oder auf andere Weise meucheln lassen.
Anton rollt die Augen und stützt sich auf der kleinen Mauer ab, schwingt die langen Beine über den Stein und lässt sich zurück auf die Terrasse fallen. Katzenhaft elegant. Wenigstens das hat er behalten.
Seine Schritte haben sich verändert. Sie sind schwingender als ich sie kannte, er nimmt die Arme mehr mit. Wenn er mal lacht, dann lacht er lauter.
Ich weiß nicht, was ich dafür geben würde, damit Anton wieder bei mir ist. Würde ich auf einen Handel mit dem Grauen Mann eingehen? Könnte ich ihm meine Entscheidungsgewalt für eine Situation überlassen, die jetzt noch in den Sternen steht?
Was wenn mich die Folgen dieses Pakts ruinieren? Wenn der Graue Mann meinen Ruf in Anspruch nimmt bei einer Verhandlung, von der ich mir nicht nur Geld und Macht verspreche, sondern mindestens positive Schlagzeilen? Die ich dringend nötig habe. Allein der Gedanke an die endgültigen Ausmaße meines Fehlens bei diesem Ball… Mir wird einfach nur schlecht.
Kann ein einfacher, lächerlicher Alchemist es wert sein, dass ich für ihn viel aufs Spiel setze? Meinen Ruf, mein Vermögen, meine Verhandlungspartner?
Anton hat die Hand an eine der rauen Steinsäulen gelegt. Der blütenweiße Schmetterling flattert auf. Nicht um zu verschwinden. Er lässt sich auf Antons schmalen, feingliedrigen Fingern nieder, breitet die Flügel aus, als hauchte er einen zarten Kuss auf Antons Haut. Ein leises Lächeln umspielt seine Lippen. Anton wirkt fast schon naiv glücklich. Und das nur, weil ein Schmetterling sich auf seiner Hand niedergelassen hat.
Sein feines Gespür hat Anton nicht verloren. Fragend dreht er sich zu mir um, muss meine Blicke gespürt haben, und hebt ganz langsam den Arm. Als würde eine sanfte Brise durch die zarten Flügel gleiten, beben sie. Dünne Federn im Wind. Wie der hauchzarte Stoff meines Nachthemdes. Nach und nach beruhigt sich das Flattern. Mit dem schmalen Rüssel tastet der Schmetterling über Antons Finger, lässt zu, dass ich ihn näher betrachte.
Menschen wie ich sehen Schmetterlinge oft. Sie werden bei Festivals fliegen gelassen, dienen als schmückendes Beiwerk in Galerien, sind hübsche Details auf Festtafeln – selbstverständlich im toten Zustand – und gehören in jedes Tropenhaus, das man aus Wohltätigkeitsgründen besucht. Oder um sich wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.
Ich habe zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten von blauen Wundern über winzige orange Tupfen, die taumelnd durch die Lüfte wankten. Nie wirkte eines dieser Insekten so sanft, so nahbar und zart wie das, das sich auf Antons Handrücken der Sonne entgegenstreckt, abwechselnd Küsse verteilt und die Flügel zum Gebet faltet.
„Schön?“, fragt Anton mich. Möchte er wissen, ob der Schmetterling mir gefällt? Ratlos lehne ich mich neben Anton und strecke die Finger nach dem Insekt aus.
Ein Ruck fährt durch dieses winzige Wesen. Es ist, als würde Wind in die Segel fahren. Er richtet die Flügel auf und lässt sich davontragen. Resigniert senke ich die Hand. Anton verzieht leicht den Mund. Wenn er richtig mit mir sprechen könnte, ich bin mir sicher, er könnte einen Kommentar nicht unterdrücken.
Schweigend sieht Anton dem kobaltblauen Himmel entgegen. „Wann dein nach Hause?“
„Wann ich nach Hause muss?“, vergewissere ich mich. Anton zuckt wegwerfend die Schultern. Was ist zwischen uns geschehen, was wird geschehen, damit er mich mit einem überschwänglichen Kuss begrüßt und mich wehmütig verabschiedet? Ich habe das unumstößliche Gefühl, dieser Anton hier könnte problemlos ohne mich leben. Ja, manchmal kommt es mir fast vor, als wäre ich seine ganz eigene Fußfessel. Dabei kann ich es mir nicht aussuchen. Ich wollte nicht in der Zeit springen können und noch weniger liegt es in meinem Interesse, immer wieder in dieses stinkende Zeitalter zurückzukehren. Zu dem immer gleichen Jungen, der nicht mehr er selbst ist.
„Bald. Du kannst dich freuen. Bald bist du mich los.“ Was sagte Anton? Elf, zwölf Besuche? Drei davon sind vorbei. Mir läuft die Zeit davon. Wenn ich Anton retten möchte, brauche ich einen möglichen Weg. Schnell. Ohne die Hilfe meiner Assistenten. Sollte ich meine Berater mit dieser Zeitreiseproblematik konfrontieren, sie würden mich in eine geschlossene Klinik einweisen. Zeitreisen sind nicht förderlich für einen tadellosen Ruf. Zeitreisen existieren nicht.
Wieder ein Schulterzucken. In einem Anflug seiner späteren Gedankenversunkenheit, sieht Anton hinab von der Terrasse, beobachtet die Heide, als könnte er ebenso wie ich das Blut darüber schimmern sehen. Wie viele Menschen müssen ihr Leben in einem aussichtslosen Kampf gelassen haben, damit das Blut in Strömen fließen konnte?
„Warum bist böse? Ich nichts gemacht!“ Er richtet die Worte nicht an mich, er spricht mit den Hügeln unter uns.
Ich antworte ihm trotzdem. „Ich bin nicht erbost. Lediglich frustriert. Du magst es dir nicht vorstellen können, aber wir werden gute Freunde sein.“ Freunde. Ich habe ihm das schon so oft erklärt. Wir sind Freunde. Wir sind Bekannte. Wir sind Geschäftspartner, Verbündete, Diskussionspartner, Dulder. In den meisten Fällen schweigt er stoisch. Jetzt seufzt Anton tief und bietet mir seine Hand an.
Ratlos ergreife ich sie. „Und was jetzt?“
„Freunde“, sagt er fest und schenkt mir ein einnehmendes Lächeln. „Tolle Freunde.“ Er… er ist einfach unmöglich.
Ich versuche mein Lachen zu unterdrücken, es blubbert trotzdem kribbelnd in mir hinauf, fängt sich in meiner Brust und wärmt das Herz.
„Genau. Wir sind tolle Freunde.“
Er drückt meine Hand. Es wäre Zeit, sie wieder loszulassen. Anton schert sich nicht darum. Die Anspannung zwischen uns ist noch immer da, sein Gesicht noch immer so weich und letzten Endes unbekümmert, dass es schon wehtut. Die Welten, in denen wir leben, könnten nicht verschiedener sein. Nicht nur, weil wir in verschiedenen Jahrhunderten geboren wurden.
Als wäre er um gute Laune bemüht, deutet Anton hinab auf die blühende Heide. Ganz so, als könnte ich irgendwo anders hinsehen.
„Ja, es ist wunderschön. Auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung zu den Bürokomplexen, die ich kenne.“ Anton rümpft die Nase. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nicht weiß, was ein Bürokomplex ist. „Wenn ich das nächste Mal komme, wirst du meine Sprache beherrschen, oder?“
„Suche Lehrer“, grinst er. Ich seufze leise auf. So jemanden wird er in seinem Jahrhundert nicht finden.
„Viel Glück dabei.“ Mein Blick schweift in die Ferne. Zart wie eine Nadel ragt die Kirchturmuhr zwischen den mittelalterlichen Gemäuern auf. Fast drei. Ich bin schon viel zu lange hier.
Beinah schüchtern berührt Anton die Phiole, die er mir selbst geschenkt hat, eingefasst in feinstes Gold, das sie umrankt wie Efeu. „Bis nächstes Mal.“
Ich kann ihn nur ansehen. Ja, wenn alles gut geht, dann sehe ich Anton noch acht Mal. Und dann? Dann werde ich eine Entscheidung fällen müssen, die mir nicht gefallen wird.
„Bis zum nächsten Mal.“ Es fühlt sich nicht an, als würde ich demnächst springen, trotzdem hebe ich zum Abschied die Hand. Ich kann Antons Anwesenheit keine Sekunde länger ertragen. Das hier ist nicht Anton. Dabei sieht er aus wie Anton. Dabei ist er wie Anton. Aber er ist nicht Anton.
Die Sonne fängt sich in seinem braunen Haar. Seine braunen Augen strahlen in ihrem eigenen Feuer. Das ist gleichgeblieben.
Anders als der Anton, in den ich mich … für den ich tiefe Sympathien hegte, steht dieser Anton leicht gebeugt, hat die Schultern minimal nach oben gezogen. Ihm fehlt die Gelassenheit.
Der Duft von Blumen und Heide wird mit jedem Schritt zurück in die mittelalterliche Stadt mehr überlagert. Nicht von angenehmen Gerüchen. Der Gestank von Fäkalien und Fäulnis steigt mir in die Nase.
Den Blick zum Himmel vermeidend aus Angst vor Käfigen, die noch lange nicht angebracht wurden, eile ich durch die Straßen. Hier ist keiner meiner Bodyguards an meiner Seite, keiner der Securitymänner. Nicht einmal ein lausiger Chauffeur, der sein Leben für meines geben könnte. Mein hässlichstes Nachtzeug ist in diesem Jahrhundert ein verboten hübscher Aufzug.
Die Augen aller Passanten ruhen auf mir. Ich liebe es, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Solange man mich mit Bewunderung betrachtet, mit Neid, Ehrfurcht, nicht mit Gier. So wie jeder einzelne in dieser Epoche.
Leise knarzt das Holz einer nahestehenden Tür. Die betagte Lady sieht mich aus fast schwarzen Augen an, die Falten, dunkle Nähte in ihrem Gesicht. Sie schenkt mir ein zahnloses Lächeln, den Blick auf meinen Hals geheftet. Die Phiole fängt das Sonnenlicht und bricht es in sich selbst. Es wirkt, als hätte ich einen Regenbogen in dem dünnen Gefäß gefangen.
Das erste Mal in meinem Leben lege ich eine Hand über ein Schmuckstück, um es zu verbergen. Hier bringt es mir keine Bewunderung ein, höchstens Probleme. Und Anwälte kennen sie zu dieser Zeit nicht. Ganz zu schweigen davon, dass niemand sich mit einem Fall befasst, der sich im tiefsten Mittelalter abspielte.
Ziellos wandere ich über die grob gepflasterten Straßen und durch die Matschwege, die meine Schuhe ruinieren. Ich will nicht wissen, was neben der Erde die „Straße“ ausmacht. Zügig biege ich um die nächste Ecke und verharre mitten in der Bewegung.
Eine Hand schießt in mein Sichtfeld. Erschrocken zucke ich zusammen. Hitze, Brennen frisst sich durch meinen Unterarm. Fassungslos starre ich auf den Schnitt, der sich über meine Haut zieht. Vom Handballen bis vier Finger breit unter der Ellenbeuge. Mein Herz rast. Ich muss den Verstand verlieren. Dieser Schnitt, er erinnert mich an die Wunde, die plötzlich auftauchte. Aus dem Nichts. Als ich mit Achim durch den Rosengarten spazierte.
Die Gestalt vor mir räuspert sich. Doch anstatt zu fliehen, bietet der Mann mir ein Taschentuch an. Eine dunkle Kapuze verbirgt sein Gesicht, der Stoff des langen Mantels fließt bis zum Boden. Seine Finger werden von schwarzen Lederhandschuhen verdeckt.
Ein seltsamer Anblick. Noch absurder in Anbetracht dessen, dass auf dem Daumen des Handschuhs ein verschnörkeltes, aufgesticktes S prangt. Meine Brauen rücken dichter zusammen. Ein Markenprodukt. Mitten im Mittelalter.
Mein Blick zuckt nach oben. Der Schwarze Mann schüttelt kaum merklich den Kopf. Ich sollte mich fürchten. Ich sollte schreien und davonlaufen. Selten fühlte ich mich sicherer. Blut tropft zu Boden. Ich fühle mich geborgen. Blut tropft zu Boden. Ich sollte verschwinden.
Mit raschen, routinierten Griffen bindet der Fremde mir das Taschentuch um den Unterarm. In seiner freien Hand hält er ein Schweizer Taschenmesser. Eine zarte, rote Spur zieht sich über die kurze Klinge. Mir bleibt das Herz stehen.
Ich bin nicht die Einzige, die in einer Zeit festsitzt, in die sie nicht gehört.
3
Zittrig schnappe ich nach Luft. Langsam schaltet der Verstand sich ein.
Der Mann vor mir hat meinen Unterarm aufgeschnitten. Aus welcher Zeit er kommt, ist irrelevant. Er vergießt mein Blut und niemand ist hier, der mich vor ihm beschützen könnte. Unwillkürlich weiche ich zurück. Das sich langsam mit Blut vollsaugende Taschentuch baumelt wie die weiße Flagge von meinem Handgelenk. Die Klinge des Taschenmessers schimmert rötlich in der Sonne. Rötlich von meinem Blut. „Sind Sie wahnsinnig?“, zische ich, wohlwissend, dass er kein Wort versteht. Mit einem scharfen Knacken klappt er die Klinge ein und verstaut das Messer in der Manteltasche.
„Gut möglich.“
Meine Rückenmuskulatur verkrampft sich. Die Antwort wird mir nicht von dem Mann vor mir gegeben. Hinter ihm ist eine zweite Gestalt aufgetaucht, in sich zusammengesunken und das Haupt doch stolz gehoben. Die Zeit hat ihm die Haare vom Kopf gefressen und tiefe Falten in seine gebräunte Haut gegraben. Sie erinnert an gegerbtes Leder. Der Mann ist der Schatten eines schemenhaften Originals, der düster die Gasse hinter sich füllt. Seine bloße Gegenwart jagt mir Schauer über den Rücken, während ich versuche, die Gesichtszüge unter der dunklen Kapuze auszumachen. Ein junger Mann und ein alter. Beide stehen vor mir. Beide gehören nicht in diese Zeit. Meine Sinne drehen sich.
In einer Bewegung, die keinen Widerspruch duldet, streckt er den Arm nach dem Schwarzen Mann vor mir aus und ergreift seine behandschuhte Hand. „Entschuldigen Sie diese Umstände, Miss. Er hat mehr zu lernen, als uns allen lieb ist.“ Seine Stimme erinnert mich an das Krächzen von Krähen
Dass meine Füße mich immer weiter von den beiden Männern fortgetragen haben, bemerke ich erst, als mein Rücken gegen die gegenüberliegende Fassade eines Hauses stößt. Hinter mir, im Inneren des Gebäudes, murmeln Stimmen in der Sprache, die ich kaum verstehe.
Ich sollte sprechen. Das wäre der beste Moment, um diese Situation zu erkunden oder zu entschärfen. Es ist, als hätte mir der Schwarze Mann mit dem Schnitt nicht nur Tropfen von meinem Blut abgezapft, sondern mir gleichzeitig die Stimme gestohlen. Hilfesuchend sehe ich die Straße auf und ab. Mit mäßigem Interesse beobachten die Passanten uns, einige scheinen mich nicht einmal zu bemerken.
Der zweite Mann kommt näher. Hektisch greife ich nach der kleinen Phiole und halte mich daran fest. Ich will zurück in mein Bett. Der Ausflug dauert schon viel zu lange an. Es ist Zeit, zu verschwinden. Aber weder der Geruch des Zimmers noch die gröbsten Details wollen mir einfallen. Mein Kopf ist wie leergefegt. Die Stimmbänder in Stahl gegossen.
Der Mann in dem langen, schwarzen Mantel folgt dem Alten ohne zu zögern. Ich spüre seine Blicke. Sie fühlen sich nicht unanständig an, nicht gierig. Viel mehr interessiert, ein wenig nachdenklich vielleicht. Zögerlich und warnend. Als er die Hand ausstreckt, wird sie von dem Alten beiseite geschlagen. „Eine hübsche Kette“, stellt er fest. Seine Stimme ist rau. Glas kratzt über Stein. Meine Knöchel werden weiß. Die Haut beginnt zu brennen. „Ein Geschenk der verschiedenen Mutter?“
Das Herz schlägt mir bis zur Kehle. Ich fühle mich hilflos wie bei meinem ersten Sprung. Die Knie zittern wie Espenlaub, als ich seitwärts gehe, nur weg von ihm. Ich versuche mir einzureden, dass jeder Schritt einen Meter mehr in meine Zeit bedeutet. Lächerlich. Niemand ist in der Lage, mehrere
Jahrhunderte zu durchwandern. Ich müsste gehen, bis mir die Füße bluten, und noch viel weiter.
„Nein.“ Ein einziges Wort hat meine Lippen verlassen und es klingt standhaft wie der sich des Deals sicheren Aktionärs. Langsam lasse ich die Finger von dem zarten Glas gleiten und verschränke sie ineinander. „Es wäre mir eine Freude, wenn Sie mich passieren lassen würden.“
Der Alte verzieht den lederartigen Mund. Haut blättert von seinen Lippen ab.
„Eine selbstbewusste, junge Lady“, krächzt er. „Du hast hier nichts verloren. Um diese Zeit sollten Mädchen wie du in ihrem Bett liegen.“ Es ist nicht einmal drei Uhr nachmittags. „Herren wie Sie sollten sich von Damen wie mir fernhalten, wenn Ihnen Ihr Kopf lieb ist.“ Langsam strömt das Blut zurück in meine Glieder. Das Stimmengewirr hinter mir hebt an, als würde in dieser Sekunde auf der anderen Seite der Mauer ein heftiger Streit entbrennen.
Der Schwarze Mann lacht leise. Ich beginne zu zittern. Das Geräusch ist mir vertraut. Aber woher? Woher nur. Ich kann es nicht greifen.
„Deine Zunge ist spitz genug, ich kenne Fürsten, die würden sie abschlagen und den Hunden zum Fraß vorwerfen.“ Der Alte spricht die Worte nicht wie eine Drohung aus. Er schildert seine Tatsachen. Die Situation wird unerträglicher als ohnehin schon. Noch ein Schritt. Mit jedem Meter komme ich meinem Bett näher, Adrianas kleinem Nachtlicht, den kalten Fliesen, der frischen, kühlen Bergluft. Dann durchwandere ich die Jahrhunderte, bis mir die Füße bluten und noch viel weiter. Solange ich nur von hier verschwinden darf.
„Mir kommen zehn Anwälte auf einmal in den Sinn, die mich verteidigen würden und Sie wegsperren, bis nichts mehr von Ihnen übrig ist.“ Meine Finger zittern nicht, als ich mir die Haare aus dem Gesicht streiche und das kühle, professionelle Lächeln aufsetze. Der Schnitt brennt wie die Hölle. Ich werde mir einige Tropfen von dem Minzöl auf die Wunde träufeln, das Anton mir gegeben haben wird, sobald ich zurück bin. Was hier auf mittelalterlicher Straße geschieht, ist auch nichts anderes als ein kühler Dialog am abendlichen Kongresstisch. „Drohungen sollte man nur aussprechen, wenn man sie halten kann“, murmelt der Alte. Erneut hebe ich den Arm. Das blutbefleckte, weiße Taschentuch weht in der leisen Brise.
„Das sagen Sie jemandem, der die weiße Flagge hisst?“ Noch ein Schritt, noch einen Meter. Mit meiner Überraschung über diese Situation schwindet die allesvernichtende Panik. Langsam nimmt das Zimmer Gestalt an. Ich höre die Vorhänge fast flattern, während sie schwer über den glatten Marmorboden schleifen. Es ist, als würde man sich hinter mir nicht länger streiten. Adriana seufzt leise im Schlaf und wälzt sich auf die andere Seite, das engelsblonde Haar zu einem Heiligenschein ausgebreitet, während sie unbewusst nach Casper tastet. Der leise Duft von Pfefferminze liegt in der Luft, der erste Vogel singt sein Lied.
„Gib mir die Kette, damit ich dich laufen lasse.“ Ich höre die Forderung des Alten kaum. Ich liege unter der schweren Decke, die die Kälte der Nacht aussperrt. Unter mir knarzt leise das Bettgestell, mattgelbe Lichtreflektionen huschen über die Tapete.
Meine Schultern berühren nicht länger den rauen Stein der Hauswand. Ich atme nicht mehr den Gestank von Fäulnis und Fäkalien ein, die raue Stimme weicht Adrianas herzhaftem Gähnen.
Zurück in meinem Jahrhundert. Meine Mitbewohnerin sitzt halb in ihrem Bett, die blonden Haare fließen ihr in widerwärtig perfekten Locken über die Schultern bis hinab auf die Matratze. Als sie mich sieht, seufzt sie leise.
„Es wird immer länger. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr zurück.“ Sie räkelt sich wie eine Katze, ehe sie sich schwungvoll aus dem Bett schwingt. Langsam beginnt das Blut sich in meiner Handfläche zu sammeln. Das weiße Stofftaschentuch ist vollgesogen. Als ihr Blick über meinen Unterarm schweift, habe ich Entsetzen erwartet, stattdessen zieht sie nur eine Augenbraue nach oben.
„Sieht nicht schön aus“, stellt Adriana nüchtern fest.
„Ein Fremder hat mir ein Taschenmesser über den Unterarm gezogen.“
„Sowas gab es damals schon?“ Adriana klingt restlos desinteressiert, während sie nach meiner Hand greift und mich ins Bad führt. Ich lasse es zu. „Heilen deine Wunden eigentlich, sobald du wieder hier bist?“
Resigniert presse ich die Lippen aufeinander. „Du tust, als würde ich es zulassen, dass man mich des Öfteren verletzt.“ „Also hast du keine Ahnung?“ Ein betäubendes Kribbeln geht durch meine Venen. Erschrocken entziehe ich ihr meine Hand. Adriana rollt die Augen.
„Nimm es mir nicht übel, aber ich glaube nicht, dass Verletzungen die Jahrhunderte überdauern. Du hast also keine Entschuldigung für heute.“
Selbstverständlich. „Zum einen suche ich keine Entschuldigung für die Vorlesungen und zum anderen ist dieser Schnitt derartig tief, dass ich von Glück sprechen kann, wenn er nicht genäht werden muss.“
Adriana lacht leise auf und zieht das Stofftaschentuch ab. „Ja, genau. Verdammt tief. Was wird es denn dann, wenn eine Katze dich kratzt? Ein Attentat?“
„Nein, das wäre ein oberflächliches…“ Ich stocke. Unter dem Tuch ist die Haut zwar blutig, aber unversehrt. Als hätte ich mir die Verletzung nur eingebildet. Den Schmerz, dieses brennende Ziehen. Meine Handfläche ist blutig.
„Ein oberflächliches Attentat?“, murmelt Adriana und wäscht sich die Hände. Das Taschentuch lässt sie achtlos in den Mülleimer fallen. „Chrona, du bist die Dramaqueen überhaupt. Schraub das Dramaniveau mal ein bisschen runter und schlaf noch ein paar Stunden.“ Adriana streicht sich eine blonde Strähne aus dem engelshaften Gesicht. „Jemand hat dich in der Vergangenheit angerempelt. Du wirst es überleben.“
Ich lache trocken auf. „Ein Mann im Mittelalter hat mir mit einem Schweizer Taschenmesser den Unterarm aufgeschlitzt!“
„Weil du einen auf Miss Unantastbar gemacht hast?“ Konzentriert betrachtet Adriana sich im Spiegel.
„Nein“, erwidere ich eisig. „Weil ich um eine Ecke gebogen bin.“
„Vielleicht war es ein Privatgrundstück.“
„Es war eine offene Straße.“ Wenn man es denn so nennen will.
Adriana schnalzt mit der Zunge und sieht mich durch den Spiegel an. „Schon einmal etwas von Zöllen gehört? Damals gab es die hinter jedem größeren Haus. Das nächste Mal solltest du einfach auf Markierungen auf der Straße achten oder gleich Geld rausrücken, wenn dich einer von denen anspricht.“
„Du vergisst mit wem du redest“, zische ich. Ob ich weiß, was Zölle sind? Himmel, wenn ich etwas erkenne, dann Zollgrenzen, egal in welchem Jahrhundert. Meine Mutter und ich haben Stunden damit verbracht die historische Bedeutung des Zolls zu studieren, um mir ein besseres Gespür für die heutigen Handelsmuster und -wege zu vermitteln. Da war nichts. Und der Mann hat keinen Ton gesagt. Er ist mir mit dem Messer über den Arm gefahren, als wäre es das Natürlichste der Welt. Als verscheuchte er Fliegen. Als hätte er blind einen Befehl ausgeführt. Nichts in der heutigen Nacht ist geschehen, weil ich eine Grenze missachtet habe.
Adrianas Brauen schießen in die Höhe. „Tatsächlich? Und ich dachte schon, ich spreche mit meiner Mitbewohnerin, die ihren Luxusschuppen schmerzlich vermisst und wirklich ausgeschlafen sein sollte für die heutigen Vorlesungen. Und die folgende Sitzung bei ihren Psychologen, weil sie noch immer an ihrem Verstand zweifelt.“
Ungläubig lache ich auf. „Ich habe keinerlei Zweifel an meinem Verstand!“ Warum verschwende ich auch nur einen Atemzug an Adriana? Dieses Mädchen und ich könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Sie mag mir hinsichtlich der umwerfenden Schönheit das Wasser reichen können, aber in jedem weiteren Aspekt hinkt sie mir nach. Wer ist Adriana schon? Eine lausige Studentin, die ihre Freizeit mit einem blauhaarigen Debilen verbringt.
„Und dann rufst du den Psychodoc weswegen in unser Zimmer?“
„Zum Erörtern meiner momentanen Verfassung.“ Meine Augenringe sind eine Zumutung. Meine Zimmermädchen werden Wunder vollbringen müssen, um mich angemessen herzurichten. Ich sollte noch wenige Stunden Schlaf erhaschen. Und sei es nur, um dem Psychotherapeuten gegenüber nicht labil zu wirken.
„Ich kann dir sagen, wie es momentan um dich steht“, erdreistet sich Adriana. „Du bist todmüde, verwirrt und wünschst dir nichts mehr, als die Zeit mit deiner aufgetakelten Gesellschaft zu verbringen. Wie auch immer.“ Sie rollt die großen, himmelblauen Augen. „Halt dich einfach von den Menschen des Mittelalters fern. Vor allem von denen mit Schweizer Taschenmesser. Die halten die Dinger meistens nicht bereit, um dich damit zu kitzeln oder zu streicheln.“ Wenn ich gesehen hätte, dass er eines bei sich trägt, hätte ich einen großen Bogen um ihn gemacht. Aber er stand hinter einer Hausecke und verschmolz mit den Schatten. „Verschwinde einfach“, zische ich und flechte mir die Haare. Meine Zimmermädchen haben mir einen neuen Pyjama zurechtgelegt. Mit dem Rücken zu Adriana entkleide ich mich und ziehe das frische Nachtzeug an. Der sanfte Duft von Minze umfängt mich gemeinsam mit einem Hauch des bekannten Waschmittels.
„Oh, genau das hatte ich vor.“ Adriana stolziert in mein Blickfeld und hält mir eine Salbe unter die Nase. „Hier. Desinfizierend. Nicht, dass du dir mittelalterliche Bakterien einfängst und mich dafür verantwortlich machst.“ Sie schnalzt harsch mit der Zunge. „Solltest du mich suchen, ich bin bei Casper.“ Ich warte darauf, dass jemand die beiden gemeinsam erwischt und ihnen die Hölle heiß macht.
„Tu, was du nicht lassen kannst“, erwidere ich pikiert. „Sobald du bereit für deine Entschuldigung bist, findest du mich in meinem Bett.“
Adriana, schon halb aus dem Badezimmer, lacht ungläubig auf. „Was?“ Aus ihren großen, unnatürlich blauen Augen sieht sie mich an. „Wofür bitte? Dafür, dass ich dir geholfen habe?“
Ungläubig hebe ich die Salbe in die Höhe. „Das nennst du eine Hilfe? Ich weiß nicht einmal, wie viel ich davon verwenden muss.“
Sie rollt die Augen. „Chrona, du bist die erste Person, die ich treffe, die absolut überlebensunfähig ist. Es ist ein Wunder, dass man dir im Mittelalter nicht längst die Kehle durchgeschnitten hat!“ Sie spricht zu laut. Für diese Uhrzeit spricht sie viel zu laut. Sie weckt das ganze Stockwerk auf. „Du solltest dem armen Typen, dem du auf den Geist gehst, Dankespralinen mitbringen.“ Sie schlägt die Tür hinter sich zu. Der Knall hallt durch die schläfrigen Gänge,