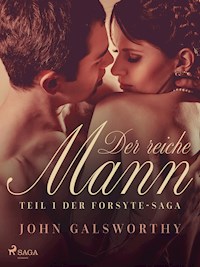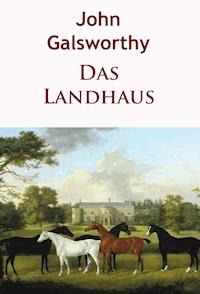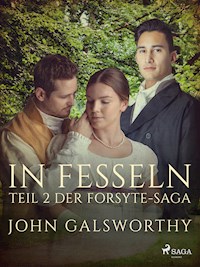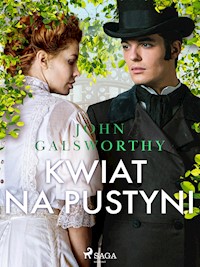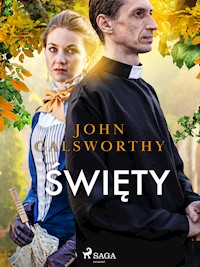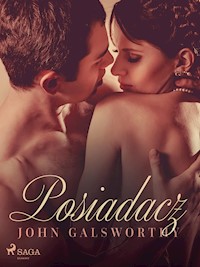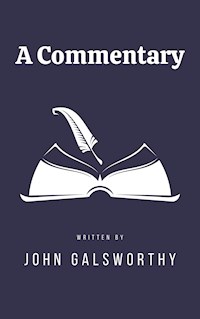6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition oberkassel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Forsyte
- Sprache: Deutsch
Im letzten Teil der großen Familiensaga stellt sich die Frage, ob die jüngste Generation die Fäden der verfeindeten Familienstränge wieder zusammenführen kann. Denn Soames Tochter Fleur und Jolyons Sohn Jon lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Sie wissen nichts von der Vergangenheit ihrer Eltern. Doch als diese die Romanze der beiden entdecken, verbieten sie ihnen den Kontakt. Doch wie könnten Fleur und Jon erwachsen werden, wenn sie sich nicht gegen ihre Eltern stellen würden? Jolyons Warnung, dass sich niemand schützend vor Jons Mutter Irene stellen würde, wenn er sterbe, scheint zu verhallen. Doch Fleur wird nicht nur von Jon begehrt. In "Die Forsyte Saga" werden der Auf- und Niedergang einer Familie, die der oberen Mittelschicht Englands Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts angehört, erzählt. Grundthema ist das Leben der fiktiven Familie Forsyte in ihren verschiedenen Facetten. Wiederkehrende Figur ist Soames Forsyte, Prototyp einer ökonomisch erstarkten bürgerlichen Klasse. Er versucht die vom viktorianischen Lebensgefühl geprägten Familienideale und sein Vermögen zu wahren. Geprägt von konfliktreichen, dramatischen Ereignissen, die den Kampf zwischen Familientradition und Befreiung von gesellschaftlichen Fesseln zum Gegenstand hat, gestaltet sich eine unterhaltsame Familiengeschichte über vier Generationen hinweg. Die komplett neue und moderne Übersetzung trägt dazu bei, die zahlreichen Mitglieder der weitverzweigten Forsyte-Familie in Erscheinung treten zu lassen und das Ende einer Epoche aufzuzeigen. Liebhaber der TV-Serie "Downton Abbey" werden ihre Freude an "Die Forsyte Saga" haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Die Forsyte Saga Zu Vermieten
John Galsworthy
aus dem Englischen von Johanna Bönisch
edition oberkassel
Inhaltsverzeichnis
Erwachen
Begegnung
Fine Fleur Forsyte
In Robin Hill
Das Mausoleum
Das Heimatland
Jon
Fleur
Idyll im Gras
Goya
Trio
Duett
Launen
Mutter und Sohn
Väter und Töchter
Begegnungen
In der Green Street
Reine Forsyte-Angelegenheiten
Soames’ Privatleben
June spielt mit
Wild entschlossen
Es ist wie es ist
Entscheidung
Timothy prophezeit
Der alte Jolyon geht um
Geständnis
Irene
Soames sinnt nach
Die fixe Idee
Verzweifelt
Mission
Die schwermütige Melodie
Unter der Eiche
Fleurs Hochzeit
Der Letzte der alten Forsytes
Dank an die LeserInnen
John Galsworthy
Impressum
Landmarks
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Erwachen
Für Charles Scribner
Erwachen
Durch das riesige Dachfenster, das die Halle in Robin Hill erhellte, fiel das Julisonnenlicht um fünf Uhr genau auf die Stelle, wo die breite Treppe eine Biegung machte und in diesem leuchtenden Strahl stand der kleine Jon Forsyte in einem blauen Leinenanzug. Sein Haar glänzte sowie seine Augen, unter einer gerunzelten Stirn, denn er überlegte, wie er das letzte von unzähligen Malen die Treppe hinuntergehen sollte, bevor der Wagen mit seinem Vater und seiner Mutter zurückkehren würde. Vier auf einmal und unten fünf? Langweilig! Das Geländer hinunterrutschen? Aber wie? Das Gesicht nach unten, die Füße voran? Total langweilig! Seitlich auf dem Bauch? Läppisch! Auf dem Rücken, die Arme auf beiden Seiten nach unten? Verboten! Oder das Gesicht nach unten, den Kopf voran, auf eine Weise, die bis jetzt außer ihm niemand kannte? Das war der Grund für das Stirnrunzeln auf dem erhellten Gesicht des kleinen Jon …
In jenem Sommer 1909 hatten die simpler gestrickten Geister, die schon damals die Sprache vereinfachen wollten, keine Kenntnis von der Existenz des kleinen Jon, sonst hätten sie Anspruch auf ihn als ihren Zögling erhoben. Doch man kann in diesem Leben auch zu einfach sein, denn sein richtiger Name war Jolyon und sein noch lebender Vater und sein toter Halbbruder hatten sich schon vor ihm die anderen Kurzformen zu eigen gemacht, Jo und Jolly. Tatsächlich hatte der kleine Jon sein Bestes getan, um sich den Konventionen anzupassen, und sich erst Jhon und dann John geschrieben. Erst als sein Vater die schiere Notwendigkeit erklärt hatte, hatte er seinen Namen Jon geschrieben.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte dem Vater gehört, was der Knecht Bob, der Ziehharmonika spielte, und sein Kindermädchen Da, die sonntags ein violettes Kleid trug und sich in dem Privatleben, das sogar Hausangestellte ab und an führen, des Namens Spraggins erfreute, von seinem Herzen übrigließen. Seine Mutter war ihm sozusagen nur in Träumen erschienen, wohlriechend, seine Stirn streichelnd, bevor er einschlief, und manchmal sein goldbraunes Haar glättend. Als er sich den Kopf am Kamingitter in seinem Kinderzimmer aufschlug, war sie da, um sich vollbluten zu lassen, und wenn er einen Alptraum hatte, saß sie auf seinem Bett und drückte seinen Kopf an ihren Hals. Sie war ihm teuer, aber fern, denn Da war so nahe, und im Herzen eines Mannes ist kaum für mehr als eine Frau auf einmal Platz. Natürlich gab es auch zwischen ihm und seinem Vater eine besondere Bindung, denn der kleine Jon wollte auch einmal ein Maler werden, wenn er groß war – mit dem kleinen Unterschied, dass sein Vater Bilder malte, während Jon vorhatte, Decken und Wände zu bemalen, auf einem Brett zwischen zwei Trittleitern stehend, mit einer dreckig-weißen Schürze und dem angenehmen Geruch von Kalkmilch. Sein Vater nahm ihn auch mit zum Reiten in den Richmond Park, auf seinem Pony namens Maus, das wegen seiner Farbe so hieß.
Der kleine Jon war mit einem silbernen Löffel im recht großen und gebogenen Mund geboren worden. Er hatte seinen Vater oder seine Mutter niemals mit wütender Stimme sprechen hören, weder miteinander, noch mit ihm oder irgendjemandem sonst. Der Knecht Bob, die Köchin, Jane, Bella und die anderen Hausangestellten, selbst Da, die ihm als Einzige Schranken setzte, alle sprachen sie in einem besonderen Ton mit ihm. Daher war er der Ansicht, die Welt sei ein Ort vollkommener und ewiger Vornehmheit und Freiheit.
Als ein Kind des Jahres 1901, hatte er angefangen, Dinge bewusst wahrzunehmen, als sein Land gerade jenen schlimmen Anfall von Militärenthusiasmus überwunden hatte, den Burenkrieg, und sich auf die Wiederkehr der Liberalen im Jahr 1906 vorbereitete. Zwang war unbeliebt, Eltern hatten exaltierte Vorstellungen davon, ihrem Nachwuchs ein schönes Leben zu bereiten. Sie verhätschelten und verzogen ihre Kinder und erwarteten voller Vorfreude die Folgen. Überdies hatte der kleine Jon mit einem liebenswürdigen Mann von zweiundfünfzig Jahren, der bereits einen einzigen Sohn verloren hatte, als Vater und einer Frau von achtunddreißig Jahren, deren erstes und einziges Kind er war, als Mutter eine weise Wahl getroffen. Was ihn davor bewahrt hatte, eine Mischung aus einem Schoßhündchen und einem kleinen Schnösel zu werden, war die Bewunderung seines Vaters für seine Mutter gewesen, denn selbst der kleine Jon konnte sehen, dass sie nicht nur seine Mutter war und dass er im Herzen seines Vaters die zweite Geige und sie die erste spielte. Was er im Herzen seiner Mutter spielte, wusste er noch nicht.
Was Tante June betraf, seine Halbschwester (aber so alt, dass sie diesem Verwandtschaftsverhältnis entwachsen war), sie liebte ihn natürlich, aber sie war so unberechenbar. Seine ihm treu ergebene Da hatte auch etwas Spartanisches. Sein Badewasser war kalt und seine Knie waren nackt, er wurde nicht dazu ermuntert, sich selbst zu bemitleiden. Was die strittige Frage seiner Erziehung anbetraf, teilte Jon die Ansicht jener, die fanden, Kinder sollten zu nichts gezwungen werden. Er mochte die Mademoiselle recht gerne, die jeden Morgen für zwei Stunden kam, um ihm ihre Sprache beizubringen, zusammen mit Geschichte, Geografie und Rechnen. Auch der Klavierunterricht, den ihm seine Mutter gab, war ihm nicht lästig, denn sie hatte eine Art, ihn von Melodie zu Melodie zu locken, zwang ihn nie, etwas zu üben, was ihm keine Freude machte, sodass er bestrebt blieb, aus zehn Daumen acht Finger zu machen. Sein Vater brachte ihm bei, Schweinchen und andere Tiere zu malen. Er war kein hochgebildeter kleiner Junge. Doch alles in allem blieb der silberne Löffel in seinem Mund, ohne ihn zu verziehen, auch wenn Da manchmal meinte, dass andere Kinder ihm sehr guttun würden.
Deshalb war es für ihn desillusionierend, als sie ihn im Alter von fast sieben Jahren auf dem Rücken liegend festhielt, weil er etwas tun wollte, was sie nicht für gut befand. Dieser erste Eingriff in den freien Willen eines Forsyte machte ihn fast rasend. Es lag etwas Erschreckendes in der schieren Hilflosigkeit jener Position und der Ungewissheit, ob es jemals wieder aufhören würde. Wenn sie ihn nun nie wieder aufstehen lassen würde! Fünfzig Sekunden lang litt er lautstarke Qualen. Am schlimmsten war, dass es ihm schien, Da habe so lange gebraucht, um zu merken, welch schreckliche Angst er ertragen musste. So offenbarte sich ihm auf schreckliche Weise der Mangel an Vorstellungskraft der Menschen.
Als Da ihn wieder aufstehen ließ, blieb er überzeugt, dass sie etwas Schreckliches getan hatte. Obwohl er nicht gegen sie aussagen wollte, war er aus Angst vor einer Wiederholung gezwungen gewesen, zu seiner Mutter zu gehen und zu sagen: »Mama, lass Da mich nicht noch einmal so auf dem Rücken festhalten.«
Seine Mutter, die Hände mit zwei geflochtenen Zöpfen darin über dem Kopf – couleur de feuille morte, wie der kleine Jon die Farbe ihres Haars noch nicht zu nennen gelernt hatte –, hatte ihn mit Augen wie kleine Stückchen seines braunen Samtjäckchens angesehen und geantwortet: »Nein, Liebling, das lasse ich sie nicht.«
Da sie für ihn wie eine Art Göttin war, war der kleine Jon zufrieden gewesen. Besonders, als er sie beim Frühstück, als er zufällig gerade unter dem Esstisch saß, weil er auf einen Pilz wartete, zu seinem Vater sagen hörte: »Also, Schatz, sagst du es Da, oder soll ich es ihr sagen? Er bedeutet ihr doch so viel.« Und sein Vater antwortete: »Naja, so darf sie ihm das aber nicht zeigen. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, auf dem Rücken liegend festgehalten zu werden. Kein Forsyte kann das eine Minute aushalten.«
Da ihm bewusst war, dass sie nicht wussten, dass er unterm Tisch war, überkam den kleinen Jon das ihm ziemlich neue Gefühl der Verlegenheit, und er blieb, wo er war, verzehrt von dem Verlangen nach dem Pilz.
Dies war sein erster Blick in die dunklen Abgründe des Lebens gewesen. Danach hatte sich ihm nicht viel mehr davon aufgetan, bis er eines Tages, als er, nachdem Garratt mit dem Melken fertig war, für sein Glas frische Kuhmilch hinunter zum Kuhstall gegangen war, Clovers Kalb tot vorgefunden hatte. Untröstlich und gefolgt von einem bestürzten Garratt, war er zu Da gegangen, doch dann war ihm plötzlich bewusstgeworden, dass sie nicht die Person war, die er brauchte, und er war davongeeilt, um nach seinem Vater zu suchen, und war dabei seiner Mutter in die Arme gelaufen.
»Clovers Kalb ist tot! Oh! Oh! Es sah so sanft aus!«
Die Umarmung seiner Mutter und ihre Worte: »Ja, mein Liebling, na, na!«, hatten sein Schluchzen aufhören lassen. Doch wenn Clovers Kalb sterben konnte, dann konnte alles andere auch sterben – nicht nur Bienen, Fliegen, Käfer und Hühner – und so sanft aussehen! Das war erschreckend – und schnell wieder vergessen.
Das nächste war, dass er sich auf eine Hummel gesetzt hatte, eine schmerzhafte Erfahrung, die seine Mutter viel besser verstanden hatte als Da. Danach hatte sich nichts wirklich Wichtiges mehr ereignet, bis zum Jahreswechsel, als er nach einem Tag absoluten Elends in den Genuss einer Krankheit kam, die aus kleinen Flecken, Bettruhe, Löffeln mit Honig und vielen Mandarinen bestand. Da war die Welt erblüht. Er verdankte dieses Blühen seiner Tante June, denn kaum war er ein kleines lahmes Entlein, kam sie von London herbeigeeilt und brachte die Bücher mit, die ihre eigene Berserkerseele genährt hatten, die in dem berühmten Jahr 1869 geboren worden war. Sie waren alt und bunt und gefüllt mit den ungeheuerlichsten Ereignissen. Aus ihnen las sie dem kleinen Jon vor, bis er selbst lesen durfte, woraufhin sie zurück nach London flitzte und sie ihm in einem Stapel daließ. Jene Bücher befeuerten seine Fantasie, bis seine Gedanken und seine Träume nur noch aus Leutnants zur See, Dauen, Piraten, Flößen, Sandelholzhändlern, Dampflokomotiven, Haien, Schlachten, Tataren, Indianern, Ballons, Expeditionen zum Nordpol und anderen extravaganten Vergnügen bestanden. Sobald er aufstehen durfte, takelte er sein Bett am Heck und am Bug auf und stach von dort in einer schmalen Badewanne in ein grünes Teppichmeer und fuhr zu einem Felsen, den er mithilfe seiner Mahagonischubladenknäufe erklomm, um den Horizont mit seinem Wasserglas vor den Augen nach rettenden Segelschiffen abzusuchen. Er baute täglich ein Floß aus dem Handtuchständer, dem Teetablett und seinen Kissen. Er hob den Saft von seinen Französischen Pflaumen auf und füllte ihn in ein leeres Medizinfläschchen und nahm den Rum, der daraus entstand, als Proviant für sein Floß, zusammen mit Pemmikan aus kleinen aufgesparten Stückchen Hühnerfleisch, die er am Kaminfeuer trocknete, nachdem er sich auf sie gesetzt hatte, und dazu noch Zitronensaft gegen Skorbut, welchen er aus den Schalen seiner Mandarinen und ein wenig aufgespartem Saft gewonnen hatte. Eines Morgens baute er einen Nordpol aus all seinen Kissen und Decken, mit Ausnahme des Kopfpolsters, und erreichte ihn in einem Kanu aus Birkenrinde (im Privatleben das Kamingitter) nach einer schrecklichen Begegnung mit einem Eisbären, der aus dem Kopfpolster und vier Kegeln, gehüllt in Das Nachthemd, bestand. Um seine Fantasie zu zügeln, brachte ihm sein Vater danach Ivanhoe, Bevis of Hampton, ein Buch über König Artus und Tom Browns Schuljahre. Nachdem er das erste davon gelesen hatte, baute, verteidigte und stürmte er drei Tage lang die Burg von Front de Boeuf, wobei er jede darin vorkommende Rolle übernahm außer die von Rebecca und Rowena, mit gellenden Schreien wie: »Attacke, de Bracy!«, und ähnlichen Ausrufen. Nachdem er das Buch über König Artus gelesen hatte, war er fast ausschließlich Sir Lamorac de Galis, denn obwohl dort nicht so viel über ihn stand, gefiel ihm dessen Name besser als die Namen anderer Ritter, und er ritt sein altes Schaukelpferd zu Tode, bewaffnet mit einem Bambusstock. Bevis of Hampton fand er langweilig, außerdem brauchte man dafür Wälder und Tiere und von denen hatte er keine in seinem Kinderzimmer, abgesehen von seinen beiden Katzen, Fitz und Puck Forsyte, bei denen man sich keine Freiheiten herausnehmen konnte. Für Tom Browns Schuljahre war er noch zu jung. Es herrschte Erleichterung im Haus, als er nach der vierten Woche wieder hinunter und nach draußen gehen durfte.
Da es März war, sahen die Bäume ganz besonders wie Schiffsmasten aus, und für den kleinen Jon war es ein wundervoller Frühling, sehr hart für seine Knie, seine Anzüge und die Geduld von Da, die für das Waschen und Flicken seiner Kleidung zuständig war. Jeden Morgen, gleich nach dem Frühstück, konnten seine Mutter und sein Vater, deren Fenster auf dieser Seite waren, sehen, wie er vom Arbeitszimmer kam, die Terrasse überquerte und die alte Eiche mit entschlossenem Ausdruck im Gesicht und glänzendem Haar hinaufkletterte. Er begann seinen Tag auf diese Weise, weil vor seinem Unterricht nicht genug Zeit war, um weiter hinaus zu gehen. Die Vielfältigkeit des alten Baums wurde niemals langweilig. Er hatte einen Großmast, einen Fockmast und eine Bramstange und er konnte sich immer an den Fallleinen herunterlassen – oder an den Seilen der Schaukel. Nach seinem Unterricht, der um elf Uhr zu Ende war, ging er für ein dünnes Stück Käse, einen Keks und zwei Pflaumen in die Küche – zumindest für eine Jolle genügend Proviant – und aß all dies auf irgendeine einfallsreiche Weise. Dann begann er bis an die Zähne mit Gewehr, Pistolen und Schwert bewaffnet das richtige Vormittagsklettern, wobei er auf unzählige Sklavenhändler, Indianer, Piraten, Leoparden und Bären traf. Man sah ihn zu dieser Tageszeit selten ohne Entermesser zwischen den Zähnen (wie Dick Needham), inmitten von schnell aufeinanderfolgenden Explosionen von Zündhütchen. Und er brachte jede Menge von Gärtnern mit gelben Erbsen zu Fall, die er aus seinem kleinen Gewehr abfeuerte. Er lebte ein Leben voller Kampf und Gewalt.
»Jon ist schrecklich«, sagte sein Vater zu seiner Mutter unter der Eiche. »Ich fürchte, er wird noch Seemann oder irgendetwas anderes Hoffnungsloses. Siehst du bei ihm irgendein Anzeichen, dass er Schönheit zu schätzen weiß?«
»Nicht das geringste.«
»Naja, Gott sei Dank hat er kein Faible für Räder und Motoren! Mit allem anderen kann ich mich abfinden, nur damit nicht. Aber ich wünschte, er hätte mehr Interesse an der Natur.«
»Er ist fantasievoll, Jolyon.«
»Ja, auf eine sehr blutrünstige Weise. Liebt er gerade jemand bestimmten?«
»Nein, nur jeden. Es hat nie jemand liebevolleren oder liebenswerteren als Jon gegeben.«
»Weil er dein Sohn ist, Irene.«
In diesem Moment streckte der kleine Jon, der weit über ihnen auf einem Ast lag, die beiden mit zwei Erbsen nieder. Doch dieser Gesprächsfetzen lag ihm schwer in seinem kleinen Magen. Liebevoll, liebenswert, fantasievoll, blutrünstig! Das Laub war nun auch schon dicht und es wurde Zeit für seinen Geburtstag, der jedes Jahr am zwölften Mai stattfand und immer denkwürdig war wegen dem von ihm gewählten Abendessen, das aus Kalbsbries, Pilzen, Makronen und Ingwerbier bestand. Zwischen jenem achten Geburtstag und dem Nachmittag, als er im Julisonnenlicht an jener Biegung der Treppe stand, waren jedoch mehrere wichtige Dinge passiert.
Da war, ausgelaugt vom Waschen seiner Knie oder von jenem mysteriösen Instinkt getrieben, der selbst Kindermädchen dazu bringt, ihre Schützlinge zu verlassen, genau einen Tag nach seinem Geburtstag unter einer Tränenflut gegangen, um – ausgerechnet – einen Mann zu heiraten. Der kleine Jon, vor dem man es geheim gehalten hatte, war einen Nachmittag lang untröstlich gewesen. Man hätte ihm das nicht verheimlichen dürfen! Zwei große Kisten mit Soldaten und Artillerie, zusammen mit The Young Buglers, beides war unter seinen Geburtstagsgeschenken gewesen, bewirkten in Kombination mit seinem Kummer eine Art Umwandlung, und anstatt selbst nach Abenteuern zu suchen und sein eigenes Leben zu riskieren, fing er an, sich Fantasiespiele auszudenken, in denen er die Leben zahlloser Zinnsoldaten, Murmeln, Steine und Bohnen riskierte.
Er legte Sammlungen dieser Arten von Kanonenfutter an und kämpfte abwechselnd mit ihnen im Feldzug Napoleons auf der Iberischen Halbinsel und im Siebenjährigen, im Dreißigjährigen und in anderen Kriegen, von denen er vor Kurzem in einem dicken Buch über die Geschichte Europas gelesen hatte, das seinem Großvater gehört hatte. Er veränderte sie, damit sie seinen Vorstellungen entsprachen, und focht sie auf dem gesamten Boden seines Spielzimmers aus, sodass niemand mehr hineinkommen konnte, aus Angst, Gustav II. Adolf, den König von Schweden, zu stören oder auf eine Armee von Österreichern zu treten. Wegen des Klangs des Wortes hatte er einen Narren an den Österreichern gefressen, und weil er festgestellt hatte, dass es so wenige Schlachten gab, in denen sie erfolgreich gewesen waren, musste er beim Spielen seine eigenen erfinden. Seine Lieblingsgeneräle waren Prinz Eugen, der Erzherzog Karl von Österreich-Teschen und Wallenstein. Tilly und Mack (Varieténummern hatte er seinen Vater sie einmal nennen hören, was auch immer das heißen mochte) konnte man nicht wirklich besonders gerne mögen, auch wenn sie Österreicher waren. Ebenfalls aus eufonischen Gründen liebte er Turenne abgöttisch.
Diese Phase, die seinen Eltern Sorgen bereitete, da sie ihn im Haus bleiben ließen, wenn er eigentlich draußen hätte sein sollen, dauerte den ganzen Mai und den halben Juni an, bis sein Vater ihr ein Ende setzte, indem er Tom Sawyer und Huckleberry Finn mitbrachte. Als er diese Bücher las, passierte etwas in ihm und er ging wieder nach draußen und machte sich begeistert auf die Suche nach einem Fluss. Da es auf dem Grundstück in Robin Hill keinen gab, musste er den Teich zu einem machen, wo es zum Glück Wasserlilien, Libellen, Schnaken, Binsen und drei kleine Weiden gab. Auf diesem Teich durfte er, nachdem sein Vater und Garratt durch Ausloten sichergestellt hatten, dass er einen verlässlichen Grund hatte und nirgendwo tiefer als etwa einen halben Meter war, ein kleines Faltboot haben, in dem er stundenlang umherpaddelte oder lag, um sich vor Indianer-Joe und anderen Feinden zu verstecken.
Am Teichufer baute er sich noch einen Wigwam von etwa einem Quadratmeter aus alten Keksdosen, mit einem Dach aus Zweigen. Darin machte er kleine Feuer und briet die Vögel, die er beim Jagen im Wäldchen oder in den Feldern mit seinem Gewehr nicht erschossen hatte, oder die Fische, die er im Teich nicht gefangen hatte, weil es dort keine gab. Das nahm den Rest des Junis und den Juli in Anspruch, als sein Vater und seine Mutter in Irland waren. Er führte ein einsames Leben des So-Tuns während jener fünf Wochen Sommerwetter, mit Gewehr, Wigwam, Wasser und Kanu. Und so sehr sein reges kleines Gehirn auch versuchte, den Sinn für Schönheit fernzuhalten, schlich sie sich dennoch hin und wieder für einen kurzen Augenblick in seine Wahrnehmung, saß auf den Flügeln einer Libelle, glitzerte auf den Wasserlilien oder streifte seinen Blick mit ihrem Blau, wenn er auf dem Rücken im Hinterhalt lag.
Tante June, in deren Obhut er gegeben worden war, hatte einen Erwachsenen im Haus, mit einem Husten und einem großen Klumpen Kitt, aus dem er ein Gesicht formte, deshalb kam sie so gut wie nie zum Teich hinunter, um nach ihm zu sehen. Einmal jedoch brachte sie zwei andere Erwachsene mit. Der kleine Jon, der gerade seinen nackten Körper mit den Aquarellfarben seines Vaters mit hellblauen und gelben Streifen bemalt und ein paar Entenfedern in die Haare gesteckt hatte, sah sie kommen und – legte sich zwischen den Weiden auf die Lauer. Wie er es vorhergesehen hatte, gingen sie sogleich zu seinem Wigwam und knieten sich hin, um hineinzusehen, sodass er Tante June und die erwachsene Frau mit einem markerschütternden Schrei fast vollständig skalpieren konnte, bevor sie ihn küssten. Die Namen der beiden Erwachsenen waren Tante Holly und Onkel Val, der ein braunes Gesicht hatte und ein wenig humpelte und schrecklich über ihn lachte. Er mochte Tante Holly, die auch eine Schwester zu sein schien, aber sie gingen beide noch am selben Nachmittag fort und er sah sie nicht wieder. Drei Tage bevor sein Vater und seine Mutter wieder zurückkommen sollten, ging auch Tante June in großer Eile fort, zusammen mit dem hustenden Erwachsenen und dessen Klumpen Kitt. Und Mademoiselle sagte: »Der arme Mann, er war sehr krank. Du darfst nicht in sein Zimmer gehen, Jon.« Der kleine Jon, der selten etwas tat, nur weil man ihm gesagt hatte, dass er es nicht tun durfte, ging nicht hinein, obwohl er gelangweilt und einsam war. In Wahrheit waren die Tage des Teichs vorüber und er war innerlich durch und durch von Unruhe und dem Wunsch nach etwas Anderem erfüllt – kein Baum, kein Gewehr – etwas Sanftes. Jene letzten beiden Tage waren ihm wie Monate erschienen, trotz Cast up by the Sea, in dem er von Mother Lee und ihrem schrecklichen verheerenden Freudenfeuer las. Er war die Treppen in jenen zwei Tagen vielleicht hundert Mal auf und ab gegangen und hatte sich mehrmals vom Kinderspielzimmer, wo er nun schlief, in das Zimmer seiner Mutter geschlichen, alles dort angesehen, ohne etwas anzufassen, und war dann weiter ins Ankleidezimmer gegangen, und auf einem Bein neben der Badewanne stehend, wie Slingsby, hatte er geheimnisvoll geflüstert: »Ho, ho, ho! Donnerwetter!« – das sollte Glück bringen. Dann hatte er sich zurückgeschlichen, den Kleiderschrank seiner Mutter geöffnet und tief eingeatmet und der Duft schien ihn näher an etwas zu bringen – an was, wusste er nicht.
Er hatte ebendies gerade erst getan, als er in dem Sonnenstrahl stand und überlegte, auf welche der verschiedenen Arten er das Treppengeländer hinunterrutschen sollte. Sie schienen ihm alle dumm, und von einer plötzlichen Trägheit befallen, begann er eine Stufe nach der anderen hinunterzusteigen. Während diesem Abstieg, konnte er sich ganz deutlich an seinen Vater erinnern – an den kurzen grauen Bart, das Zwinkern in seinem tiefen Blick, die Falte zwischen seinen Augen, das lustige Lächeln, die dünne Gestalt, die dem kleinen Jon immer so groß vorkam, doch seine Mutter konnte er nicht sehen. Alles, was sie verkörperte, war etwas sanft Wiegendes mit zwei dunkeln Augen, die zu ihm zurückblickten, und der Duft ihrer Kleidung.
Bella war in der Halle, sie zog die dicken Vorhänge zur Seite und öffnete die Haustür. Der kleine Jon sagte in bettelndem Tonfall:
»Bella!«
»Ja, Jon.«
»Lass uns doch unter der Eiche Tee trinken, wenn sie kommen, ich weiß, das wäre ihnen am liebsten.«
»Du meinst, das wäre dir am liebsten.«
Der kleine Jon dachte nach.
»Nein, ihnen, weil sie mir damit eine Freude machen.«
Bella lächelte. »Gut, ich bringe den Tee nach draußen, wenn du still hier wartest und keinen Unfug anstellst, bevor sie kommen.«
Der kleine Jon setzte sich auf die unterste Stufe und nickte.
Bella kam zu ihm und sah ihn prüfend an.
»Steh auf!«, sagte sie.
Der kleine Jon stand auf. Sie musterte ihn von hinten, er war nicht grün und seine Knie schienen sauber zu sein.
»In Ordnung!«, sagte sie. »Meine Güte, wie braun du bist! Gib mir einen Kuss!«
Und der kleine Jon bekam einen Schmatz aufs Haar.
»Welche Marmelade?«, fragte er. »Ich habe keine Lust mehr auf Warten.«
»Stachelbeere und Erdbeere.«
Mm! Die mochte er am liebsten!
Nachdem sie gegangen war, saß er fast eine Minute lang still da. Es war ruhig in der großen Halle, die nach Osten hin offen war, sodass er einen seiner Bäume sehen konnte, eine Brigg, die sehr langsam über den oberen Rasen segelte. In der äußeren Halle warfen die Säulen schräge Schatten. Der kleine Jon stand auf, sprang auf einen davon und lief um die Gruppe von Schwertlilien, die das Bassin aus grau-weißem Marmor in der Mitte füllten. Die Blumen waren hübsch, aber sie dufteten nur ganz wenig. Er stand in der offenen Tür und sah nach draußen. Was, wenn – wenn sie nicht kommen würden! Er hatte so lange gewartet, dass er das Gefühl hatte, das nicht ertragen zu können, und mit einem Schlag wanderte seine Aufmerksamkeit von derartiger Endgültigkeit zu den Staubkörnchen in dem hereinfallenden bläulichen Sonnenlicht: Er streckte die Hand hoch und versuchte welche davon zu fangen. Bella hätte dieses Luftstück abstauben sollen! Aber vielleicht war es gar kein Staub – sondern das, woraus das Sonnenlicht gemacht war, und er ging nachsehen, ob das Sonnenlicht draußen genauso war. War es nicht. Er hatte gesagt, dass er still in der Halle bleiben würde, aber er konnte es einfach nicht mehr länger, und er ging über den Kies der Auffahrt und legte sich auf der anderen Seite ins Gras. Er pflückte sechs Gänseblümchen, wählte mit Bedacht verschiedene Namen für sie – Sir Lamorac, Sir Tristram, Sir Lancelot, Sir Palimedes, Sir Bors, Sir Gawain – und ließ immer zwei gegeneinander kämpfen, bis nur noch Sir Lamorac, den er wegen seines besonders dicken Stängels ausgewählt hatte, seinen Kopf hatte, und selbst der sah nach drei Auseinandersetzungen mitgenommen und wackelig aus. Ein Käfer krabbelte langsam im Gras, das bald wieder gemäht werden musste. Jeder Halm war ein kleiner Baum, um dessen Stamm der Käfer kriechen musste. Der kleine Jon streckte Sir Lamorac mit den Füßen voran aus und stupste das Tierchen damit. Es zappelte hektisch. Der kleine Jon lachte, verlor das Interesse und seufzte. Sein Herz fühlte sich leer an. Er rollte sich auf den Rücken. Die blühenden Linden strömten einen Honigduft aus und das Blau des Himmels war schön, mit ein paar weißen Wolken, die wie Zitroneneis aussahen, und vielleicht auch so schmeckten. Er konnte Bob Way down upon the Suwannee River auf seiner Ziehharmonika spielen hören, und es gefiel ihm und es machte ihn traurig. Er rollte sich wieder auf den Bauch und drückte sein Ohr an den Boden – Indianer konnten Dinge hören, die ganz weit weg waren – aber er konnte nichts hören – nur die Ziehharmonika! Und fast genau in diesem Moment hörte er ein Knirschen, ein schwaches Hupen. Ja! Es war ein Auto – sie kamen – sie kamen! Er sprang auf. Sollte er in der Vorhalle warten oder schnell nach oben rennen und dann, wenn sie hereinkamen, rufen: »Schaut mal!«, und langsam das Geländer hinunterrutschen, mit dem Kopf voran? Sollte er? Das Auto fuhr in die Auffahrt ein. Es war zu spät! Und er wartete einfach und sprang auf und ab vor Aufregung. Das Auto kam schnell, surrte und blieb stehen. Sein Vater stieg aus, ganz so, wie er in echt aussah. Er beugte sich hinunter und der kleine Jon hopste zu ihm hoch – sie stießen zusammen. Sein Vater sagte: »Hopsala! Na, du bist aber braun geworden, alter Mann!« – so, wie er immer redete. Und das Gefühl der Erwartung – dem Wunsch nach etwas – brannte weiter ungestillt in dem kleinen Jon. Dann sah er mit einem langen, schüchternen Blick seine Mutter, in einem blauen Kleid, einen blauen Schal über ihrer Kappe und ihrem Haar, lächelnd. Er hüpfte so hoch, wie er konnte, verschlang seine Beine hinter ihrem Rücken und umarmte sie. Er hörte sie nach Luft schnappen und fühlte, wie sie ihn ebenfalls an sich drückte. Erst dann blickten seine sehr dunkelblauen Augen in ihre sehr dunkelbraunen, bis ihre Lippen seine Augenbrauen küssten, und als er sie so fest er konnte drückte, hörte er sie ächzen und lachen und sagen: »Du bist stark, Jon!«
Daraufhin ließ er sich hinuntergleiten, rannte in die Halle und zog sie an der Hand mit.
Während er unter der Eiche seine Marmelade aß, fielen ihm an seiner Mutter Dinge auf, die er noch nie gesehen zu haben schien: zum Beispiel, dass ihre Wangen cremig aussahen, dass silbrige Strähnen in ihrem dunkelgoldenen Haar waren, dass ihr Hals keinen Knubbel wie der von Bella hatte, dass sie leise kam und ging. Ihm fielen auch ein paar feine Linien auf, die von ihren Augenwinkeln aus verliefen, und schöne Schatten unter ihren Augen.
Sie war so wunderschön, schöner als Da oder Mademoiselle, oder als Tante June, oder sogar als Tante Holly, die ihm gefallen hatte, sogar schöner als Bella, die rosige Wangen hatte und immerzu plötzlich irgendwo auftauchte. Diese neue Schönheit seiner Mutter hatte eine Art besondere Bedeutung und er aß weniger als er gedacht hätte.
Als sie mit dem Tee fertig waren, wollte sein Vater mit ihm ein wenig durch die Gärten gehen. Er hatte eine lange Unterhaltung mit seinem Vater über die Dinge im Allgemeinen, wobei er versuchte, sein Privatleben zu umgehen – Sir Lamorac, die Österreicher und die Leere, die er in jenen letzten drei Tagen empfunden hatte und die nun so plötzlich wieder gefüllt war. Sein Vater erzählte ihm von einem Ort namens Glensofantrim, wo er und seine Mutter gewesen waren, und von den kleinen Wesen, die dort aus dem Boden kamen, wenn es sehr still war. Der kleine Jon blieb stehen, die Spitze seiner Füße zueinander gedreht.
»Glaubst du wirklich, dass sie das tun, Papa?« »Nein, Jon, aber ich dachte, du würdest das vielleicht.«
»Warum?«
»Du bist jünger als ich, und es sind Elfen.« Der kleine Jon verzog das Grübchen in seinem Kinn.
»Ich glaube nicht an Elfen. Ich sehe nie welche.« »Hm!«, sagte sein Vater.
»Sieht Mama welche?«
Sein Vater lächelte sein lustiges Lächeln.
»Nein, sie sieht nur Pan.«
»Was ist Pan?«
»Der ziegenartige Gott, der an wilden und schönen Orten umherspringt.«
»War er in Glensofantrim?«
»Mama hat gesagt, dass er das war.«
Der kleine Jon hob seine Füße und ging voran.
»Hast du ihn gesehen?«
»Nein, ich habe nur Aphrodite Anadyomene gesehen.«
Der kleine Jon dachte nach, Aphrodite kam in seinem Buch über die Griechen und die Trojaner vor. Dann war also Anna ihr Tauf- und Dyomene ihr Nachname?
Doch auf Nachfrage stellte sich heraus, dass es ein Wort war, das die aus dem Schaum Entstiegene hieß.
»Ist sie aus dem Schaum in Glensofantrim gestiegen?«
»Ja, jeden Tag.«
»Wie sieht sie denn aus, Papa?«
»Wie Mama.«
»Oh, dann muss sie …«, doch dann hielt er inne, rannte zu einer Mauer, kletterte hinauf und sofort wieder hinunter. Die Entdeckung, dass seine Mutter schön war, war eine, so fühlte er, die er unbedingt für sich behalten musste. Doch sein Vater brauchte so lange für seine Zigarre, dass er schließlich gezwungen war, zu sagen: »Ich will sehen, was Mama mitgebracht hat. Macht es dir etwas aus, Papa?«
Er gab ein niederes Motiv als Vorwand an, um nicht unmännlich zu erscheinen, und war ein wenig irritiert, als sein Vater wie durch ihn hindurchsah, bedeutungsvoll seufzte und antwortete: »In Ordnung, alter Junge, geh du nur und hab sie lieb.«
Er ging gespielt langsam und rannte dann, um dies wieder wettzumachen. Er betrat ihr Schlafzimmer von seinem eigenen aus, da die Tür offenstand. Sie kniete noch vor ihrem Koffer und er blieb ganz still dicht vor ihr stehen.
Sie richtete sich auf und sagte: »Na, Jon?«
»Ich dachte, ich schau mal vorbei.«
Nachdem er eine weitere Umarmung gegeben und bekommen hatte, kletterte er auf die Fensterbank, setzte sich in den Schneidersitz und beobachtete sie beim Auspacken. Der Vorgang bereitete ihm eine Freude, wie er sie bis dahin nicht gekannt hatte, teils weil sie Dinge herausnahm, die verdächtig aussahen, und teils weil er sie gern ansah. Sie bewegte sich anders als jeder andere, besonders als Bella, sie war sicher die am vornehmsten aussehende Person, die er je gesehen hatte. Schließlich war sie mit ihrem Koffer fertig und kniete sich vor ihn.
»Hast du uns vermisst, Jon?«
Der kleine Jon nickte, und nachdem er so seine Gefühle zugegeben hatte, nickte er weiter.
»Aber Tante June war doch da?«
»Oh, die hatte einen Mann mit Husten dabei.«
Das Gesicht seiner Mutter veränderte sich und sah fast verärgert aus. Er fügte schnell hinzu: »Es war ein armer Mann, Mama, er hat schrecklich gehustet, ich – ich mochte ihn.«
Seine Mutter legte ihre Hände um seine Taille.
»Du magst doch jeden, oder, Jon?«
Der kleine Jon überlegte.
»Bis zu einem gewissen Grad«, sagte er. »Tante June ist am Sonntag mit mir in die Kirche gegangen.«
»In die Kirche? Ah!«
»Sie wollte sehen, welche Wirkung das auf mich hat.«
»Und hatte es eine Wirkung auf dich?«
»Ja. Ich habe mich ganz komisch gefühlt, darum hat sie mich sehr schnell wieder nach Hause gebracht. Ich war aber dann doch nicht krank. Ich bin ins Bett gegangen und habe ein heißes Wasser mit Schnaps bekommen und The Boys of Beechwood gelesen. Es war toll.«
Seine Mutter biss sich auf die Lippe.
»Wann war das?«
»Ach, etwa – lange her. Ich wollte, dass sie mich noch einmal mitnimmt, aber sie wollte nicht. Du und Papa, ihr geht nie in die Kirche, oder?«
»Nein, das tun wir nicht.«
»Warum nicht?«
Seine Mutter lächelte.
»Naja, mein Schatz, wir sind beide gegangen, als wir klein waren. Vielleicht waren wir noch zu klein.«
»Es ist also gefährlich«, sagte der kleine Jon.
»Du sollst dir dein eigenes Urteil über all diese Dinge bilden, wenn du älter bist.«
Der kleine Jon überlegte und sagte dann: »Ich will gar nicht so viel älter werden. Ich will nicht in die Schule gehen.«
Ein plötzliches Verlangen, mehr zu sagen, zu sagen, was er wirklich fühlte, ließ ihn erröten. »Ich – ich will bei dir bleiben und dich liebhaben, Mama.«
Dann fügte er mit dem Gefühl, die Situation verbessern zu müssen, schnell hinzu: »Ich will heute Abend auch nicht ins Bett gehen. Ich bin es einfach müde, jeden Abend ins Bett zu gehen.«
»Hattest du wieder Alpträume?«
»Nur ungefähr einen. Kann ich heute Nacht die Tür zu deinem Zimmer offenlassen, Mama?«
»Ja, ein kleines Stück.« Der kleine Jon seufzte zufrieden.
»Was hast du in Glansofantrim gesehen?«
»Nichts als Schönheit, mein Schatz.«
»Was genau ist Schönheit?«
»Was genau – oh, Jon, das ist eine schwierige Frage.«
»Kann ich sie zum Beispiel sehen?« Seine Mutter stand auf und setzte sich neben ihn. »Du siehst sie jeden Tag. Der Himmel ist schön, die Sterne, und mondhelle Nächte, und dann die Vögel, die Blumen, die Bäume – sie alle sind schön. Sieh aus dem Fenster – dort ist Schönheit für dich, Jon.«
»Oh! Ja, die Aussicht. Ist das alles?«
»Alles? Nein. Das Meer ist wunderschön, und die Wellen mit ihrem Schaumkamm.«
»Bist du jeden Tag aus dem Schaum gestiegen, Mama?«
Seine Mutter lächelte. »Naja, wir haben gebadet.«
Der kleine Jon streckte plötzlich die Arme aus und umfasste mit seinen Händen ihren Nacken. »Ich weiß«, sagte er geheimnisvoll, »du bist es, wirklich, und alles andere scheint oder tut nur so.«
Sie seufzte, lachte und sagte: »Ach, Jon!«
Der kleine Jon sagte kritisch: »Findest du zum Beispiel Bella schön? Ich nicht wirklich.«
»Bella ist jung, das hat schon etwas.«
»Aber du siehst jünger aus, Mama. Wenn man gegen Bella stößt, tut das weh. Ich glaube nicht, dass Da schön war, wenn ich es mir recht überlege, und Mademoiselle ist fast schon hässlich.«
»Mademoiselle hat ein sehr nettes Gesicht.«
»Oh, ja, nett. Ich mag deine kleinen Strahlen, Mama.«
»Strahlen?«
Der kleine Jon legte seinen Finger an den äußeren Winkel ihres Auges.
»Ach, die? Aber die sind ein Zeichen des Alters.«
»Die kommen, wenn du lächelst.«
»Aber früher war das nicht so.«
»Oh, naja, ich mag sie jedenfalls. Liebst du mich, Mama?«
»Ja – ich liebe dich, mein Schatz.«
»Ganz arg?«
»Ganz arg!«
»Mehr, als ich dachte?«
»Viel, viel mehr.«
»Ich dich auch, dann sind wir also quitt.«
In dem Bewusstsein, dass er sich nie zuvor in seinem Leben eine solche Blöße gegeben hatte, spürte er einen plötzlichen Umschwung zu der Männlichkeit von Sir Lamorac, Dick Needham, Huck Finn und anderen Helden.
»Soll ich dir mal was zeigen?«, sagte er, schlüpfte aus ihren Armen und machte einen Kopfstand. Dann, angefeuert von ihrer offensichtlichen Bewunderung, stieg er aufs Bett und warf sich aus dem Stand mit dem Kopf voran auf den Rücken, ohne etwas mit den Händen zu berühren. Er wiederholte es mehrere Male.
An jenem Abend blieb er, nachdem er ihre Mitbringsel inspiziert hatte, fürs Abendessen auf und saß zwischen ihnen an dem kleinen runden Tisch, den sie nutzten, wenn sie allein waren. Er war schrecklich aufgeregt. Seine Mutter trug ein französisch-graues Kleid mit cremefarbener Spitze aus kleinen Rosen um ihren Hals, der brauner als die Spitze war. Er sah sie unentwegt an, bis das lustige Lächeln seines Vaters ihn schließlich plötzlich seine Aufmerksamkeit auf seine Ananasscheibe richten ließ. Als er zu Bett ging, war es später, als er je aufgeblieben war. Seine Mutter ging mit ihm nach oben und er zog sich sehr langsam aus, damit sie noch länger dablieb.
Als er schließlich nur noch seinen Schlafanzug anhatte, sagte er: »Versprich mir, dass du noch bleibst, bis ich meine Gebete gesagt habe!«
»Ich verspreche es.«
Der kleine Jon kniete sich hin, drückte das Gesicht in sein Bett und flüsterte hastig los und öffnete hin und wieder ein Auge, um sie ganz still und mit einem Lächeln im Gesicht dastehen zu sehen. Vater unser im Himmel – so lautete sein letztes Gebet – geheiligt sei deine Mama, dein Königreich Mama, wie im Himmel so auf Erden, unsere tägliche Mama gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie im Himmel so auf Erden, und sei auch du unser Schuldiger, denn dein ist das Böse, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amama! Pass auf!
Er sprang auf und blieb eine lange Minute in ihren Armen. Als er schließlich im Bett lag, hielt er weiter ihre Hand fest. »Weiter machst du die Tür aber nicht zu, oder? Bleibst du noch lange da, Mama?«
»Ich muss nach unten und für Papa Klavier spielen.«
»Ach so, naja, dann höre ich dich ja.«
»Hoffentlich nicht, du musst doch schlafen.«
»Ich kann doch jede andere Nacht schlafen.«
»Heute ist eine Nacht wie jede andere auch.«
»Oh, nein – heute ist eine ganz besondere Nacht.«
»In ganz besonderen Nächten schläft man ganz besonders gut.«
»Aber wenn ich einschlafe, Mama, dann höre ich dich nicht hochkommen.«
»Na, wenn ich hochkomme, dann schaue ich zu dir herein und gebe dir einen Kuss, und wenn du dann noch wach bist, dann wirst du wissen, und wenn nicht, dann weißt du trotzdem, dass du einen bekommen hast.«
Der kleine Jon seufzte. »Na schön«, sagte er, »damit werde ich mich wohl zufriedengeben müssen. Mama?«
»Ja?«
»Wie hieß nochmal die, an die Papa glaubt? Venus Anna Diomedes?«
»Oh, mein Engel! Anadyomene.«
»Genau! Aber ich finde meinen Namen für dich viel besser.«
»Und welchen Namen hast du für mich, Jon?«
Der kleine Jon antwortete schüchtern: »Guinevere! Der kommt bei der Tafelrunde vor – das ist mir gerade erst eingefallen, nur hat sie ihre Haare natürlich offen getragen.«
Die Augen seiner Mutter blickten an ihm vorbei und schienen in die Ferne zu schweifen.
»Und du wirst auch nicht vergessen, hereinzukommen, Mama?«
»Nicht, wenn du jetzt schläfst.«
»Abgemacht.« Und der kleine Jon schloss die Augen.
Er spürte ihre Lippen auf seiner Stirn, hörte ihre Schritte, öffnete seine Augen, um zu sehen, wie sie durch die Tür glitt, seufzte und schloss sie wieder.
Dann begann die lange Zeit.
Für etwa zehn Minuten versuchte er brav zu schlafen, indem er ganz viel Disteln in einer Reihe zählte, Das alter Trick zum Einschlafen. Ihm schien es, als zählte er schon seit Stunden. Es musste, so dachte er, bald Zeit sein, dass sie heraufkam. Er warf die Bettdecke zurück. »Mir ist heiß!«, sagte er, und seine Stimme klang komisch in der Dunkelheit, wie die Stimme eines anderen. Warum kam sie nicht? Er setzte sich auf. Er musste nachsehen! Er stieg aus dem Bett, ging zum Fenster und schob den Vorhang ein Stück zur Seite. Es war nicht dunkel, aber er konnte nicht sagen, ob das am Tageslicht lag oder am Mond, der sehr groß war. Er hatte ein komisches, böses Gesicht, als ob er ihn auslache, und er wollte ihn nicht ansehen. Dann fiel ihm wieder ein, dass seine Mutter gesagt hatte, mondhelle Nächte seien schön, und er starrte weiter einfach so nach draußen. Die Bäume warfen dunkle Schatten, der Rasen sah aus wie verschüttete Milch und er konnte ganz, ganz weit sehen, wirklich weit! – über die ganze Welt, und es sah alles anders und verschwommen aus. Außerdem roch es gut in seinem offenen Fenster.
Ich wünschte ich hätte eine Taube wie Noah!, dachte er.
»Es scheint der Mond mit hellem Gesicht, er leuchtet und leuchtet und bringt uns Licht.«
Nach diesem Reim, der ihm ganz plötzlich eingefallen war, vernahm er Musik, ganz leise – schön! Mama spielte! Ihm fiel ein, dass er noch eine Makrone hatte, die er in seiner Kommode aufgehoben hatte, und er holte sie und ging zurück ans Fenster. Er lehnte sich hinaus und kaute immer kurz und hielt dann wieder für einen Moment inne, um die Musik besser hören zu können. Da hatte immer gesagt, im Himmel spielten die Engel Harfe, aber das war nicht halb so schön wie das Klavierspiel seiner Mutter in der mondhellen Nacht, während er seine Makrone aß. Ein Maikäfer summte vorbei, eine Motte flog ihm ins Gesicht, die Musik hörte auf und der kleine Jon zog den Kopf wieder zurück. Jetzt musste sie kommen! Er wollte nicht, dass sie sah, dass er noch wach war. Er kroch wieder ins Bett und zog die Decke fast ganz über seinen Kopf, doch er hatte den Vorhang ein wenig offengelassen, sodass ein Mondlichtstrahl hereinfiel. Er schien schräg über den Boden, nahe des Fußendes des Betts, und er beobachtete, wie er ganz langsam immer näher zu ihm wanderte, als ob er lebendig wäre. Die Musik fing wieder an, aber er konnte sie jetzt nur noch gerade eben so hören, schläfrige Musik, schön – schläfrige – Musik – schläfrige – schlä …
Und die Zeit verstrich, die Musik wurde lauter, leiser, verklang, der Mondlichtstrahl wanderte zu seinem Gesicht. Der kleine Jon wälzte sich im Schlaf bis er auf dem Rücken lag und eine seiner braunen Fäuste umklammerte noch immer die Bettdecke. Seine Augenwinkel zuckten – er hatte begonnen, zu träumen. Er träumte, dass er Milch aus einer Schüssel trank, die der Mond war, während ihm gegenüber eine große schwarze Katze saß und ihn mit einem lustigen Lächeln wie dem seines Vaters beobachtete.
Er hörte, wie sie flüsterte: »Trink nicht zu viel!« Die Milch war natürlich für die Katze, und er streckte freundschaftlich seine Hand aus, um das Tier zu streicheln, doch es war nicht mehr da, die Schüssel hatte sich in ein Bett verwandelt, in dem er lag, und als er versuchte, herauszusteigen, konnte er die Bettkante nicht finden, er konnte sie nicht finden – er – er – konnte nicht hinaus! Es war schrecklich!
Er wimmerte im Schlaf.
Das Bett hatte auch noch angefangen, sich zu drehen, es war um ihn und in ihm, es drehte und drehte sich und fing an zu brennen und Mother Lee aus Cast up by the Sea schürte das Feuer! Oh, wie furchterregend sie aussah! Immer schneller und schneller, bis er und das Bett und Mother Lee und der Mond und die Katze alle ein einziges Rad waren, das sich immer weiter und immer höher drehte – schrecklich – schrecklich – schrecklich!
Er schrie laut auf. Eine Stimme, die »Liebling, Liebling!« sagte, drang durch das Rad und er erwachte, auf seinem Bett stehend, die Augen weit geöffnet.
Seine Mutter war da, ihr Haar wie das von Guinevere, und er umklammerte sie und vergrub sein Gesicht darin.
»Oh! Oh!«
»Ist schon gut, mein Schatz. Jetzt bist du wach. Na, na! Alles ist gut!«
Doch der kleine Jon sagte weiter: »Oh! Oh!«
Ihre Stimme sprach weiter samtig in sein Ohr: »Das war das Mondlicht, mein Schatz, das auf dein Gesicht geschienen hat.«
Der kleine Jon murmelte in ihr Nachthemd: »Du hast gesagt, es ist schön. Oh!«
»Darin zu schlafen nicht, Jon. Wer hat es denn hereingelassen? Hast du die Vorhänge aufgezogen?«
»Ich wollte sehen, wie spät es ist, ich – ich habe hinausgeschaut, ich – ich habe dich spielen hören, Mama, ich – ich habe meine Makrone gegessen.« Doch langsam beruhigte er sich wieder, und das Gefühl, seine Angst rechtfertigen zu müssen, erwachte wieder in ihm.
»Mother Lee hat sich in mir gedreht und ganz arg gebrannt«, murmelte er.
»Naja, Jon, was hast du auch anderes erwartet, wenn du nach dem Zubettgehen noch Makronen isst?«
»Nur eine, Mama, das hat die Musik noch viel schöner gemacht. Ich habe auf dich gewartet – ich habe fast gedacht, es wäre morgen.«
»Mein Spatz, es ist erst elf Uhr.«
Der kleine Jon schwieg und rieb seine Nase an ihrem Hals.
»Mama, ist Papa in deinem Zimmer?«
»Heute Nacht nicht.«
»Kann ich zu dir kommen?«
»Wenn du möchtest, mein Schatz.«
Wieder halb er selbst, trat der kleine Jon einen Schritt zurück.
»Du siehst anders aus, Mama, viel jünger.«
»Das liegt am Haar, Schatz.«
Der kleine Jon umfasste es, dick, dunkelgolden mit ein paar silbernen Strähnen.
»Es gefällt mir«, sagte er. »So gefällst du mir am besten.«
Er nahm ihre Hand und zog sie Richtung Tür. Nachdem sie hindurchgegangen waren, schloss er sie mit einem Seufzer der Erleichterung.
»Welche Seite vom Bett willst du haben, Mama?«
»Die linke Seite.«
»Na gut.«
Damit sie keine Gelegenheit hatte, es sich anders zu überlegen, vertat der kleine Jon keine Zeit, sondern stieg gleich in das Bett, das viel weicher als sein eigenes schien. Er seufzte noch einmal, drückte den Kopf ins Kissen und lag da und betrachtete die Schlacht der Streitwägen und Schwerter und Speere, die immer außerhalb von wollenen Bettdecken tobte, von denen die kleinen Härchen gegen das Licht in die Höhe standen.
»Da war wirklich nichts, oder?«, sagte er.
Seine Mutter, die vor ihrem Spiegel saß, antwortete: »Nichts außer dem Mond und deiner aufgeheizten Fantasie. Du darfst dich nicht so hineinsteigern, Jon.«
Doch der kleine Jon, der seine Nerven noch immer nicht wieder vollständig unter Kontrolle hatte, erwiderte prahlerisch: »Natürlich hatte ich eigentlich gar nicht wirklich Angst!« Und wieder beobachtete er die Speere und Streitwägen. Das schien alles sehr lang zu dauern.
»Oh, Mama, beeil dich!«
»Liebling, ich muss mir die Haare flechten.«
»Ach, heute Nacht nicht. Morgen musst du sie eh nur wieder aufflechten. Ich bin jetzt zum Einschlafen müde, wenn du nicht kommst, kann ich so schnell nicht wieder zum Einschlafen müde sein.«
Seine Mutter stand weiß und fließend vor dem dreiteiligen Spiegel, er konnte sie dreimal sehen, mit nach vorne gebeugtem Hals und vom Licht beschienenem Haar und einem Lächeln in ihren dunklen Augen. Es war unnötig und er sagte: »Komm jetzt, Mama, ich warte.«
»Na schön, mein Schatz, ich komme.«
Der kleine Jon machte die Augen zu. Alles nahm einen höchst zufriedenstellenden Ausgang, sie musste sich nur beeilen! Er spürte, wie das Bett wackelte, sie stieg hinein. Und mit noch immer geschlossenen Augen sagte er schläfrig: »Das ist schön, oder?«
Er hörte ihre Stimme, spürte ihre Lippen auf seiner Nase, kuschelte sich neben sie, die wachlag und ihn mit ihren liebevollen Gedanken umarmte, und fiel in den traumlosen Schlaf, der seine Vergangenheit abschloss.
Zu Vermieten
»Aus beider Feinde unheilvollem Schoß
Entspringt ein Liebespaar, unsternbedroht.«
Romeo und Julia.
Für Charles Scribner
Teil I
Begegnung
Am Nachmittag des zwölften Mai 1920 verließ Soames Forsyte das Knightsbridge Hotel, in dem er gerade logierte, mit der Absicht, eine Gemäldeausstellung in einer Galerie in der Nähe der Cork Street zu besuchen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Er ging zu Fuß. Seit dem Krieg nahm er kein Taxi mehr, wenn es nicht sein musste. Die Fahrer waren, seiner Meinung nach, ungehobelte Kerle, obwohl sie nun, wo der Krieg vorbei war und das Angebot langsam wieder größer als die Nachfrage wurde, der Gewohnheit der menschlichen Natur entsprechend wieder höflicher wurden. Dennoch hatte er ihnen nicht verziehen, denn er verband sie untrennbar mit düsteren Erinnerungen und nun, wie alle Angehörigen ihrer Klasse, vage mit Revolution. Die große Angst, die er während des Krieges durchlebt hatte, und die noch größere Angst, die er seither im Frieden hatte ausstehen müssen, hatte sich auf die Psyche eines Menschen von zäher Beharrlichkeit ausgewirkt. Er hatte im Geiste so oft den Ruin erlebt, dass er aufgehört hatte, zu glauben, dass er tatsächlich möglich wäre. Wenn man viertausend pro Jahr für Einkommenssteuer und Steueraufschlag hinblättern musste, konnte es einem ja wohl kaum noch schlechter gehen! Ein Vermögen von einer Viertelmillion, nur durch eine Ehefrau und eine Tochter belastet und auf verschiedenste Weisen investiert, gewährte verlässliche Garantie, selbst gegen jene »abenteuerliche Idee« – eine Steuer auf Kapital. Und was die Konfiszierung von Kriegsgewinnen anbetraf, da war er absolut dafür, denn er hatte keine, und »das geschah den Kerlen nur recht!« Außerdem hatten Bilder eher noch an Wert gewonnen und mit seiner Sammlung war es seit Kriegsbeginn besser gelaufen als je zuvor. Auch die Luftangriffe hatten sich positiv auf ein von Natur aus vorsichtiges Wesen ausgewirkt und einen bereits zähen Charakter noch härter gemacht. Die Gefahr des vollständigen Verschwindens ließ einen weniger besorgt über das nur partielle Schwinden durch Abgaben und Steuern sein, während das gewohnheitsmäßige Verfluchen der Unverschämtheit der Deutschen ganz natürlich dazu geführt hatte, die Unverschämtheit der Labour-Leute zu verfluchen, wenn nicht offen, so doch zumindest im Innersten seiner Seele.
Er ging zu Fuß. Er hatte ohnehin noch Zeit genug, denn er wollte sich um vier Uhr mit Fleur in der Galerie treffen, und es war erst halb drei. Es tat ihm gut, zu Fuß zu gehen – seine Leber drückte ihn ein wenig und seine Nerven waren ziemlich strapaziert. Seine Frau war immerzu unterwegs, wenn sie in London war, und seine Tochter trieb sich ebenfalls immer herum, wie die meisten jungen Frauen seit dem Krieg. Dennoch sollte er dankbar sein, dass sie noch zu jung gewesen war, um selbst irgendetwas in diesem Krieg geleistet zu haben. Natürlich hatte er den Krieg von Anfang an unterstützt, mit ganzer Seele, doch zwischen dieser Form der Unterstützung und der Unterstützung des Krieges mit den Körpern seiner Frau und Tochter lag eine Kluft, die auf etwas Altmodischem in ihm gründete, das Gefühlsüberschwang verabscheute. Er war zum Beispiel entschieden dagegen gewesen, dass Annette, so attraktiv und 1914 erst vierunddreißig, in ihr Heimatland Frankreich ging, ihr »chère patrie«, wie sie es, angeregt durch den Krieg, zu nennen begonnen hatte, um ihre »braves Poilus« zu pflegen – sicher nicht! Ihre Gesundheit und ihr Aussehen ruinieren! Als ob sie tatsächlich eine Krankenschwester wäre! Das hatte er nicht zugelassen. Sollte sie doch zu Hause für sie nähen oder stricken! Folglich war sie nicht gegangen und nie wieder ganz dieselbe gewesen. Sie neigte dazu, ihn zu verspotten, nicht offen, sondern durch ständige kleine Bemerkungen, und dieser unschöne Zug hatte sich verstärkt. Was Fleur anbetraf, so hatte der Krieg die strittige Frage geklärt, ob sie zur Schule gehen sollte oder nicht. Es war besser, sie war weit weg von ihrer Mutter in ihrer Kriegsstimmung, von der Gefahr von Luftangriffen und von der Anregung zu überzogenem Verhalten, also hatte er sie in einem Internat untergebracht, das so weit im Westen lag, wie es ihm mit exzellenter Qualität vereinbar erschien, und sie schrecklich vermisst. Fleur! Er hatte den etwas ungewöhnlichen Namen, für den er sich bei ihrer Geburt so plötzlich entschieden hatte, nie bereut – auch wenn es ein deutliches Zugeständnis an die Franzosen gewesen war. Fleur! Ein hübscher Name – ein hübsches Kind! Aber unstet – zu unstet, und eigensinnig! Und sie wusste, welche Macht sie über ihren Vater hatte! Soames dachte oft darüber nach, dass es ein Fehler war, so in seine Tochter vernarrt zu sein. Alt und vernarrt! Fünfundsechzig! Er wurde alt, aber er fühlte sich nicht so, denn seine zweite Ehe hatte sich, vielleicht glücklicherweise angesichts Annettes Jugend und guten Aussehens, als leidenschaftslos erwiesen. Er hatte einmal in seinem Leben wahre Leidenschaft empfunden – für seine erste Frau – Irene. Ja, und dieser Kerl, sein Cousin Jolyon, der mit ihr auf und davon war, sah sehr tattrig aus, hieß es. Kein Wunder mit zweiundsiebzig, nach zwanzig Jahren in dritter Ehe!
Soames blieb einen Augenblick stehen, um sich über das Geländer der Rotten Row zu beugen. Ein passender Ort, um Erinnerungen nachzuhängen, auf halbem Weg zwischen jenem Haus in der Park Lane, in dem er geboren worden war und in dem seine Eltern gestorben waren, und dem kleinen Haus am Montpellier Square, in dem er vor fünfunddreißig Jahren seine erste Ausgabe des Ehelebens genossen hatte. Nun, nach zwanzig Jahren der zweiten Ausgabe, erschien ihm jene alte Tragödie wie ein früheres Leben – das geendet hatte, als Fleur anstelle des Sohnes, auf den er gehofft hatte, geboren wurde. Er hatte vor vielen Jahren aufgehört, auch nur ansatzweise zu bedauern, dass er keinen Sohn bekommen hatte, Fleur war die Erfüllung seines Herzenswunsches. Sie trug schließlich seinen Namen, und er freute sich ganz und gar nicht auf den Tag, an dem sich das ändern würde. Wenn er überhaupt je über ein solches Unglück nachdachte, machte ihm das vage Gefühl, dass er sie reich genug machen konnte, um vielleicht den Namen des Kerls, der sie heiraten würde, zu erkaufen und auszulöschen, die Vorstellung schmackhafter – warum nicht, wo doch nun Frauen und Männer scheinbar gleichberechtigt waren? Und Soames, der insgeheim überzeugt war, dass sie das nicht waren, strich sich mit gewölbter Hand fest über das Gesicht, bis er das tröstende Kinn erreichte. Dank seiner enthaltsamen Lebensweise war er nicht dick und schlaff geworden, seine Nase war blass und schmal, sein grauer Schnurrbart kurz geschnitten, seine Sehkraft unbeeinträchtigt. Eine leicht gebeugte Haltung verengte und korrigierte die Ausdehnung seines Gesichts durch das Höherwerden seiner Stirn aufgrund des Lichterwerdens seines grauen Haars. Die Zeit hatte wenig Veränderung bei dem betuchtesten der jungen Forsytes bewirkt, wie der letzte der alten Forsytes – Timothy, nun in seinem hundertersten Lebensjahr – es ausgedrückt hätte.
Der Schatten der Platanen fiel auf seinen eleganten Homburg, Zylinder trug er nicht mehr – in Zeiten wie diesen war es nicht von Nutzen, Aufmerksamkeit auf Reichtum zu lenken. Platanen! Seine Gedanken wanderten jäh nach Madrid – Ostern vor dem Krieg, als er sich wegen eines Bildes von Goya entscheiden musste und deshalb eine Forschungsreise unternommen hatte, um den Maler vor Ort zu studieren. Der Mann hatte ihn beeindruckt – große Bandbreite, ein echtes Genie! So hoch der Kerl auch gehandelt werden mochte, er würde noch höher gehandelt werden, ehe sie mit ihm fertig waren. Der zweite Goya-Hype würde noch größer sein als der erste, oh ja! Und er hatte gekauft. Während dieser Reise hatte er – was er noch nie zuvor getan hatte – eine Kopie eines Freskogemäldes mit dem Titel »La Vendimia« in Auftrag gegeben, auf dem ein Mädchen abgebildet war, einen Arm in die Seite gestemmt, das ihn an seine Tochter erinnert hatte. Er hatte sie nun in seiner Galerie in Mapledurham, sie war ziemlich kläglich – man konnte Goya nicht kopieren. Trotzdem betrachtete er sie immer, wenn seine Tochter nicht da war, denn etwas in der graziösen, aufrechten Balance der Gestalt, dem Abstand zwischen den gebogenen Augenbrauen, der lebhaften Verträumtheit der dunklen Augen erinnerte ihn auf unwiderstehliche Weise an sie. Seltsam, dass Fleur dunkle Augen hatte, wo doch seine eigenen grau waren – kein reiner Forsyte hatte braune Augen – und die ihrer Mutter blau! Aber natürlich waren die Augen ihrer Großmutter Lamotte dunkel wie Zuckerrübensirup!
Er ging weiter Richtung Hyde Park Corner. In ganz England gab es keinen anderen Ort, an dem sich so viel verändert hatte, wie in der Rotten Row! Da er fast in Rufweite von ihr geboren worden war, konnte er sich an sie ab 1860 erinnern. Als Kind hatte man ihn hierher zwischen die Reifröcke gebracht, um Dandys mit engen Hosen und Koteletten anzustarren, die in militärischer Haltung auf ihren Pferden saßen, um das Lüften von weißen Zylindern mit gebogener Krempe zu beobachten, die Atmosphäre von Gemächlichkeit bei alledem und den kleinen krummbeinigen Mann mit langer roter Weste, der sich immer mit Hunden an mehreren Leinen unter das vornehme Volk mischte und versuchte, seiner Mutter einen davon zu verkaufen: King Charles Spaniels, Italienische Windspiele, die von ihrem Reifrock angetan waren – jetzt gab es das alles nicht mehr zu sehen. Es gab tatsächlich überhaupt keine Vornehmheit mehr zu sehen, nur Arbeiter, die stumpfsinnig nebeneinandersaßen und nichts anzustarren hatten außer ein paar jungen drallen Frauen mit Bowlern, die im Herrensitz ritten, oder unsteten Leuten aus den Kolonien, die auf elend aussehenden Gäulen auf und ab ritten, und hier und da kleinen Mädchen auf Ponys, oder alten Herren, die ihre Leber auf Trab brachten, oder einer Ordonnanz, die sich an einem großen einherstolzierenden Kavalleriepferd versuchte, keine Vollblüter, keine Reitknechte, kein Verbeugen, kein Bückling, kein Getratsche – nichts, nur die Bäume waren noch dieselben – den Bäumen waren die Generationen und der Niedergang der Menschheit einerlei. Ein demokratisches England – chaotisch, hektisch, laut und anscheinend ohne Spitze. Und jene heikle, anspruchsvolle Seite in Soames’ Wesen regte sich. Sie waren für immer Vergangenheit, die exklusiven Kreise von Klasse und Schliff! Wohlstand gab es noch – oh ja! Wohlstand! – er selbst war reicher, als sein Vater es jemals gewesen war. Doch Distinguiertheit, Atmosphäre, Vornehmheit – alles dahin, verschlungen von einem einzigen riesigen, hässlichen, hektischen, nach Benzin stinkenden Rummel. Kleine halbbesiegte Rudimente von Vornehmheit und gesellschaftlicher Klasse hielten sich noch hie und da im Verborgenen, verstreut und chétif, wie Annette sagen würde, aber nichts würde je wieder so solide und in sich geschlossen sein, dass man dazu aufsehen konnte. Und in diesen Wirrwarr von schlechten Manieren und lockerer Moral war seine Tochter – die Blüte seines Lebens – hineingeworfen worden! Und wenn diese Typen von der Labourpartei an die Macht kamen – falls es je soweit kommen würde –, dann stand das Schlimmste noch bevor.
Er ging unter dem Torbogen hindurch, der – Gott sei Dank! – endlich nicht mehr durch das Rauchgrau seines Scheinwerfers verunstaltet wurde. Die sollten besser dort einen Scheinwerfer hinstellen, wo sie alle hingehen, dachte er, und ihre tolle Demokratie beleuchten! Und er lenkte seine Schritte an den Fronten der Klubs in der Piccadilly entlang. George Forsyte würde bestimmt im Erkerfenster des Iseeum sitzen. Der Kerl war inzwischen so massig, dass er fast seine gesamte Zeit dort verbrachte, wie ein stetes, sardonisches, humorvolles Auge, das den Niedergang der Menschen und ihrer Welt beobachtete. Und Soames ging schnell weiter, da er sich unter dem Blick seines Cousins immer unbehaglich fühlte. George hatte, so war ihm zu Ohren gekommen, mitten im Krieg einen Brief mit der Unterschrift Patriot geschrieben, worin er sich über die Hysterie der Regierung bezüglich der Kürzung des Hafers für Rennpferde beklagte. Ja, da saß er, groß, massig, gepflegt, glattrasiert, mit glattem, kaum dünner gewordenen, ganz sicher nach dem besten Haarwasser duftenden Haar und einem Pferderennprogramm in der Hand. Nun, der veränderte sich nicht! Und vielleicht das erste Mal in seinem Leben empfand Soames für jenen spöttischen Verwandten ein leises Gefühl von so etwas wie Sympathie hinter seiner Weste.
Mit seiner Masse, seinem perfekt gescheitelten Haar und seinem stieren Blick war er ein Garant, dass die alte Ordnung noch ein paar Veränderungen wegstecken konnte. Er sah George mit dem Rennprogramm winken, als wolle er ihn einladen, zu ihm zu kommen – bestimmt wollte er ihn etwas wegen seines Vermögens fragen. Es wurde noch immer von Soames geregelt, denn als er in jener schmerzlichen Zeit vor zwanzig Jahren, als er sich von Irene hatte scheiden lassen, eine stille Teilhaberschaft übernommen hatte, hatte Soames fast unbewusst die Handhabung aller reinen Forsyte-Angelegenheiten übernommen.
Er zögerte nur kurz, nickte dann und ging hinein. Seit dem Tod seines Schwagers Montague Dartie in Paris, den niemand so recht einordnen hatte können, außer dass es wohl sicherlich kein Selbstmord gewesen war, erschien der Iseeum Soames respektabler.