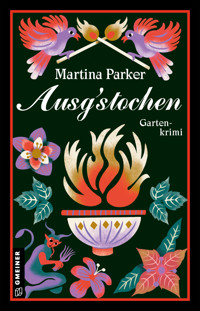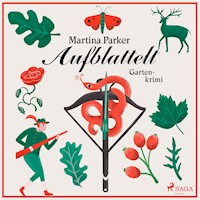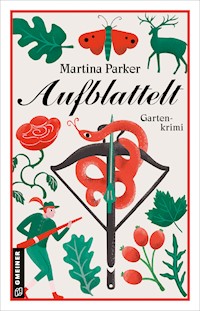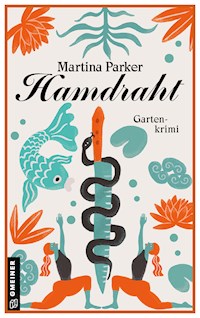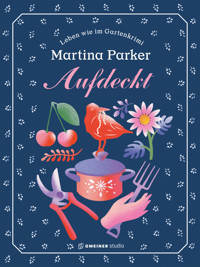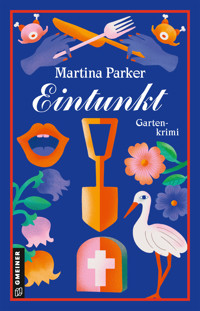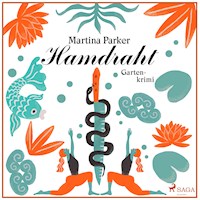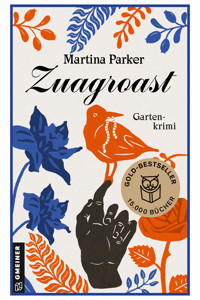
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: GMEINERHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Klub der Grünen Daumen
- Sprache: Deutsch
Alle suchen am Land ihr Glück, aber jeder findet etwas anderes. Paul findet billiges Bauland, Affären und ein paar seltsame Gewächse. Vera findet ihren Ex, einen Job als schlecht bezahlte Lokaljournalistin und jede Menge Nacktschnecken. Johanna findet, die Zuagroasten haben mehr Geld als Verstand. Die würden sogar Brennnesseln kaufen, wenn ein Preispickerl dran wäre. Und Harald findet, dass es ein großer Fehler war, diesen Zuagroasten unter die Arme zu greifen. Denn jeder Gefallen rächt sich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Parker
Zuagroast
GARTENKRIMI
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Das ist eine fiktive Geschichte, die an burgenländischen Originalschauplätzen spielt. Die Personen und die Handlung dieser Geschichte sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Im Juli 2020 erschien »Zuagroast – von Wien ins Weinviertel« in der Edition Weinviertel
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Illustration und Cover Design Lena Zotti, Wien
ISBN 978-3-8392-7014-1
Zitat und Widmung
»Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das auch leben will.«
Albert Schweitzer
*
Für Dich
Anmerkung
Ein Glossar der österreichischen und burgenländischen Ausdrücke finden Sie hinten im Buch.
Prolog
Es war eine dieser pannonischen Sommernächte, in denen es einfach nicht abkühlte. Obwohl die Sonne schon lange untergegangen war, klebten ihm die Kleider am Leib. Er hätte die Klimaanlage aufdrehen können, aber dann hätten ihn die Motorengeräusche verraten. Und niemand sollte wissen, dass er hier war. Die neue Siedlung am See war kurz vor der Fertigstellung. Es gab noch keine Straßenbeleuchtung. Die Dunkelheit war seine Verbündete. Er parkte hinter dem Baucontainer mit Schutt und wartete, bis sie kamen. Und das taten sie.
Im Neubau ging in einer der Wohnungen das Licht an. Eine grelle Glühbirne, die an einem Kabel von der Decke baumelte. Es gab hier noch keine Lampenschirme, keine Jalousien, keine Möbel. Die beiden standen am Fenster der leeren Wohnung wie Schaufensterpuppen in einer Auslage.
Der Mann im Wagen sog zischend Luft ein. Er hatte es geahnt. Er hatte Gewissheit haben wollen. Er hatte gedacht, dass nichts schlimmer sein konnte als dieser nagende Zweifel, der seit Wochen wie ein Giftpfeil in seinen Eingeweiden steckte. Aber jetzt, nachdem er die beiden erwischt hatte, war der Schmerz des Giftpfeils lächerlich. Ein Nichts gegen die Qualen, die er nun verspürte. Es war, als würde ihm eine eiserne Faust in den Magen schlagen. Und bei jedem weiteren Bild, das sich in seine Netzhaut brannte, schlug die Faust erneut zu. Aber wegschauen konnte er trotzdem nicht.
Er sah, wie der Mann in der Auslage auf die Frau zuging. Sie grinsend bedrängte. Sich an ihr rieb, ihr seine Zunge in den Mund steckte. Die Frau wich zurück, bis sie mit dem Rücken an der Mauer anstieß.
Ob die Bauträger diese Wand wohl unverputzt ließen? Wahrscheinlich. Nackte Betonmauern sahen auch im tiefsten Burgenländischen nach New York aus. Hatte er tatsächlich gerade über die Wand nachgedacht? In dieser Situation. Ob das der Schock war?
Die Frau trug nur ein dünnes Top. Die Betonwand musste kühl und rau sein. Die Frau lachte. Der Typ nahm ihre Arme hoch und presste ihre Hände mit den seinen fest gegen die Mauer. Dann drückte er ihr sein Knie zwischen die Beine. Sie warf den Kopf nach hinten. Es gefiel ihr. Sie, die immer allen mit ihren feministischen Grundsätzen in den Ohren lag, ließ sich von dem Kerl hier einfach gegen die Wand knallen. Der Typ zog ihr das Top hoch. Den BH habe ich ihr zu Weihnachten gekauft, dachte der Mann im Wagen. Dann bemerkte er, dass seine Wangen nass waren. Schweiß? Tränen? Er konnte sich nicht erinnern, wann er zum letzten Mal geweint hatte.
Schock. Fassungslosigkeit. Wut. Wie lang ging das schon mit den beiden? Wie lange hatte sie ihn an der Nase herumgeführt? Ihre Lust einem anderen geschenkt, während sie parallel ungerührt auch mit ihm geschlafen und ihm Harmonie vorgegaukelt hatte? War sie verliebt oder hatte sie nur über Wochen und Monate mit diesem anderen ihre pure sexuelle Geilheit genossen? Sie hatte ihn zum Narren gehalten, für blöd verkauft.
Das Handy in seiner Jackentasche vibrierte. Er sah auf die Anruferkennung und drückte auf »Annehmen«.
»Bist du dort?«, fragte die Stimme aus dem Lautsprecher.
»Ja«, antwortete er. Seine Stimme klang so fremd, dass er sich gar nicht sicher war, dass es seine eigene war.
»Und?«
»Es ist so, wie du vermutet hast.« Eine Welle des Schmerzes erfasste seinen Körper. Seine Frau, die Mutter seiner Kinder, die einzige Vertraute seiner Emotionswelt trieb es gerade vor seinen Augen mit einem anderen. Kurz überlegte er, ob er in die Wohnung stürmen sollte. Aber was hätte er dort getan, sie angebrüllt, eine Szene gemacht, den Typen zum Duell herausgefordert? Sollte er sich vor dem da tatsächlich zum billigen Klischee des gehörnten Ehemanns machen?
Die Anruferin musste seine Gedanken erraten haben.
»Du musst dir nicht das volle Programm geben«, sagte sie leise. »Bitte fahr zurück. Wir treffen uns bei dir. Dann reden wir weiter.«
Der Mann nickte tonlos.
»Hast du mich verstanden?«
»Ja«, sagte er leise, »aber es hat eh alles keinen Sinn mehr.«
»Bitte mach, was ich sage«, flehte die Stimme, »wir kriegen das hin, wir finden eine Lösung, ich verspreche es dir. Leg jetzt auf, du musst dich konzentrieren.«
Der Mann startete den Wagen. Auf Motorengeräusche würden die beiden im Haus in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht mehr achten. Trotzdem ließ er die Scheinwerfer ausgeschaltet, bis er die Landstraße erreichte. Die Faust hatte aufgehört, auf seine Eingeweide einzudreschen. Stattdessen hatte er das Gefühl, dass glühende Lava seine Speiseröhre hochkroch. Sodbrennen, dachte er. Auch das noch. Er hatte das Gefühl, schwer Luft zu bekommen. Eine Stressreaktion. Auch das musste der Schock sein. Er hätte besser anhalten sollen, aber er wollte so schnell wie möglich weg von diesem Ort.
Mit der linken Hand tastete er das Seitenfach der Fahrertür ab. Da musste doch noch ein Sackerl mit dem Mittel gegen Sodbrennen sein. Gott sei Dank. Da war es. Er hatte schon wieder einen Schweißausbruch. Aber jetzt konnte er endlich die Klimaanlage einschalten. Er stellte das Gebläse auf Maximum, riss das Sachet mit den Zähnen auf und saugte die milchig-minzige Flüssigkeit gierig auf. Eine Konsistenz wie Sperma, dachte er. Er bremste scharf, riss die Beifahrertür auf und erbrach sich direkt auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto blinkte ihn wild an und hupte. »Deppertes Ogsuff«, brüllte der Lenker aus dem geöffneten Autofenster.
Zum Glück war keiner hinter mir, der hätte mich abgeschossen, dachte der Mann, der sich nicht betrunken, sondern unendlich ernüchtert fühlte. Er zitterte. Er musste weiter. Nur mehr zwei Kilometer bis nach Hause. War das überhaupt noch sein Zuhause? Er wusste es nicht. Aber die Frau, die am besten wusste, was in ihm vorging, würde da sein. Sie würde wissen, was jetzt zu tun war.
Das Ortsschild seines Heimatdorfes begrüßte ihn. Das Sodbrennen war wieder schlimmer geworden. Kein Wunder, nachdem er gerade Gift und Galle gespien und dabei wohl seine Speiseröhre verätzt hatte. Eine Gelse surrte an seinem Ohr. Die war sicher ins Wageninnere geflogen, als er gekotzt hatte. Gelsen mitten in der Nacht? Warum war es heute so verdammt heiß? Es war doch schon nach 22 Uhr.
Nur noch einmal links abbiegen. Ihr Wagen war bereits vor seinem Haus geparkt. Gott sei Dank, sie war schon da. Sie stand vor seiner Eingangstür und blickte ihm entgegen. Er wartete auf das Gefühl von Erleichterung, als er sie dort stehen sah, aber stattdessen registrierte er, dass nicht nur seine Speiseröhre, sondern sein ganzer Brustkorb in Flammen stand. Es war, als wäre die Faust zurückgekehrt und würde nun seine Brust zerquetschen. Der Mann bekam keine Luft mehr. Er röchelte. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er fiel nach vorne auf das Lenkrad.
Dass sein Wagen in den ihren knallte, bekam er gar nicht mehr mit.
Kapitel 1 Egreschl und Nacktschnecken
Obwohl Nacktschnecken Zwitter sind und sich daher auch alleine befruchten können, paaren sie sich mit Leidenschaft. Manche Schnecken streicheln sich dabei bis zu 24 Stunden lang, bevor es zur Sache geht. Den größten hat dabei die Limax redii. Bei einer Körpergröße von 13 bis 15 Zentimetern hat diese Schnegelart einen bis zu 85 Zentimeter langen Penis.
Vorsätzlicher Mord wäre Vera Horvath in ihrem früheren Leben in der Stadt nie in den Sinn gekommen. Doch jetzt lebte sie im Südburgenland. Und es schien, als würde das Land das Schlimmste in ihr zum Vorschein bringen.
Es war ein Morgen, der für Gärtner prinzipiell nach Hoffnung roch: Sonne, Vogelgezwitscher, die Aussicht auf eine baldige reiche Ernte. So würde es zumindest ein poetisch veranlagter Mensch beschreiben. Vera war eher der praktische Typ.
Sie ging den schmalen Weg entlang, der vom Haus zum Bauerngarten der Urlioma führte. Das Gras war hoch und morgenfeucht, und sie spürte, wie die Feuchtigkeit durch das dünne Netzmaterial ihrer Turnschuhe drang und die kühle Nässe ihre Zehen erreichte und klamm werden ließ.
Vera zog die Zehen ein, beugte sich zu einem kleinen dornigen Strauch herunter und griff vorsichtig nach einer Stachelbeere. Wie hatte die Urlioma immer auf Heanzisch dazu gesagt? Egretscherl, genau – wie lautmalerisch. Sie drückte die noch grüne Frucht prüfend zwischen Zeigefinger und Daumen.
Die Beere fühlte sich hart an. Sie wiederholte den Test bei ein paar anderen Früchten, verletzte sich dabei an einem langen Dorn, fluchte und widmete sich dann den Beeren, die auf der Hinterseite des Busches weiter außen, näher zur Sonne wuchsen. Endlich ertastete sie eine, die ihr reif schien. Sie knipste das borstige Ende und den Stielansatz mit den Fingernägeln ab und schob sich die Stachelbeere in den Mund.
Die Frucht zerplatzte beim Daraufbeißen, das gelartige Fruchtfleisch war eher süß als sauer. Die brauchten wohl noch zwei, drei Wochen. Vera war dennoch auf den Geschmack gekommen und nahm noch ein paar weitere Egretscherl in der hohlen Hand als Wegzehrung auf ihre morgendliche Inspektionsrunde mit.
Unter der Hortensie grinste sie ihr Gartenzwerg an. Die Hortensie hieß Annabelle. Der Gartenzwerg hatte keinen Namen. Er war auch kein Sympathieträger, sondern ein unbeholfenes Abschiedsgeschenk von Veras Ex-Kollegen von der Zeitschrift »Lust aufs Land«, bei der sie die letzten acht Jahre als Redakteurin gearbeitet hatte.
»Lust aufs Land« war jahrelang das Erfolgsprodukt des Verlags gewesen, wie alle Magazine auf dem Markt, die das Wort »Land« im Titel trugen. Honigbiene, Heimat und Harmonie statt Krieg, Krise und Klimawandel. Zu den besten Zeiten hatten wir mehr Leser als das »Profil«, dachte Vera bitter. Aber die fetten Jahre waren vorbei. Die Printkrise hatte auch vor den Heften, die die heile Welt promoteten, nicht Halt gemacht.
Sankt Martin in der Wart – mit 18 hatte Vera geglaubt, diesen Ort für immer hinter sich gelassen zu haben. Jetzt, mit 42, saß sie im Haus der verstorbenen Urlioma und versuchte, eine Gstätten zu bändigen, die so gar nichts mit den illustren Gartenbildern in der »Lust aufs Land« zu tun hatte. Die Urlioma hatte lange im Heim gelebt, bevor sie gestorben war und Vera das Haus hinterlassen hatte. In dieser Zeit hatten Brennnesseln und Brombeeren die Herrschaft über die einstmals gepflegten Beete an sich gerissen. Vera sah ihre wuchernden Triebe überall emporkommen.
Gab es noch etwas Schlimmeres? Ja, die Schnecken. Diese schleimige wurmförmige Plage, die alles vernichtete, was zögerlich emporwuchs. Erst hatten die Schnecken die Erbsensprösslinge und den Pflücksalat über Nacht weggefressen, dann die aufkeimenden Kürbis- und Gurkenpflanzen. Die Schnecken waren die Feinde des Neubeginns, die Zerstörer der gärtnerischen Zuversicht.
Vera hatte im Kampf gegen die Schnecken alle Empfehlungen aus der »Lust aufs Land« ausprobiert. Sie hatte Eierschalen als abschreckende Barriere um die Jungpflanzen gestreut. Die Schnecken ließen sich nicht aufhalten. Am nächsten Tag waren die Jungpflanzen weg. Hindernisse wie den Kupferdraht, die Sägespäne und den Kaffeesatz überwanden die Viecher mühelos.
Eingegrabene Bierfallen hatten den Effekt, dass, angelockt vom Bierdunst, alle Schnecken aus dem Bezirk Oberwart zum Massenbesäufnis kamen. Und Besoffene haben wohl wirklich immer ein Masel. Denn ertrunken waren nur wenige.
Inzwischen hatte Vera schon so viel Geld für Schneckenbarrieren und immer neue Jungpflanzen ausgegeben – letztere natürlich alte Sortenraritäten in samenfester Bioqualität –, dass sie um das Geld ihr Gemüse auch gleich im teuersten Delikatessengeschäft Wiens hätte kaufen können.
Vera steckte sich eine Stachelbeere in den Mund. Heute war es besonders schlimm. Die Roten Wegschnecken dachten gar nicht daran, sich ihrem Namen entsprechend am Weg aufzuhalten. Einzelne Exemplare wiegten sich in den Ruten der Sommerhimbeeren und hatten die heranreifenden Früchte bereits mit einer Schleimschicht überzogen, die in der Sonne getrocknet war und wie dünne Folie glitzerte. Ein Dutzend fetter, ledriger Exemplare kroch über die Kohlrabi und fräste sich zielstrebig durch die jungen Früchte. Besonders schlimm hatte es das Salatbeet erwischt: Das Grazer Krauthäuptel war Austragungsort einer wahrhaften Schneckenorgie, je zwei oder gar drei Exemplare paarten sich dort, indem sie sich seltsam verschlungen aneinanderpressten. Der Gartenzwerg grinste dämlich.
Vera dachte an die Kündigung. Aussortiert. Sie war ausgemustert worden. Zu alt, wertlos, unnütz und offenbar sogar zu deppert, um den Urliomagarten halbwegs in Schuss zu halten und mit ein paar hirnlosen Schnecken fertig zu werden. Sie spürte einen Knoten im Hals. Tränen schossen ihr in die Augen. Wut stieg in ihr hoch.
Sie steckte sich die restlichen Stachelbeeren auf einmal in den Mund, um die Hand frei zu haben. Dann griff sie zum Löwenzahnstecher, den sie nach dem gestrigen Kampf gegen die Brombeerwurzeln am Beetrand abgelegt hatte. Ein letzter prüfender Blick auf ihr erstes Opfer. Dann hob sie die Hand und stach zu. Die Schnecke sank beim Versuch, sie zweizuteilen, in die weiche Erde ein, und Vera hackte noch ein paar Mal auf die Stelle, um ganz sicher zu sein, dass das im Erdreich versunkene Tier tot war. Beim nächsten Exemplar war sie klüger: Sie bugsierte ihr Opfer erst mit dem Werkzeug aus dem Beet heraus, bevor sie es auf dem Rasen erledigte. Die dritte Schnecke war besonders leicht zu erlegen, weil sie am hölzernen Beetrand emporkroch, der dem Schneidewerkzeug entsprechend Widerstand leistete. Ein einziger Schnitt mit der scharfen Klinge genügte. Schleimige, gelb-graue Innereien quollen aus den Körpern der Toten. Schnecken haben kein Blut, aber das, was Vera erfasste, konnte man nur als Blutrausch bezeichnen. Eine nach der anderen erledigte sie wie im Fieber. Zehn, elf, zwölf, 13 – Vera zählte mit – 29, 30, 32 … Die Nacktschnecken auf den Himbeeren schüttelte sie von den Ruten, bevor sie sie erledigte. Und es fühlte sich gut an, erleichternd, befreiend, befriedigend … bis sie die letzte Stachelbeere zerbiss und bemerkte, dass das schleimige Massaker vor ihr auf unangenehme Art dieselbe Textur hatte wie der Obstbrei in ihrem Mund. Vera ließ den Löwenzahnstecher sinken. Ihr war schlecht.
Sie bohrte das Werkzeug ein paar Mal in die Erde, um dieses vom Schneckenschleim ihrer Opfer zu befreien, und ging dann langsam zum Haus zurück.
Eigentlich war das Urliomahaus ja ein Hof. Aber Vera war vorsichtig mit diesem Begriff, seit sie zum ersten Mal die zweifelnden, fragenden Blicke von Besuchern aus der Stadt bemerkt hatte. Diese hatten sich unter »Hof« einen stattlichen Vierkanter vorgestellt, wie man ihn im Waldviertel findet. Das Urliomahaus hatte gerade einmal vier winzige Räume mit niedrigen Decken und kleinen Kastenstockfenstern. Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Die Urlioma hatte ausschließlich in der Küche gelebt: auf der Bettbank neben dem Beistellherd, auf dem den ganzen Tag eine Suppe vor sich hin geköchelt hatte. Der Beistellherd wurde auch Sparherd genannt, weil er bei geringstem Kostenaufwand ein echtes Multitalent war. Er wärmte die Küche, seitlich gab es ein Becken, in dem den ganzen Tag heißes Wasser bereitstand. Und das Backrohr war nicht nur nützlich, um »Grumpan zu brodn«1, hier konnte man – bei gemäßigter Temperatur – auch Nüsse und Pilze trocknen und sogar Eisfüße wiederbeleben.
Vera konnte sich noch an einen Winter erinnern, als sie als Kind so lange in einem Schneehaufen herumgesprungen war, bis ihre Schuhe und Socken pitschnass waren. Die Urlioma hatte geschimpft, als sie die Bescherung gesehen hatte. »Jessas, hiaz wiarst ma no kraunk. Hiaz muaß i di vor die Rearn setzen.«2 Dann hatte sie Vera gepackt und auf einen Hocker vor den Herd gesetzt, das Türl aufgemacht, eine Decke ins Backrohr gelegt und »der Vera ihre nackerten Fiaß« auf die Decke gelegt.
Veras nasse Socken und Handschuhe hängte die Urlioma auf dem Scherengitter über dem Ofen zum Trocknen auf. Und Veras nasse Lederschuhe kamen in das Wärmefach unter dem Rohr. Vera konnte die Wärme von damals heute noch spüren.
Das Wohnzimmer hatte die Urlioma nie beheizt. Nicht nur aus Spargründen. Das Wohnzimmer wurde nur zu Weihnachten benutzt oder wenn jemand gestorben war. Und nicht nur Christbaumnadeln und Weihnachtsmehlspeise, auch die bis zum Begräbnis zu Hause aufgebahrten Toten hielten sich in einem kalten Raum einfach länger frisch.
Das ehemalige Schlafzimmer der Urlioma hatte Vera mittels Rigipswand in zwei Räume teilen lassen. Der Arbeiter, der das erledigen musste, hatte ob dieser Bausünde die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber ihr war keine andere Lösung eingefallen. Ihre 13-jährige Tochter Letta brauchte ja auch ein eigenes Zimmer. Einen Rückzugsbereich.
Das mit dem Rückzugsbereich war voll aufgegangen. Wenn sie nicht in der Schule war, lag Letta die meiste Zeit mit ihren Kopfhörern in ihrem Verschlag, wie sie ihr Kämmerchen nannte, und wartete. Sie wartete darauf, dass sie endlich alt genug war, um in die Stadt zurückzuziehen.
»Ich hasse das Burgenland«, sagte Letta oft zu ihrer Mutter, und ihre dunklen Augen wurden dann noch eine Spur schwärzer. »Dir ist schon klar, dass du mein Leben zerstört hast.« Für Letta kam der Umzug nach Sankt Martin in der Wart einer Verbannung gleich.
Vera zog ihre feuchten Turnschuhe aus und stellte sie auf die Brüstung des Arkadengangs zum Trocknen in die Sonne. Der Arkadengang war typisch für südburgenländische Bauernhöfe – so klein diese auch sein mochten.
Vera hatte irgendwann einmal eine Geschichte über burgenländische Arkaden geschrieben und wusste seither, dass das älteste bekannte Arkadenhaus der 1874 errichtete Pfarrhof der evangelischen Pfarre Oberwart war. Zu der Zeit lebten die meisten burgenländischen Bauern noch in Lehmbauten mit Strohdächern. Aber als Mitte des 19. Jahrhunderts die Abhängigkeit der Bauern von den Grundherren abnahm, wollten die Bauern auch so feudal wohnen wie die Priester und Kleinadeligen und statteten ihre neu gebauten Höfe mit überdachten Bogenkonstruktionen in Renaissanceanmutung aus. Das sah nicht nur nach mehr Prestige aus, es war auch praktisch. Denn die so gewonnene Laube war zumindest im Sommer ein zusätzlicher Lebensraum.
Hier war es auch egal, wenn man ein bisserl Dreck machte, perfekt für Tätigkeiten wie Ribiseln orebeln3, Bohnschadln auslossn4 oder Nüsse knacken. Und unter den regensicheren Bogengängen trockneten dann der aufgehängte Kukuruz5 und die Knoblauch- oder Zwiebelzöpfe vor sich hin.
Vera hatte noch keine Ernte eingebracht, die sie unter den Arkaden hätte verarbeiten können. Dann gibt’s halt Käsetoast zum Mittagessen, dachte sie und ging in die Küche zurück. Den isst Letta wenigstens. Sie wusch sich die Hände und warf den Plattengriller an.
»Da ist schon wieder alles sperrangelweit offen, irgendwann werden s’ euch noch was stehlen.« Vera zuckte erschreckt zusammen. Ihre Mutter Hilda Horvath stand wie eine Erscheinung hinter ihr.
»Wer soll uns was stehlen?«, fragte Vera stirnrunzelnd. Sie bereute die Entscheidung, ihrer 75-jährigen Mutter ein iPad geschenkt zu haben, mittlerweile zutiefst. Seit diese im WeltWeitenWahnsinn surfte, kam sie jeden Tag mit neuen Horrorgeschichten an.
»Na, die Trickbetrüger«, sagte Hilda. »Zu älteren alleinstehenden Frauen, wie du eine bist, kommen die besonders gerne.«
Vera zuckte bei den Attributen »älter« und »alleinstehend« leicht zusammen. Sie war 42, Single und Alleinerzieherin, aber nicht alleinstehend.
»Hast das heute Früh in der ›Krone‹ gelesen?«, fragte sie forschend zurück.
»Ich hab die ›Krone‹ gekündigt«, sagte Hilda, »weil die hab ich jetzt eh gratis online abonniert.«
»Du hast die ›Krone‹ nicht abonniert, sondern auf deren Facebook-Seite ein Like-Hakerl gesetzt.«
»Ich hab sie abonniert, auf meinem Facebook steht bei der ›Krone‹ abonniert«, sagte Hilda beharrlich.
»Und deswegen bekommst jetzt den ganzen Unsinn in deinen Feed gespült«, seufzte Vera. Kein Wunder, dass bei diesem Medienverständnis Print zum Sterben verurteilt war.
»Was für ein Feed?«, fragte Hilda. »Und sag nicht Unsinn, da erfährt man interessante Sachen. Gestern haben sie was über die Heidi gebracht. Ich versteh echt nicht, dass die mit diesem Sänger zusammenbleibt. Der war ja früher mal fesch, aber jetzt ist der so blad geworden.«
»Welche Heidi, Mama?«
»Na, das Model. Aber vielleicht steht die auf Blade. Der mit den Autos, der Fabio Brillatore, der war ja auch blad.«
»Er heißt Flavio Briatore, Mama. Und was hat das jetzt mit den Trickbetrügern zu tun?«
»Na, gar nichts. Das erzähl ich dir nur so, man wird ja noch ein Gespräch führen dürfen.«
Sie rollte beleidigt mit den Augen. »Also die Trickbetrüger kommen in die Häuser. Sie kommen zu zweit, und einer fragt, ob er ein Glas Wasser haben darf oder geht aufs Klo, und der andere raubt inzwischen die Wohnung aus.«
»Und wo ist das passiert, Mama?«
Vera hatte sich angewöhnt, alle Erzählungen ihrer Mutter genau zu hinterfragen. Eine Berufskrankheit aller Journalisten.
»Na, in Deutschland, aber die kommen sicher auch zu uns. Gestern hat es bei mir auch nach 19 Uhr am Abend geläutet. Ich hab gar nicht aufgemacht. Nach 19 Uhr. Das ist a Frechheit.«
»Du hast doch einen Türspion, hast du nicht nachgeschaut?«
»Natürlich hab ich geschaut. Es waren der Harry und der Dietmar vom Sportverein.«
»Und warum hast du dann nicht aufgemacht, wenn du gesehen hast, dass es welche vom Sportverein waren, die du kennst?«
»Na, weil die auch nur mein Geld wollen. Genauso wie die Trickbetrüger. Die gehen um Spenden. Und zehn Euro will ich denen nicht geben, und fünf Euro sind zu wenig. Da wirst dann hinterher im ganzen Dorf ausgerichtet. Dann heißt es gleich, die alte Horvath ist sierig. Drum ist es besser, man tut so, als wär man nicht zu Hause. Zum Schluss hätten s’ mir noch einen Kalender geschenkt. Also echt, wer braucht jetzt einen Kalender. Einen Kalender verschenkt man im Dezember, nicht im Mai. Du musst echt noch viel lernen, wenn du jetzt wieder am Land leben willst. Was kochst du da?«
Der Käse, dachte Vera. Shit. Er hatte sich durch die Hitze verflüssigt, war über die Platten auf die Heizstäbe geronnen und dort zu einer stinkenden Masse verschmort. Was war nur aus Käse geworden? Früher war Käse beim Grillen in Form geblieben. Er war an den Rändern ein bisschen braun geworden, und dann hatte er beim Reinbeißen Fäden gezogen. Aber das, was da über die Platten kroch, war eine dottergelbe Suppe.
»Supermarktklumpert«, kommentierte Hilda. »Auf meinem Facebook schreiben die, dass im Käse gar keine Milch mehr drinnen ist. Und in einer steirischen Käsefabrik hams sogar Käfer im Käse gefunden. Ich kauf Käse nur im Bauernladen, aber nur, wenn die Frau Fuith aus Mariasdorf Dienst hat, weil die anderen Verkäuferinnen …«
»Nach was riecht es da so komisch?«, fragte Letta stirnrunzelnd. Der Hunger hatte sie offenbar aus ihrem Verschlag getrieben. Sie nahm die Kopfhörer ab. »Leave me alone …«, die Stimme von Deprirapper NF waberte aus den Lautsprechern.
»Ich hab den falschen Käse gekauft«, gestand Vera.
»Na super. In Wien hätten wir jetzt Pizza bestellen können«, sagte Letta. »Aber hier in der Einöde müssen wir verhungern.«
»Du kommst mit zu mir, ich mach dir ein Schnitzerl mit Reis«, sagte Hilda zu ihrer einzigen Enkelin. Die Bereitschaft, zu jeder Tages- und Nachtzeit Schnitzerl mit Reis zu machen, hatte ihr den Bonus eingebracht, dass Letta zu ihr weitaus freundlicher war als zu allen anderen Menschen in ihrem Umfeld.
»Wie war’s in der Schule?«, fragte Hilda.
Letta rollte mit den Augen. »Geht so. Die haben mich heute gefragt, ob meine Mama mal was mit einem Basketballer hatte.«
Vera zuckte zusammen. Sie wusste, was diese Anspielung bedeutete. In der Oberwarter Basketballmannschaft gab es zahlreiche dunkelhäutige Legionäre aus den USA. Kurz überlegte sie, ob die Bemerkung wohl rassistisch gemeint war. Aber vermutlich war es nur neugieriges Gerede ohne Hintergedanken.
Lettas Haut war dunkler als die der anderen Kinder. Bei einer Buntstiftzeichnung hatte sie nie nach dem »hautfarbenen« Rosa gegriffen, das alle anderen Kinder benutzten, um Gesicht und Hände auszumalen, sondern immer nach Ockerbraun. Ihre Hautfarbe war das Erbe ihres brasilianischen Vaters. Ein Fotograf, mit dem Vera eine heftige, wenn auch komplett dysfunktionale Beziehung gehabt hatte, bei der die Distanz zwischen Rio und Wien noch das kleinste Problem gewesen war. Vera hatte seit ihrer Schwangerschaft keinen Kontakt mehr zu ihm. Letta, eigentlich Violetta, war wirklich das einzig Positive, das dieser Typ je zusammengebracht hatte, dachte sie.
»Hattest du was mit einem Basketballer?« Letta sah sie fragend an.
»Nein«, seufzte Vera.
»Die Heidi hat auch ockerfarbene Kinder«, sagte Hilda fröhlich. »Und jetzt mach ich dir ein Schnitzerl.«
1 Kartoffeln zu braten
2 Jesus, jetzt wirst du noch krank werden. Jetzt muss ich dich vor das Backrohr setzen.
3 Johannisbeeren abrebeln
4 Bohnenschoten öffnen
5 Maiskolben
Trauerarbeit Akt 1
»Alles, was ich denken konnte, war: Ich will ihn noch einmal sehen! Ihn einfach noch einmal anschauen. Ihn ein letztes Mal berühren. Aber die haben es mir nicht erlaubt. Die Ärztin gab mir ein starkes Beruhigungsmittel. Das hat mich völlig lethargisch gemacht. Dass ich ihn nicht mehr sehen durfte, werde ich ihnen nie verzeihen.«
Kapitel 2 Eva und Paul
Stubenfliegen können Essen mit ihren Füßen schmecken! Dafür sorgen Geschmacksrezeptoren an ihren Unterschenkeln und Füßen. Landet eine Fliege auf einer Mahlzeit, die ihr zusagt – die Bandbreite reicht dabei von Hundescheiße bis Kuchen –, wird sie möglichst oft darauf herumlaufen, um etwas von dem guten Geschmack zur nächsten Mahlzeit mitzunehmen.
Eva drückte auf das Pluszeichen des glatten Displays, aber nichts passierte. Sie probierte es noch einmal. Keine Chance. Seufzend griff sie zu einem Küchentuch aus grauviolettem Leinen und wischte über die Oberfläche, um etwaige Feuchtigkeit zu entfernen. Sie hasste diesen hypermodernen Herd. Automatikprogramme, kabelloses Speisenthermometer, Pyrolyse-Ausstattung, aber ein Touch-Bedienfeld, das sie fast zum Weinen brachte.
Der Herd war Pauls Entscheidung gewesen, wie auch das Haus, der Umzug und alles andere, was Evas Leben ausmachte. Wäre Paul ein Herd, wäre er genauso einer, dachte Eva verbittert. Äußerlich schick und spiegelglatt, aber in seinen Aktionen unberechenbar. Vor lauter Frust trommelte Eva jetzt mit den Fingern gegen die Glasplatte.
Ein schrilles Geräusch ertönte. Auch Paul wurde in letzter Zeit gerne mal laut. »Du sitzt wie eine Prinzessin den ganzen Tag daheim, du hast ja keine Ahnung, was ich ständig um die Ohren habe«, brüllte er dann. Prinzessin. Irgendwann war Eva tatsächlich seine Prinzessin gewesen. Damals, als sie mit 15 in der Schulvorführung das Schneewittchen gespielt hatte und gar nicht glauben konnte, dass sich der große, blonde charismatische Paul ausgerechnet für sie interessierte.
Aus dem selbstbewussten Klassenschönling der 5c war ein erfolgreicher Architekt geworden. Oder genauer gesagt, ein »Beinahe-Architekt«. Nur Eva wusste, dass Paul das Studium nie abgeschlossen hatte. War auch nicht nötig. Das »Planungsbüro Achleitner« lief auch ohne akademische Urkunde. Und die notwendigen Stempel für die Einreichungen konnte man sich ja kaufen.
Das Schrillen ging Eva durch Mark und Bein. Sie war eine empfindsame Frau und viel zu empathisch. Einer dieser Menschen, die 1000 Kleinigkeiten wahrnehmen und manchmal ganz erschöpft waren von der Vielzahl der Eindrücke in ihrem Kopf. Menschenmassen, Lärm und Geschwindigkeiten überforderten sie und machten ihr Angst. Früher hatte ihre Sensibilität Pauls Beschützerinstinkte geweckt. Heute zeigte er sich zunehmend genervt. »Stell dich nicht so an. Andere Frauen stellen sich auch nicht so an.« Andere Frauen waren der ständige wunde Punkt in Pauls und Evas Beziehung.
»Buchschachen ist ein frischer Start für uns«, hatte er ihr versprochen, als seine letzte Affäre aufgeflogen war und er Frau und Kind fast in einer Nacht- und Nebelaktion vom Nord- ins Südburgenland transportiert hatte. Eva hatte den Verdacht, dass weniger Pauls moralische Läuterung der Grund für den Umzug war als Ungereimtheiten bei seinem letzten Großprojekt, dem Bau des »Seewinkler Inselparadieses«.
»Überzoide Wochenendhütten für gstopfte Wiener«, wie Paul gerne sagte. Immerhin: Das Projekt plus der Verkauf des Familienhauses im Norden hatte genug Geld eingebracht, um das ultramoderne Anwesen zu erwerben, das wie ein schwarzes Raumschiff über dem Buchschachener Hotter schwebte. Das Haus hatte einem gehört, dem sein Fremdwährungskredit zum Verhängnis geworden war. »Dann is eam a no die Oide oboscht«6, hatte die Nachbarin Eva erzählt. Manchmal würde Eva auch gerne oboschn. Einfach verschwinden. Aber wohin?
Eva hatte es nach dreimaligem Durchlesen der Betriebsanleitung endlich geschafft, den Herd anzuwerfen, und begann, Zwiebeln und Fleisch in Olivenöl zu bräunen. Französisches Boeuf en Daube, also provenzalischer Schmortopf vom südburgenländischen Moorochsen. Das signalisierte Regionalbewusstsein und Weltoffenheit. Genau das, was Paul ausstrahlen wollte. Sie musste sich beeilen. Die Gäste würden zwar erst am Abend kommen, aber Paul mochte es nicht, wenn das ganze Haus nach Zwiebeln roch, was bei dem offenen loftartigen Grundriss des Raumschiffes fast unvermeidbar war.
Eva öffnete die Eingangstür, um zu lüften. Auf den Stiegen stand ein Karton Eier. Die Eier waren laut Pickerl am Karton vor zwei Monaten abgelaufen. Als das das erste Mal passiert war, hatte sich Eva den Kopf darüber zermartert, warum ihr die Nachbarn abgelaufene Eier vor die Tür gestellt hatten. War das eine versteckte Message, ein Zeichen, vielleicht sogar eine Drohung? Dann hatte sie irgendwann gecheckt, dass die Eier von den eigenen Hühnern der Nachbarn stammten und nur in die alten Kartons aus dem Supermarkt verpackt wurden. Allerdings hieß das nicht zwangsläufig, dass die Eier immer frisch waren. Es waren freilaufende Hühner, die legten, wo sie wollten. Manche Eier wurden erst Wochen später gefunden.
Eva nahm eine Schüssel Wasser und legte die Eier hinein. Die meisten Eier richteten sich in der Sekunde auf. Frisch waren die nicht mehr. Ein Tiramisu traute sich Eva damit nicht zu machen. Vielleicht lieber Schokoladenbrownies oder eine Mohntorte mit Joghurt und Himbeertopping.
Eva hatte schon immer gerne gekocht und gebacken. In ihrer Rolle als One-Woman-Eventunternehmen für Pauls Geschäftsanbahnungen hatte sie diese Fähigkeit perfektioniert. Paul erwartete von Eva, fürsorglich, unterstützend, loyal, geduldig und fröhlich zu sein. Er erwartete das 24/7. Aber ganz besonders, wenn Gäste da waren.
Die, die für heute angesagt waren, waren wichtige Leute. Der Chef der »Pannonia Bau« samt Gattin. »Da darf nichts schiefgehen«, hatte ihr Paul eingebläut.
Zumindest würde seine Laune heute Abend besser sein. Sein Charmepegel stieg mit der Wichtigkeit des Besuchs. Je einflussreicher und nützlicher ihm die Menschen erschienen, desto mehr warf er sich ins Zeug, ließ den unterhaltsamen Sonnyboy raushängen, war witzig und charismatisch. Evas Freundinnen behandelte er zumeist mit Ignoranz, außer sie gefielen ihm.
Eva stellte die Daube ins Rohr, drehte das Display auf 160 Grad und machte sich fertig, das Haus zu verlassen. Sie musste noch ihre Tochter Carla abholen, die im benachbarten Pinkafeld beim Jazzdance-Unterricht war. An die ständige Fahrerei hier im Süden hatte sie sich erst gewöhnen müssen. Das Busnetz war hier wesentlich schlechter ausgebaut, die Häuser in Buchschachen verstreuter als die Straßendörfer im Norden.
»Eigentlich sieht Buchschachen schon steirisch aus«, hatte ihnen der Vorbesitzer des Hauses erklärt. Das war positiv gemeint. Er wollte ausdrücken, dass Buchschachen mehr nach Geld aussah als die umliegenden burgenländischen Dörfer. Die urbanen Zuagroasten, die sich hier niederließen und ihre Kohle in die Revitalisierung der Arkadenhöfe steckten, schätzten das Dorf wegen seiner Nähe zur Autobahn. Man war gerne am Land, aber wollte auch schnell wieder weg.
Eva stieg in ihren schwarzen SUV, betätigte die Zündung und gab Gas. Der Wagen rollte langsam aus der Einfahrt. Sie blinkte und bog auf die Landstraße ein. Auf dem Bankerl vor der Kirche saßen zwei Frauen und winkten ihr freundlich zu. Eva winkte zurück. Sie erkannte ihre Nachbarin an der auffällig geblümten Kittelschürze. Den darauffolgenden Dialog der beiden hörte sie natürlich nicht.
»Wor des dei Weanerin, derst immer die Oa aufibringst?«, fragte die eine und fügte ein bisserl süffisant hinzu: »Woarum tuist da deis, bei dem Wogn kaun sa si d’ Oa a kafn?«
»Jo, weil i neigierig bin«, sagte die andere. »Außerdem is des ka Weanerin, sondern ane ausn Nordburgenland.«
»Jessas«, sagte die erste. »Nordburgenlandler san des … geh, hear ma auf. Do is ma jo a Bimbo no liawa.«7
*
Vor der Schule, in der der Tanzunterricht stattfand, hatten sich schon zahlreiche Eltern mit ihren Fahrzeugen eingeparkt. Es war windig. Eva beschloss, in die Aula der Schule zu gehen und dort auf Carla zu warten. Eine der Mütter, die bereits dort stand, kannte Eva vom Sehen. Viktoria? Veronika? Nein, Vera. Die Frau hieß Vera. Sie hatte sich den Namen gemerkt, weil sie bei der Anmeldung hinter ihr gestanden und ihr deren Tochter mit den blitzenden Augen und den dunklen Locken aufgefallen war. Irgendwie hatten Vera und ihre Tochter eine urbane Aura. Das lag auch an der Kleidung. Vera hatte ihre dunklen Haare zu einem schlampigen Dutt hochgesteckt und trug derbe Boots zu einem schlichten grauen, asymmetrisch geschnittenen Kleid. Vera musste bemerkt haben, dass Eva sie angestarrt hatte, denn sie blickte fragend zurück und hob das Kinn. Eva errötete.
»Du bist die Mutter von Carla, oder?« Vera lächelte breit.
Sie musste wirklich aus der Stadt sein, so leicht wie ihr das Du über die Lippen kam. Die anderen Mütter hatten Eva bisher immer gesiezt.
»Ja, wir sind erst vor einem halben Jahr nach Buchschachen gezogen. Ich dachte, ›Dance Together‹ könnte Carla Spaß machen.«
»Jede Freizeitbeschäftigung, bei der mein Kind nicht auf seinem Bett liegt und am Handy herumwischt, ist ein Gewinn«, sagte Vera.
Eva schmunzelte, dann überkam sie wieder die gewohnte Schüchternheit. Sie war nicht sonderlich gut in Small Talk. Das war Pauls Part. Vera hatte ihr in drei Minuten ihre halbe Lebensgeschichte und den Grund für ihre Heimkehr nach Sankt Martin in der Wart erzählt. Eva fiel es wesentlich schwerer, sich zu öffnen. In ihrer Unsicherheit starrte sie auf eine Pinnwand schräg vis-à-vis, auf der diverse Zettel und Prospekte hingen. Feng Shui, eine Aufforderung zum Mülltrennen, die Ankündigung eines Schulkonzertes. Ein Zettel mit einem grünen Daumenabdruck.
Vera folgte ihrem Blick.
»Oh, schau mal, da ist ein Aushang von einem Gartenstammtisch. Das wär was für mich. Wenn ich nicht bald die Schnecken in den Griff bekomme, zuck ich aus. Die Viecher haben mir das ganze Gemüsebeet leergefressen. Habt ihr in Buchschachen auch einen Garten?«
Eva nickte. Sie liebte alles, was wuchs und gedieh. Bei diesem Thema fühlte sie sich sicher. »Ja, aber weniger Gemüse, mehr Stauden und alte Rosen. Das meiste habe ich aus dem Nordburgenland hierher verpflanzt, aber der Garten hier ist riesig, es gibt noch so viele Lücken, ich bin noch lange nicht fertig.«
»Na dann«, sagte Vera und fotografierte den Flyer mit dem Handy, um die Kontaktdaten zu speichern. »Vielleicht sieht man sich dort.«
»Vielleicht«, sagte Eva.
Der Tanzunterricht war zu Ende. Die Tür zum Turnsaal ging auf. Dutzende Kinder stürmten zu ihren Eltern. Vera winkte Eva noch einmal zu und verschwand mit Letta im Schlepptau.
Eva blieb nachdenklich vor dem Flyer stehen. »Worauf warten wir noch«, fragte Carla.
»Ich mach noch schnell ein Foto von dem Aushang da«, sagte Eva. »Aber dann müssen wir uns tummeln, sonst wird der Papa grantig.«
Der Papa war tatsächlich grantig. »Wo warst du bitte die ganze Zeit«, herrschte er Eva an. »Ich hab dir doch gesagt, das heute Abend ist wichtig, und du fährst den ganzen Nachmittag in der Gegend spazieren.«
»Ich bin nicht spazieren gefahren, ich habe Carla von der Tanzstunde abgeholt«, verteidigte sich Eva.
Aber es war sinnlos, Paul hatte sich schon in Rage geredet: »Die kommen in zwei Stunden, das ganze Haus fäult nach Zwiebeln, nix is fertig, und du siehst erbärmlich aus. Wir müssen heute repräsentieren, geht das in deinen Schädel nicht rein? Das heute ist wichtig! Wenn ich dann einmal was von dir erledigt haben möchte, kriegst du es nicht auf die Reihe. Also bitte, komm endlich in die Gänge. Tua weiter.«
Eva seufzte tief. Als ob sie nicht wüsste, was sie zu tun hätte. Dann tat sie, was zu tun war.
Es war schon der dritte Repräsentationsabend für zukünftige Kunden und Kontakte in dieser Woche. Paul hielt Hof. Anders konnte man das, was er hier abzog, nicht beschreiben. Er gab sich vor Besuch wie ein König, der sein Reich präsentierte.
Die Hausführung war immer der erste Akt bei Pauls Abendeinladungen. Er ließ die Leute sogar ins Schlafzimmer blicken. Eva hasste die Blicke der männlichen Gäste, die dann zwischen dem luxuriösen Boxspringbett und ihr hin und her schweiften. Sie konnte deren Gedanken lesen. »Hier nagelt er also seine Frau. Sieht eh hübsch aus, die Puppe. Aber wenn man so reich ist wie der Achleitner, dann stehen die Weiber halt auf einen.«
Als ob sie Paul wegen seines Geldes geheiratet hätte. Als sie ihn kennenlernte, hatte er noch gar keines. Es war Evas Vater, der Paul damals bei der Hochzeit das Geld für die Gründung der Firma gegeben hatte. Evas Vater war ein Patriarch. Die Mitgift war der letzte Akt seiner Versorgungs- und Unterhaltspflicht für Eva gewesen. Und der ehrgeizige Paul hatte die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Er hatte mit dieser Starthilfe ein florierendes Bauunternehmen geschaffen. Dass er sein Architekturstudium nie abgeschlossen hatte, war allerdings seine Achillesferse. Vor allem, weil Eva sehr wohl ihren Abschluss auf der Universität für Bodenkultur gemacht hatte. Wofür eigentlich, fragte sich Eva. Sie hatte keinen Tag in ihrem Beruf als Landschaftsarchitektin gearbeitet. Ihr Job war es, den Haushalt zu führen und Paul in all seinem Tun zu unterstützen. Dann hatte sie nach mehreren Fehlgeburten Carla bekommen, und jetzt war es ohnehin zu spät für eine Karriere. Sie wusste, dass sie in ihrer Rolle der verzweifelten Hausfrau ein wandelndes Klischee war, und trotz ihres brillanten Intellekts betrübte sie diese Erkenntnis noch mehr als die Tatsache selbst.
Die Türglocke riss sie jäh aus ihren Grübeleien. Der Chef der »Pannonia Bau« und seine Frau waren eingetroffen. »Immer herein in meine bescheidene Hütte«, tönte Paul. Das mit dem »bescheiden« war pure Komplimenthascherei. Denn natürlich fühlte sich der Besuch dadurch genötigt, einen Lobgesang auf das Raumschiff und dessen Kommandanten anzustimmen. Paul sonnte sich in dem Lob. »Seht her, wer ich bin! Seht her, was ich erreicht habe!« Und dann immer die subtile Message: »Als meine Verbündeten könnt ihr Teil dieses Glanzes sein.«
Eva wusste genau, wie es nun weiterging. Nach der obligatorischen Hausführung würde Paul den Champagner aufreißen, und aus Herrn Direktor Zieserl und Gattin würden Harald und Sylvia werden.
Bis zum Plopp des Champagnerkorkens hatte sie Zeit, um die Vorspeisen vorzubereiten.
Sie bestrich kleine Blunzenpogatscherl mit Leberaufstrich von der südburgenländischen Weidegans und träufelte etwas Uhudlergelee darüber. Das Walderdbeeraroma der Uhudlertrauben passte gut zum erdig-würzigen Leberaufstrich aus der Region. Paul mochte fleischbetonte Küche mit dem gewissen Extra. Veganismus hielt er für eine Krankheit.
Eva servierte die Vorspeise gerade rechtzeitig zum Anstoßen und zum Bruderschaftskuss. Die Lippen des Herrn Direktor waren weich und fleischig auf ihren Wangen. Sylvia verteilte nur spitzlippige Luftküsse.
Sie reichte die Platte mit den Pogatscherln herum. Harald Zieserl griff begeistert zu und lobte den Geschmack dieses »innovativen Schmankerls«. Eva musste innerlich lachen: Hatte er gerade wirklich »Schmankerl« gesagt? Gab es tatsächlich Menschen, die dieses Unwort des Gastromarketings in den Mund nahmen?
Der Bauch des »Pannonia Bau«-Direktors wölbte sich über seiner Anzughose, er hatte ein freundliches Gesicht mit Hamsterbacken und einem leichten Doppelkinn, und seine Augen blitzten jovial. Er sah aus wie einer, der sich gerne anfüttern ließ. Wahrscheinlich hatte er sich sein Übergewicht auf Dutzenden Besprechungen, Veranstaltungen und politischen Events angefressen.
Seine Frau Sylvia war deutlich jünger, und alles an ihr wirkte hart. Ihr gestählter Body, der in Stretchhose und hochhackigen Boots steckte, ihre Fake-Brüste, die unter dem engen Top fast waagrecht von ihr wegstanden, der Zug um ihren Mund. Ihre grauen Augen hatte sie mit viel schwarzem Kajal umrandet. Auch ihre Haare waren pechschwarz gefärbt. Eva hätte wetten können, dass die Frau auch irgendwo ein schwarzes Tattoo aus ihrer wilden Zeit hatte, bevor sie die Frau Baudirektor wurde, vielleicht sogar ein Arschgeweih. Altersmäßig könnte das hinkommen. Eventuell würde Paul dieses Geheimnis lüften. Den interessierten Blick, mit dem er Sylvia aus dem Augenwinkel taxierte, kannte Eva nur zu gut. Aber Paul war viel zu schlau, um sein Interesse offen zu zeigen. Das konnte warten. Seine heutige Priorität war nicht, die Frau anzubraten, sondern den Mann einzukochen. Und das tat er gerade nach allen Regeln der Kunst.
Paul war ein blendender Unterhalter. Er hatte ein Feuerwerk an witzigen Geschichten parat. Eva kannte die meisten dieser Anekdoten schon und lächelte daher nur, wie jemand halt lächelt, der einen Witz zum 100. Mal hört, aber die Zieserls hingen gebannt an seinen Lippen. Außerdem verstand es Paul ausgezeichnet, anderen Leuten das Gefühl zu geben, sie wären etwas Besonderes. Er hatte sich gut auf den Abend vorbereitet, den bisherigen Lebenslauf des »Pannonia Bau«-Direktors recherchiert und streute ihm jetzt gekonnt Rosen. »Also das Wohnprojekt Pinkatal. Damit ist dir schon ein Coup gelungen, mein lieber Freund. Das hat Style. Das hätte die Zaha Hadid8 auch nicht besser hinbekommen.« Dem Direktor schwoll die Brust vor Stolz.
Und schon lenkte Paul das Gespräch geschickt auf das Thema, auf das er schon den ganzen Abend hinsteuerte. »Ehrlich gesagt erinnern mich die Wohnungen im Pinkatal ein bisschen an mein letztes Werk. Ihr wisst schon, das ›Inselparadies‹ am Neusiedlersee. So etwas können wir auch hier schaffen. Mit einem attraktiven Wohnprojekt wie diesem bringen wir die Menschen in unsere Region, stärken die südburgenländische Wirtschaft und schaffen zusätzliche Arbeitsplätze.«
Paul hätte echt in die Politik gehen können. Er sagte bereits »unsere Region«, obwohl er gerade mal ein paar Monate hier lebt, überlegte Eva. Aber dem »Pannonia Bau«-Typen schien das runterzugehen wie Öl. »Ich bin in meiner Funktion natürlich ein großer Freund der Regionalentwicklung«, sagte er und biss begeistert in das fünfte Blunzenpogatscherl.
»Unser Gast hat Hunger, was macht die Hauptspeise?« Das »Tua weiter« sparte er sich in Gegenwart der Gäste. Aber Eva hörte es, auch wenn es unausgesprochen blieb.
»Kommt sofort!«, sagte sie mit einem strahlenden Fake-Lächeln und verzog sich in die Küche.
Sie selbst hatte null Appetit. Sie hatte schon mit Carla eine Kleinigkeit gegessen, die nach dem Tanzen ausgehungert gewesen war und nun vermutlich in ihrem Zimmer lag und Serien schaute. Eva hätte sich gerne zu ihr ins Bett gelegt und ihr dabei Gesellschaft geleistet.
Dabei roch die Daube köstlich. Das Fleisch war butterweich, die Soße sämig. Ein Duft von Thymian, Rosmarin, Lorbeer und Wacholder erfüllte die Küche, als sie kurz den Deckel lüftete. Die angebrochene Flasche Kochwein stand noch neben der Abwasch. Eva genehmigte sich einen kräftigen Schluck. Anders würde sie diesen Abend nicht durchstehen. Als Beilage hatte sie weiße Polenta und Bittersalate mit Apfel-Wacholder-Vinaigrette gemacht. Die Gäste würden zufrieden sein.
Sie trug das Essen auf. Der Champagner war schon leer. Paul öffnete gerade eine Flasche Desiderius 2013. Die Gäste mussten ihm wirklich wichtig sein, wenn er mit dermaßen großen Geschützen auffuhr.
»Ah, der Wein vom Szemes. Ich dachte, der Jahrgang ist längst ausverkauft«, sagte Harald Zieserl anerkennend.
»Nicht, wenn man die richtigen Leute kennt«, grinste Paul verschwörerisch. »In unserem Geschäft sind gute Beziehungen doch alles.« Er zwinkerte dem »Pannonia Bau«-Chef zu. »Soll ich dir eine Kiste besorgen?«
Eva kaute betont langsam an einem Bittersalatblatt. Sie kam sich an solchen Abenden immer öfters vor wie die Zuschauerin in einem bizarren Theaterstück. Nicht nur Paul und Harald, auch Sylvia Zieserl ließ sich ordentlich auftischen. Diese Sylvia isst viel zu viel für ihre Figur, dachte Eva. Entweder sie macht Intervallfasten, oder sie ist Bulimikerin. Bitte, lieber Gott, lass sie nicht in mein Klo speiben.
»Würmchen, träumst du schon wieder, der Herr Direktor sitzt auf dem Trockenen, schenk ihm doch nach.« Eva hasste es, wenn Paul sie Würmchen nannte. Ein Spitzname, den er ihr wegen ihrer Gartenleidenschaft gegeben hatte. Sie war Landschaftsarchitektin und kein Kompostwurm. Aber das jetzt auszudiskutieren, wäre sinnlos gewesen.
Sylvia Zieserl grinste belustigt. »Würmchen? Wie originell.« Und dann nach einer kleinen Pause: »Darf ich hier rauchen?«
Nein, dachte Eva, sie hatte keine Lust, dass das Raumschiff danach wie ein Aschenbecher stinken würde.
»Natürlich«, sagte Paul, griff zum Feuerzeug, das neben dem Kamin lag, und gab Sylvia lässig Feuer. Eva sah, dass er dabei mit dem kleinen Finger ihre Hand streifte. Sylvia zog überrascht die Augenbraue hoch, wirkte aber eher geschmeichelt als brüskiert. Harald Zieserl kriegte davon nichts mit.
Paul war bereits beim Hauptakt seiner Aufführung angelangt. »Wir sollten hier im Süden wirklich über so ein Projekt wie das ›Inselparadies‹ nachdenken. Die Lafnitzer Auen wären ideal dafür. Wohnen in und mit der Natur. Attraktive Wochenendhäuser für die urbanen Bobos, die mehr Geld als Verstand haben und sich nach Entschleunigung sehnen.«
Harald Zieserl nickte interessiert. »Was ist ein Bobo?«, fragte Sylvia gelangweilt.
»Na, so ein bürgerlicher Pseudoidealist, der wegen der Klimakrise nicht mehr nach Mauritius fliegt und dem es in seinem Wochenendhaus im Waldviertel zu kalt ist. Hier im Südburgenland ist das Wetter fast so schön wie in der Toskana. Der Bobo kann hier am Wochenende seinen Traum vom Landleben zelebrieren und ist dank der guten Autobahnanbindung am Montag trotzdem pünktlich in seinem Büro in der Stadt«, klärte Paul auf. »Habt ihr noch nie von Bobos gehört? Bourgeoiser Bohémien. Der siebente und der achte Bezirk in Wien und das Lendviertel in Graz sind voll von solchen Leuten.«
Die Zieserls lauschten gespannt. »Das Ganze muss natürlich eine finanzielle Win-win-Situation für uns sein«, sagte Paul und rieb den Daumen der rechten Hand gegen den Mittelfinger. »Die Bürgermeister müssen halt mitspielen, wegen der Umwidmung, aber im Nordburgenland war das auch kein Problem. Da wäscht eine Hand die andere. Da kennst du sicher die richtigen Leute. Win-win, sage ich nur. Wir müssen halt schauen, dass die Grünen nicht zu schnell Wind von der Sache kriegen. Die wehren sich ja gegen jede Bautätigkeit und verstehen einfach nicht, dass eine attraktive Wohnanlage mit einladenden Grün- und Kommunikationsflächen auch dem Schutz von Grund und Boden dient.«
»Ich hab eh gute politische Beziehungen, auch in der Bundesregierung«, sagte Harald Zieserl stolz.
»Was stinkt denn da so grauenhaft?«, fragte Sylvia und rümpfte angewidert die Nase.
Eva stürzte in die Küche. Auf der linken Herdplatte stand die Plastiktortenform mit der Mohntorte, die sie am Nachmittag gebacken hatte. Die Herdplatte war an, das Plastik war geschmolzen und stank entsetzlich.
Eva versuchte, die Form wegzuziehen, aber sie klebte an der Platte fest. Ihr Versuch, den Herd auszuschalten, war ebenfalls ergebnislos. Das Ding piepste nur wie verrückt.
Paul war ihr gefolgt. Sie bemerkte seine steile Zornesfalte. Er hasste solche Ungeschicklichkeiten, weil sie seine perfekte Performance störten. »Was hast du da wieder angestellt«, zischte er sie an, »eine Plastikschüssel auf einen aufgedrehten Herd stellen. Wie blöd kann man sein?«
»Ich schwöre, der Herd war nicht an!«, sagte Eva. »Ich war seit einer halben Stunde nicht mehr in der Küche. Der muss von allein angegangen sein.«
»Jaja, von allein«, höhnte Paul. »Das war vermutlich der Heilige Geist. Mach das weg und dann lass dir was einfallen wegen dem Dessert. Ist noch Eis eingefroren? Dann nimm das. Und servier ja nicht den Kastanienreis, den die Putzfrau ständig aus Ungarn daherzaht, der besteht nur aus Bohnen und Zucker. Ich mach inzwischen einen Eiswein auf.«
Er rannte wieder zurück zu den Gästen. Eva hatte er finster angestarrt, aber sobald er in Sichtweite der Zieserls war, knipste er wieder sein Siegerlächeln an.
»Kleines Problem mit dem Herd.«
Eva hatte es inzwischen geschafft, den Herd abzudrehen. Sie kratzte mit dem Ceranfeldschaber das weiche rauchende Plastik von der Platte. Sie hatte den Dunstabzug auf Höchstleistung aufgedreht und eine Duftkerze angezündet, aber es stank immer noch fürchterlich. Schnell richtete sie in kleinen Schälchen Eis an. Sie konnte sich noch immer nicht erklären, warum der Herd angegangen war. Sie wusste zu 100 Prozent, dass sie diese Platte den ganzen Abend lang nicht bedient hatte. Vielleicht wurde sie auch verrückt. Paul warf ihr ständig vor, dass sie ein Traummännlein war, das Geister sah und ein Fall für den Psychologen war.
Eva griff zum Tablett, stellte die Eisschälchen, Waffeln und eine Schüssel Schlagobers darauf und ging damit zurück zu Paul und seinen Gästen. Wenigstens würde er sie nicht weiter sekkieren, solange die beiden da waren. Dass sie sich nachher etwas anhören würde können, war sicher.
Die wahre Schuldige kam freilich nicht nur ungestraft davon, sie wiederholte sogar ihre Missetat: Die fette Fliege kreiste summend um den Herd und ließ sich dann zum zweiten Mal an diesem Abend gemütlich auf dem Pluszeichen des Displays nieder, an dem kaum sichtbar ein Tropfen Uhudlergelee klebte.
6 Dann ist ihm auch noch die Frau abhandengekommen
7 War das die Wienerin, der du immer die Eier hinaufbringst«, fragte die eine und fügte ein bisschen süffisant hinzu: »Warum tust du das, bei so einem Wagen kann sie sich auch Eier kaufen?« »Ja, weil ich neugierig bin«, sagte die andere. »Außerdem ist das keine Wienerin, sondern eine aus dem Nordburgenland.« »Jesus«, sagte die erste. »Nordburgenländer sind das … Geh, hör mir auf. Da ist mir ja ein Bimbo noch lieber.«
8 Zaha Hadid war eine bekannte irakisch-britische Architektin.
Kapitel 3 Skikurs
Ob und wann er darf, darüber entscheidet bei den Taufliegen immer das Weibchen – und es macht es dem Auserwählten nicht leicht. Anstatt dem Werben zügig nachzugeben, weist es dieses zuerst zurück. Doch hat das Männchen es geschafft, sie zu begatten, hat es gewonnen. Denn seine Samenflüssigkeit löst bei ihr ein mysteriöses Post-Sex-Verhalten aus: die Abwehr weiterer Verehrer und vermehrte Eierproduktion.
Paul erwachte mit einer Morgenlatte. Kurz überlegte er, ob er seine noch schlafende Ehefrau damit konfrontieren sollte. Aber dann entschied er, dass ihm das zu mühsam war. Er hatte gestern, nachdem die Zieserls gegangen waren, noch einen wilden Streit mit Eva gehabt. Er hatte ihr vorgeworfen, dass sie unfähig war, ein simples Essen auf den Tisch zu bringen. Gerade dann, wenn es wirklich wichtig für ihn war. Und dann hatte er sie gefragt, ob sie sich mit Absicht so blöd anstellen würde, um ihn zu demütigen. Eva hatte geheult und war hysterisch geworden.
Für Versöhnungssex war es jetzt zu spät. So wie er Eva kannte, war die schon im »Gekränkt-und-beleidigt-Modus« und würde den ganzen Tag kaum mit ihm sprechen, sondern ihn nur mit waidwundem Blick mustern. Wie er diese Märtyrernummer hasste.
Evas passive Opferhaltung widerte ihn zunehmend an. Konnte sie nicht ein bisschen Feuer im Arsch haben. So wie diese Zieserl. Jaja, die Zieserl. Er dachte an ihre Titten. Die waren echt geil. Er fuhr mit der Hand in seine Boxershorts und stellte sich vor, sein Schwanz läge zwischen ihren Titten. Er bewegte seine Hand langsam auf und ab. Dass Eva was mitbekommen würde, schloss er aus. Die hatte Ohrenstöpsel drinnen, wegen seiner Schnarcherei. Und außerdem hatte sie ihre komischen CBD-Tropfen genommen, wie immer, wenn sie was aufregte. Das war dann aber auch schon der letzte Gedanken, den er an Eva verschwendete. An die Zieserl zu denken, war weitaus vergnüglicher. Er grunzte zufrieden, als er sich seinen Fantasien hingab.
Eva wachte auf, weil sie spürte, dass sich die Matratze, auf der sie lag, rhythmisch bewegte. Sie erstarrte.
Das konnte jetzt bitte nicht wahr sein. Ihr Mann lag neben ihr und holte sich einen runter.
Was sollte sie tun? Sie könnte hochfahren, ihn anschreien, ihn beschämen. Aber stattdessen hielt sie die Augen fest geschlossen und stellte sich schlafend. Sie spürte einen Kloß im Hals. Sie biss sich auf die Zunge. Tränen stiegen hinter ihren geschlossenen Lidern auf. Sie hatte all das schon einmal erlebt. So ähnlich und noch viel schlimmer.
Es passierte in der zweiten Klasse Oberstufe während ihrer Zeit im Gymnasium. Eva war unsterblich in Paul verliebt. Sie war die Jüngste in der Klasse, gerade mal 15. Sie war noch Jungfrau. Paul wollte es tun, aber sie hatte Angst davor, dass es wehtun würde, davor, schwanger zu werden, und am allermeisten davor, sich dumm anzustellen. Dümmer als all die anderen erfahrenen Weiber in der Klasse wie die Bettina oder die Sandy, mit denen der Paul schon was gehabt hatte.
Küssen hatte Eva beim Flaschendrehen gelernt. Flaschendrehen wurde damals auf jeder Klassenparty gespielt. Sie hatte immer gebetet, dass sie nicht den pickligen Robert oder den schweißelnden Alex, sondern den Paul erwischen würde. Und dann erwischte sie ihn wirklich. Eva konnte sich noch genau an das Etikett der Flasche erinnern. Es war eine leere Mavrodaphne-Flasche – den süßen griechischen Wein hatten sie zuvor alle gemeinsam gesoffen. Eva vertrug schon damals nichts. Sie hatte rote Wangen vor Aufregung und drehte die Flasche besonders wild, als sie an der Reihe war. Die Flasche kurvte sicher achtmal im Kreis, bevor sie wackelnd zur Ruhe kam. Der Flaschenhals zeigte auf Paul.
Paul grinste und robbte auf den Knien zu ihr, dann nahm er ihr Gesicht in seine Hände und küsste sie. Und der Kuss war richtig gut, nicht so nass und schlabbrig wie der vom Dietmar und den anderen Buben in der Klasse, die sie in ihrer ewigen Pechsträhne immer zu erwischen schien, wenn sie Flaschendrehen spielten. Von da an war Eva verliebt in Paul. Und aus irgendeinem Grund hatte der Paul dann auch einen Stand auf sie gehabt. Nur das mit dem Sex, oder besser gesagt, das mit dem Keinen-Sex-Haben, war ein Problem.
Dann war der Skikurs gekommen. Der Höhepunkt des Schuljahres, obwohl das Quartier ein einziger Tiefpunkt war. Eine Jugendherberge in Zell am See. Man schlief zu sechst oder zu acht in einem Raum mit Stockbetten. Wählte man das untere Bett, so staubte es aus der Rosshaarmatratze des oberen Betts auf einen herunter. Falls der oben Schlafende sich während der Nacht zu viel bewegte, konnte man ihn mit ein paar Tritten in seinen Rücken daran erinnern, dass man auch noch da war. Allerdings musste man dabei aufpassen, nicht den Lattenrost aus den Angeln zu heben. Schlief man oben, so war der Plafond so knapp über dem Bett, dass es einer gewissen Körperbeherrschung bedurfte, unter die Decke zu gleiten, ohne sich den Kopf anzuhauen.
Eva hatte oben in so einem Bett gelegen, weil sie die Kleinste der Klasse war und deswegen weniger Platz brauchte als die Sandy, die unter ihr lag und schon so groß und entwickelt war wie eine richtige Frau.
Eva konnte dem Skifahren per se nur wenig abgewinnen. Sie war nicht unsportlich, sie machte Ballett und Rhythmische Gymnastik, aber Skifahren war einfach nicht ihres. Wacklige Sessellift- und Schleppliftfahrten, bei denen der Bügel immer weiter über den Hintern rutschte, bis man aus der Spur fiel. Klamme, schmerzende Finger, wenn nach einem Sturz Schnee in die Fäustlinge geraten war. Klobige Skischuhe, mit denen sie in der Hütte auf den Stiegen zum Klo immer stolperte. Viel zu lange Leihski, die machten, was sie wollten. Eisflächen, Mugel, brauner Matsch.
Am meisten freute sie sich immer auf später, wenn die Lehrer schliefen und sich Paul und ein paar andere Burschen heimlich in das Zimmer der Mädchen schlichen, sie dicht an dicht auf ihrem Stockbett saßen, »Bravo« lasen, gemeinsam Paprikachips aßen und den heimlich mitgebrachten Fernet tranken. Die Lehrer hatten angedroht, dass jeder Bursch, der in einem Mädchenzimmer erwischt wurde, von der Schule fliegen würde. Aber Paul hatte schon damals gewusst, wie er es anstellen musste, um nicht erwischt zu werden.
Und dann war dieser verhängnisvolle letzte Abend gekommen. Es hatte eine Abschlussdisco gegeben. Die Mädchen hatten sich alle in Schale geworfen. Sie trugen Glitzershirts und hellrosa getönten Lippenpflegestift, um die gerade erworbene Skifahrerbräune zu betonen.
Die Disco war ein Raum ohne Fenster, aber mit Ghettoblaster. Und bei »Everything I do, I do it for you« von Bryan Adams hatte Paul mit Eva eng getanzt und ihr ins Ohr geflüstert, er würde heute zu ihr ins Zimmer kommen, aber allein und viel später. Und dann würde er es mit ihr tun.
»Nein«, hatte Eva erschrocken gesagt. War er deppert geworden? Am Skikurs in einem Raum mit allen anderen? Er hatte nur blöd gegrinst und die Augenbraue hochgezogen und noch mehr Cola getrunken, das die Klasse vorsorglich schon vorher mit Inländer Rum gespiked hatte. Und dann hatte er sie für den Rest des Abends ignoriert.
In der Nacht war Eva dann aufgewacht, weil sich das Stockbett rhythmisch bewegt hatte. Erst wusste sie nicht, was es war. Ein Erdbeben? Eine Lawine? Sie wollte schon das Licht anmachen.
Aber dann hörte sie unterdrücktes Stöhnen, und da wusste sie, die Sandy unter ihr trieb es mit jemandem.
Es dauerte nicht lange, vielleicht zehn Minuten, aber Eva kam es vor wie eine Ewigkeit. Sie fand es furchtbar peinlich und verstörend, aber irgendwie auch spannend und erregend.
Dann stand der Bursche, der bei der Sandy im Bett gewesen war, auf. Eva sah, wie er sich aufrichtete und seine Trainingshose hochzog. Er hatte keine Schuhe an, nur Socken. So schlich er zurück zur Tür, und als er diese öffnete, um den Raum zu verlassen, fiel das Notlicht aus dem Gang auf sein Gesicht, und Eva sah, wer es war. Paul.
Eva weinte die ganze Nacht. Am nächsten Tag redete sie im Bus auf der Rückreise nach Eisenstadt kein Wort mit ihm. Paul redete interessanterweise auch kein Wort mit Sandy.
Eine Woche war absolute Funkstille zwischen Eva und Paul. Eva hätte ihn hassen sollen, aber stattdessen hatte sie das Gefühl, das alles wäre ihre Schuld gewesen. Es war passiert, weil sie zu unreif und ängstlich war und ihrem Freund nicht das geben konnte, was er brauchte. Sie wollte ihn nicht verlieren. Sie konnte ihn nicht verlieren. Sie brauchte ihn.
Am darauffolgenden Wochenende holte Paul sie am Samstag ab wie immer. Sie gingen in die Disco in Eisenstadt. Eva trank fünf Tequila auf ex, dann sagte sie ihm, sie fühlte sich nun reif für Sex.
Paul fuhr mit ihr in den Wald und entjungferte sie im Auto. Es tat weh. Eva hatte das Gefühl, dass sie sich ungeschickt anstellte. Und danach fragte sie sich, was alle anderen an Sex fanden. Aber von diesem Tag an waren Paul und sie offiziell zusammen.
Paul war der geborene Leader. Er forderte einfach ein, was er wollte, und auch wenn er bei manchen unbeliebt war, gelang es ihm, eine Illusion großer Popularität zu schaffen.
Schon mit zehn reagierte er auf Bemerkungen wie »Du bist nicht mehr mein Freund« nur mit einem lapidaren Schulterzucken und einem höhnischen Lachen: »Ist mir doch egal.«
Mit zwölf war er der König beim »Bluatfetzen«, einem Spiel, bei dem der eine Spieler versuchen muss, eine Münze in die Luft zu werfen und diese im Flug nach bestimmten Regeln zu fangen. Gelingt ihm das nicht, darf ihm der andere Spieler die Münze mit den Fingern gegen die Knöchel der geballten Faust schnippen. Und das wurde so lange gespielt, bis die Knöchel blutig waren.
Mit 14 zerdrückte Paul leere Bierdosen auf seiner Stirn und entdeckte den Alkohol und die Mädchen. Und diese entdeckten ihn. Vor allem die, die in den Mädchencliquen das Sagen hatten, rissen sich um ihn. Dabei basierten all diese Interaktionen auf einem gravierenden Irrtum. Alle Beteiligten verwechselten bei der Partnerwahl Popularität mit Beliebtheit. Beliebtheit drückt aus, wen man persönlich gern mag. Popularität hingegen drückt aus, was man denkt, wen die anderen am meisten mögen.
Mit 16 küsste er beim Flaschendrehen zufällig Eva. Danach schmuste er ein paarmal mit ihr. Sie war ihm vorher nicht wirklich aufgefallen, obwohl sie ausgesprochen hübsch war. Ihre Rolle in der Klasse war es, keine bestimmte Rolle zu haben. Sie war weder stark noch schwach, weder Mitläuferin noch Verteidigerin. Sie war in dieser ganzen mafiösen Gruppendynamik einfach neutral. Und sie war die Erste, die Paul mochte, weil sie ihn mochte und nicht, weil er populär war. Der Haken war nur: Paul mochte sich selbst nicht besonders, und er wusste nicht, ob er Eva für ihre Gefühle lieben oder verachten sollte.
Trauerarbeit Akt 2
Die Menschen sagen, dass ein schneller Tod ein Geschenk ist. Aber er hätte nicht sterben sollen. Nicht er. Es gibt keine Gerechtigkeit. Ich will, dass er Krebs bekommt. Ich weiß, wie Krebs ist. Ich habe das alles schon einmal gesehen. Wie ein Krebskranker nach Luft schnappt, sich mit starken Schmerzen herumschleppt. Wie sich seine Lungen mit Wasser füllen. Wie der Bauch anschwillt. Wie sich die Augen gelb färben und die Haare ausgehen. Aber Krebs bekommen auch immer die Falschen. Wer Gerechtigkeit will, muss selbst dafür sorgen.
Kapitel 4 Johannas Kräuterstammtisch
In Asien gibt es Mönche und Nonnen, deren Philosophie es ist, niemandem wehzutun, auch nicht den kleinsten Wesen auf diesem Planeten, weder in Gedanken, Worten noch Taten. Die Anhänger des Jainismus tragen stets einen Mundschutz, damit sie nicht versehentlich Insekten verschlucken, und fahren mit Staubwedeln über den Boden, bevor sie diesen betreten, um keine Insekten zu zerquetschen.
Echtes Blau ist im Gartenreich schwer zu finden. Eine Tatsache, mit der sich auch Johanna plagte. In der Mitte ihres »blauen Beetes« thronte eine Bauernhortensie, die zwar hellblau aufblühte, aber dann immer wieder beharrlich in ein schmutziggraues Lila umschwenkte.
Johanna hatte schon mit allerlei Listen versucht, die Pflanze umzustimmen. Sie hatte rund um den Wurzelstock Alaun und rostige Nägel vergraben, Essig ins Gießwasser gegeben und die Staude mit Rhododendronerde angehäufelt. Mal hatte sie dabei mehr, mal weniger Erfolg. Aber erst wenn der Herbst kam und die Blüten zusehends grüner wurden, war das Ringen um die richtige Farbe vorbei, und Johanna war wieder versöhnt – bis zum nächsten Jahr.