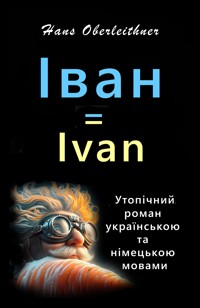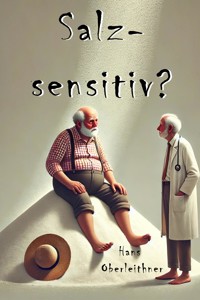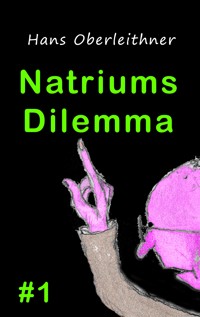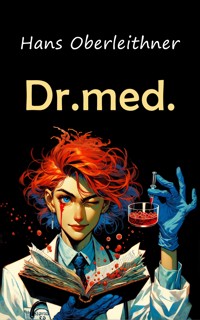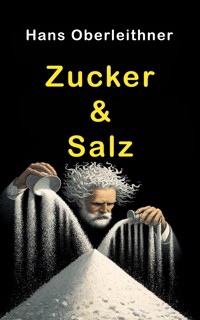
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zuckers Dilemma: Weder Mensch, Tier noch Pflanze existierten auf dieser Welt, gäbe es nicht Zucker. Und weil der Mensch wissen will, warum das so ist, spürt er ihm nach. So kommt es, dass dieser scheinbar harmlose Stoff der Natur in Professor Schrullings Kopf zu leben beginnt, allmählich sein Denken steuert, und ihn schließlich vollends beherrscht. Der Jäger wird zum Gejagten, Zucker zum Monster. Natriums Dilemma: Weder Mensch, Tier noch Pflanze existierten auf dieser Welt, gäbe es nicht Natrium. Und weil der Mensch wissen will, warum das so ist, spürt er ihm nach. So kommt es, dass dieses scheinbar tote Element der Natur in Professor Wunderlichs Kopf zu leben beginnt, allmählich sein Denken steuert, und ihn schließlich vollends beherrscht. Der Jäger wird zum Gejagten, Natrium zum Meuchler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hans Oberleithner
Zucker & Salz
Ein süß-salziger Sachbuch-Thriller
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Zuckers Dilemma
Schrulling
Agatha
Pablo
Sophia
Fanni
Tim
Vermutung
Verdacht
Mörderkristall
Zweifel
Entschluss
Erwachen
Schrecken
Paranoia
Flucht
Nachspiel
Reflexionen
Albtraum
Monolog
Hypothese
Experiment
Brainstorming
Analyse
Rio de Janeiro
Kyoto
Moskau
Cambridge
Traumwelt
Erfüllung
Zwillingsbrüder
Leere
Flut
Kampf
Leid
Selbstfindung
Heimchen
Natriums Dilemma
Wunderlich
Penelope
Pedro
Victoria
Susanne
Nick
Vermutung
Verdacht
Mörderelement
Zweifel
Entschluss
Erwachen
Schrecken
Paranoia
Flucht
Nachspiel
Reflexionen
Albtraum
Monolog
Hypothese
Experiment
Brainstorming
Analyse
Rio de Janeiro
Kyoto
Moskau
Cambridge
Traumwelt
Erfüllung
Jahre später
Leere
Flut
Kampf
Leid
Selbstfindung
Heimchen
Impressum neobooks
Prolog
Salz ist Zuckers Zwillingsbruder.
Als unverbesserlicher Experimentator habe ich den Versuch gewagt, den Thriller Natriums Dilemma in Zuckers Dilemma umzuschreiben. Um gleich im Vorfeld Prügel von mir abzuwenden, möchte ich dieses „literarische Experiment“ mit drei grundlegenden Eigenschaften rechtfertigen, die Zucker & Salz (Natrium) gemeinsam haben:
Ohne Zucker & Salz ist Leben nicht möglich
Etwas Zucker & Salz macht das Leben schön
Viel Zucker & Salz verkürzt das Leben
So habe ich einfach Salz gegen Zucker ausgetauscht, aber den Verlauf der Story so werktreu wie möglich belassen. Mein „wissenschaftliches Gewissen“ hat mich dann doch gezwungen, da und dort physiologische Anpassungen vorzunehmen, um Zucker & Salz noch ein gewisses Eigenleben zu ermöglichen.
Die Namen der Protagonisten habe ich verändert um zu signalisieren, dass nicht nur Moleküle austauschbar sind, sondern auch ganze Menschen (zumindest in der Fiktion).
Trotzdem bleibt die Story „scheinbar“ dieselbe. Scheinbar, denn das Wort Salz löst in uns meist ganz andere Gedankengänge aus als es das Wort Zucker tut.
Und auf einmal befindet man sich in unterschiedlichen Welten, trotz der scheinbar gleichen Story ...
Der Autor
Zuckers Dilemma
Schrulling
Labormief schlägt ihm entgegen als Schrulling, Professor für Lebenswissenschaften und berüchtigter Zuckerhasser, an einem nebligen Montagmorgen im Jahr 2000 sein Institut betritt. Ein paar Stimmen dringen dünn aus den Katakomben, wie er die im Souterrain gelegenen Labore benennt, und verebben rasch, sobald er den, von Kaffeeflecken geadelten grauen Filzboden seines Arbeitszimmers betritt. Er entledigt sich der Winterjacke, wirft seinen Rucksack in die Ecke und geht auf die seinem Zimmer gegenüberliegende Toilette, um die Gläser seiner Hornbrille mit einem Streifen Papier vom Wasserdampf zu befreien. Dabei blickt er in den Spiegel über dem Waschbecken. Er mag diese kurzen Momente, wenn er ohne Brille sein Gesicht betrachtet. Es ist dann weichgezeichnet, die groben Falten seiner Stirn und die Muttermale auf seinen Wangen sind dann zu sanften Wellen und dezenten Schatten mutiert, was ihn in gewisser Weise fröhlich stimmt, sodass er seinen morgendlichen Rundgang durchs Institut mit gewöhnlich guter Laune beginnt.
Sein erster Stopp ist gleich nebenan, in der Kommandozentrale, wie das kleine Geschäftsbüro von Insidern gern genannt wird. Frau Herrlich, Seele des Instituts, blickt etwas besorgt durch ihre grün geränderte Brille am Bildschirm vorbei zu ihm hin, während er sich auf eine türkisfarbene Philippe Starck Couch fallen lässt. Es ist das einzige Designermöbel, das ihm die Universität im Zuge seiner Berufung vor mehr als 20 Jahren erlaubt hatte anzuschaffen. Das grüne Licht kam allerdings erst nach seiner schriftlichen Begründung, dass die Farbe Türkis nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen den Stress von Studierenden, die auf dieser Couch ihr Examen erwarteten, erheblich senken würde. Schrulling erinnert sich jedes Mal mit Schmunzeln, wenn er sich auf diese Couch niederlässt, wie er den entscheidungsbefugten Verwaltungsbeamten letztlich damit gefügig gemacht hatte, indem er einen im Journal of Color Psychology publizierten Artikel seinem Begründungsschreiben hinzufügte. Er hatte die innere Gewissheit, dass der Empfänger von diesem in Fachchinesisch verfassten Artikel gleichsam beeindruckt wie überfordert sein würde. Uns so war es auch.
Es gebe dicke Luft im Zellkulturlabor, sagt Frau Herrlich mit einem magischen Schwingen in ihrer Stimme, wohl um dieser Botschaft mehr Eindringtiefe in Schrullings Hirnrinde zu verschaffen. Irgendetwas Komisches laufe gegenwärtig da unten ab. Sie teile ihm das lieber gleich mit, damit er sich innerlich darauf einstellen könne. Schrulling hat sich an diese Art von morgendlichen Botschaften gewöhnt, es erzeugt in ihm nicht mehr diese gewisse Enge im Hals, wie er sie früher verspürt hat, als er noch jung und unerfahren war. Inzwischen hat er sich ein reiches Repertoire an Strategien zugelegt, um solchen Situationen zu begegnen. Zum Beispiel, aufmerksames Zuhören, begleitet von nachdenklichem Kopfnicken, um das aufgeworfene Problem still und leise auszutrocknen. Oder, penetrantes Hinterfragen, um das Problem emotional einzudampfen, bis es, entkernt und geschrumpft, seine ursprüngliche Bedeutung verloren hat. Oder auch, mit ein paar lockeren Bemerkungen das Problem weglächeln, so, dass es den Nimbus der Ernsthaftigkeit einbüßt. So begibt er sich also gut gewappnet nach unten in die Katakomben.
In fahles Neonlicht getaucht, trifft er auf seine Mitstreiter. Sie haben sich um den Brutschrank gruppiert, dem behaglichen Zuhause von Millionen lebender Zellen aus Organismen, die längst gestorben sind, aber deren einzelne Bausteine bei guter Betreuung in dieser künstlichen Umgebung bis zum Nimmerleinstag weiterleben. Der Anblick erinnert ihn an ein Bild Rembrandts, auf dem ein toter Straßenräuber zu sehen ist, nackt auf dem Seziertisch des Anatomen Dr. Nicolaes Tulp liegend und umgeben von vornübergebeugten Gestalten, die mit ernster Miene den Meister fragend anblicken.
Da steht Agatha, die streitbare Dozentin, die Wangen leicht gerötet und ihr bohrender Blick auf Schrulling gerichtet. Daneben, in geduckter Haltung und überlangem weißen Labormantel, lugt der kleine Pablo, Jungforscher aus Montevideo, über die Schulter von Sophia, Doktorandin aus Kiew, die ihrerseits ein sicheres Plätzchen in Agathas Windschatten aufgesucht hat. Tim, der technische Assistent kauert versunken wie Rodins Denker auf einem der schwarzen Laborhocker, den Blick auf den Boden gerichtet, während Fanni, die Ziehmutter der Zellen, angestrengt durch die Glasscheibe ins Innere des Brutschranks starrt. Schrulling streift mit einem flüchtigen Blick die Gesichter und überlegt kurz, welche seiner Problemlösungsstrategien hier am besten zur Anwendung kommen sollte. Die Luft um ihn herum ist irgendwie elektrisch aufgeladen, es scheint zu knistern. Panik auf der Titanic, mit dieser Feststellung versucht er die Scherzstrategie, was aber die Gesichter wenig aufzuhellen scheint. Agatha zeigt mit spitzem Finger in Richtung Brutschrank. Der Tod geht um, sagt sie etwas manieriert und wirft energisch ihre dunklen Haare in den Nacken. Beim Wort Tod geht ein kurzer Schauer durch Pablos zusammengesunkenen Körper und Sophias Blick wirkt zunehmend gläsern. Während Tims Kopf unwillig die Denkerpose verlässt und seine Augen ziellos die weiße Decke über ihm mustern, fügt Fanni noch Ursache unbekannt hinzu.
Währenddessen schweifen Schrullings Gedanken zurück in die Vergangenheit. Wie oft schon hat er solche Situationen erlebt. Er kennt dieses dumpfe Gefühl von Ratlosigkeit, das sich wie ein hochinfektiöses Virus in den Gehirnen einnisten kann und jeden kreativen Gedanken im Vornherein im Keim erstickt. Immer wieder hat er sich aufgerafft und sich mit seinen Mitarbeitern auf die Jagd nach den Ursachen begeben, Hypothesen geschmiedet, getestet und wieder verworfen. Bis eines Tages, wie aus heiterem Himmel, das Problem von selbst verschwunden ist, ohne erkennbaren Grund. Zurück lässt so eine vorübergehende Gefängnisrevolte, wie Schrulling das Massensterben von Zellen im Brutschrank einmal genannt hat, zwei Lager. Lager eins ist glücklich, dass alles vorüber ist, während Lager zwei unglücklich ist, dass das Rätsel noch ungelöst ist. Altgediente Forscher wie er unterstützten eher Lager eins, während sie aufkeimende Verschwörungstheorien von Lager zwei wegzulachen versuchten.
Mit solchen Gedanken im Kopf begibt sich Schrulling mit seinen Leuten in das obere Geschoß des Instituts. Er macht das Schlusslicht dieser kleinen Prozession, die einen kurzen Zwischenstopp in der engen Institutsküche einlegt. Dort staut es sich um die Schweizer Kaffeemaschine, die stampfend und dampfend zu Höchstform aufläuft. Agatha macht sich kunstvoll einen Macchiato, Pablo hält bescheiden sein winziges Tässchen für einen Espresso bereit, andere haben den Wasserkocher für ihren Tee angeworfen. Schrullings Finger gleiten über das warme Chrom der Maschine. So zuverlässig wie diese Maschine arbeitet wünschte er sich das Zellleben unten im Brutschrank, ein wohl hoffnungsloser Wunsch. Manchmal beneidet er die Forscher der toten Materie, Physiker zum Beispiel. Kein Problem mit Reproduzierbarkeit, wenn’s einmal klappt, klappt es immer. Eher haben sie das Problem der falschen Hypothesen, die sie testen. Wir testen auch Hypothesen, häufig auch falsche, sinniert Schrulling. Doch unsere Materie lebt und das schafft Raum für Graustufen, erwünschte und unerwünschte. Während der Kaffee in seine Tasse strömt, ruft er sich in Erinnerung, dass es die Vielzahl der Graustufen ist, die letztlich das Riesenheer der Bioforscher am Leben erhalten. Dieser Gedanke hat etwas Beruhigendes an sich und so schlendert er entspannt in den kleinen Konferenzraum, gleich neben der Küche.
Dort sitzen schon seine Leute und rühren in ihren Tassen. Die helle Frühlingssonne bahnt sich ihren Weg durch eine der Oberlichten und wirft ihren harten Morgenstrahl auf die grüne Tafel am oberen Ende des Raums. Wenn das so weiter geht, können wir einpacken, eröffnet Agatha gereizt die Runde. Dann machen wir eben ein Kaffeehaus auf, versucht Schrulling scherzhaft gegenzusteuern. Pablos Gesicht hellt sich kurz dankbar auf, während Sophia deutlich geräuschvoller in ihrer Tasse rührt. Die Zellen sterben einfach, sagt Fanni mutlos und streichelt mit ihren Fingerkuppen den Schreibblock vor ihr. Während seine Mitarbeiter ihrem Unmut freien Lauf lassen, wandern Schrullings Gedanken weit zurück, ins Jahr 1958, als diese Zellen aus der Niere eines Beagle in die Forschungslabore gelangten. Und jetzt, nach beinahe 60 Jahren spinnen sie, sterben einfach. Patienten enttäuschen Ärzte, wenn sie sterben, Zellen enttäuschen Forscher, wenn sie schlapp machen, sagt sich Schrulling, eigentlich dasselbe Phänomen.
Die Morgensonne hat sich inzwischen zurückgezogen und den Raum in indifferenten Grautönen zurückgelassen. Wer hat zuletzt die Zellen gefüttert? hört sich Schrulling fragen und ahnt, dass ihn die Antwort wenig weiterbringen wird. Das war in letzter Zeit mein Job, sie kriegen alles, was sie brauchen, meldet sich gähnend Tim zu Wort. Ernährungsfehler sind ausgeschlossen, lässt sich Agatha vernehmen, während sie nervös mit dem Fingernagel einen Kaffeekleks an ihrer Tasse entfernt, das Zellmedium ist wie der Big Mac bei McDonald’s immer gleich, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Da kann man einfach nichts falsch machen“ fügt sie noch hinzu. Schrulling fragt nachdenklich und kaum hörbar, Zucker ist also der einzige Bestandteil, den wir noch hinzufügen?Ja, und dann wird sorgfältig gerührt, um den Zucker aufzulösen, ergänzt Fanni eifrig.
Vor seinem geistigen Auge sieht Schrulling, wie sich die Zuckerkristalle im bernsteinfarbenen Medium in mäandernde Schlieren auflösen und langsam verdämmern. Toter Zucker, sinniert Schrulling, totes Zellfutter. Vielleicht aber, kommt es Schrulling plötzlich in den Sinn, ist Zucker nur bei flüchtiger Betrachtung tot? In Gedanken sieht er den impulsiven Tim, wie er den Zucker mit ausladender Bewegung lawinenartig im Medium versenkt, während Fanni die Zuckerkristalle mit einem kleinen Löffel langsam und behutsam in den Glaskolben rieseln lässt. Darüber, wie Forscher arbeiten, wird nie in wissenschaftlichen Publikationen berichtet, denkt Schrulling, und er erinnert sich an die nüchterne Analyse eines namhaften Wissenschaftsjournals, dass von zehn wissenschaftlichen Experimenten nur eines davon in einem anderen Laboratorium reproduzierbar ist. Das weist doch darauf hin, dass beim Experimentieren Dinge eine Rolle spielen, die der Aufmerksamkeit eines Forschers entgehen. Eine abstruse Vorstellung beginnt Schrulling zu befallen. Was nun, wenn Zucker in weiterem Sinne gar nicht tot ist? Wenn es nicht nur mit den klassischen Eigenschaften ausgestattet ist, die in jedem Chemieschinken stehen? Wenn es auf seine Weise lebt und mit uns spricht, in einer Sprache, die wir noch nicht verstehen? Eigentlich schämt er sich für diese Gedanken, sie sind ketzerisch und wissenschaftlich geradezu unanständig. Er sieht die Gesichter seiner Leute vor sich, wenn er ihnen dieses Zerrbild eines bislang sprachlosen Moleküls zu vermitteln versuchte, Agathas ungläubigen Blick, Sophias fassungslose Miene, Tims spöttisches Grinsen. Doch auf einmal scheint ihm das egal zu sein. Land in Sicht, wir sterben nicht, sagt Schrulling vielsagend und fühlt sich großartig dabei. Mit diesem Motto beendet er die Diskussion. Seine Leute verlassen etwas betreten den Raum. Schrulling geht als letzter, beschwingt und erleichtert.
Lebender Zucker – diese geradezu makabre Idee beflügelt ihn.
Agatha
Agatha macht einen Zwischenstopp auf der Toilette, bevor sie zu Ihrem Arbeitsplatz eine Etage tiefer zurückkehrt. Sie blickt zerstreut in den Spiegel, während sie mit klammen Fingern den Handtuchspender bearbeitet. Das düstere Neonlicht lässt ihr Gesicht bleich erscheinen. Sie trocknet ihre Hände und fährt sich mit den Fingern durch ihre dunklen halblangen Haare. Wo bin ich gelandet, denkt sie, ist das noch meine Welt? Ich bin jetzt fünfunddreißig, habe studiert, doktoriert, habilitiert, und verbringe meine Zeit damit, den Zellen beim Sterben zuzusehen. Eine Art von Nekro-Voyeurismus, denkt sie sarkastisch und lächelt bitter in den Spiegel.
Zurückgekehrt in ihr Zimmer, fährt sie ihren Computer hoch. Geduldig wartet sie, bis die Sanduhr verschwindet. Sie sollte eigentlich zum Zelltod in vitro eine Literaturrecherche durchführen. Lustlos bleibt sie an einem pop-up Fenster hängen, kiss-no-frog, flirten, chatten, verlieben. Sie sieht die Männer an, deren freundliche Gesichter, mosaikartig angeordnet, von der linken oberen Ecke ihres Bildschirms auf sie herabblicken. Keiner sieht Moritz ähnlich, ihrem Exfreund. Sie dreht den Bildschirm vorsichtshalber weg von der halboffenen Tür. Den Moritz hat sie gegen die Zellen eingetauscht. Entweder ich oder die Zellen, hat Moritz damals in einer heftigen letzten Auseinandersetzung gebrüllt, worauf Agatha wortlos seine Wohnung verließ. Jetzt bin ich mit meinen Zellen allein, spricht sie sich Mut zu. Die damaligen lustvollen Gedankenspiele, ein Kind haben zu wollen, haben sich lautlos davongeschlichen. Mittlerweile schließt sie reflexartig ihre Tür, wenn helle Kinderstimmen im Institutsflur hörbar werden, Kinder, die von Zeit zu Zeit die Papis und Mamis in ihrer Wirkungsstätte besuchen. Sie erblickt den Zuckerstreuer, den sie zu ihrem Geburtstag von den Institutsleuten bekommen hat, im Zuge der üblichen kleinen Feier in der engen stickigen Küche, als Gag gedacht. Das Metallrohr, einem Elephantenrüssel gleich dessen eines Ende im Zucker steckt, ist zugeklebt, eine Anspielung auf Agathas Zuckermobbing. Ja, sie untersuche wie Zucker dem Menschen schade, antwortet sie jedes Mal, wenn ihre Tante Hilde sie nach ihrer Tätigkeit fragt. Wie oft schon hat sie sich mit ihr über den bösen Zucker unterhalten, zuckerarme Lebensmittel aufgezählt, sie vor der Zuckerkrankheit mit allen ihren Folgen gewarnt, wenn sie weiterhin so viel Zucker in sich hineinstopfe. Genützt hat es bisher wenig, denkt sie resigniert, hundert Kilo bei ein Meter fünfundsechzig – das sagt wohl alles! Sie schiebt den Zuckerstreuer hinter den Fuß ihres Bildschirms und ruft mit ein paar Mausklicks die Medline auf. Als die vertrauten Schriftzüge des Recherche-programms erscheinen, strömt wieder Wärme in ihren Körper. Sie hämmert, plötzlich besser gelaunt, cell death in vitro in die Tastatur und beginnt zu arbeiten.
Pablo
Am Weg zu den Katakomben macht Pablo in der Küche halt. Immer wenn etwas schief geht im Labor, denkt er sehnsüchtig an Montevideo. Vor zwei Jahren hat er seine Heimat verlassen. Häufig sieht er sich in Gedanken durch die engen Gassen schlendern, vorbei an den bröckelnden Fassaden, um an einem kleinen Tischchen Platz zu nehmen und im Schatten einer Platane Mokka zu trinken. Er spürt wie die Kuppe seines Ringfingers den blauen Tassenrand abfährt, hört die Papageien über sich krächzen, riecht den Kaffeesatz am Tassenboden. Er denkt an Lily, die wohl jetzt an einer Bushaltestelle wartet, am Weg zur Arbeit. Sie wird das weiße Kleid tragen, mit den dunkelblauen Tupfen und vielleicht an ihn denken. An ihn, der sich nach Europa aufgemacht hat, eine andere Sprache spricht, Gerichte isst, die sie nicht kennt, in einem Bett schläft, dessen Knarren ihr fremd ist. Pablo kehrt aus seinem Tagtraum zurück, lässt sich sein winziges Mokkatässchen von der ratternden Kaffeemaschine bis zum Rand füllen und überdenkt seine Zukunft. Wenn jetzt die Zellen schlapp machen, droht sein Projekt zu zerfallen. Er stellt sich die Situation beinahe komisch vor, er würde nach drei Jahren des Exils in Montevideo landen, seine Lily an sich drücken und ihr ins Ohr flüstern, nada, absolutamente nada. Warum auch hat er sich eigentlich auf dieses Zuckerprojekt eingelassen? War es Agatha, die ihn mit ihren magischen Augen dazu verführt hat? Oder Schrulling, der ihm vorgerechnet hat, wie viele Menschen an den Folgen dieses bösartigen Kristalls stürben? Er weiß es nicht mehr. Vielleicht hat ihn das süße Gold deshalb angezogen, weil es ihm schon in seiner Heimat vertraut war. Zucker ist mit ihm mitgeflogen und hat sich hier seiner bemächtigt. Pablo löffelt den Bodensatz aus seinem Mokkatässchen. Die Sonne hat sich inzwischen einen Weg bis auf den Küchentisch gebahnt. Gedankenverloren verlässt er die Küche und steigt hinab in die Katakomben.
Sophia
Wo soll das hinführen, sinniert Sophia, während sie sich den Labormantel anzieht. Land in Sicht, wir sterben nicht - Schrullings Zweckoptimismus geht ihr gehörig auf den Geist. Als sie sich vor einiger Zeit dem Laboratorium von Professor Schrulling anschloss, war sie noch voller Zuversicht. Sie hatte sich gegen mehr als dreißig Mitbewerber um diese Dissertationsstelle durchgesetzt. Wie ihr Schrulling später einmal unter vorgehaltener Hand in der lockeren Atmosphäre einer Geburtstagsfeier verriet, gab ihr energischer Händedruck, damals nach dem Vorstellungsgespräch, den entscheidenden Ausschlag, ein Geständnis, das sie gleichsam gefreut wie verwirrt hat.
Der Universität in Kiew hatte sie den Rücken gekehrt, hatte die schwere Eingangstür an der dunkelroten Monumentalfassade erleichtert ins Schloss fallen hören und sich leichtfüßig über die Treppen in Richtung Westen davongemacht. Nun war sie da, Mitglied einer Wohngemeinschaft, mit eigenem Zimmer und Meerschweinchen, einem Fach im Kühlschrank und Fahrradstellplatz. Heute fühlt sie sich zum ersten Mal einsam und denkt zurück an Kiew. Sie sieht sich auf das weitverzweigte Aderwerk des Dnepr blicken, die goldenen Kuppeln der Klöster und Kirchen im Dunst der Stadt erahnend. Vielleicht hat sie sich zu rasch mit Walter, einem Mitbewohner ihrer WG angefreundet. Seine Erzählungen über das Dorf in Unterfranken, aus dem er stammt, hatten sie beeindruckt. Sie hatten ihr in den ersten Wochen Halt gegeben, ein Gefühl von Heimat. Jetzt, kommt ihr vor, scheint das wegzubrechen. Walter will Lehrer werden und dann in sein Dorf zurückkehren. Sie aber drängt es in die weite Welt. Ein paar einsilbige Dorfbewohner um mich herum sind mir zu wenig, findet sie, ich will Geistesmenschen um mich haben und ‚mein Ding‘ verfolgen. Mit spitzen Fingern knüpft sie ihren Mantel zu. Den Zellen werde ich schon noch Mores lehren, hämmert es in ihrem Kopf und verschwindet lautlos hinter der Glastür, die ins Zelllabor führt.
Fanni
Fannis Wangen sind immer noch gerötet, als sie vor der sterilen Werkbank ihren Platz einnimmt. Land in Sicht, wir sterben nicht - das ist die von Schrulling ausgegebene Devise und daran wird sie sich halten. Als sie damals wegen ihrer Nierenbeckenentzündung für Wochen zuhause bleiben musste, hat sie sich tatsächlich Sorgen gemacht, dass Tim in ihrer Abwesenheit nicht sorgfältig genug mit den Zellen umgehe. Es kann ja jedem einmal ein Fehler passieren, das Massensterben im Brutschrank nach Tims Intermezzo spreche dafür.
Eigentlich ist es ja nur eine einzige banale Handlung, nämlich die Zugabe von Zucker in das bereits vorgefertigte Nährmedium. Sie liebt die braune Glasflasche mit dem roten Schraubverschluss, die weißen Kristalle, die mit dem schwarzen Plastiklöffel auf das säuberlich ausgebreitete Papierchen der Feinwaage manövriert werden. Sie genießt den Anblick, wenn sich die Zuckerladung in das bernsteinfarbene Medium ergießt und sich die Kristalle, Schlieren hinter sich herziehend, langsam von ihr verabschieden und sich in nichts auflösen. Wie oft schon hat sie dieses Drama beobachtet, voller Hingabe. Fast ist es so etwas wie ein intimes Verhältnis zu diesen Kristallen, denkt sie beinahe beschämt, etwas Magisches, das sich zwischen ihr und den Kristallen abspielt.
Sie schaltet die Umluft ein, angelt sich eine Glaspipette aus dem sterilen Alubehälter und beginnt ihre Arbeit.
Tim
Unwillig schlendert Tim zu seinem Arbeitsplatz zurück und startet seinen Rechner. Am Medium kann’s nicht liegen, alles Blödsinn, es wird ja fertig gekauft und nur der läppische Zucker kommt noch hinzu. Ein Gramm kann ja jedes Kind abwiegen, und damit hat sich’s. Er blickt flüchtig auf die Uhr am unteren Rand seines Bildschirms und ruft das Tagesmenü der Mensa auf. Schweinelachsschnitzel im Backteig mit Tomatensauce, und als Nachspeise Bananen-Vanille-Quark, das geht doch. Vorher will er den Zucker ins Medium kippen, und dann schnell weg aus diesem Irrenhaus. Das Theater mit dem Zucker geht ihm schon lange auf den Wecker. Es ist ein Dauerthema ist diesem Labor, ein nervtötendes Thema. Eigentlich, so kommt es ihm in den Sinn, hasst er diese weißen Kristalle. Ständig kleben sie an ihm, in der Küche, beim Essen, im Labor. Es macht ihn beinahe zornig, wenn er die Zuckerklumpen mit dem Wägelöffel zerteilen muss, wenn sie dabei durch die Gegend fliegen und dann beim Drauftreten grausam quietschen. Die mögen mich nicht, denkt Tim jedes Mal, wenn er ihr Kreischen hört, und ich mag sie auch nicht. Fast genießt er es, wenn die Zuckerklümpchen am Flaschenboden vom Rührfisch zerschlagen werden, bis sie sich widerwillig im Nährmedium auflösen. Das will er jetzt schnell hinter sich bringen und dann in die Mensa eilen.
Vermutung
Schrulling setzt sich an seinen Schreibtisch und denkt nach. Während er gedankenverloren seine tägliche Ration Karotten verzehrt, die größensortiert auf der vollgekritzelten Schreibunterlage vor ihm aufgereiht sind, gleitet sein Blick ziellos über die Gegenstände, die sich dort im Laufe der Jahre angesammelt haben. Auf der mattgelben Oberfläche tummeln sich Pipetten, Injektionsnadeln, Teebeutel und Unmengen von Schreibmaterial. Die Ecken und Kanten dieses riesigen Tisches, Erbstück eines verstorbenen Urahnen, haben ihm in der Vergangenheit schon so manchen blauen Fleck beschert, wenn er, von einer plötzlichen Idee befallen, auf möglichst direktem Weg unter Missachtung physischer Hindernisse sein Zimmer verließ, um im Labor nebenan ein Opfer mit dieser ‚Eingebung‘ zu infizieren.
Hier sitze ich nun, sinniert Schrulling, in meinem Biotop und grüble über das eigentlich Unmögliche. Hat Zucker eine Persönlichkeit, nicht nur tote Chemie? Dieser Gedanke beschleunigt seinen Herzschlag. Ist es denkbar, dass Zucker, dem ja doch eine unzweifelhafte und glasklare Molekülstruktur zugrunde liegt, dass dieses Millionen Jahre alte Molekül in gewisser Weise fühlen kann, dass es Informationen aus der Umgebung aufnimmt und sich dabei verändert? Nicht, was die molekulare Struktur betrifft, sondern was außerhalb dieser liegt. Eine Art wechselnde Aura, die sich auf die Zellen überträgt und deren Leben steuert. Schrulling war nie ein Anhänger esoterischer Lehren, aber irgendwann ist vielleicht der innere Widerstand aufgebraucht. Mit den Jahren wird der Zensor oben im Kopf mürbe, sinniert Schrulling halb traurig, halb froh. Seit vielen Jahren zwinge er sich, jede noch so kleine Entdeckung in Einklang mit dem bestehenden Wissen zu bringen, jede Beobachtung zu benennen, einzuordnen, Zusammenhänge herzustellen, Kausalität zu erkennen. Jetzt will er die Sache einmal anders angehen, den Bauch sprechen lassen, nicht den Kopf. Dieser Gedanke belebt ihn. Er wird sich auf die Lauer legen, wenn Fanni und Tim den Zucker in ihre Medien mischen und sie dabei beobachten. Wenn Zucker fühlt, dann ist schon dieser Schritt, die Konfrontation des Experimentators mit dem Zucker, ein womöglich entscheidender.
Er streicht die Falten seines weißen Labormantels glatt, wählt, wie meistens nach solchen gedanklichen Höhenflügen, den möglichst geraden Weg zur Tür und begibt sich, nach der üblichen Kollision mit der Tischkante, leicht hinkend hinab in die Katakomben.
Durch die kleine Glasscheibe in der Tür zur Zellkultur sieht er gerade Fanni bei der Arbeit. Sie sitzt auf einem kleinen schwarzen Schemel und verrichtet die verschiedenen Handgriffe ruhig und gelassen. Den letzten Schritt, das Hinzufügen von Zucker ins Medium, hat sie schon vorbereitet. In einem kleinen Plastikschälchen liegen die weißen Kristalle, die sie gleich in die bereitgestellte, mit bernsteinfarbenem Medium gefüllte Flasche kippen wird. Doch dann kommt es plötzlich anders. Fanni kippt mit einer sanften Bewegung die Zuckerkristalle in ihre hohle linke Hand, streicht mit dem rechten Zeigefinger kreisförmig über den Zucker. Dabei murmelt sie etwas. Schrulling presst sein Ohr an die Tür und hält die Luft an. Ein paar Silben kann er wahrnehmen, von a, o und u dominierte Wortfetzen, mehr nicht. Als er wenige Sekunden später wieder durch das Glasfenster späht, sieht er gerade noch, wie die Zuckerkristalle aus ihrer hohlen Hand in einem dünnen weißen Strom in das bernsteinfarbene Medium rieseln und dabei langsam verdämmern. Schrulling verlässt lautlos seinen Posten und begibt sich nach oben in sein Zimmer. Das ist keine orthodoxe Methode, murmelt er in sich hinein. Sieht ja fast so aus, wie eine Art von Initiationsritus, als ob Fanni dem Zucker ihren persönlichen Stempel aufdrücken wollte. Er ist beeindruckt.
Tags darauf beobachtet Schrulling, wie Tim die Zuckerklumpen mit dem Wägelöffel traktiert, quetscht und zerdrückt, bevor er sie mit leicht angewidertem Gesichtsausdruck im bernsteinfarbene Medium versenkt und dabei ungeduldig mit den Fingernägeln an die Glaswand schnippt, um den Zucker so rasch wie möglich in Lösung zu bringen. Und da, plötzlich und unvermittelt, fixiert sich in seinem Gehirn die Idee, dass dieser Zucker, durch würdelose Behandlung traumatisiert und lieblos auf die Reise geschickt, in der belebten Welt sein in ihm schlummerndes Aggressionspotenzial ausleben wird. Zucker, ein scheintoter Kristall, fühlt und reagiert, nicht im chemischen, sondern im geistigen Sinne. Schrullings naturwissenschaftliches Nervenkostüm revoltiert. Er versucht sich damit zu beruhigen, dass er seinen Rechner anknipst, sich hinter dem Bildschirm verschanzt und nach eventuellen Hinweisen in der Weltliteratur sucht.
Verdacht
Schrullings rechte Hand ruht auf der Maus, sein Blick ist auf den Bildschirm gerichtet. Nur manchmal hört man das Klicken der Maustaste. Frau Herrlich hat ihm eine Tasse Lindenblütentee neben den Bildschirm gestellt, für die Nerven, wie sie sagt, und ungezuckert, entsprechend der Ideologie des Instituts. Schrulling sucht nach den versteckten Eigenschaften von Glukose, dem akademisch gebrauchten Synonym für Traubenzucker. Obwohl ihm Chemie in der Schule nie lag und er sich damals strikt jeglicher chemischen Formel verweigerte, war ihm das Glukosemolekül hartnäckig gefolgt. Als er dann im ersten Jahr seines Medizinstudiums wieder mit dem Kinderkoks konfrontiert wurde, wie die untere Kaste der Labormenschen diesen Leitwolf unter den Zuckern despektierlich bezeichnet, gab er seinen inneren Widerstand auf. So gliederte er Glukose, derKönigsbegriff der Oberklasse, in sein Repertoire unvermeidbarer medizinischer Begriffe ein. Dass ihn nun diese Glukose seit mehr als dreißig Jahren verfolgt, hat er sich weder gewünscht noch ausgesucht. Glukose kam ihm stets wie das langweiligste Molekül der Welt vor, ein bleicher Kleingeist, der sich unauffällig im Körper tummelt und nur darauf wartet, aufgefressen zu werden.
Doch dann fiel plötzlich die Maske.
Schrulling denkt zurück an das Schlüsselerlebnis vor etlichen Jahren. Er saß damals vor der Apparatur, dem technischen Herzstück seines Forschungslabors. Es war bereits später Abend und draußen regnete es. Er scheute sich bei diesem Wetter aufs Rad zu steigen und entschied, den gerade niedergehenden Regenschauer noch abzuwarten. Er hatte noch ein paar lebende Zellen in der Apparatur und wusste nicht so recht, wie er die Zeit bis zur nächsten Regenunterbrechung totschlagen könnte. Gedankenlos nahm er damals ein Zuckerkrümel, das sich von seinem Streuselkuchen gelöst hatte, mit seiner angefeuchteten Fingerspitze auf und schnippte es in hohem Bogen in das Medium, das seine Zellen umgab. Schrulling erinnert sich immer wieder mit leichtem Gruseln an das Folgende. Sekunden später, es war absolut still im Raum, vernahm er aus den Tiefen der Apparatur ein leises Knarren. Als er sich erschreckt über die Apparatur beugte, verstummte das Knarren. Erst Jahre später schien ihm die Bedeutung dieses Geräusches allmählich zu dämmern. Zucker, dieser dunkle Geselle, war in die Zelle eingedrungen und hatte ihr delikates Räderwerk stillgelegt. Das Knarren erschien ihm, so träumt Schrulling jetzt verzückt vor sich hin, wie das Öffnen einer Tür, die Zucker bei seinem Eindringen in die Zelle aufstieß. Das Wunderbare daran war, dass die riesige Apparatur diesen winzigen Schritt wiedergab und er, Schrulling, das Knarren letztlich dem Zucker hatte zuordnen können.
Eigentlich war es gar nicht er, der die Bedeutung dieses Knarrens erkannte. Es war am nächsten Tag in der Küche, als er diese kleine Geschichte erzählt, während die Kaffeemaschine dampft und stampft. Wahrscheinlich war es das Geräusch dieses Schweizer Markenprodukts, das ihn an das Knarren vom Vortag erinnert hat. Wie in einem Film sieht er die damalige Szene vor sich, das Vergangene ist in diesem Moment für ihn gegenwärtig ... Komisch, sagt Tim, der hinter ihm an der Kaffeemaschine wartet, um seine Tasse zu füllen, komisch, er habe ein ähnliches Geräusch gehört, unlängst, als er das Medium für die Zellen ansetzte. Als er den Zucker in die bernsteinfarbene Flüssigkeit kippte, die seine Zellen umgab, habe er ein leises Knarren, eher einem Ächzen ähnlich, vernommen. Pablo, der unauffällig in der Ecke steht und bedächtig an seiner Mokkatasse nippt, kündigt mit hörbarem Luftholen an, das er auch was sagen will. Er habe letzte Woche, so berichtet er zögernd, kurz vor dem Verlassen des Instituts das Medium der Zellen aufgefrischt und dabei Zucker dazu gekippt. Gerade als er dabei war, den Brutschrank zu schließen, habe er ein leises Knarren vernommen, als ob jemand, in eine enge Lederjacke gehüllt, einen tiefen Atemzug getan hätte. Er erinnert sich deshalb daran, weil dieses Knarren irgendwie anders war als das gewohnte technische Rauschen um ihn herum, es sei eher ein Wimmern gewesen. Er sei sogar einen Augenblick mit angehaltenem Atem stehengeblieben, sagt Pablo, weil er dachte, es könnte noch ein Mensch in seiner Nähe sein, obwohl es schon gegen Mitternacht war und er eigentlich davon ausging, dass er im Institut allein war. Agatha und Sophia, die sich gerade mit ihren Frühstücksbroten beschäftigen, schütteln beide beinahe im Gleichtakt ungläubig ihre Köpfe und verdrehen dabei in stillem Einverständnis die Augen. Sophia sagt, so ein Erlebnis hätte sie noch nie gehabt, wobei sie das Wort ‚Erlebnis‘ genießerisch in die Länge zieht, und Agatha ergänzt etwas süffisant, dass Männer vielleicht zu Halluzinationen neigten, wenn sie des Nachts einsam und allein im Labor arbeiten.
Ob nun echt oder eingebildet, dieses Knarren, Ächzen und Wimmern hat damals seine Gedanken in eine neue Bahn gelenkt, und er, Schrulling, ist abgebogen von seinem ausgetretenen Pfad und querfeldein in unbekanntes Terrain vorgestoßen. Und meine Leute sind mir gefolgt, stellt Schrulling fest, anfangs zwar etwas zögerlich und skeptisch abwartend, später aber bedingungslos.
Mörderkristall
Agatha scrollt durch das weite Feld der Lebenswissenschaften. Ein chinesischer Nephrologe der Nanjing-Universität berichtet, wie Zucker die Niere von Stumpfnasenaffen zerstört und bei immunschwachen Pandas Leberkrebs auslöst. Eine Finnische Psychologin der Universität Vaasa berichtet, wie Zucker Nervenzellen von Robben attackiert und in Schneehasen Alzheimer auslöst. Ein afrikanischer Kardiologe der Universität Ouagadougou in Burkina Faso zeigt, dass Zucker das Blut in gestressten Erdferkeln dickflüssig macht und in Streifenschakalen tödliche Blutgerinnsel erzeugt. Dann stößt Agatha eher zufällig auf ihre eigene Literatur. Fast verschämt überfliegt sie die Kurzfassung ihrer ersten Publikation zum Thema Zucker. Etwa fünf Jahre ist es her, der Tag, an dem sie vom Zuckervirus infiziert wurde. Zufällig geriet sie in ein Vorweihnachtsessen, das traditionell Schrullings Arbeitsteam beim Griechen um die Ecke einzunehmen pflegt. Sie war damals gleich einer streunenden Katze, die hungrig durch die Gassen streicht. Ihr Hunger war ein geistiger, erinnert sie sich. Leer war ihr Kopf, auf Ideen wartend, die nicht kommen wollten. Ein Schauer erfasst ihren Körper, wenn sie an die Zeit denkt, die sie bis dahin nutzlos abgesessen hat. Wie viele Stunden hat sie wohl zugebracht, inmitten sogenannter High-End Instrumente, die auf einen Einsatzbefehl geradezu lauerten und den sie nicht geben konnte, weil ihr einfach nichts einfiel. Mir fiel nichts ein, weil alles um mich herum und in mir erstarrt war, denkt sie jetzt. Die Menschen, die sie damals umgaben, oft liebe Menschen, waren in gewisser Weise scheintot. Ihre Zunge beginnt am Gaumen zu kleben, wenn sie sich an diese Zeit erinnert. Forschungsmaschinen bleiben stumm, wenn Scheintote sie bedienen. Das Kleine diskutieren, das Große ignorieren, diesen Ehrencodex befolgte sie damals, voll stiller Verzweiflung.
Dann traf sie auf Schrulling, der sie durch die großen Scheiben des Griechen an der Ecke vorbeistreunen sah und sie freundlich hereinwinkte. Sie kannten einander flüchtig aus Seminaren, wenn auch ihre Institute nichts miteinander zu tun hatten. Retsina löste ihr die Zunge, sie schilderte anfangs zögernd, dann zunehmend empathisch ihr Leben unter den Scheintoten und ihre unbefriedigte Neugier, die zu verkümmern drohe. Sie erinnert sich, wie Schrulling durch sie hindurchzusehen schien, wie er aber plötzlich, als sie gerade resigniert ihr herausgestülptes Innere rasch wieder in sich hineinstopfen wollte, fragte, ob sie denn Zucker liebe. Ohne ihre Antwort abzuwarten, folgte ein langer Exkurs in für sie fremde Gefilde der Wissenschaft, der damit endete, dass er sie am Ende sichtlich erschöpft fragte, ob sie da mitmachen wolle. Der Bauernsalat auf ihrem Teller war inzwischen welk und das Weinglas leer.
Das war ihr Einstieg in die Welt des Zuckers, erinnert sie sich wehmütig und lässt gedankenverloren den Mauszeiger am Bildschirm kreisen. Fünf Jahre sind inzwischen vergangen, ihr Freund Moritz war in dieser Zeit am Horizont aufgetaucht, wie der Morgenstern, leuchtete kurz auf, bis ihn der helle Strahl des süßen Goldes traf und er daraufhin unterging. Sie hat Moritz gegen Zucker eingetauscht, ja, das hat sie. Sie erinnert sich an so manchen lauen Sommerabend, an ihrem Schreibtisch vor dem Bildschirm sitzend, wenn ihr Fenster offenstand und heitere Stimmen aus der Dunkelheit an ihre Ohren drangen, von Menschen, die zusammen aßen und tranken. An so einem Abend hat sie die Aggressivität des Zuckers erkannt und jenen Tunnel entdeckt, durch welchen dieser Mörderkristall – ein später stehender Ausdruck im Labor – in die Zellen gelangt und Chaos anrichtet. Sie weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, wie sie in den folgenden Monaten und Jahren eine Armada williger Doktoranden hinter sich versammelt hat, um ihr Bauchgefühl in Datenzu verwandeln. Vor ihrem geistigen Auge erscheinen schemenhaft ihre Messsklaven, wie sich der eine oder andere Doktorand selbst tituliert hat, dicke und dünne, blasse und braune, schüchterne und laute. Sie erinnert sich, wie sie jeden einzelnen indoktriniert hat, wie sie Zucker als den Bösewicht hingestellt hat, den es zu jagen galt, dessen Verstecke man ausfindig machen sollte, dem man anklagen sollte, in aller Öffentlichkeit. Sie findet, dass ihr das ganz gut gelungen ist. Ein Verbrechen nach dem andern hat sie dem Zucker nachgewiesen und diese Schandtaten erbarmungslos veröffentlicht.
Agathas Gedanken kehren zurück in die Gegenwart. Mit dem Mauszeiger geht sie auf Zucker-Jagd. Sie weiß, wo sich dieser Mörderkristall in der Außenwelt aufhält, wie es in den Körper gelangt, die Tür zur Zelle aufstößt und alles erstarren lässt. Sie begibt sich auf Spurensuche, Spuren, die der Zucker auf dem Weg durch die Forschungslaboratorien der Welt hinterlassen hat, fein säuberlich in unzähligen Journalen dokumentiert und auf Mausklick abrufbar. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, schränkt sie die Spurensuche ein und verengt ihr Suchgebiet auf ‚böser Zucker‘. Eine Unmenge an Literatur tut sich auf. Zucker scheint jede Zelle im Menschen zu überfallen wenn er in Überzahl ist. Die Zähne faulen, das Herz streikt, die Niere versagt, die Augen werden trüb, die Haut eitert. Ich suche nicht nach den Folgen von zuviel Zucker auf die Menschen sondern nach dem Bösen, das im Zucker steckt, murmelt Agatha in sich hinein.
Während sie leicht entnervt nach unten scrollt, taucht der Titel einer Arbeit auf, der ihr die aufkommende Müdigkeit wieder aus den Augen treibt: Erbarmungsloser Zucker, ein psycho-analytischer Ansatz zur Klärung seiner Aggressivität. Der Artikel ist 1960 in einem russischen Journal publiziert worden und liegt dank der automatischen Übersetzung ihres Computerprogramms bereits in Deutsch vor. Sie schickt den Artikel zu ihrem Drucker und steckt dann das Schriftstück in ihren Rucksack. Dann knipst sie den Rechner aus und verlässt das Institut in Richtung botanischen Garten. Dort sucht sie das menschenleere Tropenhaus auf, setzt sich unter eine Bananenpalme und beginnt zu lesen.
Zweifel
Plötzlich war das Knarren wieder in seinem Kopf. Wenn nichts mehr klappt, dann hält man sich auch an einem Strohhalm fest, überkommt es Pablo. Das Knarren damals, als er den Zucker den Zellen zufügte, damals, knapp vor Mitternacht, den Rucksack schon zum Gehen umgehängt und die Lichter des Instituts bis auf das mattblaue Licht in der Zellkultur schon gelöscht, es war so unerwartet tierisch, dass ihn jetzt noch ein Schauer erfasst, wenn er daran denkt. Er weiß, dass er zur Schreckhaftigkeit neigt, vielleicht eine Folge seiner Entwurzelung. Sein Montevideo, seine Lily, die in irgendeinem Bett jener Stadt gerade schlief, das notorische Zirpen der Zikaden, das durch sein offenes Zimmerfenster zu dringen pflegte, alles weit weg und gleichsam auch ganz nahe. Zucker rieselt, denkt er, aber er knarrt nicht. Das Knarren, so erinnert er sich jetzt mit wissenschaftlicher Akribie, trat auch nicht während des Rieselns auf, sondern einige Sekunden danach. So als ob es vom Boden der Kulturschale käme, denkt er verwirrt, dort wo die Zellen, eng aneinandergeschmiegt, einem geknüpften Teppich gleich, in totaler Finsternis ihr eintöniges Leben fristen.
Agatha hat ihm schon vor einiger Zeit den Floh ins Ohr gesetzt, dass der Mörderkristall gewaltsam in Zellen eintritt und sie erstarren lässt. Ja, sie hat damals den Ausdruck ‚gewaltsam‘ gebraucht und ihn dabei vielsagend angeblickt. Tatsächlich hat er dann, wohl ihres hypnotischen Blickes wegen, dieses Thema aufgegriffen und entdeckt, dass sich Zellen schockartig zusammenziehen, sobald sie süß werden. Er hat dieses Phänomen in monatelanger Lauerstellung, gekrümmt vor der Apparatur kauernd, dokumentiert und einer komplexen statistischen Analyse unterworfen. Er ging damals sogar soweit, Mathematiker an diese Daten heranzulassen, deren Methoden er zwar nicht folgen konnte, die ihm aber suggerierten, er habe da etwas ungemein Wichtiges entdeckt. Es war dann noch schwer genug, einen Editor zu finden, der bereit war, einen Artikel über die Zuckerstarre lebender Zellen in seinem Wissenschaftsjournal unterzubringen. Nächtelang saß er damals mit Schrulling in dessen Arbeitszimmer und feilte an Begriffen. Er erinnert sich, wie ihn damals das fahle Licht des Computerbildschirms in einen fast tranceartigen Zustand versetzt hat. War es die andauernde Aufmerksamkeit auf die immer wiederkehrenden Formulierungsversuche Schrullings, das Eindringen des Mörderkristalls in das gallertige Innere der Zelle in wissenschaftlicher Verknappung zu beschreiben oder war es der grüne Tee, den er dabei literweise getrunken hat? Er grinst, wenn er an diese Nächte denkt, wenn Schrulling zum x-ten Male inmitten mentaler Vertiefung plötzlich aufgesprungen und auf die nahe Toilette gerannt ist, um den Tee loszuwerden und wie er wieder zurückgekommen ist, noch an seinem Gürtel hantierend und vor sich hin murmelnd, nur um nicht den roten Faden ihrer gemeinsamen Denkprozesse zu verlieren. So wurde mit fortschreitender Stunde aus dem nüchternen Zucker ein hinterlistiger Mörderkristall, der Zellen arglistig tötet. Dieses Bild hat sich damals in seinem Kopf festgesetzt, befeuert von Schrullings drastischen Kommentaren. Wie trocken haben sich dann die Formulierungen angefühlt, auf die sie sich schließlich für ihre gemeinsame Publikation einigten, … Zucker migriert in Zellen und versteift sie … oder … Zucker löst komplexe Änderungen in der Zellmechanik aus …, nur um die potenziellen Leser dieses Artikels, allesamt ehrenwerte Kollegen mit wertkonservativen Vorstellungen, nicht zu sehr zu provozieren. Viel lieber hätte sie damals Sätze formuliert wie … Zucker tötet hinterrücks oder ... Zucker, der süße Tod.
In den Naturwissenschaften haben Begriffe des täglichen Lebens keinen Platz, resümiert Pablo fast wehmütig und denkt dabei unwillkürlich an das Knarren, das er damals vernahm. Eine Zelle hat kein Gemüt, also kann sie das Eindringen von Zucker nicht emotional verarbeiten. Eher war es ein Knarren im rein physikalischen Sinn, überlegt Pablo und kehrt damit auf das sichere Terrain der Naturwissenschaft zurück. Da sitzen Millionen von Zellen, eng ineinander verhakt, am Boden einer Plastikschale und werden plötzlich vom Zucker angegriffen. Wenn nun alle gleichzeitig erstarrten, könnte das etwa das Knarren erklären? Tritt man auf eine Schneeflocke, so wird man auch nichts hören, sind es aber viele, dann knirscht es. Pablo fühlt sich plötzlich erleichtert. Das werde ich testen und zieht mit einem energischen Ruck die Glasscheibe der sterilen Werkbank herunter.
Entschluss
Während Sophia mit kontrollierten Bewegungen das bernsteinfarbene Medium aus der Pipette geräuschlos in die Kulturschale laufen lässt, fällt ihr nochmals die Bemerkung Pablos ein, als er damals ein komisches Knarren zu hören meinte, als er die Zellen mit Zucker fütterte. Ein Knarren, das aus der Tiefe des Brutschranks drang, so drückte er sich damals aus, und sie erinnert sich, dass seine Stimme dabei zitterte. Pablo ist ein Sensibelchen, das war ihr von Anfang an klar, als sie ihn zum ersten Mal traf, am Weg in die Katakomben. Sein Weißer Labormantel schlapperte über den Knien und sein Händedruck bei ihrer Begrüßung war kaum spürbar. Respekt hat er ihr eingeflößt, als sie bei einer ihrer ersten Laborbesprechungen sein geistiges Potenzial erkannte, wie er aus der hintersten Ecke des Raumes seine Meinung gegen die Schrullings stellte, mit unruhigen Augen, aber fester Stimme. Ja, sie ist überzeugt, er hat was am Kasten, aber das Knarren, das entspringt seiner Phantasie. Sie selbst will keine Zeit mit solchen Gedanken verschwenden, ihr Ziel will sie eisern festhalten und mit den Füßen am Boden bleiben. Natürlich fühlt sie sich auch bedroht von dem gegenwärtigen Stillstand im Labor. Jeder Tag ist verloren, wenn die Zellen bereits vor dem Experiment sterben. Danach können sie ruhig ex