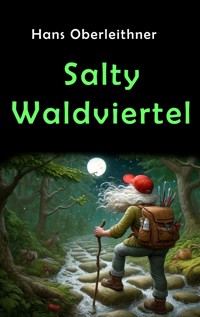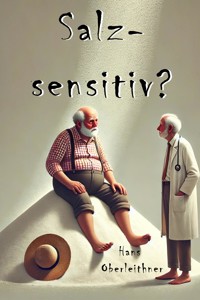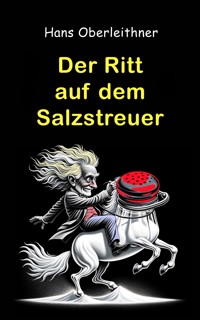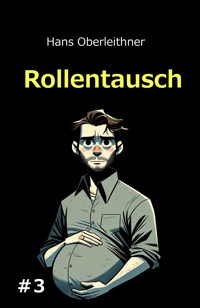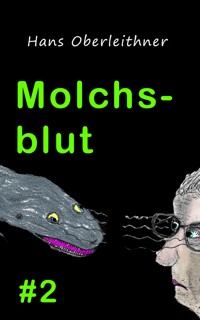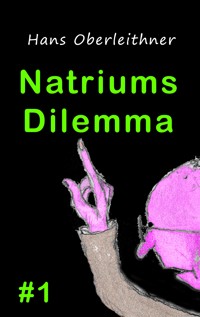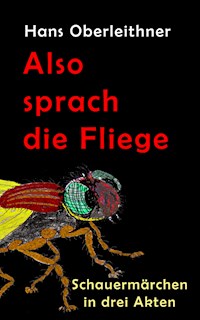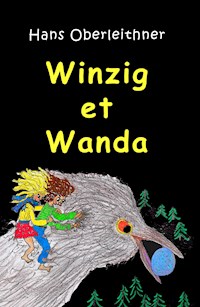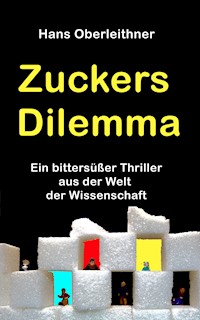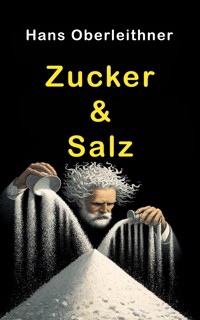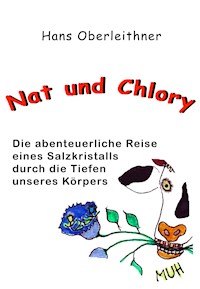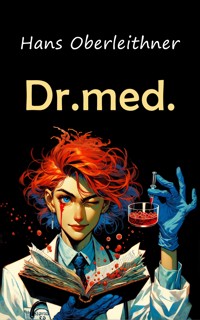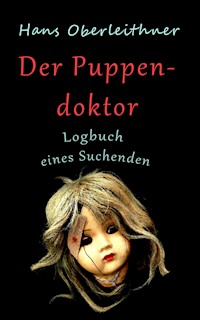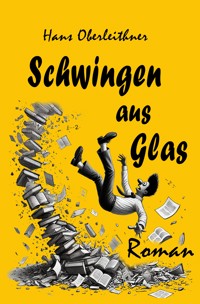
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie hoch kann der Verstand fliegen, bevor die Flügel brechen? In "Schwingen aus Glas" wird das Leben des Protagonisten Bert mit der Präzision eines Seziermessers enthüllt: Ein mathematisches Naturtalent mit schweißnassen Händen, das an der unberechenbaren Dynamik menschlicher Gefühle zu scheitern droht. Gefangen zwischen der seelenlosen Präzision der Wissenschaft und der unerbittlichen Last familiärer Bindungen, sucht Bert seinen eigenen Weg - getrieben von ekstatischen Höhenflügen und bodenlosen Abstürzen. Orte voller Symbolik – ein verschütteter Bauernhof, ein nüchternes Forschungslabor, ein einsames Strandhaus – werden zu Schauplätzen eines Experiments, das längst seiner Kontrolle entglitten ist. Der Roman ortet mit verblüffender Schärfe die Grenzen zwischen Geist und Gefühl, Ordnung und Chaos. Eine Parabel über die Zerbrechlichkeit des Daseins und die unaufhaltsame Kraft des Unausweichlichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Oberleithner
Schwingen aus Glas
Wo Formeln zerfallen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Bert
Vera
Bert
3 Jahre später
Bert
13 Jahre später
Bert
Vera
Paul
Bert
10 Jahre später
Lisa
Sarah
Max
Paula
Lisa
Bert
Paul
Lisa
Vera
Der Boss
Lisa
Sarah
Max
Lisa
Der Boss
Bert
Lisa
Paul
Impressum neobooks
Prolog
Das Leben windet sich, es stolpert, stößt,
als wüsste es selbst nicht, wohin.
Die große Maschine namens Geist läuft heiß,
verbrennt die letzte Empathie.
Menschen tauchen auf, verschwinden,
nur karge Spuren verbleiben
im Schlamm der Geschichte.
Bert
Bert ist ein mathematisch hochbegabter, jedoch sozial zurückhaltender Einzelgänger, der von seiner Jugend als stiller Schüler über sein Studium der Medizin bis hin zur wissenschaftlichen Forschung beständig zwischen Empathie und Rationalität hin- und hergerissen wird. Sein Handeln ist letztlich von Visionen und persönlichen Rückschlägen geprägt, wobei er bestrebt ist, seinen eigenen Weg zu finden.
Berts Marsch vom Bauernbub zum Forscher war ein Versuch der Selbstentdeckung. Um ins Gymnasium zu gelangen, musste Bert das elterliche Zuhause im Schatten der Berge gegen den Mief eines Schülerheims in einer staubigen Provinzstadt tauschen. In der Schule war er schweigsam. Seine bläulich geäderte Nase und sein lascher Händedruck waren stets feucht, sein soziales Standing in der harten Burschenwelt war unauffällig bis nicht erkennbar.
Berts schulische Leistungen waren makellos. Seine Aufsätze waren knapp und schnörkellos, seine mündlichen Äußerungen nüchtern und fehlerfrei. Sein Gesichtsausdruck hatte ein ständig leises Grinsen an sich, der linke Mundwinkel leicht nach oben gezogen, eine Miene, die in Kombination mit seinen makellosen Leistungen sowohl Lehrer wie Mitschüler verunsicherten. Bei Klassenfahrten blieb der Sitz neben ihm meist leer und beim Fußball saß er (grinsend) mit langer Hose auf der Reservebank, ohne jemals zu spielen. Die vier Textgleichungen einer einstündigen Mathe-Arbeit erledigte er in fünfzehn Minuten, was daran zu erkennen war, dass er sein Heft zuklappte und dann schweigend den Rest der Stunde davor sitzen blieb, um (grinsend) dem Stöhnen, Ächzen und Seufzen seiner Kameraden zu lauschen.
Mit dem Beginn seines Medizinstudiums an der Universität änderte sich Berts Verhalten. Warum er gerade dieses menschennahe Fach gewählt hatte, ausgerechnet er, vor dessen schweißnassen Händen jedermann zurückschreckte und dessen exzeptionelle Mathe-Begabung in einer Umgebung von Blut, Schweiß und Tränen doch verkümmern musste, ist unbekannt. Vielleicht war es der langsame Niedergang seiner an der Schüttellähmung erkrankten Mutter, die kaum noch die Kaffeetasse zum Mund führen konnte, ohne den Inhalt zu verschütten, und ihn dabei verzweifelt ansah, so als ob sie ihn aufforderte, etwas dagegen zu tun. Oder war es vielleicht die Faszination, dass dem Vater - dessen Hand im rotierenden Blatt der Kreissäge hängen geblieben war - der abgetrennte rechte Zeigefinger wieder angenäht wurde, sodass sich dieser mit sichtbarer Genugtuung wieder die Pfeife stopfen konnte.
Zur eigenen Überraschung entwickelte Bert ein besonderes Interesse für psychische Krankheiten, als ob er das aufholen wollte, was er bislang weitgehend ignoriert hatte. Ihn faszinierte die schwammige Grenze zwischen „normal“ und „krank“. Er stellte beinahe amüsiert fest, dass er eigentlich gar nicht weiß, wo er selbst hingehört. Hatte bisher die Logik sein Leben diktiert, so kam nun aus einem brachliegenden Winkel seines Gehirns die Phantasie hervor, die das in seinem Kopf gespeicherte Wissen durcheinander brachte.
In langen Nächten, wenn er rauchend in seinem Bett lag und auf das konturlose Grau der Zimmerdecke blickte, wurde ihm allmählich bewusst, dass Patienten für ihn eher Mittel zum Zweck waren, an denen er sein Wissen testen konnte. Das Wissen aus den Büchern, das er sich Schritt für Schritt im Studium erwarb. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn er aber in das Reich der Phantasie abdriftete, mit brennenden Augen und dem herben Tabakgeruch in der Nase, dann fühlte er eine bislang unbekannte Kraft, die sich seiner bemächtigte und ihm Flügel verlieh. Hektisch zerlegte er dann sein Wissen in einzelne Bausteine, erfand neue Krankheiten und Symptome, und testete sie in Gedanken.
Den Lebensstil seiner Kindheit hatte er so gut wie möglich ins Studium mitgebracht. Er mietete für wenig Geld ein winziges Mansardenzimmer im Haus einer pensionierten Ärztin, die mit gewissem Stolz Berts tägliches Leben als angehender Mediziner verfolgte. Wenn er morgens sein Rad über den knirschenden Kies zum Gartentor schob, winkte sie ihm durchs geschlossene Fenster, die Hand am Sims, die Augen wässrig. Wenn er abends zurückkehrte und die knarrende steile Holzstiege nach oben stapfte, öffnete sie ihre Tür einen Spalt breit und sah ihm nach. Die Schüssel Salat, den Bund Karotten oder die Handvoll Kirschen, fein drapiert in einem weißen Porzellanschälchen vor seiner Tür abgestellt, nahm er dankbar mit in sein Denkstübchen. An einem Kirschstängel kauend, warf er sich wenig später aufs Bett und sinnierte über die Eindrücke des vergangenen Tages. Da tauchten in seinem Kopf die flackernden Augen des anorektischen Mädchens auf, das, von zwei Krankenwärtern in den Hörsaal geführt, dort vor dem verstummten Auditorium stockend ihre Leidensgeschichte erzählte. Oder der enthobene Blick eines Schizophrenen, der glaubhaft schilderte, dass er jeden Abend vom Dalai Lama besucht wurde. Das alles machte ihn traurig und hilflos.
So verabschiedete sich Bert in mehreren Etappen von der Idee, die Psychiatrie als das Fach seiner Zukunft zu wählen. Wenn er abends im Bett sein geistiges Lieblingspuzzle spielte, nämlich die verfügbaren Wissensbausteine in unorthodoxer Weise aneinanderzufügen, da wurde ihm immer mehr bewusst, dass die klinische Medizin nur nach streng regulierten Vorgaben funktionierte und keinen Raum für Phantastereien vorsah. Sie war quasi die Fortsetzung seiner Gymnasialzeit, ein komplexes Regelwerk in engen Wissensgrenzen. Was ihm damals die Kraft verlieh, den elterlichen Hof zu verlassen, diese Kraft verließ ihn nun zunehmend, wenn er an die Routine des ärztlichen Alltags dachte. ‚Heilen ist die Anwendung bestehenden Wissens‘, sagte er sich. Unheilbar heißt, am Anschlag zu sein. Das Lebensgefühl, vor einer Wand zu stehen, die zwar eine Tür hat, aber versperrt ist, diese dogmatische Haltung des bis hierher und nicht weiter missfiel ihm.
Bert wurde bewusst, dass sein bisheriges Leben von Pragmatismus geprägt war. Zog ein Gewitter auf, so musste man das Heu einbringen. Hatte der Fuchs nachts die Hühner besucht, so musste man das Loch im Zaun flicken. Kam ein Bauer mit Rotlauf zum Arzt, bekam er Penicillin. Ereignisse, die sich vor der Wand abspielten. Was dahinter war, wusste niemand. Auch wenn für die Tür in der Wand der Schlüssel fehlte, man könnte doch einmal durch das Schlüsselloch spähen? Im Gymnasium war er nie neugierig gewesen. Mathe empfand er als Spielerei, Turnen als Quälerei, Deutsch als Pflicht, Latein als Sport. Seine Zeugnisse waren immer makellos (bis auf Turnen), und wenn er damit in den Sommerferien heimkam, fragte ihn niemand danach. Es war einfach selbstverständlich, für ihn und seine Eltern. Wahrscheinlich nennt man es Neugier, wenn jemand durchs Schlüsselloch späht. Für Bert war es eher so etwas wie ein Gefühl der Befreiung. Raus aus dem engen Korsett der Medizin und rein in das schier unendliche Feld der Forschung.
Als Bert eines Tages beim Abendessen seinen Eltern eröffnete, dass das Studium bald vorbei sei und er in Zukunft forschen wolle, erntete er ungläubiges Staunen. Bert verstrickte sich dabei in heillose Erklärungen, dass nämlich Forschen vor dem Heilen käme, dass er mit Forschen nicht die klinische Forschung meine, bei der lediglich Behandlungsmethoden verglichen würden. Nein, er meine das Erforschen der medizinischen Grundlagen, dort, wo noch alles offen ist, quasi unberührter Schnee ohne Fußstapfen, die er selbst setzen wolle. Befremdet schwiegen die Eltern. Die Schüttellähmung der Mutter übertrug sich im Laufe von Berts hilflosen Erklärungsversuchen auf das Geschirr am Esstisch, sodass sein wirrer Monolog von einem ständigen Klappern begleitet wurde, während sein Vater den vormals abgetrennten und jetzt immer noch tauben Zeigefinger seiner rechten Hand massierte, so als ob er darauf hinweisen wollte, dass das für ihn Medizin bedeute und nichts anderes.
Bert verbrachte den Sommer auf der Alm, kümmerte sich um das Vieh und dachte nach. Als Einzelkind wollte er keinesfalls seine Eltern vor den Kopf stoßen. Sie hatten damals seine Entscheidung, Medizin zu studieren, ohne Murren hingenommen, obwohl damit die Idee, er würde den Hof weiterführen, begraben war. Über die ganzen Jahre kam ihnen kein Sterbenswörtchen zu diesem Thema über die Lippen. Sie waren stolz und traurig zu gleich. Das las Bert aus ihrem Verhalten, wenn er in den Semesterferien daheim war. So sprachen sie nur im Flüsterton in der Stube, wenn Bert abends im Zimmer nebenan die Bücher aufschlug. Beim Frühstück blickte ihn die Mutter selig an, wenn er eine Schote aus dem Dasein eines Medizinstudenten zum Besten gab. Er sagte dann zum Beispiel „… und dann haben wir Mediziner“ – er sagte das ‚wir Mediziner‘ mit einer kurzen Pause dahinter, worauf die Augen des Vaters zufrieden aufblitzten und sich der Blick der Mutter vor lauter Empathie verschleierte – „… uns im chirurgischen Praktikum gegenseitig die Tornisterverbände angelegt, mit so viel Kompressen, Mullbinden und Pflastern, dass wir danach aussahen wie Außerirdische“.
Bert ahnte, dass seine Eltern in ihrem Inneren ständig damit beschäftigt waren, Hofbesitzer gegen Arzt abzuwägen. Da der schwitzende Bauer am Traktor, dort der Gott im weißen Mantel. Eigentlich eine klare Sache. Doch was geschah dann mit dem Hof? Wenn sein Vater abends auf der Bank vor dem Haus saß und versonnen zur Alm hinaufblickte, dann konnte Bert seine Gedanken lesen und er meinte zu ahnen, was davon für ihn schwerer wog.
Als nach einem wochenlangen Dauerregen – Bert war gerade unterwegs zur Universität, um sein Promotionszeugnis abzuholen – der durchweichte Almboden ins Rutschen geriet und in Form einer riesigen Schlammlawine Haus, Hof, Vieh und seine Eltern unter sich begrub, da war mit einem Schlag dieses Thema verschwunden.
Nicht wirklich.
Es gab zwar den Hof nicht mehr, aber das stumme Staunen seiner Eltern bei der Eröffnung, dass er lieber forschen statt heilen wollte, dieses wohl tiefe, versteckte Bedauern damals in den Gesichtern der Eltern machte ihn nach wie vor unglücklich. In vielen, quälenden Nächten nach dem Unglück tauchten in seinem Kopf immer wieder die bekümmerten Mienen seiner Eltern auf, die das Wort ‚forschen‘ bei ihnen auslöste. Es wird wohl die Enttäuschung gewesen sein, sich ihn nicht mehr als strahlenden Gott in weißem Mantel vorstellen zu dürfen, sondern als einsamen Menschen, der Mäuse quält und viele Seiten Papier mit irgendwelchen Hieroglyphen beschreibt, die nur wenige andere, ebenfalls einsame Menschen verstehen können.
In manchen Momenten plötzlicher Schwäche war er nahe daran, ganz ähnlich zu denken. Doch die Erfahrungen im Studium mit psychisch Kranken hatten ihn gelehrt, dass es mit seiner Empathie nicht sehr weit her war und er eigentlich gar nicht die ‚Qual der Wahl‘ hatte. Wenn er sich gegenüber ehrlich sein würde, war die Ursache seiner Traurigkeit beim Anblick des anorektischen Mädchens, das bis zum Skelett abgemagert mit tonloser Stimme sein Leid schilderte, nicht ihr trostloser Zustand als solcher, sondern vielmehr die Hilflosigkeit der Medizin. Als man seine beiden Eltern leblos aus den Schlammmassen barg, war er erschüttert und traurig. Nicht, weil er seine zwei allerliebsten Menschen mit einem Schlag verloren hatte, sondern weil die Medizin nicht im Stande war, sie zu retten.
Trotz dieser kurzen Momente schmerzhafter Selbstbetrachtung entschied sich Bert für den Dienst an den Kranken. Jeden Morgen ging er im weißen Mantel, Stethoskop und Reflexhammer in der Tasche, durch die Krankenzimmer, saß auf Bettkanten, maß die Blutdrucke, stach in Venen, blickte vielsagend auf Laborbefunde. Die Kranken musterten ihn verstohlen, wie er schweigsam seinen Dienst tat, streckten ihm bereitwillig die Arme zum Blutabnehmen entgegen oder machten hastig ihre Bäuche zum Abtasten frei. Und da waren sie wieder, seine verflixten roten Hände, deren Feuchte er unbemerkt am Bettlaken abstreifte. Auch das feine, fast unmerkliche Grinsen war wieder zurück, wenn er in kargen Worten die erwartungsvoll blickenden Kranken über ihre Befunde informierte. Tröstende Worte überließ er der Krankenschwester, die dicht neben ihm stand und die empathische Lücke zu füllen versuchte.
Gierig warf sich Bert auf die neuen Befunde, wenn sie nachmittags aus dem Labor eintrudelten. Befriedigt war er, wenn eine Therapie Erfolg zeigte, enttäuscht war er, wenn sich die Befunde verschlechterten. Unglücklich war er, wenn einer der Kranken starb. Enttäuscht von den Kranken, die sich durch ihr Ableben seiner Therapie entzogen, enttäuscht von der Medizin, die ihm keine besseren Mittel bot als die traditionell verfügbaren.
Es kam der Tag, an dem Bert seine ersehnte Freiheit wieder erlangte. Einer seiner Kranken war überraschend gestorben und gleichzeitig fand seine Liaison mit einer Röntgenassistentin ein abruptes Ende. Mit der analytischen Nüchternheit seines mathematischen Gehirns glaubte er, den gemeinsamen Nenner, das grundlegende Übel hinter diesem Super-GAU, entdeckt zu haben. Sein Patient war gestorben, weil die Medizin in den Fesseln ihrer eigenen Tradition gefangen war. Sein Mädchen war geflüchtet, weil sie das traditionelle Denken dem Neuen vorzog – und deshalb, trotz ihrer Jugend, bereits erstarrt war, genauso wie er es bei der traditionellen Medizin beobachtete. Bert war sich jedoch nicht bewusst, dass seine kritische Haltung zur Tradition wohl in der Auslöschung seiner eigenen Vergangenheit wurzelte. Er weigerte sich, eine Welt zu akzeptieren, die ihm vom Leben vorenthalten worden war. Eine vertraute alte Welt, die einst in Schlamm, Stein und Geröll unterging. Deshalb misstraute er allem, was sich bewährt hatte, und fand seine Erlösung in der Suche nach dem Kommenden.
Also brach Bert seine Zelte ab. Er ergatterte dank seiner intellektuellen Brillanz ein Stipendium an einer elitären Forschungsstätte in Übersee und, kaum dass er seinen Fuß auf diesen Kontinent gesetzt hatte, stürzte er sich Hals über Kopf in dieses neue Metier. Er hatte sich bewusst für eine Forschungsstätte entschieden, die den großenFragen in den Lebenswissenschaften nachging. Es ging ihm nicht um das ‚fine tuning‘ bereits vorhandener Konzepte, sondern um die Betrachtung einer fundamentalen Frage aus einem völlig neuen Blickwinkel.
Mit dieser Philosophie trat Bert offene Türen ein, denn ‚der Boss‘ des Forschungslabors – so wurde der impulsive Leiter von jedermann genannt –tickte genauso. Zudem erhielt Bert einige Vorschusslorbeeren, denn mathematische Begabung war eher rar im Bereich der Lebenswissenschaften und die Hoffnung besonders beim Boss war groß, dass damit ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für sein ohnehin schon berühmt-berüchtigtes Labor hinzukäme, nämlich die ‚mathematische Definitionbiologischer Prozesse‘. Daran knabberten schon eine Reihe junger Post-Docs, mehrheitlich aus Indien, Japan und Europa. Offensichtlich mit wenig Erfolg, ablesbar von ihren erschöpften Gesichtern und den sarkastischen Bemerkungen des Bosses, die dieser bei der Vorstellung seiner Leute dann und wann, von einem schiefen Lächeln begleitet, fallen ließ.
Bert nahm die Idee einer mathematischen Definition biologischer Prozesse dankend auf und machte sich ans Werk. In einem fensterlosen Raum entwickelte er komplexe Gleichungen, holte sich frische Daten aus dem tierexperimentellen Labor von nebenan, verwandelte Biomoleküle in mathematische Faktoren, aß säckeweise Chips vor dem Bildschirm und kehrte meist spät nachts zurück in sein schmuckloses Apartment, um erschöpft, aber mit sich und der Welt zufrieden, in einen traumlosen Schlaf abzutauchen.
Diese Arbeitsweise gefiel ihm und dem Boss. Bert war sichtlich froh, der Blut-und-Tränen-Atmosphäre eines Krankenhauses entkommen zu sein, dem genau getakteten Tagesablauf, dem mittäglichen Geruch von zerkochtem Gemüse und erkaltender Rindsuppe, den hierarchischen Anordnungen von oben. Hier, an diesem elitären Platz, genoss er die Freiheit, seine Zeit nach seinen eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Anfangs beteiligte er sich noch selbst an einigen Experimenten mit Mäusen und Ratten, doch als er wegen einer Rattenhaarallergie zunehmend rote Augen bekam, nahm er das dankbar zum Anlass, sich aus dem Experimentallabor zurückzuziehen. In seinem Dunkelkabinett saß er stundenlang fast bewegungslos vor dem Bildschirm eines Hochleistungsrechners, fütterte ihn mit Unmengen experimenteller Daten, die ihm laufend online zugeschickt wurden, modifizierte die mathematischen Modelle, verwarf alte Ideen und entwickelte neue. Sein Boss besuchte ihn von Zeit zu Zeit, ließ sich die Modelle erklären und verließ ihn nach einer Stunde ermattet, ohne die Mathematik dahinter verstanden zu haben. Bert wusste das und konnte damit umgehen. Der Boss wollte das fertige Produkt sehen, ohne den komplexen Weg seiner Entstehung nachvollziehen zu müssen. Das fertige Produkt sollte allerdings glanzvoll sein, originär und bahnbrechend. So ging das einige Zeit dahin, in scheinbarer Harmonie.
Vera
In einem existenziellen Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Einsamkeit und persönlicher Katharsis entdeckt Bert, ein engagierter Forscher, nach einer zufälligen Begegnung mit einer blinden Künstlerin neue Perspektiven für sein Leben und seine Arbeit, wodurch er sich von seiner isolierten, rationalen Welt löst und emotionale Erfüllung findet.