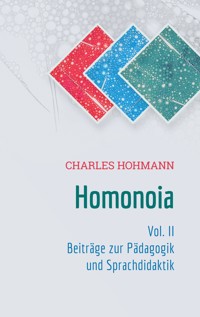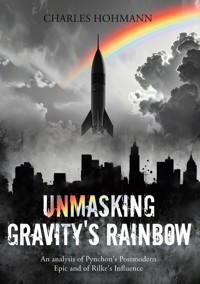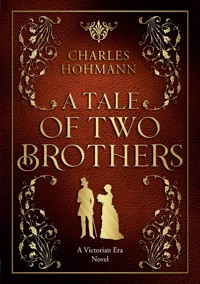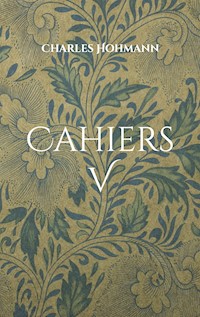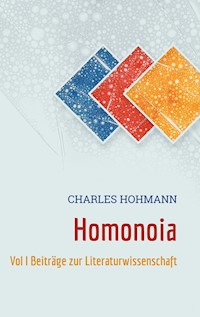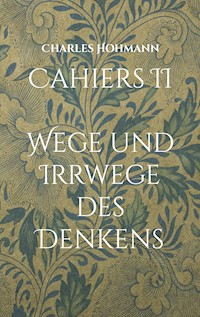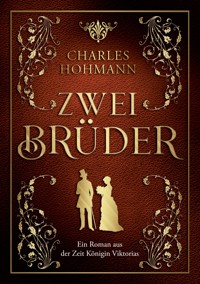
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schauplätze in diesem Roman sind das im Zweiten Weltkrieg gebeutelte Grossbritannien, die blutgetränkte Wüste im glühenden Sudan während der viktorianischen Kampagne von 1885, das hellenistische Alexandrien, die Klöster in der Sketischen Wüste, das Paris der exilierten Emigranten, das vom Meer umbrandete Malta und die Eliteuniversität Oxford. Ein britischer Militärkaplan schliesst sich nach seinen Einsätzen im Ausland seinem Bruder in England an, einem Akademiker, der um seine Ehe kämpft. Die beiden ungleichen Charaktere sehnen sich nach einer besseren Zukunft. Doch das Gespenst der geisterhaften Hand an der Wand , das das Ende der Weltordnung, wie sie sie kennen, heraufbeschwört, übersehen sie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Favente Deo et sedulitate
Durch Gottes Gnade und durch Eifer
‘There was a sound of revelry by night,
And Belgium's capital had gathered then
Her Beauty and her Chivalry, and bright
The lamps shone o'er fair women and brave men;
A thousand hearts beat happily; and when
Music arose with its voluptuous swell,
Soft eyes looked love to eyes which spake again,
And all went merry as a marriage bell;
But hush! hark! a deep sound strikes like a rising knell!’
George Gordon Lord Byron,Childe Harold’s Pilgrimage, Canto III, XXI
Es ging ein Klang des Jubels durch die Nacht;
In Belgiens Hauptstadt war zum Fest erschienen
Schönheit und Ritterschaft; der Kerzen Pracht
Glänzt über holden Frauen und Paladinen;
Die Herzen hüpften als über ihnen
Musik in Wollustwogen schwoll empor,
Da sprach und schaute Lieb’ aus Aug’ und Mienen,
Und lustig ging’s wie Hochzeitsglockenchor, –
Da, – still! – dumpf tönt ein Schall wie Grabegeläut ans Ohr!
(Übers. Otto Gildemeister)
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Luftkampf
Kapitel I: Blutiger Sand
Kapitel II: Der bibliophile Prinz
Kapitel III: Verrat und Flucht
Kapitel IV: Besuch aus dem Jenseits
Kapitel V: Von Druiden und Mönchen
Kapitel VI: Hochzeit
Dramatis personae
Biografie des Autors
Prolog
Luftkampf
Bei Tagesanbruch des 15. August 1940 wurden die Einwohner von Storrington, einer kleinen Ortschaft im Süden Englands, Zeugen eines dramatischen Luftkampfes. Eine Spitfire der Royal Air Force lieferte sich ein Gefecht mit einer deutschen Heinkel, die als Nachzüglerin einer Staffel unterwegs war. Die Bomber hatten ihre tödliche Last bereits abgeworfen und befanden sich auf dem Rückflug nach Frankreich.
Das deutsche Flugzeug war durch Flakbeschuss über London bereits schwer beschädigt – insbesondere das Heck hatte Treffer abbekommen. Nun geriet es erneut unter Beschuss: Eine Spitfire feuerte mehrere Salven ab, bis die Heinkel in Brand geriet. Eine dichte schwarze Rauchfahne zog hinter ihr her, während sie unaufhaltsam an Höhe verlor. Schließlich streifte sie das Dach eines Hauses, bevor sie mit voller Wucht in den Garten dahinter einschlug.
Die vierköpfige Besatzung hatte keine Chance, sich mit dem Fallschirm zu retten. Doch abgesehen von der Bestazung wurde niemand verletzt. Allerdings stand der Dachstuhl des getroffenen Hauses lichterloh in Flammen.
Feuerwehr und Sanitäter trafen rasch am Unglücksort ein. Die Bewohner, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, standen fassungslos vor den Trümmern ihres Heims und bangten um ihr Hab und Gut. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht, und die Feuerwehrleute bargen, was noch zu retten war. Doch viele Kleidungsstücke und ausrangierte Möbel fielen den Flammen zum Opfer.
Schwerer wog jedoch der Verlust unzähliger Bücher, die von Ruß geschwärzt und durch Löschwasser unrettbar beschädigt waren. Sie stammten aus dem letzten verbliebenen Bestand einer einst fürstlichen Bibliothek. Zu den wenigen geretteten Gegenständen gehörten zwei Metalltruhen, beide mit der Aufschrift „Rev. Reginald Collins, Field Chaplain“ versehen. Ihr Inhalt – Dokumente, Bücher, Uniformen und Medaillen – war glücklicherweise unversehrt geblieben.
Im Jahr 1901 hatte die amerikanische Newberry Library den Großteil der Büchersammlung des vergleichenden Linguisten Prinz Louis Lucien Bonaparte erworben, der 1891 verstorben war. Ein kleiner Rest blieb jedoch im Besitz von Dr. Victor Collins, dem ehemaligen Bibliothekar des Prinzen. Nach der Auflösung des Haushalts Bonapartes ließ Dr. Collins diese Bücher nach Storrington bringen, wo er sich ein Haus gekauft hatte.
Dr. Collins selbst war zur Zeit des Unglücks bereits verstorben – er hatte die letzten Jahre seines Lebens in Davos in der Schweiz verbracht und war noch vor Kriegsausbruch dort gestorben. Im Haus befanden sich während des Brandes seine 80-jährige Witwe Ellen O’Connell Bianconi Collins, seine 63-jährige Tochter Maud Collins sowie sein 54-jähriger Sohn Charles O’Connell Collins mit seiner französischen Frau Anne Marie Thierry und ihrem achtjährigen Sohn Dan O’Connell Collins.
Nicht anwesend waren drei erwachsene Kinder der Familie: Charles James O’Connell Collins, der bei den Royal Engineers diente, sowie Ellen und Michelle Collins, die beide als Telegrafistinnen im Dienst der Royal Air Force standen.
Nach dem Krieg kehrten Charles O’Connell Collins und seine Frau Anne Marie Thierry ohne ihre Kinder nach Frankreich zurück. Sie zogen in das Haus von Anne Maries Eltern in Bar-sur-Aube und nahmen die beiden Truhen mit, die sie auf dem Dachboden verstauten.
Eines Sommers, während eines Besuchs bei seinen Großeltern Charles O’Connell Collins und Anne Marie Thierry, kletterte ein Junge über eine Leiter hinauf auf den Dachboden. Dort entdeckte er die beiden Truhen, brach sie auf und begann neugierig, ihren Inhalt zu durchstöbern. Er fand Tagebücher, Briefe, Karten aus Afrika, eine Uniform und zwei Verdienstorden.
Ich war dieser Junge. Der Fund dieser Dokumente, ihre Lektüre und die Erzählungen meiner Mutter über unsere Familiengeschichte ließen mich jahrelang nicht los. Sie glühten in meinen Gedanken, bis schließlich der Drang zu schreiben erwachte. Und je mehr ich schrieb, desto stärker wurde dieses Verlangen – bis meine Vorfahren zu Wesen der Fantasie wurden, die hinaus ins Leben drängten.
Gab es eine geheime Verbindung zwischen Fantasie und Wirklichkeit? Ich fragte mich, ob es eine Wechselwirkung gab – ob die Realität sich in gleichem Maße veränderte, wuchs und schrumpfte wie die Vorstellungskraft. Besteht eine Art Symbiose zwischen Leben und Dichtung, eine Art Quantenverschränkung? Vielleicht.
Die folgenden Kapitel schildern die Ereignisse eines Frühlings im Jahr 1885, in dem mein Urgroßvater Victor Collins und mein Urgroßonkel, der Feldprediger Reginald Collins, im Mittelpunkt stehen. Die Schauplätze reichen von Suakin über Alexandria und Malta bis nach Paris und Oxford. Ich bin all diesen Orten gefolgt, auf den Spuren der Protagonisten. Mein Bericht ist teils fiktiv, doch stets den Dokumenten aus den Truhen verpflichtet.
Charles Hohmann, Wylägeri, im Jahr 2023
Suakin
Kaplan Reginald Collins, DSO
Kapitel I
Blutiger Sand
Am Ende eines Meeresarms des Roten Meeres, rund 750 Meilen südlich von Sues, liegt Suakin – eine kleine, kreisförmige Insel, die durch einen Damm mit dem Festland verbunden ist. Diesen Damm ließ einst General Charles George Gordon errichten. Er führt in die benachbarte Ortschaft El Geyf, in der die meisten Einwohner leben. El Geyf ist von einem Ring aus Festungen geschützt, hinter denen die lebenswichtigen Shata-Quellen liegen.
Jenseits der Verteidigungsanlagen erstreckt sich eine karge Wüstenlandschaft, die stellenweise von einer dünnen Grasnarbe überzogen ist. Samr-Bäume, Mimosensträucher und Tundub-Büsche setzen spärliche grüne Akzente. Während der Regenzeit schwellen die Khors – die aus den umliegenden Hügeln kommenden Wasserwege – an, überfluten das Land und lassen es für kurze Zeit erblühen, bevor die sengende Sonne alles wieder in Trockenheit hüllt.
Suakin mag nicht der älteste Hafen an dieser Seite des Roten Meeres sein, doch zweifellos ist er der berühmteste. In seiner Blütezeit diente er als Drehscheibe des Handels zwischen Arabien, Abessinien, Ägypten, Indien und sogar dem fernen China. Schiffe aus aller Welt machten hier fest, und das geschäftige Treiben der Händler verlieh dem Ort einen kosmopolitischen Charakter.
Unter den Einheimischen hält sich eine faszinierende Gründungslegende: Einst waren die Könige von Ägypten und Abessinien enge Verbündete. Als Zeichen ihrer Freundschaft schenkte der abessinische König seinem ägyptischen Gegenüber sieben wunderschöne Jungfrauen, begleitet von seinem treuesten Eunuchen. Auf ihrer langen Reise legte die Gruppe für eine Nacht auf der Insel Suakin eine Rast ein. Während die Frauen dort in Sicherheit schliefen – bewacht von Wachen an allen Zugängen –, verbrachte der Eunuch die Nacht auf dem Festland.
Als die Gesandtschaft schließlich am ägyptischen Hof eintraf, nahm der König das Geschenk zunächst wohlwollend an. Doch seine Freude wich rasch der Entrüstung, als er feststellte, dass die Frauen schwanger waren. Auf seine Fragen hin berichteten sie, in jener Nacht auf Suakin seien ihnen sieben Dschinns erschienen, die sie geschwängert hätten. Der König glaubte ihrer Geschichte – ein Glück für den Eunuchen, der so dem sicheren Tod entging.
Um seinen abessinischen Freund nicht zu beleidigen, entschied der König, die Frauen mit Nahrung und Gewändern nach Suakin zurückzuschicken. Später folgten weitere Vorräte, die auf Kamelen transportiert wurden, sowie eine Sambuke – ein zweimastiges Segelschiff – für den Warentransport. So nahm der Seehandel seinen Anfang, und die Insel erhielt ihren Namen: Sawwa Dschinn – „Der Dschinn tat es.“
Es heißt, dass die Nachkommen der geheimnisvollen Geisterkinder noch lange auf Suakin lebten. Ein alter Mann der Stadt erzählt gerne, dass er als Jugendlicher noch seltsam aussehende Menschen mit bronzener Haut dort gesehen habe. Man munkelte, sie seien die letzten Nachfahren der Dschinns – Wesen, die jene verfolgten, die ihnen mit böser Absicht begegneten.
Samstag, 7. März 1885
Ankunft in Suakin
Ein hochgewachsener Offizier, Feldprediger im Heer Ihrer Majestät, und sein Adjutant, der einen Lederkoffer trägt, beide in Khaki-Uniform und mit Tropenhelmen, steigen aus einem Beiboot auf die Insel Suakin. Es ist der 7. März 1885. Jahrhunderte zuvor hatten hier Karawanen aus dem Inneren Abessiniens und des Sudans ihre Waren auf Schiffe verladen, die sie in ferne Regionen brachten. Sogar die Königin von Saba soll auf ihrer Reise nach Ägypten an diesem Ort gerastet haben.
Die beiden Männer bahnen sich ihren Weg durch das dichte Gedränge in Richtung Hanafi-Moschee. Der Offizier, Padre Reginald Collins, kennt den Weg – er war bereits während der Frühjahreskampagne des britischen Expeditionskorps hier. Sie zwängen sich durch die Menge aus britischen Soldaten in schweissnassen Khaki-Uniformen, stolzen türkischen Beamten, ägyptischen Füsilieren mit rotem Tarbusch und weißer Uniform sowie bärtigen indischen Söldnern, deren kunstvoll gebundene orangefarbene Dastars ihr ungeschnittenes Haar verbergen.
Collins’ Erscheinung ist so eindrucksvoll, dass selbst zerstreute Beobachter ihn bemerken. Seine scharfen, durchdringenden schwarzen Augen verleihen seinem Gesicht einen Ausdruck lebhafter Wachsamkeit. Er ist um die vierzig, schlank und straff in seiner Haltung. Sein Adjutant, Thomas Shanahan, einige Jahre jünger, hat braune Augen und ein breites Kinn, das auf einen starken Willen schließen lässt.
Während sie die engen Gassen durchqueren, erklärt Collins, dass die Architektur Suakins der türkischer Hafenstädte am Roten Meer wie Jeddah oder Massawa ähnelt – mit dem Unterschied, dass hier die Mauern aus Korallenstein gehauen sind. Auf ihrem Weg begegnen sie einem Strom von Pilgern in weißen Galabijas mit kunstvoll geschlungenen Turbanen.
Hinter ihnen glänzt die HMS Jumna in der gleißenden Morgensonne. Sie liegt vor der Bucht vor Anker, denn die enge Einfahrt und das gefährliche Korallenriff machen es für ein Kriegsschiff ihres Tiefgangs unmöglich, näher heranzukommen. Auf ihrer Fahrt mit dem Beiboot waren die beiden Männer rechts an der Quarantäne-Insel für Mekka-Pilger vorbeigekommen, dann an der Condenser-Insel mit ihrem schlanken, obeliskartigen Kamin – ein markanter Punkt der Suakin-Berber-Linie während der Kampagne von 1884–85. Schließlich hatten sie das Zollhaus im Norden der Stadt erreicht.
Nun drängen sie weiter durch die immer enger werdenden Gassen und erreichen den Souk. Die Straßen der Insel bestehen aus festgestampftem Sand – Räderverkehr ist hier unbekannt. Zwischen beladenen Kamelen und ihren arabischen Treibern, die zur Karawanserei in Geyf unterwegs sind, bahnen sie sich ihren Weg. Schwarze Nubier mit schweren Körben auf den Schultern, fast unbekleidete Hadendowas, Hadrerebes und Bejas – die eigentlichen Ureinwohner der Region jenseits der Insel – bevölkern den Markt ebenso wie ergraute Veteranen vergangener Derwisch-Kriege.
Das Stimmengewirr aus Beidawi und Khasa, durchsetzt von Arabisch, hallt von den Korallenmauern wider. Dazwischen ertönen die Rufe portugiesischer und griechischer Händler, die unter zerschlissenen Zeltplanen ihre Waren lagern und mit potenziellen Käufern lautstark feilschen.
In den Auslagen des Marktes glänzen die silbrigen Leiber frisch gefangener Fische, während rohe Fleischhälften an eisernen Haken baumeln, umschwirrt von dichten Wolken aus Fliegen. Am Boden stehen Käfige voller aufgeregtem Geflügel, belauert von abgemagerten, streunenden Hunden. Zwischen schweren Säcken, randvoll mit duftenden Gewürzen, türmen sich exotische Waren: kunstvoll gewebte Teppiche, funkelnde Hals- und Armreifen, prunkvolle Kaftane und verzierte Schwerter – alles zu scheinbar wohlfeilen Preisen angeboten.
An einer sonnenverbrannten Mauer hockt ein alter Derwisch, die rechte Hand verstümmelt, womöglich ein Opfer der Scharia. Seine trüben Augen sind halb geschlossen, während er mit leiser Stimme um Almosen bittet.
Die Brise, die im Hafen noch den salzigen Duft des Meeres trug, weicht in den engen Gassen einem beißenden Gemisch aus Gerüchen: staubiges Vieh, scharfer Weihrauch, Knoblauch und Zwiebeln, schwerer türkischer Tabak, stechender Urin und der saure Schweiß der Händler und Passanten.
Collins und Shanahan verlassen den Markt und gehen in Richtung Gordon-Tor. Kurz dahinter erhebt sich Beit Sham, ein dreistöckiges Haus im türkischen Stil, in dessen Mauern das Hauptquartier des Expeditionskorps untergebracht ist. Zwei Wachen am Eingang salutieren, als die Männer sich nähern. Collins erwidert den Gruß knapp und teilt ihnen mit, dass Major Graham sie erwartet. Die Soldaten nicken und lassen sie passieren.
Vom zweiten Stock werfen kunstvolle Roschans – filigran geschnitzte Holzerker – ihre Schatten auf den sandbedeckten Innenhof. Die Männer treten durch das schwere Tor ein. Der wachhabende Offizier mustert sie kurz und fragt nach ihrem Anliegen.
„Wir sind mit Generalmajor Graham verabredet. Er erwartet uns.“
Der Offizier deutet auf eine Tür zur Rechten, über der schlicht General geschrieben steht. Collins klopft. Eine tiefe Stimme aus dem Inneren ruft sie herein.
Hinter dem Schreibtisch erhebt sich ein Hüne von einem Mann. General Graham, fast zwei Meter groß, streicht sich über seinen walrossartigen Schnurrbart und mustert die Ankömmlinge mit prüfendem Blick. Es heißt, er habe in der Krim und in China mit den Expeditionsheeren gekämpft – ein altgedienter Soldat des Empire.
„Padre Collins! Es freut mich, Sie in alter Frische wiederzusehen. Wie war die Pflege auf dem Spitalschiff? Wir hatten befürchtet, Sie würden das Augenlicht verlieren – dieser böse Sonnenstich hätte schlimmer enden können. Der Zwischenhalt in England hat sicher zu Ihrer Genesung beigetragen.“
„Dank der Ärzte und der guten Pflege konnte ich mich rasch erholen und bin bereit, meine Aufgaben wieder aufzunehmen.“
Collins stellt seinen Begleiter, Adjutant Shanahan, vor. Der General deutet auf zwei Stühle und bietet ihnen etwas zu trinken an, was beide höflich ablehnen.
Er öffnet eine Kladde, entnimmt einige Dokumente und überfliegt sie mit ernster, aber wohlwollender Miene.
„Sie stießen 1879 als katholischer Feldprediger zur Armee und waren bis 1882 in Aldershot stationiert. Im August desselben Jahres segelten Sie nach Ägypten, wo Sie von der Regierung Ihrer Majestät ein Stipendium erhielten, um Arabisch zu erlernen. Interessant – Ihre Sprachkenntnisse werden uns von großem Nutzen sein.“
Er blättert weiter.
„1882 dienten Sie bei den Royal Irish Fusiliers im 1. Bataillon. Sie nahmen an der Schlacht von Tel-el-Kebir teil. Ich sehe hier einen Brief von Oberst Beasley – abgeschickt drei Tage bevor er seinen Verletzungen erlag. Darin lobt er ausdrücklich Ihre Tapferkeit.“
Graham hebt den Blick.
„Sie wurden mit dem Khedive’s Bronze Star mit Spange ausgezeichnet. Während eines Eigenbeschusses, als indische Truppen versehentlich auf ein britisches Detachement feuerten, ist es Ihnen gelungen, unter größter Gefahr die Inder zu erreichen und das Missverständnis aufzuklären. Eine bemerkenswerte Leistung.“
Von draußen dringt der Lärm des Marktes herein – Stimmengewirr, Rufe, das Kreischen eines Kamels. Graham runzelt die Stirn.
„Wir können die Fenster nicht schließen – die Hitze wäre unerträglich. Ich bitte um Entschuldigung.“
Er fährt fort:
„Hier ist noch eine Notiz. Ihre Kameraden bewunderten Ihre Aufopferungsbereitschaft während der Cholera-Epidemie in Alexandria im selben Jahr. Nach einem Aufenthalt in England sind Sie nun wieder hier.“
Der General lehnt sich zurück, faltet die Hände.
„Padre, ich bin stolz, Sie in meinem Regiment zu haben. Viele unserer irischstämmigen Soldaten erinnern sich an Sie und werden Sie willkommen heißen. Werden Sie bereits diesen Sonntag die Messe lesen?“
«Das habe ich vor.»
„Unser Hauptlager liegt auf dem Festland, in Geyf. Dort werden Sie ein Offizierszelt beziehen“, erklärt Graham. „Für die Messe werden wir etwas Geräumigeres benötigen – die Sonne ist mörderisch, wie Sie ja selbst leidvoll erfahren mussten. Ich werde alles Nötige veranlassen. Darf ich Sie heute Abend in der Offiziersmesse an meinen Tisch einladen?“
„Sehr gerne.“
Die Männer erheben sich, salutieren und verlassen das Hauptquartier.
„Shanahan, ich denke, wir haben uns einen Drink verdient“, meinte der Padre. „Ich habe hier einen portugiesischen Freund – Olivera da Figuera. Er betreibt einen Laden und eine Schankstube. Ich möchte ihm einen Besuch abstatten. Kommen Sie mit?“
Da Figuera hat sein Geschäft in einer Seitengasse des Souks. Im Erdgeschoss, in zwei nebeneinanderliegenden Räumen, stehen einfache Holztische, an denen ein gutes Dutzend Gäste sitzen. Manche trinken Tee, andere paffen an langen Shishas oder spielen Dame. Der Padre und Shanahan nehmen an einem freien Tisch Platz.
Ein junger Hadendowa – erkennbar an den dichten, krausen Haarbüscheln an Schläfen und Scheitel – tritt an sie heran und erkundigt sich nach ihren Wünschen. Der Padre winkt ab. „Wir würden gerne Señor Olivera da Figuera sprechen.“
Der Junge verschwindet und kehrt kurz darauf mit dem Wirt zurück.
„Padre Collins! Welch eine Freude, Sie zu sehen! Sie sind ja wieder ganz gesund. Letztes Jahr mussten Sie doch wegen eines Fieberanfalls aufs Lazarettschiff. Ich erinnere mich gut, wie Sie in einem Dhoolie zum Hafen getragen wurden.“
Da Figuera ist ein untersetzter, breitschultriger Mann mit offenem Kragen und hochgekrempelten Ärmeln, die kräftige, dunkel behaarte Arme entblößen.
„Ja, dank der guten Pflege auf dem Lazarettschiff und meinem Aufenthalt in England habe ich mich vollständig erholt.“
Shanahan nimmt seinen Tropenhelm ab und wartet höflich, bis der Padre ihn vorstellt.
Da Figuera lacht herzlich. „Des Padres Freunde sind auch meine Freunde. Kommt, oben haben wir mehr Ruhe.“
Er führt sie eine knarrende Holztreppe hinauf. Ein schmaler Gang endet an einer Tür, hinter der sich ein privater Empfangsraum befindet – ein Majlis. Der Eckraum ist mit dicken Teppichen ausgelegt, Kissen liegen an den Wänden. Zwei kunstvolle Roschans gewähren Ausblick: Die eine öffnet sich zum geschäftigen Souk, die andere zur Seitengasse, in der sich der Eingang des Kaffeehauses befindet. Durch das Fachwerkfenster kann man in der Ferne den Turm der Condenser-Insel erkennen, während die andere Seite den Blick auf einen muslimischen Friedhof freigibt, wo sich zwei Kuppelgräber verehrter Scheichs erheben.
Da Figuera lehnt sich zu ihnen und senkt die Stimme. „Unten muss man vorsichtig sein. Die Wände haben Ohren.“
Er dreht sich zum Padre. „Osman Dignas Spione lauern überall und versuchen, die Absichten der Engländer auszuhorchen.“
Die Männer machen es sich auf den Kissen bequem. Bevor er sich setzt, löst der Padre seinen Gürtel. Da Figuera, in eine weite Galabija gekleidet, lässt sich entspannt nieder, während Shanahan in seiner engen Uniform unbeholfen wirkt. Schließlich lockerte auch er seinen Gürtel.
Ein Diener tritt ein, bringt eine gläserne Karaffe und füllt kleine Becher mit einer milchig-trüben Flüssigkeit, die er mit Eiswasser verdünnt.
„Ihr müsst meinen Mastic probieren!“, verkündete da Figuera stolz.
Kurz darauf wird eine große Platte mit Mezze serviert – Datteln, Pistazien, Falafel, Baba Ganoush, Hummus und weitere Köstlichkeiten. Shanahan verzieht das Gesicht. Ein beißender Geruch liegt in der Luft, der offenbar von den Haaren des Bediensteten ausgeht.
Er nippt an seinem Glas, hustet und japst: „Mein Gott, das brennt ja wie Feuer!“
Da Figuera grinst. „Ein Destillat aus Feigen, versetzt mit Mastix – einem Harz, das wie Anis schmeckt.“
Shanahan schüttelt den Kopf. „Damit kann man Tote wieder zum Leben erwecken.“
Als der Diener sich entfernt, murmelt er: „Jetzt kann ich wieder atmen. Aber warum riecht der Mann so unangenehm?“
„Die Hadendowa sind stolz auf ihre Haarpracht. Um sie voluminös zu halten, reiben sie sie mit Schaffett ein. Leider schmilzt das Fett in der Sonne und entwickelt diesen ranzigen Geruch.“
Der Padre wechselte das Thema. „Unglaublich, wie sich dieser Osman Digna an der Macht hält. Wir haben ihn in der zweiten Schlacht von El Teb Ende Februar letzten Jahres geschlagen. Die erste Schlacht war ein Desaster – General Valentine Baker wurde schwer verwundet.“
Da Figuera nickt. „Wie Sie wissen, war Digna Zeit seines Lebens Sklavenhändler. Doch als die Briten begannen, den Sklavenhandel zu unterbinden, sah er seine Felle davonschwimmen. Deshalb schloss er sich dem Mahdi-Aufstand an.“
Shanahan runzelt die Stirn. „Aber warum folgen ihm so viele?“
„Seine Gefolgschaft verdankt er seinem Redetalent“, sagt Da Figuera. „In seinen wöchentlichen Ansprachen fordert er Entbehrung. Die Ehemänner sollen den Schmuck ihrer Frauen opfern – widerwillig, denn sie wissen, dass sie ihn ihnen früher oder später ersetzen müssen. Wer heute arm ist, werde am Tage der Auferstehung reich belohnt, verkündet er mit seiner tiefen Stimme.“
„Haben Sie ihn je gesehen?“, fragt Shanahan. „Wie sieht er aus?“
„Einmal, auf seinem Pferd, umringt von seinen Anhängern“, antwortet da Figuera. „Er ist stämmig und von mittlerer Größe, schweigsam und lacht kaum. Seine buschigen Augenbrauen verleihen ihm ein furchterregendes Aussehen. Wenn er zornig ist, kräuselt sich seine Stirn wie zerknittertes Papier.“
Er hebt den Zeigefinger. „Das wichtigste Ereignis für ihn sind die regelmäßigen Briefe des Mahdi, die ihm ein Bote aus Khartum überbringt. Darin schildert der Mahdi seine Vision: ganz Zentralafrika unterwerfen, in Ägypten einmarschieren, das Rote Meer überqueren, Mekka erobern, Turkmenistan in seine Gewalt bringen und schließlich die ganze Welt zum Islam bekehren. Wer sich dem Mahdi-Aufstand nicht anschließt, darf getötet werden, ihre Frauen sind Freiwild. Seine tiefe Stimme trägt seine Predigten bis in die entferntesten Reihen. Er schließt stets mit den Worten: ‚Enthüllt eure Brust und sucht den Tod! Denn ihr seid die wahren Gläubigen, und wenn eine Kugel euch trifft, dann ist das euer größter Lohn.‘“
Der Padre nickt nachdenklich. „Solche Männer üben eine gewaltige Anziehungskraft auf ihr Umfeld aus und finden viele Bewunderer. Wenn ich das so sagen darf – Dignas Entschlossenheit und Charisma erinnern in gewisser Weise an General Gordon. Auch er kannte keine Furcht. Sein starker christlicher Glaube ließ ihn dem Tod mit Fassung entgegensehen. Letzten Monat ist er in Khartum gefallen, von einer Lanze durchbohrt – am Zenit seines Ruhmes. Sein Tod zwang die Regierung unter dem Druck der Öffentlichkeit, wieder in den Sudan einzumarschieren.“
Er trinkt einen Schluck Wasser und setzt leiser hinzu: „Doch was kaum jemand weiß: Als 1882 der Krieg ausbrach, schloss sich Osman Digna Arabi an, der es geschafft hatte, die Armee hinter sich zu bringen und einen Aufstand in Alexandria zu organisieren – ein Aufstand, den wir in der Schlacht von Tel-el-Kebir niederschlugen.“
Der Padre hält kurz inne, seine Miene verdüstert sich. „Ich selbst war damals als Feldprediger dabei. Danach wurde Osman Digna zum Leutnant des Mahdi – und Englands erbittertster Feind.“
Shanahan lehnt sich vor. „Weiß man, wo er jetzt ist? Was hat er vor?“
Da Figuera schnaubt. „Die Gerüchteküche brodelt. Man sagt, er habe seine Kämpfer in Berber versammelt und Vorposten in Ariab sowie in den Hügeln von Khor Taroi eingerichtet. Immer wieder tauchen Freischärler auf und feuern aus der Ferne. Ich denke, ihr werdet bald gegen bedeutendere Verbände antreten müssen. Inschallah – mögen die Briten seinem Treiben ein Ende setzen.“
Das Lager in Geyf
Der Himmel glänzt wie poliertes Messing, und die Sonne brennt gnadenlos auf die ausgedörrte Wildnis herab – eine Landschaft, in der nur ein paar kümmerliche Büsche überleben. Als sie sich Geyf nähern, stoßen sie am Ende der Landbrücke auf eine Gruppe Soldaten. Der Padre bittet um Orientierungshilfe.
Ein Gefreiter grinst und sagt: „Willkommen im Ofen.“ Mit seinem gebräunten Arm deutet er in Richtung der Kaserne. „Dort sind die ägyptischen Regimenter.“ Dann schwenkt er seinen Arm im Uhrzeigersinn und zählt weiter auf: „Im Osten, hinter diesen Hütten, stehen Berkshire und Yorkshire. Daneben das Shropshire-Regiment. Weiter östlich Surrey, die Scots Guards und die Coldstreams. Ganz hinten die Royal Dublin Fusiliers und die Royal Irish.“ Er grinst verschmitzt. „Die kann man nicht übersehen – dort gibt es immer irgendeinen Aufstand oder eine Schlägerei.“ Dann wird seine Miene wieder ernst. „Als Offizier sind Sie in Ihrem Zelt sicher, aber ich kann nicht garantieren, dass Sie gut schlafen. Fast jede Nacht liefern sich die Wachen ein Feuergefecht mit den Derwischen an den Festungsmauern.“
Einige Zelte bestehen aus doppellagigen weißen Baumwollplanen, kreisförmig um einen Pfosten gespannt, um Schatten vor der sengenden Sonne zu spenden, aber auch mit großen Öffnungen versehen, um jedes Lüftchen einzufangen. Andere sind Pyramidenzelte mit einem charakteristisch zylindrischen Unterbau. In den größeren finden zwanzig Soldaten Platz, in den Offizierszelten vier.
Der Padre entdeckt sein Zelt auf dem Gelände der Royal Irish Fusiliers. Dort wird er von Soldaten herzlich begrüßt, die ihn noch aus dem Frühjahrsfeldzug kennen. Sie schütteln ihm die Hand und überschütten ihn mit Fragen. „Wir haben Sie zuletzt gesehen, als Sie auf das Lazarettschiff gebracht wurden. Sie sehen jetzt gut aus.“
„Ja, Jungs, die Hitze damals hat mir zu schaffen gemacht. Aber jetzt geht es mir gut“, erwidert der Padre.
Im Offizierszelt, das für sie vorgesehen ist, werden sie von zwei Männern empfangen, die von ihren Feldbetten aufspringen und sich vorstellen. Der eine ist Dick Heldar, Zeichner und Porträtist, der andere Herbert Belling-Tarpenhow, Kriegsberichterstatter der Times. Der Padre und Shanahan verstauen ihre Habseligkeiten auf den freien Pritschen.
„Um unser Seelenheil müssen wir uns wohl keine Sorgen machen, wenn Sie bei uns sind“, meint Heldar schmunzelnd. Er hat dunkles, gewelltes Haar, einen Oberlippenbart und wirkt jugendlich. „Eine Frage: Kennen wir uns nicht von irgendwoher, Padre? Waren Sie nicht auch in Downforth?“
Der Padre runzelt die Stirn, dann hellt sich sein Gesicht auf. „Heldar? Sie waren ein paar Klassen unter mir – und bekannt für Ihre Karikaturen.“ Er lacht. „Ich erinnere mich, dass unsere Lehrer nicht immer begeistert davon waren, oder? Wie ist es Ihnen seither ergangen? Ist das Ihre erste Kampagne als Karikaturist?“
„Ja.“
„Dann werden wir uns mit Anekdoten aus der Benediktiner-Klosterschule die Langeweile vertreiben können.“
Der zweite Mann, Belling-Tarpenhow, ist Mitte dreißig, eher klein, untersetzt und massig. Er hat eine Glatze, einen buschigen Schnäuzer und trägt statt einer Uniform ein zerknittertes Flanellhemd. Er greift in seinen Rucksack, zieht einen Flachmann hervor und hält ihn den Neuankömmlingen hin.
„Ein Willkommenstrunk! Auf unsere gemeinsame Zeit in diesem bescheidenen Hotel Seiner Majestät. Ich hoffe nur, keiner von euch schnarcht.“ Plötzlich hält er inne, dann zeigt er auf einen Käfer, der um eine Biskuitkiste huscht, kurz innehält, witternd stehen bleibt und sich dann schnell wieder verkriecht. „Hier haben wir übrigens noch einen fünften Mitbewohner. Der ist bestimmt als blinder Passagier in einer Keksdose aus England mitgereist. Ich bezweifle, dass er in diesem Brutkasten lange überlebt.“
Shanahan hebt eine Augenbraue. „Da könnten Sie sich täuschen. Käfer gibt es auf allen Kontinenten außer der Antarktis. Es sind über 100.000 Arten bekannt – sie haben sich an nahezu jede Umgebung angepasst. Und nicht alle Menschen ekeln sich vor ihnen. Vor ein paar Jahren fand ein Forscher in einer Höhle in Laugerie-Basse eine 1,5 Zentimeter große Marienkäferfigur, geschnitzt aus Mammutelfenbein. Das 20.000 Jahre alte Stück wurde vermutlich als Amulett getragen – ein Glückssymbol.“
Der Padre ergänzt: „Auch für die alten Ägypter war er ein Glücksbringer und ein Schutzsymbol. Sie hatten beobachtet, dass die Skarabäen – so nannten sie diese Käfer – das Nilhochwasser frühzeitig spüren. Die Tiere zogen sich vom Wasser zurück, tauchten in den Häusern auf und kündigten so das ersehnte Hochwasser an. Später übernahm der Skarabäus als Amulett die Bedeutung von ‚Auferstehung und Leben‘.“
„Warum?“, fragt Shanahan.
„Die Ägypter sahen, wie der Skarabäus Dungkugeln vor sich herrollte und sie im Schlamm vergrub. Später schlüpften aus der Erde neue Käfer. Für sie war das ein Symbol der Wiedergeburt nach dem Tod.“
„Dann hätten wir also einen Glücksbringer im Zelt“, kommentiert Tarpenhow.
„Nicht nur das“, fügt Shanahan hinzu. „Es gibt Biologen, die vermuten, dass Mistkäfer sich an einer Karte der Milchstraße orientieren, die sie im Kopf haben. Und noch etwas: Er ist gepanzert – also auch ein Krieger.“ Ein heiteres Lachen bricht aus.
Shanahan packt seinen Überseekoffer aus. Am mittleren Zeltpfosten baumeln bereits Cholera-Gürtel, Rückenschützer, Schutzbrillen, Wasserflaschen, Schwerter und Nackenschleier der Kameraden. Der Sandboden ist mit den Säcken ausgelegt, in denen die Zelte transportiert wurden. Ein paar Kisten in der Mitte des Raumes dienen als Tische.
Der Padre entdeckt einige Dokumente auf einem Feldbett. „Aha, hier haben wir gefaltete Kattunstoffkarten von Suakin und der Umgebung – und eine, die den Weg nach Berber zeigt. Das wird uns helfen, uns zu orientieren. Und ein Englisch-Arabisch-Wörterbuch.“ Er blättert darin. „Die arabischen Wörter sind in lateinischer Schrift transkribiert. Keine große Hilfe für einen Gefreiten mit schottischem oder irischem Akzent, der sich mit einem Araber unterhalten will. Und hier haben wir ein Dokument vom Geheimdienst, das wir lesen sollen: Report on the Egyptian Provinces of the Sudan, Red Sea, and Equator. Spannende Lektüre.“
Shanahan deutet auf eine Tube Chinin. „Ich nehme an, die werden wir brauchen, wenn wir ins Landesinnere vordringen.“
Der Padre öffnet seinen ledernen Koffer und überprüft unter den neugierigen Blicken der anderen den Inhalt: Messbuch, Bibel, Kelch, Kruzifix, Stola, zwei Gefäße für den Messwein, eine kleine Schatulle mit Hostien, Kerze mit Kerzenhalter und ein Ölgefäß für die Letzte Ölung – alles intakt. Es ist der 7. März, ein Samstag, und morgen muss er die Messe lesen.
Er klappt den Koffer zu und wirft einen Blick auf seine Uhr – sechs Uhr. Das Abendessen des Generalstabs findet um halb sieben im Hauptquartier auf der Insel statt. Die vier „Zimmergenossen“ müssen sich also beeilen. Über die Landbrücke, den Gordon Causeway, bis zum Tor zur Insel – Gordon’s Gate – brauchen sie mindestens zwanzig Minuten. Die Zeit muss einfach reichen!
Als sie das Zelt verlassen, hören sie Kanonenschüsse. Es sind die Bordkanonen der HMS Dolphin, die über das Lager hinweg auf Gruppen feindlicher Freischärler schiessen. Während der Padre und Shanahan zusammenzucken, bleiben Tarpenhow und Heldar unbeeindruckt. Sie haben sich inzwischen an den Krach gewöhnt. In einiger Entfernung vom schützenden Wall erkennen sie kurz nach jedem Schuss eine Sandfontäne, gut und gerne 30 oder 40 Fuss hoch.
In der Offiziersmesse
Der Generalstab und die Offiziere haben sich auf dem Flachdach des Hauptquartiers versammelt. Die Hälfte der Terrasse ist mit einer Strohmatte bedeckt, unter der ein großer Tisch festlich gedeckt ist. Davor und auf dem Balkon stehen uniformierte Gäste mit gefüllten Gläsern beisammen. Ein Gefreiter kündigt die Neuankömmlinge an. Erfahrene Kämpfer, die bereits mehrere Einsätze hinter sich haben, treffen auf junge Offiziere, die zum ersten Mal in Afrika sind. Stabsärzte, angloägyptische Offiziere, akkreditierte Zeitungsreporter und hochrangige Militärs mischen sich unter die Gesellschaft. Matrosen der HMS Jumna haben das Gedeck, Wein, Champagner und Whisky herangeschafft. Die Stimmung ist gelöst.
Padre Collins wird von einem anglikanischen Feldprediger begrüßt, den er bereits kennt, und den anderen Gästen vorgestellt. Die Gruppe steht auf dem Balkon der Terrasse. Von hier aus bietet sich ein Panoramablick auf das Festland im Südwesten: eine scheinbar endlose Reihe von Pyramidenzelten, akkurat aufgestellt wie eine Armee in Formation. Dahinter erhebt sich der Schutzwall mit seinen fünf Forts, und in der Ferne zeichnen sich die Erkowit-Hügel ab. Im Osten, hinter zwei Minaretten mit ihren bienenkorbförmigen Kuppeln, glitzert das Rote Meer. Die weiße HMS Jumna und die HMS Dolphin liegen vor Anker und leuchten in der Abendsonne. Die See ist glatt, nur einige zaghafte Wellen kräuseln sich in Ufernähe. Eine leichte Brise vertreibt die drückende Hitze des Nachmittags – eine Erleichterung, die alle spüren.
Die Gespräche kreisen um die kommenden Tage. Wird Digna den Schutzwall angreifen? Könnten die Hadendawas mit ihren Horden einen Durchbruch erzwingen? Oder wird das Heer Richtung Sinkat oder gar Tambuk vorrücken? Weiter südlich, in Trinkitat, hatten sich General Baker und General Graham den Einheimischen gestellt – und Graham hatte die Niederlage der ersten Schlacht gerächt. Vielleicht werden auch dorthin Truppen verlegt, denn die Derwische machen die Gegend erneut unsicher.
Padre Collins spürt die skeptischen Blicke einiger Offiziere. Katholische Feldgeistliche sind noch nicht lange im Heer zugelassen. Ein katholischer Priester leistet nicht den üblichen Fahneneid auf die Königin, die er nicht als kirchliches Oberhaupt anerkennt, sondern spricht einen abgewandelten Eid. Viele in England betrachten den Katholizismus noch immer als unvereinbar mit einer modernen Gesellschaft. Manche glauben, Rom unterhalte ein geheimes Netzwerk von Agenten, um Großbritannien zu unterwandern und die päpstliche Unfehlbarkeit zu verbreiten – jene Lehre, die 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil verkündet wurde. Doch viele Soldaten hier sind katholische Iren. Sie wollen Sakramente empfangen, die ein evangelischer oder anglikanischer Geistlicher nicht spenden kann.
Auf Einladung von General Gerald Graham rücken die Anwesenden zu den Tischen und nehmen Platz. Der General erhebt sich, räuspert sich und beginnt seine kurze Ansprache mit einem Grinsen: „Wir treffen uns hier, damit ich euch anschauen kann und ihr mich – nicht, dass ich besonders stolz auf mein Gesicht wäre, aber wir müssen uns kennenlernen, jetzt, da wir alle Teil dieser Expedition im Sudan sind.“ Dann wird sein Ton ernster: „Wir sind weit weg von zuhause, und ich weiß, dass einige von euch das Gefühl haben, man habe sie vergessen. Doch ich kann euch versichern, dass der Erfolg eures Einsatzes in aller Munde sein wird. Denn wir vertreten hier Werte und Errungenschaften, die wir uns in unserer langen Geschichte selbst erarbeitet haben.“ Zustimmendes Raunen geht durch die Reihen.
„Unter euch sind Soldaten aus dem gesamten Empire: Briten, Iren, Inder, Kanadier – und bald auch Australier. Sie sind freiwillig zu uns gestoßen und haben ihrem Mutterland die Hand gereicht – ein Zeichen kolonialer Solidarität und eine Warnung an unsere Feinde.“ Applaus brandet auf, einige rufen „Yipee!“ und „Yay!“, Gläser klirren. Der General nutzt die Pause für einen Schluck Wasser.
„Gemeinsam arbeiten wir an einer unauflöslichen Union mit dem Ziel, unseren Handel, unsere Besitztümer und die Souveränität unserer Fahne zu verteidigen. Doch letzten Endes geht es um den Frieden in unserem Reich, die pax britannica. Und eines Tages werdet ihr mit Stolz sagen können: ‚Ich war dabei!‘“
Wieder bricht lauter Beifall aus.
Der General blickt in die Runde und fährt mit Nachdruck fort: „Ihre Majestät, unsere glorreiche Königin – Gott beschütze Sie! – hat uns die Aufgabe anvertraut, die sudanesische Bevölkerung von der korrupten Herrschaft des Mahdis zu befreien und den Tod General Gordons zu rächen.“
Zwischenrufe unterbrechen ihn: „God save Her Majesty!“ – „Long live the Queen!“
„Doch unser Auftrag geht weiter: Wir wollen das Leben der Einheimischen verbessern, die Ernährung der Bevölkerung sichern und Hungersnöte verhindern. Unsere neuen Medikamente sollen sie vor Epidemien wie Malaria, Typhus und Cholera schützen, und wir müssen für Stabilität und Sicherheit sorgen. Ebenso ist es unser Ziel, die Barbarei des Sklavenhandels zu beenden und unsere christlichen Werte – Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit – vorzuleben.“
Seine Stimme wird fester. „Ein weiterer wichtiger Auftrag ist der Bau und Schutz einer modernen Eisenbahn zwischen Suakin und Berber, um unsere Truppen in Khartum effizient zu versorgen. Eine große Verantwortung ruht auf unseren Schultern. Unser Feind in diesem Landesteil ist Osman Digna, ein treuer Anhänger des Mahdis, den wir schon lange bekämpfen. Immer wieder gelingt es ihm, die Derwische zu mobilisieren. Sie sind tapfere Gegner, kämpfen für ihre Lebensweise und ihre Religion. Der Tod bedeutet für sie nicht das Ende, sondern ein glücklicheres Leben im Jenseits. Doch sie sind irregeleitet. Wenn ihre Anführer entmachtet sind, werden sie sich den Vorzügen der Zivilisation öffnen. Dann können sie in Frieden ihre eigene Zukunft bestimmen. Und wir sind es, die ihnen diesen Weg ebnen.“
Einige Zuhörer beginnen, ungeduldig auf ihre Gläser zu blicken oder nach den Dienern Ausschau zu halten, die das Essen servieren. Die Dunkelheit hat sich inzwischen über das Hauptquartier gelegt.
Der General hebt noch einmal seine Stimme: „Zum Schluss möchte ich meinen tief empfundenen Dank aussprechen für die herausragende Arbeit der Royal Engineers, des Armee-Ordonnanz-Korps sowie der Telegrafenund Postdetachemente. Sie waren unsere Vorhut und haben durch ihre hervorragende Organisation unsere Ankunft erheblich erleichtert. Möge uns Gott beistehen!“
Ein anhaltender Applaus brandet auf.
Nach dem Essen kommt General Graham auf Padre Collins zu und bittet um ein Treffen am nächsten Tag. Sie einigen sich auf 15 Uhr.
Um halb neun erklingt das Horn First Post, das Signal zum Aufbruch. Der General stimmt God Save the Queen an, und alle stimmen herzhaft mit ein. Dann lösen sich die Gäste auf und kehren in das Zeltlager im Geyf zurück.
Die Nacht ist drückend, denn der Wind vom Meer hat nachgelassen. Erst gegen Morgen wird es kühler, und eine Decke ist willkommen.
Doch erneut fallen Schüsse. Am Morgen erreicht die Anwesenden die Nachricht, dass Kämpfer des Mahdis zwei Soldaten des Berkshire-Regiments getötet und drei weitere verletzt haben. Es ist der erste von vielen Nachtangriffen, die die Soldaten noch oft unsanft aus dem Schlaf reißen werden.
Beim Morgenappell greift Shanahan nach seiner Uniform, die am Pfosten hängt. Er runzelt die Stirn. „Warum ist meine Uniform feucht? … Ihre auch!“
Padre Collins bemerkt, dass auch der Boden feucht ist.
Tarpenhow nickt. „Unser Lager liegt in einer Senke. In der Nähe des Meeres nimmt der salzige Boden nachts Feuchtigkeit auf. Die setzt sich in unseren Uniformen fest. Hoffentlich trocknen sie in der Hitze rasch – sonst haben wir mit Hautabschürfungen zu kämpfen.“
Shanahan, Heldar und Tarpenhow waschen sich und rasieren sich. Padre Collins stutzt seinen Spitzbart.
Shanahan schüttelt den Kopf. „Dass Sie bei dieser Hitze Ihren Bart behalten!“
„Der Bart schützt die Haut“, erklärt Collins. „Haare leiten keine Wärme. Es ist nicht nur die Sonne, die gefährlich ist, sondern auch die Lichtreflexion des Sandes. Nicht ohne Grund haben die Hadendawas und andere Einheimische so beeindruckende Haarschöpfe.“
Tarpenhow lacht. „Macht sie größer – und furchteinflößender. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür.“
Sie begeben sich zur Essensausgabe. Jeder erhält ein Stück Brot, ein Viertelpfund schwitzenden Cheddar und reichlich Wasser. Padre Collins verzichtet – für die Heilige Messe muss er nüchtern bleiben.
Sonntag, 8. März 1885
Heilige Messe
Um neun Uhr versammeln sich die katholischen Soldaten in einem eigens dafür errichteten, größeren Zelt, um der Messe beizuwohnen. Ein grob geschnitztes Holzkreuz ragt vor ihnen empor, sein dunkler Schatten fällt lang über den sandigen Boden.
Shanahan hat sich bereit erklärt, als Ministrant zu dienen. Gemeinsam mit Padre Collins steht er auf einer kleinen, aus Biskuitkisten errichteten Bühne vor dem provisorischen Altar. Der Padre trägt eine grüne Stola über seiner Uniform, die liturgischen Gegenstände hat er sorgfältig auf einer Decke ausgebreitet. Die Soldaten nehmen ehrfürchtig ihre Mützen ab, einige knien nieder, Gebetsbücher oder Rosenkränze in den Händen.
„Introibo ad altare Dei“, intoniert Padre Collins mit feierlicher Stimme, und die Messe beginnt.
In seiner Predigt spricht er über das Sakrament der Eucharistie: „Jesus hat beim letzten Abendmahl das eucharistische Opfer gestiftet. Er lehrt uns, dass sein Blut das Blut des Bundes ist, vergossen zur Vergebung der Sünden. Das Kreuzesopfer bleibt für alle Zeiten bestehen, bis zu seiner Wiederkunft. In dieser Messfeier ist Christus in unserer Mitte, denn wir sind in seinem Namen versammelt.“
Er hebt den Kelch und spricht die Wandlungsworte: „Accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim Corpus meum.“ Dann fährt er fort: „Hic est enim Calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis.“
Nachdem er Brot und Wein konsekriert hat, schließt er die Augen und betet: „Allmächtiger Gott, in dessen Händen der Sieg ruht, der David die Kraft verlieh, Goliath zu bezwingen: Wir bitten dich demütig um deine Gnade. Stärke deine Diener mit Mut und Entschlossenheit, damit sie die Witwen, Waisen und die Heilige Mutter Kirche gegen alle Feinde verteidigen – gegen sichtbare und unsichtbare. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.“
Während der Kommunion knien die Soldaten in Reih und Glied. Die Hitze ist drückend, einige lockern ihre Kragen oder wischen sich den Schweiß von der Stirn. Der Padre legt ihnen die Hostie auf die Zunge: „Dies ist der Leib Christi.“
Als er zum Altar zurückkehrt, verkündet er das Ende der Messe: „Ite, missa est.“
Die Soldaten verlassen das Zelt, worauf Padre Collins den Altar aufräumt. Sein Blick bleibt am Kruzifix hängen, während Gedanken durch seinen Kopf wirbeln: Sie beten, weil sie hoffen, im Kampf verschont zu bleiben. Ihre Gebete sind wie eine Versicherung, eine Wette auf Unsterblichkeit. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Doch nur wenige beten wirklich aus innerer Überzeugung, nur wenige verstehen die wahre Tiefe der Liturgie.
Nach der Messe steigen Shanahan, Padre Collins, Tarpenhow und Heldar in ein Beiboot. Heldar trägt seinen Zeichenblock unter dem Arm. Ihr Ziel ist die Quarantäne-Insel, wo sie die ankommenden Dromedare und Pferde in Augenschein nehmen wollen. Die Insel ist der zentrale Umschlagplatz für die Versorgung des Heeres. Über die staubige Ebene ziehen endlose Karawanen beladener Dromedare – mit Vorräten, Ausrüstung, Tierfutter und Brennstoffen. Soldaten schuften in der sengenden Sonne, während Ordonnanzen in vollem Galopp Befehle überbringen. Generäle und Stabsoffiziere mustern die neu eingetroffenen Verbände. Die Luft ist schwer von dem fauligen Geruch der umliegenden Sümpfe.
Die mühsamste Arbeit ist das Entladen der Kamele aus Indien und Aden. Mit schweren Hebevorrichtungen werden sie an Land gehievt. Viele Tiere sind geschwächt, sie haben den Transport in den engen Fesseln schlecht überstanden. Räude hat sich ausgebreitet, Flöhe und Zecken wimmeln in ihren Fellen.
Padre Collins, der den Sudan und Ägypten bereist hat, betrachtet die Tiere nachdenklich. „Ein Dromedar ist ein seltsames Wesen“, sagt er schließlich. „Es wirkt immer missmutig, grunzt und stöhnt beim Aufstehen oder Niederlegen, als sei es eine Qual. Seine Laute sind abscheulich – es brüllt wie ein Stier oder grunzt wie ein Wildschwein. Manche sind bösartig. Ein Biss oder Tritt kann schwere Verletzungen verursachen.“
Shanahan runzelt die Stirn. „Aber sie können lange ohne Wasser auskommen, oder?“
Der Padre nickt. „Bis zu neun Tage, sagt man. Aber das kostet sie Kraft. Bei harter Arbeit in dieser Hitze brauchen sie zweimal täglich 25 bis 30 Liter.“
Vor ihnen reißen die Tiere mit stoischer Ruhe Zweige von Dornensträuchern und zerkauen sie genüsslich. „Auch Mimosen lassen sie sich nicht entgehen“, bemerkt der Padre. „Die Dornen können jede Stiefelsohle durchbohren.“
Heldar stellt seine Staffelei auf und beginnt zu skizzieren. „Diese Tiere schauen auf uns herab – aus ihren viel zu kleinen Köpfen, mit halb geöffneten Augen, als wollten sie sagen: Ihr könnt uns doch alle mal! Sie strahlen eine lässige Arroganz aus.“ Er lacht leise. „Aber ich will nicht nur die Kamele zeichnen, sondern auch ihre Führer aus Indien und Somalia. Diese Männer wissen, wie man mit den Tieren umgeht.“
Padre Collins betrachtet die Szene. „Wir werden uns bald mit diesen Tieren anfreunden müssen.“
Tarpenhow entfernt sich, um das ausgeladene Schienenmaterial zu begutachten. Shanahan bleibt bei dem Padre.
Nach einer Weile seufzt er. „Wozu das alles? Diese gigantischen Vorbereitungen, diese unzähligen Menschen, die zusammenströmen, der immense Aufwand an Geld und Ressourcen – und doch lauern hier Krankheit und Tod. Wofür?“
Padre Collins bleibt ruhig. „Wir sind Soldaten. Wir gehen dorthin, wo man uns hinschickt, und tun, was man uns befiehlt. Aber wir bringen auch Ordnung und Gerechtigkeit. Wir kämpfen gegen die Sklaverei, wir schützen die Menschen vor Hunger und Seuchen, wir bringen ihnen Recht und Gesetz. Damit die Völker Ihrer Majestät in Frieden leben können.“
„Das verstehe ich ja. Aber schauen Sie sich doch an, in welch unverhältnismäßigem Maß wir unsere Mittel einsetzen, um diese Ziele zu erreichen. Wir nutzen die gesamte Technik, die uns zur Verfügung steht: einen Aufklärungsballon, befüllt mit komprimiertem Gas aus Chatham, fahrbare Geschütze, gezogen von Mauleseln, Gardner-Maschinengewehre mit fünf Läufen, Raketen und schnell feuernde Karabiner. Und gegen wen führen wir diesen Krieg? Gegen einen Feind, dem es nicht an Mut mangelt und der ebenfalls bewaffnet ist – aber womit? Mit handgefertigten, primitiven Speeren, Schwertern wie aus der Zeit der Kreuzzüge, Schilden aus Krokodilleder und ein paar Remingtons, die sie kaum richtig bedienen können.“
„Was sie jedoch auszeichnet“, entgegnet der Padre, „ist die Entschlossenheit eines Volkes, angefacht von einem Fanatismus, der den Tod nicht fürchtet – im Gegenteil: Sie suchen ihn aus zwei Gründen. Erstens, weil er ihnen den Weg in eine bessere Welt eröffnet, und zweitens, weil ihnen ein Leben, in dem sie ihre Kultur, ihre Freiheit und ihr Land verlieren, als noch schlimmer erscheint. Aber ich gebe Ihnen recht. Auch mir scheint der Aufwand, den wir betreiben, in keinem Verhältnis zu den hehren Zielen zu stehen, die wir vorgeben. Doch ich bin nicht als Politiker hier, sondern als Seelsorger. Meine Aufgabe ist es, den Verwundeten und Sterbenden in ihren seelischen Nöten beizustehen. Wenn ein Soldat auf einem fremden Schlachtfeld sein Leben für Königin und Vaterland gibt, dann muss ich ihm die Gewissheit schenken, dass sein Opfer nicht vergebens war – und ihm mit der Letzten Ölung das Tor zum Paradies öffnen.“
„Seltsam“, meint Shanahan nachdenklich. „Wir Christen hegen denselben Wunsch nach Erlösung wie ein Muslim, der im Kampf stirbt, um ins Paradies zu gelangen.“
Schweigend beobachten sie das Treiben vor ihnen und werfen immer wieder Blicke auf Heldars Skizzen. Schließlich richtet der Padre seinen Blick auf Shanahan und fragt: „Warum haben Sie sich eigentlich freiwillig für diese Mission gemeldet?“
„Ich suche meinen älteren Bruder. Er ist auf die schiefe Bahn geraten, und unser Vater hat ihn verstoßen. Wir wissen, dass er sich unter falschem Namen hat einziehen lassen. Inzwischen ist unser Vater gestorben, und ich habe meiner Mutter versprochen, Thomas zu finden.“
„Darf ich fragen, worum es bei diesem Streit ging?“
Shanahan seufzt. „Unsere Familie war tief gespalten. Einige unserer Vorfahren gehörten den United Irishmen an. Schon Wolfe Tone hatte mit Napoleon verhandelt, um die britische Herrschaft über Irland zu beenden. Französische Truppen landeten in Irland, wurden aber besiegt. Tone schnitt sich im Dubliner Gefängnis die Kehle durch, bevor man ihn hängen konnte. Seitdem werden die United Irishmen gnadenlos verfolgt – bis heute. Unser Vater hingegen war ein gemäßigter Nationalist. Er glaubte an Verhandlungen mit den britischen Besatzern. Mein Bruder jedoch, von einem starken Gerechtigkeitssinn getrieben, schloss sich dem Widerstand an. Als uns das Geld ausging, nahm Vater eine Arbeit in Liverpool an, und die ganze Familie zog nach England. Dort eskalierte der Streit zwischen ihm und meinem Bruder endgültig.“
„Aber warum hat er sich dann freiwillig zur Armee Seiner Majestät gemeldet?“
„Nachdem ihn unser Vater aus dem Haus geworfen hatte, blieben ihm nur zwei Optionen: die Auswanderung nach Amerika oder die Armee als Broterwerb. Da er sich die Überfahrt nicht leisten konnte, blieb ihm keine Wahl – er musste unter jener Flagge kämpfen, die er so sehr verachtete. Meine Schwester hat mir erzählt, dass er ihr schrieb, er sei in den Sudan abkommandiert worden. Die Rekrutierungsbüros nehmen es ja nicht so genau mit der Identitätsprüfung. Und deshalb bin ich hier.“
„Vielleicht kann ich Ihnen helfen – ich spreche mit vielen Soldaten. Können Sie ihn mir beschreiben?“
„Ich habe ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Auffällig ist, wie bei mir, seine Sattelnase und das breite Gesicht. Er hat braune Haare mit Mittelscheitel und ist etwas größer als ich. Aber er darf auf keinen Fall auffliegen! Er hat einiges auf dem Kerbholz. Sollte seine wahre Identität bekannt werden, würde man ihn verhaften, nach England zurückbringen, verurteilen und ins Gefängnis werfen. Er muss seinen Tarnnamen unbedingt behalten!“
Der Padre nickt verstehend, und Shanahan kehrt in sein Zelt zurück.
Gegen drei Uhr spricht Padre Collins beim General vor. Neben ihm sitzt ein weiterer Offizier des Generalstabs, Major Pembroke.
„Bitte, nehmen Sie Platz.“ Der General entkorkt eine Whiskyflasche und schenkt drei Gläser ein. Dann öffnet er eine silberne Zigarettendose. „Eine Zigarette?“
Der Padre lehnt höflich ab.
„Danke, dass Sie gekommen sind. Major Pembroke hat eine Bitte an Sie.“
„Ich höre.“
Neben dem hünenhaften General wirkt der schmächtige Major Pembroke fast verloren. Er strafft sich, rückt seine Brille zurecht und ergreift das Wort.