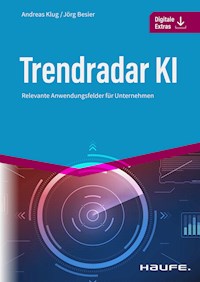5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Erkenntnisse der modernen Traumaforschung und die eigene Neugierde haben zu der Öffnung einer bisher verschlossenen Kiste mit den Fragmenten der familiären Vergangenheit geführt: Nach Überleben des Afrika-Feldzuges in Deutsch-Ostafrika im Ersten Weltkrieg kehrt eine Dresdener Mediziner-Familie in die Heimat zurück und versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen. Durch Urlaub auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden kommen sie mit den Kreisen um Hitler in Berührung. Einige Jahre im Dresdener Gemeinderat, Teilnahme an der kulturellen Entwicklung in Dresden-Hellerau, Schiffsreisen des "Familienoberhaupts" in die ganze Welt als Arzt und nach der Machtergreifung durch die NSDAP mehrere Verhaftungen der Familie durch die Gestapo mit folgenden Gefängnisaufenthalten, direkte Teilnahme zweier Kinder an den Kriegsereignissen mit glücklichem Nichtbesteigen der "Wilhelm Gustlow" in Gdingen 1945 bestimmen das Leben dieser Familie und ihrer Mitglieder bis zum Erleben des Dresdener Feuersturms im Februar 1945 von Bühlau aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Klug
Zwischen zwei Welten
Sehnsucht und Wirklichkeit
Copyright: © 2019: Andreas Klug
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-7497-4109-0 (Paperback)
978-3-7497-4110-6 (Hardcover)
978-3-7497-4111-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Fragmente des Lebens einer Familie zwischen Afrika, Gestapo-Haft, dem Untergang der „Wilhelm Gustlow“ und dem Feuer über Dresden im Februar 1945, gesammelt in einer Kiste
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Intro
Dresden 1945
Kwa heri, Afrika
Heimat
Aller Anfang ist schwer
Das neue Auto
Das Leben in Dresden in den 20-er Jahren
Gymnasium zum Heiligen Kreuz
Pooper bekommt die „Hummeln“
Reisen ist so wichtig !
Bei Irlingers
Als Schiffsarzt in die Welt
Machtergreifung
In Dresden in Haft
Ein Putsch und seine Folgen
Was ist mit Punker los?
Judith und das Manneken Pis
Die Junglehrerin
Otto II, genannt Punker
Gefängnis zum ersten, zweiten und …dritten !
Judith: Ausbildung statt Schule
Ostpreußen
Feuer!
Epilog
Zeichenerklärung:
Quellen:
Vorwort
Mein Deutschlehrer hat mir einst beizubringen versucht, dass man niemals mit „Ich“ beginnen soll – kein Buch und keinen Aufsatz. Also muss ich einen anderen Weg finden, um mein Problem loszuwerden:
Die Familie meiner Mutter hatte eine – nach meinen Maßstäben – unheimlich interessante Geschichte. Sie selbst konnte oder wollte meine Fragen nicht beantworten, die ich als neugieriger junger Mensch über diese Zeit stellte. Zu meinem Glück konnte ich ihre Mutter, meine Omi, fragen, die auf diesem Gebiet wesentlich gesprächiger war. Ihre Antwort begann meist mit: „Frag mich nur, Kind, später wirst du das nicht mehr tun können.“ Und so konnte ich manche Erzählung über die Lebensverhältnisse in diesen Zeiten in meinem Gedächtnis speichern. Viel Unterstützung gaben mir dabei auch die Fotos, die in einem Karton gesammelt waren.
• Wer konnte denn schon über das Leben in Afrika um 1912 oder über Schiffsreisen nach Singapur und Südamerika in dieser Zeit erzählen?
• Wer sonst hatte in den Zwanziger-Jahren im Stadtrat von Dresden gesessen wie einst einer der Vorfahren im Reichstag?
• Wer sonst konnte mir erzählen von der Gründung der auch heute noch so bekannten wie umstrittenen „summerhill school“?
• Wer sonst hatte den Obersalzberg bei Berchtesgaden noch vor Hitler und seinem Berghof durchwandert?
• Wer sonst war den Verfolgungen der NSDAP und dem Foltern der Gestapo bei mehreren Gefängnis-Aufenthalten entkommen?
• Wer sonst konnte von dem Glück berichten, trotz Passierschein keinen Zutritt mehr auf die „Wilhelm Gustlow“ bei der Flucht aus Ostpreußen erhalten und so überlebt zu haben?
• Wer sonst hatte das Glück gehabt, aus der Innenstadt von Dresden in einen Vorort ziehen und damit dem Feuersturm im Februar 1945 entgehen zu können?
All diese Fragmente gab es in meinem Kopf und dazu noch Durchschläge von Briefen aus Deutsch-Ostafrika und den zwanziger Jahren sowie das Dokument der Einbürgerung meines Ur-ur-Großvaters 1816 nach Magdeburg. Mit all diesen Relikten der Vergangenheit saß ich da und war mir der Tatsache bewusst, dass niemand nach mir mehr eventuelle Fragen würde beantworten können. Was also tun?
Ich bin weder ein Romancier, kann keine Bücher schreiben, noch bin ich Journalist. Was also tun mit all diesen Fragmenten? So manchem meiner Freunde und Bekannten stellte ich diese Frage. Wie gehe ich mit so etwas um? Keiner wusste eine Antwort. Aber ich wollte mir auch darüber klar werden, warum meine Mutter so mit uns Kindern umgegangen war, wie sie es getan hatte, warum sie auch die meisten Fragen nach der Vergangenheit abgeblockt hatte mit der ewig gleichen Antwort. „Weiß ich nicht“.
Aber ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert – umso mehr, wenn es um die der eigenen Familie geht.
In all dieser Ungewissheit stieß ich zufällig auf das Zitat von Peter Härtling. Es gab mir Mut, mich einfach hinzusetzen und zu beginnen – ohne zu wissen, wohin das führen würde:
„Der Mensch kann nicht ohne Erinnerung existieren. Er braucht seine Geschichte“
(Peter Härtling)
Kapitel 1:
Intro
Knarrend und knarzend öffnete sich die Tür aus vergilbten Brettern. Lange Spinnweben bis zur Decke zeugten von der Zeit, die seit dem letzten Öffnen vergangen war.
Muffig roch die Luft und Staub reizte in der Nase zum Niesen, als Buschi in die Dunkelheit des Dachbodens vordrang.
Alles war hier immer abgestellt worden, wenn irgendjemand aus der gewiss nicht kleinen Familie etwas hinterließ. Die Rumpelkammer der Familie, hätte man sagen können. Hier war ein Platz für alles aus den Hinterlassenschaften, was man des Aufhebens für würdig erachtete oder nur mal kurz zwischenlagern wollte, bis eine andere Unterkunft gefunden worden war. Aber wie so oft: aus dem „kurz“ wurde bisweilen eine ganz schön lange Zeit und manchmal kam auch Gevatter Tod dazwischen.
Als Letztes war jene alte Truhe dort im Eck von Tante Gisela kurz vor ihrem Hinscheiden hier eingelagert worden. Bedeutsam hatte sie ihm dieses Relikt aus der Familiengeschichte vermacht. Er hatte den Inhalt nicht gleich überprüfen können. Dafür hatte die Zeit gefehlt. Jetzt aber – in Rente – hatte er mehr Zeit und wollte in aller Ruhe den Dingen auf den Grund gehen.
Die Truhe unter der Schräge der Dachsparren sah aus wie eine dieser alten Seekisten, die man oft auf frühen Fotos von Schiffsreisenden entdecken konnte. Ein langer metallener Splint war als Sicherung durch die Ösen der beiden metallenen Überwurfverschlusslaschen geschoben. In einem Loch an seinem Ende hatte früher wohl irgendein Sicherungsmechanismus gegen unbefugtes Herausziehen gesteckt. Zum Glück war der jetzt verschwunden.
So bildeten nur der dicke Staub, die Spinnweben über der Truhe und die Düsternis des Dachbodens ein Hindernis, jetzt sofort seine Neugierde zu stillen, was der eigentliche Inhalt dieser Kiste sei.
Der mitgebrachte Besen beseitigte die gröbsten Spinnweben über der Kiste und ermöglichte ihm, sie mit etwas Mühe in Richtung Türe zu ziehen. Unter metallischem Schaben konnte er den langen Metallsplint aus den Ösen ziehen. Jetzt stand der Öffnung der Überwurfbügel nichts mehr im Wege !
Voller Spannung klappte er die beiden Metalllaschen hoch. Der schwere Holz-Deckel klemmte. Wer weiß, wie lange der schon nicht mehr offen war !
Glücklicherweise hatte Buschi so etwas geahnt und einen breiten Schraubenzieher mitgebracht. Rechts und links jeweils an den Ecken ansetzen und mit leichtem Druck auf den Spalt den Deckel mobilisieren und hochklappen. Dann lag der bislang verborgene Inhalt vor ihm.
Irgendwie kam er sich gerade wie ein Affe vor, der in einem Beutestück herumkramt, so wie er es manchmal in den Zoo-Sendungen im Fernsehen sah, wenn die Wärter dem Affen etwas zu Tun geben wollten. Das war schon eigenartig, aber schließlich hatte seine Omi Deppe ihm kurz nach seiner Geburt seinen Spitznamen gegeben nach dem 1948 neugeborenen Affen, den sie bei Spaziergängen im Dresdener Zoo als „gesichtsverwandt“ (so hatte sie sich ausgedrückt) entdeckt hatte. Vielleicht war die Ähnlichkeit größer als bisher gedacht? (der Affe Buschi starb 2017 im Dresdener Zoo)
Als Oberstes war ein Tuch zur Abdeckung an den Längsseiten zwischen Wand und Inhalt eingeschoben. Und darunter: ein leicht zerfleddertes Heft mit festem Deckel.
Er nahm es heraus und schlug es auf.
Anscheinend so etwas wie ein Tagebuch! Buschi blätterte es langsam durch.. Die Seiten waren vollgeschrieben – aber kein Datum. Der Text endete auf der vorletzten Seite mitten im Satz:
„Gebe Gott, dass …“ und dann brach die Aufzeichnung ab.
Als nächstes lag in der Kiste ein großes, dickes Blatt:
Einbürgerungsurkunde
des Schlossermeisters Otto Deppe in Magdeburg
anno domini 1816
Beim Hochheben des großen, starken Papierbogens der Urkunde erschien darunter ein offener Karton, angefüllt mit durcheinandergewürfelten alten Schwarz-Weiß-Fotos.
Es gab allerdings auch einige wenige farbige aus neuerer Zeit.
Buschi blätterte sie kurz durch. Ah ja, einen Teil kannte er aus den Unterlagen seiner Omi. Da gab es Aufnahmen von ihr in den Bergen und in Wäldern und auch noch einige andere mit ihm unbekannten Personen – schön in Positur gesetzt für den Herrn Photographen (so schrieb sich das damals). Da müsste er sich noch umhören in der Familie, wer das wohl sein könnte.
Buschi klappte die Kiste wieder zu, nahm das, was er für ein Tagebuch hielt, in die eine, den Besen und den Schraubenzieher in die andere Hand und schloss die Türe zum Speicher wieder. Zunächst wollte er sich mit den handschriftlichen Aufzeichnungen beschäftigen. Anscheinend waren es irgendwelche Notizen seines Großvaters mütterlicherseits – jenes Dr. Ludwig Deppe, den die ganze Familie immer „Pooper“ genannt hatte. Er glaubte die Schrift wiederzuerkennen. Als Erbstück befand sich nämlich ein Buch in seinem Besitz mit handschriftlichen Anmerkungen eben dieses Großvaters. „Mit Lettow-Vorbeck durch Ostafrika“ lautete der Titel. Gedruckt worden war es im Jahre 1919.
Schon seltsam, dachte Buschi, sich so kurz nach dem ersten Weltkrieg ausgerechnet um das Schreiben eines Buches zu kümmern, wo man doch sicherlich zunächst mal andere Bedürfnisse hatte. Ihm fiel dabei ein, dass auch noch andere Bücher in der Familie Deppe entstanden waren: als zweites war - zusammen mit Poopers Ehefrau Charlotte, seiner Omi - ein weiteres über diesen Aufenthalt im ehemaligen Deutsch-Ostafrika entstanden. Es war 1925 unter dem Titel „Um Ostafrika“ erschienen und beinhaltete außer dem Kriegstagebuch-ähnlichen Inhalt des ersten Buches die zusätzliche Beleuchtung des Lebens der am Wohnort Tanga zurückgebliebenen Ehefrau besonders nach der Besetzung durch die feindlichen Engländer.
Außerdem wusste er um eine Schrift über Säuglingserziehung, die seine Großmutter Charlotte 1923 während ihrer Tätigkeit in Hellerau geschrieben hatte. Allerdings war diese damals unter dem Namen Ihres Mannes erschienen. Denn erstens hatte der einen „Doktor“ und zweitens war dann der Autor keine Frau ! So würde das Werk auch mehr akzeptiert – dachten sie beide damals. So jedenfalls hatte man ihm das in seiner Jugend erzählt.
Zu solch einem Vorgehen hatte sich ausgerechnet die resolute, selbstbewusste und durchsetzungskräftige kleine Omi Deppe durchgerungen! Das passte überhaupt nicht zu dem Bild, das er von ihr hatte!
Na ja, Köpfchen hatte sie aber immer schon gehabt und sich stets unter allen Regimen auch selbst durchschlagen können. Anders ging es damals (1916 in Ostafrika und dann 1919 nach dem verlorenen Krieg in Deutschland) eben nicht. Auch in der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, der ehemaligen sowjetisch besetzten Zone des besiegten Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg, hatte sie sich alleine durchschlagen müssen. Der Rest der Familie war in den Westen entkommen. Es blieb einem als Frau nichts Anderes übrig als bisher Ungewohntes selbst zu übernehmen, sich auf eigene Füße zu stellen, wollte man weiterleben, so hatte es ihm seine Omi Deppe einst erzählt.
Er griff zu den Aufzeichnungen seines Großvaters Pooper, dem er persönlich nie begegnet war.
Kapitel 2:
Dresden 1945
Schwer rang er nach Atem. Das verdammte Herz !
Dr. Ludwig Deppe ordnete sein Kissen neu und ließ sich ermattet zurücksinken. Es waren nicht die Anzahl der zurückliegenden 71 Lebensjahre, die ihm zu schaffen machte. Aber in Afrika hatte ihn die Anopheles-Mücke mit Malaria angesteckt. Seitdem hatte er stets mit dem Herzen zu tun.
Alles war genau so gekommen, wie er es vorausgesagt hatte! Damals, als Schiffsarzt 1933 auf der Fahrt nach Shanghai, hatte man in den Nachrichten die Ernennung von Hitler zum Reichskanzler gemeldet. Wie hatte ihn das doch aufgeregt! Unglaublich! So jemanden könne man doch nicht zum Reichskanzler machen und Krieg würde es geben, hatte er seine Freunde telegraphisch aus Shanghai gewarnt. Diese Telegramme hatten ihn eine ganz schöne Stange Geld gekostet, da sie als Privatpost und nicht als Reederei-Post galten. Aber diese Angelegenheit war wichtig genug für diese unvorhergesehene Geldausgabe in der sonst so extrem sparsamen Familie.
Eine derartige Entwicklung voraussehend hatte er vor seiner Abreise schon Otto Strasser und dessen Bruder Gregor brieflich auf eine solch schädliche Entwicklung hingewiesen.
Wenn Hitler der bestimmende Mann in der Partei bliebe, würde das zu einem völlig unsozialen Staat führen!
Er erinnerte sich genau, wie er einst Otto Strasser kennengelernt hatte. Es war auf einem Treffen der „Vereinigung sozialistischer Ärzte“ gewesen. Einzutreten für die sozialen Bedürfnisse, die so viele Menschen auf die Strasse trieben, war ihm als SPD-Abgeordneten im Stadt-Parlament von Dresden immer ein Anliegen gewesen.
Aus Berlin war dann dieser Herr Strasser als Redner gekommen und hatte vehement dafür plädiert, dass die neu gegründete NSDAP es als ihre Aufgabe ansehen würde, die im Moment vom Ausland und dem internationalen Judentum niedergedrückte deutsche Bevölkerung wieder zu alter Größe und Bedeutung auferstehen zu lassen. Dafür werde sich der Führer mit aller Kraft einsetzen. In einem anschließenden privaten Gespräch hatte er sich mit ihm weiter darüber ausgetauscht.
Der Redner hatte sich ihm als Otto Strasser vorgestellt. Er sei früher auch Mitglied der SPD gewesen, nach der Niederwerfung von Arbeiteraufständen im Ruhrgebiet unter dem Stillhalten der SPD aber ausgetreten. Diese Aufstände seien ja völlig berechtigt gewesen. Später habe er beim „Völkischen Beobachter“ gearbeitet, dem Parteiorgan der NSDAP – aber unter einem Pseudonym. Man habe schließlich irgendwie seine Brötchen verdienen müssen. Dadurch sei er mit dem Programm dieser neuen Partei in Berührung gekommen und ihr dann auch beigetreten. Seit Mitte der 1920er Jahre habe er mit seinem Bruder Gregor einen sozialrevolutionären Flügel innerhalb der Partei aufgebaut, der durchaus auch für Arbeiterstreiks stimmte.
Damit habe er sich aber in Widerspruch zu Hitler begeben, der sehr viel mehr mit den Herren vom Kapital zusammenarbeiten würde.
In diesem Gespräch hatte Pooper, also er selbst, betont, wie wichtig es sei, für die arbeitenden Menschen auch die gesundheitlichen Voraussetzungen zu schaffen, indem die Bevölkerung aus den dunklen und ungesunden Hinterhöfen herausgeholt würde. Dieser Aspekt des politischen Kampfes müsse mehr betont werden, um der Partei genügend Unterstützung bei den Leuten zu beschaffen.
Da würde ihm die Berliner Sektion der Partei völlig zustimmen, äußerte sich Strasser – ganz im Einklang mit dem 1920 im Münchener Hofbräuhaus verabschiedeten Parteiprogramm. Dass in diesem Programm, das Otto Strasser dargelegt hatte, einige Punkte durchaus als sozialistisch angehaucht verstanden werden konnten, hatte es für Pooper diskussionswürdig gemacht.
Hinter den Kulissen der neuen Partei entwickelten sich dann allerdings die Gegensätze zwischen der Berliner und der Münchner Fraktion immer mehr, in der Hitler die Hauptrolle spielte. Die Brüder Strasser hatten letztendlich ein neues Parteiprogramm entworfen, das 1926 von den norddeutschen NSDAP-Gruppen in Hannover befürwortet worden war, aber an den süddeutschen Parteigruppen um Hitler scheiterte.
1930 war Otto Strasser aus der Partei herausgedrängt worden, hatten die Zeitungen berichtet. Strasser hatte daraufhin eine neue Gruppierung mit dem Namen "Die schwarze Front" gegründet, die einen nationalen Sozialismus propagierte. Dadurch war er noch mehr in Gegnerschaft zu Hitler geraten und hatte nach Prag emigrieren müssen.
Einen Brief an Strasser hatte er, Pooper, deswegen vor seiner Abfahrt einem Kollegen zur Weiterleitung übergeben. Dass der das allerdings erst nach der Machtergreifung Hitlers in die Wege geleitet hatte und der Brief dann an der Grenze von der Gestapo abgefangen worden war, das hatte er zum damaligen Zeitpunkt ja nicht ahnen können! „Die schwarze Front“ wurde nach der Machtergreifung auch als allererste Gruppierung verboten – angeblich noch vor den Kommunisten und der SPD.
Jetzt – 12 Jahre später - lag Deutschland in Trümmern und der Feind stand überall innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches! Und zusätzlich standen er selbst und seine Frau unter der Aufsicht der Gestapo!
Seine Gedanken schweiften noch weiter zurück … nach Magdeburg, seiner Geburtsstadt.
Sein Leben war so ganz anders verlaufen, als er sich das ausgemalt hatte – damals, nach seinem ersten Examen in Tübingen. Auf Bestreben seiner Mutter hatte er dort Theologie studiert.
Als Examensbestem war ihm als besondere Auszeichnung gestattet worden, seine erste Predigt nach Studienende in der Stiftskirche zu Tübingen zu halten.
„Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich werde euch erquicken.“
Matth.11,28
So war sein Thema damals gewesen.
Genau konnte er sich an seinen Predigttext erinnern.
Student der Theologie Ludwig Deppe
Wie ernst war es ihm doch gewesen mit der Realisierung dieser Hilfe für die Menschen! Aber Worte allein – so musste er erkennen – waren hohl und leer!
Wie anders sähe es aber aus und um wie Vieles wahrhaftiger sei er selbst dann, wenn er solchen Worten auch Konkretes folgen ließe! Als Pfarrer auf einer Kanzel erschien ihm das sehr weit hergeholt und nahezu unmöglich.
Da müssten richtige Taten her!
Die würden irgendwann auch ein Ergebnis bei den Menschen zeigen. Genau dazu hatte er sich dann auch entschlossen!
Ein Studium der Medizin würde ihn - seiner Meinung nach - wesentlich besser dazu befähigen als jene von der Mutter gewünschte Tätigkeit als Theologe.
Seine Schwestern hatten sein Engagement verstanden und seine Entscheidung nachvollziehen können. Schließlich waren sie selbst als Diakonissinnen und Kinderheim-Leiterin mit diesem Gedankengut vertraut.
Ludwig Deppe ca. 1910 mit seinen Schwestern
Doch Unterstützung von Seiten der Eltern, die er so erhofft hatte, gab es nicht mehr. Vier Kindern eine geordnete Zukunft zu ermöglichen, war für jene genug gewesen. Außerdem war es schließlich seine eigene persönliche Entscheidung, die von den Eltern ausgewählte Richtung nicht weiter zu verfolgen.
Er dachte an seinen Vater Otto Deppe. Der Beruf als Kunstschlosser hatte jenem immer genügt. Nie hatte der etwas anderes sein wollen.
Innungsmeister Otto Deppe und Gemahlin
Auch im Reichstag hatte er gesessen und Bismarck selbst habe angeblich zu ihm gesagt, er wolle ihn im Sitzungssaal an seiner Seite platziert haben, damit „wenigstens ein einziger ehrlicher und nicht korrumpierbarer Mann neben ihm sitze“ - so jedenfalls die Überlieferung in der Familie.
Dem entsprechend war er auch erzogen worden. Ehrlich und treu zu seinem Wort zu stehen – das sei die Hauptsache, hatte sein Vater immer gesagt. Und man solle immer auch ein Auge auf die haben, die nicht so könnten wie man selbst – getreu dem Bürger-Eid, den sein Großvater Friedrich Wilhelm August Deppe am 26.10.1816 bei der Verleihung der Bürgerrechte von Magdeburg hatte leisten müssen.
Eine Geisteshaltung, die in der gesamten Familie vorherrschte - für ihn nichts Besonderes.
Das sei das „Hugenottische“ in der Familie, wurde er immer belehrt.
Angeblich sei der Name Deppe ein eingedeutschtes „ d` e´pe´e “ einer hugenottischen Familie, die damals aus dem Französischen vertrieben worden sei. Früher habe es auch noch eine große hölzerne Truhe mit einem Wappen und gekreuzten Schwertern auf der Vorderseite gegeben. Jetzt aber sei diese irgendwie verschwunden. So jedenfalls wurden die Geschichten innerhalb der Familie immer wieder erzählt.
Diesen Erziehungsrichtlinien folgend hatte er beschlossen, es nicht bei bloßen Worten zu belassen. Was wäre einem als Pfarrer anderes übrig geblieben ? Die Durchführung dieser Vision musste tatkräftig von ihm selbst angegangen werden.
Also hatte er zum Entsetzen seiner Eltern den Talar an den Nagel gehängt, sich aufgemacht und - auch dank des guten Leumunds seines Vaters – einen Bankkredit aufgenommen, um die erneuten Studienkosten aufzufangen. Denn das Preisgeld allein, das für das beste Theologie-Examen ausgesetzt gewesen war, hätte trotz aller Sparsamkeit nicht sehr lange vorgehalten.
Jetzt hatte er ein anderes Ziel vor Augen !
Gab es nicht viele Menschen auf der Welt, denen geholfen werden konnte mit den Errungenschaften der Medizin?
Medizinstudent Ludwig Deppe im sogenannten Wichs, der Korps-Uniform einer studentischen Verbindung
Waren speziell die Kolonien nicht voll von solchen armen, nach Hilfe lechzenden Menschen? Die Artikel in den Zeitungen und Journalen berichteten immer von den schlechten Zuständen, in denen diese Menschen leben mussten.
Damals war sein Interesse für „das Koloniale“ entstanden (so hatte man es damals genannt). Alle Nachrichten und Berichte über die neuen deutschen Kolonien, über das Leben der Menschen dort, über die so fremde Tier-und Pflanzenwelt waren bei ihm auf fruchtbaren Boden gefallen. Damit war er nicht alleine: dieses Interesse war im gesamten christlichen Abendland verbreitet. Und dann hatte auch der Kaiser geäußert, dass Deutschlands Zukunft auf dem Wasser und in den Kolonien, an der Sonne, läge. Natürlich hätte man sich auch alleine auf den Handel mit jenen Völkern beschränken können. Aber es ging ja wohl auch um die Konkurrenz mit England mit all seinen Kolonien.
Vor allem aber konnte man den Menschen dort helfen! Das war seine ureigenste Meinung.
A propos „helfen“ – er selbst brauchte jetzt auch etwas Hilfe.
„Lotte !“ ,
Seine einst kräftige Stimme war doch schon um einiges schwächer geworden.
„Lotte!“
Seine Frau Charlotte öffnete die Tür.
„Bring mir bitte noch etwas Papier und ein neues Kohlepapier für die Schreibmaschine. Ich will Herrn Hiller noch einen Brief schreiben. Kürzlich habe ich vergessen, ihm bei seinem Besuch die Namen der mir bekannten Leute von Ostafrika mitzugeben.“
Mühsam erhob er sich aus dem Bett, zog den Morgenmantel an, setzte sich an den Schreibtisch und spannte zwei der neuen Papierbögen ein mit einem Kohlepapier dazwischen.
Beginnen wollte er mit den Leuten von der „Königsberg“.
Der leichte Kreuzer „Königsberg“ hatte zu Beginn
des 1. Weltkrieges in Tanga in Ostafrika gelegen.
Leichter Kreuzer Königsberg
© Bundesarchiv Bild 105-DOA3002
Nach langen Kämpfen mit starken englischen Schiffsverbänden hatte sie sich in einem Versteck im Rufidji-Delta verborgen. Durch englische Flugzeuge entdeckt war sie schließlich trotz heftiger Gegenwehr so sehr durch Artilleriebeschuss beschädigt worden, dass die Besatzung sie hatte selbst versenken müssen.
Die noch verwendungsfähigen Kanonen hatte man allerdings von dem bei Ebbe aus dem Wasser ragenden Wrack abbauen und auf Lafetten (= Radgestelle) setzen können.
Transport eines der Geschütze von der „Königsberg“ zur Schutztruppe nach der Demontage im Rufidji-Delta
© Bundesarchiv Bild-134-CO318
Die gesamte Mannschaft hatte sich mit diesen Waffen der Schutztruppe der Kolonie angeschlossen. Von ihnen hatte er diese Geschichte später erfahren können.
So war die Truppe maximal verstärkt worden, als die Engländer Deutsch - Ostafrika angegriffen und sie dann jahrelang vergeblich durch halb Afrika gejagt hatten.
Er suchte in seinen Unterlagen.
Pooper murmelte vor sich hin.
„Irgendwo war doch noch dieses Foto von der Königsberg, das er sich damals vom Kolonialamt in Berlin hatte besorgen können!“
Das Bild, das er schließlich fand, war nicht von allerbester Qualität. Aber jetzt – in diesen Zeiten – war er froh, überhaupt noch an eines gekommen zu sein.
leichter Kreuzer „Königsberg“
© Bundesarchiv Bild 105-DOA5055
Dieser Hiller wollte noch einmal den ganzen Feldzug gegen die Engländer in Afrika 1914-1918 aufrollen. Da konnte er schon ganz gut auf seine Originalaufzeichnungen und sein Buch „Mit Lettow-Vorbeck durch Afrika“ zurückgreifen (General Lettow-Vorbeck, damals noch Oberstleutnant, führte den Feldzug in Afrika). Schließlich lag jetzt – zu Beginn des Jahres 1945 - jene Geschichte bereits einige Jahrzehnte zurück.
Er musste nur schnell machen, damit die blöden Ödeme sich nicht wieder in seinen Beinen ansammelten. Mit seiner Aszitis (Wasser in der Bauchhöhle ) hatte er schon genug Probleme, so dass seine Kollegin Dr.Gütt, eine Kommilitonin seines Sohnes Punker,ihm bisweilen dort so viel Flüssigkeit mit der Spritze abpunktieren musste, dass man fast einen ganzen Eimer füllen konnte.
Sein Gesundheitszustand war innerhalb der Familie in der letzten Zeit immer ein Sorgenpunkt gewesen. Seiner „Kleinen“, seiner Tochter Judith, hatte er nicht umsonst gezeigt, wie sie die im Regal stets bereitliegende Spritze mit Strophantin und Digitalis direkt in sein Herz stoßen sollte, wenn die Gestapo wieder käme, um ihn zu holen und zu foltern.
Aber noch war es nicht so weit!
Auch wenn der Gauleiter Mutschmann fast geifernd hinter ihm her war, um ihn endlich zur Strecke zu bringen, wie er sich ausgedrückt hatte. In einer stillen Stunde hatte er ihr berichtet, wie das bei der Gestapo so zugegangen war.
Die stundenlangen Verhöre hatte er immer im Stehen erdulden müssen - eine starke Lampe in sein Gesicht strahlend. Der Rest des Raumes hatte stets in Dunkelheit gelegen, so dass er seine Gegenüber nicht hatte erkennen können. Es waren keine Kriminalbeamten gewesen, sondern stets Leute von der NSDAP – zumindest den Worten nach, die sie ihm gegenüber äußerten.
Einmal habe er nicht mehr stehen können und sei auf dem Boden zusammengesunken. Da sei die Stimme des Verhörenden schneidend aus dem Dunkel gekommen, ein deutscher Mann habe aufrecht zu stehen und nicht wie ein Häuflein Elend am Boden zu kriechen. Aber wahrscheinlich sei er nur ein Wurm und eine völlig überflüssige Existenz, für die dieser Platz genau richtig sei.
So ähnlich habe sich auch der Gauleiter persönlich geäußert, als er am Anfang einmal bei einem Verhör dabei gewesen war.