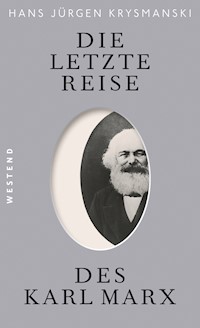14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Durchschnitt haben die reichsten 0,1 Prozent der Westeuropäer in den vergangenen fünfzehn Jahren ihr Vermögen schätzungsweise verdreifacht. Auch die laut Manager Magazin fünfhundert reichsten Deutschen sind in dieser Zeit reicher geworden. Eine vergleichsweise geringe Zahl von Individuen ist netzwerkartig über die ganze Erde verteilt. Sie haben als Geldgeber ungeheure, unkontrollierte Macht. Dieses Buch handelt vom obersten 0,1 Prozent der Westeuropäer, von den Superreichen. Alles Geld dieser Welt wird zu ihnen hin gezogen, wie in ein schwarzes Loch. Und Geld bedeutet Macht. Ultimative Geldmacht verändert ganz normale Ansichten, Lebensentwürfe und Verhaltensweisen zutiefst, denn Geldmacht ist eine imperiale Struktur. So werden Milliardäre, ob wir oder sie es wollen oder nicht, eine globale Klasse für sich. Das Schattenreich der Milliardäre ist kein absolutes Mysterium. Es gibt allerdings vieles, was wir darüber noch nicht wissen. Was bedeutet die Konzentration ultimativer Geldmacht? Wer sind diese Superreichen? Wie leben sie? Hans-Jürgen Krysmanski geht diesen und der alles entscheidenden Frage nach: Was macht unbegrenzter Reichtum aus den Superreichen, aus uns und unserem demokratischen Gemeinwesen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
HANS JÜRGEN KRYSMANSKI
0,1 PROZENT
DAS IMPERIUM
DER MILLIARDÄRE
ebook Edition
Nicht in allen Fällen konnten die Inhaber der Bildrechte ermittelt werden. Wir bitten gegebenenfalls um Hinweis an den Verlag.
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
komplett überarbeitete Neuausgabe
ISBN 978-3-86489-580-7 Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2015 Satz: Publikations Atelier, Dreieich Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany
Inhalt
Vorwort
Prolog: Eat the Rich (1999)
Ein bis zwei Prozent
Der Mythos der Titanen
Von der Nützlichkeit der Milliardäre
1 Ein weites Feld
Wem gehört die Welt?
Gibt es eine „globale herrschende Klasse“?
Eigentumsformen des Kapitals
Richistan
Ein bisschen Marx
Spielereien?
2 Die Aneignung Europas
Schamloser Reichtum
Geldmacht und Geldmachtkomplex
Ein neuer Souverän?
Das europäische Projekt
3 Das private Imperium
„An sich“ und „für sich“
Empire und Biopolitik
Plutokratie?
Nationalstaaten, Sozialdemokratie und John Galt
Corporate Power und die Davos-Klasse
4 Milliardäre
Berater
Sozialgeographisches
Kapitalisten?
Forbes versus Bloomberg
The Giving Pledge
Private Welten
Exkurs
Ein Oligarch bringt es auf den Punkt
5 Varianten des Kapitalismus
Milieuskizzen
Waffenmärkte
Finanzmärkte
Fredric Jameson liest Das Kapital
Planetarisierung
Nomadisierung
6 Können Milliardäre das Kapital überwinden?
Musterung der Kräfte
Mäzene, Think-Tanks, Stiftungen
Zwischen Refeudalisierung und Absurdistan
Singularitäten
Epilog: Avanti Dilettanti (2029)
Widersprüche
Über die Befreiung aller Planungsdaten
Abkürzungen
Anmerkungen
Personenregister
Vorwort
Als die Erstauflage dieses Buchs 2012 erschien, waren die extremen Unterschiede in der lokalen und globalen Vermögensverteilung bereits Thema einer breiten öffentlichen Diskussion. Im anwachsenden Datenstrom sind »Ungleichheit« und »Ungerechtigkeit« immer sichtbarer und das Verschwinden von Mittelschichten sowie die Verhinderung ihrer Herausbildung Faktum geworden. Inzwischen haben Bücher wie Chrystia Freelands Plutocrats und Thomas Pikettys Capital weitere Akzente gesetzt.1 Pikettys Sicht auf die Statistik einer zweihundertjährigen Reichtumsakkumulation erinnert daran, dass Ökonomie politisch und Politik ökonomisch ist. Dennoch hapert es (trotz Insiderinformationen, wie sie etwa Freeland bietet) bei uns allen an Wissen um die Handlungs- und Verhaltensweisen derjenigen, welche das Geschick auf die Spitze der Reichtumspyramide gespült hat. Sie »sind« wie wir, und sie sind es nicht. Wie bewegt sich diese zusammengewürfelte »globale Klasse«, welche Bewegungsmöglichkeiten stehen ihr offen?
Das vorliegende Buch entstand einerseits aus einem privaten Interesse an Macht- und Herrschaftsfragen, wie es in meiner Generation – und dann noch für einen Soziologen – ganz natürlich ist. Die Tradition des amerikanischen »Power Structure Research« lieferte Methoden, die Spaß machen und die etwas mit »Sociological Imagination« (C. Wright Mills) und »Cognitive Mapping« (Fredric Jameson) zu tun haben. Im Hintergrund ging es aber auch um die historische Entfaltung des »privaten Eigentums« an diesem Planeten, der doch uns allen gehört. Und es ging um »Big History«, um Grundstrukturen der Menschheits- und Naturgeschichte. Also: interessante, datierbare Details aus dem Leben der oberen Zehntausend einerseits und der Blick auf Weltepochen andererseits.
Bei all dem wird deutlich, dass es noch tausendfacher Forschungsanstrengungen bedarf, um unsere Epoche so transparent zu machen, dass eines Tages Verhältnisse entstehen, in denen »die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist« (Kommunistisches Manifest, 1848). Der Superreichtum einiger weniger Individuen übrigens ist der exakte historische Gegenpol zu dieser Utopie.
Immer häufiger ist von »Oligarchen« die Rede. Thomas Piketty spricht vom »drift towards oligarchy« weltweit. Paul Krugman kämpft in der New York Times gegen »the rule of oligarchs« im eigenen Land. Mit solchen Akzentverschiebungen in Richtung Plutokratie (Freeland) geht auch eine Krise der geopolitischen Routinen einher. Auf der Weltbühne agieren auf einmal – neben den traditionellen staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen – die seltsamsten Figuren und Konfigurationen: geldmächtige Individuen, milliardenschwere Technikgurus und »Philanthropen«, sich verselbständigende Geheimdienste, Warlords mit Krawatte, Gotteskrieger mit Schweizer Bankkonten. Was sollen wir mit denen anfangen?
Die politische Klasse macht den Eindruck, als blicke sie nicht mehr durch. Demokratie ist käuflich geworden. In den USA schicken Cliquen von Superreichen vierzigtausend Lobbyisten nach Washington und in die Think Tanks, während »das Volk« es gerade mal auf sechshundert Abgeordnete bringt. Von der Wahlkampffinanzierung ganz zu schweigen. Staatliche Regulierungsbehörden dämmern dahin. Gewaltenteilung wird durch Korruption zur Farce.
Für das alles ist Privatisierung das Schlüsselwort, von der Privatisierung des Krieges bis zur Privatisierung der Kunst. Vor den schönsten Flecken unseres Planeten stehen die Schilder »Privat – betreten verboten«. Wenige tausend Personen verfügen über jeweils mehr als eine Milliarde (und bis zu sechzig Milliarden) Dollar Privatvermögen. Umgeben sind sie von ein paar hunderttausend hochspezialisierten Helfern (vom Vermögensverwalter bis zum Bodyguard) und von den zehn Millionen Millionären dieses Planeten.
Privateigentum dieser Größenordnung kann durch keine Rechtsoder Völkerrechtsordnung mehr eingebunden werden. Bei allen konstruktiven Möglichkeiten, die es birgt, wirkt diese Form privatisierter gesellschaftlicher Macht letztendlich destruktiv. Denn in dieser Welt der Milliardäre und Oligarchen gibt es globale Interessengegensätze und Konkurrenzen, die mit allen, aber auch allen Mitteln ausgetragen werden. Diese Konflikte erzeugen das eigentliche Milieu des unbeschränkten Privateigentums: das ökonomische und politische Chaos. Zugleich signalisiert diese Chaotisierung das Ende des Privateigentums, wie wir es kannten. Der Kapitalismus geht über in einen Transkapitalismus mit neofeudalen Strukturen.
Die alten Formeln »Expropriiert die Expropriateure!« oder auch »Eignet Euch die Aneigner an!« müssen mit neuem Leben erfüllt werden. Dabei geht es nicht nur um den Besitz von Geld, Grund und Boden, sondern auch um den Besitz von Wissen (jenem Gut, das sich als einziges durch Gebrauch vermehrt) – und zwar von wissenschaftlichtechnischem Wissen. »Wir haben eine wissenschaftlich-technische Gesellschaft geschaffen«, sagte Carl Sagan 1996 in seinem letzten Interview, »in der niemand wirklich etwas von Wissenschaft und Technik versteht. Dieses Gemisch aus Ignoranz und Macht wird uns irgendwann ins Gesicht explodieren. Ich frage mich, wer über Wissenschaft und Technik in einer Demokratie bestimmt, wenn das Volk keine Ahnung von diesen Dingen hat.«2 Es geht also auch darum, alle wissenschaftlich-technischen Kenntnisse und Daten, die sich der Machtausübung und Rendite wegen in privaten Denkfabriken und in den Planungsstäben des großen Geldes konzentrieren, öffentlich zugänglich zu machen – sie zu »enteignen«.
Was die Zahlenangaben im folgenden Text angeht, so stammen sie aus eben jenem chaotischen Datenuniversum. Die Dinge sind im Fluss. Und so ist auch dieses Buch Teil eines offenen Projekts, keine abgeschlossene Analyse oder gar ein fertiges Theoriestück.
Hamburg/Münster, Oktober 2014
Prolog: Eat the Rich (1999)
Es war kaum vermeidbar, an den Anfang dieses Buchs als historische Momentaufnahme den unveränderten Text eines Vortrags zu setzen, den ich im November 1999 an der Universität Münster im Rahmen einer Veranstaltungsreihe »Test the West: Amerika, du hast es besser?« gehalten habe.1
Im letzten Urlaub war ich in der Haute Provence und wagte mich auch einmal hinunter in das Gewimmel der Côte d'Azur. Aus rein soziologischem Interesse nahm ich die Staus auf mich, um nach St. Tro-pez und in eins der Cafes am dortigen Hafen zu gelangen. Vor mir lagen – Sie kennen das – die Megayachten, wie immer mit dem Heck zur Mole. Eine dieser riesigen Yachten hieß »Battered Bull«, unter der Flagge der karibischen Cayman Islands. Diese winzige Inselgruppe ist eines der größten Finanzzentren der Welt, mit 560 Banken, die sechzig verschiedene Länder repräsentieren. Ein exklusives Spekulationsparadies für reiche Amerikaner. Der Name der Megayacht, Battered Bull, bezog sich auf das Symboltier für einen »bulligen« Aktienmarkt, auf den Stier also, und auf die Tatsache, dass der manchmal Prügel bezieht. Keine Frage: ein Hinweis auf gewisse Erfahrungen des amerikanischen Eignerpaars. Fast unbemerkt verließen die beiden später die Yacht: Mitvierziger, ein unauffälliges Touristenpaar wie tausend andere an diesem Augustnachmittag in St. Tropez.
Doch »mehr sein als scheinen« erhält hier eine neue Bedeutung. Die Battered Bull ist 170 Fuß lang, rund 53 Meter. Bei ihrem Bau vor vier Jahren kostete die Yacht vierzig Millionen Dollar. Allein fünf Millionen Dollar davon entfielen auf die perfekte, perlweiße Lackierung. Sie fährt mit einer zwölfköpfigen Crew durch die Weltmeere. Bei Reisegeschwindigkeit werden pro Stunde 500 Liter Dieselöl verbraucht. Die jährliche Versicherungssumme bei Lloyds, London, beträgt 1,5 Millionen Dollar. Der Liegeplatz in St. Tropez kostet pro Tag 11 000 Dollar. Summa summarum gibt das nette Paar jährlich rund sieben Millionen Dollar an reinen Betriebskosten (ohne Abschreibung) für dieses Vergnügen aus.
Die Eigner dieser Superschiffe umgibt äußerste Diskretion. Doch kann man zum Beispiel die Reisen von Battered Bull im Internet verfolgen. Das Eignerpaar hat dort ein elektronisches Album seiner globalen Reiseeindrücke angelegt – fast wie ganz normale Touristen. Aber eben nur fast. Denn letztlich sind sie nur eines: alles das, was normale Touristen nicht sind.
Die Beobachtungen in St. Tropez haben einen interessanten Hintergrund. Wenn es eine wachsende Industrie gibt, so ist es der Bau von ozeantüchtigen Megamotoryachten ab 35 Meter Länge und ab zwanzig Millionen D-Mark Neupreis. Selbst Werften, die bisher Kriegsfregatten bauten, entdecken diesen lukrativen Geschäftszweig. Dieser ganz besondere Bauboom hat seine Auswirkungen bis nach Senden bei Münster. Münsteraner erinnern sich an die Pleite eines besonders edlen Möbelhauses auf der Rothenburg. Inzwischen gehört der einstige Inhaber Rolf Rincklake van Endert mit seiner Firma Metrica zu den international gefragtesten Innenausstattern von Megayachten.
Diese Bewegungen zu Wasser sind durch die modernen Kommunikationstechnologien möglich geworden. Es ist kein Problem mehr, aus der Mitte des Pazifiks Konzerne zu leiten und Finanztransaktionen durchzuführen. Doch auch zu Lande und in der Immobilität bildet die Schere zwischen Reichtum und Armut sich traditionellerweise anschaulich ab – und nirgendwo so deutlich wie in New York. Die Geschichte der Apartmenthäuser in Manhattan ist ein offenes Buch über Amerikas Milliardäre. Als zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die ersten Wohnwolkenkratzer um den Central Park herum wuchsen, stellten die Reichsten exakte Kopien ihrer Landhäuser mehrstöckig auf deren Spitze. Das waren Penthouses!
Und heute? Das neueste Hochhaus mit Eigentumswohnungen findet sich unter der Adresse 515 Park Ave, Ecke 60. Straße. Kein Name steht dran, kein Majestic, Beresford oder Dakota. Aber Apartments gibt es dort: zum Beispiel 2 000 Quadratmeter über zwei Stockwerke verteilt, zum Preis von zwölf Millionen Dollar. Für das Dienstpersonal noch eine Extrawohnung im zweiten Stock, 200 Quadratmeter für 400 000 Dollar. Und das alles ist noch nichts im Vergleich zu Bill Gates’ Lakeside Xanadu bei Seattle, das sogar William Randolph Hearsts San Simeon Castle in den Schatten stellt.
Ein bis zwei Prozent
Wie definieren wir Reichtum? Ferdinand Lundberg unterscheidet in einem berühmten Buch aus den sechziger Jahren zwischen den Reichen und den Superreichen.2 Er sagt: Die Reichen mögen zwar über sehr viel (und oft schnell erworbenes) Geld verfügen. Sie leben aber immer noch in der Gefahr, alles oder einen großen Teil ihres Vermögens plötzlich wieder zu verlieren. Man denke nur an das Auf und Ab des Donald Trump, dem derzeit die spektakulärsten Hochbauten Manhattans gehören.
Die Superreichen dagegen, so Lundberg, können absolut ruhig schlafen. Ihre Vermögen sind so riesig, so weit verzweigt, so gut platziert, auch so gut versteckt, dass dieser Planet schon zerplatzen müsste, damit auch sie nur noch im Hemd dastünden. Um diese Superreichen geht es, um »The Billionaires«.
Das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb vor kurzem: »Die herrschende Schicht ist einem apokryphen Wort zufolge diejenige, deren Soziologie niemand zu schreiben wagt.«3 Als Soziologe muss ich bekennen: Das stimmt. Die Sozialwissenschaften – von der Soziologie, Ökonomie, Politologie bis zur empirischen Sozialforschung – haben sich ihre Daseinsberechtigung auch dadurch erworben, dass sie die Schicht der Superreichen aus der sozialen Wirklichkeit hinausdefiniert und hinausgerechnet haben. Oder wie ist die folgende Geschichte zu verstehen?
In den Vereinigten Staaten vereinen die obersten fünf Prozent der Bevölkerung sechzig Prozent des nationalen Reichtums auf sich. Damit aber nicht genug. Das oberste eine Prozent ist in den letzten Jahren noch einmal dramatisch reicher geworden als die folgenden vier Prozent. Und die obersten 0,25 Prozent dieses einen Prozents schließlich heben noch schneller ab als die folgenden 0,75 Prozent.
In den offiziellen statistischen Berichten zur Einkommensverteilung aber tauchen diese fünf Prozent – oder gar das eine Prozent -überhaupt nicht auf. Sie scheinen nicht zu existieren. Zwar berichtete das United States Census Bureau im Dezember 1997, dass in den letzten zwanzig Jahren die wohlhabendsten zwanzig Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung ihre Realeinkommen um dreißig Prozent gesteigert hätten. Ihr Einkommen (durchschnittlich 117 500 Dollar jährlich) sei damit dreizehnmal höher als das der ärmsten zwanzig Prozent (9 250 Dollar jährlich).
Aber: Wo sind die Superreichen? Auf Anfragen einiger Journalisten räumte das United States Census Bureau ein, dass niemals jemand befragt worden sei, der mehr als 300 000 Dollar im Jahr verdient. Das lag daran, gestand man kleinlaut, dass ein Jahreseinkommen von 300 000 Dollar die größte Ziffer war, welche die Computer der Behörde überhaupt erfassen konnten. Selbst als dieses Limit im letzten Jahr auf eine Million angehoben wurde, fielen die 190 Milliardäre und die 4 000 Multimillionäre mit Vermögen über 300 Millionen Dollar (um nur die zu nennen) aus der Statistik heraus.
Würde man Spielbauklötze aufeinanderstapeln, von denen jeder tausend Dollar Einkommen beziehungsweise Vermögen symbolisiert, so müssten sich 98 Prozent der Amerikaner mit Stapeln begnügen, die im besten Falle ein paar Meter hoch wären. Ein Prozent der Amerikaner aber hätte Stapel, die jeweils um ein Mehrfaches höher als der Eiffelturm wären.
Der Mythos der Titanen
Als Geneva Overholser vor kurzem in der International Herald Tribune aufmerksam machte auf die überzogenen Bezüge der »Business Titans«, also auf die Bezüge der (unterhalb der Superreichen angesiedelten) Schicht der Chief Executive Officers (CEOs/Vor-standsvorsitzende), gingen so viele entrüstete Leserbriefe ein wie noch nie. 419-mal mehr als seine Arbeiter verdient inzwischen im Durchschnitt der CEO eines großen amerikanischen Konzerns: 10,7 Millionen Dollar jährlich. Sein Gehalt stieg 1998 um 36 Prozent, der Lohn eines Facharbeiters um 2,7 Prozent. Dennoch giftet zum Beispiel einer der Leserbriefe: »Ich bin mir sicher, dass die Ansprüche, die auf dem CEO eines großen Konzerns lasten, von Ihresgleichen überhaupt nicht begriffen werden können. Manche Menschen sind eben in der Lage, enorm viel mehr Verantwortung zu tragen als andere.« Untersuchungen beweisen dagegen, dass Höhe der CEO-Gehälter und Erfolg ihrer Konzerne eher negativ miteinander korrelieren.
Noch anders steht es um die Superreichen, also die Schicht oberhalb der CEOs. In dieser Schicht erst landen ja die wirklichen Konzerngewinne. Statistisch mögen die Milliardäre sich einnebeln; als mythische Gestalten aber sind sie in der amerikanischen und globalen Medienlandschaft omnipräsent. Time Magazine nennt sie »Builders & Titans«, die Erbauer und Titanen des zwanzigsten Jahrhunderts, die uns »aus dem industriellen Zeitalter ins digitale Zeitalter katapultiert« haben. Allen sei eines gemeinsam: ihre Obsession mit der Schaffung von Reichtum. Räuberisch – rapacious – seien sie gewesen, allesamt. Aber: Diese geldbesessenen Individuen hätten auch jene »gewaltige Maschine in Gang gesetzt, welche die USA zur führenden Industriegesellschaft der Welt« machte. Sie die alleinigen Macher? »Wer baute das siebentorige Theben?«, schreibt Bertold Brecht. »So viele Berichte. So viele Fragen.« Die Berichte erzählen zunächst einmal von den großen Räuberbaronen der vorletzten Jahrhundertwende, von John D. Rockefeller, Andrew Carnegie und J. Pierpont Morgan.
Rockefellers Standard Oil kontrollierte um 1900 neunzig Prozent des amerikanischen Öls und war der erste multinationale Konzern überhaupt. Rockefeller machte heimliche Deals mit den Eisenbahnen, bestach Senatoren und betrieb Industriespionage. Seine Schläger nahmen sich der Gewerkschaften an. Am Ende war Rockefeller, umgerechnet, fast dreimal so reich wie Bill Gates heute.
Carnegie machte sein Vermögen mit Öl, Bessemer-Stahl und Eisenbahnschienen. Seine Devise: »Put all your eggs in one basket and then watch that basket.« Er schrieb Bücher voller naiven Fortschrittsglaubens. Seine Stahlarbeiter mussten zwölf Stunden arbeiten. Mit seinem Namen ist die blutigste Streikunterdrückung der amerikanischen Geschichte, 1892 in Homestead, Pennsylvania, verbunden. Doch nach dem Verkauf seines Imperiums wurde Carnegie der erste große Philanthrop, gründete weltweit 2 800 Bibliotheken und stand am Anfang der Entwicklung eines mächtigen Konzernstiftungswesens.
J. P. Morgan schließlich begründete die amerikanische Bankenmacht. Er trieb Eisenbahnaktien auf die gleiche Weise hoch wie heute die Hedge-Fonds Software-Aktien. An faire Konkurrenz glaubte er nicht. Schon damals gerieten die größten Industriekonzerne der USA unter die Kontrolle von Wall Street.
Die Titanengalerie hat noch viele Namen. Henry Ford erfand das Fließband und den gut bezahlten Fabrikarbeiter, der sich die von ihm gebauten Autos der T-Modelle auch leisten können sollte. Ford richtete aber auch ein »Sociological Department« ein, um den Schnapskonsum seiner Arbeiter zu kontrollieren und die Gewerkschaften zu bekämpfen. Er hatte Sympathien für Adolf Hitler. Doch der Autokrat Ford war Mitte der dreißiger Jahre schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Überhaupt: Franklin D. Roosevelts »New Deal« brachte Unbill für Milliardäre. Ihr proportionaler Anteil an der Bevölkerung ging zurück, um erst unter Ronald Reagan wieder dramatisch anzusteigen.
Das meiste Geld wurde inzwischen nicht mehr mit Stahl, nicht einmal mehr mit Chemie und Aluminium, sondern mit Produkten aus dem Äther gemacht. David Sarnoff legte mit seinem Radioimperium »Radio Corporation of America« (RCA) die Grundlagen des massenmedialen Goldrauschs. Die neuen Medien brachten den Mythos der »Builders & Titans« direkt in die Wohnzimmer der Massen. Die Reichen und Superreichen waren auf einmal sofa-nah. Die unerreichbare Ferne schien überspielt. Und hochbezahlte Stars aus den Filmfabriken Hollywoods, die selber wie Fließbandarbeiter arbeiten mussten, wurden Identifikationsfiguren für Träume von einem reichen Leben, an dem sie selbst nur tragisch beschränkt – als Mätressen oder Gigolos – teilnahmen.
Nur ein paar Titanennamen noch. Charles Merril predigte auf Messen und in Einkaufszentren die Botschaft vom Aktienbesitz für kleine Leute und machte Amerika zur »Shareholder Nation«. Stephen Bechtel baute in den dreißiger Jahren die Hoover-Talsperre, legte nach dem Zweiten Weltkrieg die Pipelines in Saudi-Arabien und errichtete 1951 das erste Atomkraftwerk. Die Bechtel-Corporation wurde zum Synonym für amerikanische Baustellen überall auf der Welt. Walt Disney schuf nicht nur Dagobert Duck. Lucky Luciano war der erste Gangster-Milliardär. William Levitt erfand die Massenproduktion von billigen Reihenhäusern und machte so die amerikanischen Suburbs möglich. Leo Burnett brachte Werbeindustrie und Fernsehen zusammen. Aus Thomas Watsons Büromaschinenfabrik wurde der erste Computergigant, IBM (International Business Machines Corporation). Und Ray Kroc, der die Würstchenbude der Brüder McDonald in ein Fastfood-Imperium verwandelte, wirft mit seinem Business-Credo noch einmal ein Schlaglicht auf das Motto dieses Textes: Eat the Rich. Was sagte er über die Konkurrenz? »This is rat eat rat, dog eat dog. I'll kill 'em, and I'm going to kill 'em before they kill me.«
Über den Reichsten unter den Reichen der Gegenwart, über den virtuellen Räuberbaron der Jahrtausendwende, Bill Gates, kann ich aus Zeitgründen nur wenig sagen. Vielleicht nur, dass auch dieser Titan Ray Krocs Credo beherzigt. »Er ist unermüdlich, ein Darwinist. Erfolg heißt für ihn Plattmachen der Konkurrenz«, schreibt Bob Glaser, ein früherer enger Mitarbeiter von Gates. Da ist es nur eine Fußnote, dass ungefähr ein Viertel der 33 000 Microsoft-Beschäftigten inzwischen Millionäre sind. Was ist heutzutage schon ein Millionär? Oder dass es im Internet eine Seite gibt, Bill Gates’ Wealth Watch Clock, auf der abzulesen ist, dass er auf jeden Fall reicher als ganz Mittelamerika bleibt?
Entscheidend sind die ökonomischen, sozialen und politischen Hintergründe solchen Reichtums. Mit dem Ende des Kalten Kriegs wurden die einst den Militärs und Geheimdiensten vorbehaltenen Informations- und Kommunikationstechnologien zum lukrativsten Geschäftsfeld. Dies wiederum ermöglichte die ungehemmte Explosion der globalen Finanzmärkte. Und dadurch wurden nationale Grenzen irrelevant. Über dieses globale Niemandsland beginnt nun der E-Commerce zu rasen.
Zu allem Überfluss reißt die neue elektronische Technologie auch die Grenzen zwischen den Sphären des Privaten und des Öffentlichen nieder. Private E-Mail ist ein Widerspruch in sich. Nichts mehr ist nicht öffentlich, aber zugleich kann auch alles privatisiert werden. Und niemand verdient an diesem in aller Öffentlichkeit stattfindenden allgemeinen Privatisierungsprozess mehr als die letzten Privatmenschen, die Milliardäre.
Der Mythos von den Segnungen der Schaffung privaten Reichtums ist durch die Bewusstseinsindustrie zu einer fast unwiderstehlichen materiellen Gewalt geworden. Erliegen wir dieser Obsession inzwischen nicht alle? Höchstens unsere Mitbürger aus den neuen Bundesländern erschrecken noch darüber, dass Geld tatsächlich die Welt regiert.
Von der Nützlichkeit der Milliardäre
Doch gerade den Milliardären war ihr eigener Mythos nie ganz geheuer. So kam die moderne, milliardenschwere Philanthropie in die Welt. Ted Turner, Miteigentümer von CNN und Time Warner, hat 1998 sogar den Vereinten Nationen eine Milliarde Dollar in Gestalt einer Stiftung zukommen lassen. Nicht uneigennützig. Immerhin aber machte Turner, dem seine Frau Jane Fonda4 vielleicht manches aus der Flower-Power-Zeit zuflüsterte, schon vor einiger Zeit auf Folgendes aufmerksam. Den meisten Milliardären, schrieb er, bedeute die Rangliste der Reichsten auf dieser Welt, die das Forbes-Magazin regelmäßig veröffentlicht, sehr viel. Mehr wahrscheinlich als den Tennisspitzenspielern ihre Computerliste. Man tut alles, um oben zu bleiben. Also raffen die Milliardäre und raffen und behalten ihre Eier im Korb. Dieser Listenplatz-Ehrgeiz mindere dann aber auch massiv die Bereitschaft, beklagt Turner, Stiftungen zu gründen oder auf andere Weise zum Gemeinwohl beizutragen. Turner schlug deshalb eine neuartige Rangliste vor, eine Rangliste der frei-giebigsten Philanthropen auf dieser Welt. Gäbe es eine solche Liste, fügte Turner hinzu, wäre vielleicht auch Bill Gates schon spendierfreudiger.
Doch die Dinge werden fragwürdig, wenn durch Philanthropie direkte Eingriffe in Politik, Kultur und sogar Religion erfolgen. Dies aber geschieht in wachsendem Umfang. Oskar Lafontaine zitiert in seinem neuen Buch5 den amerikanischen Soziologen Norman Birnbaum: »Die internationale Elite der multinationalen Konzerne beherrscht nicht nur die Produktionsmittel, sondern inzwischen auch die Mittel zur politischen Willensbildung.«
Milliardäre bestimmen – mittels eines Geflechts von Stiftungen und Organisationen und durch die Informationsindustrie – das Bildungswesen ganzer Länder; ihnen gehören Privatuniversitäten, große Teile des Gesundheitswesens, die wichtigsten Zeitungs-, Fernseh- und Filmkonzerne. Sie verfügen über Privatarmeen. Wissenschaftliche Berater, Kunst- und Kulturstrategen, Politiker werden ohne große Umstände »eingekauft«. Ein amerikanischer Präsident ist wahrscheinlich billiger zu haben als eine ordentliche Siebzig-Meter-Luxusmotoryacht. Unter der Überschrift »Der gekaufte Präsident« schreibt die Süddeutsche Zeitung: »Es wäre naiv zu glauben, dass ein Kandidat oder eine Partei Millionen sammelt, um anschließend nur die eigenen Ideale und Programme zu verfechten … Ein Wahlkampf, der auf Dollar gebaut ist, lässt dem zukünftigen Präsidenten der USA gar keine andere Wahl, als sich letztlich erkenntlich zu zeigen.«6
So fragen wir zum Schluss: Wie nützlich sind Milliardäre? Haben sie eine legitime Rolle in der Welt? J. Bradford DeLong, ein amerikanischer Ökonom, der sich sehr nüchtern mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, kommt zu folgendem Schluss: »Wenn wir eine Lehre ziehen können, so diese: Es ist durchaus möglich, dass durch eine vernünftige Politik die Akkumulation exzessiven Reichtums eingedämmt wird. Wir alle haben es im Gefühl, dass eine extrem ungleiche Gesellschaft eine hässliche Gesellschaft ist. Mir persönlich ist zum Beispiel hinsichtlich der Verteilungsstruktur des Reichtums das Amerika des Jahres 1975 viel lieber als das heutige.«7
Nun, die Reichen sind – fast wie Aliens – seit Jahrtausenden unter uns. Und es waren ja nicht nur Religionsgründer, welche immer wieder die Frage gestellt haben, wie wir mit diesen »Außerirdischen« – die zum Beispiel auf Megayachten mit Namen wie Battered Bull die Weltmeere durchqueren – umgehen sollen. Vielleicht wollen sie, ganz wie ET, auch nur »nach Hause«. Wie können wir ihnen helfen? Kann man wirklich nur entweder Geld machen oder Mensch sein?
1 Ein weites Feld
»Trifft es zu, dass die Menschheit insolvent ist, weil sie über 50 000 Milliarden Dollar Schulden hat? Wissen Sie, bei wem die Menschheit diese Schulden hat?«(Ferdinand von Schirach)1
Vieles deutet darauf hin, dass die Epoche des Kapitals zu Ende geht. Dennoch suggeriert unsere individuelle Befindlichkeit noch immer: diese Produktionsweise wird ewig währen – auch wenn unsere Intelligenz uns sagt, dass dies die unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten ist. Es fällt heute noch immer leichter, den Zerfall des Planeten und seiner Natur zu imaginieren als den Zusammenbruch des Kapitalismus. Da kann doch etwas nicht stimmen. So stellen sich für die Sozialwissenschaften vor dem Hintergrund der neoliberalisti-schen Globalisierung, der Gefährdung der Biosphäre und der Gefahren und Versprechen der digitalen Revolution bestimmte Grundfragen neu. Man wird erstens nicht mehr um eine brutale, klare Fassung des Themas Macht und Herrschaft (mit Namensnennungen) herumkommen. Und will die Soziologie, wie andere Disziplinen auch, nicht nur Spielball gesellschaftlicher Kräfte sein, sondern – zumindest in bescheidenem Umfang – auch Akteur, so muss sie zweitens die eigene öffentliche Wirksamkeit bedenken und pflegen, was manche »soziologische Erzählkunst« nennen.2
Für mich stehen für diese beiden Aspekte – Macht und Narra-tion – die Begriffe »Power Elite« und »Sociological Imagination«. Sie sind mit dem Namen des 1961 jung verstorbenen amerikanischen Soziologen C. Wright Mills verbunden. Die deutsche Mainstream-Soziologie hat im Unterschied zur globalen Soziologengemeinde von C. Wright Mills nie etwas wissen wollen. Dabei stehen seine Bücher (1956) und (1959) weltweit noch immer auf den ersten Plätzen aller Rankinglisten soziologischer Literatur. Auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie des Jahres 2000 in Köln – Thema: »Gute Gesellschaft? Zur Konstruktion sozialer Ordnungen« – organisierte ich eine Ad-hoc-Gruppe >Zur Aktualität von C. Wright Mills<. Unsere Podiumsdiskussion war, abgesehen vom Eröffnungsplenum, die bei weitem bestbesuchte Veranstaltung des Kongresses. Ihr Thema lautete: (Carl Schmitt). Das Einleitungsreferat hielt Hermann L. Gremliza , Hamburg) unter dem Titel »Meine Freunde, die Milliardäre oder: Die Wirklichkeit ist ziemlich vulgärmarxistisch«. In den Medienberichten über den Soziologiekongress figurierte fast nur diese Podiumsveranstaltung, an der unter anderem die Professoren Heinz Hartmann (Münster), Todd Gitlin (New York), Hermann Korte (Hamburg) und Claus Noé, 1998/1999 Staatssekretär im Finanzministerium von Oskar Lafontaine, beteiligt waren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!