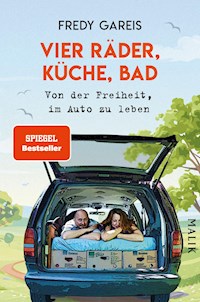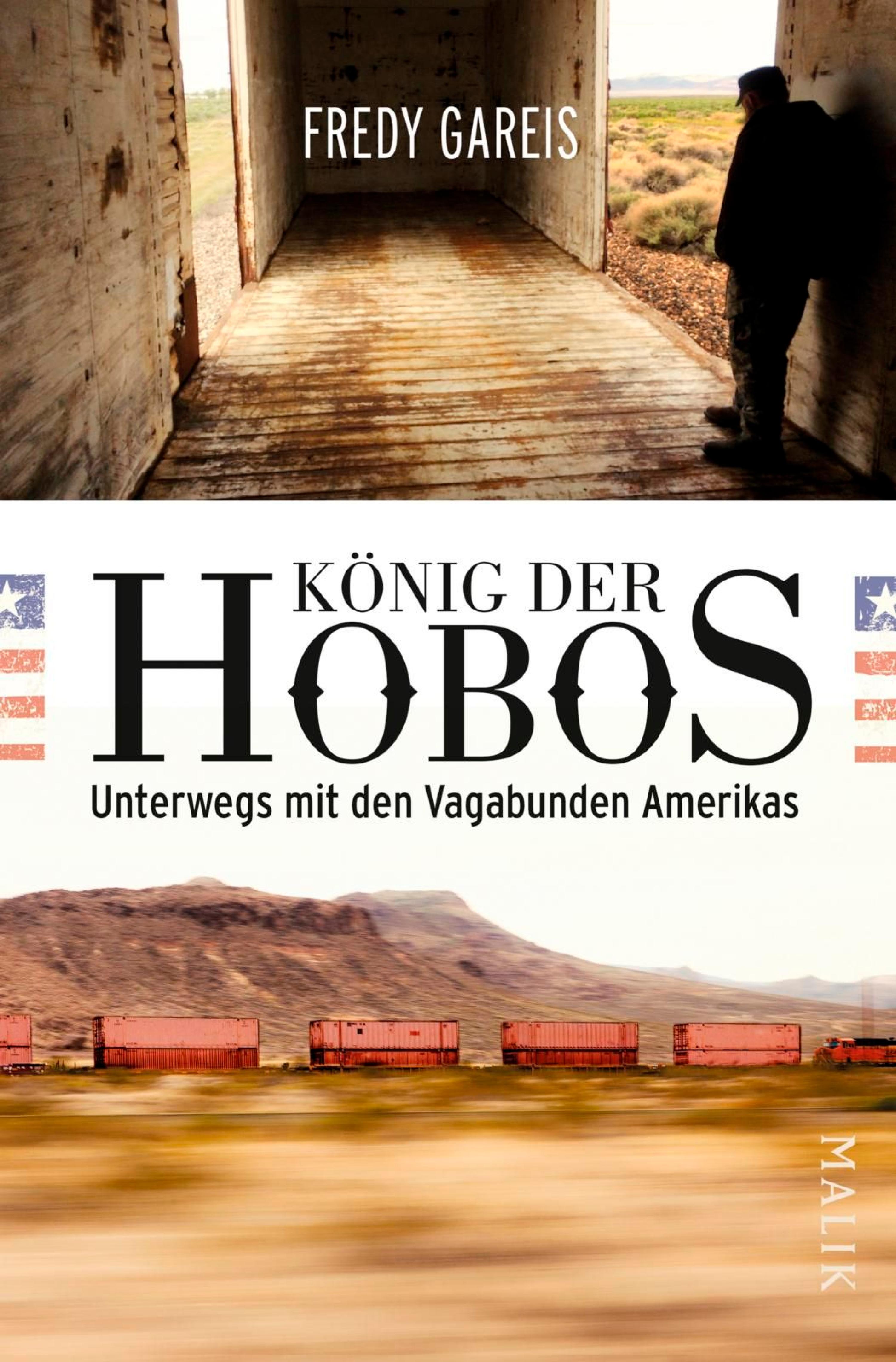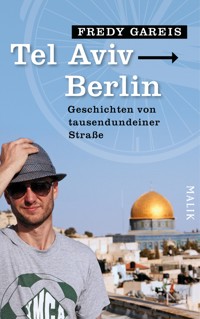9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was hat es mit dem geheimnisvollen Himbeersee auf sich, an dem seine Großmutter unter Stalin zehn Jahre in einem Straflager war? Wie kam es, dass seine Mutter den Geburtsort »Soda-Kombinat« im Pass trägt? Fredy Gareis wächst als Kind von Russlanddeutschen auf – mit vielen offenen Fragen, denn über das Schicksal seiner Familie wurde zu Hause nie gesprochen. Und so macht er sich mit 39 Jahren selbst auf, das Riesenland im Osten zu erkunden. Vier Monate fährt er mit einem alten Militärjeep quer durch Russland, wandelt auf den Spuren seiner Familie, setzt das Puzzle seiner Kindheit zusammen, übersteht Wodkaexzesse, macht hinreißende Zufallsbekanntschaften und versucht nebenbei zu ergründen, wie die Menschen im Land von Putin wirklich leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die im Buch dargestellten Erlebnisse, Dialoge und Personen basieren auf Erinnerungen und weichen an einigen Stellen gewollt oder ungewollt von der Realität ab. Namen und Merkmale einzelner Personen wurden zum Schutz ihrer Privatsphäre mitunter geändert.
Den Toten: Alice, Ottilie, Walja, Elvira, Leo, Ernst, Richard, Wilhelm, Theodor Den Lebenden: Lucie, Frieda, Lisa, Lora, Jascha Allen auf der Suche nach einem besseren Leben, allen auf der Suche nach Heimat
Mit 72
Fotos und einer Karte
ISBN 978-3-492-97119-5
September 2015 ©
Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015 Redaktion: Fabian Bergmann Fotos Bildteil/Umschlag: Fredy Gareis Fotos der Collage: privat Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de Karte: cartomedia, Karlsruhe Innenlayout: Denise Sterr Litho: Lorenz & Zeller, Inning a. A. Datenkonvertierung:
CPI
books GmbH, Leck
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht.
Im Uhrzeigersinn: Beerdigung meines Urgroßvaters in Sibirien. Wilhelm & Ottilie Zwicky. Ururgroßvater Theodor Zwicky. Meine Mutter und ich in Kasachstan. Kurz vor Ende der Sonderkommandantur. Onkel Leo. Meine Oma als junge Frau in der Nähe von Alma-Ata. Kinderglück. Großmutter und Mama.
Die russische Wirklichkeit ist ein erhabenes, universelles, geordnetes Chaos.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Ein Ende, ein Anfang
Mutter weint.
Wir stehen auf dem Parkplatz vor unserem Hochhaus; ihr Schluchzen ist das einzige Geräusch zwischen den Betonmauern der Sozialbauten. Es ist Samstagmorgen, fünf Uhr. Die Nacht verabschiedet sich, und der Tag bricht an.
»Fahr du, bitte«, sagt sie mit matter Stimme und drückt mir den Schlüssel in die Hand.
Ich starte den Motor und lenke den Wagen durch die Häuserreihen zum Autobahnanschluss Rüsselsheim-Mitte, fahre auf die Rampe und gebe Gas. »Nicht so schnell«, mahnt mich meine Mutter. Sie hat kein Interesse, allzu rasch ans Ziel zu kommen.
Über den Zuckerrübenfeldern der Riedlandschaft steigt langsam die Sonne auf und taucht alles in ein helles Orange. Der Himmel ist sattblau und wolkenlos. Wann habe ich meine Mutter zum letzten Mal weinen sehen?
Ein Opel Astra setzt zum Überholen an. Ohne Eile zieht er an uns vorbei. Ich schaue hinüber. Hinter den halb offenen Scheiben ein Pärchen: sie mit einer Zigarette in der Hand, er mit einem Hut auf dem Kopf. Beide lachen, auf dem Dach liegen zwei Surfbretter. Leise höre ich meine Mutter neben mir wieder schluchzen.
Wenige Autos auf der Straße. Man braucht schon einen guten Grund, um um fünf Uhr morgens an einem Samstag unterwegs zu sein: eine Geburt, eine Hochzeit, eine Familienfeier. Oder man fährt in den Urlaub.
Der Opel setzt sich vor uns auf die rechte Spur und fährt langsam davon. Ich lege meine rechte Hand auf Mutters Oberschenkel, aber sie nimmt sie nicht. Sie ist damit beschäftigt, sich die Tränen aus den Augen zu wischen.
Im Gegensatz zu den Distanzen, die meine Familie einst in Russland zurücklegen musste, sind die 65Kilometer zwischen Rüsselsheim und Mannheim ein Katzensprung. Jeden Sonntag sind wir diese Strecke gefahren, um Großmutter zu besuchen.
Wir passieren eine Fabrik zu unserer Rechten, aus deren Fassade sich eine Metalllippe hervorschiebt. Sie hat mich schon immer an ein trotziges Gesicht erinnert und gleichzeitig angekündigt, dass wir bald da sein würden. Gleich säße ich an Großmutters Tisch, vor mir einen Teller Borschtsch mit einer Haube Smetana, russischem Schmand, später würde ich im Wohnzimmer fernsehen, während sich die Verwandtschaft in der Küche verschanzte und sich mit klirrenden Wodkagläsern zuprostete.
Ich fahre von der Autobahn ab, vorbei an einem heruntergekommenen Bau, der früher als Lager für Russlanddeutsche diente, und parke im Stadtteil Rheinau direkt vor Großmutters Wohnung. Sie saß immer am Fenster und wartete auf uns, winkte, und ein Lächeln schlich über ihr Gesicht, während wir aus dem Auto stiegen.
Diesmal bewegen sich die Gardinen nicht.
Wortlos gehen wir auf das Haus zu. Mutter weint immer noch. Ich will sie in den Arm nehmen, aber sie läuft so schnell die Treppe hoch, dass ich kaum hinterherkomme. Sie stolpert durch die Tür, durch den kleinen Flur ins Schlafzimmer und fällt direkt vor Großmutters Bett auf die Knie.
Großmutter liegt auf dem Rücken, der Körper kerzengerade, die Hände über dem Bauch gefaltet, die Lippen schon blau.
Mutter greift nach diesen Händen, die vor Jahrzehnten im sibirischen Straflager mit Eisenstangen Soda gebrochen haben. Jetzt ist die Haut durchscheinend, von Äderchen durchzogen, dünn wie Pergament, und ich bilde mir ein, ein Knistern zu hören, als Mutter die starren Hände der Toten anhebt und an ihr Gesicht legt.
Oh Mamutschka… oh Mamutschka.
Ich muss an meinen Besuch bei meiner Großmutter vor ein paar Wochen denken. »Ich bin müde«, klagte sie, »ich will schon lange nicht mehr.« Ständig war sie krank, der Mann verstorben, die Verwandten wohnten weit weg. Vielleicht, dachte ich, fehlt ihr auch eine Aufgabe– so wie damals, als es darum ging, Stalin und Sibirien zu überleben und die Familie nach Deutschland zu bringen.
Ich lasse meine Mutter allein und gehe in die Küche, setze mich an den Tisch mit der dicken Plastikdecke, die an den Ecken mit Metallklemmen befestigt ist. Nie wieder wird meine Großmutter mir ein Stück Napoleontorte abschneiden, nie wieder werden wir gemeinsam Kaffee aus einer Untertasse schlürfen, nie wieder vor der kleinen Stereoanlage sitzen und den Schlagerklassiker von Dschinghis Khan schmettern: »Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand– Russland ist ein schönes Land, hahahaha!« Bald wird die Wohnung leer geräumt sein, und alles, was sich hier drin befindet, wird nur noch in meiner Erinnerung existieren. Dabei hätte ich noch so viele Fragen an meine Großmutter gehabt.
Ihre Stimme erfüllt meinen Kopf.
»Propaganda!«, schallte es aus der Küche. »Propaganda!« Und dabei knallte Großmutter ein Glas auf den Tisch– wahrscheinlich verschüttete sie Wodka; alles so laut, dass es bis ins Wohnzimmer zu hören war.
Den Rest konnte ich nicht verstehen, denn die anwesende Verwandtschaft unterhielt sich auf Russisch. Ich war zehn Jahre alt und selbst in der Sowjetunion geboren, aber zu der Welt hinter der Küchentür hatte ich keinen Zugang. Ich durfte noch dabei zuschauen, wie Großmutter mehrere Laibe Brot auf den Tisch legte, riesige Einmachgläser mit sauren Tomaten öffnete, geräucherten Hering aufschnitt, eine Schüssel mit Pelmeni, Teigtaschen, in die Mitte stellte und an jedes Tischende eine Flasche Wodka mit blauem Etikett. Doch dann hieß es für mich: ab ins Wohnzimmer! Die Diskussionen wurden immer hitziger– ich musste den Fernseher lauter stellen. Heute weiß ich: In der Küche war Russland oder, besser, die Sowjetunion. Da wurden die Erinnerungen an den Kommunismus wach, an die Straflager, an den Hunger. Ins Wohnzimmer verscheucht, saß dort die nächste Generation, die damit nichts mehr zu tun haben sollte.
»Was wir erlebt haben, soll dich nichts angehen«, sagte Großmutter immer. »Das hier ist ein anderes Leben. Wir haben all das durchgestanden, damit ihr es einmal besser habt.«
Meine Oma war 1976 über das Durchgangslager Friedland nach Mannheim ausgesiedelt, ein Jahr später folgte ihre Tochter mit mir. Mit dem Grenzübertritt wollte meine Mutter die Sowjetunion für immer hinter sich lassen. Sie passte sich an, wie man sich nur anpassen kann, wurde bisweilen deutscher als die Deutschen und weigerte sich, zu Hause Russisch zu reden.
Jahre später, als ich anfing, mich mit meiner Familienbiografie und damit mit Russland zu beschäftigen, fiel mir der Ausweis meiner Mutter in die Hände. Als Geburtsort steht da: »Soda-Kombinat, UDSSR«. Das Straflager, in dem Großmutter elf Jahre lang für Stalin schuften musste und schließlich ihre Tochter gebar. Mutter riss mir den Ausweis aus der Hand und sagte nur: »Das geht dich nichts an!«
Sie schämt sich bis heute für diesen Eintrag, für dieses bürokratische Überbleibsel aus der Ära Stalin, das sie bis an ihr Lebensende begleiten wird.
Erst in späteren Jahren begann Großmutter, mir am Küchentisch Geschichten zu erzählen– vom Werben der deutschstämmigen Zarin Katharina der Großen um Siedler vor allem aus der alten Heimat, vom langen Treck Zehntausender Deutscher, Schweizer und Elsässer in den Osten, vom Leben der Kolonisten an der Wolga und in Bessarabien, vom Straflager in Sibirien, aber auch von der Enttäuschung, dass sie in Deutschland nicht das Zuhause gefunden hatte, von dem sie in der fernen Weite der sibirischen Steppe geträumt hatte.
»Weißt du, Fredy, der Himmel hängt auch hier nicht voller Geigen. In Russland waren wir die Fritzen. In Deutschland sind wir die Russen. So richtig gehören wir nirgendwo dazu.«
Sie starb, wie alle Großmütter, viel zu früh.
Am Ende bleiben mir 600Euro in einem Umschlag, zwei Fotoalben mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Menschen, deren Namen ich nicht kenne und deren Vergangenheit mir fremd ist, zwei Ordner mit Unterlagen über die Umsiedlung, ein Adressbüchlein, ein maschinengeschriebener Lebenslauf, der 1976 schließt, als wäre der Neuanfang das Ende.
Ich blättere eine Weile durch die Unterlagen, diese Dokumente der Migration, der Enteignung und der Verfolgung, und erinnere mich gleichzeitig daran, wie sehr Großmutter die Seifenoper »Reich und Schön« liebte. Sie verpasste nie eine Folge. Dann gehe ich wieder ins Schlafzimmer zu meiner Mutter. Sie kniet immer noch am Bett. Auf dem Nachttisch stehen ein paar gerahmte Fotos, sie zeigen meine Oma stolz in einem Pelzmantel, eine goldene Brosche am Revers. Nie trat sie ungeschminkt vor die Tür; als es mit der Gesundheit bergab ging, wollte sie noch nicht mal die Verwandtschaft empfangen, damit keiner sah, wie es um sie stand.
Wie lange werde ich sie so lebendig noch im Gedächtnis behalten? Wie lange wird es dauern, bis diese Bilder anfangen zu schwinden und ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass sie immer nur Chanel N°5 benutzte und die Speisekammer so vollgestopft mit eingemachter Marmelade war, dass der nächste Weltkrieg für diejenigen, die bei meiner Großmutter Unterschlupf gefunden hätten, sehr süß geworden wäre?
SANKT PETERSBURG
Санкт-Петербург: Der Westen im Osten
Die fremde Seele
Ein paar Jahre später, an einem Sonntag im August, sitze ich im Flugzeug Richtung Sankt Petersburg, und alles, was ich unter mir sehe, ist ein grünes Meer aus Bäumen.
Hinter mir liegen Interviews mit Bekannten und Verwandten. Ein Treffen mit meinem Vater, den ich seit 20Jahren nicht mehr gesehen hatte. Abende, an denen ich über meiner Reiseroute brütete, und Nächte, in denen ich auf Russisch träumte.
Jetzt schwinden die Kilometer bis zur Ankunft in dem Land, das sich über neun Zeitzonen erstreckt, doppelt so groß wie die USA ist, dabei aber nur halb so viele Einwohner hat. Ein Land, von dem es heißt, dass man es nicht mit dem Verstand fassen kann. Ein Land, dessen Seele mir so fremd ist wie der dunkle Wald da unter mir– und das doch die Heimat meiner Familie war.
Neben mir sitzen zwei Frauen. »Und Sie, junger Mann? Was haben Sie in Russland vor?«, spricht mich die deutlich Ältere der beiden an.
»Ich will mir ein Auto kaufen und bis zum Pazifik fahren«, antworte ich wahrheitsgemäß.
»Sie wollen sich ein Auto in Russland kaufen?« Beide schauen mich ungläubig an. »Und bis zum Pazifik? Durch die Taiga? Wieso das denn?«
»Warum denn nicht?«
»Aber in der Taiga ist absolut nichts, da wird man von der Leere verschluckt!«, gibt die Ältere zu bedenken.
»So schlimm wird es hoffentlich nicht sein. Ich war schon an ganz anderen Orten.«
»Vielleicht«, entgegnet die junge Frau skeptisch, »aber die Taiga ist anders. Da herrschen Gesetze, die du nicht kennst. Die Bären werden dich zum Frühstück verspeisen!«
Dann wendet sie sich der alten Dame zu, und die beiden fangen an, sich über die Situation in der Ukraine zu unterhalten. Vor Kurzem erst hat Russland die Krim annektiert; ich höre sie davon reden, dass man den ukrainischen Drecksäcken und Verrätern, diesen Faschisten, keinen Meter geben dürfe. Und schon sind wir bei Putin. Wie gut es sei, einen Mann an der Spitze des Staates zu haben, der mit der so oft zitierten silnaja ruka regiere, der eisernen Faust.
Ungewöhnlich ist das nicht. Es gibt eine Denkschule, die besagt, dass Russland für immer eine Autokratie sein werde, dass westliche Regierungsformen in diesem Riesenland schlicht nicht funktionierten. Es sei einfach zu groß und zu chaotisch, Macht könne unter diesen Umständen nicht dezentralisiert werden. Im Gegenteil: Nur mit eiserner Faust lasse sich das gigantische Reich zusammenhalten. Vielleicht ist diese Argumentation zu einfach, dennoch zieht sich das Phänomen wie ein roter Faden durch die russische Geschichte, von den frühesten Herrschern bis heute.
Schließlich setzt die Maschine unter dem Applaus der Passagiere auf, rollt aus und entlässt uns in das brandneue Terminal des Flughafens Pulkowo, in dem die Böden und die Glasflächen auf Hochglanz poliert sind und die Zöllnerinnen in Miniröcken und auf Stöckelschuhen umherlaufen. Das Klack-klack, die Vorliebe der russischen Frauen für Absätze, wird mich über 12.000Kilometer bis nach Magadan am Pazifik begleiten.
Meine Mutter will nie wieder einen Fuß in dieses Land setzen, aber ich stehe jetzt hier und warte, bis die Beamtin in dem Glaskasten meinen Pass stempelt. Ein russisches Sprichwort kommt mir in den Sinn: »Du suchst den gestrigen Tag– er ist bereits vergangen.« Maybe so. Aber ohne Gestern kein Heute, oder?
In der U-Bahn rattere ich Richtung Stadtzentrum. Das Innenlicht flackert. Vom Band Informationen in der Landessprache über die nächsten Stationen. Ich hoffe, dass sich mein verschüttetes Russisch möglichst schnell wieder zutage fördern lässt, sodass ich nicht stumm durch dieses Land laufen werde wie einst meine Vorfahren. Daher kommt der Begriff für die Deutschen: nemetz– stumm. Bei der großen Einwanderungswelle im 18.Jahrhundert wurden alle Ausländer so bezeichnet: »Einen Deutschen nennt man bei uns jeden«, schrieb Nikolai Gogol 1832, »der aus einem fremden Land stammt, sei er nun Franzose oder Großkaiserlicher oder Schwede, immer ist er ein Deutscher.« Während die anderen Völker im Laufe der Zeit andere Namen bekamen, blieb der Begriff »stumm« an den Deutschen haften, das war das namentliche Schicksal der größten Einwanderergruppe.
Am Newski-Prospekt, der Hauptader der Stadt, erblicke ich wieder das Licht der Welt. Bei 32Grad im Schatten läuft mir nach ein paar Minuten schon der Schweiß über den Rücken. Ich suche mein Hotel auf diesem endlosen Boulevard, dessen Häuserzeilen früher Metzger, Bäcker und Fischverkäufer beherbergten und wo vor knapp 100Jahren 150.000Arbeiter marschierten und »Brot, Brot, Brot!« skandierten. Bewaffnet mit Messern und Hämmern, stellten sie sich gegen die Kräfte des Zarenregimes. Bald war die Monarchie der Romanows am Ende, und die Symbole der Revolution – die gebrochene Kette und die strahlende Sonne– erschienen auf Bannern und Zeitungsköpfen.
Heute reiht sich am Schauplatz der Russischen Revolution, die am Ende das zaristische Joch durch das kommunistische ersetzte, Restaurant an Restaurant; ihre Markisen hängen träge in der schwülen Luft. Die Männer auf den Terrassen ignorieren die zahllosen Frauen in luftigen Kleidchen und auf klippenhohen High Heels. Ein alltäglicher Anblick, an den sie sich schon lange gewöhnt haben. Sie interessieren sich eher für die BMWs und Audis und deren Fahrer, die an der roten Ampel mit nervösen Sohlen die Maschinen hochjagen und dann bei Grün über den Boulevard donnern, als gäben die Lichter das Signal für die Daytona 500. Das kraftvolle Röhren der Motoren hallt von den historischen Mauern wider, aber die Palais und Kirchen haben in den drei Jahrhunderten ihres Bestehens schon ganz anderes erlebt.
Alessia ist so zierlich, dass sie in ihrem SUV nahezu verschwindet. Sie hat grüne Augen, ist 27 und die Freundin einer Freundin aus Berlin, die sich bereit erklärt hat, mir einen ersten Überblick über Sankt Petersburg zu verschaffen. »Steig ein«, sagt sie, und ich ziehe die Tür des BMW hinter mir zu.
Handzahm fahren wir den Newski-Prospekt entlang, vorbei an den Touristenmassen, den zahlreichen Kanälen, der riesigen Kasaner Kathedrale. Nach einer Brücke machen wir eine Kehrtwende, sodass ich einen Panoramablick auf diese bombastische Stadt habe, die in der untergehenden Sonne glüht. Die Wolken leuchten fast purpurn.
Der Maßstab der Fünfmillionenstadt, ihre Größe und Wirkung sind fast surreal: die unendlichen Boulevards, die weitläufigen Plätze und die Weißen Nächte, wenn die Sonne fast nicht untergeht. Eine Stadt der Ausblicke und des Lichts, errichtet mit den Idealen der Aufklärung von einem jungen Zaren, der sich in den westlichen Ländern gebildet hatte.
Als Peter der Große die Stadt 1703 gründete, rümpfte der russische Adel kollektiv die Nase: ein sumpfiges Loch an der Mündung der Newa im abgelegenen Nordwesten des Reichs, am Finnischen Meerbusen? Unerhört! Aber bald schon sollte Petersburg der alten Hauptstadt Moskau den Rang streitig machen und zukünftige Generationen inspirieren. Auch wenn zu Beginn der Adel noch per Dekret in die neue Stadt beordert werden musste.
Peters Lebensstil würde man heute unter der Kategorie »work hard– play hard« verbuchen. Er trank und feierte tatsächlich wie ein Großer, während er gleichzeitig Russlands Gesellschaft und Politik von Grund auf umkrempelte, um endlich auf Augenhöhe mit den Großmächten Frankreich, Großbritannien und Spanien zu gelangen. Alexander Puschkin, der Vater der russischen Literatur, spricht ein gutes Jahrhundert später in seinem Gedicht »Der eherne Reiter« davon, dass Peter mit seiner Stadt »ein Fenster nach Europa hin« geöffnet habe.
Das Fenster mag der Herrscher geöffnet haben, gebaut aber haben es Zehntausende Leibeigene, die zwangsrekrutiert worden waren und während der Schufterei für Peters Vision an Skorbut, der Ruhr, an Hunger und Erschöpfung starben.
Alessia arbeitet für eine Filmproduktionsfirma, und Sankt Petersburg ist für sie die schönste Stadt der Welt. Trotzdem denkt sie darüber nach, ihr und ihrem Land den Rücken zu kehren.
»Es wird immer schlimmer«, meint sie, als wir unsere kleine Rundfahrt fortsetzen und an der Universität vorbeikommen. »Schon jetzt darf man nichts Negatives mehr über die Annexion der Krim sagen. Aber viele denken natürlich auch ganz anders darüber, finden es gut, wie Putin das Land führt.«
An einem Park hält Alessia an, und wir steigen aus. »Hast du schon was gegessen?« Ohne meine Antwort abzuwarten, stellt sie sich in die Schlange eines Imbisses.
»Hier.« Kurze Zeit später drückt sie mir einen Pfannkuchen mit Erdbeermarmelade in die Hand. »Sind zwar nicht die besten der Stadt, schmecken aber ganz ordentlich.« Dazu reicht sie mir ein Gläschen Wodka. Sto gramm– 100Gramm. Eine gängige Trinkgröße in diesem Land.
»Willkommen in Russland«, sagt sie, warnt mich aber im selben Atemzug: »Pass auf, im Glas ertrinken hier mehr Menschen als im Meer.«
Wir setzen uns auf eine Parkbank und beobachten das Treiben. In der Mitte des Platzes sprudelt eine Fontäne. Um den Brunnen torkeln mehrere Männer in blau-weiß gestreiften Shirts und mit Käppi auf dem Kopf. Einige liegen bewusstlos auf dem Boden, andere werden von ihren Kameraden aus dem Delirium geohrfeigt, nur damit diese ihnen gleich die nächste Flasche in die Hand drücken können.
»Was ist denn hier los?«, frage ich verwundert.
»Heute ist der Tag der Seestreitkräfte«, erklärt Alessia.
»Und an dem betrinkt man sich einfach hemmungslos?«
»Ja, das artet immer etwas aus. Aber keine Angst, die sind alle so blau, die tun dir nichts.« Dennoch rät mir Alessia, wie später viele andere, auch zur Vorsicht in ihrem Land: »Vor allem in den Dörfern. Ich würde da nie aus dem Auto steigen. Da laufen mir viel zu viele Betrunkene rum, und auf die Polizei kannst du auch nicht zählen– die ist komplett korrupt.«
»Ich dachte, Putin bekämpft die Korruption.«
»Stimmt auch, aber du wirst da draußen schon merken, dass Moskau verdammt weit weg ist«, entgegnet sie mit ernster Miene.
Ich lehne mich zurück und genieße meinen Pfannkuchen. Ein Junge läuft aufgedreht über den Platz, direkt in einen Pulk pickender Tauben hinein. Ihre Mahlzeit endet in aufgescheuchtem Durcheinander. Der kollektive Flügelschlag übertönt kurz das Gejohle der Besoffenen am Brunnen, die sich so feuchtfröhlich in den Armen liegen, als wären sie siegreich aus einem Krieg zurückgekehrt. Ich muss daran denken, dass die aktuelle politische Lage bereits an den Kalten Krieg erinnert und momentan nichts darauf hindeutet, dass sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen in nächster Zeit entspannen könnte.
Die 100
Literaten und Despoten
In der kochenden Hitze wellt sich der Asphalt auf. Schritt für Schritt erwandere ich mir am nächsten Tag den endlosen Newski-Prospekt, laufe durch perfekte Fluchten, wie man sie in der Zeichenschule lernt. Dann verlasse ich den Boulevard und gehe den schmaleren Wladimirski bis zur gleichnamigen Kathedrale mit ihrer gelb-weißen Barockfassade hinab. Direkt dahinter biege ich an der Metrostation in eine Nebenstraße, in der Babuschkas auf Plastikeimern sitzen und Obst und Gemüse aus den Gärten ihrer Datschen feilbieten: Heidelbeeren, Stachelbeeren, Holunder, Knoblauch, Lauchzwiebeln, Dill und saure Gurken. Der Geruch steigt mir in die Nase, erdig-sauer, und nimmt der Luft etwas von der Hitze, die über der Stadt liegt.
Ein paar Meter weiter, gegenüber charmant verfallenden Häusern, liegt der Eingang zu Dostojewskis letzter Wohnstätte. Der Geograf der russischen Seele hatte alle zwei Jahre seine Adresse geändert, aber hier lebte er bis zu seinem Ende, hier schrieb er unter anderem das Meisterwerk »Die Brüder Karamasow«. Darin kommt in einer Episode Jesus zurück auf die Erde, aber er wird sogleich vom Großinquisitor festgenommen, ins Gefängnis gesteckt und beschuldigt, die Leute mit seinem Gerede von Freiheit in die Irre zu führen. Menschen brauchen Führung, lässt Dostojewski den Großinquisitor sagen, sonst gehen sie unter.
In der Wohnung des Schriftstellers sind die Dielen poliert, die Decken hoch, die Möbel massiv. Sein Herz pochte im Schreibzimmer, er saß an einem Tisch so groß wie ein Schiff. Nur wenige hatten das Privileg, ihn in dieser heiligen Halle besuchen zu dürfen. Selbst den Kindern war es nicht gestattet, irgendetwas anzufassen, Bücher schon mal gar nicht. Der Samowar musste immer heiß sein. So befeuerte Dostojewski seine kreativen Nächte; er arbeitete nur zwischen 23Uhr abends und 6Uhr morgens– tagsüber fand er keine Ruhe. Damals schon nicht. Gut, dass er heute nicht hier wohnt.
Seine Werke sind bekanntlich keine leichte Kost– trotzdem waren sie der Grund, warum ich überhaupt anfing zu lesen. Bis zum fortgeschrittenen Alter von 16Jahren las ich eigentlich nur Comics, Science-Fiction und Detektivhefte. Dann drückte mir ein Freund »Schuld und Sühne« in die Hand. Es war am Anfang der Sommerferien, und ich dachte, vielleicht lese ich mal ein paar Seiten und gehe dann ins Freibad. Aber nach ein paar Stunden steckte meine Nase immer noch in dem Wälzer, und ich konnte es nicht fassen, wie es möglich war, das Innenleben eines Menschen so genau auszuleuchten, wie es Dostojewski bei Raskolnikow gelang, jenem Mann, der sich den perfekten Mord ausdenkt.
Aus Tag wurde Abend wurde Nacht. Ich schlief mit dem Buch ein. Ich wachte damit auf und las weiter. Meine Mutter wurde misstrauisch und versuchte, mich aus der Wohnung zu scheuchen.
Jetzt bin ich tatsächlich in Dostojewskis Stadt, doch sie überfordert mich mit ihrer Weitläufigkeit, ihrem historischen Erbe. Wo beginnen die Wälder, die Flüsse, die Seen? Nördlich von hier liegt Karelien und noch weiter weg das Polarmeer, aber ich muss nach Süden, nach Moskau, um mir dort ein Auto zu kaufen. Noch stehe ich nur auf der Schwelle zu diesem riesigen Land, noch hat die Reise nicht richtig begonnen.
Alessia trägt heute ein weißes Top und einen Rock mit Blümchenmuster, den sie, sobald wir uns der Newa nähern, im Sommerwind im Zaum halten muss. Auf ihre Schulter hat sie sich den allerersten Satelliten tätowieren lassen, den die Sowjets ins All geschossen haben: Sputnik 1.
Wir beginnen unseren Spaziergang auf der Haseninsel und laufen hinüber zur Peter-und-Paul-Festung. In ihren Stöckelschuhen gleitet Alessia über die groben Pflastersteine, als wäre der Straßenbelag ein kurzer, weicher Teppich. Ich muss mich anstrengen, um mit ihr Schritt zu halten.
Als ich sie frage, warum sie noch nicht in den Westen abgehauen sei, wo ihr doch so viel an der aktuellen Situation in ihrem Land auf den Nerv gehe, meint sie nur: »Irgendwie könnte ich mir trotzdem nicht vorstellen, anderswo zu leben, eine andere Luft zu atmen, woanders zu arbeiten. Egal, wie die aktuelle Situation ist, ich bin Patriotin. Es geht mir nicht ums Geld, nicht um Materielles. Mich hält die russische Seele hier.«
»Was meinst du damit?«
»Nun ja, die russische Seele ist voller Gefühl, immer kurz vorm Explodieren. Europäer sind im Gegensatz immer so ruhig. Und dann ist unsere Leidensfähigkeit auch noch größer.«
»Lustig, dass du das gerade jetzt sagst.«
»Warum?«
»Schau doch da vorne!«
Wir sind direkt auf das Foltermuseum zugelaufen. Alessia lacht und wendet sich dabei schüchtern ab. Die Haare fallen ihr ins Gesicht.
Ein paar Schritte weiter streckt die Peter-und-Paul-Kathedrale ihre lange Spitze gen Himmel. Das Wahrzeichen Sankt Petersburgs ist von vielen Orten der Stadt gut sichtbar. Hier, unter dem glänzenden Gold der Türme, liegen die Zaren und ihre Angehörigen begraben, vor ihren Marmorsärgen lässt sich eine Besuchergruppe nach der anderen ablichten.
Während wir uns unter den fotografierenden Muttchen mit ihren Kopftüchern tummeln und die Kühle in der Kirche genießen, in der Geschichte begraben liegt und dennoch präsent ist, unterhalten wir uns über die kaiserliche Vergangenheit des Landes, seine schillernden Figuren. Als ich Alessia frage, ob es da jemanden gebe, der sie besonders interessiere, antwortet sie ohne Zögern: »Iwan der Schreckliche.«
1547 wurde Iwan IV., der 16-jährige Großfürst von Moskau, mit dem Segen des örtlichen Metropoliten der erste Zar ganz Russlands; Idee, Symbolik und Zeremoniell entlieh er dem untergegangenen byzantinischen Kaisertum. Klar, dass ihm der Beiname nicht verliehen wurde, weil er die ganze Zeit friedlich Tee mit Sahne trank. Andererseits finden sich die Ursachen des ausgeprägten Hangs zur Grausamkeit in seiner Kindheit, als der früh zur Vollwaise gewordene Thronfolger nur Spielball und Fußabtreter der miteinander konkurrierenden Bojaren, des Hochadels, war. Kaum volljährig präsentierte er ihnen die Rechnung: Zur Feier des Tages ließ der 15 und damit mächtig gewordene Iwan ein paar Fürsten hinrichten.
Als neuer »Cäsar« unterwarf er Land und Einwohner, von den Bauern bis hin zu den verhassten Bojaren. Dabei half ihm eine Leibgarde aus adeligen Vertrauten, Tataren und ausländischen Söldnern. Aber was heißt schon »half«? Die Opritschniki verbreiteten Angst und Schrecken, wo immer sie auftauchten. Schon wie sie das taten– sie ritten in schwarzen Mönchskutten und mit schwarzen Hüten daher; ihr Abzeichen waren ein Hundekopf (Wir sind wachsam und gehorsam!) und ein Besen (Wir räumen gründlich auf!)–, verursachte bei Dorfbewohnern den einen oder anderen Herzinfarkt. Ein vergleichsweise gnädiger Tod, denn die schwarzen Reiter waren, wie Iwan selbst, für brutalste Foltermethoden bekannt. Sie unterwarfen die Kirche und richteten Massaker an, um die Städte unter die Zarenherrschaft zu zwingen. In Nowgorod schlachteten sie in einem mehrwöchigen Wüten Tausende Bürger ab, weil Iwan die Handelsstadt im Livländischen Krieg um die Vormacht an der Ostsee verdächtigte, mit dem Feind zu mauscheln.
Im Westen blickte man mit, gelinde gesagt, Unverständnis auf den Zaren– im Osten waren eben nur Barbaren unterwegs. Obwohl man sich an die eigene Nase hätte fassen können: Feudalismus, Inquisition, Hexenverfolgung, Kolonialismus– und Heinrich VIII. von England, der sich zwei seiner sechs Ehefrauen durch das Henkersbeil entledigte. Ganz östlicher Barbar, war Iwan jedoch satte achtmal verheiratet, zweimal wurde er durch Gift und einmal durch Ertränken Witwer, außerdem erschlug er im Jähzorn seinen Sohn und massakrierte nicht nur seine Gegner, sondern auch Bedienstete und Getreue. So wurden schließlich auch die Opritschniki selbst mit eisernem Besen ausgekehrt.
Doch die Expansion nach Osten und Süden machte Russland zum größten Landimperium jener Epoche. Fast unnötig zu erwähnen, dass Stalin ein großer Fan Iwans war.
»Du magst also Blut und Gewalt«, sage ich. Alessia streicht sich die Haare aus dem Gesicht, nickt ernsthaft und bestimmt. »Oh ja«, bestätigt sie, dann bricht sie in ein helles Lachen aus.
Schlendernd verlassen wir die Insel und überqueren wieder die Newa Richtung Stadtzentrum. Nach und nach rückt die mintgrüne Eremitage in unser Blickfeld, bis wir schließlich direkt davorstehen. Ihre Wuchtigkeit droht uns fast zu erschlagen.
Das Sonnenlicht spiegelt sich in Alessias blutroten Fingernägeln, während sie mit dem Arm hierhin und dorthin zeigt. Auf ihrem Unterarm entdecke ich eine weitere Tätowierung. Sie sieht aus wie ein leerer Bilderrahmen.
»Was hat es denn damit auf sich?« Ich deute auf das Tattoo.
»Weißt du von der Blockade?«
Im September 1941 ordnete Hitler an, dass das damalige Leningrad nicht eingenommen, sondern durch eine Belagerung ausgehungert werden solle. Sie dauerte knapp 900Tage, bis Ende Januar 1944. Die Deutschen bombardierten die Stadt rund um die Uhr und ließen keine Lebensmitteltransporte durch. Nur über den gefrorenen Ladogasee im Nordosten kamen ein paar Konvois mit Essbarem durch, aber das war bei Weitem nicht genug für zweieinhalb Millionen Einwohner. Die fingen an, Hunde und Katzen zu essen, auch die Tiere aus dem Zoo verschwanden. Es war unmenschlich kalt, und die Deutschen waren so nahe herangerückt, dass man die Musik aus ihren Feldlagern hören konnte.
Etwa 1,2Millionen Petersburger starben, die meisten von ihnen verhungerten und erfroren.
»Und trotzdem«, erzählt Alessia, »gingen die Leute arbeiten, damit sie nicht einfach zu Hause vor einem leeren Teller saßen. Also haben sie auch die Eremitage in Schuss gehalten und jeden Tag dort sauber gemacht. Eines Tages wollte der Kurator ihnen zum Dank etwas Gutes tun und gab ihnen eine Führung durchs Haus. Dabei hingen da nur die leeren Rahmen, die Bilder waren ja alle schon längst in Sicherheit gebracht worden. Der Kurator gab die Führung trotzdem und schaffte es einfach anhand seiner Worte, die Bilder zum Leben zu erwecken. Für mich symbolisiert dieser Rahmen die Macht der Worte und der menschlichen Vorstellungskraft. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren nachts im Bett lag und diese Geschichte in einem Buch las. Am nächsten Morgen bin ich sofort los und habe mich tätowieren lassen.«
Die Bevölkerung brachte damals gewaltige Opfer, die Stadt war nur noch ein Schatten ihres einst glanzvollen Selbst. Zweieinhalb Jahre Belagerung, unablässiger Bombenterror, Menschen, die in den Straßen einfach tot umfielen und liegen gelassen wurden, weil die Lebenden keine Kraft hatten, sie wegzuräumen– und dennoch gab Petersburg nicht auf.
Von diesem Grauen ist heute nichts mehr zu sehen. Mein Blick schweift über den Schlossplatz, auf dem sich Hunderte Touristen tummeln und jede Ecke abfotografieren. Dabei befindet sich das schönste Motiv direkt neben mir.
Wir laufen vorbei am Hotel Astoria, in dem Hitler seinen Sieg feiern wollte, die Vernichtung des Volkes, das er als »Untermenschen« bezeichnete. Das war 1942, die Plakate dafür waren schon gedruckt. Aber wie meine Großmutter in ihrer unendlichen Weisheit so gerne sagte: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
In Sankt Petersburg fühlt man die Macht der Geschichte an jeder Ecke, man entkommt ihr nicht. Es ist eine Stadt, in der Romantik und Schrecken ganz nah beieinanderliegen. Schon die Namen mancher Gotteshäuser lassen einen frösteln. Kreuzigungskirche. Oder Blutkirche, die an der Stelle errichtet wurde, an der Zar Alexander II. 1881 einem Attentat zum Opfer fiel. Majestätisch reckt sie sich mit ihren Zwiebeltürmen ins Nachmittagslicht, die Sonne strahlt immer noch so hell, als wäre es zwölf Uhr mittags. Durch den Kanal, an dem die Kathedrale liegt, fahren die Ausflugsboote. Wir hören die Stimmen der Touristenführer, und wir riechen den Schiffsdiesel.
Wir schlendern am Kanal entlang, vorbei am Haus von Alexander Puschkin, der »Sonne der russischen Poesie«, der 1837, noch keine 40, bei einem Duell starb, um die Ehre seiner in den Ruch einer Affäre geratenen Frau zu verteidigen. Zu seiner Beerdigung flutete die Bevölkerung die Straßen wie 13Jahre zuvor das unbezähmbare Hochwasser, das Puschkin selbst in seinem »Ehernen Reiter« verewigt hatte.
Unten am Wasser, an der Kaiwand, erinnert ein kleiner Spatz aus Messing aber an ein anderes seiner Gedichte, »Das Vöglein«. Und natürlich kann Alessia es auswendig:
»Den alten Brauch, den gibt es ewig,
dem ich in Fremde folgen mag:
Ich lass ein Vöglein aus dem Käfig
an fröhlich heitrem Frühlingstag.
Nun meine Seele wird genesen;
gibt’s einen Grund zum Traurigsein,
wo ich nur einem Lebewesen
bescher den freien Sonnenschein?«
Während wir weiterspazieren, unterhalten wir uns über den geliebten und verehrten Dichter, dessen Werke das goldene Zeitalter der russischen Literatur einläuteten. Puschkin behandelte nicht mehr Themen des Barock oder der klassischen Mythologie, sondern die des russischen Alltags und Lebens, schrieb gleichzeitig in der gesprochenen Sprache des Volkes, nicht im steifen, alten Kirchenslawisch. Mit Puschkin richtete sich der Blick nach innen, und in dieser Atmosphäre wuchsen Giganten wie Gogol, Tolstoi und Dostojewski heran. Aus dieser Zeit stammt auch das Bonmot des Lyrikers Fjodor Tjuttschew: »Mit dem Verstand ist Russland nicht zu fassen. An Russland muss man einfach glauben.«
Plötzlich bleibt Alessia stehen und verstummt.
»Was ist los?«, frage ich verblüfft.
»Schau da drüben«, antwortet sie knapp und deutet auf ein Gebäude auf der anderen Straßenseite.
Ein großer sandsteinfarbener Block, der mit seiner zweckmäßigen kommunistischen Architektur sofort aus dem historischen Ensemble Petersburgs herausfällt. Drei große Holztüren, direkt zur Hauptstraße, mit einem Wachmann in Uniform davor.
»Früher ist man noch nicht mal in die Nähe dieses Gebäudes gegangen, aus Angst, nie wieder nach Hause zu kommen.«
Es ist das berüchtigte »Große Haus«, Sitz des FSB, des Inlandsgeheimdiensts der Russischen Föderation; zu Sowjetzeiten war hier der KGB untergebracht, davor– nach der Oktoberrevolution 1917– der NKWD, das Volkskommissariat des Innern. Angeblich färbte sich an manchen Tagen die Newa rot, weil das Blut aus den unterirdischen Zellen in den Fluss geleitet wurde.
»Weißt du«, fährt Alessia fort, »ich war erst vor zwei Wochen da drin. Ich wollte endlich die Prozessakte meines Urgroßvaters lesen. Er wurde 1934 von einem Exekutionskommando erschossen. Die Akteneinsicht wurde vor Kurzem erlaubt. Es war ganz seltsam: Als ich diesen Ordner öffnete, auf dem FÜR IMMER AUFBEWAHREN stand – Gerichtsakten über politische Fälle dürfen, wie ich erfahren habe, nicht vernichtet werden–, da wurde ich direkt in den Winter des Jahres 1934 katapultiert. Meine Großmutter Natascha war so alt wie ich heute. Spät in der Nacht kam ein schwarzer Wagen angefahren und hielt vor dem Haus in der Krasnoarmejskaja, um meinen Urgroßvater mitzunehmen und nie wieder zurückzubringen.
Damals holten sie die Leute mit der ›schwarzen Maria‹ immer mitten in der Nacht ab. Alle hatten fürchterliche Angst. Manche hatten sogar schon eine Tasche gepackt, für den Fall der Fälle. Die Menschen wurden manchmal nur aufgrund der Aussage eines Nachbarn einkassiert, bloß weil der sauer war oder vielleicht neidisch. Meine Großmutter hat heute noch Angst. Sie wollte auch nicht, dass ich hier hingehe und in die Akten schaue. Sie meinte, dann werde mein Name auf einem Zettel stehen, und wer wisse, was der FSB damit mache. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit dieser Geschichte in Verbindung bleiben muss.
Ich nahm also ängstlich die Dokumente des NKWD in die Hand und sah, dass es fast genau 80Jahre her war. In der Akte lag eine Quittung über die Sachen, die sie meinem Urgroßvater bei der Festnahme weggenommen hatten: ein Zigarettenmundstück und eine Krawatte. Dann waren da die Protokolle der Verhaftung sowie Abschriften der ersten Verhöre: Wo arbeitete er? Mit wem war er befreundet? Über was unterhielten sie sich? Und wie war das mit den Antisowjetthemen?
Die ersten Fragen hatte mein Urgroßvater gar nicht beantwortet, aber bei der letzten, der gefährlichsten, da fing er dann an zu reden!
Ich sprang auf und schrie dieses alte Papier an: Was soll das? Warum erzählst du ihnen die Wahrheit? Halt einfach die Klappe, rede bloß nicht weiter! Weißt du denn nicht Bescheid? Du bist doch ein schlauer Kerl!
Ich habe es nicht verstanden, dass er so offen über seine Ansichten sprach. Jeder dieser Sätze brachte einen in jenen Tagen auf direktem Weg ins Grab. Ich kapiere es bis heute nicht. Er konnte doch nicht so naiv sein, oder? Damals wussten sogar kleine Kinder, dass man solche Dinge nicht sagt, noch nicht einmal vor den eigenen Geschwistern.
Aber mein Urgroßvater redete frei von der Leber weg über die ineffiziente Politik der Sowjets und die Katastrophe der Kollektivierung, die Zerstörung der Dörfer, die Vorteile des Kapitalismus und die zerstörende Geschwindigkeit der Industrialisierung. Und er befürwortete leidenschaftlich die einstigen Taten der Narodnaja Wolja, die im Zarenreich mit Attentaten für ein demokratisches Russland gekämpft hatte, er bewunderte die Opfer, die die Untergrundgruppe gebracht hatte, las subversive Literatur und wusste, wie man die Dinge zum Besseren wenden konnte. Aber er sagte auch, dass er keine terroristischen Aktivitäten geplant habe und nicht vorhabe, eine Organisation in dieser Richtung zu gründen.
Er redete so offen darüber, ohne auch nur einen Vorwurf abzustreiten. Ganz im Gegenteil zu seinen drei Gesinnungsgenossen, die ebenfalls festgenommen wurden. Die sagten gegen ihn aus. Zwei bekamen zehn Jahre Sibirien. Einer kam frei. Mein Urgroßvater wurde dafür verurteilt, konterrevolutionäre Ansichten zu propagieren; er wurde wegen des Lesens verbotener Bücher, der Produktion von Flugblättern und der Rekrutierung für den Kampf gegen den Sowjet verurteilt.
Die ganze Akte ist maschinengeschrieben, nur am Ende steht ein Wort in Handschrift: ERSCHIESSEN.
Bei der letzten Anhörung wurde erlaubt, dass seine Frau und sein Kind dabei sein durften. Nach der Verkündung des Urteils war der Tochter noch gestattet, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Er umarmte sie und steckte einen Zettel in die Tasche ihres Mantels: ›Natascha, ich bin unschuldig.‹
Dann musste er quittieren, eine Kopie des Urteils erhalten zu haben. Seine Unterschrift in diesen Akten… Ich berührte sie, und damit fasste ich über die Jahrzehnte hinweg nach seiner Hand.
Es ist so unglaublich, was die Menschen damals alles durchgemacht haben. Und doch bin ich froh, dass ich in das ›Große Haus‹, vor dem so viele Angst haben, gegangen bin. Irgendwie fühlte ich mich danach… kompletter.«
Wir stehen immer noch dem riesigen Gebäude gegenüber auf der anderen Straßenseite. Die ganze Zeit über ist weder jemand hineingegangen noch herausgekommen. Ich suche nach tröstenden Worten, aber mir will nichts einfallen.
Wahlverwandtschaften
Die Mutter jammert in einem fort, dass nichts im Hause sei, weil man ja bis eben auf der Datscha gewesen sei, aber ungeachtet ihrer ständigen Entschuldigungen verschwindet auf dem Tisch jedes noch so freie Plätzchen. Zuerst zwei Sorten Marmelade, Brot, Butter. Dann Wurst, Sardellen, Gurken, denen man die Frische förmlich anhört, beim Aufschneiden knacken sie wie eine Erdplatte kurz vorm Erdbeben. Speck, Brot mit Leberwurst, Tomaten, es nimmt kein Ende. Die blondhaarige Mutter verschwimmt vor meinen Augen zu einem hellen Fleck, in ihren weißen Shorts und der weißen Bluse jagt sie wie ein Derwisch durch die Küche, setzt die Pfanne auf, brät Eier mit Schinken und Käse. Während sie mich fragt, ob ich Tee wolle, hat sie schon längst die Kanne aufgesetzt.
Die ganze Familie ist vom sommerlichen Aufenthalt auf der Datscha außerhalb Petersburgs braun gebrannt, es ist ein gesundes, strahlendes Braun, wie es sonst Kinder nach vier Ferienwochen im Schwimmbad haben.
Das Klappern des Geschirrs hallt von der hohen Altbaudecke wider. Hier, auf der Wassiljewski-Insel, wohnt Alessia mit ihren Eltern in einer großzügig geschnittenen 120-Quadratmeter-Wohnung. Auf den unteren Stockwerken lebt man allerdings noch wie zu Stalins Zeiten, in Kommunalkas: mehrere Familien in einer Wohnung, sodass es keinerlei Privatsphäre gibt. Auf diese Weise kann natürlich auch nichts vor dem Staat verborgen werden. Entsprechend funktioniert das Klingelsystem in den Mehrparteienwohnungen: zweimal klingeln für Petrow, dreimal für Timoschenko usw.
Zu Hause bei Alessia hängen an der einen Küchenwand Teller aus den verschiedensten europäischen Städten, auf der anderen Seite ist ein Regal mit den von Vater Sergej gesammelten Bierkrügen angebracht. Er kommt gerade durch die Tür und setzt sich zu uns an den Tisch. Ein Mann von 50Jahren, breit gebaut und mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht.
»Wie gefällt dir Petersburg?«, fragt er mich.
»Ganz gut, eine wunderschöne Stadt, aber eigentlich bin ich auf der Suche nach so was hier– Leute kennenlernen, mit ihnen reden.«
Er nickt. »Die Mauern haben keine Seele. Aber die Menschen.« Sergej stellt mir ein Schnapsglas hin, schenkt ein. »Trinken wir. Auf. Deine. Reise.« Er spricht sehr langsam, gräbt sein Deutsch hervor, das er einst auf dem Bau in Deutschland gelernt hat. »Das Erste, was sie uns beigebracht haben, war: ›Ist die Grube tief genug?‹ Aber nun sag, was hast du vor?«
Ich erzähle ihm von meiner geplanten Reise bis zum Pazifik, davon, wie ich versuchen will, meiner Familiengeschichte nachzuspüren, die Schnittmenge des Russischen und des Deutschen zu erforschen.
Wieder nickt er. »In Russland zeigen wir zu viel Gefühl. In Deutschland zeigt ihr zu wenig. Das passt perfekt zusammen.«
Beide Völker waren sich einmal wesentlich näher, als man heute den Eindruck hat und es vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Thomas Mann sprach von einer deutsch-russischen Wahlverwandtschaft, Friedrich Nietzsche baute auf die Einigung von Slawen und Deutschen, Rainer Maria Rilke liebte das Land und seine Dichter: »Das Leben des russischen Menschen steht ganz im Zeichen der gesenkten Stirne, im Zeichen des tiefen Nachdenkens, um welches herum alle Schönheit überflüssig wird und aller Glanz eitel.« Selbst in der jungen Sowjetunion sahen nicht wenige Deutsche ein Land der Zukunft, das alte Strukturen aufbrechen würde. Was die UDSSR dann auch tat, wenn auch anders als vielleicht gedacht.
Aber wie immer muss man unterscheiden zwischen der Politik und den Menschen. Auf der ganzen langen Reise werde ich zwar oft, sehr oft, auf Merkel und ihren Schulterschluss mit der neuen ukrainischen Regierung angesprochen, aber dennoch herzlich aufgenommen. Der wahre Kampf scheint dieser Tage in den Kommentarspalten der Onlinemedien zu toben und zwischen »Putin-Verstehern«, »Transatlantikern« und bezahlten Keyboardkriegern beider Lager doch recht schwarz-weiß geführt zu werden.
Wir trinken einen nach dem anderen, und Sergej fragt, ob es stimme, dass in Berlin alle schwul seien. Hier in Russland sei Homosexualität auch kein Problem. Solange sie privat bleibe. Was hinter den Türen geschehe, gehe keinen was an. Aber Paraden in der Öffentlichkeit oder dass sich ein Bürgermeister vor die Menge stelle und verkünde, er sei schwul… das sei undenkbar.
»Das ist eine Frage des persönlichen Freiraums«, meint Sergej. »Weißt du, wenn hier im Haus die Leute herumschreien, da kommt keine Polizei, weil sie dafür nicht zuständig ist. Das ist bei uns anders als in Deutschland, wo sich ständig jemand in dein Privatleben einmischen will.«
Die Mutter greift sich die Einkaufstasche und saust hinaus, um noch mehr Wodka zu kaufen, weil wir schon zu den Sprüchen von druschba, Freundschaft, und guten Wünschen für meine Reise eine halbe Flasche geleert haben. Dazu immer einen Happen essen. Und riechen, schmecken, hören, fühlen.
Sergej spricht weiterhin deutsch, ich russisch, und mit jedem weiteren Glas rollen mir die Wörter flüssiger von der Zunge. Rollen sollte auch das R. Aber das muss ich mir erst wieder angewöhnen. Als Kind war mein Deutsch stark von diesem grollenden, auf der Zunge gesprochenen R geprägt, aber ich wurde so sehr gehänselt deswegen, dass ich es mir schleunigst abgewöhnte.
Sergej schenkt wieder ein. Er hat kaum etwas vom Essen angerührt und hebt das Glas. »Zwischen erste Pause und zweite Pause passt immer noch eine kleine! Auf deine Reise. Du wirst es überleben, hier in Russland ist nur einiges anders. Wir sagen: In Deutschland ist alles verboten, was nicht erlaubt ist. Aber in Russland ist alles erlaubt, was verboten ist. Du musst also aufpassen, dass du nicht dein Koordinatensystem von zu Hause anwendest. Dann wird alles gut.«
Um elf Uhr abends sind draußen immer noch helle Streifen am Nachthimmel zu erkennen.
»Magst du Dostojewski?«, erkundigt sich Alessia.
»Machst du Witze?«
»Gut, dann gehen wir jetzt dorthin, wo Raskolnikow nachts herumirrte.«
Nachdem ich mich – unter endlosen Glückwünschen für die Fahrt– von ihren Eltern verabschiedet habe, verlassen wir die Wohnung. Die Temperatur ist etwas gesunken, jetzt erst ist es erträglich, in der Stadt spazieren zu gehen. Unten auf der Straße kann man in der Ferne das Meer riechen. Wir gehen langsam nach Kolumna, ein Arbeiter- und Studentenviertel.
»Ich frage mich, was du über diesen Tag schreiben wirst«, sagt Alessia und biegt in einen von schummrigen Lampen erleuchteten Gehweg an einem Kanal ein.
»Weiß ich auch nicht. Aber wenn wir uns küssen würden, hätte ich noch mehr zu erzählen.«
»Ach, hör auf«, sagt sie und schlägt mich auf den Arm.
Unter den Bäumen hören wir unsere eigenen Schritte auf dem Sand des Weges. Auf den Bänken sitzen ein paar Bettler und teilen sich eine Flasche Wodka. Einer steht auf, kommt auf mich zu und fragt: »Werter Herr, haben Sie es vielleicht in Ihrem Herzen, ein paar Rubel für einen Obdachlosen zu spenden?«
»So nette Penner findest du nur in Petersburg«, meint Alessia. »Woanders fallen sie einfach betrunken über dich her.«
Nach ein paar Metern betreten wir eine kleine Brücke, die Krasnoarmenski Most.
»Hier war es«, verkündet Alessia, »dass Raskolnikow zum ersten Mal Sonja Marmeladowa traf. Durch ihre Liebe erst bekam er neuen Lebensmut. Sie trug ein rosa Kleid, wenn ich mich recht erinnere…«
Zwischen den gedrungenen Häusern mit den gedeckten Farben, die von einer Zeit erzählen, in der es Kutschen und Gaslampen gab, gehen wir an Raskolnikows Haus vorbei, überqueren dieselben Brücken wie Dostojewskis Held– ich versuche dabei, Alessia nicht zu lang in die Augen zu schauen.
Vor der pastellblauen Nikolaus-Marine-Kathedrale bleiben wir stehen. Ich erinnere mich daran, wie »Schuld und Sühne« für mich vor allem als eine Farbe in Erinnerung geblieben ist– dieses Fiebrige des Protagonisten, seine schwach beleuchtete Wohnung, sein Neid auf die alte Wirtin und seine moralische Überheblichkeit.
»Alessia, welche Farbe hat das Buch für dich?«, rutscht es mir heraus.
»Farbe?«, fragt sie verwundert zurück.
Irgendwie war ich mir ihrer Antwort 100-prozentig sicher, und als sie tatsächlich, ohne lange zu zögern, »gelb« sagt, kann ich nicht anders: Ich muss sie einfach küssen.