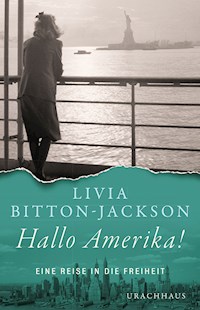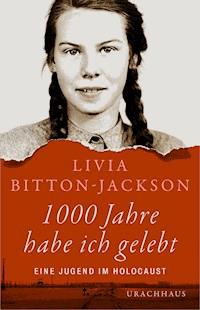
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit 13 Jahren wurde Elli Friedmann im März 1944 mit ihrer Familie nach Auschwitz verschleppt. Als eine der wenigen Jugendlichen, die mehrere Konzentrations- und Arbeitslager überlebt haben, zeichnet die heute 87-Jährige ein erschreckendes Bild der unvorstellbaren Grausamkeiten des Naziregimes. Nur ihr unbeugsamer Glaube an das Überleben half ihr, die Gräuel der Konzentrationslager zu überleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Livia Bitton-Jackson
1000 Jahrehabe ich gelebt
Eine Jugend im Holocaust
Aus dem amerikanischen Englischvon Dieter Fuchs
Den Kindern in Israel gewidmet, die – ohne dass dies normalerweise erwähnt wird oder man ihnen dafür Respekt zollt – an jedem einzelnen Tag ihr Leben aufs Spiel setzen, indem sie ihren Weg zur Schule über die Straßen von Judäa, Samaria und Gaza nehmen. Einem dauerhaften Frieden in Israel zuliebe – der die einzige Sicherheit dafür darstellt, dass der Holocaust sich niemals wiederholen kann.
Inhalt
Vorwort
Die Stadt meiner Träume
»He, Judenmädchen, Judenmädchen …«
Die Geschichte vom gelben Fahrrad
Die Geschichte vom gelben Stern
Leben Sie wohl, Herr Stern
Das Ghetto
Ein Wunder
Vati, wie konntest du mich verlassen?
Darf ich bitte meine Gedichte behalten?
Tante Serena
Oh Gott, ich will nicht sterben!
Auschwitz
Arbeit macht frei
Neugeboren in der Dusche
Krawall im Lager
Jugendliche Eitelkeit
Ein neuer Hoffnungsschimmer
»Mami, in deiner Suppe ist ein Wurm«
Rätselhafte Helden
Der Aufstand
Hitler ist nicht tot
Tätowiert
Das kaputte Bett
Ist das wahr mit dem Rauch?
Die Selektion
Der Transport
Ein Taschentuch
Wir sind im Himmel
Herr Zerkübel
Leah Kohn, vergib mir …
Ein Teller Suppe
Der goldene Vogel
Ein Echo aus dem Nebel
Um in der Welt zu leben
Ein verlorenes Spiel
Ein amerikanisches Flugzeug!
Endlich frei
Heimkehr
Amerika, wirst du mir zur Heimat werden?
Die Freiheitsstatue
Anhang
Vorwort
Am 30. April 1995 flog ich mit einer Maschine der Fluggesellschaft El-Al von Tel Aviv nach München. Vom Flughafen nahm ich die S-Bahn nach Tutzing, und von dort wurde ich in den kleinen bayerischen Badeort Seeshaupt gebracht. Diese Reise war für mich nicht einfach, und ich unternahm sie nach wochenlangem Abwägen. Ich ging zurück nach Deutschland – nach fünfzig Jahren.
An genau diesem Tag vor fünfzig Jahren war ich in Seeshaupt von der amerikanischen Armee befreit worden, und mit mir mein Bruder, meine Mutter und Tausende anderer bis auf die Knochen abgemagerter Häftlinge. Einige führende Persönlichkeiten von Seeshaupt hatten nun beschlossen, dieses Ereignisses zu gedenken. Sie gründeten ein Komitee und sandten Einladungen an die Überlebenden in aller Welt. Eine solche Einladung traf auch bei mir in New York ein, und also unterbrach ich meine Reise von Tel Aviv nach Hause, um einen Abstecher nach Seeshaupt zu machen.
Der Sohn des damaligen Bürgermeisters, der bei Kriegsende neun Jahre alt war, konnte nie vergessen, wie die siegreichen Alliierten seinen Vater mitsamt Familie und anderen maßgeblichen Bürgern von Seeshaupt zum Bahnhof geführt hatten, wo sich ihnen ein schreckliches Bild menschlichen Leids darbot. Der Anblick Tausender malträtierter Leiber und ausgezehrter, den Tod in sich tragender Skelette prägte sich unauslöschlich in sein Gedächtnis.
Er wurde Arzt in Seeshaupt, und als ihm später bewusst wurde, dass seine Patienten aus der Nachkriegsgeneration seinen Erzählungen keinen Glauben schenkten, entschloss er sich, diejenigen der damals grauenhaft Anzusehenden, die noch lebten, wieder an den Ort ihrer Befreiung zurückzubringen. So wollte er demonstrieren, dass das Unglaubliche wirklich geschehen war.
Der Himmel war bedeckt, und ein leichter Nieselregen behinderte meine Sicht, als mein Gastgeber Dr. Peter Westebbe, einer der Organisatoren der Gedenkfeierlichkeiten, mit mir durch die Straßen von Seeshaupt zur Einweihungszeremonie fuhr.
Achtzehn Überlebende waren aus aller Welt zusammengekommen, um an der Feier teilzunehmen. Einige aus den USA, einige aus Südamerika, einige aus Israel, eine Person aus Griechenland. Auch die Seeshaupter waren anwesend – etwa dreihundert, zumeist recht junge. Der jetzige Bürgermeister der Stadt leitete die Einweihung eines Mahnmals, das denen gewidmet war, die sterben mussten, und denen, die überlebten und an dieser Stelle befreit werden konnten – den Akten zufolge mehr als zweitausendfünfhundert. Seeshaupter Schulkinder pflanzten Bäume, tanzten und sangen, und der Pfarrer der Gemeinde weihte das Denkmal. Das einheimische Publikum war sichtlich bewegt.
Die achtzehn Überlebenden, die sich nun wieder in Seeshaupt eingefunden hatten, Männer und Frauen zwischen Mitte sechzig und Ende siebzig, tauschten kurz Erinnerungen an die fünfzig Jahre zurückliegende Befreiung aus – und als wir uns gegenseitig in die Augen blickten, wurde uns klar, dass auch die vielen Jahre nicht imstande gewesen waren, den Schmerz der Erinnerung zu lindern. Der Schmerz war immer noch da. Genau wie das Gefühl, von einer unendlich schweren Last erdrückt zu werden.
An die Einweihungszeremonie schloss sich dann eine Feier an. Mehrere hundert Gäste waren eingeladen, an einem Festmahl teilzunehmen, bei dem die Musikkapelle der Stadt für Unterhaltung sorgen sollte.
Ich schlich mich aus dem Saal und ging langsam zum Bahnhof. Die Kleinstadt lag eingehüllt in die nachmittägliche Stille des Sonntags. An den Schienen entlang wanderte ich auf den farblosen, verlassenen, unvergessenen Bahnsteig zu. Kein Zug weit und breit. Keine Reisenden. Völlige Leere. Nur ein beständiger, leichter Nieselregen.
Für mich war der Bahnsteig allerdings voll. Übervoll war er – mit einem wilden Durcheinander der unterschiedlichsten Anblicke, Hunderte und Aberhunderte – ein blutiger Teppich aus Toten und Sterbenden. Ich sah Greco, den fünfzehnjährigen griechischen Jungen, wie er mit aufgerissenen, fiebrigen Augen um Wasser bettelte. Ich sah Lilli, die sechzehnjährige Brünette mit dem abgerissenen Bein, wie sie in ihrem eigenen Blut saß. Ich hörte Martha, auf beiden Augen blind, wie sie nach ihrer Mutter rief. Und Elisabeth, und Irene … alterslose Gesichter, ausgezehrte Gliedmaßen füllten den grau schimmernden Nebeldunst voll und ganz aus.
»Heute fahren keine Züge mehr.« Überrascht drehte ich mich um. Die anhand ihres Dialekts unschwer als Bayerin zu erkennende Frau hatte ein freundliches und ansonsten nichts sagendes Gesicht. »Von hier fahren heute keine Züge mehr ab.«
»Ich danke Ihnen. Aber ich warte nicht auf den Zug.«
Sie sah mich verständnislos an, ging dann aber weiter, wenngleich nur zögernd, so als ob an mir etwas Verdächtiges wäre.
Doch das zuvor Gesehene tauchte nicht mehr auf. Die Vision dessen, was ich vor einem halben Jahrhundert erlebt hatte, wollte sich für die Gegenwart nicht mehr einstellen. Ein kalter, undurchlässiger Schleier überzog die Gleise; der Bahnsteig und das ungemütliche, einstöckige Stationsgebäude waren menschenleer.
Ich spazierte zurück zum Brauereisaal, wo die Feier schon langsam dem Ende entgegenging. »Gibt es etwas, das Sie uns noch zu sagen haben?«, fragte mich einer aus dem Festkomitee. »Was können wir denn aus dem Geschehenen lernen?«
Ich überlegte. Vierzehn Jahre war ich alt, als der Krieg aus war, und damals war ich fest davon überzeugt, dass das Böse, der Holocaust, gemeinsam mit den Kräften, die dieses Böse in die Welt gebracht hatten, niedergeschmettert worden war. Sechs Jahre später fing für mich in der Neuen Welt ein neues Leben an. Ein neues Lebenwein Leben ohne Bedrohung. In einer neuen Welt – einer Welt voller Hoffnung.
In Amerika wurde aus dem traumatisierten Mädchen schließlich eine Großmutter. Und ich musste zusehen, wie die Welt, die immer mehr von technischem Fortschritt geprägt war, gleichzeitig immer mehr bereit schien, Terror und menschliches Leid hinnehmen zu wollen.
Meine Angst ist zurückgekehrt. Und trotzdem: Meine Hoffnung, mein Traum von einer Welt ohne menschliche Grausamkeit und Gewalt, ist nicht geschwunden.
Ich hoffe, dass wir im Wissen um das Böse aus der Vergangenheit das Böse in der Zukunft vermeiden können. Ich hoffe, dass wenn wir uns klar machen, welch schreckliche Ereignisse Vorurteile und Intoleranz nach sich ziehen können, wir eine Vereinbarung zu treffen in der Lage sind, die uns gegen Vorurteile und Intoleranz angehen lässt.
Aus diesem Grund habe ich meine Erinnerungen an das Schreckliche niedergeschrieben. Nur wer wirklich dabei war, kann wahrhaftig über das Grauen berichten. Und ich war dabei.
Für euch, die dritte und vierte Generation, ist der Holocaust bereits Geschichte oder nur mehr Legende. Oder einfach eine Sensationsstory, die ab und an über die Mattscheibe flimmert. Doch ich bin mir sicher: Beim Lesen meiner Erinnerungen werdet ihr spüren – und wissen –, dass es sich beim Holocaust weder um eine Legende noch um ein Hollywood-Drama handelt, sondern um eine Lektion der Geschichte, die zu verstehen von großer Bedeutung für die Zukunft ist. Eine Lektion, aus der die nachfolgenden Generationen lernen können, wie zu vermeiden ist, dass das, was die Katastrophe des Zwanzigsten Jahrhunderts ermöglicht hat, in das einundzwanzigste weitertransportiert wird.
Ich erzähle hier von Gaskammern, Erschießungen, elektrisch geladenen Zäunen, von Folter, gnadenloser Sonne, seelischer Misshandlung und beständiger Todesangst.
Aber ich erzähle auch vom Glauben, von der Hoffnung, von Momenten des Triumphs und von der Liebe. Ich erzähle von Hartnäckigkeit, von Treue, von der durch nichts zu besiegenden Courage, und davon, dass man niemals aufgeben soll.
Das ist es, was ich euch zu sagen habe: Gebt niemals auf.
Die Stadt meiner Träume
Somorja, Sommer 1943–März 1944
Ich träume davon, die Schule in Budapest zu besuchen, der Hauptstadt. Budapest ist eine große, schöne Metropole mit breiten Straßen und großen Gebäuden und gelben Trambahnen, die um die Ecken flitzen. Alle Straßen in Budapest sind gepflastert. In unserer Stadt haben wir nur eine gepflasterte Straße, die Hauptstraße. Und die ist nicht breit. Wir haben weder hohe Gebäude noch Trambahnen, nur von Pferden gezogene Wagen und zwei Automobile. Eines davon gehört dem Vater meiner Freundin.
Unser Städtchen ist von der Landwirtschaft geprägt und liegt unweit der Kleinen Karpaten. Die lieblichen Hügel zeichnen sich in blauem Dunst im Westen ab. Im Süden pulsiert die Donau, der kühle, stetige Fluss, mit der Verheißung des Lebens. Wie sehr liebe ich es, in seiner klaren blauen und sich kräuselnden Strömung zu schwimmen und im Schatten des kleinen Wäldchens zu liegen, das sich an sein Ufer schmiegt.
Wir Kinder planschen den ganzen Sommer lang in der Donau. Familien picknicken im Gras, der Fußballverein der Stadt hat seinen Trainingsplatz in der Nähe, und die Schwimm-Mannschaft bereitet sich auf die jährlichen Meisterschaften vor. Und auch die Kaserne entleert ihren verschwitzten Inhalt, Hunderte von Rekruten, einmal pro Tag in die kühlen, reinigenden Fluten der Donau.
Wenn die Sonne hinter den Hügeln versinkt und der kleine Wald seinen langen Schatten über die Wiesen wirft, kommen Kuh- und Schafherden an den Fluss. Die Hirten treiben zuerst die Schafe, dann die Pferde und Kühe ins Wasser, fluchen dabei immer lauter, und jagen uns Kinder heraus. Mit der Dämmerung kommen auch die Stechmücken, und dann ist es Zeit zum Heimgehen.
Der Weg über die offenen Weiden ist angenehm und kühl, doch in der Stadt ist es heiß und staubig, wenn wir zu Hause ankommen. Die Schafe sind vor uns da, und sie sind es, die den Staub aufwirbeln. Aber bald senkt sich der Staub wieder, und das tut schließlich auch die Nacht. Eine dunkle, samtige Decke der Stille schirmt die Stadt behaglich von den Aufdringlichkeiten der Außenwelt ab. Ein Stern nach dem anderen scheint auf die staubigen Wege und die einzige gepflasterte Straße der Stadt. Gegen neun Uhr wird alles ruhig. Hier und da hört man das Bellen eines aufgeregten Hundes. Aber bald wird auch er schlafen.
Dann beginnt das Orchester von Insekten seine Ouvertüre, deren Einklang unterbrochen wird vom misstönenden Quaken eines Frosches, dem Bewohner eines kleinen Tümpels hinter dem letzten Haus in unserer Straße.
Ich liebe es, in der einbrechenden Nacht stundenlang wachzuliegen und meinen Gedanken nachzuhängen. Das Leben birgt ein aufregendes Rätsel, einen süßen, geheimnisvollen Zauber. In meiner Vorstellung bin ich eine gefeierte Dichterin, schön, elegant und sehr begabt. Meine Gedichte öffnen mir das Herz der Welt, und ich genieße das Gefühl, von der Welt umarmt zu werden.
Ich sehne mich danach, dass meine Mutter mich umarmt. Wenn am Schabbatmorgen meine Freundin Bonnie und ich unsere Mütter in der Synagoge treffen, nimmt Frau Adler Bonnie in ihre Arme und nennt sie meine Schönheit, auf Deutsch. Frau Adler gibt Bonnie immer deutsche Kosenamen. Mami begrüßt mich mit einem »Hallo« und einem Lächeln, ohne eine zärtliche Berührung oder ein Kosewort.
»Das ist doch alles Unsinn«, sagt meine Mutter, wenn ich mich beklage. »Willst du, dass ich dich ›meine Schönheit‹ nenne? Bonnies Mutter macht sich lächerlich. Jeder sieht doch, wie unscheinbar ihre Tochter ist!«
Was spielt es für eine Rolle, ob Bonnie nun hübsch ist oder nicht? Worauf es mir ankommt, ist, dass Bonnies Mutter denkt, sie ist schön. Und was ist mit der Umarmung?
»Ich halte nichts vom Schmusen«, erklärt Mami lächelnd. »Das Leben ist hart, und zuviel Zärtlichkeit macht dich weich. Wie willst du den Problemen im Leben begegnen, wenn ich dauernd mit dir schmuse? Du bist einfach zu sensibel. Wenn ich dich auf meinen Schoß nehmen würde, würdest du gar nicht mehr weg wollen … Du würdest weich wie Butter werden, unfähig, den Anforderungen des Lebens standzuhalten.«
Mamis Erklärungen sind nicht überzeugend. Ich glaube, sie umarmt mich nicht, weil ich nun einmal nicht zum Umarmen bin. Ich glaube, sie sagt nicht, ich sei schön, weil ich ihr nicht gefalle. Ich bin zu groß und schlaksig. Meine Arme und Beine sind zu lang, und dauernd werfe ich etwas um. Wenn ich ein Tablett mit Getränken trage, ruft Mami mir zu, ich soll nicht so tolpatschig gehen. Das ist der Grund, warum dann alles danebengeht. »Sieh dir Eva an. Sie ist ein Jahr jünger als du, aber ein Tablett kann sie wirklich geschickt tragen.« Oder: »Gestern war ich bei deiner Freundin Julie zu Hause. Du müsstest sehen, wie gekonnt sie ihrer Mutter beim Auftragen hilft!« Oder: »Siehst du deinen Bruder Bubi? Er ist ein Junge, und sieh nur, wieviel mehr er in der Küche hilft und um wie vieles geschickter er sich dabei anstellt!«
Das ist der wahre Grund dafür, dass meine Mutter mich ablehnt: mein Bruder. Er ist ihr Liebling. Nie gibt er Widerworte, sagt meine Mutter. Und nie fragt er: »Warum muss ich?«, wann immer sie ihm diese oder jene Anweisung gibt. Warum kann ich nicht wie er sein?
Warum kann ich nicht wie er aussehen? Mein Bruder sieht gut aus und ich nicht. Ich bin überhaupt nicht hübsch. Er hat lockiges Haar und ich nicht. Meine Haare sind glatt. Sie haben nicht einmal den Anflug einer Welle. »Es ist ein Jammer!«, höre ich meine Mutter zu einer Nachbarin sagen. »Was muss ein Junge so gut aussehen? Bei den beiden ist mir etwas durcheinandergeraten. Mein Sohn hätte das Mädchen werden sollen. Und wie meine Tochter aussieht, wäre ganz in Ordnung für einen Jungen.«
Und es gibt noch etwas. Mein Bruder Bubi ähnelt den vier Brüdern meiner Mutter. Mami nennt sie Meine-schönen-Brüder. Die drei Worte als ein Ausdruck. Bubi spricht wie sie, bewegt sich wie sie und verhält sich wie sie. Und er ist so großartig wie sie.
Ich schlage mehr der Familie meines Vaters nach. Die sind schon okay, aber weniger aufregend. Sie sind viel einfacher gestrickt.
Bubi ist ein Könner, ich hingegen bin nur fleißig. Ich meine, ich kriege gute Noten, weil mir das Lernen Spaß macht, aber mein Bruder kriegt gute Noten, ohne je ein Buch aufzuschlagen. Mami ist sehr stolz auf ihn. Papa lobt mich wegen meines Fleißes. Er sagt, Fleiß ist manchmal wichtiger als Können. Mit Fleiß erreicht man manchmal mehr.
Ich frage mich: Bedeutet der Umstand, dass ich fleißig bin, gleichzeitig, dass ich von Haus aus eigentlich nichts kann? Oder nicht begabt bin? Wie kann ich ohne Begabung je eine gefeierte Dichterin werden? Kann ich das allein durch Fleiß erreichen?
»Hör zu, Elli«, erklärt mir Mami, »du hast ein nettes Lächeln, und wenn du lächelst, hast du ein recht hübsches Gesicht. Wenn du also Menschen triffst, schenke ihnen ein Lächeln. Und sie werden dich für ein hübsches Mädchen halten.«
Ich höre zu und lächle, so oft ich kann.
Der Sommer geht vorüber und mein Bruder Bubi macht sich auf nach Budapest. Er ist dort Student am Jüdischen Lehrerseminar, und ich hoffe und bete, dass mein Traum, ihm in die Stadt zu folgen, nächstes Jahr wahr wird.
Dunkel verregnete Herbsttage gefrieren zu glitzernd weißem Winter. Die bedrückende ungarische Besatzung, das zähe Andauern des Krieges und immer größere Lebensmittelknappheit machen den Winter noch kälter. Hitlers gellende Rundfunkansprachen, insbesondere eine seiner unablässig wiederholten Ankündigungen: »Wir werden mit den Köpfen der Juden Fußball spielen«, versetzen mein Herz in Panik. Papa beruhigt mich. »Mach dir keine Sorgen, Elli-Kind. Das ist nur so dahergeredet. Nimm es nicht wörtlich, um Gottes willen.« Mit scharf hervortretenden Sorgenfalten in seinem ebenmäßigen, schönen Gesicht legt er die Hand auf meine Schulter. »Über diese Dinge sollst du gar nicht nachdenken, Ellike. Vergiss einfach, dass du so etwas gehört hast.«
Aber ich kann das Bild nicht aus meiner Vorstellung löschen. Blutige Köpfe, die über den Fußballplatz unserer Stadt rollen, werden zu einem immer wiederkehrenden Alptraum.
Im Verlauf des Winters verliert mein Vater etwas von seiner aufrechten Haltung. Er schweigt mehr und länger, und die Schatten unter seinen Wangenknochen werden deutlicher sichtbar. Seit dem Beginn der ungarischen Okkupation, und erst recht, seit vor drei Jahren unser Geschäft enteignet wurde, ist Papa immer abwesender. Sein berühmter Humor ist bitter geworden, sein Lachen ein seltener Genuss. Freude scheint er nur noch aus seinen Studien zu ziehen, und all die langen Winterabende verbringt er tief gebeugt über riesigen Bänden des Talmud.
An meinem Geburtstag, dem 28. Februar, beginnt der Schnee zu schmelzen. Das Frühjahr kündigt sich an. Papa ist wieder ein bisschen fröhlicher, und mein Herz singt vor Freude. Ich bin dreizehn geworden, und es scheint ein wunderbarer Frühling zu werden. Ich habe einen neuen Mantel mit Schulterpolstern bekommen, der mich weniger dürr und reifer aussehen lässt. Ich sehe mindestens wie fünfzehn aus in diesem wunderschönen Marinemantel mit den hohen Schultern. Sogar Jancsi Novák, mein Schwarm, lächelte mir zu und sagte: »Oh! Hallo.«
Viele andere wunderbare Dinge passieren in diesem Frühjahr. Ich habe gute Noten im Zeugnis, und Papa gab seine Zustimmung. Ohne eine Sekunde Zeit zu verlieren, forderte ich die Anmeldebogen für die Jüdische Schule in Budapest an. Ich schrieb auch einen langen Brief an Bubi.
Wie herrlich es ist, meine Träume mit jedem Tag, der vergeht, schärfere Gestalt annehmen zu sehen! Wie herrlich es ist, mich im Geiste dabei zu beobachten, wie ich in Budapest lebe und jeden Tag nach der Schule Bubi treffe! Mit ihm herumziehe! Mein Bruder kennt Budapest in- und auswendig.
An diesem Abend sind meine Gedanken nicht von schmerzender Sehnsucht durchzogen. Sie sind voller Vorfreude und ganz auf die Wirklichkeit gerichtet, und in einer Wolke glücklicher Erregung schlafe ich ein.
Es klopft laut an das Fenster bei meinem Bett. Im Nebenzimmer schrecken meine Eltern auf.
»Sie sind wieder da«, sagt mein Vater tonlos. »Was können sie diesmal wollen?«
»Sei bitte höflich zu ihnen«, flüstert Mami. »Es ist immer besser, umgänglich zu sein, auch wenn sie grob sind. Bitte. Wir müssen jeden Ärger vermeiden.«
Ich höre, wie Papa die vordere Ladentüre aufsperrt. Nun poltert es am Hintereingang des Hauses.
Ich höre, wie Papa hastig die Tür wieder verriegelt und zur Rückseite eilt. Ich höre Mutters Schritte ihm folgen.
Die Leuchtziffern der Uhr zeigen halb drei.
Sie kommen immer überraschend mitten in der Nacht, sie, die ungarische Militärpolizei. Sie kommen immer und schlagen an Fenster und Türen, fünf oder sechs von ihnen. Stiefel mit hohen Absätzen, Gewehre auf den Schultern, lange Hahnenfedern an schwarzen Helmen. Sie sind der Schrecken der Juden in den besetzten Gebieten. Sie veranstalten Razzien mitten in der Nacht, auf der Suche nach versteckten Waffen. Immer durchwühlen sie das Haus von oben bis unten, stochern mit Bajonetten wild im Mobiliar und schikanieren Papa wie einen Verbrecher.
»Ihr Juden versteckt doch feindliche Ausländer! Ihr kollaboriert doch mit dem Feind! Ihr wollt Ungarn an den Feind verraten!«
Sie nehmen immer mit, was ihnen gerade passt – Päckchen mit Kaffee, Tee, Schokolade. Sie öffnen Schränke und Schubladen und lassen eine Uhr, einen Füllfederhalter, ein Armband oder einen Seidenschal in ihren Taschen verschwinden.
Auf keinen Fall darf ich das Bett verlassen. Es ist Mamis Befehl, bis oben hin zugedeckt zu bleiben und mich schlafend zu stellen. Aber jedesmal blinzle ich und sehe, wie sie meinen Vater bedrohen und anherrschen und der sich auf die Lippe beißt. Mein Vater ist ein großer Mann, aber sie sind größer, mit ihren befederten Helmen. Mein Vater ist schlank, und sie sind bullig.
Normalerweise finden sie irgendein Vergehen. Einmal ›konfiszierten‹ sie den Wintermantel meiner Mutter mit der Begründung, er sei aus englischer Wolle hergestellt – Feindmaterial. Ein anderes Mal nahmen sie eine Schachtel mit Tee, weil es russischer Tee war – Feindesimport. Einmal karrten sie Schachteln voll Seife und Kisten voll Baumwollgarn weg. Es handelte sich um französische Seife und amerikanische Baumwolle. Ein schwerwiegender Tatbestand: heimlicher Handelsverkehr mit dem Feind. Eine Vorladung wegen der Zuwiderhandlung wurde auf dem Esszimmertisch zurückgelassen, und mein Vater hatte am nächsten Morgen auf der Polizeiwache zu erscheinen, geduldig eine endlose Folge sinnloser Fragen zu beantworten und ein ›Geständnis‹ der begangenen Verbrechen zu unterschreiben – nämlich englische Wolle, französische Seife, amerikanische Baumwolle, russischen Tee als vermeintlich ungarische Produkte auszugeben. Die Strafen waren gesalzen. Manchmal blieb mein Vater tagelang in Haft. Und wir durchlebten Höllenqualen: Foltern sie ihn? Werden sie ihn wieder herauslassen?
Ich höre Stimmen in der Küche. Warum bleiben sie so lange? Entgegen der Anweisung meiner Mutter schleiche ich auf Zehenspitzen zur Küchentür und spähe durch den Vorhang. Da steht, mitten im Raum, mit gerötetem Gesicht mein Bruder und redet erregt auf meine Eltern ein. Niemand sonst ist da. Wo ist die Polizei hin?
»Bubi!« Meine Überraschung ist so grenzenlos wie meine Freude. Ich stürze in die Küche, barfuß, und umarme ihn. »Bubi!«
»Pssst! Lasst uns leise sein.« Mein Vater ist bleich. »Setzen wir uns. Bubi, erzähl uns langsam und in Ruhe, was passiert ist.«
Die Deutschen sind in Budapest einmarschiert! Auf seinem Weg zum Unterricht hat Bubi heute Morgen deutsche Panzer die Andrássy út hinunterrollen gesehen. Und er sah eine riesige Hakenkreuzfahne am Parlamentsgebäude und eine lange Kolonne von Militärfahrzeugen mit Nazi-Fahnen die Hauptverkehrsstraße entlangfahren.
Sofort nahm er eine Tram zum Bahnhof, kaufte eine Fahrkarte und stieg in den nächsten Zug, der nach Hause fuhr. Seit dem Morgen ist er unterwegs gewesen.
Mein Vater legt seine Hand auf Bubis Schulter. »Mein Sohn, irgendetwas stimmt da nicht ganz. Wie soll das gehen, dass die Deutschen in Budapest einmarschieren und das ganze Land nichts davon mitbekommt? Kein Wort im Radio. Kein Wort in den Zeitungen. Wie kann das sein?«
Mamis Stimme klingt angestrengt. »Wir werden das in der Früh sehen. Die Zeitungen bringen die Neuigkeit sicher als Schlagzeile. Dann werden wir wissen, was zu tun ist. Lasst uns jetzt ruhig wieder zu Bett gehen.«
Am Morgen gibt es keinerlei Nachrichten von einem Einmarsch.
»Bubi, ich habe niemandem gesagt, dass du heut Nacht heimgekommen bist. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass es ein falscher Alarm war. Ich bin mir sogar absolut sicher. Ich mache dir keinen Vorwurf wegen deiner Angst und werfe dir nicht vor, dass du heimgekommen bist. Es sind halt beängstigende Zeiten«, sagt Vater sanft.
In Bubis Augen ist ein seltsames Flackern. Er sagt nichts.
»Aber es gibt für dich keinen Grund, hierzubleiben und den Unterricht zu versäumen. Ich denke, es ist am besten, wenn du schnurstracks wieder zurückfährst. Um dreizehn Uhr geht ein Schnellzug nach Budapest.«
»Aber Papa, ich habe sie gesehen – die Panzer, die Hakenkreuzfahnen. Überall. Und die Menschenmengen. Ich hörte sie ›Heil Hitler‹ schreien!«
»Das muss eine Demonstration gewesen sein. Irgendein Nazi-Aufmarsch … Wenn du den Ein-Uhr-Zug nimmst, kannst du morgen früh pünktlich zum Unterricht da sein. Dann hast du nur diesen einen Tag verpasst.«
Bubi wendet den Blick ab. Dem Vater muss man gehorchen. Mutter ist auch dieser Meinung und richtet ein Proviantpaket für meinen Bruder her.
Ich küsse meinen Bruder zum Abschied, und ein heftiger Schmerz fährt durch mein Inneres.
Wir bringen ihn nicht zum Bahnhof, um keinen Verdacht zu erregen. Die Menschen würden Fragen stellen. Und wir haben keine Antworten.
Bubi fährt mit dem 13-Uhr-Express nach Budapest.
Zwanzig nach eins kommt Herr Kardos, der Rechtsanwalt von unten an der Ecke, dessen Sohn auch in Budapest studiert, auf unser Haus zugerannt. Er hat ein Telegramm von seinem Sohn bekommen: deutsche in budapest einmarschiert! Er will wissen, ob wir irgendetwas von Bubi gehört haben.
Vater wird weiß wie ein Laken. »Mein Sohn ist in diesem Moment unterwegs Richtung Budapest.«
»Was? Er war hier? Und sie wussten es? Sie wussten es und haben nichts gesagt?«
»Ich habe ihm nicht geglaubt. Niemand wusste von irgendetwas. Es kam nichts in den Zeitungen. Nichts im Radio. Was sollen wir jetzt machen?«
»Ich fahre nach Budapest. Und hole meinen Sohn heim.«
Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich meine Mutter weinen. Sie ist eine starke Frau, immer gut gelaunt und optimistisch. Aber heute quellen ihr die Augen über und sind gerötet. Das Gesicht meines Vaters ist aschfahl, und seine Hände zittern, während er sich eine Zigarette nach der anderen anzündet. Ich möchte schreien und schreien.
Am nächsten Morgen trompeten die Schlagzeilen: WIR SIND FREI! HITLERS GLORREICHE ARMEE IN BUDAPEST!
Den lieben langen Tag plärrt das Radio »Deutschland, Deutschland über alles«, und das ganze Land ist in heller Aufregung wegen der Neuigkeit. Zwei Tage zu spät. Zwei Tage zu spät.
Es erreichen uns Nachrichten von Juden, die in Budapest auf offener Straße, in der Straßenbahn, am Arbeitsplatz, an Bahnhöfen verhaftet und in Güterzüge gepfercht wurden. Und die Züge sind mit Ketten verschlossen. Wohin bringt man sie? Niemand weiß das.
Vater hört auf, im Zimmer auf und ab zu gehen. »Ich halte es nicht mehr aus. Es gibt einen Zug um zwanzig Uhr. Ich fahre nach Budapest, um Bubi herzubringen.«
»Es ist zu spät. Sie werden auch dich verhaften. Du wirst nicht in der Lage sein, ihm zu helfen. Bleib hier bei uns. Gott wird uns beistehen und ihn retten.«
Mutters Stimme ist eigenartig zittrig. Ich umarme sie und sie bricht in Tränen aus. Vaters hohe, aufrechte Gestalt bröckelt in sich zusammen wie ein vertrockneter Keks. Lieber Gott, wenn nur Bubi da wäre!
In der Nacht kommt Bubi aus Budapest an.
Herr Kardos kehrt nicht zurück. Auch sein Sohn Gyuri nicht. Sie werden in Güterzügen abtransportiert. Sie sind die ersten Todesopfer des Holocaust, gemeinsam mit all den anderen Jungen und Mädchen aus unserer Stadt, die in Budapest studiert haben. Sie alle wurden aus der schönen ungarischen Hauptstadt weggebracht, in Zügen, mit Ketten verschlossen und mit unbekanntem Ziel.
Budapest, die Stadt meiner Träume, ist zum Vorzimmer von Auschwitz geworden.
»He, Judenmädchen, Judenmädchen …«
Somorja, 25. März 1944
Fast unhörbar sagte Frau Kertész: »Auf Wiedersehen, Klasse. Auf Wiedersehen, Kinder. Ihr könnt jetzt alle heimgehen.«
Frau Kertész, unsere Klassenlehrerin, hatte gerade die schockierende Mitteilung gemacht: »Das Königlich Ungarische Ministerium für Erziehung hat … im Interesse der allgemeinen Sicherheit … für alle Schulen des Landes ein Ende des Unterrichts angeordnet. Mit sofortiger Wirkung …« Ihr Stimme brach und sie schluckte heftig. »Unsere Schule ist jetzt also geschlossen.«
Wir haben Samstag, den 25. März 1944. Sechs Tage ist es her, dass die Deutschen in Budapest einmarschiert sind. Was ist mit dem Schulabschluss in drei Monaten? Und mit den Zeugnissen?
Aber Frau Kertész geht aus dem Klassenzimmer, bevor jemand etwas fragen kann. Sie geht, ohne ein Wort über die deutsche Besatzung zu verlieren und ohne einen Hinweis darauf zu geben, was als nächstes geschehen wird.
Wir sitzen in verstörtem Schweigen und starren einander an. Und dann, langsam, ganz langsam, stehen meine Klassenkameradinnen eine nach der anderen auf und verlassen den Raum.
Auch ich erhebe mich und sehe mich um. Die abgenutzten Holzbänke, festgeschraubt am dunklen, speckigen Boden. Die getünchten Wände, behängt mit abgegriffenen Landkarten und ausgebleichten Bildern. Alles ist so vertraut und heimelig. Sogar das dunkelgrüne Kruzifix über der Tür wirkt beruhigend.
Fast vier Jahre lang habe ich mich in diesem Zimmer abgemüht, habe geschwitzt und manchmal auch triumphiert. Da vor der Tafel. Fast vier Jahre lang habe ich die Luft hier geatmet, den Geruch des gewienerten Bodens, durchsetzt mit Kreidestaub und voll Aufmerksamkeit und Aufregung.
Werde ich jemals wieder an dieser schmalen, von tausend Bleistiften zerfurchten Schulbank sitzen? Werde ich jemals wieder mit meinen Mitschülerinnen Geheimnisse austauschen und ausgelassen herumalbern?
Vielleicht macht die Schule ja bald wieder auf. Vielleicht kommt das Land unter der deutschen Besatzung zur Ruhe, und alles ist wieder wie vorher. Ziemlich sicher ist bald alles wieder wie vorher. Der Unterricht wird wieder aufgenommen, und unsere Klasse wird wieder zusammenkommen. Und wir werden wie geplant den Schulabschluss machen. Dessen bin ich mir ziemlich sicher.
Ich beschließe, das Gebäude durch den Haupteingang zu verlassen. Den nehmen die Jungen immer. Vielleicht ist Jancsi Novák auch gerade am Gehen. Ich möchte ihn noch einmal sehen.
Als ich auf die Eingangshalle zugehe, versperrt mir ein ausgestreckter Arm den Weg. Erstaunt blicke ich auf. Es ist nicht Novák. Ein untersetzter, pickelgesichtiger Junge mit dunklem, fettig zurückgekämmtem Haar steht grinsend vor mir. Er hebt seinen Arm zum Führergruß und sagt: »Heil Hitler!« Eine Gruppe von Jungen, auf beiden Seiten der Treppe aufgereiht, antwortet wie ein Echo: »Heil Hitler!«
Grinsend.
Ich gehe durch sie hindurch die Treppe hinunter, mit erhobenem Kopf und nach vorne gerichtetem Blick. Sie fangen an zu rufen, laut und lauter: »Heil Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!«
Ich renne die Treppe hinunter. Der untersetzte Junge ruft: »Nieder mit den Juden! Nieder mit den Juden!« Und die anderen geben das Echo, lauter und lauter: »Nieder mit den Juden! Nieder mit den Juden!«
Ich eile die Treppe hinab und hinaus auf die Straße. Ich laufe und laufe. Andere Klänge dringen an mein Ohr. Ich erkenne sie wieder. Meine Schulkameraden singen den vulgären Militärmarsch »Hej, zsidó lány, zsidó lány …« He, Judenmädchen, Judenmädchen … Noch weit von der Schule entfernt kann ich sie das widerwärtige Lied singen hören.
Die Klänge begleiten mich nach Hause. Spöttisch, höhnisch, vernichtend. Klänge wie Schläge. Klänge, die töten können. Im Laufen geht einer meiner Zöpfe auf. Tränen verkleben mir die Kehle. Schweiß rinnt mir den Rücken hinab. Meine Schläfen hämmern.
Niemand ist zu Hause. Heute ist Schabbat und meine Eltern sind noch in der Synagoge. Ich fische mir den Eingangsschlüssel unter der Fußmatte hervor und werfe die schwere Eichentür hinter mir zu. Ich laufe in mein Zimmer und vergrabe das Gesicht im Kissen. Der Magen zieht sich mir zusammen, im Rhythmus meines Weinkrampfes.
Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich weine um mein Klassenzimmer, das nicht länger mein Klassenzimmer ist. Um die Schule, die nie wieder meine Schule sein wird. Ich weine um mein Leben, das nie wieder das gleiche sein wird.
Die Geschichte vom gelben Fahrrad
Somorja, 27. März 1944
Der gefürchtete Moment ist gekommen: Es gibt keinen Ausweg mehr. Wir sind in der Hand der SS. Unsere ›Liquidierung‹ hat begonnen.
Wir sind verloren und ohne jede Hilfe. Wie lebloses Material werden wir auf einem antriebsstarken Förderband einem unbekannten Schicksal entgegentransportiert. Es ist seltsam, aber der reibungslose Ablauf der Vorgänge wirkt irgendwie beruhigend.
Das Einfachste ist aufzugeben. Der Kampf ist vorbei. Vielleicht ist es Gottes Wille. Nein, nicht vielleicht. Mit Sicherheit ist es Gottes Wille.
An einem Montagmorgen im März müssen sich alle Juden im Rathaus einfinden und registrieren lassen. Wir müssen uns in Reihen aufstellen, damit man uns zählen kann, und wir bekommen Kennzeichen angesteckt. Wie Kinder, die ins Ferienlager gehen. Oder Tiere, die eine Tierhandlung verlassen.
Man befiehlt uns, unsere Wertsachen abzugeben – Schmuck, Radios und Fortbewegungsmittel.
Ich muss mich von meinem neuen Schwinn-Fahrrad trennen.
Das Fahrrad ist mein einziger wirklicher Besitz. Es ist ein Geburtstagsgeschenk meiner Eltern. Jahrelang hatte ich gehofft und gebetet, ein Rad zu bekommen, und mein neues Schwinn ist schöner als alles, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Noch großartiger.
Es ist strahlend gelb und hat gelbrote Muster auf den schwarzen Reifen. Es hat einen dunkelgelben Ledersattel und die gleiche Farbe haben auch die Griffe am glänzenden Chromlenker. Es ist einfach wunderschön.
Ich und mein Fahrrad hergeben? Ausgeschlossen! Wie können sie mir nur sagen, ich soll es zum Rathaus bringen und einfach dort lassen – diesen, meinen wertvollsten Besitz? Ohne meinem Protest Ausdruck zu geben? Ohne auch nur eine Erklärung zu verlangen? Nicht im Traum habe ich je daran gedacht, dass so etwas möglich sein könnte.
Das Gesicht meines Vaters war zu einer Maske gefroren, als er uns diese Nachricht am Sonntagnachmittag überbrachte. Ich fing an zu schreien. Ich würde das nicht machen. Sollten sie mich umbringen, aber mein Fahrrad würde ich mir nicht wegnehmen lassen. Ich war noch nicht einmal damit gefahren. Das Frühjahr fing ja erst an. Ich hatte auf das Frühjahr gewartet, um es auszuprobieren. Der Schnee hatte gerade erst zu schmelzen begonnen, und sobald Matsch und Dreck weg waren, wollte ich mein brandneues, glänzendes Rad auf die Straße bringen. Ich konnte mich jetzt nicht von ihm trennen!
In meiner Angst und meiner Wut fühlte ich mich hilflos, ausgeliefert. Vergewaltigt.
Vater redete ruhig, beinahe flüsternd, auf mich ein. Seine Stimme klang erstickt, voll Zorn und Schmerz. »Sobald das alles vorbei ist, dieser ganze Wahnsinn, kaufe ich dir ein neues Schwinn. Kümmere dich nicht um dieses hier, Elli. Mach dir nichts draus. Du wirst das schönste Fahrrad überhaupt haben. Ein Erwachsenenrad. Größer als dieses und noch viel schöner.«
»Ich will aber kein anderes Rad. Ich habe noch nicht einmal dieses ausprobiert. Mit welchem Recht nehmen sie es mir weg? Ich habe es von dir bekommen. Es ist mein Geburtstagsgeschenk. Es gehört mir. Wie können sie es mir einfach wegnehmen?«
Vatis weiche Hände liebkosten tröstend meine Wangen, während ich schluchzte. Wieder und wieder sagte er: »Mach dir nichts draus, Ellike. Mach dir nichts draus.«
Am Montagmorgen, als ich aufrecht und gerade mit meinem Schwinn gehe – zwischen meinem Vater und meinem Bruder, die beide ihre eigenen Räder schieben –, empfinde ich keine Wut oder Angst mehr. Nur Trauer und Demütigung. Als ich dann aber mein strahlend glänzendes Rad an die Wand gelehnt neben all den anderen, verbeulten alten Fahrrädern sehe, spüre ich, wie es mir den Boden unter den Füßen wegzieht.
Benommen folge ich Vati und meinem Bruder ins Innere des Rathauses. Schmuck, Radios und Fotoapparate sind auf langen Tischen aufgehäuft. Mami steht in einer Warteschlange, um einen Teil ihres besten Silberbestecks und ihren antiken silbernen Kronleuchter oben auf den Haufen zu legen. Ich sehe ihr nicht ins Gesicht. Aber ich sehe die anderen Gesichter, wie sie sich nach der Abgabe der Wertgegenstände von den Tischen abwenden. Erniedrigung und Scham spiegeln sich in jedem der Augenpaare.
An diesem Abend führt mich Vater hinunter in den Keller. In der hinteren Ecke des feuchten, dunklen Raumes ist im Licht der Taschenlampe eine unebene Stelle im Erdboden zu sehen.
»Schau, Elli. An dieser Stelle habe ich unsere wertvollsten Schmuckstücke vergraben, etwa fünfundzwanzig Zentimeter tief. Mami und Bubi kennen die Stelle auch. Jeder von uns sollte wissen, wo der Schmuck vergraben ist. Wir wissen nicht, wer von uns zurückkehrt. Wirst du dir das merken?«
Ich weigere mich hinzusehen. »Ich will es nicht wissen! Ich will es mir nicht merken!«
Vati legt seinen Arm um meine Schultern. »Elli … Ellike …«, wiederholt er sanft. Dann begleitet er mich mit schweren Schritten die Stufen hinauf.
In der Küche wendet sich Mami vom Herd zu uns und fragt Vati nüchtern: »Hast du es ihr gezeigt?«