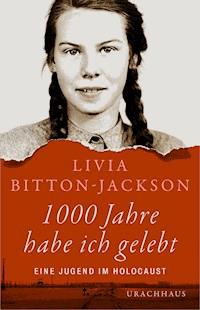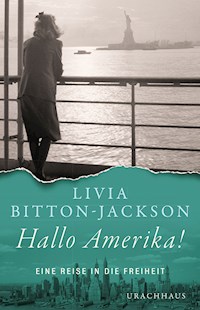Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager finden Elli, ihre Mutter und ihr Bruder ihr Haus geplündert und zerstört. Die ehemaligen Nachbarn sind zurückhaltend – überhaupt wird ihr schnell bewusst, dass das Ende des Krieges nicht gleichbedeutend ist mit dem Ende des Antisemitismus. In den sechs Jahren, die sie auf ihr Visum für die USA warten muss, unterrichtet sie und riskiert ihr Leben, indem sie Flüchtlingen hilft, auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs und nach Palästina zu gelangen. Wie viel Freiheit bedeutete die Befreiung aus Dachau? In dieser Fortsetzung ihrer Memoiren berichtet die heute 87-jährige Livia Bitton-Jackson von den Schwierigkeiten der Jahre nach dem Krieg. Antisemitismus und Vorbehalte gegenüber Fremden waren nach wie vor an der Tagesordnung. Ein unverzichtbares Zeugnis für unsere Zeit! Verfasst von einer der letzten Überlebenden des Holocaust. • Deutsche Erstausgabe! • Erschütternde Schilderung einer der letzten Überlebenden des Holocaust. • Zweiter Teil der bewegenden Autobiografie einer faszinierenden Frau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Livia Bitton-Jackson
Brückender Hoffnung
Aus dem amerikanischen Englischvon Dieter Fuchs
Inhalt
Vorwort
Heimkehr
Wieder in der Schule
Der »Tattersall«
Vatis Mantel
Miki
Ein Brief aus Amerika
Unser Ziel ist Amerika
Die Barischna
»Ich ertrage die Sonne nicht!«
Meine erste bezahlte Arbeit
Ich mache Ferien
Ein langer Tag
Die Bescheinigung
Ich schaffe das
»Bis Mama und Papa wieder da sind«
Vorbereitung auf die Wanderung
Ein jähes Erwachen
Warum glaubt mir denn keiner?
Restlos ausgefüllte Tage
Ein schmerzlicher Abschied
Ein verlorenes Kind
Tanz auf der Kreuzung
Ginas Geheimnis
Bricha
Das Hagana-Camp
»Wie wir feststellen mussten …«
Vilo
Unsere letzte Chance
Der Transport ist in Gefahr
Die »Untersuchung«
An der Grenze
Endlich in Freiheit
Frühling in Wien
Andy
Besuche in der Klinik
Auf Wiedersehen, Wien
Wieder in Deutschland
Lager Feldafing
Lager Geretsried
So ist es doch geschehen …
Epilog
Anhang
Vorwort
Ich war dreizehn, als 1944 die Deutsche Wehrmacht mit Hakenkreuzfahnen in Budapest einmarschierte und mein Leben sich für immer veränderte. Nach wenigen Tagen wurde meine Familie – meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Tante und ich selbst – ihrem Zuhause entrissen. Man brachte uns in eine andere Stadt und pferchte uns zusammen mit Tausenden anderer Juden auf dem Gelände der Synagoge ein. Dieser Ort diente als »Ghetto« oder Durchgangslager, in welchem wir auf unsere »Deportation« warteten.
Die folgende dreitägige Fahrt in einem ebenso dunklen wie überfüllten Zug, ohne Luft und frisches Wasser, war das Vorspiel zu unserem Albtraum von Auschwitz, jenem Konzentrationslager, in dem über vier Millionen Menschen ermordet wurden und nur ein paar Tausend überleben durften, um Sklavendienste zu verrichten. Mein Vater war da schon nicht mehr bei uns. Ein paar Tage vor unserer erzwungenen Zugfahrt wurde er überraschend und ohne Abschied von uns getrennt und in ein anderes Lager gebracht.
Bei unserer Ankunft in Auschwitz stieß man meinen siebzehnjährigen Bruder erbarmungslos in die Reihe der Männer. Sodann setzte sich ein verzweifelter Zug aus Frauen und weinenden Kindern in Bewegung. Angetrieben von bellenden Hunden und einem Gewitter aus Hieben und Schlägen erreichten wir schließlich das Lagertor. Hier entschied ein Mann namens Doktor Josef Mengele, wer leben durfte und wer sterben musste. Den Stock in der Hand, selektierte Doktor Mengele meine Tante Serena zusammen mit Alten, Schwachen und Müttern mit ihren Kindern für die Gaskammer.
Weil ich groß für mein Alter war und durch meine blonden Zöpfe ein »arisches« Aussehen hatte, zog Dr. Mengele, der »Engel des Todes«, mich und Mami aus der Reihe, die zur Gaskammer führte. Anstatt im Krematorium umzukommen, wurden meine Mutter und ich zu einem Leben im Inferno verdammt.
Durch viele wundersame Fügungen blieben meine Mutter und ich bis zum Ende des Krieges am Leben. Am 30. April 1945 befreiten uns amerikanische Soldaten aus einem Zug, in dem 30 000 sterbende Insassen verschiedener Lager an einen unbekannten Ort verbracht werden sollten.
Durch eine weitere glückliche Fügung befand sich auch mein Bruder Bubi in diesem Zug. So erlebten wir den bitteren Geschmack der Freiheit gemeinsam. Zusammen stellten wir uns der Realität eines Lebens nach der Befreiung – und wurden dabei langsam gewahr, wen und was wir alles verloren hatten.
Dann machten wir uns auf den Heimweg.
Ich hätte mir nicht ausmalen können, welche Sorgen und Abenteuer mich erwarteten – und dass unser Bemühen, einen sicheren Hafen zu erreichen, sechs zermürbende Jahre dauern würde. Dieses Buch beschreibt jene Jahre, den verbliebenen Rest meines Teenagerdaseins, in dem wir jungen Überlebenden, beladen mit der Last der Vergangenheit, versuchten, unser Leben zurückzuerobern. Es ist die Geschichte unserer verzweifelten Suche nach Liebe und Sinn in einer Zeit, in der die Welt um uns herum durch die Nachbeben des Krieges zugrunde zu gehen schien.
Dies ist die Geschichte von Triumphen im Angesicht überwältigender Widrigkeiten, eine Geschichte außerordentlicher Ereignisse in einer außergewöhnlichen Zeit. Und dennoch denke ich, dass es im Grunde die Geschichte eines Teenagers ist. Sie spiegelt die Probleme, Ängste und Hoffnungen wider, die so gut wie jeder junge Mensch der Menschheitsgeschichte irgendwann einmal hat.
Dieser junge Mensch hättest auch du sein können.
Heimkehr
Šamorín, Juni–Juli 1945
Wir sind wieder zu Hause.
Der Bauer, auf dessen Karren wir mitgefahren sind, setzt uns – meine Mutter, meinen Bruder und mich – direkt vor unserem Haus ab, vor unserem Heim, aus dem man uns vor über einem Jahr deportiert hat. Das Haus steht noch immer auf derselben kleinen Anhöhe, auf der es sich seit einem halben Jahrhundert befindet. Wie gewohnt duckt es sich bescheiden in den Schatten der riesigen Akazie. Aber es leuchtet nicht mehr gelb. Die Farbe ist ausgebleicht und mit grauen Flecken übersät. Und es gibt keine Fenster mehr. Jemand hat sie aus den Angeln gehoben.
Vor etwas über einem Jahr wurden wir brutal aus dem Schoß unserer Heimat gerissen, und jetzt schaut uns das Gebäude mit dem leeren Blick einer verrückten alten Frau an, verständnislos und abweisend.
Wir halten den Atem an und gehen auf unser geliebtes Haus zu. Einer nach dem anderen bewegen wir uns durch die Spinnweben der Zeit, über den kleinen Hof und hinein in die große Küche, den weiträumigen Salon. Die Zimmer sind leer … Möbel, Geschirr, Alltagsgegenstände, Vorhänge und Teppiche sind verschwunden. Sogar die Pumpe an der Wasserstelle ist nicht mehr da.
Dafür gibt es in jedem Raum ein Häufchen menschlicher Ausscheidungen.
Unsere Heimatburg ist jetzt ein kahles Gerippe ohne jede Würde. Eine leere Hülle, der die Seele geraubt wurde.
Wer hat das getan? Wer hat uns unser Zuhause genommen?
Und wo ist Vati?
»Der wohnt sicher irgendwo anders«, versichert uns Mami. »Wie sollte er denn hier leben?«
Wie sollte überhaupt jemand hier leben?
»Stroh!«, ruft Mami fröhlich. »Lasst uns Stroh von den Nachbarn holen. Das wird gehen. Darauf können wir schlafen.« Mami ist wieder in ihrem Element.
Unsere direkten Nachbarn, die Familien Botlós und Plutzer, erschüttert unser Anblick genauso wie die Mérys am Ende der Straße. Sind wir womöglich Geister, die von den Toten zurückgekehrt sind? Sie schlagen die Hände vors Gesicht und schütteln fassungslos den Kopf. Sie sind so schockiert, dass sich ihre Ausrufe nach und nach in Schreie des Entsetzens verwandeln.
»Jesus Maria! Frau Friedmann?! Sind Sie das?«
»Elli?! Bist du das?«
»Oh, heiliger Jesus! Und der hier soll der junge Herr Friedmann sein?!«
»Sie sind wieder da! Ich kann es kaum glauben. Wir dachten, dass … dass von dort niemand zurückkommt!«
»Mein Gott, wie anders Sie aussehen! Sie sind ja nicht wiederzuerkennen!«
»Wie abgemagert Sie sind! Nicht zu fassen, dass Sie das sind!«
»Was haben die bloß mit Ihnen gemacht?«
»Elli, was haben sie mit deinen Haaren angestellt, deinen wunderschönen Haaren? Was ist mit den langen Zöpfen passiert? Warum sind deine Haare so kurz?«
»Wo ist Herr Friedmann?«
»Und Frau Serena? Und all die anderen?«
»Ist die ganze Familie zurückgekehrt?«
»Sind alle so … nur Haut und Knochen? So verändert?«
Frau Plutzer gibt uns einen Ballen Stroh, einen Krug Milch und ein Körbchen voller Eier. Frau Méry bringt einen Besen, damit wir den Boden fegen können. Frau Botlós schleppt Schüsseln mit Obst und Gemüse heran. Herr Botlós bringt Holzbretter und nagelt damit die Fenster zu. Von anderen bekommen wir einen Sack Kartoffeln und Feuerholz, und das Haus erwacht wieder zum Leben.
Vati wird staunen, wie schnell wir es wieder bewohnbar gemacht haben. Bubi, mein Bruder, hat Schmerzen in seinem verletzten Bein, deshalb sagt meine Mutter, er solle sich auf dem Stroh ausstrecken. Stattdessen geht er ins Dorf, um Vati zu suchen.
Einige der jüngeren Männer und Frauen sind zurückgekehrt. Offiziell heißen wir »Repatriierte«, also Deportierte, die wieder heimgefunden haben. Manche Häuser sind mittlerweile unbewohnbar, deshalb finden ihre Besitzer Unterschlupf in einem verlassenen Gebäude, welches die Regierung extra für die Heimkehrer bereitgestellt hat. Vati ist nicht unter ihnen.
Nach und nach treffen immer mehr Überlebende ein. Aber keine Spur von Vati. Wo kann er nur sein? Warum braucht er so lang?
Wir sind schon ganze zwei Wochen wieder daheim, als wir endlich etwas von ihm hören. Neuankömmlinge haben ihn in Österreich gesehen, und zwar in Begleitung eines gewissen Herrn Weiss, der in einem vierzehn Kilometer entfernten Dorf wohnt. Gott sei Dank – in ein oder zwei Tagen wird er bei uns sein!
Nachdem eine weitere Woche vergeblichen Wartens verstrichen ist, kann Bubi im Lieferwagen eines Viehhändlers mit in das Dorf von Herrn Weiss fahren, um sich nach Vati zu erkundigen. Ich will auch mit, aber Mami hat viel zu viel Angst, dass sich in der Gegend russische Soldaten herumtreiben. Es kursieren allerhand Gerüchte von Vergewaltigungen und Raubüberfällen durch unsere sowjetischen Besatzer.
»Für dich als Mädchen ist so ein Ausflug viel zu gefährlich«, sagt Mami entschieden. »Besser, du bleibst hier bei mir. Du musst einfach geduldig sein und warten, bis wir etwas von Vati hören. Heute Abend ist Bubi wieder da. Du und ich, wir warten hier gemeinsam.«
Eine Stunde später kommt Bubi wieder zur Tür herein, weiß wie eine Wand. Als ich ihn ansehe, schließen sich eiskalte Finger um mein Herz und bringen es zum Stillstand. Kaum hörbar fragt Mami: »Bubi, was ist passiert?«
»Ich bin gar nicht erst gefahren. Der Viehhändler hat es mir gesagt.«
Die Zeit bleibt stehen. In vollkommener Stille beginnt die Welt sich so schnell um mich zu drehen, dass ich mich an der Lehne von Mamis Stuhl festhalten muss. Von irgendwo aus der Leere dringt Bubis Stimme zu mir: »Vati wird nicht nach Hause kommen. Er ist zwei Wochen vor der Befreiung in Bergen-Belsen gestorben …«
Mein Aufschrei klingt wie das Jaulen eines verwundeten Tieres. Ich laufe hinaus ins Freie. Bubi kommt hinter mir her und führt mich vorsichtig zurück in die Küche.
»Elli, ich muss einen Riss in dein Kleid machen«, sagt er, und die Trauer in seiner Stimme zerrt schmerzhaft an meiner Wunde. »Und dann werden wir eine Stunde lang Shiwa sitzen. So ist die Vorschrift. Wenn die Todesnachricht erst nach der dreißigtägigen Trauerperiode eintrifft, sitzt die Familie nur eine Stunde Shiwa, anstatt wie sonst eine ganze Woche. Vati ist im April gestorben, und jetzt haben wir schon Juli.«
Ich heule weiter, während Bubi mein Kleid am Kragen einreißt. Dann drückt er mich vorsichtig zu Boden, wo ich neben Mami sitzen bleibe. Meine sonst so schöne Mami ist kreidebleich und leblos wie eine chinesische Puppe und starrt vor sich hin.
Wie sollen wir ohne Vati der Zukunft entgegensehen?
Wieder in der Schule
Šamorín, September 1945
Die langen, heißen Sommertage sind vorüber und die Blätter unserer Akazie haben sich goldgelb verfärbt. Während ich mit den Schulheften unter dem Arm die Hauptstraße entlanglaufe, sauge ich mit der Atemluft die melancholische Botschaft des Herbstes ein. Die letzten Überbleibsel des Sommers mit gelegentlichen Funken von Sonnenlicht überdecken ein zartes und bittersüßes Gefühl des Abschieds. Eine Schultasche aus Leinen, die Mami aus einem alten Rucksack geschneidert hat, ist stolz über meine Schulter geschwungen. Ich gehe wieder zur Schule.
Ich bin hier die einzige Überlebende, die wieder die Schulbank drücken will, und so besuche ich erneut meine alte Schule, die städtische Mittelschule von Šamorín. Erneut bin ich in der Abschlussklasse, in meinem alten Klassenzimmer. Genau wie früher hängt der Geruch nach ranzig gewordenem Öl im Raum. Die Tafel hat an denselben Stellen Risse. Wenn die Kreide über die Tafel quietscht, bekomme ich wie schon seit jeher Gänsehaut. Und auch das Läuten der Schulglocke am Ende der Stunde erschreckt mich immer noch.
Und doch ist nicht alles so wie einst. Andere Mitschüler. Andere Lehrer. Eine andere Unterrichtssprache. Unsere Stadt und die umliegende Gegend gehören nicht mehr zu Ungarn. Sie gehören jetzt wieder zur Tschechoslowakei. Viele meiner christlichen Freunde sind mit ihren Familien als alteingesessene ungarische Bauern und Landbesitzer auf die andere, die ungarische Seite der Donau umgesiedelt worden. An ihrer statt wurden neue Leute geholt. Tschechische und slowakische Lehrer unterrichten jetzt anstelle der ungarischen, die ich früher hatte. Und die ich geliebt habe. An der Schule findet sich kein einziges bekanntes Gesicht mehr.
Meine Klassenlehrerin war früher Frau Kertész. In den Lagern, bei der Zwangsarbeit, bei den endlosen Zählappellen und in überfüllten Viehwaggons habe ich immer wieder sehnsüchtig an sie gedacht. Da ich weder Papier noch Stifte hatte, schrieb ich ihr in Gedanken lange Briefe und berichtete darin von meinen Sorgen, meinem Schmerz und meiner Todesangst. Und ich betete, dass ich eines Tages zurückkehren würde und ihr diese Briefe wie ein Kapitel meiner Seele in die Hand drücken könnte. In Gedanken sah ich sie lächeln und mich loben.
Nun bin zwar ich zurückgekommen, aber nicht Frau Kertész, und niemand hier hat je von ihr gehört.
Kein Mensch erinnert sich an Herrn Apostol, der früher unser Rektor war und wie eine mächtige Zitadelle über die Schule wachte. Keiner kennt Herrn Kállai, den beliebten Sachkundelehrer, oder Fräulein Aranka, die kleine, alte Jungfer, durch die der Mathematikunterricht zum Synonym für blanken Terror wurde. Ich bin die Einzige, die sich an all diese Menschen erinnert. Und ich habe niemanden, mit dem ich meine Erinnerungen teilen könnte.
Nicht ein Jahr und zwei Monate lang war ich weg – nein, eine ganze Ewigkeit. Ich war auf einem anderen Planeten, im Reich der Vernichtungslager Polens und Deutschlands.
Als ich weggebracht wurde, war ich eine energiegeladene Dreizehnjährige mit langen, blonden Zöpfen und in glücklicher Erwartung der Überraschungen, die das Leben für mich bereithielt. Ich kam zurück als wissende, geläuterte Erwachsene, bar meiner Zöpfe und jeder Erwartung.
Die Haare wachsen jetzt wieder. Und ich habe zwei neue Freunde. Am dritten Schultag, als ich in der Pause alleine dastand, kamen Yuri und Marek auf mich zu und wollten wissen, wer ich sei. Als ich auf Slowakisch antwortete, sprangen sie vor Freude fast in die Luft. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass ich sie verstehen würde. Yuri ist aus der Sowjetunion und kann nur Russisch, Marek ist aus Böhmen und spricht Tschechisch. Beide Sprachen sind mit dem Slowakischen verwandt, deshalb können wir uns problemlos verständigen. Alle anderen Mitschüler reden nur Ungarisch, was mit dem Slowakischen rein gar nichts gemein hat. Sie sind Slowaken, die in Ungarn geboren und zur Schule gegangen sind und von der Regierung erst kürzlich »repatriiert« wurden. Weil ich hier geboren bin, kann ich sowohl Ungarisch als auch Slowakisch. Binnen kurzer Zeit habe ich durch meine Sprachkenntnisse eine gewisse Berühmtheit erlangt und mir die Position der Klassendolmetscherin erarbeitet. Und die Freundschaft von Yuri und Marek. Mittlerweile sind wir unzertrennlich geworden.
Obwohl ich ein ganzes Schuljahr versäumt habe, sind meine Mitschüler so alt wie oder sogar älter als ich. Während der ungarischen Besatzung hatte ich die Möglichkeit, nach vier Jahren Grundschule in die Mittelstufe zu wechseln. In der Tschechoslowakei und der Sowjetunion dauert die Grundschule fünf Jahre.
Nach wie vor kann ich kaum glauben, dass ich jetzt zur Schule gehe und wie früher in einer Welt der Fächer, Hausaufgaben, Lehrer, Mitschüler und Prüfungen lebe. Meine Schulfreunde kämpfen mit nichts anderem als Matheproblemen, russischer Grammatik und ihren Aufsätzen in slowakischer Sprache. Wie sehr wünschte ich, ich könnte genauso sein wie sie.
Zwei russische Soldaten gehen vorbei und stoßen quiekende Laute der Begeisterung aus. Den Vorwurf, Mädchen seien ihnen gleichgültig, kann man diesen Russen definitiv nicht machen. Einer versucht, mir den Weg zu versperren, doch ich weiche ihm mit geübtem Elan aus und eile weiter die Straße entlang. Die Rollläden der Geschäfte sind zu, obwohl es schon fast acht Uhr morgens ist. Seit dem Ende des Krieges öffnen die Geschäfte nicht mehr um acht. Es gibt kaum etwas zu verkaufen, deshalb bleiben viele den ganzen Tag lang geschlossen.
Eine große sowjetische Flagge hängt über dem Eingang der Schule und überdeckt mit ihrem Stern beinahe die kleinere, rotweiß-blaue Flagge der Tschechoslowakei. Die Schulglocke läutet, als ich die breite Treppe zum Eingang erreiche. Vor der Schule ist niemand zu sehen; alle Schüler sind bereits hineingegangen. O Gott, bin ich vielleicht zu spät dran? Wie spät ist es denn? Von hier aus kann ich die Turmuhr nicht sehen. Und warum gibt es eigentlich das Acht-Uhr-Läuten der Kirchenglocken nicht mehr?
Mit einem Stechen in der Magengegend eile ich in mein Klassenzimmer. Beim Eintreten wirft mir der Lehrer einen fragenden Blick zu. Aber Pan Černiks kantiges, fast viereckiges Gesicht mit den freundlichen, blauen Augen wirkt eher amüsiert als verärgert, als er mein Auftauchen mit einem Kopfnicken registriert. Die Dielen knarren, als ich auf Zehenspitzen zu meinem Platz in der hintersten Reihe gehe und mich verlegen an Yuri und Marek vorbeiquetsche. Yuri schämt sich immer für mich, wenn ich zu spät komme. Er räuspert sich missbilligend und fragt mit gepresster Stimme: »Hast du die Hausaufgaben? Ich geb’ sie für dich ab.«
»Hast du deine schon abgeliefert?«
»Ja. Er hat schon alles eingesammelt.« Yuri schnappt mir das Blatt aus der Hand und geht nach vorn zu Herrn Černiks Tisch:
»Pan učitel. Herr Lehrer. Hier sind die Aufgaben von der Friedmannowa.«
Pan Černik nickt erneut, lächelt milde und beginnt mit der Stunde, in dem Fall Gesundheitslehre. Obwohl das Slowakische relativ neu für mich klingt, kann ich Pan Černik dank seiner deutlichen Aussprache recht gut verstehen. Er unterrichtet mit besonderer Rücksicht auf die ungarischsprachigen Schüler, macht nach jedem Satz eine kleine Pause, stellt Verständnisfragen, wiederholt wichtige Punkte und wartet dann geduldig, bis alle fertig geschrieben haben. Wir haben keine Bücher, deshalb müssen wir den Stoff der jeweiligen Stunde komplett aufschreiben.
Vor dem Krieg gab es für jedes Fach einen anderen Lehrer. Jetzt unterrichtet Herr Černik sämtliche Fächer, mit Ausnahme von Russisch. Das kann er nämlich nicht. Er ist Slowake aus dem Hügelland im Norden, ein kräftig gebauter Mann mit breiten Schultern und einem freundlichen, wenngleich müde wirkenden Gesicht von leicht dunkler Hautfarbe. Fräulein Drugowa, die Russischlehrerin, ist energisch und drall und hat ihr hellbraunes Haar zu einem Knoten hochgesteckt. Genossin Drugowa pflegt eine präzise und fast schon kompromisslose Art des Unterrichts. Sie hat keinerlei Bewusstsein dafür, dass manche Besonderheiten des Russischen komisch wirken könnten – zum Beispiel, dass sie Hitler immer als »Gitler« bezeichnet oder zu Hans immer »Gans« sagt –, und betrachtet unser allfälliges Gelächter als persönlichen Affront.
Genossin Drugowas Lust am Unterrichten passt hervorragend zu meiner Lust am Lernen. Ich bin wie eine Musikerin in ihrem Orchester und lerne Russisch in dem ähnlich unbarmherzigen Tempo, in dem sie dirigiert. Gedichte von Puschkin und Lermontow, Erzählungen von Gogol und Lazhechnikow, die Theaterstücke von Tschechow. Für mich verwandelt Genossin Alla Drugowas gnadenloser und bierernster Frontalangriff den Russischunterricht in ein Liebesfest des Lernens.
Der Unterricht hat Yuri und mich enger zusammengebracht. Unsere Freundschaft war der Grund dafür, dass mir Russisch leichtfiel und er einen besseren Zugang zum Slowakischen hatte. Sein großes Problem war aber das Schriftliche: Im Gegensatz zu den Slowaken, Tschechen und Ungarn musste Yuri erst noch die lateinischen Buchstaben lernen, bevor er im Unterricht mitschreiben konnte. Da er aus dem weit entfernten Moskau stammte, musste er sich viel mehr umstellen als die Slowaken aus dem angrenzenden Ungarn oder die Tschechen aus dem nahen Böhmen. Die Unterschiede erzeugten eine unsichtbare Wand um Yuri, die ich aber deutlich wahrnehmen konnte. Yuri wiederum spürt, davon bin ich überzeugt, dass ich trotz meiner Begeisterung für die neuen Freundschaften in Wahrheit einer anderen Welt angehöre – einer Welt weit entfernt von diesem Klassenzimmer. Er versteht, dass die Kluft, die mich und meine Mitschüler voneinander trennt, nicht überbrückt werden kann. Nicht durch ihn. Und auch durch keinen anderen meiner neuen Schulfreunde.
Der »Tattersall«
Šamorín, Juli 1945–Juli 1946
Meine geheime Welt jenseits der unüberbrückbaren Kluft ist der »Tattersall«. Dabei handelt es sich um das Gemeinschaftsheim unserer neuen Familie, die aus den wenigen Überlebenden unseres Städtchens besteht. Von den über fünfhundert jüdischen Einwohnern, die Šamorín ursprünglich hatte, sind nur sechsunddreißig zurückgekehrt, hauptsächlich junge Männer und Frauen. Wo vorher all jene waren, die nicht wiedergekommen sind – unsere Kinder, Partner, Großeltern, Geschwister, Ehemänner, Ehefrauen, Tanten, Onkel, Cousins und Kusinen, Freunde und Liebhaber –, ist jetzt ein Abgrund.
Dieser Abgrund zieht sich wie ein Schutzgraben um den Tattersall. Ich habe keine Ahnung, wer dem verlassenen Gebäude, das uns »Repatriierten« von den Behörden zugewiesen wurde, diesen merkwürdigen Namen, den Namen eines englischen Pferdehändlers, gegeben hat. Die vormaligen Besitzer haben das geräumige Haus mit seinem kopfsteingepflasterten Hof, einer großen Küche und ein paar spärlich eingerichteten Zimmern verlassen, als die Sowjetarmee näherrückte. Die Stadt hat es daraufhin in eine Art Herberge und Zufluchtsort umgewandelt. Hier haben wir uns einen Rückzugsbereich geschaffen, eine Insel des Beisammenseins.
Die Welt außerhalb des Tattersall gehört »denen«, also den ehemaligen Nachbarn, Freunden, Mitschülern und Arbeitskollegen, die uns gewaltsam aus ihren Reihen vertrieben und uns sowohl nahestehende Menschen als auch unser jeweiliges Zuhause geraubt haben. Die Welt jenseits des Abgrunds hat für uns keinerlei Bedeutung. Unser Geburtsort, das Vaterland, das uns brutal aus seinem Schoß gestoßen hat, existiert für uns nicht mehr.
Der Tattersall ist unsere einzig wirkliche Welt. Dies ist der Ort, an dem wir »wir selbst« sind: Wir träumen von zukünftigem Glück als junge Männer oder Frauen und sehnen uns nach emotionaler wie körperlicher Erfüllung. Sechsunddreißig Menschen verbringen ihre Tage im Tattersall und träumen denselben Traum. Wir führen die intimsten Gespräche, als wären wir alle eng miteinander verwandt, und erzählen uns die geheimsten Ängste, Pläne und Hoffnungen. Wir reden über ein Leben weit weg von hier, jenseits des Abgrunds.
Ich habe größtes Verständnis dafür, dass die Tattersall-Familie meine Teilnahme am Außenleben argwöhnisch betrachtet. Nur mich selbst verstehe ich nicht recht. Warum gibt es bei mir diese Leidenschaft fürs Lernen, diesen unwiderstehlichen Drang, die Hand auszustrecken und die Welt zu berühren? Ein Teenager wie jeder andere zu sein?
Miki ist der Einzige, der mich versteht.
Miki ist der Sekretär des Tattersall und hat damit die renommierteste Stellung innerhalb der Familie inne. Er verwaltet unser Essen und die Geldzuweisungen durch die Regierung. Darüber hinaus vertritt er uns gegenüber den Behörden. Miki ist groß und schlank, mit hängenden Schultern und großen, hellblauen Augen, die aber weitgehend von seinen gesenkten Augenlidern verdeckt sind. Ich finde hängende Schultern und gesenkte Augenlider höchst romantisch und aufregend.
Miki findet es gut, dass ich wieder zur Schule gehe, und rückt mich bei den Gesprächsrunden gern in den Mittelpunkt. Dann dreht er sich in meine Richtung und fragt vor allen anderen nach meiner Meinung: »Und was sagst du dazu, Elli?« Die anderen sehen überrascht zu mir und warten geduldig auf meinen Beitrag, den ich aus Respekt vor Miki – wenngleich stammelnd – von mir gebe. Danach geht Miki immer an meinem Stuhl vorbei, fragt, wie es mir in der Schule gehe, und hält dabei seine stahlblauen Augen fest auf mich gerichtet.
Jeden Nachmittag gegen halb fünf trinkt Miki seinen Tee im Speiseraum, also genau dort, wo ich meine Hausaufgaben mache. Wenn der Uhrzeiger sich auf dreißig nach vier zubewegt, lausche ich gespannt, ob nicht langsam seine trägen, unaufgeregten Schritte über den Hof kommen. Ich lausche, und mein Herz schlägt schneller.
»Hallo, Miki«, sage ich leise und versuche, meine Stimme normal klingen zu lassen.
»Ach, hallo. Wie geht’s mit den Aufgaben? Brauchst du Hilfe?«
»Na ja, es ist Algebra. Hast du denn Zeit?«
»Ich hab’ eine Stunde Pause. Schau’n wir mal, wo es klemmt.«
So wissend und entspannt wie immer zieht er einen Stuhl heran, und innerhalb weniger Sekunden sind wir in die Fallstricke der Algebra verwickelt. Eine Genossin, die gerade Küchendienst hat, bringt Miki seinen Tee mit Zitrone – ein Privileg für den Sekretär des Tattersall.
Mikis Nähe stellt seltsame Dinge mit meinen Gefühlen an. Aber ich konzentriere mich und sauge jedes Wort in mich auf, das aus seinem Munde kommt. Wenn das Problem gelöst und seine Teetasse leer ist, erhebt sich Miki mit einem Nicken und geht wieder in sein Büro am Hofeingang. Ich lerne weiter, bis die Tattersall-Gruppe zum Abendessen eintrudelt.
Das Essen wird um Punkt sieben serviert. Miki kommt immer ein paar Minuten später. Ich beobachte ihn aus den Augenwinkeln, aber er scheint mich nicht zu bemerken. Als die Gesellschaft sich langsam auflöst, verschwindet Miki aus dem Raum, ohne mich auch nur anzusehen. Warum ist er so schrecklich distanziert?
Aber ich weiß, dass ich ihn später noch treffen werde. Wie jeden Abend wird er in seinem Büro auf mich warten, um mich die Hauptstraße entlang – quer durch unser Städtchen – nach Hause zu begleiten.
Ich bin die Einzige aus meiner Familie, die im Tattersall zu Abend isst. Mein Bruder Bubi ist die ganze Woche weg. Seit Beginn des Schuljahres lebt er in Bratislava, wo er einen Vorbereitungskurs auf die »Matura« macht, also die Abschlussprüfung des Gymnasiums. Der Kurs ist extra für die Schüler, die wegen des Krieges die Schule nicht abschließen konnten. Früher ging Bubi in Budapest zur Schule. Aber jetzt gehört unsere Gegend wieder zur Tschechoslowakei, und eine unfreundliche Grenze trennt uns von Ungarn. Bubi kann nicht mehr in seine alte Schule.
Mami kommt nur in den Tattersall, um Leute zu treffen. Essen will sie dort nicht. Sie ist wieder genauso pingelig wie früher: Nahrung, die jemand anderes als sie selbst zubereitet hat, kann sie nicht zu sich nehmen. Sie denkt an ungewaschene Hände, schlecht geputztes Gemüse, schmutziges Kochgeschirr.
Wie großartig Mami sich erholt hat! Ich kann kaum glauben, dass sie dieselbe ist, die noch vor gar nicht so langer Zeit die übelriechende, ekelhafte Pampe hinuntergeschluckt hat, die in Auschwitz ausgeteilt wurde. Sie zog mich immer auf, wenn allein der Anblick der Holzstücke, Glassplitter, Menschenhaare und sogar Fellteile in dem verbeulten Essnapf bei mir Brechreiz auslöste. »Haut rein, Mädchen!«, rief sie mir und den anderen immer fröhlich zu. »Wo sonst bekommt man eine derartige Delikatesse? Gourmetküche, exklusiv hier in Auschwitz!« Das tat sie, damit wir ihrem Beispiel folgten und lernten, den unvorstellbar ekelhaften Abfall zu uns zu nehmen und dadurch zu überleben. Tag für Tag bat, drohte und nötigte sie uns, bis wir schließlich verstanden, dass, egal, wie furchtbar, ekelhaft und verrottet der Fraß auch war, wir ihn hinunterwürgen mussten, um am Leben zu bleiben. Bis dann der Hunger selbst Wunder vollbrachte. Der Brei war auf einmal nicht mehr übelriechend und widerwärtig, und das Schlucken ging plötzlich auch ganz leicht. Wir schlangen ihn gierig hinunter und vermissten irgendwann sogar die festen Bestandteile, die diese Abfälle zumindest ein bisschen nahrhaft gemacht hatten.
Einige Monate nach unserer Rückkehr versuchte ich, eine rohe Kartoffel mitsamt der Schale zu essen. Im Lager war eine Kartoffel etwas, von dem man nachts träumte. »Warum haben wir die Kartoffeln eigentlich noch nie roh gegessen?«, hatte ich meine Mutter eines kalten Morgens im Konzentrationslager gefragt, nachdem sie ein Stück Stoff, das sie unten an ihrem Kleid abgerissen hatte, gegen eine kleine, halb gefrorene Kartoffel eintauschen konnte. »Die schmeckt so gut. Süßer noch als ein Apfel.« Jetzt wusch ich die Kartoffel und biss erwartungsvoll hinein. Sie schmeckte nach nichts als Stärke und alles in allem ziemlich widerlich, also spuckte ich aus, was ich im Mund hatte. War es möglich, dass der Hunger meine Wahrnehmung derart verändern konnte? Heute weiß ich, was Hunger mit einem macht, und ich finde die Erinnerung daran sehr beängstigend.
Jetzt, da sie wieder in ihrem eigenen Haus lebt, sieht Mami wie früher überall nur Schmutz lauern. Zu meiner großen Bestürzung hat sie die Tattersall-Leitung überredet, uns anstelle von Mahlzeiten die rohen Zutaten zu geben, damit sie unser Essen selbst zubereiten kann – mit ihren aufs Sorgfältigste geschrubbten Händen und Küchenutensilien. Was mich betrifft, so ist mir die Gemeinschaft im Tattersall lieber als die Hygiene daheim. Deshalb haben Mami und ich einen Kompromiss ausgehandelt. Zu Mittag esse ich zu Hause, am Nachmittag gehe ich dann zu den anderen in den Tattersall und bleibe auch zum Abendessen.
Mami ist als Schneiderin sehr beschäftigt. Nachdem die ungarischen Machthaber während des Krieges das Geschäft meines Vaters konfisziert hatten, setzte Mami ihr Können als Schneiderin ein, um uns irgendwie über Wasser zu halten. Jetzt macht sie Kleider für die russischen Soldatinnen und bekommt dafür Dinge, die wir gebrauchen können: ein paar Eier, eine Tüte Mehl, eine Schüssel Zucker, ein lebendes Huhn, ein Stück Seife und sogar Glas für die Fenster. Wir haben kein Geld, um solche Sachen zu bezahlen. Und selbst diejenigen, die das Geld hätten, können doch nichts kaufen, weil die meisten Geschäfte geschlossen sind oder kaum etwas anzubieten haben.
Kurz nach unserer Heimkehr brachte Bubi eine Glühbirne für die leere Fassung in der Küche mit, und wir hatten endlich Licht. Als Mami wissen wollte, wie er denn an sie herangekommen sei, berichtete er, in einem unbewohnten Haus eine Lampe auf dem Nachttisch gesehen zu haben. In der Annahme, dass dazu auch eine Birne gehörte, kletterte er durchs Fenster hinein und entdeckte nicht nur die Birne, sondern auch einen russischen Offizier, der im Bett lag und schlief. Ohne mit der Wimper zu zucken, drehte Bubi die Birne aus der Fassung – nur wenige Zentimeter vom Kopf des schlafenden Russen entfernt.
»Wäre es nicht toll, wenn wir auch im Schlafzimmer Licht hätten?«, höre ich mich sagen, wohl wissend, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit ist. »Dann könnten wir abends in unseren Strohbetten lesen.«
Eine halbe Stunde später kommt Bubi mit einer Lampe in der Hand. »Wo hast du die denn her?«, fragt Mami begeistert.
»Der Offizier schläft immer noch«, sagt mein Bruder trocken. »Ich bin reingeklettert und hab sie vom Nachttisch genommen. Es gibt keine Fassung hier im Schlafzimmer. Wie soll mein Schwesterherz denn ohne Lampe lesen?«
Mami ist völlig schockiert. »Um Gottes willen, Bubi! Der russische Offizier hätte dich erschießen können! Bitte tu so etwas nie wieder!«
»Versprochen, Mami«, sagt Bubi mit gespielter Einfältigkeit. »Wir brauchen ja auch keine Lampe mehr.«
Die Russen sind ziemlich gut ausgerüstet und verfügen über die unterschiedlichsten Dinge. Um meinen Bruder künftig von derart halsbrecherischen Beschaffungsmaßnahmen abzuhalten, kam meine Mutter auf die Idee, Sachen zu nähen und gegen Nützliches einzutauschen. Sie stellte sich auf der Straße einer Gruppe Soldatinnen in den Weg und bot mit meiner Unterstützung als Dolmetscherin an, »schöne« Kleider für sie zu machen. Noch am selben Nachmittag kamen jede Menge junger Russinnen zu uns nach Hause, brachten die wunderbarsten Stoffe mit und bestellten alle möglichen Kleidungsstücke. Ich erklärte ihnen, dass Mami leider keine Nähmaschine besaß. Es verging nicht einmal eine Stunde, da hievten zwei russische Soldaten eine alte Nähmaschine in die Küche. Das war der Beginn von Mamis Karriere als Schneiderin – sie machte schicke Seidenkleider, raffinierte Spitzenblusen und bunte Faltenröcke.
Seit diesem Tag gehen bei uns in der Küche die Barischnas und Towarischtschs ein und aus, also die russischen Soldatinnen und ihre männlichen Gegenstücke. Während sie gut gelaunt darauf warten, dass Mami letzte Hand an ihre Bestellungen legt, singen sie ihre Lieder und spielen dazu Ziehharmonika und Balalaika. Mir macht es unglaublich Spaß, mein in der Schule gelerntes Russisch anzuwenden und gemeinsam mit diesen einfachen, aber herzlichen jungen Frauen und Männern zu singen. Die Einheimischen hassen die Russen und bezeichnen sie als primitive Besatzer. Für mich sind sie Helden, die geholfen haben, die Deutschen zu besiegen. Deshalb habe ich auch keine Angst, Mami allein zu Hause zu wissen, während ich im Tattersall bin und auf ein paar kostbare Sekunden mit Miki warte.
Vatis Mantel
Šamorín, November 1945
Der Winter kommt früh dieses Jahr. Frost bedeckt die kahlen Äste unserer Akazie, und alles glitzert in silbrigem Weiß. Auf die Fensterscheiben, die unsere russischen Freunde eingebaut haben, hat der Winter mit kunstvoller Hand weiße Muster gemalt, und sogar die Wände im Haus sind mit Eisblumen bedeckt. Nur das Fenster und die Wände in der Küche erstrahlen nicht in frostigem Glanz. Wir können es uns nicht leisten, die Zimmer zu beheizen. Der Stapel Feuerholz, den uns Herr Plutzer bei unserer Ankunft gebracht hat, muss fürs Kochen aufgespart werden.
Dass ich für gewöhnlich zur Schule renne, erweist sich als ideal, um mich einigermaßen warmzuhalten. Der Mantel, den ich in Augsburg bekommen habe, ist mittlerweile vollkommen abgetragen und bietet kaum Schutz gegen den eisigen Wind. Zum Glück sind die Schulräume geheizt, sodass im Laufe der ersten Stunde die Kälte aus meinen geschwollenen Gliedern weicht. Ein amerikanischer Militärarzt hat mich nach der Befreiung untersucht und gesagt, ich hätte Arthritis, weshalb ich mich im Winter stets trocken und warm halten solle.
Ich habe Glück. Ich besitze einen Mantel und verbringe die Vormittage in einem geheizten Klassenzimmer. Aber Mami und Bubi haben keine Wintermäntel. Bubis Zimmer in Bratislava ist unbeheizt. Er wärmt sich in den Wohnungen von Freunden auf, wo er auch lernt und seine Aufgaben macht. Mami kann sich nur am Küchenherd wärmen.
»Wir müssen unsere Wintermäntel finden«, erklärt Mami entschieden. »Wir müssen sie wiederbekommen.«
Vor der Deportation hat Mami unseren christlichen Nachbarn ein paar unserer besten Kleidungsstücke und Wertsachen zur Aufbewahrung anvertraut. Abends, nach der Verdunkelung, öffneten diese Nachbarn ihre Tür nicht mehr als einen Spaltbreit, damit Mami im Schutz der Dunkelheit unsere Sachen übergeben konnte. Dadurch, dass diese Menschen auf Dachböden oder in Abstellkammern »jüdische Gegenstände« versteckten, brachten sie sich selbst in Lebensgefahr. Das Verbergen von »jüdischen« Kleidungsstücken, Pelzmänteln, Überwürfen, bestickten Tischdecken und Bettbezügen erforderte ein hohes Maß an Mut und Menschlichkeit.
Und ihre Menschlichkeit hatte Bestand. Nach unserer Wiederkehr gaben sie uns die Sachen zurück. Denn im Grunde waren wir spurlos verschwunden gewesen. Mehr als ein Jahr war vergangen, ohne dass man irgendetwas von uns gehört hätte: Die Nachbarn konnten mit Fug und Recht annehmen, wir seien tot. Sie durften davon ausgehen, dass wir niemals zurückkehren würden und die Sachen nun ihnen gehörten.
Als sie erfuhren, dass wir heimgekehrt waren, zögerten die meisten keine Sekunde und brachten die aufbewahrten Dinge umgehend zu uns. Andere waren jedoch nicht bereit, die Sachen freiwillig herzugeben, und taten so, als wüssten sie von nichts.
Plötzlich fällt Mami ein, dass sie ihren pelzgefütterten Wintermantel bei Frau Fehér untergebracht hat, den von Vati hingegen bei Frau Patócs.
»Gott sei Dank«, ruft sie. »Jetzt hat jeder von uns einen Mantel. Du kannst meinen anziehen, Bubi bekommt den von Vati.«
Mami und ich gehen zusammen zum Bauernhof der Familie Patócs, um nach Vatis Pelzmantel zu fragen. Frau Patócs ist freundlich und auch voller Verständnis, kann sich aber nicht daran erinnern, dass Mami ihr »irgendetwas« zur Aufbewahrung dagelassen hat. Sie betont ausdrücklich, dass sie keine sei, die fremde Sachen besitze. Aber ihr fallen Nachbarn ein, die »womöglich den einen oder anderen jüdischen Schatz horten«.
Vor dem Haus der Fehérs wiederholt sich die Szene mehr oder weniger. Frau Fehér erinnert sich gut an Mamis »wunderbar marineblauen Mantel mit dem Silberfuchskragen«, nur leider seien all unsere Sachen »von diesen – vergib mir, Jesus – Scheißkerlen konfisziert worden«. Mit den »Scheißkerlen« meint sie die sowjetischen Besatzer.
In der bitteren Kälte stehen Mami und ich auf der Schwelle von Frau Fehér und zittern vor Enttäuschung.
»Gehen wir zu den Keménys«, sagt Mami. »Ich weiß, dass Serena ihnen ein paar Dinge anvertraut hat. Jetzt, wo ich viel dünner bin als früher, passt mir der Pelzmantel meiner geliebten Schwester vielleicht.«
Mamis ältere Schwester Serena war meine Lieblingstante. Wie sie bei unserer Ankunft in Auschwitz so gewaltsam von Mami und mir getrennt und in die Gaskammer geschickt wurde, während wir ins Arbeitslager kamen, ist eine meiner schmerzlichsten Erinnerungen.
Frau Kemény hat keine Sachen von der »lieben Frau Serena«. Sie weiß auch nicht, wer sie sonst haben könnte. Sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, welchen Nachbarn die liebe Frau Serena ihre »kostbaren Habseligkeiten« anvertraut haben könnte.
»Ihre liebe Schwester ist also nicht zurückgekehrt? Die arme Frau Serena.« Frau Keménys Mitgefühl kommt wirklich aus tiefstem Herzen. »Was ist denn mit dieser lieben, guten Seele passiert? Wir standen uns so nah. Wirklich so nah. Ach Herr Jesus, ich vermisse sie so.«
Mami bedankt sich bei Frau Kemény für ihr Beileid und bittet sie, doch noch einmal genau zu überlegen, bei wem Tante Serenas Wintermantel sein könnte. Der Winter sei bitterkalt, und der Mantel werde dringend gebraucht. Frau Kemény tut es wahnsinnig leid, aber so sehr sie sich auch den Kopf zerbricht, kann sie sich an rein gar nichts erinnern.
Während die beiden Frauen miteinander reden, streift mein Blick durch das vollgestellte Wohnzimmer von Frau Kemény. Plötzlich bleibt er an der wunderschön gearbeiteten Kommode aus Mahagoni hängen. Ich kenne diese Kommode. Kein Zweifel: Es ist die von Tante Serena!
Ich tippe Mami auf die Schulter.
»Mami.« Auf einmal ist es ganz still, und beide Frauen sehen mich überrascht an. Meine Stimme klingt hart. Ich nehme Mami an der Hand und ziehe sie zu dem wohlbekannten Möbelstück.
»Mami, schau dir diese Kommode an! Erkennst du sie?«
Mami schaut ungläubig auf die Kommode. Sie streckt langsam die Hand aus, um sie zu berühren. Dann streicht sie zärtlich, ja: ehrfurchtsvoll, über die lackierte Oberfläche, während ihr die Tränen über die Wangen laufen.
Frau Kemény sitzt da wie vom Blitz getroffen.
Ich betrachte den Stuhl, von dem Mami soeben aufgestanden ist, und erkenne Tante Serenas Esszimmerstuhl, der ebenfalls zu der Garnitur aus Mahagoni gehört.
»Und dort, Mami.« Wie in Trance dreht Mami sich langsam um und geht zu dem Stuhl zurück, auf dem sie fast eine Stunde lang gesessen hat. Sie sieht die Frau vor sich lange und nachdenklich an. Mamis Stimme klingt unsagbar müde, als sie sagt: »Frau Kemény, wie ist das möglich? Woher haben Sie die Sachen meiner Schwester?«
Frau Kemény schweigt.
»Sagen Sie mir bitte, Frau Kemény: Haben Sie sonst noch etwas von meiner Schwester? Ich frage nicht, wie Sie an die Sachen gekommen sind. Ich bitte Sie nur darum, uns all das zu geben, was hier bei Ihnen ist. Wir haben keine warme Kleidung. Besitzen Sie vielleicht zufällig auch den Wintermantel meiner Schwester?«
Frau Kemény zittert so sehr, dass man es sehen kann. »Werden Sie mich jetzt anzeigen, Frau Friedmann?«
»Ich habe kein Interesse daran, Sie anzuzeigen«, sagt Mami ruhig. »Alles, was ich möchte, sind die Sachen meiner Schwester. Geben Sie alles zurück, dann ist die Sache für uns erledigt. Wir werden niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen verraten.«
Noch am selben Abend kommt Herr Kemény mit dem Pferdekarren und bringt uns die Kommode, vier Esszimmerstühle aus Mahagoni und die Anziehsachen von Tante Serena: Kleider, Röcke, Blusen und Unterwäsche. Und den pelzgefütterten Mantel.
Als alles abgeladen ist, gibt Herr Kemény Mami eine Liste mit Namen. Darauf stehen die nichtjüdischen Nachbarn, die noch Sachen von Tante Serena haben.
Mami zieht Tante Serenas Mantel an, und ihre Augen füllen sich erneut mit Tränen. Ich vergrabe mein Gesicht im Pelzkragen meiner Lieblingstante, die in der Gaskammer von Auschwitz erstickt ist, und bei dem Gedanken an sie müssen wir beide bitterlich weinen.
Am nächsten Tag arbeiten wir uns durch Herrn Keménys Liste der Nachbarn von Tante Serena und entdecken in ihrem Nachlass zwei von Vatis Anzügen sowie diverse Möbelstücke, die früher uns gehört haben.
In einem der Pakete finden wir Baumwollfaden, Nähnadeln und eine Schere. Diese Dinge bekommt man hier nirgends, selbst wenn man Geld hat. Mami ist überglücklich. Sie zerschneidet eine prächtige Armeedecke, die wir bei der Befreiung von den Amerikanern bekommen haben, und näht daraus je einen Wintermantel für Bubi und mich.
Bubi kann Vatis Anzüge nicht tragen. Obwohl er recht groß gewachsen ist, hängen Vatis Jacketts kläglich über seine Schultern, während die Hosenbeine ihm um die Füße schlackern. Vati war fünfundvierzig, mit breiten Schultern und einer athletischen Figur. Bubi ist erst siebzehn und hat schmale Schultern.
Mein modebewusster Bruder weigert sich, den von Mami geschneiderten Mantel anzuziehen. Lieber bibbert er in dem löchrigen Pullover, den er von einem Klassenkameraden in Bratislava bekommen hat.
Heute gehe ich allein nach Hause, und als ich an den geschlossenen Geschäften unweit der Schule vorbeigehe, löst sich die dunkle Silhouette eines Mannes aus dem Schatten. Genau wie Vati ist er groß gewachsen und bewegt sich mit zügiger, athletischer Eleganz. Ich beschleunige meinen Schritt, um ihn einzuholen. Erst zwei Schritte hinter ihm merke ich, dass dieser Mann nicht Vati sein kann. Er ist kleiner und auch breiter. Dennoch verschlägt es mir angesichts der Ähnlichkeit den Atem. Schlagartig wird mir auch klar, warum. Es liegt an dem Mantel, einem kurzen, grauen Stadtmantel mit hohem Pelzkragen. Ich weiß, dass das ein Pelzmantel ist. Ich erinnere mich sogar an den Namen des Tieres – Nutria. Früher habe ich mich immer gern in das samtweiche Futter von Vatis Mantel gekuschelt.