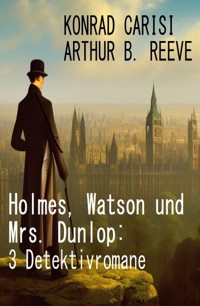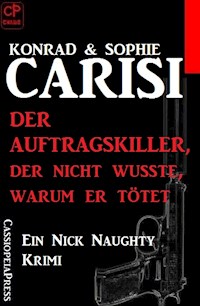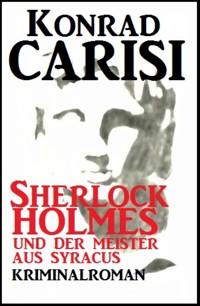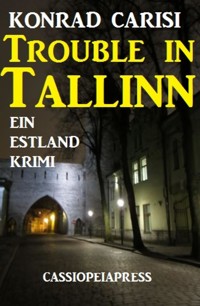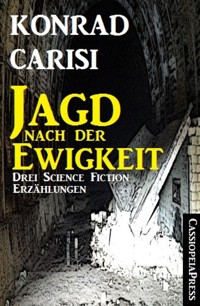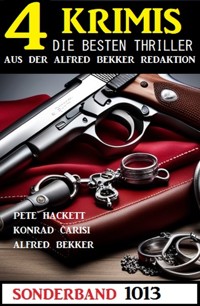
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält folgende Krimis: (499) Konrad Carisi: Sherlock Holmes und der Meister aus Syracus Alfred Bekker: Wir fanden Knochen Pete Hackett: Trevellian und das Galopprennen in den Tod Pete Hackett: Trevellian und die Aasgeier von New York Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre. Mal provinziell, mal urban. Und immer anders, als man zuerst denkt. Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker & Konrad Carisi & Pete Hackett
4 Krimis Sonderband 1013
Inhaltsverzeichnis
4 Krimis Sonderband 1013
Copyright
Sherlock Holmes und der Meister aus Syracus
Kapitel 1: Ein längst überfälliges Treffen
Kapitel 2: Das Leben des Lord William Fryfield
Kapitel 3: Köpfe
Kapitel 4: Verbindungen
Kapitel 5: Das Antikhandelshaus Alston
James Watson und der Mord ohne Leiche
Extraerzählung von Konrad Carisi
Prolog
1
2
Wir fanden Knochen
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Trevellian und das Galopprennen in den Tod
Trevellian und die Aasgeier von New York
4 Krimis Sonderband 1013
Konrad Carisi, Pete Hackett, Alfred Bekker
Dieses Buch enthält folgende Krimis:
Konrad Carisi: Sherlock Holmes und der Meister aus Syracus
Alfred Bekker: Wir fanden Knochen
Pete Hackett: Trevellian und das Galopprennen in den Tod
Pete Hackett: Trevellian und die Aasgeier von New York
Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre.
Mal provinziell, mal urban. Und immer anders, als man zuerst denkt.
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sherlock Holmes und der Meister aus Syracus
von Konrad Carisi
Der Umfang dieser Geschichte entspricht 110 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch beinhaltet die beiden Geschichten:
Sherlock Holmes und der Meister aus Syracus
James Watson und der Mord ohne Leiche
Sherlock Holmes ist der berühmteste Detektiv seines Jahrhunderts, aber nicht der Einzige. Er erhält Besuch von seinem ebenfalls legendären Kollegen Auguste Dupin. Der Pariser Meisterdetektiv macht sich auf die Reise, um Sherlock Holmes zu besuchen und gemeinsam lösen sie einen Fall, der Scotland Yard bis dahin zum Verzweifeln brachte. Aus der Themse gefischte Leichenteile geben Rätsel auf. Anscheinend geht ein Serienmörder um...
Kapitel 1: Ein längst überfälliges Treffen
„Was für ein Zimmer hätten Sie denn gerne?“, fragt mich die freundliche Frau im engen Kleid. Es ist schon fast unschicklich eng, doch die Zeiten ändern sich. Ich werde alt. Nein, ich muss mich korrigieren: Ich bin alt.
„Ich habe reserviert. Telegrafisch, genaugenommen. Mein Name ist C. Auguste Dupin“, stelle ich mich vor. In Paris wäre der Name etwas wert gewesen, hier nicht. Zugegeben, in Paris auch nur in gewissen Kreisen. Die Frau nickt ruckartig und sieht in ihrem kleinen schwarzen Büchlein nach. Es ist kein sehr teures Hotel, aber das Frisian Palace ist sauber und liegt zentral in London. Was will man mehr? Mein Weg war beschwerlich von Paris aus. Das hat aber weniger mit der Reiseweite zu tun, als mit etwas viel Banalerem: Ich werde auch nicht jünger. Wie ich es hasse, dass ich nun diesen Stock brauche, auf den ich mich stütze. Alles dauert einfach länger.
„Ismael bringt Sie herauf, Mister Dupin“, sagt die Frau und winkt den dunkelhäutigen Pagen in seiner blassroten Jacke, die die Uniform dieses Hotels darstellt, heran. Er nimmt mir die Reisetasche ab und geht vor. Ich bemühe mich, Schritt zu halten. Ismael geht nicht besonders schnell. Ich bin mit dem dritten Bein nur etwas unsicher.
Es geht glücklicherweise nur eine Treppe hinauf und dann einen Korridor entlang. Das Zimmer ist klein, sauber und ordentlich: ein alter Stuhl mit geflochtener Sitzfläche, ein niedriger dreibeiniger Tisch und dazu ein Bett mit Eisengestell, das eine echte Matratze enthält und nicht nur irgendeinen strohgefüllten Sack. So etwas gab es in meiner Jugendzeit noch häufiger, wenn es preiswert sein sollte. Das Zimmer geht zu einem Hinterhof hinaus, auf dem Leute ihre Wäsche aufhängen und Kinder spielen. Kurz schaue ich den Jungs zu, die mit Stöcken als Gewehren Räuber und Gendarm spielen. Im Leben bei etwas die Ernsthaftigkeit wiederfinden, die man als Kind so vielen Spielen entgegenbrachte ... das muss ein Schlüssel des Glücks sein. Ismael verschwindet nach einer tiefen Verbeugung und einem enttäuschten Blick. Vermutlich hat er irgendein Trinkgeld erwartet. Leider lässt nicht nur die Leistungsfähigkeit meines Körpers nach, auch die meiner Brieftasche lässt zu wünschen übrig. Ich ziehe mir die Reisekleidung aus und ein gutes Hemd an. Dann geht es wieder in das Durcheinander der Straßen von London.
Ich bin aus Paris natürlich so eine Menge an Menschen gewöhnt, aber mit dem dortigen Durcheinander bin ich eben vertraut. Es ist gewissermaßen meine natürliche Umwelt, mein Revier ist Paris. Das hier ist es nicht. Obwohl doch nicht so weit entfernt wie vielleicht Japan, ist mir doch alles fremd. Ich gehe hinunter auf die Straße, beobachte eine Weile die Menschen und sammle Eindrücke. Dann winke ich eine Droschke heran. Der Kutscher fragt mit breitem Akzent, wo es hingehen soll.
„Baker Street 225B“, erwidere ich. Er nickt langsam. Dann leuchten seine Augen so, wie es nur das Wiedererkennen von etwas zu Stande bringt, oder das Erinnern an etwas.
„‘türlich, jetzt weiß ich, wo Se hin wollen. Hübsche Häuser da“, stellt er fest. Ich steige ein und die Fahrt beginnt.
Durch ein Gewirr von Straßen fährt er mich, so dass ich mir Mühe geben muss, die Orientierung zu behalten.
*
Als ich endlich vor der unscheinbaren Tür stehe, bin ich ganz wieder ein kleiner Junge im Geiste. Ich klopfe dreimal energisch, doch nichts geschieht. Das kann doch nicht wahr sein, all der weite Weg und dann ist er wirklich nicht da?
Eine Geschichte oder ein Roman wäre da gnädiger, als es die Realität zuweilen ist.
Ich betrachte enttäuscht den Messingklopfer an der Tür.
„Verzeihen Sie die Verspätung“, höre ich hinter mir jemanden sagen. Ich drehe mich um. Ich erkenne Sherlock Holmes sofort von den Zeitungsfotos wieder. Er ist etwas älter, natürlich und auch hagerer, gewiss. Doch die Adlernase ist unverkennbar. Sein Mantel ist gefüttert, denn es ist noch kalt und zudem ist er auch nicht mehr ganz jung. Ich weiß, wovon ich rede. Auch wenn ich es früher nicht geglaubt hätte: Im Alter lässt die Hitze der Jugend zusehends nach und man friert selbst jetzt noch im Frühjahr.
„Keine Ursache, Mister Holmes. Sie sind ja nur ein wenig zu spät“, erwidere ich und deute dabei schelmisch lächelnd eine Verbeugung an, so gut es mit meinem Stock und einem schmerzenden Rücken geht.
„Auguste Dupin, zu Ihren Diensten.“
„Ihre Briefe haben mir ein ums andere Mal Kopfzerbrechen bereitet. Dafür danke ich herzlichst“, stellt Sherlock Holmes mir gegenüber fest. Auch er deutet eine Verbeugung an. Seit einigen Jahren korrespondieren wir und schicken uns oft kleine Rätsel. Manchmal berichten wir uns von unseren Fällen und versuchen, selbst eine Lösung zu finden, bevor wir sie lesen. Es ist selten, einen verwandten Geist zu finden.
„Ein verwandter Geist ist mir stets lieb und teuer“, stelle ich fest.
Er nickt zustimmend.
„Ich empfand ihre Arbeit in jungen Jahren immer als inspirierend. Dieses Treffen ist auch lange überfällig“, erwidert er. Dabei deutet er auf eine wartende Droschke. „Wie wäre es mit Tee und Gebäck? Oder auch was Sie sonst wollen“, fügt er hinzu. „Leider ist niemand zu Hause, so dass ich Sie außer Haus bewirten möchte.“
Ich nicke und wir fahren quer durch die Stadt. Im Theene Teehaus steigen wir ab und bekommen guten Schwarztee aus China gereicht.
„Ich verfolge Ihre Karriere schon lange“, stelle ich fest. Sherlock Holmes lächelt und rührt mit dem kleinen silbernen Löffel in der blauweißen Teetasse vor sich herum.
„Das ist mir klar, doch Sie haben es stets in den Briefen vermieden, die einzig wirklich interessante Frage zu beantworten.“
„Wieso?“, erwidere ich. Das ist die Frage, die er nie stellte und ich nie beantwortete. Holmes nickt.
„Genau. Wieso habe ich einen Bewunderer in Ihnen? Jemanden der meine Karriere verfolgt.“
„Was denken Sie?“, frage ich. Er trinkt einen Schluck Tee, vielleicht um Zeit zu gewinnen.
„Ich habe Erkundigungen eingeholt, sie sind ein Bekannter Pariser Detektiv, Mister Dupin. Bis heute erzählt man sich von Ihren Fällen. Natürlich nur von denen, in denen Sie offiziell ermittelt haben.“
Ich nicke. „Aber nur wenige wissen, wer ich bin. Ich suche mehr das Rätsel, weniger den Ruhm.“
„Sie sind alt“, stellt Holmes fest, ohne dabei unfreundlich zu klingen. Es ist eine Beobachtung.
„Auch Sie sind in dem Alter, wo Erfahrung wettmachen muss, was der Körper nicht mehr zu leisten vermag“, erwidere ich und heben den Stock freundlich, wie zum Gruß. Es liegt genauso wenig Schärfe in meiner Stimme wie in seiner. Ich lehne mich hinterher wieder an die Lehne des weichen Sessels, in dem ich sitze. Vor uns ist ein Fenster, das zu einem bepflanzten Hinterhof hinausgeht.
„Dass die Augen nachlassen, davor habe ich auch immer die meiste Angst. Genauso wie der Verstand einen verlassen kann“, gibt Holmes widerwillig zu. „Die meisten Menschen sehen zwar, sehen aber nicht richtig hin! Es ist wichtig, einen klaren Blick zu haben.“
„Wo ist eigentlich Ihr Chronist?“, wechsle ich das Thema mehr als oberflächlich. Ich mag nicht, wenn alte Menschen sich nur noch über ihre Gebrechen und Ängste unterhalten. Mir ist dabei leidvoll bewusst, dass ich ein alter Mensch bin.
„Ein tragischer Trauerfall in der Familie, deswegen ist er nun auf Verwandtschaftsbesuch. Ein nach Deutschland verheirateter Cousin verstarb. Doktor Watson ist für ein paar Wochen weg. Aber zurück zu Ihnen: Sie wollen einen verwandten Geist sehen, wieso? Ich denke, Sie wollen einen Nachfolger im Geiste sehen, da Sie keinen eigenen vom Fleisch und Blut Ihrer selbst haben.“
Ich lächele traurig. Ich gebe nicht sofort eine Antwort. Ja, so in der Art ist es. Oder bin ich einfach nur einsam geworden?
„Vielleicht sehen Sie in mir einen Erben. Sie haben, denke ich, keine Kinder. Es war da nie eine Frau, die sie genug faszinierte“, fügt Holmes hinzu und mustert mich. Dabei bemerke ich eine Vibration in seiner Stimme. Ich bin sicher, in Gedanken ist er bei diesen Worten bei einer bestimmten Frau. Einer Frau, die einen das Leben lang verzaubert und ein Mysterium bleibt. Jeder hat so eine Frau, eine Frau, die ihr ganzes Geschlecht für einen Mann immer dominieren wird.
„Ich wollte Sie kennenlernen“, gebe ich zu, „sehen, wie gut Sie wirklich sind, Holmes.“ Ich lächle traurig. Ja, so ist es, ich bin ein einsamer alter Mann.
„Das trifft sich gut, auch wenn ich, nebenbei bemerkt, denke, Sie verheimlichen mir immer noch etwas“, stellt Holmes fest. Kurz wundere ich mich, was er meint mit „es trifft sich gut“.
Ich lache und sage: „Nein, das könnte ich nie. Etwas vor dem großen und einzigartigen Sherlock Holmes verheimlichen ...“, lenke ich halbherzig vom Thema ab.
Ein Polizist errettet mich vor weiteren Nachfragen. Als ich bemerke, wie zielstrebig er auf uns zugeht, ist mir klar, was Holmes meinte mit „es trifft sich gut“. Er hat ihn, da ich mit dem Rücken zur Tür sitze, zuerst gesehen und gleich die richtigen Schlüsse gezogen.
Der Polizist trägt die typische dunkle Uniform der unteren Ränge.
„Mister Sherlock Holmes?“, fragt der Polizist fast ehrfürchtig. Man merkt, dass Holmes schon das ein oder andere Mal der Polizei behilflich war.
„Ja, Mister Clarke, was kann ich für Sie tun?“, begrüßt Holmes den Fremden. Mister Clarke freut sich sichtlich. Ein spitzbübisches Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. Es lässt ihn jünger aussehen.
„Sie erinnern sich an meinen Namen, Mister Holmes?“, stellt Mister Clarke das Offensichtliche fest. Holmes nickt nur und wartet, dass Mister Clarke sagt, was er zu sagen hat. Irgendein Anliegen wird ihn schließlich so zielstrebig zu uns geführt haben. Dieser bemerkt die unpassende Stille und räuspert sich geräuschvoll.
„Nun, also. Ja, richtig. Ich soll Sie suchen, Sir. Mister Holmes, meine ich. Also Superintendent Lestrade verlangt nach Ihnen. Es sei äußerst dringlich. Er hat Sie in der ganzen Stadt bereits suchen lassen!“
„Tatsächlich“, erwidert Holmes trocken. Ob Spott in der Stimme liegt, kann ich nicht genau sagen.
„Ist es nicht Inspektor Lestrade?“, frage ich. „Von dem habe ich in der Zeitung gelesen.“
„Er wurde befördert. Dank meiner guten Ratschläge, wenn ich das so sagen darf“, erklärte mir Holmes ohne falsche Bescheidenheit. „Er hat die ein oder andere gute Schlussfolgerung zwar auch selbst gezogen, aber einer seiner besten Entschlüsse war es immer, mich hinzuzuziehen.“
„Was ja auch reicht“, stelle ich fest. „Es ist wie in der Politik: Man muss nicht alles können, man muss nur klug und ehrlich genug zu sich sein, um sich Hilfe zu holen.“
„Wenn die beiden Herren bitte entschuldigen“, unterbricht der Polizist Mister Clarke. Ihm scheint die Unterhaltung nicht zu behagen. „Es eilt, sehr geehrte Gentlemen. Es eilt wirklich.“
Holmes winkt die Bedienung heran und bezahlt für uns beide.
„Sicher, wir kommen“, stellt er fest. An mich gewandt fügt er hinzu: „Das dürfte Ihnen gefallen. Dafür sind Sie doch hier, nicht wahr?“
„Weswegen?“, frage ich verdutzt.
„Mich in Aktion zu sehen“, stellt Holmes fest und folgt dem Polizisten. Ich sehe, dass ich mit dem verdammten Bein hinterherkomme. Mein Knie schmerzt bei jedem Schritt.
Er führt uns zu einem Kollegen, der in einem Automobil auf uns wartet. Der Motor läuft noch, als wir uns auf die Rückbank setzen. Während wir durch die Stadt brausen, fragt Holmes mich: „Wissen Sie eigentlich, woher die Picadilly Street ihren Namen hat?“
„Dort rasen wir gerade?“, spekuliere ich und merke, dass die Polizisten uns aufmerksam zuhören.
Er nickt. Ich schüttle den Kopf, schließlich war ich noch nie in London.
„Robert Baker erwarb als Schneider Reichtum. Er erfand einen steifen Kragen, den Picadil. Vom Geld, das er dadurch verdiente, als die Reichen und Schönen bei ihm ein- und ausgingen, baute er ein Haus. Das nannte er passenderweise Picadilly Hall. So kommt die dazugehörige Straße zu ihrem Namen“, schließt er.
Selbst die Polizisten hören ihm aufmerksam zu. Der Wagen hält abrupt. Der Polizist, den Holmes als Mister Clarke angesprochen hat, führt uns in den Keller eines Gebäudes. Es erinnert mich an ein Krankenhaus. Dort gibt es oft Kellergewölbe, in denen die Anatomiestudenten an Leichen üben dürfen. Für einige ist das ein Frevel, für mich eher gutes Handwerk an totem Fleisch üben. Dann begreife ich, was der Zweck des Gebäudes ist: Es ist ein Leichenhaus, vermutlich die Gerichtsmedizin.
Ein kleiner Mann mit Rattengesicht erwartet uns. Es ist mir sofort klar: Das muss Lestrade sein. Mister Clarke nimmt Haltung vor dem Superintendenten an. Ich glaube, ich habe schon einmal eine Fotografie in der Zeitung mit ihm gesehen. Ich beziehe einige Zeitungen aus ganz Europa, um auf dem Laufenden zu bleiben.
„Mister Holmes“, nickt Superintendent Lestrade ihm zu. Mich sieht er mit hochgezogenen Augenbrauen an. Er hat den Blick eines fantasielosen Menschen: jene, mit denen ich als Kind nicht so gerne spielte. Sie tun fast alles, was man ihnen vorschlägt, aber sie lösen nie selbst auf eigene Weise Probleme ihres Lebens. Sie machen nie gute Vorschläge.
„C. Auguste Dupin, enthusiastischer Rätsellöser aus Paris“, stelle ich mich leicht spöttisch vor. Dabei verbeuge ich mich so gut es geht und ziehe meinen Hut.
„Er ist auf meine Einladung hier und vertritt gewissermaßen Watson“, fügt Sherlock Holmes hinzu. Das scheint Lestrade zufriedenzustellen. Mit einem Ersatz-Watson kann er leben.
„Ich bin froh, dass Sie da sind, Holmes“, beginnt Superintendent Lestrade und führt uns zu einer verschlossenen Kellertür. Er ist kühl hier unter der Erde. Hier werden sonst Leichen aufgebahrt und obduziert, doch es ist niemand hier, kein Personal, außer uns. Mir fällt gleich auf, dass der Mordfall, um den es hier geht, pikant sein muss. Mord ist es zweifelsfrei, da wir nun mal in ein Leichenhaus gerufen wurden. Pikant ist der Fall, weil der Raum auch noch gesichert ist. Vor einer eisenbeschlagenen Eichentür steht ein Polizist Wache und öffnet uns auf ein Nicken von Superintendent Lestrade. Auf einem dunklen Holztisch liegt in der Mitte des kleinen Nebenraumes ein Toter. Lestrade entzündet die Öllampen, die ringsherum an den Wänden hängen. Durch kreisrunde Spiegelchen hinter der Flamme wird ihr Licht noch verstärkt. Mein Blick fällt auf den Toten. Eine schreckliche Sekunde lang begreife ich nicht ganz, was ich sehe. Da liegen nur Einzelteile! Ein Kopf, der rechte Fuß und der rechte Arm fehlen. Der Rest ist in kleine Teile zerstückelt, aber vorhanden. Es sieht nicht allzu fachmännisch aus, wenn man die Schnittkanten betrachtet. Vom Schlachter kenne ich glattere Schnitte. Andererseits ist für das Schlachten eines Schweines bereits viel Kraft nötig, wie viel mehr dann erst für den Oberschenkelknochen eines Menschen?
„Das ist, nein, das war Lord William Fryfield“, erklärt Superintendent Lestrade. „Er wurde an den Docks aus der Themse gefischt. Die Teile haben sich in einer illegalen Reuse verfangen. Wir denken, der Rest ist auch noch dort in der Themse. Die Suche gestaltet sich aber als kompliziert. Selbst an guten Tagen ist die Themse eine dreckige Brühe und die Parlamentarier im Westminster Palast haben schon die ein oder andere Sitzung beendet wegen des Gestanks.“
„Weil es ein Lord ist, macht man Ihnen also Druck“, stellt Holmes fest und sieht sich die Leichenteile näher an. „Doch was verunsichert Sie so, Lestrade?“
Superintendent Lestrade schließt die Tür. Er sieht uns sehr ernst an. Der Gestank der Leiche nimmt nun stark zu, da kein Luftzug mehr besteht. Ich halte mir ein Taschentuch vor die Nase.
„Es liegt nun fast zwanzig Jahre zurück. Da wurde beim Old Scotland Yard, wie man unser altes Hauptgebäude ja inzwischen nennt, ein Stück einer Frauenleiche gefunden. Es war ein sauber abgetrennter Arm. Er wurde durch die Form der Hand als weiblich deklariert. Später kam ein Fuß an anderer Stelle in London dazu, im Great Western Hotel. Es liegt eine kleine Zugfahrt vom Stadtkern entfernt. Darüber hinaus fand sich ein nicht zugehöriges Bein in der Themse.“
„Ich erinnere mich an einen Zeitungsbericht“, stellt Sherlock Holmes fest und blickt nachdenklich wie in weite Ferne.
„Es war unangenehm, aber nicht mein Fall. Die Presse stürzte sich darauf. Der ermittelnde Detective löste den Fall aber zur allgemeinen Zufriedenheit“, stellt Lestrade fest. Er wirkt dabei nicht so, als würde er das auch so sehen. Ich tippe auf einen ehemaligen Vorgesetzten. „Ich war damals bereits bei Scotland Yard.“
„Die Lösung war?“, frage ich wirklich interessiert. Immerhin sind derartige Funde schon befremdlich. Der Fall ist mir völlig unbekannt.
„Medizinstudenten waren es wohl. Die haben sich einen makaberen Scherz erlaubt. Die Teile waren willkürlich aus der Anatomie-Fakultät entwendet. Soweit zumindest damals das Ergebnis.“
Ich hebe die Augenbrauen.
Sherlock Holmes fragt: „Gab es ein Geständnis der Studenten?“
In seinen Augenwinkeln sehe ich leichte Belustigung, wenn ich mich nicht irre. Superintendent Lestrade schüttelt den Kopf. Sein Rattengesicht bekommt einen härteren Zug um die Mundwinkel als bisher.
„Es war niemand geständig. Aber wenn man alles Unmögliche ausschließt, ist das, was übrigbleibt, die Wahrheit. Das sagen Sie doch selbst immer, Mister Holmes!“
„Und was ist am wahrscheinlichsten in Anbetracht dieser Teile, oder sagen wir Leiche?“, fragt Sherlock Holmes mit Blick auf die Körperstücke. Superintendent Lestrades Schultern sinken merklich etwas herab.
„Dass mein Vorgänger geschlampt hat bei seinen Ermittlungen. Der Fall war unangenehm und die Lösung bequem und schnell. Es könnte eine Verbindung geben.“
Holmes nickt langsam.
„Eine Möglichkeit ist das, ja. Erzählen Sie mir von Lord Fryfield. Der Name ist mir nicht vertraut“, fordert Holmes nun. Er betrachtet die Stücke des Toten mit wachsender Neugier.
„Lord William Fryfield ist dreiundvierzig Jahre alt ... gewesen, ein bekannter Lebemann und Kunstsammler. Im Parlament steht, ich meine, stand er den progressiven Kräften vor. Man sagt, er unterstützte das Frauenwahlrecht und traf sich mit Sozialisten.“
Holmes mustert Superintendent Lestrade dabei kurz.
„Sie wissen etwas, das Ihnen unangenehm ist“, sage ich in das darauffolgende Schweigen. Es ist offensichtlich, dass es noch mehr gibt, das Lestrade unangenehm ist. Superintendent Lestrade nickt.
„Lord Fryfield ist ein in der City bekannter Lebemann, seine Frauengeschichten machen oft die Runde. Aber wer weiß, ob das alles so stimmt.“
„Es ist immer mehr Rauch bei bekannten Persönlichkeiten als Feuer“, stimme ich ihm zu.
„Also gibt es reichlich Motive“, resümiert Holmes trocken.
„Er ist Parlamentarier, was liegt da nicht näher als ein politischer Mord?“, fragt nun Superintendent Lestrade. „Ich lasse bereits überprüfen, über was als nächstes abgestimmt wird.“
Sherlock Holmes schüttelt langsam den Kopf.
„Mein lieber Lestrade, Ihr Eifer in allen Ehren aber schließen Sie besser nicht frühzeitig eine Ermittlungsrichtung völlig aus. Man verrennt sich dann hinterher in eine völlig falsche Richtung. Können Sie uns zu seiner Witwe bringen?“
Superintendent Lestrades Augen springen von Sherlock Holmes zu mir und schließlich nickt er.
„Sicher“, sagt er dabei und wendet sich zur Tür. Er öffnet sie und winkt einen der Polizisten heran, die davorstehen.
„Stower, bringen Sie die beiden Gentlemen zu einer Droschke.“
Er reicht uns einen kleinen Notizzettel.
„Die Adresse des Verstorbenen“, erklärt er dabei das Offensichtliche.
Draußen winken wir uns mit tatkräftiger Hilfe von Stower eine Droschke heran, keine der modernen pferdelosen Droschken, sondern eine der alten Einspännerkutschen. Die Kutsche hat nur eine Achse und der Fahrer sitzt erhoben hinter der Kabine. Die Kabine ist klein und muffig, dennoch mag ich es lieber als ein Automobil. Ob die sich wohl durchsetzen werden? Es wird die Zeit zeigen.
„Zu Lord Fryfields Anwesen bitte, Amuthon-Street 111“, instruiert Sherlock Holmes den Fahrer, während ich bereits einsteige. Genaugenommen hieve ich mich herein, es ist nicht mehr ganz so leicht, diese kleine Stufe hinaufzukommen.
Der Fahrer fährt schnell und die Federung ist nicht mehr die neueste. Mein Bein schmerzt bei jedem Pflasterstein, den wir überfahren. Es schmerzt also beständig. Möglicherweise würde ich dem Automobil doch den Vorzug geben, wenn es denn besser gefedert wäre.
„Ein wirklich interessanter Fall“, konstatiert Sherlock Holmes und notiert etwas in sein kleines ledernes Notizbuch.
„Zweifellos. Solche Brutalität ist selten. Jemanden so zu zerhacken ... befremdlich ist das“, stimme ich zu. Holmes kratzt sich nachdenklich an seinem eckigen Kinn.
„Worunter leiden Sie?“, fragt er mich unvermittelt. Er überrascht mich damit. Fast hätte er mich überrumpelt. Ich lächele nur verlegen und antworte nicht direkt.
„Ich leide, worunter wir alle mehr oder weniger leiden: das Alter, Mister Holmes, das Alter.“
Wir versinken in Schweigen. Holmes fragt nicht weiter nach, worüber ich froh bin.
Kapitel 2: Das Leben des Lord William Fryfield
Etwas später erreichen wir das Anwesen der Familie Fryfield. Es ist ein fast kirchenartiger Bau am Rande Londons mit weiten Ländereien.
Das mittlere Schiff des Gebäudes ist höher als die Seitenschiffe und am uns zugewandten Eingang erkennt man, dass es ein Trikonchos-Bau ist. Es gibt drei deutliche namensgebende Auswölbungen. In einer echten Kirchen wären das Ausbuchtungen neben und hinter dem Altar. Es gibt klassischen Kirchen eine spezielle Kreuzform. Ob wir es hier mit einem Gläubigen oder einem Angeber zu tun haben?
Dieser sechsstöckige Bau ist aber keine Kirche, viele Details verraten, dass er als Wohnhaus konzipiert wurde. Abgesehen davon müsste eine echte Kirche anders ausgerichtet sein. Der Eingang ist stets im Osten, die Apsis im Westen. Dass Jerusalem so wie der Aufgang der Sonne im Osten lagen, dürfte die Baulogik klassischer Kirchen erklären. Hier aber ist es umgekehrt, ich nehme an, dass sich die Arbeitszimmer im Osten befinden. Möglich ist natürlich auch das Schlafzimmer, um sich ganz wie Ludwig der Vierzehnte von der Sonne wecken zu lassen.
Sherlock Holmes klopft an die schwarze Holztür. Ein ergrauter Diener im modischen und vor allem ziemlich neuen Frack öffnet uns. Er hat Augenbrauen dünn wie Striche und eine Hakennase.
„Sie wünschen?“, fragt er mit unüberhörbarem französischem Akzent. Während er redet, bebt der leichte Kropf an seinem Hals. Seine Haltung ist dabei tadellos und sein Blick verrät, dass wir es hier mit einer Schlüsselfigur zu tun haben. Er ist gewissermaßen der Torwächter. Er misst uns mit Blicken und entscheidet, ob wir vorgelassen werden oder unwürdig sind. Zudem hat er den Blick eines Mannes, der um seine Macht weiß.
„Wir wünschen, Lady Freyfield zu sprechen“, erklärt Holmes freundlich. „Wir beraten die Polizei bezüglich des bedauerlichen Mordes an ihrem Mann.“
Der Diener nickt und ich sehe echtes Bedauern und Trauer in seinen Augen aufblitzen. Dann fängt er sich wieder und sein Gesicht wird zur distanzierten Maske, die sein Beruf verlangt.
„Bitte folgen Sie mir in den Naos, ich werde die Lady über Ihr Kommen unterrichten.“
Er führt uns in einen Seitenraum, der mit römischen und griechischen Statuen gefüllt ist. Es ist letztlich nur ein protziges Wartezimmer. Die römisch-griechischen Statuen sind größtenteils aus Bronze, was dafür spricht, dass sie nicht echt sind. Die meisten glauben zwar, dass die Marmorstatuen, die wir kennen, die echten sind, doch das ist nicht ganz richtig. Die Griechen fertigten ihre Skulpturen gerne aus Bronze an, die Römer kopierten diese oft alten Originalstücke dann später gerne in Marmor und verkauften sie an eine breite Oberschicht des Römischen Imperiums. Allerdings gibt es heutzutage kaum echte Bronzestatuen, da sie sich viel zu leicht einschmelzen lassen, als dass sie erhalten bleiben.
Ich lasse mich zufrieden in einen der weichen Lederclubsessel fallen, die hier stehen. Gute Sitzmöbel sind eine echte Wohltat im Alter.
„Er nennt es ein Naos“, stellt Sherlock Holmes leicht amüsiert fest.
„Einen Tempel, auf griechisch“, stimme ich zu und schmunzle.
„Altertümliches ist hier wohl dafür gedacht anzugeben“, resümiert Holmes und sieht sich die Statuen im Raum genauer an.
„Gentlemen“, sagte eine Frau in den späten Dreißigern, als sie den Raum betritt und uns aufschreckt. Sie trägt ein dunkles Kleid, das ihre Figur betont aber gleichzeitig hochgeschlossen ist. Sollte etwas an den Gerüchten über Affären des Lords Fryfield dran sein, liegt es zumindest nicht am Aussehen seiner Angetrauten.
Es wird wohl dann ihr Verhalten sein, das ihn in die Arme anderer Frauen trieb. Oder die Freude am Jagen, das motiviert manche Männer auch. Einige Männer neigen ab einem gewissen Alter dazu, den eigenen Wert noch einmal versichert haben zu wollen. Sie versuchen, jüngere Frauen von sich zu begeistern und bekommen so die Bewunderung, die ihnen möglicherweise zu Hause fehlt. Letztlich suchen wir alle Anerkennung für das was wir tun, egal von wem wir sie letztlich bekommen. Ob diese jungen Frauen nur das Geld der Herren bewundern, ist dabei oft für den Mann zweitrangig oder nicht ersichtlich. Was ihn auch immer dazu brachte, überlege ich, das Aussehen seiner Frau ist es nicht, und verwerfe den Gedanken wieder. Man sollte sich nicht zu schnell auf eine Sichtweise festlegen.
Lady Fryfield hat jedenfalls ein hübsches etwas flaches Gesicht mit verquollenen Augen. Sie hat versucht es zu überschminken, doch es ist erkennbar, dass sie viel geweint hat.
„Sie wollten mich bezüglich des Todes meines Mannes sprechen.“ Ihre Stimme ist kalt und schneidend. Wir stören, das ist offensichtlich. Die Stimme steht auch im Kontrast zu ihren verweinten Augen. Sie bleibt stehen, also tut Sherlock Holmes das auch. Ich erhebe mich mit meinem Stock aus dem bequemen Sessel. Das Leder knirscht dabei in der Stille ungewöhnlich laut.
„Zuerst möchte ich unser Beileid aussprechen“, sage ich höflich. Holmes nickt zustimmend.
Mit einem grazilen Nicken nimmt sie die Beileidsbekundungen an, sagt aber nichts.
„Wüssten Sie jemanden, der einen Grund hatte, Ihren Mann zu töten?“, fragt Holmes unvermittelt. Er möchte sie damit vielleicht aus der Fassung bringen, ihr etwas entlocken. Das gelingt ihm nicht. Dafür gelingt es ihm, sie aufzubringen. Ihre Wangen werden rot, als sie mit keifender Stimme sagt: „Was glauben Sie? Er war ein Mitglied des Parlaments, er war ein Lord. Glauben Sie auch, dass er mich betrogen hat? Als diese widerwärtigen Gerüchte in der Presse ... Sie alle erfreuen sich doch nur am Leiden anderer. Dort wird das Eheleben anderer schamlos thematisiert und nichts kann man unter sich regeln. Er war mein Mann, meiner!“
Beim letzten Wort bohrt sich ihr Zeigefinger in die Luft vor Holmes, und der Finger erinnert mehr an einen Dolch.
Sherlock Holmes hebt unbekümmert eine Augenbraue und mustert sie. Ich glaube, der Gefühlsausbruch dieser Dame ist ihm etwas unangenehm.
„Dann stelle ich die Frage anders, Lady Fryfield: Ihr Mann, der zweifellos Ihnen allein gehörte, hat er von Zeit zu Zeit das Vergnügen anderer Damen gesucht?“
Es blitzt in Lady Fryfields Augen auf. Egal, ob ihr Mann eine Liebschaft hatte oder nicht. Sie jedenfalls glaubt es oder traut es ihm zu. Das schließt sie als Täterin ein, weshalb ich auch Holmes nicht unterbreche. Sofern sie die Bedrohung durch andere Frauen als groß genug einschätzte, ist sie eine mögliche Täterin.
„Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen?“, frage ich dazwischen. Ich denke nicht, dass wir ihr auf diese Weise mehr entlocken können, ihr Gesicht ist wieder eine Fassade und sie hat sich unter Kontrolle. Er hat sie wütend gemacht. Hoffentlich verrät sie uns nun noch genug, was wir wissen müssen.
„Gestern, als er in der Frühe losfuhr“, erwidert sie kurz angebunden. Sie mustert mich und Sherlock Holmes noch einmal. „Ich muss mir Ihre Anschuldigungen nicht anhören.“
Der Diener betritt den Raum, abwartend ob er uns hinausgeleiten soll. Er scheint durch ihren Ausbruch alarmiert zu sein.
„Wohin wollte er?“, fragt Holmes, ihre Bemerkung ignorierend.
„Das geht Sie nichts an“, zischt sie und bedeutet uns mit einer Bewegung zu gehen. Ich frage mich, ob ich der einzige bin, der stattdessen hört „ich weiß es nicht“.
Der Diener sieht erwartungsvoll zu uns. Lady Fryfields Gesichtsausdruck lässt mich vermuten, dass sie es gar nicht genau weiß und deswegen so gereizt ist. Dieses Ehepaar scheint schon länger mehr nebeneinander als miteinander zu leben.
„Guten Tag“, verabschiedet uns Lady Fryfield und lässt uns einfach stehen. Sie hätte auch „hinaus“ rufen können, so wie sie es betont hat. Der Diener bringt uns derweil zur Tür, die krachend hinter uns ins Schloss fällt.
„Sie scheint schon länger nicht mit ihrem Mann geredet zu haben“, stellt Holmes fest. „Zumindest nicht mehr als oberflächlich.“
Ich nicke.
„Ihre Krähenfüße sprechen für Stress und einige wache Nächte, ihre abgekauten Nägel ebenso für Ärger im Haus. Ihre Augen sind sehr verweint, aber nicht erst seit heute. Zudem passt ihr Kleid nicht“, bemerkt Holmes, während wir zurück zur Droschke gehen. „Sie hat mindestens fünf Pfund zugenommen. Frustrationsessen, denke ich. Ein Phänomen der gelangweilten gutverdienenden Schicht.“
„Ihre Probleme werden ihr aber genauso dramatisch erscheinen wie die Frage des Arbeiters, am Ende des Monats mit wenig Geld über viele Tage zu kommen.“
„Natürlich, ich meinte eher: Man muss genug Geld haben, um aus Frust zu essen, nicht aus Hunger.“
„Finanziell steht es wohl gut, ja. Das Haus ist gut gepflegt. Mit Garten gibt es sicher, denke ich, mindestens neun Diener.“
Wir gehen gemäßigt zurück zur wartenden Droschke. Der Kutscher raucht seine Pfeife und nickt uns zufrieden zu. Auch diese Wartezeit wird ihm immerhin vergütet. Plötzlich hält eine andere Droschke, ein Mann steigt aus. Er hat es eilig. Er hat einen abgetragenen braunen Tweedanzug an. Unter dem Arm hat er eine Aktentasche aus Leder. Sie ist, wenn auch hochwertig, schon einmal geflickt worden.
Er versucht nach mehr Geld auszusehen, als er besitzt, denke ich. Irgendein Aufgestiegener vielleicht, oder jemand in finanziellen Nöten?
„Guten Tag die beiden Gentlemen. Ich bin Patrick Lynche, Antiquitätenhändler“, begrüßt er uns mit einem gewinnbringenden Lächeln. Er hebt dabei seinen Bowlerhut. Der Mann will uns etwas verkaufen, er hat diese besondere Körperhaltung ...
„Die Herren Holmes und Dupin“, stellt Sherlock uns kurz vor und ergreift die dargebotene Hand.
„Sollten Sie wie die Fryfields große Begeisterung für die griechisch-römische Antike haben, kommen Sie doch mal in mein Geschäft in Whitechapel im East End.“
Ich sehe Holmes‘ Augenbrauen hochschnellen, was Mister Lynche wohl auch nicht entgeht.
„Ich weiß, das ist keine gute Adresse, viele arme Arbeiter ... Aber Statuen und Fresken nehmen Platz weg, da habe ich ein sehr platzintensives Gewerbe. Und keine schlechte Nachbarschaft, seien Sie versichert.“
Er zeigt ein gewinnbringendes Lächeln, das ihn wirklich fast sympathisch macht. Er hat ja auch allen Grund zu lächeln, immerhin will er unser Bestes: unser Geld.
„Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen“, erklärt Holmes. Patrick Lynche reicht ihm seine Visitenkarte und wir verabschieden uns.
Mit der Droschke machen wir uns auf den Weg in die Baker Street. Ich verabschiede mich von Sherlock Holmes, denn es ist schon spät und der Mond geht auf, während die Gasflammen der Laternen entzündet werden. Dieses warme Licht von brennendem Gas erfreut, finde ich, das Auge jedes Mal.
Sherlock Holmes und ich wollen uns am nächsten Morgen beim Frühstück weiter beraten.
Als ich alleine in meinem Zimmer im Hotel Frisian Palace bin, lege ich mich auf das Bett und atme tief ein und aus. Der kleine Raum mit seinen weiß verputzen Wänden und den alten Holzdielen kommt mir nun sehr eng vor. Mein Bein schmerzt und das nicht als einziges. Nach einer Weile raffe ich mich auf und fülle mir eine Spritze mit Morphium. Die Nadel sticht durch meinen Arm und in meinen Blutkreislauf dringt süßer Nektar der Götter. Er macht den Tag erträglich, sobald die Arbeit einen nicht mehr auf Trab hält. Der Doktor hat mir von einer so weiten Reise wie nach London abgeraten. Sei es drum! Dieses eine Leben ist nun mal das meinige und ich beende es lieber dabei, etwas zu tun, das mir gefällt, als es zu verlängern in Langeweile und Ereignislosigkeit. Umso mehr das Morphium wirkt, umso mehr merke ich, wie ich müde werde. Der Schmerz weicht und lässt nur Müdigkeit zurück.
Ich versinke in traumlosen, gnädigen Schlaf. Als letztes muss ich daran denken, wie passend Morphium betitelt ist: Morpheus, Gott des Schlafes und Bruder von Thanatos, dem Gott des Todes ...
*
Am nächsten Morgen besucht mich Sherlock Holmes beim Frühstück im Frisian Palace. Im Erdgeschoss ist eine einladende Lobby, in der an kleinen runden Eichentischen serviert wird. Es ist deftigeres Essen zum Frühstück, als ich es gewöhnt bin. Umso älter man wird, umso empfindlicher reagiert der Magen auf derlei Leckerei.
„Ein Kontakt von mir hat sich über Lord Fryfield erkundigt“, stellt Sherlock Holmes fest und ruft den Kellner zu sich, um noch eine Tasse Tee zu erhalten.
„Etwas Interessantes dabei herausgekommen?“, stelle ich die redundante Frage. Natürlich ist da ‚etwas‘ bei herausgekommen, sonst hätte Holmes es nicht erwähnt. Die meisten Menschen schätzen es aber, auf diese Weise in einem Gespräch ‚der Klügere‘ zu sein. Es ist kurze Überlegenheit, dennoch scheint sie jeder ab und zu kosten zu wollen. Unabhängig von sonstiger Intelligenz sind wir doch auch Menschen und sehnen uns nach Anerkennung. Holmes nickt und trinkt seine Tasse leer, bevor ihm eine neue Kanne vom Kellner gebracht wird.
„Er war ein ums andere Mal im Club ‚Zur roten Krone‘, und zwar oft inkognito“, stellt Sherlock Holmes fest. Ein hochgewachsener Junge mit sommersprossigem Gesicht und blonden Haaren bringt nun eine neue Kanne Tee. Der Junge kellnert wohl schon länger, er ist jung, aber sehr geschickt. Den Mund hält er geschlossen, ich habe gestern kurz gesehen warum: Seine Zähne sind in einem miserablen Zustand, wie die vieler Leute aus den unteren Schichten.
„Woher weiß Ihr Kontakt es dann?“, frage ich.
Allein, dass Holmes ‚Kontakt‘ sagt und nicht ‚Freund‘ oder ‚Bekannter‘, ist interessant. Männer wie wir haben nur wenige Freunde. Jemand muss es wert sein, dass man sich so eingehend mit ihm befasst, um ihn Freund zu nennen.
„Mein Kontakt ist ein Obdachloser, der dort gerne ein und aus geht. Das Besondere ist hier, wie oft bei solchen Etablissements, der Hintereingang, und dort lungert mein Kontakt oft herum. Es gibt dort wohl einige windgeschützte Häusereingänge. Von da aus kann er die hohen Herren sehen und auch mal ins Träumen kommen.“
„Sie haben interessante Kontakte“, gebe ich zu. „Und nützliche.“
Holmes lächelt. Wir machen uns auf den Weg zum „Zur roten Krone“. Später wollen wir auch noch einen Kollegen von Lord Fryfield treffen, den Abgeordneten Lord Augustus Tembroke. Doch bis dahin wollen wir uns im Bordell umhören. Wer weiß? Vielleicht hat Fryfield einer Dame dort mehr verraten als seiner Frau zu Hause?
Eine Droschke bringt uns vor den Hintereingang des Bordells, der letztlich als Haupteingang für die besser gestellten Kunden fungiert.
Wir klopfen und eine zierliche Chinesin öffnet uns. Sie trägt ein Kleid, das ihrem Dekolleté schmeichelt. Das bringt den Kreislauf doch etwas in Gang, immerhin bin ich alt, nicht tot!
„Sie wünschen?“, fragt sie mit starkem Akzent.
„Wir suchen die gute Bekannte unseres Freundes William Fryfield“, erklärt Holmes und beugt sich vertrauensvoll zu der Frau vor. Die Chinesin mustert uns und scheint fieberhaft nachzudenken, ob wir schon einmal da waren. Immerhin lebt dieses Etablissement davon, diskret zu sein. Wir benehmen uns also, als würden wir hergehören. Unser Bluff geht auf.
„Bitte, treten Sie ein. Ich sage Vicki Bescheid“, sagt die Chinesin und führt uns in eine luxuriöse Wartehalle. Wandteppiche verbergen Türen und Treppenaufgänge hinter sich. Der Raum ist ein großes Oktogon und ein schwerer Kronleuchter spendet ein flackerndes Halblicht. Auf der Balustrade des Obergeschosses redet ein Mann in Anzug und Weste mit einer Rothaarigen. Er mustert uns abschätzig. Ich denke, das ist kein Kunde, das ist nun entweder ein Lude oder irgendjemand anderes, der hier für Ordnung sorgt. Sein Blick verrät, dass er unser Gefahrenpotenzial für Unruhe zu sorgen einschätzt. Leider scheine ich nicht mehr der Mühe wert zu sein, so schnell wie er den Blick abwendet.
„Ich bin gespannt, was wir hier erfahren“, sage ich leise, mehr zu mir selbst als zu Sherlock. Holmes nickt dabei aber unmerklich.
Die Chinesin führt eine Frau zu uns. Vicki ist groß für eine Frau und hat hohe Wangenknochen, was ihr ein spitzes Gesicht verleiht. Sie trägt ein einfaches Kleid, was an ihr nichtsdestoweniger umwerfend aussieht.
„Ja? Was wollen Sie?“, fragt sie. Ihr Akzent ist, denke ich, ein Indiz für eine osteuropäische Herkunft. Da bin ich mir aber nicht sicher. Vielleicht aus der Ukraine? Ich richte meinen Blick von ihren üppigen Rundungen zurück zu ihren meerblauen Augen. Das ist zugegeben nicht ganz leicht.
Selbstdisziplin, denke ich, ist die schwerste Art der Disziplinierung. Man kann dabei den Lehrmeister nicht ordentlich verabscheuen für das, was er einem antut.
„Wir sind wegen eines Ihrer Kunden hier, Lord William Fryfield“, stellt Holmes klar. Es blitzt in Vickis Augen. Das ist nicht nur Wiedererkennen, das ist echte Emotion, vielleicht sogar Liebe. Kurz werden ihre Gesichtszüge weicher, entspannter. Dann verhärten sie sich zu einer misstrauischen Maske.
„Sie sie bei der Polizei?“
„Nein, wir beraten sie nur. Wir sind aber nur an Lord Fryfield interessiert, nichts und niemand anderem.“
„Wir reden nicht über Kunden, noch bestätigen wir ihre Besuche oder ob sie Kunden sind. Ich habe den Namen noch nie gehört“, sagt Vicki mit kalter Stimme. Ihre schönen Gesichtszüge verhärten sich.
„Sie lügen“, stellt Holmes fest, während ich mich in einen der Sessel fallen lasse. Meine Knie tun höllisch weh. Vickis Gesichtszüge verhärten sich, sofern möglich, noch mehr.
Dafür ist der Sessel eindeutig durchgesessen und zu weich.
„Das ist eindeutig“, fährt Sherlock Holmes fort, da sie, ihn böse anfunkelnd, schweigt. „Sie, Madame, denken mit äußerst warmen Gefühlen an ihn. Ich denke, mir fällt dabei eine unrühmliche Rolle zu. Ich muss Ihnen mit dem tiefsten Bedauern mitteilen, das wir im Falle des Todes von Lord William Fryfield ermitteln. Wir suchen seinen Mörder, nicht seinen Ruf zu beschmutzen.“
Das hat gesessen. Vicki blinzelt ein paar Mal, dann füllen sich ihre Augen mit Tränen. Sie beginnt hemmungslos zu weinen, sinkt auf einen der Sessel und schluchzt. Dann scheint sie zu begreifen, dass sie in Gesellschaft ist und versucht ihre Contenance zurückzugewinnen. Ihre Schminke ist etwas verlaufen, was ihr einen leicht irren Ausdruck verleiht, als ihre Mundwinkel wieder einen harten Zug annehmen.
„Wer war das?“, zischt sie. Viele Menschen werden nicht gefährlich, wenn sie laut sind, sondern erst, wenn sie derart still werden.
„Genau das versuchen wir herauszufinden“, sage ich und erhebe mich mühevoll mit meinem Stock vom Sessel. Ich schreite zu ihr und reiche ihr ein Taschentuch. Sherlock scheint nicht auf eine derartige Idee zu kommen. Sie nimmt das frische Taschentuch dankbar an und schnäuzt sich geräuschvoll.
„Wir nehmen an, Sie hatten ein engeres Verhältnis zu Lord Fryfield“, stelle ich behutsam fest. Ich würde mich sogar zu der Spekulation hinreißen lassen, dass es enger war als zu seiner Frau, der verwitweten Lady Fryfield. Aber das behalte ich besser für mich.
„Beschreiben Sie bitte Ihr Verhältnis“, unterbricht Holmes Vickis und meine Gedankengänge. Sie blinzelt einige Tränen weg und schnäuzt sich sehr undamenhaft.
„Wir lieben uns, auch wenn er seine Frau nicht für eine so Standesungemäße wie mich verlassen kann. Er mag sie wohl auch oder eher die Frau, die sie mal war. Sie ist so frigide ... aber das sind meine Worte. Er ist da, nun, verständnisvoller. Er ist allgemein so verständnisvoll. Aber wenn es zu Hause nie etwas zu essen gibt, isst man eben außer Haus“, stellt sie mit Trotz und ihrem leichtem Akzent fest. „Er sorgt dafür, dass ich keine Kunden außer ihm habe.“
„Hat er Feinde, von denen er Ihnen berichtet hat? Sorgen in letzter Zeit?“, frage ich. Sie schüttelt den Kopf. Ihr Blick geht dabei in weite Ferne, sicher in die Vergangenheit. Sich Erinnern ist ja auch immer ein Sehen von dem, was war. Dabei ist es wie ein Blick in die Vergangenheit, also ein Sehen im ganz wortwörtlichen Sinne.
„Er war so aufgebracht wegen der Antiquitäten, die er kaufen wollte. Sie waren wirklich wertvoll, sagte er. Irgendein Bronzekopf von einem Griechen. Hektor, oder nein Alexander hieß er, glaube ich.“ Ihre Gesichtszüge bekommen dabei eine viel wärmere Ausstrahlung. Sie werden regelrecht weich, als sie sich an den Verstorbenen erinnert. „Mein William ist so sehr begeistert von der Antike.“
Mir fällt auf, dass sie schon wieder die Zeitform wechselt. Ich glaube nicht, dass sie ihn umgebracht hat, oder redet sie absichtlich von ihm in der Gegenwart?
„Eine Plastik Alexanders des Großen ist wahrlich selten und teuer“, stellt Sherlock Holmes beeindruckt fest. Vicki nickt unsicher, sie scheint keine Ahnung von solchen Dingen zu haben. Woher auch?
„Er war wegen einer Abstimmung aufgeregt, aber ich wüsste nicht, wer ihm etwas getan haben sollte. Er ist so ein lieber Mann“, sie schluchzt dabei. Ihr scheint der Tod mit seiner Endgültigkeit wieder in den Sinn zu kommen. Ich nicke verständnisvoll, weil sie beim Schluchzen immer wieder mich ansieht. Vielleicht war jemand anderes auf die Antiken aufmerksam geworden und ein anderer Sammler hatte Lord William Fryfield auf dem Gewissen? Noch ist alles möglich, man sollte keine Möglichkeit zu früh aussortieren. Oft scheitern viele Ermittlungen daran, dass man sich zu früh festlegt.
„Fällt Ihnen vielleicht noch etwas ein?“, hakt Holmes unerbittlich nach. Er scheint den konkurrierenden Sammler für nicht sehr wahrscheinlich zu halten. Oder sieht er die Möglichkeit etwa nicht?
Dann hätte ich mich schwer in ihm getäuscht. Vicki tupft sich einige Tränen weg, während Holmes einen Blick auf seine Uhr und anschließend mir einen Blick zuwirft. Ich begreife sofort, worauf er hinaus will. Es ist Zeit für uns zu gehen. Unser Termin erwartet uns. Wir wollen uns schließlich noch mit dem Abgeordneten Lord Augustus Tembroke treffen.
„Madame, ich wohne im Frisian Palace. Bitte melden Sie sich, sollte Ihnen noch etwas einfallen. Mein Name ist Dupin“, beende ich unsere Befragung mit Blick auf Holmes. Er scheint einverstanden. Diese Frau wirkt ziemlich aufgelöst und wird eine ganze Weile keine vernünftige Aussage machen. Vicki seufzt und wirkt kurz unentschlossen. Erst glaube ich, sie will uns noch etwas mitteilen. Dann begreife ich ihre Unentschlossenheit und sage: „Behalten Sie das Taschentuch.“
Ich stemme mich auf meinen Stock hoch und ein infernalischer Schmerz geht durch mein Rückgrat. Doch dann ebbt er ab, und wir verlassen die Rote Krone.
Kapitel 3: Köpfe
Lord Tembroke erwartet uns in einem Arbeitszimmer, das er im Westminster Palace hat. Die Fenster sind zu, die Themse stinkt heute aufgrund der eingeleiteten Abwässer des Molochs London wieder bestialisch. Ich bin ja eigentlich keine zart besaitete Person, doch dieser Gestank ist wahrlich geeignet, Tote zu erwecken. Lord Augustus Tembroke sitzt an einem schweren Mahagonitisch, auf dem sich Formulare und Notizen nur so türmen.
„Gentlemen“, begrüßt uns Lord Tembroke fröhlich. Er ist von beachtlichem Umfang, aber blitzschnell aus seinem Stuhl aufgesprungen. Seine Jacke ist etwas unmodern geschnitten und die Hose spannt deutlich um diesen von Wohlstand zeugenden Bauch. „Was genau wollen Sie von mir wissen? Wie kann ich denn Scotland Yard behilflich sein?“
Ein Schatten huscht über sein Gesicht, als er wohl an den Tod von Lord Fryfield denkt. Danach hat er wieder ein geschäftsmäßiges Lächeln aufgesetzt. Doch es erreicht nicht seine Augen. Jeder Mensch lügt seine Mitmenschen an. Wir setzen uns auf zwei schwere Sessel, die dem Schreibtisch gegenüberstehen. Sie sind lederbespannt und sehr bequem. Ein großes Regal nimmt die Wand hinter Lord Augustus Tembroke ein: lauter Bücher, die er nie liest. Kein Buchrücken ist geknickt, sie sind alle wie neu, dazu verräterischer Staub. Das ist kein Bibliophiler, das ist einer, der nur beeindrucken will.
„Es ist eine Schande“, poltert Lord Tembroke los, bevor wir die erste Frage stellen konnten. „Wer das war, darf einfach nicht davonkommen.“
Holmes nickt verständnisvoll.
„Genau deswegen sind wir hier, Lord Tembroke. Wann haben Sie den verstorbenen Lord Fryfield zuletzt gesehen? Wirkte er beunruhigt wegen etwas?“
Augustus Tembroke kratzt sich am Kinn. Dann schüttelt er den Kopf.
„Tja gesehen. Wann war das noch? Ach ja. Gesehen habe ich ihn, nun ...“, er zögert. „Sie sind doch verschwiegene Gentlemen, oder?“
Holmes und ich nicken. „Natürlich, uns geht es allein um den Mörder.“
„Vorgestern habe ich ihn in einem Gentlemen‘s Club der etwas anderen Art getroffen. Die Rote Krone, sagt Ihnen das vielleicht etwas.“
„Wir kennen es und wissen, dass er dort häufiger war.“
„Nun, ich bin ihm da ein ums andere Mal am Eingang begegnet, man nickt sich zu, aber redet nicht. Wie man das eben so macht.“
Ich nicke, immerhin sind wir heute schon da gewesen. Die Rote Krone dürfte einige prominente Gäste haben.
„Was glauben Sie, wer ein Motiv hätte?“, fragt Holmes geradeheraus.
Lord Augustus Tembroke sieht ihn seltsam an.
„Seine Frau oder General Winterbotton“, sagt er dann. Er scheint sich nicht ganz wohl in seiner Haut zu fühlen.
„Erklären Sie die Vermutung, bitte“, sage ich.
Augustus Tembroke sieht zu mir.
„Seine Frau und William, also Lord Fryfield, hatten sich auseinandergelebt, soweit ich das, im Vertrauen, mitbekommen habe. Sie hatte weder Interesse an ihm noch an einer Versöhnung und war wohl ziemlich kalt und abweisend. Andererseits konnte sie sich ja schlecht scheiden lassen, was hätte das für ihren Stand geheißen? Sie ist nicht so gut familiär aufgestellt wie Fryfield es ist. Ich meine, wie er es war. Sie hatte kein Interesse an einem lebenden und ungebundenen William. Der Tod kommt ihr wohl zupass. Auf der anderen Seite ist da General Winterbotton. Der ist ein anderes Kaliber, meine Herren. Er ist sehr religiös, wenn Sie verstehen, was ich meine.“
„Leider nein, erklären Sie es mir?“, frage ich höflich nach.
„Er ist oft im Epikur-Club mit Wiliam Fryfield aneinander geraten. General Winterbotton ist nicht nur gegen Alkohol, weil es den Körper schädigt. Er gehört einer sehr fundamentalistischen Gruppe von Erwachsenentäufern an. Der General ist aus christlichen Motiven gegen unsere Arbeitsreform. Es geht darum, wie viele Rechte ein Arbeitgeber hat. Winterbotton ist selbst ein Aufsteiger. Er will, dass die Arbeiter gar keine Rechte haben. Wenn wir, wie bisher, versuchen, die Kinder in die Schule und nicht ans Fließband zu bekommen, verderben wir sie, sagt Winterbotton. Wissen ist für ihn nicht so wichtig, wenn Sie verstehen. Für ihn sollte es kein Buch neben der Bibel und der Verordnung der Streitkräfte geben“, höhnt Lord Tembroke. „Er ist ein unangenehmer Zeitgenosse, sehr aufbrausend. Er verdirbt allen im Epikur-Club die Laune. Mich eingeschlossen.“
Augustus Tembroke reicht uns eine kleine Visitenkarte des Epikur-Club.
„Vielen Dank“, sage ich darauf.
„Aber einen konkreten Verdacht haben Sie nicht, oder?“, hakt Holmes nach. Lord Augustus Tembroke schüttelt den Kopf.
„Nein, sonst wäre ich bei der Polizei gewesen. William und ich sind oft abends weg gewesen und ich habe ihn als Kollegen im Parlament sehr geschätzt. Ich will nicht schlecht über ihn reden, wirklich. Aber seine Frau ... die war ziemlich kalt, in mehrfacher Hinsicht, wissen Sie? Der traue ich zu, die Drecksarbeit von jemand anderem machen zu lassen.“
Ich wechsle einen Blick mit Sherlock Holmes. Dieser scheint keine Fragen mehr zu haben. Wir verabschieden uns. Auf dem Weg zur Straße frage ich Holmes: „Ich bezweifle, dass Fryfields Frau genug Kraft hätte, seinen Körper so zuzurichten, was meinen Sie?“
Holmes nickt. „Vielleicht ein Liebhaber? Ihr Ehemann schien auch grundsätzlich Interesse am anderen Geschlecht zu hegen, nur nicht an ihr. Oder aber sie hat vielleicht wirklich jemanden beauftragt. Das würde auch eine Verbindung schaffen zu dem Mord damals bei Scotland Yard. Vielleicht hat der Mörder für Geld erneut zugeschlagen. Oder er saß wegen eines anderen Vergehens im Gefängnis, so dass er lange keinen Mord beging.“
„Sind die Akten von damals zugänglich?“
„Ich habe sie zu mir in die Baker Street bringen lassen. Ich denke, wir sollten uns mit einem guten Glas einmal daransetzen.“
Ich muss lachen und nicke. „Gerne, wer weiß, was wir so finden. Zudem, wer sagt schon nein zu einem Glas am Abend?“
*
Wir fahren in die Baker Street und machen uns daran, zwei Dutzend Kisten voller Akten zu durchforsten. Es ist ungeheuer viel Material für so einen Fall. Normalerweise arbeitet selbst Scotland Yard nicht so allumfassend, wenn es darum geht, was ins Archiv kommt. Doch hier scheint man froh gewesen zu sein, es begraben zu können. Es ist viel Material, selbst jeder Zeitungsartikel, so klein er auch ist, ist enthalten.
Doch es ist völlig unsortiert und wir verbringen Stunden damit, uns einzuarbeiten, von der furchtbaren Handschrift einiger Ermittler gar nicht zu reden. Der Drang, mit Hilfe einer guten Spritze Morphium in die sanften Arme des Schlafes zu wechseln, wird bei mir immer stärker. Das lange Sitzen verwandelt mein Bein in eine schmerzende Masse. Irgendwann fragt Holmes mich unvermittelt: „Wollen Sie etwas zum Entspannen einnehmen?“
Er geht zum Bücherregal und zieht ein medizinisches Fachbuch von Joseph Bell heraus. Es ist innen ausgehöhlt und enthält eine Spritze Morphium. Holmes tropft etwas auf seine Hand und riecht daran.
„Es ist etwas alt, aber noch gut. Ich musste Watson versprechen, es nicht mehr zu nehmen, aber ich habe etwas behalten und frische den Vorrat immer wieder auf. Nur für alle Fälle.“
Er tritt zu mir und reicht mir die Spritze.
„Haben Sie keine Sorge, ich berichte niemandem von Ihrem kleinen Laster.“ Ich nehme die Spritze dankbar an. „Seit wann wissen Sie es?“, frage ich und schiebe meinen Ärmel hoch.
„Seit gestern. Ihr Gang verrät es mir, Sie brauchen das täglich. Ich bilde mir kein Urteil. Das Alter ist hart zu ertragen.“
„Was haben Sie vor, dagegen zu tun?“, frage ich und spritze mir das Morphium. Sherlock Holmes lacht.
„Wenn es nicht mehr geht, kaufe ich mir ein Landgut und züchte vielleicht Bienen“, sagt er. „Dann gehe ich in Ruhestand.“
Ich setze mich in einen Sessel.
Ich will mich kurz ausruhen und döse einfach weg. Ich erwache am nächsten Morgen, was ich am Sonnenlicht erkenne. Das erste, was ich sehe, ist Holmes, der noch genauso über den Akten brütet wie am Abend. Hat er überhaupt geschlafen, geschweige denn sich bewegt?
Er wirkt völlig in Gedanken versunken.
Einen Moment sitze ich einfach so im Sessel. Dann klingelt es unten. Ich warte darauf, dass Sherlock Holmes reagiert. Das tut er nicht, also stehe ich auf. Ich nehme an, er ist wirklich sehr tief versunken. Oder er vermag mit offenen Augen zu schlafen. Unten an der Tür steht Mister Clarke von Scotland Yard.
„Mister Dupin“, begrüßt er mich freundlich überrascht. Ich trete zur Seite und lasse ihn eintreten. „Ist Mister Holmes oben?“
Ich nicke zur Antwort. Gemeinsam gehen wir nach oben die kleine Treppe hinauf. Ich bin dabei langsamer, als mir lieb ist. Doch die Treppe ist nun mal steil. Dafür wirkt das Morphium noch und ich fühle mich kräftig.
„Mister Holmes“, grüßt Mister Clarke, als er den Wohnsalon betritt. Sherlock Holmes sitzt in seinem Sessel und raucht Pfeife. Er ist immer noch umgeben von Akten, wie ich ihn zurückgelassen habe. Dabei ist sein Blick in weite Ferne gerückt. Immerhin raucht er eine Pfeife, also hat er sich bewegt.
„Mister Holmes, es gibt Neuigkeiten“, störe ich Sherlock Holmes‘ Gedankengänge. Mister Clarke sieht mich irritiert an.
„Woher wissen Sie das?“, fragt er irritiert.
„Warum wären Sie sonst bei zwei alten Männern, nicht?“, erwidere ich und zwinkere. An unserem Charme kann es wohl nicht liegen, dass er hier ist, oder?
Clarke nickt etwas verdattert. Ein einfallsloser Mann, befinde ich. Schade, dass so jemand in dem Kreativität erfordernden Beruf des Ermittlers arbeitet. Aber die Bürokratie frisst oft die besten und lässt sie nicht weiterkommen.
„Nun, was versetzt Sie so in Aufruhr?“, fragt Holmes. Er zieht genüsslich an seiner Pfeife. Mister Clarke sieht sich etwas unsicher um.
„Es gibt noch mindestens eine Leiche“, stellt er fest. Meine Augenbrauen wandern in die Höhe und auch Holmes setzt interessiert die Pfeife ab.
„Wer? Wo? Wann?“, platzt es regelrecht aus Sherlock Holmes heraus.
„Wir wissen es noch nicht genau, deswegen lässt Superintendent Lestrade Sie rufen. Wir haben nur eine Leiche. Ich warte unten mit einem Dienstautomobil, einem Daimler Victoria“, stellt Clarke fest.
Wahrlich, ein neues Jahrhundert wartet. Kommt es mir nur so vor, oder ist Clarke stolz auf dieses Automobilmodell? Ich kenne mich nicht besonders aus damit, muss ich gestehen.
Bei der Erwähnung der Leiche ist Holmes allerdings sofort auf den Beinen.
„Gehen wir, los, gehen wir!“, sagt er und ist schon auf der Treppe nach unten. Ich blicke zu Clarke und folge dann Holmes.
*
Mister Clarke fährt uns zu einem Leichenschauhaus. Dort, in einer Seitenkammer, liegt die neue Leiche, oder sagen wir eher, Teile von ihr.
„Wir haben die Leiche aus der Kanalisation. Jemand hat sie da hereingeworfen und sie verkeilte sich an einem Engpass. Kanalarbeiter fanden sie, als sie im städtischen Auftrag dort unterwegs waren, um einige Bettler zu verscheuchen, die dort oft ihr Nachtquartier aufschlagen“, stellt Mister Clarke fest. „Die andere Leiche wurde ja aus der Themse gefischt. Ob das mit ihr hier zu tun hat, wissen wir nicht.“
„Ihm“, korrigiert Sherlock Holmes und deutet auf die Schulterbreite. „Es ist ein ‚er‘, denke ich.“
Wir ziehen uns Handschuhe an und untersuchen den Körper. Er ist etwas aufgedunsen vom Kanalwasser und stinkt erbärmlich.
„Er trägt einen Absolventenring“, bemerke ich. Holmes sieht ihn sich an. Er ist dreckig und hat im Wasser gelitten.
„Cambridge“, murmelt Holmes. Die Leichenteile haben zum Teil noch Kleidung an: Lackschuhe, eine längsgestreifte Hose und zu einem weißen Hemd ein dunkles Jackett. Zumindest lässt der Rest uns darauf schließen. Er war sicher nicht ganz mittellos. Auch wenn die Qualität der Kleidung unter dem Wasser der Kanalisation sehr gelitten hat, ist sie zu erkennen.
Ich fühle in die Taschen und kann Holmes ein kleines grünes Ticket reichen.
„Woher kommt das wohl? Es ist unlesbar, aber der Form nach ein Billet. Vielleicht ein Zug, oder eine Fähre“, sage ich.
„Bahnhof Paddington gibt kleine grüne Fahrscheine heraus“, sagt Sherlock Holmes und mustert den Fahrschein eingehend. Er stellt dem Tonfall nach dabei eine Tatsache fest.
„Das ist nicht weit von hier, oder?“, frage ich. Mister Clarke nickt geflissentlich. Auch diesmal haben wir keinen Kopf bei der Leiche, was die Fahndung natürlich erschweren wird.
In den Taschen des Toten finde ich noch drei weitere Fahrkarten. Auch sie sind unlesbar durch das Wasser, aber ebenfalls eindeutig im selben Grün: vermutlich auch alle vom Paddington-Bahnhof. Ich glaube nicht, dass Holmes sich dabei irrt. Leute wie er und ich können sich so einiges merken.
„Mister Clarke, ich will, dass alle Cambridge-Absolventen, die am Paddington-Bahnhof leben, ausfindig gemacht werden. Schicken Sie, wenn nötig, Leute von Haus zu Haus und lassen Sie rumfragen“, ordnet nun Holmes entschieden an.
Mister Clarke schlägt beinahe artig die Hacken zusammen, so stark imponiert ihm Holmes. Er notiert sich die Anweisung. Man kann sehen, wie er Sherlock Holmes bedenkenlos als Weisungsbefugten akzeptiert. Mister Clarke scheint schwer beeindruckt zu sein.
Nach erneutem Begutachten des Toten frage ich Holmes: „Wollen wir noch zum General?“
„Ja, natürlich“, schreckt Holmes aus seinen Beobachtungen der Leichenteile auf.
Wir lassen uns von Mister Clarke am Epikur-Club an der Radbod Road absetzen. Der Club ist in einem weiß gestrichenen Gebäude untergebracht. Vor der Tür, in einer Nische, steht eine Statue, die wohl Epikur zeigen soll: die Stirn in Falten mit einem Rauschebart, der bis auf die Brust reicht. Dafür fehlt der Darstellung das Haupthaar. Wenn die Haare weichen, kommt ja wohl der Verstand, sagt man. Wir betätigen den Messingtürklopfer. Ein visitenkartengroßes Schild neben der Tür verrät, dass sich hier wirklich der Epikur-Club befindet. Das nenne ich mal Understatement! Allerdings sind viele der exklusiveren Clubs, wie Holmes mir verrät, eher unscheinbar nach außen hin.
„War Epikur nicht dieser Hedonist, dem es nur um Genuss ging?“, frage ich Holmes. Ich kann mich wirklich nicht mehr gut erinnern. Das Alter verlangt seinen Tribut, sehr zu meinem Missfallen.
„Aber nein, das ist die vulgäre Rezeption. Epikur steht, in den wenigen Texten, die erhalten sind, viel mehr für das Nutzen der wenigen Zeit, die man hat, nicht für unmoralisches Verhalten“, erwidert Holmes. Bevor ich genauer nachhaken kann, öffnet sich die Tür vor uns. Ein dunkelhäutiger Bediensteter in weißem Hemd und Jackett steht im Türrahmen. Er trägt einen roten Turban, wie es die indische Glaubensgemeinschaft der Sikh tut.
„Sie wünschen?“, fragt er in akzentfreiem Englisch, das vermutlich besser ist als mein eigenes.
„Wir wollen zu General Winterbotton“, sagt Holmes. „ Wir wissen, dass er um diese Zeit im Club zu sein pflegt und müssen ihn dringend sprechen, im Auftrag von Scotland Yard.“
„Bitte, treten Sie ein.“
Wir werden in eine kleine Vorhalle geführt, in der einige bequeme Sessel stehen. Ich lasse mich in einen davon fallen und das Leder knirscht angenehm.
Der Bedienstete lässt uns dort alleine und ich sehe mich im Raum um. Er ist schlicht, aber qualitativ eingerichtet. Hier ist echtes Geld, keine Angeberei wie beim verstorbenen Lord Fryfield.
Die Wände sind holzvertäfelt, vermutlich Mahagoni.
„General Winterbotton möchte wissen, was Ihr Anliegen ist“, unterbricht der Diener meine Gedanken, als er plötzlich wieder auftaucht.
„Es geht um Lord Fryfield“, sagt Holmes schlicht und kurz angebunden. Der Diener wartet kurz, ob er noch etwas sagt. Als das nicht geschieht, verlässt er uns wieder. Das Ticken einer Wanduhr teilt die verrinnende Zeit mit harten Schlägen in gleiche Einheiten ein. Dann erscheint endlich erneut der Diener.
„Ich muss Ihnen beiden leider mitteilen, dass der Sir Winterbotton kein Interesse hat, mit Ihnen zu reden. Wenn ich Sie nun bitten dürfte zu gehen, Gentlemen“, erklärt er. Dabei spricht er mit gespielter Reue, seine Augen zeigen mir aber, dass es ihm eigentlich gleichgültig ist.
Holmes und ich sehen uns kurz an. Sherlock nickt und ich erhebe mich aus dem bequemen Sessel. Den sollte ich mitnehmen, der ist wirklich bequem! Umso älter man wird, umso mehr weiß man das zu schätzen.
„Bitte richten Sie dem General aus, dass wir ihn in dem Fall vorladen zu Scotland Yard. Wir lassen die Vorladung postalisch bei Ihnen eingehen. Superintendent Lestrade kümmert sich darum. Guten Tag“, sagt Holmes und verlässt, gefolgt von mir, den Raum. Wir sind bereits auf der Straße, als der Diener des Epikur Clubs hinterherruft: „Warten Sie bitte!“
Ich verkneife mir ein triumphierendes Lächeln. Der Butler, sichtlich gerannt, kommt die Stufen des Eingangsportals herab.
„Der General wäre bereit, Sie zu empfangen, wenn er sich damit solcherlei Unannehmlichkeiten erspart.“
„Da bin ich mir sicher“, sagt Holmes. Wir folgen dem Butler wieder hinein, diesmal hoffentlich direkt zum General.
Tatsächlich geht es nun am Wartezimmer vorbei in einen prächtigen Salon. Die Fenster sind wie in einer Kirche aus buntem Glas. Das verleiht dem Raum eine faszinierende, ja fast sakrale Atmosphäre. Dichter Pfeifenrauch liegt in der Luft. Ich sehe, wie Holmes kurz lächelt. Ich glaube, er wäre einer Pfeife nicht abgeneigt. Der General sitzt in einem breiten, dick gepolsterten Sessel und liest in einer Zeitung. Seine Pfeife verströmt einen angenehmen, schweren holzigen Geruch. General Winterbotton ist wahrlich eine Erscheinung. Er ist im Stehen sicher fast zwei Meter groß und hat einen kräftigen Backenbart. Er trägt eine Uniform und an der Brust baumeln mehrere Orden und Abzeichen.
Er blickt von seiner Zeitung erst nicht auf, sondern liest demonstrativ den Artikel zu Ende. Jemanden warten lassen ist in einer Welt, in der Zeit gleich Geld ist, die größte Demütigung. Er verfügt so über unsere Zeit. Das ist eine ziemliche Macht, will man meinen.
„Gentlemen“, sagt er dann endlich und legt die Zeitung weg. Er mustert uns. Seine Augen sind in einem blassen Grün, aber sein Blick ist intensiv. „Was wollen Sie so dringend von mir, dass Sie mir sogar drohen?“
„Wie ist Ihr Verhältnis zu Lord William Fryfield?“, fragt Holmes. General Winterbotton hebt die Augenbrauen.
„Versucht er, mir wieder was anzuhängen? Was hat er Ihnen denn erzählt? Ich werde vielleicht mal lauter, als das einem Gentleman gebührt, aber ...“, setzt er an. Holmes und ich wechseln einen Blick.
„Sie wissen es offensichtlich nicht“, stelle ich fest und unterbreche den großen Mann. „Lord Fryfield ist tot.“
Winterbotton, der gerade eigentlich aufbrausen wollte, wird ganz leise. Er sieht von Holmes zu mir und zurück.
„Warum sind Sie dann hier?“
Ich streiche ihn von der geistigen Verdächtigenliste. Sofern er nicht wirklich gut schauspielert, ist er nicht die hellste Kerze an Gottes Kronleuchter. Er sieht uns verwirrt an.
„Wir ermitteln im Mordfall des Lord Fryfield für Scotland Yard“, stellt nun wiederum Holmes fest.
„Sie“, murmelt General Winterbotton und seine grünen, blassen Augen zucken etwas. Dann scheint etwas in der Mechanik seines Hirnes einzurasten und einen Sinn zu ergeben. Teile fügen sich und ergeben ein Bild.
„Sie verdächtigen mich?“, fragt General Winterbotton und klingt dabei, als würden wir ihn öffentlich der Sodomie bezichtigen. „Sie wagen es“, setzt er hinzu, doch ich fahre ihm in die Parade. Das ist eines der Vorrechte, die man als alter Mann genießt.
„Ja, wagen wir. Wie würden Sie ihr Verhältnis zu Lord William Fryfield beschreiben?“
General Winterbotton blinzelt kurz und wirkt völlig aus dem Konzept gebracht. Eigentlich wollte er sich jetzt richtig aufregen. Er schüttelt leicht den Kopf und flüstert: „Möge der Herr Gnade dieser armen Seele gegenüber zeigen.“ Dabei faltet er kurz die Hände. „Wir haben uns oft gestritten“, gibt er dann zähneknirschend zu. Ich verkneife mir eine überraschte Bemerkung. Der General nimmt vielleicht ja auch das Gebot des „du sollst nicht lügen“ ernst. Sollen wir diesem gläubigen Mann also glauben? Andererseits, wenn er unser Täter wäre, hat er ja getötet. Auch nicht gerade ein kleines Vergehen.
„Worum ging es dabei?“, fragt Holmes. Er will sich Lord Augustus Tembrokes Aussage wohl bestätigen lassen.
„Vor allem in letzter Zeit um die Arbeitergesetze. Lord Fryfield will, dass sie alle lesen, am liebsten will er jedes Kind auf die Universität schicken. Wer bestellt noch die Felder, wenn alle in Büchern schmökern? Wer baut Häuser oder webt Stoffe, wenn wir alle nur noch Professoren haben? Wer braucht eine Hundertschaft Mathematiker, Biologen oder Historiker? Ich bin dagegen, sie sollen arbeiten und das möglichst lange. Das hält sie von dummen oder sündigen Gedanken fern. So haben sie eher ein gottgefälliges Leben.“
General Winterbotton redet sich regelrecht in Rage. Seine Wangen röten sich und eine blaue Ader auf seiner Stirn pulsiert energisch.
„Wie ist er eigentlich zu Tode gekommen?“, fragt Winterbotton, als er sich einige Atemzüge lang beruhigt hat.
„Wieso?“, frage ich dagegen.
„Na ja, man soll ja nicht schlecht über die Toten reden“, stellt Winterbotton fest.
„Aber?“, hake ich nach.
„Er litt Gerüchten zufolge an Somnambulismus. Hab ich jedenfalls so gehört. Ich meine nur, falls er irgendwo runtergefallen ist.“
Holmes und ich werfen uns einen Blick zu. Davon hören wir nun zum ersten Mal. Superintendent Lestrade hätte uns so etwas nicht vorenthalten.
„Er ist ein Schlafwandler?“, frage ich ehrlich verdutzt. „Woher wollen Sie das wissen?“
General Winterbotton fühlt sich sichtlich unwohl.
„Nichts, was wir besprechen, verlässt diesen Raum“, versichert Holmes. General Winterbotton nickt unsicher. Er ringt kurz mit sich und wir lassen ihn in Ruhe. Oft brauchen die Leute einen kleinen Moment Zeit, da darf man sie nicht bestürmen.
„Ich warne Sie. Wer mich herausfordert, dem ruiniere ich den Ruf, so dass er sich nie wieder irgendwo in London sehen lassen kann. Nein, nicht mal sicher fühlen kann er sich dann noch in London. Ich werde persönlich Ihr Leben ruinieren, wenn Sie solche Gerüchte weiterverbreiten.“
Ich verkneife mir, mit den Augen zu rollen. Es ist die Drohung eines Menschen, der von dem abhängig ist, was andere über ihn denken. Jemand, der seine Reputation über alles stellt, der droht so. Sein Dilemma ist auch offensichtlich: Wir agieren zwar für das Gesetz, stehen aber nicht direkt unter seinem Befehl. Damit sind wir nicht in das Netz der Macht eingebunden, in dem jemand wie Winterbotton die Fäden zieht. Wir sind nur zwei alte Männer. Doch dann gibt er schließlich nach und seine Schultern sacken ein wenig herab.
„Er ist, nein war beim gleichen Arzt wie ich. Doktor Joseph Mayfield. Ich bin da wegen eines hohen Blutdrucks. Ich bin deswegen häufiger da, zur Beobachtung. Er hat einen Kommentar in diese Richtung fallen lassen.“
„Mehr nicht? Nur eine Bemerkung?“ Ich sehe Winterbotton direkt in die Augen. General Winterbotton nickt und es wirkt ehrlich.
„Es war unbedacht von Doktor Mayfield und mir unangenehm, das zu wissen.“ Ich notiere mir den Namen und die Adresse, die General Winterbotton widerwillig nennt. Vielleicht müssen wir mit Doktor Joseph Mayfield nochmal reden.
Wir verabschieden uns schließlich und entscheiden, dass wir es nochmal mit Lady Fryfield probieren. Inzwischen haben wir einige neue Erkenntnisse. Auf dem Weg dahin machen wir einen Abstecher bei Superintendent Lestrade im Scotland Yard.
Lestrade sitzt an einem Wurzelholztisch, der so poliert ist, dass er wie ein guter Konzertflügel glänzt. Es ist ein Vorgesetzten-Zimmer, das einschüchtern soll. Superintendent Lestrade selbst passt nicht ganz hier hinein. Vielleicht hat er es so möbliert von seinem Vorgänger geerbt.
Wir informieren ihn knapp über unsere bisherigen Ermittlungen. Dann ist er an der Reihe. Schon beim Betreten des Raumes konnte man ihm ansehen, dass er etwas weiß und das Gefühl genießt.
„Professor Doktor David Pretchett aus Cambridge, seit einiger Zeit wohnhaft in der Arlington Road beim Bahnhof Paddington. Lehrt seit drei Jahren bereits in London, an der archäologischen Fakultät. Er ist seit ein paar Tagen nicht bei der Arbeit erschienen und nicht zu Hause anzutreffen.“
Sherlock Holmes wirft mir mit hochgezogenen Brauen einen Blick zu.
„Faszinierend“, stellt er fest.
„Hilft Ihnen das weiter?“, fragt Superintendent Lestrade hoffnungsvoll.
Ich nicke langsam.
„Der verstorbene Lord Fryfield sammelte wohl antike Stücke. Damit gibt es zumindest eine dünne thematische Brücke zwischen unseren beiden Opfern. Ihre Leidenschaft für Artefakte der Antike hat sie möglicherweise zusammengeführt. Vielleicht kannten Sie sich. Oder verkehrten im gleichen Club. Auch Ausstellungen wären als Verbindung möglich. Das ist zumindest ein Anfang.“
„Wir sollten seine Frau auch danach fragen“, füge ich hinzu und Sherlock Holmes nickt.
„Vorher sollten wir einen Arzt konsultieren“, stellt Holmes fest.
Lestrade sieht verständnislos von Sherlock Holmes zu mir.
„Bitte sagen Sie mir, dass Sie nicht in nächster Zeit krank werden, Holmes! Nicht jetzt!“
Sherlock Holmes lächelt verhalten.