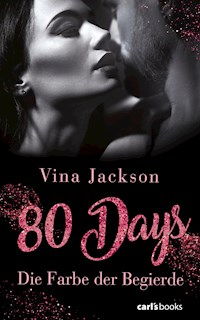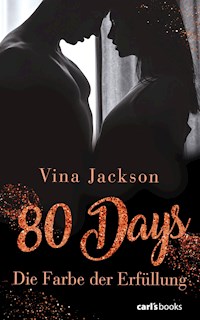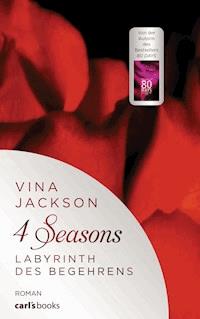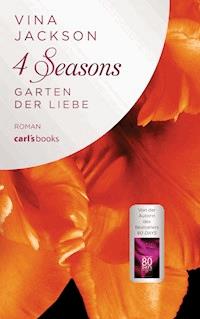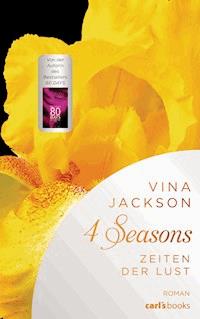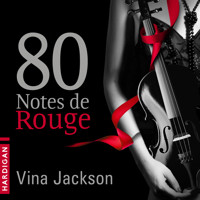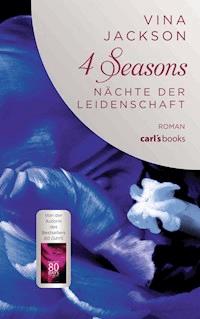
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
4 Seasons – vier Romane – ein lustvoller Reigen
Neuseeland, sechziger Jahre: Moana hat sich hoffnungslos in ihre beste Freundin Iris verliebt, und schon bald erwidert Iris ihre Liebe. Die Welt in Neuseeland wird zu eng und klein für die lustvollen Abenteuer der beiden Freundinnen. Als Iris´ Großmutter Joan stirbt, teilen sich die beiden Freundinnen das Erbe und reisen nach Europa. Sie erfahren von Joans illustrer Londoner Vergangenheit und lernen auf diesem Weg den jungen Thomas kennen, einen reichen Aristokraten mit dunklen erotischen Vorlieben.
Sofort verfällt Iris seiner Upper-Class-Welt, seinem weltläufigen Charme und seinem Sex-Appeal. Für kurze Zeit bilden die drei ein erotisches Trio. Doch je bedingungsloser Iris sich ihrer Leidenschaft zu Thomas hingibt, desto eifersüchtiger und angstvoller beobachtet Moana, wie sich Iris von ihr entfernt und sich in dunklen Gefilden der Lust zu verlieren droht. Wird Moana ihre geliebte Iris an den verführerischen Thomas verlieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »The Pleasure Quartet – Spring« im Verlag Simon & Schuster, London.
1. Auflage
Copyright © 2015 by Vina Jackson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
bei carls’s books, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-14971-0www.carlsbooks.de
1 DIE SCHÖNE UND DAS MESSER
Am Anfang herrscht Finsternis.
Eine Finsternis schwärzer als die Nacht.
Die Stille wirkt bedrohlich.
Ein dünner Lichtstrahl durchdringt die Düsterkeit, wird stärker, erweitert sich zu einem Kegel, unter dem allmählich das schwache Spiel von Formen und Schatten sichtbar wird.
Ein Arm taucht auf. Dann noch einer. Ineinander fließende Bewegungen, wie ein sich langsam ausbreitender Fleck.
Ärmel aus dunklem Stoff, die Arme ruhelos, irgendwie mit einem Körper verbunden, der immer noch knapp außer Sichtweite bleibt.
Eine Backsteinmauer.
Davor ein großer Mann, das Gesicht im Schatten, einen unförmigen Mantel um seinen langen Körper geschlungen, zusammengehalten mit einem groben Hanfstrick. Der Mann regt sich nicht.
Die Zeit dehnt sich, und ich spüre ein Jucken am rechten Schenkel, während ich dort stehe und auf das Unvermeidliche warte. Doch ich wage nicht, mich zu rühren. Die bewusste Langsamkeit, mit der sich die Szene entfaltet, hat etwas Zeremonielles, das mich tief bewegt.
Die eigentümliche Stimmung versetzt mich zurück nach Neuseeland, ans Meer, wo ich vor ein paar Monaten zusammen mit Iris den Ball besucht habe. Wir haben einen Strand gesehen, der mit reglosen Körpern übersät war. Was sich natürlich nicht vergleichen lässt: Hier handelt es sich um eine eindeutig urbane Umgebung und eine völlig andere Darstellung menschlicher Leidenschaft. Die Backsteinmauer, über der schwache Nebelschwaden wabern, das Muster der Pflastersteine, und weit und breit keine donnernden Wogen. Hier eine trostlose Stadt bei Nacht, dort entfesselte Naturgewalten. Einen größeren Gegensatz könnte es nicht geben. Dennoch ist beides auf emotionale Weise miteinander verbunden. Mit mir als Zuschauerin. Als Voyeurin.
Ein erwartungsvoller Schauder durchläuft mich.
Eine Frau taucht auf. Wie aus dem Nichts.
Sie ist von kleiner Statur, oder vielleicht wirkt es nur so, weil der Mann außergewöhnlich groß ist. Der Hintergrund liegt im Dunkeln, und ich kann die Größe der beiden nicht richtig einschätzen.
Sie trägt einen knöchellangen rostbraunen Samtrock und eine weiße Bluse mit Schößchen. Ihre Taille ist schmal, kastanienbraune Locken fallen ihr über die Schultern. Ihr Gesicht ist stark geschminkt, die Lippen in einem aggressiven Rot. Sie hat grüne Augen und ein betont unschuldiges Auftreten.
Sie geht weiter.
Den Mann, der ihr auflauert, kann sie nicht sehen. Er umkreist sie, bleibt im toten Winkel, ein subtiler Tanz, dessen Schrittfolgen nur jemand erkennen kann, der die beiden beobachtet.
Das Licht ist unmerklich heller geworden, vertreibt die Schatten, während die beiden ihren Weg über die nassen Pflastersteine fortsetzen.
Er folgt ihr, seine große Gestalt bedrohlich und für sie immer noch unsichtbar. Seine Hand gleitet in den dunklen Mantel. Taucht wieder auf. Hält eine tödliche Klinge.
Scharfes Einatmen ist zu hören.
Er hält das Messer hoch.
Wie ein Ritual, dessen Ablauf längst festgelegt wurde und nun unausweichlich ist.
Im Nu holt er sie ein.
Sie wendet den Kopf, ihr Blick fällt auf das Messer, angezogen vom Aufblitzen der scharfen Klinge. Sie zeigt keine Überraschung, keine Panik.
»Du bist es«, sagt sie ruhig.
Endlich ist sein Gesicht zu erkennen. Er ist Mitte vierzig, mit markantem Gesicht und hohen Wangenknochen, die auf Grausamkeit deuten. Eine gezackte Narbe auf der rechten Wange verläuft vom Kieferknochen bis zum Mundwinkel. In sein gefährliches Aussehen mischt sich aber auch eine gewisse Traurigkeit.
»Ja.«
»Ich wusste, du würdest zurückkommen«, fährt die Frau fort. Sie macht keine Anstalten, sich zu verteidigen oder der Waffe auszuweichen. Er hält den Arm ruhig, während er sie anschaut.
»Ich musste dich wiederfinden …«
»Um es mir heimzuzahlen?«
»Ja. Was du getan hast, war unverzeihlich.«
»Ich weiß.« Sie seufzt.
Ihre Schultern sacken leicht nach vorn.
Der Mann mit der Klinge zögert.
Die beiden wirken wie Statuen, reglos, erstarrt. Das Licht um sie herum ist immer heller geworden. Nun sind sie in blendendes Weiß getaucht.
»Ich bin bereit«, sagt die Frau und wappnet sich.
»Lulu …«
»Ich werde dich nicht um Verzeihung bitten.«
»Vielleicht solltest du das tun.« Er klingt bedauernd.
»Ich habe dich einmal geliebt.«
Als er das hört, scheint er in seiner Entschlossenheit kurz zu wanken; ein Schatten legt sich über seine Augen, verbirgt seine Wut.
Ruhig öffnet sie den obersten Knopf ihrer weißen Bluse und entblößt ihre bleiche Haut. Sofort möchte ich mehr sehen. Die Rundung ihrer Brüste. Ihre Nippel.
Sie spürt sein Zögern, greift nach der Hand, die das Messer hält, und senkt sie an ihre Kehle.
»Tu es«, flüstert sie.
Er steht wie angewurzelt da.
»Jetzt!«, befiehlt sie und zieht an seinem Handgelenk.
Der gezackte Rand der Stahlklinge dringt schwach in ihre weiße Haut und hinterlässt eine dünne Blutspur.
Sie schnappt nach Luft.
Er schreit laut.
Und reißt das Messer zurück, hebt es hoch über den Kopf, bevor er mit voller Wucht wieder zustößt. Diesmal dringt die Messerspitze tief ein, Blut schießt heraus, spritzt auf den Boden, durchtränkt ihre Bluse, verbreitet ein tödliches Muster auf dem Stoff wie eine fremdartige Blume, verschwindet in der Dunkelheit ihres Samtrocks und versickert dort.
Einen kurzen Augenblick bleibt die junge Frau noch stehen, schwankend, ihr Blick wird stumpf, bis sie schließlich zu Boden sinkt.
Ich hatte etwas Melodramatischeres erwartet – als wäre das, was ich gerade gesehen habe, nicht dramatisch genug –, mehr Sprache, Handlung, doch die Schlichtheit trifft mich wie ein Schlag.
Sie liegt ausgestreckt auf den Pflastersteinen, die Gliedmaßen seltsam abgewinkelt, ein Arm zuckt noch einmal unwillkürlich. Der Mann, der Mörder, steht vor ihr, sein Gesicht totenblass, Tränen in den Augen. Das Licht schwindet allmählich, bis das Paar nur noch von einem weißen Lichtkegel umgeben ist und die Stadtkulisse in der Dunkelheit versinkt, aus der sie hervorgegangen ist.
Ein zögerliches Klatschen, noch eines. Raschelnde Bewegungen im Publikum. Dann setzt der Applaus richtig ein.
Der Bann war gebrochen.
Ich trat ein paar Schritte zurück und zog den schweren Vorhang zur Seite, durch den die Zuschauer nun ins Foyer hinaus und auf die geschäftigen Straßen von Covent Garden strömen würden. Auf der anderen Seite der Sperrsitze machte Agnetha, ein fülliges Mädchen mit einem roten Band im dunklen Haar, dasselbe. Ich wich zur Seite, um die Menge an mir vorbeizulassen, genau wie Agnetha auf ihrer Seite des Theaters. Zuschauer, die es eilig hatten, einen Bus oder die U-Bahn nach Hause zu erreichen, strömten in einem Durcheinander aus Hüten und Mänteln, Handschuhen und Schals hinaus, leere Gesichter, fast schon verzweifelt, verzerrt, jetzt, wo der Zauber vorbei war und sie ins wirkliche Leben zurückkehrten. Ich bildete mir ein, flüchtige Blicke in ihr Leben zu erhaschen, während sie an mir vorbeigingen, die Liebenden an dem Lächeln zu erkennen, das ihre Lippen umspielte, die Müden und Verlassenen an dem Geist der Einsamkeit, den sie mit sich trugen, ihre Schultern gebeugt, ihre Schritte etwas langsamer als die der anderen.
Schwer ist die Arbeit nicht, überlegte ich nach diesem Anfangsabend meines ersten Jobs in London. Doch ich war mir nicht sicher, wie viel vom Zauber des Theaters bleiben würde, wenn ich das Stück während seiner Laufzeit immer wieder sehen musste.
Die Ereignisse auf der Bühne hatten mich in ihren Bann gezogen, die Voyeurin in mir, die für eine kurze Weile vergessen konnte, dass es sich um Schauspieler handelte. Die die Künstlichkeit des Dramas übersah, das mich dennoch packte, während Hunderte von Zuschauern ihre Süßigkeiten mampften und ihr Bier oder ihren Weißwein aus Plastikbechern tranken.
Ich war immer leicht zu beeindrucken gewesen, schon als Kind fühlte ich mich angezogen von der dunklen Magie des Lebens im Schatten, die mich umgab, real oder eingebildet. Was mich, wie ich annahm, nach London geführt hatte. Hier konnte ich mich in den Kopfsteinpflasterstraßen verlieren, die sich wie ein Labyrinth unter dem grauen Himmel wanden.
Das, und natürlich Iris. Sie würde jetzt in der kleinen Wohnung auf mich warten, die wir uns am Kanal in Hammersmith teilten.
Nachdem ich wieder in Jeans und T-Shirt geschlüpft war, das mittlerweile leere Theater verlassen hatte und vom Nachtbus aus die Londoner Sehenswürdigkeiten vorbeirauschen sah, dachte ich an Iris – ihre nach Salzwasser riechende Möse, in der ich mich so gern vergrub, und an die erste Nacht, in der wir richtig zusammen gewesen waren. Die erste Nacht beim Ball, am Meer.
Ich war immer schon ein Kind des Meeres.
Das war das Einzige, was ich von meinen Eltern geerbt hatte, die im Winter 1947 von London nach Neuseeland ausgewandert waren. Obwohl ich zu der Zeit noch gar nicht geboren war, erzählte mir meine Mutter später, meine Liebe zum Wasser müsse wohl von den sechs Wochen an Bord der Rangitata herrühren. Sie habe die Zeit größtenteils an Deck verbracht, um mit dem Aufruhr in ihrem Magen fertigzuwerden, ausgelöst von Morgenübelkeit und Wellengang. Mein Vater war unterwegs im Alkoholrausch über Bord gegangen und ertrunken.
Wir legten in Auckland an, und dort blieben wir. Nach der langen Überfahrt und dem Verlust ihres Ehemanns weigerte sich meine Mutter, noch weiter zu reisen, und ich wurde sechs Monate später geboren. Obwohl ich keinen Tropfen Maoriblut in mir habe, wurde ich Moana genannt, nach dem Maori-Wort für »Meer«, und in einem katholischen Internat untergebracht, sobald ich alt genug für die Schule war. Meine Mutter besuchte mich einmal pro Woche, doch jedes Mal, wenn wir uns gegenüberstanden, sah ich in ihr nur die Frau, die mich verlassen hatte, und meine Mutter sah nur die Wellen, die meinen Vater fortgespült hatten.
Was Liebe ist, erfuhr ich erst durch Iris.
Wir lernten uns mit sieben kennen, bei der Kommunion, als ich den Mund geöffnet und die trockene Oblate geschluckt hatte, die mir von einem Priester im Ornat auf die Zunge gelegt worden war. Dabei hatte er meine Unterlippe mit dem Daumen etwas zu bedächtig und zu lange gestreift. Ich hatte Iris durch den Vorhang ihres weißen Schleiers erspäht, wie sie mit den Fingern im Weihwasser spielte, bis eine Aufsichtsperson sie wegzog. Ich war aus der ordentlichen Schlange meiner Mitschülerinnen ausgebrochen, die darauf warteten, hinter die Klostermauern zurückgebracht zu werden, und dem kleinen Mädchen nachgelaufen, das gewagt hatte, das Unberührbare zu berühren. Es war mir gelungen, ihre Hand zu ergreifen, bevor ich ebenfalls von einer Erwachsenen zurückgezerrt wurde. Als wir uns berührten, wurden auch meine Finger nass. Ich achtete sorgsam darauf, die Hand auszustrecken, damit sie feucht blieb und ich die kostbaren Tropfen nicht abwischte, doch selbst ich konnte nicht verhindern, dass Weihwasser trocknet.
In der nächsten Woche stellten wir uns einander vor, und von dem Tag an freute ich mich auf die Sonntage, womit ich bei meinen Lehrern die Hoffnung weckte, dass ich, an der bisher kein Anzeichen von Frömmigkeit zu entdecken war, endlich auch zu Gott gefunden hatte.
Ich hatte zwar nicht zu Gott gefunden, aber in Iris eine Freundin. Wir stahlen uns gemeinsame Augenblicke zwischen den Chorälen oder im Schutz dunkler Nischen, wenn wir uns eigentlich auf die Beichte vorbereiten sollten.
Ich fing sogar an, die Bibel zu lesen, aber nur das Hohelied Salomos. Nachts in meinem Bett im Schlafsaal ließ ich einen angefeuchteten Finger in mich gleiten, bis die sanften Worte des Königs und der Rhythmus, den ich mit meiner Fingerspitze auf die seidige Härte meines Kitzlers übertrug, eine tosende Erregung in mir auslösten, die wie ein Sturm durch meinen Körper brauste. Für mich war dieses magische Gefühl wie eine Welle. Sie begann mit meiner zunehmenden Feuchtigkeit und türmte sich allmählich auf, wartete darauf, dass ich sie im richtigen Moment auf dem Scheitelpunkt erwischte und sie den ganzen Weg hinab ritt.
Eines Sonntags fragte ich Iris nach diesem Gefühl.
»Das ist ein Orgasmus«, sagte meine Freundin wissend.
Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redete.
»So was soll man angeblich beim Sex haben. Mit einem Mann.«
Diese kostbare Information hatte Iris von ihrer äußerst freizügigen Großmutter Joan erhalten, die einst Zirkusartistin gewesen war und an exotischen, weit entfernten Orten gearbeitet hatte. Gerüchten zufolge konnte sie Feuer schlucken und ein ganzes Schwert in ihrer Möse versenken. Die alte Frau lebte jetzt allein in einer Hütte, nicht weit vom schwarzen Strand des Piha Beach entfernt, wo sie jeden Morgen über die rauen Pfade der Waitakere Ranges wanderte und danach so energisch Klavier spielte, dass die Surfer behaupteten, über den donnernden Wogen manchmal ein gespenstisches Schlaflied wuchtig angeschlagener Tasten zu hören.
Als ich siebzehn war, wurde ich inoffiziell von Iris’ Eltern adoptiert, da meine Mutter plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben war und weder Erspartes hinterlassen noch Vorsorge zur Bezahlung der Schulgebühren getroffen hatte. So bekam ich eine Familie.
An den Wochenenden, unter dem Vorwand, Musikunterricht zu nehmen und der alten Frau Gesellschaft zu leisten, wurden Iris und ich zu ihrer Großmutter am Piha Beach gefahren. Iris’ Vater chauffierte uns in seinem neuen Plymouth Valiant mit den schicken Chromstoßstangen. Im Radio lief knisternd Ray Columbus und The Invaders, solange wir Empfang hatten.
Die cremefarbenen Lederpolster drückten sich kühl an meine Schenkel. Ich hielt Iris’ Hand umklammert, ganz darauf konzentriert, mich nicht übergeben zu müssen, denn das Auto schaukelte auf der kurvigen, von Bäumen gesäumten Straße zum Strand heftig hin und her. Im Sonnenlicht wurde der nachtschwarze Sand so heiß, dass es fast unmöglich war, barfuß darüberzulaufen, ohne sich die Füße zu verbrennen.
Iris’ Vater trank nachmittags mit den Jungs vom Surfclub Bier, während Iris und ich Joan ständig nach Berichten über ihr früheres Leben löcherten. Wir hörten fasziniert zu, wenn Joan von anzüglichen Erlebnissen auf dem Rücksitz von Kraftdroschken erzählte, als sie als Zweiundzwanzigjährige von wohlhabenden Männern umworben wurde.
Sie könne immer noch das Bein über den Kopf heben, teilte sie uns eines Tages mit, stieg gewandt auf den Klavierhocker und führte uns dieses bemerkenswerte Kunststück vor. Dazu legte sie ihren schmalen, faltigen Arm um die linke Wade und hob das Bein über ihre rechte Schulter, als hätten ihre Hüften Scharniere und würden so leicht aufschwingen wie eine Haustür.
Die Geschichten, die wir am liebsten hörten, drehten sich um den Ball, eine bizarre Festlichkeit, die nur einmal im Jahr stattfand, immer an einem anderen Ort irgendwo auf dem Globus. Joan erzählte uns, sie sei als Darstellerin für die Veranstaltungen von einer hochgewachsenen, gut aussehenden Frau engagiert worden, die im Schatten vor der Trocadero Music Hall am Piccadilly Circus auf sie gewartet habe. Ihr langes Haar habe bis zu den Knöcheln gereicht, sagte Joan, und sei so leuchtend rot gewesen, dass man auf den ersten Blick habe meinen können, sie stünde in Flammen. Die Frau habe ihr eine enorme Geldsumme als Vorschuss gegeben, um sich sowohl ihrer Verschwiegenheit zu versichern als auch lebenslanger Auftritte in einer Nacht pro Jahr, und von dem Abend an sei Joan mit dem Ball gereist.
Iris war skeptisch, ich aber hörte hingerissen zu, als die alte Frau von einem Fest auf einem Flussdampfer in New Orleans erzählte, dessen Wände in Flammen standen, ohne dass sie niederbrannten, und die Hälfte der Gäste als menschliche Fackeln verkleidet war. Sie beschrieb ein weiteres Fest in einer Villa auf Long Island bei New York, das von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen unter Wasser stattfand, und bei dem alle Gäste in der Verkleidung von Meerjungfrauen und tropischen Fischen durch die Räume geschwommen waren. Und noch eines, in einer riesigen Höhle unter einem gefrorenen Wasserfall in Norwegen, bei dem eine Tänzergruppe von Kopf bis Fuß mit Diamanten beklebt war und sie wie Schneeflocken wirken ließ, die anmutig von einem schimmernden Himmel aus Stalaktiten herabschwebten.
Joan hatte nie geheiratet, ihre Anstellung beim Ball aber aufgegeben, als sie ein Kind bekam, empfangen unter einem Rosenbusch von einem Mann, den sie bei einer Gartenparty kennengelernt hatte. Das Leben als umherreisende Darstellerin eignete sich nicht dazu, ein Kind großzuziehen, und daher hatte sich Joan, mit Iris’ Mutter im Bauch, für ein neues Leben mit den Pionieren entschieden, die ans andere Ende der Welt auswanderten. Sie zog nach Neuseeland, wo sie ein Kind zur Welt brachte, das sich unerklärlicherweise zu einer eher konservativen Person entwickelte, trotz der Gene ihrer Mutter, die sie schließlich Iris weitergeben würde.
Joan blieb in Verbindung mit verschiedenen Künstlern des Balls, die weiterhin reisten und auftraten, und so geschah es kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag, dass sie von dem Ball erfuhr, der in Kürze in Neuseeland stattfinden würde.
»Glaubst du, dass die Geschichten wahr sind?«, fragte mich Iris an jenem Abend.
»Jedes einzelne Wort«, erwiderte ich, wobei meine Augen vermutlich vor Entzücken strahlten.
Die Einladung kam auf einer dicken weißen Karte mit eingeprägten Goldbuchstaben, der Umschlag war mit einem großen Klecks Wachs versiegelt. Joan bat mich, ihn aufzumachen, und beschwerte sich, dass ihre inzwischen arthritischen Finger mit einem so schweren Umschlag nicht mehr zurande kamen, obwohl sie erst an diesem Morgen ihre Finger mit der Geschicklichkeit einer halb so alten Person über die Tasten hatte fliegen lassen.
Ich fuhr mit dem Fingernagel über das Papier, pulte das Siegel ab und betastete es vorsichtig. Es war weich und nachgiebig und roch nach Marshmellows.
»Kap Reinga«, hauchte ich, als ich die Karte herauszog und die Einladung laut vorlas. Ich betonte die beiden Worte, als wären sie etwas Heiliges. Schon lange hatte ich das Kap besuchen wollen, das als der nördlichste Punkt der Nordinsel galt, den Ort, der auf Maori Te Rerenga Wairua genannt wird, der Absprungplatz der Geister. Es hieß, man könne vom Leuchtturm an der Spitze der Landzunge die Trennlinie zwischen der Tasmansee im Westen und dem Pazifischen Ozean im Osten erkennen, an der die beiden Wassermassen aufeinandertreffen. Auf dem Weg dorthin befand sich ein hundertvierzig Kilometer langer Strand, ein so gewaltiges Stück Küstenlinie, dass sie schier endlos erschien.
»Und wie lautet das Motto?«, fragte Joan mit erwartungsvoll strahlenden Augen.
»Der Tag der Toten«, las ich von der Karte ab. »Ein bisschen makaber, findest du nicht?«
»Überhaupt nicht«, erwiderte die alte Frau. »Und ich sollte das wissen, da ich bereits mit einem Fuß im Grab stehe.« Streng hob sie die faltige Hand, um unseren höflichen Protest abzuwehren. »Der Tod ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg des Lebens.«
In jener Nacht lagen Iris und ich nebeneinander in Iris’ schmalem Bett im baufälligen Haus ihrer Eltern in North Shore. In einem anderen Leben hätten wir Schwestern sein können, doch in diesem war uns mehr bestimmt.
Ich war in Iris verliebt. Mehr als verliebt, ich verzehrte mich nach ihr und war von der Furcht erfüllt, sie zu verlieren. Nachdem wir die Schule abgeschlossen hatten und Iris eine Stelle als Bürokraft bei einem örtlichen Autohändler fand, tauchten zwangsläufig Verehrer auf. Ältere Männer meist, reiche Männer, die sich Autos leisten konnten, und hin und wieder kam mir der Verdacht, dass auch ihre Frauen Iris anhimmelten. Wer würde das nicht bei ihrem wirren Schopf dunkelbrauner Locken, die ihr Gesicht umrahmten, Augen von der Farbe geschmolzener Schokolade und Handgelenken so zart wie die eines Kindes?
Iris hatte ein rundes Puppengesicht und einen Ausdruck vollkommener Unschuld, der die Menschen zu ihr hinzog wie Bienen zum Honigtopf. Ich kam mir wie das genaue Gegenteil vor. Ich war nicht dick, aber stämmig, mein braunes Haar war glanzlos und glatt, meine Augenbrauen ein wenig zu dicht und meine Gesichtszüge eckig und unscheinbar. Zumindest sah ich mich selbst so. Ich blickte selten in den Spiegel, weil ich mein Aussehen so gewöhnlich fand, und ich wünschte mir oft, ich wäre als Junge geboren worden, damit ich mir keine Sorgen zu machen brauchte, ob meine Haare gekämmt waren oder meine Taille zu dick wurde. Vor allem wünschte ich mir, als Junge geboren zu sein, damit ich um Iris’ Hand anhalten konnte.
Schon als ich zum ersten Mal vom Ball hörte, hatte ich mir gewünscht, gemeinsam mit Iris einmal dabei sein zu können. Joans Beschreibungen hatten etwas Magisches gehabt. Ich konnte es tief in meinem Inneren spüren, genauso wie mich eine ständige Sehnsucht umtrieb, dem Meer nahe zu sein. Als ich dann erfuhr, der Ball würde am Kap Reinga stattfinden, dem Ort, an dem ein Meer auf das andere trifft, wusste ich, dass wir dorthin mussten.
Anfangs glaubte ich, für uns gäbe es keine Möglichkeit, eine Einladung zu bekommen. Doch dann lag ein weiterer dicker weißer Umschlag in Joans Briefkasten, diesmal adressiert an Moana Irving und Iris Lark. Mit zitternden Händen riss ich ihn auf und stellte fest, dass die alte Frau an die Organisatoren des Balls geschrieben und empfohlen hatte, uns Mädchen in der Küche einzustellen. Wir konnten beide nicht besonders gut kochen, doch das, sagte Joan bei unserem nächsten Besuch, sei kaum von Belang.
Nichts, was an Speisen und Getränken beim Ball serviert würde, habe Ähnlichkeit mit dem, was wir je gekostet hätten oder kosten würden, daher wären die Rezepte exotisch und streng geheim. Wir müssten nur unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen, müssten schälen, schneiden, hacken und rühren. Man sei der Meinung, jedes Gericht werde von der besonderen Aura der Person durchtränkt, die es zubereitete, daher stelle der Ball nur ein paar erfahrene Köche ein, die alles überwachten. Das andere Küchenpersonal wurde aufgrund der Schwingungen ausgewählt, die es vermutlich auf die Speisen übertragen würde. Eine Kombination aus Persönlichkeit, Begeisterung für das Ereignis und der eigenen Libido. All das, hatte Joan den Organisatoren mitgeteilt, besäßen Iris und ich intuitiv im Übermaß, jede auf ihre eigene Art.
Nachdem uns die Einladung sicher war, gab es nichts weiter zu tun, als den Weg dorthin zu finden. Joan hatte ihre Teilnahme mit der Begründung abgelehnt, sie ziehe die Erinnerungen ihrer Jugend allen minderwertigen Abenteuern vor, zu denen ihr geschwächter Körper jetzt noch fähig sei.
Iris hatte ihren Vater überredet, ihr sein Auto zu leihen. Sie hatte wenig Erfahrung im Straßenverkehr, hatte jedoch als Voraussetzung ihrer Anstellung beim Autohändler fahren gelernt, da sie die Fahrzeuge zur Ausstellungsfläche hinaus und nach Schließen des Geschäfts wieder in die Werkstatt fahren musste.
Wir hatten keine Ahnung, welche Kleidung von uns erwartet wurde, doch nach allem, was wir über den Ball gehört hatten, schätzte ich, dass die gewagt kurzen, leuchtend bunten Kleidchen, die Iris und ich normalerweise auf Partys trugen, nicht das Richtige waren. Eine knappe, der formellen Einladung beigefügte Notiz hatte uns davon unterrichtet, man werde uns passende Kleidung für die Küchenarbeit zur Verfügung stellen. Wenn unsere Pflichten erledigt waren und es uns freistand, an den restlichen Abendunterhaltungen teilzunehmen, erwartete man, dass wir uns in etwas Passenderes kleideten und ebenfalls an der Zeremonie teilnahmen, die bei Tagesanbruch stattfinden würde.
Die Fahrt zog sich endlos hin. Iris fuhr äußerst vorsichtig, da sie sich das Donnerwetter zu Hause vorstellen konnte, falls der geliebte Valiant ihres Vaters auch nur einen Kratzer abbekam. Das Fahrzeug war so geräumig und Iris so klein, dass sie kaum über das Lenkrad sehen konnte, und jeder, der uns entgegenkam, hätte vermuten können, das Auto würde von allein fahren.
Auf mein Drängen hin machten wir westlich von Kaitaia halt, um im Meer zu schwimmen.
Wozu Badeanzüge nötig sind, hatte ich noch nie verstanden. Ich wollte schon immer das Fließen des Meerwassers an meinem gesamten Körper spüren und vor allem auf den Teilen meiner Haut, die normalerweise von einem Badeanzug bedeckt sind. Daher zog ich, nachdem wir die wüstenartigen Dünen zum Strand überquert hatten, sofort meine Bluse aus, schlüpfte aus Rock und Unterwäsche, warf alles beiseite und rannte auf die Brandung zu. Wobei mir völlig egal war, ob ich von irgendwelchen Schaulustigen nackt gesehen wurde. Iris folgte mir bald, blieb aber zunächst stehen, faltete sorgfältig ihr Kleid zusammen und legte es ordentlich über ein Stück Treibholz, damit es nicht zerknitterte oder zu sandig wurde.
Mein Herz schlug schneller, als ich meine Freundin nackt ins Wasser kommen sah. Sie hatte kleine Brüste, schmale Hüften und die langen schlanken Beine eines Stelzvogels. Sie unterschied sich von der Mehrheit der neuseeländischen Pioniergeneration, ein größtenteils kräftiger und zäher Menschenschlag, gewöhnt an körperliche Arbeit und mit robuster Gesundheit gesegnet. Die Zartheit meiner Freundin weckte ebenso meinen Beschützerinstinkt wie auch lustvolles Verlangen. Als sie im Wasser nahe genug bei mir war, zog ich sie an mich, und unsere nackten Körper sanken gemeinsam in die Wellen. Wir lachten, bespritzten uns und küssten uns unter den salzigen Wogen, bis die Kälte uns zwang, ans Ufer zurückzuschwimmen.
Als wir das Kap erreichten, wurde es allmählich dunkel. Außer dem Leuchtturm gab es keine Gebäude, und wir hatten auch nicht mit einem so formellen Veranstaltungsort gerechnet. Joan hatte uns erzählt, wir würden den Ball schon finden, sobald wir ankämen. Die Veranstaltungsorte seien immer so gestaltet oder gelegen, dass Uneingeladene direkt daran vorbeigehen würden, aber für jeden auserwählten Teilnehmer sei der Ball nicht zu übersehen.
Ich hörte den Ball, bevor ich ihn sah. Wir hatten das Auto auf einem Grünstreifen nahe der Landspitze geparkt, und als wir ausstiegen und meine nackten Füße das Gras berührten, wusste ich, wohin wir uns wenden mussten. Ein seltsamer, wehklagender Walgesang war zu hören. Ich übernahm die Führung, und zusammen kletterten wir vorsichtig die steile Uferböschung zum Meer hinab, das sich vor uns erstreckte.
Staunend blieb ich stehen – es war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Als stünde ich am Ende der Welt. Und dort, über der Landspitze, von der die Toten ihre Reise ins Jenseits beginnen, wie es hieß, flogen Hunderte großer weißer Vögel, schlugen im Gleichklang mit den Schwingen, stürzten sich vom Rand der Klippe hinab, tauchten Augenblicke später wieder auf, stiegen hoch in die Luft, drehten ab, vereinten sich mit anderen, tollten in dem starken Wind, der um das Kap blies. Doch das waren keine Vögel, erkannte ich und schlug erschrocken die Hand vor den Mund. Das waren in kunstvolle Federkostüme gekleidete Menschen. Männer und Frauen, alle nahezu nackt und mit phosphoreszierender Körperfarbe bedeckt, die das Licht der untergehenden Sonne in tausend farbigen Splittern reflektierte, fast zu grell, um sie anzusehen.
Ich hätte diesen Wesen, die anscheinend ohne beengende Gurte oder Aufhängevorrichtungen frei durch die Luft flogen, endlos zuschauen können, doch mir war bewusst, dass Iris und ich in der Küche erwartet wurden. Wir gingen weiter, dem Walgesang hinab zum Ufer folgend.
Zuerst wirkte der Strand verlassen. Aber als sich meine Augen an das rasch schwindende Abendlicht gewöhnt hatten, erkannte ich, dass das, was ich für Felsen gehalten hatte, in Wirklichkeit Menschen waren, deren Körper mit einer silbrig-grauen, glitzernden Farbe bemalt waren. Sie lagen reglos zusammengerollt im Sand und erinnerten an schlafende Seehunde. Als wir uns ihnen näherten, erhoben sich zwei der grauen Wesen, um uns zu begrüßen. Beide waren Frauen, hatten große Brüste mit aufgerichteten Nippeln, so steif, dass es mir schwerfiel, meinen Blick davon abzuwenden und den Frauen in die Augen zu sehen.
»Willkommen«, sagten die Frauen gleichzeitig, nahmen Iris und mich an der Hand und führten uns hundert Meter weiter den Strand entlang bis zu einer Abschirmung aus Farn, die von außen wie der niedrige Bewuchs eines Felshangs wirkte. Doch als wir näher kamen, teilten sich die Pflanzen wie Vorhänge und gaben einen hohen Tunnel frei, so breit wie ein Fahrdamm. Die Seitenwände des Tunnels wurden durch Kerzen erhellt, die auf in den Fels eingelassenen Totenschädeln standen. Ob es die Schädel von Menschen, Tieren oder realistische Nachbildungen waren, konnte ich nicht erkennen, doch die Wirkung war eher beruhigend als gruselig. Wieder war es, als beträten wir eine andere Welt, während wir dem schwach beleuchteten Gang durch das riesige Höhlenlabyrinth folgten.
Musik dröhnte so laut durch die Felswände, dass ich die Vibrationen spürte, wenn ich mit den Fingerspitzen an dem feuchten Fels entlangfuhr – wie in einem riesigen, schlagenden Herzen. Durch die Öffnungen, an denen wir auf dem Weg zur Küche vorbeikamen, erhaschte ich nur flüchtige Blicke auf die Gäste des Balls, doch was ich dabei sah, war so bizarr, dass ich mir nicht sicher sein konnte, ob ich mich überhaupt hier befand oder alles nur Teil eines raffinierten und verrückten Traums war.
Wie die beiden Helferinnen, die uns führten, und die Akrobaten, die draußen über der Felskuppe flogen, waren auch die Feiernden unbekleidet, aber so bemalt, dass die Haut fast durchscheinend wirkte; als wären sie Geister, Reisende, die bereits im Jenseits gewesen und zurückgekehrt waren. Sie waren schamlos nackt und manche in leidenschaftlichen Umarmungen vereint, ein Gewirr aus Armen und Beinen und den entsprechenden Lauten, teilweise äußerst menschlich und lustvoll, dann wieder wie die überirdischen Schreie von Engeln und Dämonen.
Iris griff nach meiner Hand, zog mich an sich und küsste mich kurz auf die Lippen. »Das ist unglaublich«, flüsterte sie. »Ich bin so froh, dass wir hergekommen sind.«
Wir wurden in die Küche geführt, ohne viel Federlesen entkleidet und angewiesen, uns zu waschen – nicht nur die Hände, sondern den ganzen Körper. Das taten wir in einem Duschbereich, in dem eine Art unterirdischer Wasserfall aus der Felswand sprudelte. Dann wurden wir mit dünnen Kleidchen ausgestattet, die als Schürzen dienten, und man zeigte uns unsere Arbeitsplätze.
Ich erhielt die Aufgabe, farbenprächtige Zuckerblumen herzustellen. Mir wurde ein Berg fertiger Blättchen in sämtlichen Schattierungen des Regenbogens zugeteilt, die ich zu Blüten zusammenfügen sollte. Eine Rezeptkarte, die als Anleitung diente, verriet nichts über die notwendigen Schritte, ein solches Kunstwerk zu fertigen, sondern wies mich lediglich an, mich darauf zu konzentrieren, ein Gefühl der Sehnsucht nach dem Dessert hervorzurufen, das alle, die es probierten, mit Verlangen erfüllte. Da Iris an ihrer Arbeitsplatte vor mir stand und geschnittene Mangos, Erdbeeren und Bananen mit bloßen Händen zu Saft zerquetschte, wobei die Rundungen ihrer Pobacken und ihr Kreuz unter dem hauchzarten Stoff des Kleides deutlich sichtbar waren, fiel mir die Aufgabe nicht schwer.
Die Stunden vergingen rasch und wie in Trance. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Blüten ich tatsächlich geformt hatte, denn sobald ich mit einem Strauß fertig war, kam ein Bediensteter in weißen Handschuhen und schob sie auf ein Silbertablett, um sie den Gästen zu servieren. Schließlich wurden wir von unseren Pflichten entbunden und angewiesen, uns erneut zu waschen und für die Zeremonie umzuziehen. Wir hatten die ganze Nacht gearbeitet, und die Morgendämmerung war nicht mehr fern. Vor dem Waschen bekamen wir etwas zu essen. Es gab mit Kokos aromatisiertes Gelee in Form von Skeletten, mit Marmelade gefülltes, so leichtes Gebäck, dass es krümelte, wenn ich es zu fest zwischen Daumen und Zeigefinger drückte, eine dünne, hellrote Suppe, die nach Karotten aussah, aber nach Blaubeeren schmeckte. Schließlich bekam jede von uns noch ein Sträußchen der blutroten Blüten des Pohutukawa-Baums, die ich eigenhändig geformt hatte, dazu ein Glas von dem Saft, den Iris ausgepresst hatte.
Die seltsame Mahlzeit besänftigte zwar unsere knurrenden Mägen, rief aber eine andere Art von Hunger hervor, ein so starkes Verlangen, dass wir es kaum unter den Wasserstrahl schafften, bevor wir übereinander herfielen. Ich schleppte Iris regelrecht in den Duschbereich. Vor den Augen von einem halben Dutzend anderer Küchenhilfen hob ich das Kleid meiner Freundin bis zur Taille hoch, kniete mich auf den feuchten Boden und vergrub mein Gesicht zwischen ihren Beinen, leckte ihre geschwollenen Schamlippen, als wären ihre Säfte Nektar für die Götter.
Das plätschernde Wasser konnte Iris’ Stöhnen nicht übertönen, was mich nur umso mehr anfeuerte. Meine Arme erlahmten von der Mühe, Iris’ Kleid um ihre Hüften hochzuhalten, und meine Knie schmerzten auf dem harten Felsboden, doch ich achtete nicht darauf. Das war nichts im Vergleich zu der Freude, die ich dabei empfand, meiner Freundin Lust zu bereiten. Ich ließ meine Zunge über Iris’ empfindsamste Stellen gleiten, über ihren Kitzler schnellen, huldigte jeder Spalte und Falte, als wäre sie ein mit dem köstlichsten Wein gefüllter Kelch.
Ich bekam kaum noch Luft, als Iris ihre Finger in meinem Haar vergrub und meinen Kopf fest an sich drückte, meine Nase in ihre Öffnung stieß und auf meinem Gesicht ritt, bis sie in einem Orgasmus erbebte und in meinen Armen zusammensank.
Sofort wurden wir hochgehoben und zur Seite getragen, wo uns ein Dutzend Hände mit weichen Handtüchern abtrocknete und geschickt jeden Zentimeter unseres Körpers mit kräftigen Pinselstrichen in glitzernder Silberfarbe bemalte, sodass wir Mondstrahlen oder Geistern ähnelten.
Iris lachte so fröhlich wie ein Kind, und ich fühlte mich, als wäre ich betrunken, berauscht von den Säften, die ich gerade von ihrer Öffnung geleckt hatte.
»Der Morgen bricht an … die Zeremonie …«, flüsterten drängende Stimmen, und wir fügten uns ein in den Strom schimmernder Körper, die aus den Höhlen herauskamen und durch die Tunnel dem Strand und dem anbrechenden Tag zustrebten.
Der Sand unter meinen Füßen war kühl und weich, und ich geriet auf dem unebenen Boden beinahe ins Stolpern. Wir waren durch den Farnvorhang gekommen und schlossen uns den Gästen an, die sich am Ufer versammelt hatten, alle nackt und schimmernd wie ein Schwarm Fische, die versehentlich aus dem Meer an Land gekommen waren.
Alle blickten in dieselbe Richtung, manche jubelten und riefen: »Maîtresse, Maîtresse …« Ich wandte den Kopf, und mir stockte der Atem, als ich sah, was da auf uns zukam. Eine Frau saß hoch aufgerichtet auf einem Thron aus Walknochen, auf den Schultern getragen von sechs Männern, einen Kopf größer und doppelt so muskulös wie sämtliche Männer, die ich je gesehen hatte. Sie waren praktisch Riesen, und alle nackt. Ihre enormen Schwänze klatschten ihnen gegen die Oberschenkel, während sie mit ihrer kostbaren Fracht den Strand entlangrannten.
Der Körper der Frau war bemalt, aber in reinem Weiß statt Silber und auf eine Weise, die ihre Knochen unter der Haut deutlich hervorhob, sodass sie halb wie ein Engel wirkte, halb wie ein Mensch. Dazu trug sie kunstvolle Federschwingen, die sich an ihrem Rücken hin und her bewegten, als wären sie kein Kostüm, sondern ihr angewachsen.
Die Menge trat zurück, bildete einen Kreis, und die Frau wurde in die Mitte gelegt. Sie breitete Arme und Beine aus; beinahe hätte ich aufgelacht, weil es mich daran erinnerte, wie ich als Kind am Strand meine Gliedmaßen hin und her bewegt hatte, um ein Flügelwesen im Sand zu schaffen. Andächtiges Schweigen legte sich über die Versammelten, nur das stetige Rauschen der Wellen war zu hören.
Ein Mann trat aus der Zuschauermenge hervor. Sein Haar war pechschwarz, sein Körper durchtrainert. Zwischen seinen Beinen ragte stolz sein Schwanz auf.
In diesem Moment erhob sich die Sonne über dem Meer. Der Mann fiel vor der Frau auf die Knie. Sie richtete sich auf, warf ihn auf den Rücken und senkte sich auf sein steifes Glied hinab. Als sie sich vereinten, begannen die Schwingen der Frau zu schlagen, und die Menge brach in Jubel aus.
Vor Erstaunen schrie ich auf, denn am Körper der Frau veränderte sich etwas. Ihre Haut war nicht mehr bleich, sondern mit Bildern überzogen, die so hell leuchteten wie die Sonnenstrahlen über dem Meer. Eine Landschaft aus Spiralen, Hieroglyphen, geflügelten Wesen, Säugetieren, Fischen und Reptilien breitete sich über ihren Körper, alle durch eine pulsierende Ranke wie mit einem dünnen Netz verbunden.
»Sie ist gezeichnet«, sagten Stimmen neben mir ehrfurchtsvoll. »Jetzt ist es vollbracht.«
Der Morgen brach an wie an jedem anderen Tag, aber ich wusste, dass nichts wieder so sein würde wie zuvor.
Am Strand sah es aus wie nach einer Schlacht. Nackte, geschmeidige Körper lagen über den Sand verstreut, atmeten im Gleichklang, als hätte die Szene, die wir gerade miterlebt hatten, die Menge auf überirdische Weise vereint.
Ich wandte mich zu Iris. Sie lachte, wie trunken vor Glück über die Ereignisse der vergangenen Nacht. Der Wind wehte ihr eine lange braune Haarsträhne an die Lippen und in den Mund, und sie ließ ihn gewähren.
Sie drehte sich um und küsste mich.
Ich erwiderte den Kuss, war mir bewusst, dass ihr salziger Geschmack noch an meinen Lippen hing. Iris zu küssen war wie der Biss in eine Feige. Sie war gleichzeitig fest und weich, und die Form ihrer Lippen setzte unweigerlich Assoziationen in mir frei. Ich wollte ihr wieder die Beine spreizen und aus ihrem Brunnen trinken. Für einen weiteren Augenblick ihrer Lippen auf den meinen wäre ich gestorben.
»Ich liebe dich«, sagte ich, aber sie lachte erneut, kam auf die Füße und griff nach meiner Hand. Ihre Finger waren schlank und glitten in meine wie Seide. Als wäre ich in eine Porzellanpuppe verliebt, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, sie mit leidenschaftlicher Kraft zu umarmen, und der Furcht, ich könnte etwas zerbrechen.
Sie zog mich hoch.
»Komm«, sagte sie. »Sonst geraten wir noch hinter all den anderen in einen Stau.«
Da erst ging mit auf, dass alles, was wir gesehen hatten, eine Aufführung gewesen war. Überall am Strand lagen Kostümteile verteilt. Ein einzelner Flügel, der vom Rücken eines Engels gefallen war, ragte aus dem Sand, ein Paar falsche Wimpern lag wie Spinnenbeine auf einem Stück Treibholz. Ein Putztrupp kam langsam auf uns zu, verstaute die Abfälle der vergangenen Nacht in Müllsäcken.
War unser Liebesakt auch eine Aufführung gewesen?, fragte ich mich. Der Gedanke schnitt mir tief ins Herz. Ich hatte das nicht so empfunden. Wenn ich von etwas trunken gewesen war, dann von Iris, von ihrem intimen Fluss, der über meine Zunge geronnen war und ein unauslöschliches Mal in mir hinterlassen hatte.
ENDE DER LESEPROBE
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: