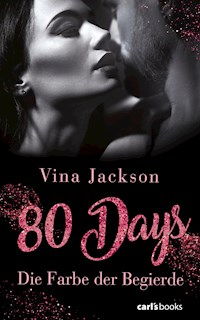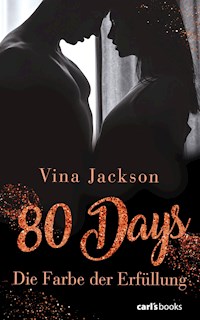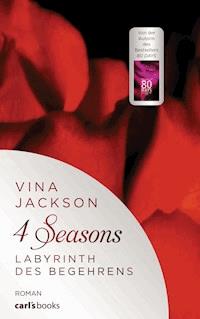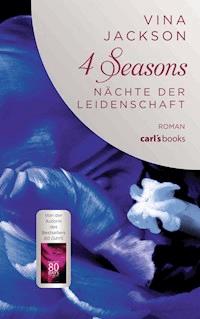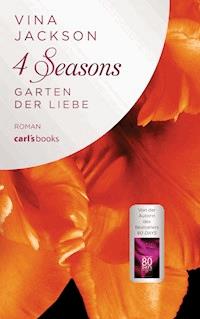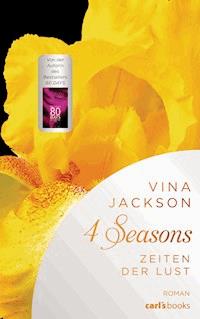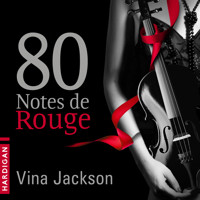6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Erotik
- Serie: 80 Days
- Sprache: Deutsch
Als die russische Tänzerin Luba nach New York umzieht, verfällt sie Chey, einem attraktiven, rätselhaften Bernsteinhändler, der Luba in einem Wirbel aus Leidenschaft und Liebe erobert. Doch ohne ein Wort der Erklärung verschwindet er viele Monate lang. Und trotzdem kann Luba dem verführerischen Chey nicht widerstehen, als dieser wieder auftaucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
1 TANZ MIT DEN BÖSEN BUBEN
Böse Buben hatten mich schon immer fasziniert. Und später, als ich älter wurde, waren es die bösen Kerle.
Sechs Monate lag es nun schon zurück, dass ich Chey verlassen hatte, und mittlerweile befand ich mich in New Orleans. Der Dezember ging seinem Ende entgegen, und mir wurde ganz schwindlig, wenn ich überlegte, welche guten Vorsätze für das neue Jahr ich in der Silvesternacht wohl fassen sollte. Mal fiel mir gar nichts ein, dann wieder wurde ich von einer Flut von Ideen und rasch wechselnden Gefühlen überschwemmt. Da es mir schwerfiel, mich zu konzentrieren, konnte ich jedoch nichts von dem festhalten, was da auf mich einströmte.
Ich fand alles nur noch langweilig. Mein Leben war eine monotone Abfolge von Tanzen, Essen, Trinken, Schlafen, gelegentlichem Ficken, dann wieder Reisen, Tanzen, Essen, Trinken, Schlafen und immer so weiter.
Ich sehnte mich nach Chey.
Ich sehnte mich nach bösen Buben und bösen Kerlen.
Selbst jetzt im Winter war es in New Orleans warm und schwül, die Luft war von Düften geschwängert. Als ich zum Zeitvertreib durch die engen, malerischen Straßen des French Quarter schlenderte, strich mir vom nahen Mississippi eine sanfte Brise über die nackten Arme. Es kam mir ganz unwirklich vor, ich fühlte mich körperlos wie in einem Traum. Vor knapp einer Woche hatte ich bei Madame Denoux Weihnachten gefeiert, und wir hatten auf der Terrasse ihres Hauses, das auf der anderen Seeseite lag, gegessen. Sie hatte auch einige Freunde und Angehörige eingeladen, darunter einen entfernten Cousin, der mich später mit in die Stadt zurücknahm. Als wir in seinem Wagen über die flache Brücke fuhren, die die enorme Weite des Pontchartrain überspannt, hatte ich den Eindruck, wir würden auf dem Wasser dahingleiten und ich müsste nur den Arm ein bisschen weiter aus dem offenen Fenster strecken, um die Finger in den See halten zu können. Wie in einer Fata Morgana glitzerten am Horizont die Lichter des Vieux Carré und die Weihnachtsbeleuchtungen an den Häusern am Ufer. Ich ging dann letztlich mit dem Cousin ins Bett, doch als Liebhaber war er ausgesprochen enttäuschend. Unbeholfen und nur auf sich bedacht. Schon vor dem Frühstück schlich ich mich aus seiner Wohnung in der Magazine Street und ging den halben Kilometer zur Canal Street zu Fuß. Auf meinem Weg durch den menschenleeren Financial District verspürte ich einen nagenden Hunger in meinen Eingeweiden. Aber nicht nach Essen.
New Orleans war eine außergewöhnliche Stadt, vor allem im Vergleich zu Donezk, meinem Geburtsort, wo jedes Gebäude ein kantiger Zweckbau war und der Horizont aus der Zackenlinie aneinandergereihter Fabrikschlote bestand, die Tag und Nacht schwarzen Rauch in den Himmel bliesen.
Madame Denoux’ Club war über Weihnachten fünf Tage geschlossen gewesen, doch an diesem Abend sollte die gewohnte Routine wiederaufgenommen werden. Ich würde wieder tanzen.
Als ich in die Garderobe kam, war ich in Gedanken bei den Weihnachts- und Neujahrsfesten, wie ich sie aus der Ukraine kannte. Leider hatte ich keine Erinnerungen, die besonders hervorstachen, nur einzelne Bilder, die zu einem diffusen Ganzen verschmolzen. In der Garderobe waren bereits drei andere Frauen dabei, sich auszuziehen, sich vor den großen Spiegeln zu schminken, ihre Kostüme zurechtzuzupfen, Strapse überzustreifen, den Körper abzupudern, sich reichlich mit Parfüm zu besprühen und Modeschmuck anzulegen. Ich war aus Kalifornien hierhergekommen und davor in New York gewesen, allein schon wegen dieser Großstadterfahrung lehnten sie mich ab, aber vor allem weil Madame Denoux mich als Glanznummer ihres Programms präsentierte. Wahrscheinlich hielten sie mich für schön und eingebildet, eine Kombination, mit der eine Frau nur schwer Freundinnen findet. Aber ich bin nun mal schön – was für mich nichts Besonderes ist, weil man es mir schon seit meiner frühesten Kindheit gesagt hat. Nun, ich habe mich im Leben stets nach meinen eigenen Regeln gerichtet, ohne dass ich das Bedürfnis hatte, mit Frauen Freundschaft zu schließen. Zumal ich mit ihnen kaum etwas gemein hatte, das wussten sie, und das wusste ich.
Ich wandte den anderen im Raum den Rücken zu und zog mich aus. Ich spürte, dass sie mich musterten. Als ich mich bückte, um die Riemchen meiner Sandalen zu öffnen, durchbohrten mich ihre Blicke, die über meine Arschritze und die sanfte Erhebung meines Steißbeins wanderten. Sollten sie doch. Ich war es gewohnt, dass man mich betrachtete. Und das ausgiebig.
Nach einem kurzen Brummen erklang aus den Lautsprechern an der Garderobenwand Musik, Duke Ellingtons Version von »Minnie the Moocher«, das Zeichen für Pinnie, auf die Bühne zu gehen. Sie war zierlich, kurvig und wunderschön mit ihrer bunt gemischten Abstammung. Ihr dunkles, glänzendes Haar, das sich bis zu ihrer Taille ergoss, schlang sie sich beim Tanzen gern um den Körper. Was die Gäste aufreizte, denn dieser neckische haarige Vorhang verbarg zum Teil ihre Brüste mit den dunklen Nippeln. Eine weitere Besonderheit an ihr war das ungezähmte Schamhaar, das üppig und wild wie bei einem Geschöpf aus dem Dschungel wucherte. Außerdem hatte sie mitten auf der Stirn ein Muttermal, und statt es zu überschminken oder durch andere Reize davon abzulenken, zog sie gezielt mit ihrem wie mit einem Lineal geschnittenen Pony die Aufmerksamkeit darauf. Sie war die einzige Kollegin, die freundlich zu mir war und hin und wieder zwischen zwei Auftritten mit mir sprach. Die anderen ignorierten mich hartnäckig. Und ich sie.
Mir blieb mindestens noch eine Stunde Zeit, bis ich auf die Bühne musste, denn ich kam als Letzte an die Reihe.
Ich nahm das Buch, das ich gerade las, aus meinem Korb, machte es mir in einem Sessel bequem und blendete meine unmittelbare Umgebung vorübergehend aus. Seit Neuestem war ich geradezu süchtig nach Romanen. Dieser handelte von einem Wanderzirkus, eine opulente Geschichte, und war ausgesprochen abwechslungsreich. Realistische Romane mochte ich weniger. Sie erinnerten mich zu sehr an die Bücher, die ich in meiner ukrainischen Schule und später in St. Petersburg als Pflichtlektüre hatte lesen müssen – anspruchsvolle, aber nicht enden wollende Werke über die Mühen der Menschheit, mit denen ich nie etwas anfangen konnte.
Als die letzten Töne von Van Morrisons Song »Into the Mystic« verklangen, blickte ich auf. Leise vor sich hin fluchend, rauschte Sofia von der Bühne in die Garderobe. Offenbar hatte während ihres Auftritts irgendetwas an ihrem Kostüm gehakt. Der Blick, mit dem sie mich bedachte, als sie sich vor ihren Spiegel setzte und sich abzuschminken begann, war gehässig, als trüge ich die Schuld an diesem banalen Vorfall. Vielleicht ärgerte sie sich, weil mein Bühnenkostüm so schlicht war und ohne Klettverschlüsse, Schnallen, Schnelllösevorrichtungen, Knöpfe und Reißverschlüsse auskam.
In fünf Minuten würde die Bühne mir gehören. Ich schloss die Augen, um mich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit darauf vorzubereiten. Ein Striptease hat nichts Erotisches, sondern ist einfach nur Arbeit; doch wenn ich es schaffte, die Umgebung auszublenden und auf eine andere Ebene zu gelangen, konnte ich wie von unsichtbaren Flügeln getragen durch meine Nummer gleiten. Seit letztem Jahr tanzte ich zu Debussys »La Mer« und kannte inzwischen jede Kräuselung des heraufbeschworenen Gewässers und jede sinnliche Windung der Melodie. Es war Cheys Lieblingsmusik gewesen, er mochte das Meer sehr. Als ich zum ersten Mal zu dieser Komposition getanzt hatte, war es allein für ihn gewesen. Ein privater Tanz.
Tanzen, ausziehen, mich darbieten wurden zu einer Art geheimen Zeremonie, bei der ich zugleich die Rolle des Opferlamms und die der Hohepriesterin mit dem tödlichen Messer einnahm. In diese Fantasiewelt begab ich mich und blieb darin für die Dauer meines Auftritts.
Ich schaltete ab.
So wie es mir immer gelang.
Mein Zeichen nahm ich wie aus großer Ferne wahr. Madame Denoux hatte mein Band in das Abspielgerät gelegt, und meine leisen Atemzüge drangen aus den Lautsprechern. Es war stockfinster im Zuschauerraum, als ich auf Zehenspitzen auf die Bühne huschte und meine Ausgangsposition einnahm.
Urplötzlich stand ich im Licht der Scheinwerfer.
Die Zuschauer schnappten nach Luft.
Abend für Abend erlebte ich diese Reaktion. Nicht weit von mir entfernt, verborgen hinter dem Bühnenvorhang, stand Madame Denoux, und ich wusste, dass sie zufrieden lächelte.
Zuerst nur kaum wahrnehmbare Bewegungen – als wollte ich meine Energien sammeln, als zöge ich mich an jenen Ort in meinem Inneren zurück, wo es nichts als Stille und einen ewig summenden Kern gab, wo eine verborgene Kraft darauf wartete, aufgenommen, in jede Faser meines Körper gesandt und dann genutzt zu werden. Ich war die Puppenspielerin, die sich an eigenen Fäden über die Bühne führte.
In der ersten Minute mimte ich, dass eine sanfte Brise über die Wogen strich und nahezu unsichtbare Wassertröpfchen in der dunstigen Luft verteilte, während sich bereits ein Unwetter ankündigte und die Flut immer stärker anstieg. Eine kleine Armbewegung hier, eine Drehung des Handgelenks dort, der Schwung meiner Hüften im Einklang mit der sacht anschwellenden Musik, der süß melancholische Klang der Piccoloflöte zum leisen Spiel der Harfe und dem Schlag der Trommel. Als würde es sanft zu regnen beginnen und sich am Horizont ein Gewitter zusammenbrauen.
Der zweite Satz begann mit dunkleren Tönen von Klarinette und Oboe. Gedämpfte Trommelschläge kündigten das erste Donnergrollen an. Das Wasser wurde rauer, die Wogen mächtiger, und ich gestaltete meine Bewegungen entschiedener, rascher, sportlicher.
Obwohl ich das Publikum kaum sah, wusste ich, dass ich es jetzt in der Hand hatte. Ich konnte durchatmen und mich umsehen. Denn ich kannte jeden Schritt, und der Rhythmus der Musik war wie in meinen Körper eingebrannt. Er entsprach dem Schlag meines Herzens, mit dem es das Blut durch meinen Körper pumpte, und trug mich bis zum Ende meiner Darbietung. Es war nicht so, als würde ich von den Wogen fortgerissen und von dem unentwegt wütenden Sturm mal hierhin, mal dorthin geschleudert. Vielmehr war es, als würde ich auf dem Sturm reiten, das Orchester dirigieren und als läge es in meiner Macht, die Gezeiten zu lenken.
An anderen Tagen war es nicht so romantisch, dann war es eher eine Frage der Übung. Wie Chey meinte, galt das ohnehin für fast alles.
Immer und überall kam es auf das Training an oder auf die gute alte Schinderei – auch wenn es so aussah, als ließe ich mich von meinen Eingebungen leiten. Das entnahm ich der Art und Weise, wie mich das schweigende Publikum betrachtete, Nachtschwärmer mit gebannten Gesichtern, die diese ungewöhnliche Frau ansahen, als erwarteten sie so etwas wie den Zauberkünstler aus dem Roman, den ich gerade las. Sie hatten das ganze Getriebe der Maschinerie vergessen, von der Eingangshalle über den besonderen Geruch und Geschmack der gereichten Erfrischungen bis hin zu den erlesenen Düften und der Erscheinung der Directrice. Madame Denoux trug zu ihrer weißen Karnevalsmaske stets ausgefallene, aber äußerst geschmackvolle Kleider. Etwas Besonderes war ihre Haltung, die einstudierte und perfektionierte Mattigkeit, die sie so geheimnisvoll wirken ließ. Dabei war sie eine ganz normale Frau, nicht anders als wir – nur dass sie ihren Lebensunterhalt mit der Zurschaustellung anderer Frauen verdiente.
An diesem Abend war es nicht so voll, wie ich es erwartet hatte. Einen Tag vor Silvester befand sich New Orleans bereits im Partytaumel. Überall spürte man die Vorfreude auf den Neuanfang, den das Jahresende mit sich brachte; alle Einwohner der Stadt waren auf den Beinen, um mitzuerleben, wie das eine Jahr ausklang und das neue begann. Es war der einzige Zeitpunkt, zu dem es zwischen den Menschen auf den Straßen wirklich keine Unterschiede gab. Ganoven und Touristen, Huren und junge Schuhputzer, sie alle einte das Gefühl, in dieser einen Nacht aufzugehen, wenn in den ersten Minuten des neuen Jahres die im French Quarter gezündeten Silvesterraketen in die Nacht zischten, den Himmel kurz erhellten und dann wieder erloschen. Zurück blieb nicht viel: die vergängliche Schönheit des Feuerwerks, die Erinnerung an ein paar vergnügte Stunden und – in den meisten Fällen – ein schlimmer Kater.
Und was würde von mir zurückbleiben? Anders als bei einer Musikerin gab es von meinen Darbietungen keine Aufzeichnungen, die man immer wieder abspielen konnte. Man würde mich vergessen, auch wenn sich jeder meiner Schritte jeweils für einen Sekundenbruchteil in den Gesichtern meiner Zuschauer widerspiegelte und bestenfalls, wenn ihnen mein Auftritt wirklich gefiel, in ihr Gedächtnis einbrannte. Doch niemals konnten sie eins zu eins wiederholt werden.
Zwei meiner Zuschauer an diesem Abend fesselten mein Interesse, eines der wenigen Paare. Frauen, die ihre Männer oder Liebhaber begleiteten, wirkten gewöhnlich gelangweilt, als hätten sie so etwas wie unser Programm oder Gewagteres schon oft gesehen. Oder sie schienen verunsichert, eifersüchtig, voller Angst, was ihre Männer wohl später zu Hause von ihnen erwarteten, nachdem sie mich auf der Bühne gesehen hatten, voller Scham über ihren Körper, über die unter dem unerbittlichen Zug von Alter und Erdanziehung herabhängenden Brüste und ihre schlaffen Schenkel.
Doch die Augen der Rothaarigen in dem schwarzen Kleid sprühten Funken. Ihr Körper war angespannt, und sie umklammerte den Oberschenkel des Mannes, während sie aufmerksam meine einstudierten Bewegungen verfolgte. Und er betrachtete nicht etwa mich, sondern sie, die mich betrachtete, und fixierte sie wie ein Löwe, der in der offenen Savanne gerade eine einsame Gazelle entdeckt hatte. Er hatte dichtes, dunkles Haar, breite Schultern, einen festen, schlanken Körper und schien mit sich und dem Leben im Reinen. Selbstbewusst, aber nicht eingebildet. So wie Chey.
Ich machte eine kleine Drehung, um die beiden direkt vor mir zu haben, gab mir aber weiterhin den Anschein, mein Publikum nicht wahrzunehmen. So, wie es Madame Denoux’ Rat war, den allerdings nur wenige meiner Kolleginnen befolgten. Tanzt, als ob euch niemand zuschaut. Die Leute im Publikum wollen sich als Voyeur fühlen, als wären sie Zeuge eines intimen Augenblicks, als würden sie von der Tänzerin etwas Privates oder Verbotenes erhaschen. Denn sonst seid ihr nur Mädchen, die sich für Geld ausziehen, also nichts Besonderes.
Sie hatte etwas an sich, diese junge Frau, die mir mit ihrem attraktiven Begleiter zuschaute – sie war mir ähnlich. Es war die Art, wie sie meinen Körper zu würdigen wusste, wie sie das Theaterhafte des Ganzen mit den Augen verschlang. Womöglich sah sie sich selbst auf der Bühne und fragte sich, wie sie sich fühlen würde, wenn all die Leute im Publikum ihr beim Tanzen zusähen und nicht mir. Auch Madame Denoux hatte es bemerkt. Ich hatte sie umhergehen sehen und stellte mir vor, dass sie eins und eins zusammenzählte, dass sie knallhart rechnete, um sich ja keine Gelegenheit entgehen zu lassen, einem Mann die Taschen zu leeren oder ein neues Mädchen für ihre Sammlung zu finden. So wie sie mich gefunden hatte.
War es der Ausdruck im Gesicht der Rothaarigen, oder lag es an dem Mann, der mich an Chey erinnerte? Oder hatte ein Ton eine leichte Variante in die Melodie gebracht, die ich eigentlich auswendig kannte? Schwer zu sagen.
Manchmal meldeten sich, ungerufen und unerwünscht, Erinnerungen zurück. Bruchstücke meiner Vergangenheit flackerten über einen Schirm mit Hintergrundbeleuchtung, Bilder, die sich jagten wie bei einem Drogentrip. Lebhaft. Schmerzlich.
Die Gesichter meiner Eltern, als ich sie zum letzten Mal sah; sie winkten mir zu, und ihr Auto entschwand in der Ferne auf dem Feldweg, der vom Landwirtschaftsinstitut wegführte, wo sie lebten und arbeiteten. Ich war fünf Jahre alt. Mein Vater leitete das Institut, meine Mutter war als Wissenschaftlerin im Labor und in den Versuchsgärten tätig. Hier hatten sie sich kennen- und lieben gelernt. So jedenfalls wurde es mir später von meiner Tante erzählt.
Er war ein Ingenieur aus Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, sie im Donbass geboren und aufgewachsen. Man hatte ihn befristet nach Donezk versetzt, er machte es jedoch zu seinem dauerhaften Wohnsitz, als sie heirateten und ihr erstes und einziges Kind bekamen. Mich.
Ich weiß, dass ich ein geliebtes Wunschkind war, und es schmerzt mich sehr, dass die Erinnerungen an meine frühe Kindheit und an meine Eltern im Lauf der Zeit immer mehr verblassen. Ich meine, unseren Gemüsegarten vor mir zu sehen und einige Spielsachen in meinem Kinderzimmer, doch den Klang ihrer Stimmen, die sanften Lieder meiner Mutter, die sie mir beim Einschlafen vorsang, kann ich nicht mehr heraufbeschwören. Lubaschka, glaube ich, nannte sie mich. Doch mittlerweile sind ihre Lieder und diese Erinnerungen so tief in mir verschüttet, dass ich sie nicht mehr hervorholen kann. Ebenso wenig das Lächeln auf ihrem Gesicht oder das strenge, professorenhafte Auftreten meines Vaters.
Ich weiß nicht einmal mehr, welche Farbe ihre Augen hatten. Die unechten Erinnerungen, die ich aus den wenigen über die Zeit geretteten Fotos ableite, sind alle in Schwarz-Weiß.
Der Fahrer des Lasters, der auf der Schnellstraße nach Moskau mit ihrem Wagen zusammenstieß, soll betrunken gewesen sein. Er hatte die Kontrolle über seinen mit Baumaterialien beladenen Sattelschlepper verloren. Dass er bei dem Unfall ebenfalls ums Leben kam, in seiner Fahrerkabine von den schweren Betonblöcken zerquetscht wurde, die sich auf der Ladefläche gelöst hatten, war mir kein Trost. Alle drei waren auf der Stelle tot. Es geschah mitten in der Nacht.
Ich kam bei meiner Tante unter, der geschiedenen und kinderlosen Schwester meiner Mutter. Auch sie lebte in der Nähe von Donezk. Da sie früher einmal Balletttänzerin hatte werden wollen, machte sie es sich zur Lebensaufgabe, dass ich diesen Traum verwirklichte. Sie ermutigte mich zu tanzen und brachte große finanzielle und zeitliche Opfer, um mich zu dem Erfolg zu führen, der ihr versagt geblieben war.
Sie meldete mich an der örtlichen Ballettschule an, wo ich an drei Nachmittagen nach der Schule und an den Wochenenden den Unterricht besuchte. Um ihn bezahlen zu können, musste meine Tante jeden Samstag in unserer Wohnung Klavierunterricht geben. Für mich bedeutete es, dass ich an diesen Nachmittagen bei jedem Wetter, ob bei Regen, Schnee oder Sonnenschein, die knapp fünf Kilometer von unserer Wohnung zur Ballettschule allein und zu Fuß zurücklegen musste. Und das geschah immer öfter, weil ihr altes, gebraucht gekauftes Auto allmählich den Geist aufgab und sie mich nicht mehr abholen konnte.
Es gab mir viel Zeit, meinen Träumen nachzuhängen.
Wie die meisten kleinen Mädchen in Russland und erst recht in der Ukraine träumte ich davon, Primaballerina zu werden, und man versicherte mir immer wieder, dass es mir am entsprechenden Talent nicht fehle. Aber hatte ich auch die nötige Disziplin und den Ehrgeiz?
Die Antwort auf diese Frage sah ganz anders aus.
Ich war faul und nicht bereit, die klassischen Schrittfolgen zu lernen, ich verabscheute ihre Steifheit. Viel lieber verlor ich mich in der Musik und erfand meine eigenen Bewegungen, die sich ganz von selbst ergaben und nicht zu einer dieser rigiden Choreografien gehörten, die uns die strengen Lehrerinnen in unsere kleinen Schädel paukten.
»Lubow Schewschenko«, tadelten sie mich immer wieder. »Du bist unverbesserlich. Was sollen wir bloß mit dir machen?«
Ich glaube, ich war damals zehn oder elf. Irgendwie schaffte ich die Abschlussprüfung und wurde nach St. Petersburg eingeladen, um in der Geburtsstadt meines Vaters die angesehene Theater- und Ballettakademie zu besuchen. Ob in der Stadt noch irgendwelche Angehörige von ihm lebten, wusste ich nicht, und da ich Waise war, erhielt ich für die Lebenshaltungskosten ein kleines Stipendium. Ich hatte keine Wahl und musste in ein Wohnheim ziehen, wo ich mit anderen Mädchen zusammenlebte, die es ebenso wie mich aus ländlichen Gegenden in die Großstadt verschlagen hatte – in ein Gebäude der ehemaligen Geheimpolizei, das für die Unterbringung von wirtschaftlich Schwachen umgebaut worden war.
Die Aussicht, auf mich selbst gestellt zu sein, ängstigte mich nicht. Zwischen meiner Tante und mir hatte es in den Jahren zuvor so viele Missverständnisse gegeben, dass wir uns oft nur noch anschwiegen. Sie hatte mich vom ersten Tag an wie eine Erwachsene behandelt, dabei hatte ich doch noch Kind sein wollen.
Dennoch war es dann ausgesprochen schwer für mich, als ich ins kalte Wasser geworfen wurde und in einem Schlafsaal mit acht Betten auf engstem Raum mit anderen Mädchen zusammenleben musste. Die meisten waren ein paar Jahre älter als ich. Sie kamen aus Sibirien, Tadschikistan, zwei weitere wie ich aus der Ukraine und einige, mit makelloser Haut, hohen Wangenknochen und schlechten Zähnen, aus dem Baltikum. Mir wurde rasch klar, dass ich mit ihnen nur wenig gemeinsam hatte. Nur eine ging auf dieselbe Akademie wie ich, die anderen besuchten die verschiedensten Schulen, allesamt ohne künstlerische Ausrichtung. Daher stachen wir hervor wie bunte Hunde, Soscha und ich.
Zu sagen, dass wir enge Freundinnen wurden, wäre übertrieben. Doch immerhin akzeptierte sie mich, obwohl sie sechzehn Monate älter war als ich und ihr Busen schon zu wachsen begann. Ich diente ihr als Botin, Hilfskraft und Schleuserin. Luba, ihre rechte Hand, wann immer es um etwas Illegales oder Verbotenes ging, also wenn Zigaretten in den Schlafsaal geschmuggelt werden sollten oder das untersagte Schminkzeug der anderen unter ihrer Matratze versteckt werden musste. Meine Grundausbildung in Gesetzesverstößen …
Wenige Jahre später wurde Soscha schwanger. Sie hatte sich mit einem Jungen vom Polytechnikum angefreundet, und wann immer sie sich heimlich mit ihm traf, musste ich für ihr Fehlen eine Ausrede parat haben. Sie war damals erst sechzehn. Als man ihren Zustand herausfand, gab es kein Pardon. An dem einen Tag war sie noch bei uns, am nächsten wurde sie wie ein beschädigtes Paket zu ihrer Familie in der Nähe von Vilnius zurückgeschickt. Uns erzählte man, sie habe heimkehren müssen, weil es in ihrer Familie einen schweren Krankheitsfall gegeben habe. Aber wir wussten es besser, wir kannten die Wahrheit.
Als ich mir knapp zwei Jahre später, kurz vor meinem Abschluss an der Akademie, gerade überlegte, beim Corps de Ballet eines unbedeutenderen Ballettensembles der Stadt mitzutanzen, erhielt ich ganz überraschend einen kurzen Brief von Soscha. Sie hatte einen Jungen bekommen, ihn Iwan genannt und inzwischen einen älteren Mann geheiratet, der in der Gemeindeverwaltung arbeitete. Sie schrieb, sie sei glücklich, und hatte ein Bild von ihrer Familie beigelegt. Das Foto war in einem Garten aufgenommen, die nackten Zweige der Bäume ragten wie blanke Knochen in den Himmel, und selbst das Gras hatte ein ungesundes Grün. Soscha war damals noch nicht einmal neunzehn, wirkte in meinen Augen aber bereits wie eine alte Frau – zumindest um Jahre älter, als sie tatsächlich war. Ihre Augen waren eingesunken, das Haar stumpf und der Funke der Jugend für immer verloschen.
An diesem Tag schwor ich mir, niemals zu heiraten und Kinder zu kriegen.
Damals hatten wir am Vormittag normalen Unterricht: Russisch (mein Lieblingsfach), Rechnen (später Mathematik und Geometrie), Geschichte, Geografie, Staatsbürgerkunde und anderes. Gewöhnlich sank ich während dieser Stunden in allertiefste Tagträume. Nachmittags mussten wir in der Akademie lernen, üben und proben. Jede von uns hatte drei verschiedene Tanzkostüme, eines davon ausschließlich für die Auftritte, wenn ein Ballett nach monatelangem Einstudieren endlich bei einer Gala das Licht der Welt erblicken durfte. Ich bekam nie ein Solo, und es schien mir, als sollte ich bis ans Ende meiner Tage im Corps als junger Schwan dahinflattern. Dabei fühlte ich mich eher wie eine zappelnde Ente. Oh, wie ich Tschaikowski hasste!
In der Ballettschule hatten wir auch samstags Unterricht, und es blieb uns nur der Sonntag als freier Tag. Vormittags waren wir allerdings meist damit beschäftigt, unsere Kleider zu waschen, zu bügeln, zu flicken und den Schlafsaal in Ordnung zu bringen, sodass wir eigentlich nur an den Sonntagnachmittagen tun und lassen konnten, was wir wollten. Meistens gingen wir dann ins Kino und in eine Eisdiele in der Nähe und nutzten die Gelegenheit, uns mit Jungs zu treffen. Um acht mussten die Jüngeren wieder im Wohnheim sein, um Punkt halb zehn die über Fünfzehnjährigen. Da gab es keine Ausnahme, und Ungehorsam oder ein Verstoß gegen die Vorschriften zog unweigerlich Hausarrest an den nächsten Wochenenden nach sich.
Ach ja, die Jungs …
Es war wirklich kein Wunder, dass ich mich für sie zu interessieren begann, nachdem ich jahrelang – und die Jahre eines Teenagers ziehen sich endlos in die Länge – mit sieben Mädchen in einer Welt voll verstohlener Geständnisse, aufgebauschter Geschichten, tobender Hormone und Eifersüchteleien zusammengelebt hatte. Wir verfolgten einander mit wahren Argusaugen, brannten vor Neugier, glühten vor Eifersucht, als gäbe es kein Morgen. Wer war die Schönste, die Größte, wer hatte den am weitesten entwickelten Busen?
Einige machten ein Geheimnis daraus, als sie ihre erste Periode bekamen, andere verkündeten es Gott und der Welt. Ich, das Waisenkind aus der Ukraine, war weder das hässliche Entlein noch die Größte unter ihnen; ich hatte nicht die weiblichsten Rundungen und war auch nicht die Erste oder die Letzte, bei der die Blutungen einsetzten. Doch tief in meinem Innern wusste ich schon damals, dass ich etwas Besonderes war. Aus diesem Gefühl heraus entwickelte ich den Ehrgeiz, die Welt kennenzulernen, ganz anders als meine Mitschülerinnen, die sich gedanklich gerade mal mit der näheren Zukunft befassten, ein Studium planten oder überlegten, wie sie eine möglichst gute Partie machen konnten. Ich aber hörte überall eine leise Stimme, die mir zuflüsterte, dass es im Leben mehr geben müsse.
Und dann der Sex …
Ein beliebtes Gesprächsthema in den Stunden nach dem Zapfenstreich im Schlafsaal der Mädchen. Allerdings wurde darüber auch am helllichten Tag in den Garderoben, während der Proben, in den Duschen und an der roten Backsteinmauer hinter dem Haus getuschelt, wo wir uns abwechselnd zum Rauchen einfanden, weil wir wussten, dass dort bestimmt keine der Aufseherinnen vorbeikommen würde.
Da ich eine der Jüngsten war, sah ich mir zunächst nur an, was sich da alles tat im Haus der Lust. Meine Mitbewohnerinnen waren im Laufe der Jahre erblüht, während ich trotz meiner Ballettstunden und des mir auferlegten anstrengenden Trainings Mühe hatte, meinen Babyspeck loszuwerden. Alle sagten, ich habe zwar ein hübsches Gesicht, doch mein Körper streife nur langsam seinen Kokon ab. Und so fand ich mich in der Gemeinschaftsdusche in der Rolle einer Spionin wieder. Während mir das Wasser über den Körper lief, stand ich da und betrachtete voll Neid die anderen mit ihren gerundeten Hüften, den wippenden Brüsten und breiten Hintern. Ich hingegen war einfach nur ein von oben bis unten gut gepolstertes Knochengestell, ohne Kurven und ohne Anmut.
Und sie erzählten viel, nachdem das Licht gelöscht war. Über die Jungs, mit denen sie sich getroffen hatten oder noch treffen wollten, und über all die Dinge, die sie dann mit ihnen anstellen würden. Ich hörte still zu und versuchte, aus den Übertreibungen die Wahrheit herauszufiltern. Manchmal trafen mich ihre Worte bis ins Mark, dann wieder setzten ihre Geheimnisse mein Inneres in Flammen. Und immer wusste ich, dass ich eines Tages eine von ihnen sein würde. Wenn ich erwachsen und eine Frau geworden war.
Normalerweise trafen wir uns in der Eisdiele in der Luganskaya uliza, ein altmodisches Relikt noch aus der Stalinzeit. An neun von zehn Tagen gab es nur Vanilleeis, und selbst das mit künstlichem Aroma, das einen bitteren Nachgeschmack hinterließ. Doch die beiden alten Babuschkas, die den ehemaligen Staatsbetrieb übernommen hatten, störte es nicht, wenn wir Mädchen stundenlang dort saßen und tratschten, Schminktipps austauschten und Typen trafen, die von außerhalb in die Stadt gekommen waren. Die älteren Mädchen tauschten mit ihnen gelegentlich verstohlene Küsse gegen gefragte Mitbringsel. Die galten nicht etwa als Bezahlung – das kam auf keinen Fall infrage –, sondern eher als eine Art Trinkgeld, das sicherstellte, dass sie wiederkommen und uns auf dem Schwarzmarkt gehandelte Kopien von Markenartikeln verkaufen würden.
Als wir etwas älter geworden waren, brüsteten sich einige Mädchen damit, dass sie den Jungs mehr als nur Küsse gewährt hatten.
Ich war schon wegen meiner knappen finanziellen Mittel nur Zuschauerin bei diesem Spiel. Dennoch wurde ich in den Jahren nach Einsetzen meiner Periode jedes Mal rot, wenn ich die Eisdiele in der Luganskaya betrat. Ein seltsames Kribbeln erfasste meinen Unterleib, und in meinem Kopf überschlugen sich wilde Fantasien. Zumindest wurde der Geschmack der künstlichen Vanille dadurch erträglicher.
Im Jahr nach Soschas plötzlicher Abreise schlief im Bett neben mir ein Mädchen aus Georgien namens Valentina.
Valja war eine wilde Hummel und steckte ständig in Schwierigkeiten, nicht weil sie von Natur aus böse, sondern weil sie aufsässig war und immer Unfug im Kopf hatte. Sie wies mich in die Kunst des Schwanzlutschens ein und erklärte mir, da dies den Männern ausgesprochen gut gefalle, bahne es uns Mädchen einen direkten Weg zu ihren Herzen. (Wie ich später herausfand, auch zu ihren Lenden.) Sie scherzte oft, eine Russin sei erst dann eine richtige Frau, wenn sie einem Mann kunstvoll einen blasen könne. Für ihren Unterricht schleppte sie sogar Bananen an, die damals noch schwer zu bekommen waren.
Anfangs reizten mich mehr der köstliche Geschmack und die weiche Beschaffenheit der Bananen als ihre Form. Valja jedoch bestand darauf, dass ich stundenlang übte, bis sie eines Tages erklärte, ich sei reif für die Praxis.
Ich glaube, er hieß Boris. Oder Sergej. Ich erinnere mich weder an seinen Namen noch an sein Aussehen, denn Boris (oder Sergej?) kam einige Tage nach Sergej (oder Boris?). Ich wurde zur Wiederholungstäterin. Er – nein, sie beide studierten an der nahe gelegenen Technischen Hochschule. Ich war sechzehn und er etwa ein, zwei Jahre älter. Mit der Ankündigung, ich sei bereit, hatte Valja unser Treffen arrangiert und für diesen Dienst zweifellos einige Rubel eingesteckt. Treffpunkt war die Eisdiele, und ich weiß noch, dass man an jenem Tag aus mehreren Eissorten auswählen konnte. Ich entschied mich neben dem bekannten künstlichen Vanilleeis für Walderdbeere, und er bezahlte. Später gingen wir Händchen haltend zu der Backsteinmauer hinter meinem Wohnheim, und Valja stand Schmiere. Er löste den Gürtel um seine schmale Taille und zog sich die abgewetzte Cordhose bis zu den Knien herunter. Seine Unterhose war irgendwas zwischen weiß und grau. Als er mir in die Augen sah, erkannte ich, dass er offenbar noch mehr Angst hatte als ich. Neugierig streckte ich die Hand aus und griff durch die dünne Baumwolle nach seinem Penis, der sich weich und schlaff anfühlte wie ein Stück billiges Fleisch. Boris (oder Sergej?) erstarrte. Und obwohl mich Valja mit endlosen Proben auf diesen Augenblick vorbereitet hatte, wollte mir plötzlich nicht mehr einfallen, was ich als Nächstes tun musste.
Dann aber kam es mir wieder. Ich musste mich hinknien. Der Boden war kalt. Ich schob den Stoff zur Seite und sah zum ersten Mal in meinem Leben den Schwanz eines Mannes vor mir, ein Anblick, der mich ängstigte, aber auch faszinierte. Ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt, kleiner vielleicht. Tief holte ich Luft. Dabei stieg mir ein dumpfer Geruch in die Nase. Der Geruch eines Mannes.
Ich nahm den Schwanz in die Hand. Der zuckte hoch, und ich spürte in seinen Adern das Blut pulsieren.
Ich öffnete den Mund, brachte ihn in die richtige Position und berührte ihn mit den Lippen.
Zunächst leckte ich den Schaft, dann die Adern entlang bis hinunter zum Hodensack, wie Valja es mir geraten hatte, falls der Junge keine Erektion hatte.
Wieder lief ein Schaudern durch sein Glied.
Schließlich holte ich tief Luft und schob mir die pilzförmige Eichel in den Mund.
Noch ehe ich saugen, lecken oder sonst etwas tun konnte, schwoll er an, bis er meine Mundhöhle ausfüllte.
Welch eine Offenbarung!
Meine Lippen schlossen sich fester um das rasch immer härter werdende Glied. Seine nachgiebige, aber solide Oberfläche fühlte sich zugleich weich und fest an.
Boris (oder Sergej?) stöhnte auf, obwohl ich gar nichts tat.
Ich war hellwach, speicherte jede Einzelheit dieser Erfahrung, registrierte meine Empfindungen und sortierte meine widersprüchlichen Gefühle. Mir war, als hätte ich eine völlig neue Welt betreten.
Doch es dauerte kaum länger als eine Minute, bis Boris (oder Sergej?) seinen Schwanz abrupt aus meinem Mund herauszog und sich sein weißes Ejakulat in einem Strahl über mein Kinn und das Oberteil meines Kleids ergoss. Er sah mich kurz an, murmelte eine Entschuldigung und zog sich die Hose hoch. Dann wandte er sich um und lief fort. Ich kniete noch immer auf dem Boden wie eine Bittstellerin und versuchte, meine sich überstürzenden Gedanken zu ordnen, wobei mir nach wie vor der Mund offen stand.
»Und? Wie war’s?«, fragte Valja. »Aufregend?«
»Ich weiß nicht«, antwortete ich aufrichtig. »Interessant. Aber irgendwie ging alles viel zu schnell. Ich würde es gern noch mal versuchen.«
»Wirklich?«
»Ich glaube nicht, dass ich es falsch gemacht habe«, fuhr ich fort. »Vielleicht lag es an ihm.«
Am nächsten Morgen beim Zähneputzen musterte ich mich eingehend im Spiegel und sah eine neue Person. Ich war kein Kind mehr, endlich blickte ich in die Augen einer Frau. Natürlich weiß ich, dass sich diese Veränderung nicht über Nacht einstellt, doch damals kam mir das Bild, ich hätte eine Brücke erreicht und sie im Triumph überquert.
Dabei wurde mir klar, dass ich Macht über den Penis dieses jungen Manns gehabt hatte. Und im Gegensatz zu allen Erwartungen und landläufigen Erfahrungen hatte ich diese Begegnung mehr genossen als er.
Bei dem zweiten Jungen – womöglich Sergej – war der Penis schon hart, als ich ihn aus der Hose zog. Er war noch schöner, gerade wie ein Lineal, zartrosa, ohne hervortretende Adern und mit schweren, herabhängenden Hoden.
Außerdem schmeckte er anders.
Im Laufe des nächsten Jahres lernte ich durch meine unstillbare Neugier und die tiefe Faszination für den Sex die verschiedensten Schwänze kennen. An den dazugehörigen Männern hatte ich nicht das geringste Interesse. Sie stammten allesamt aus der Gegend und waren oft grob, maulfaul, unbeholfen und zumeist auch schwere Trinker, sie ließen mich völlig kalt. Aber andere gab es hier nicht.
Und so träumte ich von kultivierteren Kerlen, von eleganten Männern mit einer Neigung zum Verbotenen, die mich ungestraft verführten und unartige Dinge mit mir anstellten, wenn ich erst meine Unschuld verloren hätte. Ich wollte die aus der Oberliga, Männer, bei denen mir die Knie weich wurden und meine Sinne vibrierten, sobald sie den Mund aufmachten. Ich wusste, dass es sie gab, dass sie irgendwo auf mich warteten, um mich zu erregen und zu vernaschen. Doch bis sie meinen Weg kreuzten, musste ich mich mit den Burschen vom Land begnügen, die mir zwar das Gefühl gaben, etwas Verbotenes zu tun, ansonsten aber einfach nicht böse genug waren.
Als sich in unserem kleinen Kreis erst einmal herumgesprochen hatte, dass ich bereit und zu haben war – zumindest fürs Schwanzlutschen –, standen sie Schlange. Einige wollten sich damit nicht zufriedengeben und forderten mehr, doch ich hatte meine Regeln und setzte sie durch. Mein Körper gehörte mir und sollte ein Geheimnis bleiben; jeder Versuch, diese Grenze zu überschreiten, führte unverzüglich dazu, dass ich meine Gunstbeweise einstellte. Natürlich probierten sie es auch weiterhin, doch ich blieb hart. Ich lutschte ihnen den Schwanz, mehr nicht. Und ich gestattete selbstverständlich auch keinem von ihnen, mich zu berühren.
Die jungen Russen, die ich traf, waren durchweg so unattraktiv, dass man meinen konnte, sie wären alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Fremde hingegen sollten, so ging das Gerücht, von ganz anderem Kaliber sein. Nina, eine der Älteren, hatte einmal das Glück gehabt, bei einer kurzen Tournee als zweite Besetzung mit dem Corps de Ballet ins Ausland zu reisen. Sie hatte uns Mädchen im Schlafsaal berichtet, dass die Männer dort nicht nur die größeren Schwänze hatten, sondern auch dichten konnten.
Für mich in meiner Naivität war das Ziel damit klar. Wie falsch ich doch lag! Unangenehm wurde es für mich auch deshalb, weil ich inzwischen einen schlechten Ruf hatte und nur noch schwer Freundinnen fand. Die anderen Mädchen waren neidisch auf mich, und gleichzeitig hatten sie Angst, ich könnte ihnen den Freund abspenstig machen. So komisch denken junge Frauen manchmal.
An die Gesichter meiner unartigen russischen Jungs kann ich mich nicht mehr erinnern, an die Schwänze, die ich im Interesse meiner weltlichen Ausbildung bediente, hingegen schon. Wenn ich daran denke, muss ich schmunzeln, so verderbt man das vielleicht auch finden mag. Ach, meine bösen Buben! Aber recht bald hatte ich sie satt mit ihrer Einfallslosigkeit, ihrer primitiven Sprache und der Grobschlächtigkeit, und ich sehnte mich nach bösen Kerlen.
Ich beschloss, die erstbeste Gelegenheit zu ergreifen und ins Ausland zu gehen.
Ohne Valja, die mir – wie zuvor Jungs – Männer hätte besorgen können, kam meine sexuelle Entdeckungstour erst einmal zum Erliegen, als ich St. Petersburg verließ.
Bis ich Chey traf.
Meinen ersten richtigen Liebhaber. Der Erste, der in mich eindrang und mich besaß.
Er war ein Mann, kein Junge wie die aus der Eisdiele. Er wusste etwas mit seinem Schwanz anzufangen, aber vor allem mit mir. Nach der Erfahrung mit ihm wurde ich egoistisch im Bett, und andere, weniger raffinierte Männer langweilten mich.
Die Beziehung zu Chey hatte mich geprägt, und die Spuren, die sie hinterließ, waren so dauerhaft wie die der winzigen rauchenden Pistole, die ich mir später wenige Zentimeter von der Scham entfernt in die Haut stechen ließ – an einer Stelle, die bei den meisten Frauen ein Geheimnis bleibt und nur die engsten Freunde und Geliebten kennen. Da ich mittlerweile Nackttänzerin geworden war, zeigte ich Cheys Pistole jedoch Abend für Abend einem ganzen Raum voller Menschen. Und ich sah, dass sie die Augen zusammenkniffen, dass ihre anfängliche Neugier und ihre Vermutung, es sei eine Blume, in Erschrecken umschlug, sobald sie erkannten, dass ich eine Waffe als Brandzeichen trug – zumal ihr Lauf auf die mächtigste Waffe überhaupt wies, auf meine Möse. Voller Begierde deuteten Männer und manchmal auch Frauen sie als Hinweis, dass ich zu haben war, eine leichte Beute, im Bett gefährlich oder auf Schmerz aus. Also ein böses Mädchen.
Aber das war ich nicht. Ich gehörte Chey.
Ich weiß noch genau, wie wir uns kennenlernten. Ich war neunzehn und ganz neu in New York.
Unterstützt von einer mir wohlgesonnenen älteren Lehrerin hatte ich mich im Jahr zuvor mit einem Video für ein Stipendium bei der School of American Ballet im Lincoln Center beworben.
Doch ich wurde abgelehnt.
Man nahm ein anderes Mädchen aus meinem Jahrgang. Sie stammte aus einem reichen Elternhaus, denn ihr Vater hatte während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs Ende der achtziger Jahre, als der Rest der russischen Bevölkerung oft hungern musste, für läppische Summen ganze Stahl- und Düngemittelfabriken aufgekauft und damit ein riesiges Vermögen gemacht.
Ihr Gesicht war ausdruckslos und ihre Beine streichholzdünn, sie besaß jedoch Anmut und eine außerordentliche Biegsamkeit und hatte die Juroren offenbar durch die erstaunliche Präzision ihrer Bewegungen von sich überzeugt.
Ich schrieb mir ihre Adresse auf, die ich später nach meiner Abschlussprüfung in meinem Visumantrag als Kontakt angab. Dank entfernter Verwandter meiner Tante in Amerika hatte ich zudem einen Bürgen. Man bewilligte mir einen dreimonatigen Aufenthalt zur Fortbildung – genügend Zeit, um mich einzuleben und als Kellnerin erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Als meine Aufenthaltsgenehmigung ablief, tauchte ich in Queens in einer stillen Seitenstraße von Ridgewood unter. In diesem Viertel lebten unzählige Menschen aus Osteuropa – Albaner, Ukrainer, Rumänen, alle auf der Suche nach einer besseren Zukunft in den Vereinigten Staaten –, die hier, auf fremder Erde und im Schatten von Hochhäusern, letztlich genauso lebten wie in ihrer Heimat.
Ich fand eine einigermaßen erschwingliche, allerdings auch recht erbärmliche Unterkunft unweit einer U-Bahnlinie, mit der ich rasch nach Manhattan kam, wo ich einen Job in einer Patisserie mit Kaffeeausschank in der Bleecker Street ergattert hatte. Sie gehörte einem Franzosen namens Jean-Michel, der sich gerade von seiner Frau getrennt hatte und den es nicht weiter störte, dass ich keine Aufenthaltsgenehmigung besaß, solange ich gut aussah und ausgesprochen achtsam mit seinen Törtchen und Kuchen umging. Er backte die besten Croissants und Petits Pains au chocolat von ganz Greenwich Village, aus einem leichten, lockeren Blätterteig, der auf der Zunge zerging und dessen Duft unwiderstehlich sämtliche Leckermäulchen anzog. Sie zu verkaufen, fiel mir nicht schwer. Da ich schon immer sehr geduldig war – vielleicht weil es mir an Ehrgeiz mangelte, weil die biologische Uhr für mich nicht tickte, weil mich niemand zur Eile antrieb oder Rechenschaft von mir forderte –, ließ ich dem Teig alle Zeit, die er brauchte, ehe ich ihn vorsichtig über einem Stück Butter ausrollte, ihn umdrehte, erneut ausrollte, zusammenfaltete und diese Prozedur dann ein ums andere Mal wiederholte, bis ich schließlich die süße Bitterschokolade darin einschlug. Anschließend backte ich das Ganze im Ofen, sodass der köstliche Duft von zwei Dutzend Petits Pains au chocolat den Laden erfüllte, und präsentierte sie dann auf einem Glasteller im Schaufenster. Dass Jean-Michels Hände gern einmal über meinen Körper wanderten, wenn er mich in seine ausgefeilte Kunst des Backens einwies, war nur eine kleine Unannehmlichkeit, solange ihm bewusst blieb, dass weiteres Vordringen nicht gestattet war.
Der Herbst neigte sich dem Ende zu, und erste Anzeichen des Winters kündigten sich an. Obwohl der Himmel noch blau und die Tage voller Licht waren, packten die New Yorker morgens Schal und Handschuhe in ihre Taschen, um für die kalten Abende gerüstet zu sein. Da ich viel tiefere Temperaturen gewöhnt war, genoss ich die kühle Luft, die über meine bloßen Arme strich, als ich den West Broadway hinunterging. Es war der erste Sonntag im November, und ich würde allein im Laden stehen, denn Jean-Michel nahm am New-York-City-Marathon teil. Er joggte durch die Straßen, weil er verzweifelt versuchte, die Pfunde wieder loszuwerden, die er unvermeidlich zugelegt hatte. Da er nicht mehr der Jüngste war und sich mittlerweile an die amerikanischen Portionen gewöhnt hatte, war sein Bauch ebenso aufgegangen wie der Teig seiner Croissants.
Als die Glocke an der Ladentür ertönte, fuhr ich erschreckt hoch. Beinahe hätte ich das Blech mit den bildschönen pastellfarbenen Makronen fallen lassen, denen ich den ganzen Vormittag gewidmet hatte – Eischnee mit gemahlenen Mandeln und Zucker vermengt und die süße Mandelmasse dann mit dem Spritzbeutel in möglichst ebenmäßigen runden Häufchen aufs Backpapier gesetzt. Sie mussten alle die gleiche Größe haben, damit sie nach dem Abkühlen mit einer Füllung aufeinandergeklebt werden und dann in mit Schleifen verzierte Schachteln gepackt werden konnten. Wir verkauften sie an junge Frauen, die sich nach ihrer Büroarbeit eine Belohnung gönnen wollten, oder an Ehemänner mit einem schlechten Gewissen, die auf ihrem Heimweg an keinem Blumenladen mehr vorbeikamen.
In meiner Hast, das Backblech wieder gerade zu halten, ehe die Makronen auf den Boden kullerten, verbrannte ich mir die Fingerspitzen und einen Streifen Haut auf der Handinnenfläche. Verärgert und gereizt eilte ich aus der Backstube in den Laden, um den Kunden zu bedienen.
Chey.
»Sie sollten die Stelle mit Eis kühlen«, sagte er, als er den feuerroten Streifen sah, den das heiße Backblech in meine Hand gebrannt hatte. Ich war zusammengezuckt, als er die Geldstücke für sein Schokocroissant und seinen Cappuccino statt in meine unbedacht ausgestreckte Hand auf den Verkaufstresen legte.
»Ja«, antwortete ich, weil mir nichts anderes einfiel.
Er machte einen lässigen Eindruck in seinem College-Sweatshirt, den Jeans und Turnschuhen. Sein zerzaustes strohblondes Haar schimmerte im Sonnenlicht, das durch das Schaufenster flutete. Er sah aus, als hätte er gerade einen Spaziergang durch den Central Park oder durch die wenigen Straßen gemacht, die nicht wegen des Marathons gesperrt waren.
Er wirkte durch und durch amerikanisch – bis auf die Augen, die mich scharf und zugleich kühl musterten, als er von meiner Hand aufsah. Sie waren blaugrau, von der Farbe des Meeres an einem wolkenverhangenen Tag, und passten irgendwie nicht recht zu seiner Erscheinung, ebenso wenig der Klang seiner Stimme. Er hatte keinen New Yorker Akzent, sondern einen, den ich nicht zuordnen konnte.
In seiner Freizeitkluft wirkte er wie verkleidet, als wäre er in der falschen Wohnung aufgewacht und hätte sich aus dem Kleiderschrank eines Fremden bedient.
Unwillkürlich erschauderte ich, als ich ihm sein Wechselgeld gab.
Er setzte sich auf einen der Hocker an dem Tresen vor dem Fenster und blätterte hastig in einem Buch, ohne wirklich darin zu lesen. Ich stellte mich zwischen Küche und Verkaufstheke, sodass er mich nicht sehen konnte, und beobachtete ihn, als er das Croissant in die linke Hand nahm, es in den mit Schokoladenpulver bestäubten Milchschaum stippte, wobei Krümelchen zurückblieben und am Rand der Tasse haften blieben.
Da die Hitze aus der Backstube den kleinen Laden aufgeheizt hatte, zog er sich kurze Zeit später das Sweatshirt über den Kopf. Dabei hatte er auch sein T-Shirt mit in der Hand und enthüllte kurz, ehe er es wieder herunterzog, einen gebräunten, muskulösen Rücken mit einer Tätowierung auf der rechten Seite. Sein kurzärmeliges T-Shirt saß ziemlich eng, sodass ich, als er die Tasse zum Mund führte, das Spiel seiner kräftigen Armmuskeln betrachten konnte.
Plötzlich drehte er sich zu mir um.
Und ich merkte, dass ich die Luft anhielt.
2 TANZ IM MONDLICHT
Erst eine Woche später sah ich ihn wieder. Diesmal trug er einen todschicken anthrazitfarbenen Businessanzug, und er kam zusammen mit einem anderen Mann. Sie setzten sich mit dem Rücken zu mir an denselben Fensterplatz, Chey und sein fetter, in einen beigefarbenen Blouson gezwängter Freund, der noch ein zweites Stück Torte und auch einen zweiten Cappuccino verlangte und mir ungeniert auf die Brüste glotzte, als ich ihm die Bestellung brachte.
»Bedienung«, hatte er gerufen und dabei mit den Fingern geschnippt, als könnte ich ihn übersehen, obwohl er nur wenige Meter entfernt saß und die beiden die einzigen Gäste im ganzen Laden waren.
Als ich ihm den Kaffee brachte, schnellte seine Hand ungeduldig zur Zuckerdose und stieß dabei gegen das Tablett, das ich gerade vor ihm abstellte. Die Tasse kippte um, und ihr brühend heißer Inhalt ergoss sich über meine weiße Bluse. Mit einem Aufschrei sprang ich zurück. Es gelang mir nur mit Mühe, Ruhe zu bewahren und die beiden nicht zu beschimpfen.
Der fette Kerl schnappte sich eine Serviette und machte Anstalten, meine Brüste abzutupfen, doch Chey stand rasch auf und zerrte ihn rabiat auf den Hocker zurück.
»Es reicht«, sagte er, woraufhin sein Begleiter kleinlaut in sich zusammensackte wie ein Ballon, aus dem schlagartig die Luft entweicht.
Er hatte russisch gesprochen.
Am nächsten Tag wurde im Laden ein Päckchen von Macy’s für mich abgegeben. Auf der beiliegenden Karte stand nur: Entschuldigung. Für Ihre Bluse.
Sie war aus reiner Seide, mit einem raffinierten Spitzenkragen, viel schöner und zweifellos sehr viel teurer als das zweckdienliche Stück, das jetzt Kaffeeflecken hatte. Der französische Konditoreibesitzer hob die Augenbraue, als ich das Päckchen neben meinen Mantel zu meiner Handtasche legte, und verkniff sich die Frage, ob ich es denn nicht zurückgehen lasse. Cheys Bekannter war grob gewesen, und ich war bereit, dieses Geschenk als Wiedergutmachung zu akzeptieren.
Eine Woche später wurde ich zwanzig, und Chey sollte mich zum Essen einladen.
Er kam nachmittags vorbei, um sich zu vergewissern, dass ich das Päckchen erhalten hatte. »Ich hoffe, die Bluse passt und ist ein angemessener Ersatz für die, die mein Freund ruiniert hat.«
»Oh. Ja, natürlich. Sie ist sehr schön, danke. Das wäre doch wirklich nicht nötig …«
»Gern geschehen«, erwiderte er.
Als er mir dann »Alles Gute« wünschte, stutzte ich. »Woher wissen Sie, dass ich Geburtstag habe?« Mein Tonfall war nicht gerade freundlich, denn das Letzte, was ich brauchen konnte, war ein Stalker – vor allem einen mit trampeligen Freunden –, auch wenn er sehr gut aussah.
»Das wusste ich nicht«, entgegnete er mit einem Lächeln. »Herzlichen Glückwunsch.«
Er war schon halb aus der Tür, als meine Neugier siegte und ich ihn in meiner Muttersprache fragte: »Sind Sie Russe?«
Er blieb abrupt stehen, was die Frage gewichtiger machte, als sie gemeint gewesen war, und ich fühlte mich wie eine Idiotin. Wie eine naseweise Idiotin noch dazu. Wo ich es doch so sehr hasste, wenn andere herumschnüffelten.
»Nein«, antwortete er auf Englisch. »Ich spreche nur ein paar Brocken. Arbeitsbedingt.«
»Schade«, sagte ich. »Manchmal sehne ich mich nach meiner Muttersprache.«
Er schien über etwas nachzudenken. Ich bedauerte bereits, einem Fremden gegenüber so offen gewesen zu sein. Da ich in New York keine Freunde hatte, war ich mittlerweile ausgehungert nach Gesellschaft. Und jetzt hatte ich mich vor diesem Mann lächerlich gemacht. Inständig hoffte ich, ein neuer Kunde käme herein und würde mich aus meiner Verlegenheit befreien, aber die Ladenglocke schwieg.
»Darf ich Sie zum Essen ausführen, Luba?«, fragte er nach einer ganzen Weile. Er hatte das Namensschild an meiner Schürze gelesen. »Ich kann zwar nicht russisch mit Ihnen sprechen, aber Sie wären einen Abend lang nicht allein. Ich weiß, wie es ist, wenn man neu in einer Stadt ist. Und immerhin haben Sie Geburtstag.«
Ich hatte schon gehört, dass die Amerikaner direkter waren als Menschen in anderen Teilen der Welt, doch Chey war das erste lebende Beispiel dafür. Nun, wenn mich ein gut aussehender, angenehmer Mann zum Essen einlud, sagte ich ohne triftigen Grund nicht Nein. Also nahm ich die Einladung an.