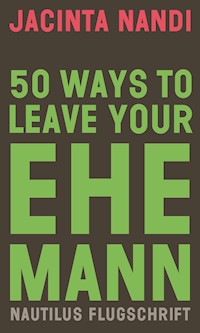
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Sie hat es getan: Die schlechteste Hausfrau der Welt hat ihren Mann verlassen und ist mit ihren beiden Kindern in eine eigene Wohnung gezogen – oder wie sie sagt: Sie wurde weggentrifiziert nach Lichtenrade. Obwohl sie wusste, auch als Alleinerziehende ist die Welt alles andere als in Ordnung. Das beginnt schon damit, dass es für ganz normale Mütter mit ganz normal wenig Geld verdammt schwer ist, ihren Mann zu verlassen. Und das ist kein Zufall, denn Frauen, Mütter, sollen nicht frei sein. Und wenn sie sich doch ihre Freiheit erkämpfen, sollen sie einen hohen Preis dafür bezahlen. Jacinta Nandi schreibt über Slutshaming und Mitleid, Rechtfertigungsdruck und Doppelstandards gegenüber Alleinerziehenden. Sie fragt, warum verheiratete Frauen so unsolidarisch tolle Kuchen backen und ob Single Moms by Choice die besseren Alleinerziehenden sind. Während Männer irgendwie immer gut genug sind, müssen Frauen nicht nur perfekte Partnerinnen und perfekte Mütter sein, sondern auch perfekte Opfer – wie der Fall Amber Heard deutlich gezeigt hat. Was muss sich verändern, damit keine Frau mehr gezwungen ist, in einer Beziehung zu bleiben, die sie nicht will? »Leave your Ehemann« – das muss viel einfacher werden! »Wie kann eine Autorin so viel Gegenwärtigkeit in ihren Büchern haben und dabei so trügerisch einfach schreiben? Lachen und Weinen und vor Lachen weinen sind eins bei Jacinta Nandi.« Mithu Sanyal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JACINTA NANDI wurde 1980 in London geboren und lebt seit 2000 in Berlin. Für die taz schrieb sie die Kolumne »Die gute Ausländerin«, außerdem publiziert sie regelmäßig im Missy Magazine und der Jungle World. Sie war Mitglied der Lesebühnen Rakete 2000 und Die Surfpoeten. Zuletzt erschienen von ihr die Bücher Die schlechteste Hausfrau der Welt (2020) und WTF Berlin – Expatsplaining the German Capital (Satyr 2022).
Einige Texte aus diesem Buch wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht:
»Care-Arbeit versus Liebe« im Missy Magazine;
»Dick pics und geklaute Armbanduhren« im Dummy Magazin;
»Sisyphus und die Hausarbeit« in der Anthologie Wenn die Sprache feiert. Philosophische Bühnentexte, Berlin: Satyr 2022;
»Divorce Barbie« bei Solomütter (online);
»Mitleid unerwünscht« bei Edition F (online);
»Gregor Gysi, bist du da?« bei Supernova (online);
»Vielleicht lasse ich mir die Eier einfrieren«
bei der Heinrich-Böll-Stiftung / Gunda Werner Institut (online)
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2021
Erstausgabe September 2022
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert
www.majabechert.de
Porträt der Autorin Seite 2:
© Andi Weiland
2. Auflage Oktober 2023
ISBN EPUB 978-3-96054-304-6
Inhalt
PROLOG, ODER: So, Freundchen, so geht das nicht weiter!
Meine Mama und ich zusammen im Frauenhaus
Sektflaschen und Pizzakartons
Divorce Barbie
Vielleicht bin ich einfach Müll?
Die unerträgliche Härte des Alleinerziehendseins
Isaac Newton war bestimmt kein Alleinerziehender
Unterhaltsvorschusskasse
Alleinerziehende Papas
Gregor Gysi, bist du da?
Der Bruder des Ehemanns
Erlernte Hilflosigkeit
»Vielleicht lasse ich mir die Eier einfrieren!«
Mitleid unerwünscht
Sein Geld
Lonely in Lichtenrade
CARE-ARBEIT versus Liebe
Alleinerziehend im Lockdown
Cat Ladies
Dick pics und geklaute Armbanduhren: das Einsamste, was man sich vorstellen kann
Geile Impfstoffmamas
Single Mom By Choice
#LeaveYourHusband
Almost Famous
Sogar Kim
Anni und die Tropical-Islands-Jahreskarte
THE BAR FOR MEN IS SO LOW, IT’S A TAVERN IN HADES
I Get You
Die Gemeinschaftspumpe
Drama Queen
Petzen
Schlechter Rat
Sisyphus und die Hausarbeit
Vatertag
Kindergeld
Catsitting
Crazy Ex-Husband
Amber Heard: 50 Ways to Leave Your Ehemann
And she said, »losing love Is like a window in your heart Everybody sees you’re blown apart Everybody sees the wind blow«
Nach dem Papa-Tag
Danksagung
PROLOG, ODER:So, Freundchen, so geht das nicht weiter!
»Ich habe dein Buch gelesen«, sagt mein Kumpel Nils. Nils ist so ein deutscher Kumpel, diese Art deutsche Kumpel, bei denen du eigentlich immer unsicher bist, ob ihr euch wirklich mögt. Kennt ihr die Art deutschen Kumpel, die ich meine? Er sagt viele Sachen, die mich nerven, und wahrscheinlich sage ich auch viele Sachen, die ihn nerven, und dann kommt er vorbei und repariert meine Waschmaschine oder verbindet Lampen im Flur oder hängt einen Spiegel auf, und mir fällt wieder ein, dass ich ihn eigentlich mag. Er hat auch einmal einen Nachbarn, der sich immer beschwert, dass der Kleine zu laut ist im Treppenhaus, so wütend angebrüllt, dass der Typ mich nie wieder angeschnauzt hat.
»Ach so«, sage ich.
»Ich habe das gar nicht verstanden!«, sagt er. »Das war so, als ob ich ein Buch über ein anderes Universum lese. Eine völlig andere Welt. Eine Parallelwelt.«
»Ach so«, sage ich.
»Warum hast du dem Kerl nicht gesagt: So, Freundchen, so geht das nicht weiter. Na klar, du verdienst fette Kohle und ich bin eine freischaffende Künstlerin, aber das Kind gehört uns beiden und wenn wir beide zu Hause sind, machen wir 50/50. Wir stehen beide auf, wenn das Kind wach ist, und dann ackern wir, bis er groß ist. Und ich schäme mich für dich, Freundchen, dass das nicht selbstverständlich ist, aber egal, du weißt, wo der Wischmopp ist.«
Nils hat dieses Berlinerisch drauf, wo man merkt, er ist nicht wirklich Arbeiterklasse. Nur ein bisschen. Er klingt wie ein Chef, der nie erlebt hat, dass jemand nicht machen wollte, was er ihm sagte. Oder wie ein Anwalt, aber für richtige Drogenclans. Oder ein Hausmeister, aber ein sehr glücklicher, der eine Datsche besitzt.
»Ach soooooooo …«, sage ich, voll unsicher. »Denkst du echt, dass das gutgegangen wäre, wenn ich so was gesagt hätte?«
»Na klar. Es hätte ihm nicht gefallen, aber du hättest ihm eine Chance gegeben. Traurig für den Kleinen, wa, dass du dieses Gespräch nicht gesucht hast? Das ist die traurige Realität!«
In meinem autobiografischen Sachbuch von 2020, Die schlechteste Hausfrau der Welt, ging es mir darum zu verstehen, warum die Hausarbeit so schwer ist – und vor allem darum zu beantworten, warum cis Männer ihre Partnerinnen nicht so gerne unterstützen wollen. Ich fragte: Wie kann es sein, dass ich, die alles macht, die schlechte Hausfrau bin, und er, der nichts macht, ist angeblich total ordentlich und pingelig?
Und die Wahrheit ist: Ich habe meinem Ex schon gesagt, ab und zu, dass ich nicht verstehe, wie derjenige, der ausschläft bis 11 oder 12 oder 13 Uhr, sauer sein kann, weil diejenige, die um 7 oder 8 oder sogar 6 Uhr aufsteht, alles gemacht hat, aber nicht ordentlich genug. Aber vielleicht habe ich dabei das Wort »Freundchen« nicht benutzt. Das stimmt. Vielleicht hätte ich mich nur besser ausdrücken sollen.
Ich frage mich, ob das wirklich sein kann, was Nils behauptet. Kann es wirklich sein, dass das besser gegangen wäre? Ich versuchte, alles zu schaffen, und mein Ex versuchte auszuschlafen. Und er war sauer genug bei dieser Arbeitsteilung. Kann es wirklich, wirklich sein, dass er zufriedener und fleißiger gewesen wäre, wenn er weniger Schlaf bekommen hätte und mehr hätte putzen müssen, oder sogar vor Mittag auf dem Spielplatz sein? Das eine Mal, als er doch vormittags zum Spielplatz gehen sollte – weil ich in Ruhe kochen wollte –, war er so sauer, dass er die Badezimmertür richtig hart zugeknallt hat. Ich glaube nicht, dass »Freundchen« so ein magisches Wort ist, das meinen Ex sehen lässt, dass wir beide, ich und er, im selben Boot sitzen, dass wir beide, er und ich, dieses Kind zusammen großziehen sollten, dass Kindererziehung und Haushalt zu viel Arbeit sind für eine Person, ganz alleine, ohne zu zerbrechen.
Und ehrlich gesagt: Ich denke, man sollte vorsichtig sein, wenn man Frauen solche Tipps gibt – und viel weniger vorsichtig, wenn es darum geht, ihren faulen Partnern Tipps zu Care-Arbeit und »Mithelfen« zu geben.
Aber wollt ihr die Wahrheit wissen? So traurig ist die Realität für meine Söhne nicht. Klar, der Kleine leidet unter der Trennung. Man muss nicht Kristina Schröder sein, um das zu erkennen.
»Wo sollen wir hin, zum Micky-Maus-Spielplatz oder zum Gemüsebeet-Spielplatz?«
»Daddys Haus?«
»Du gehst zu Daddys Haus am Wochenende, ne?«
»Ja, aber heute zusammen. Ich und du und Ryan und alle Sachen. In Daddys Haus wieder.«
»Ist es nicht gut, dass du jetzt dein eigenes Zimmer hast?«
»Nein, nein. Es ist gut, wenn du und Ryan da seid, und ich und Daddy, und alle zusammen.« Er guckt mich so an, als ob ich nicht verstanden hätte, was er sagen möchte. »Alle zusammen IN EINEM HAUS!«, erklärt er vorsichtig, als ob ich nur ein bisschen schwer verstehe.
»Ja, Baby. Ich weiß. Es tut mir leid, dass es nicht so ist.«
Traurig, traurig, traurig – aber es ist auch eine Freude, das Leben mit den Jungs. Das Leben ohne Mann. Sogar in Pandemiezeiten blickt die Freude rein in unser Leben wie die Sonne durch ein schmutziges Fenster. Ein Leben ohne Mann ist manchmal einsam, trotz der Kinder. Aber es ist ein Leben voller Freude – es ist eine Freude, dein Leben mit diesen Menschen zu teilen, ohne einen Mann dabei. Der immer, würde ich fast behaupten, sogar wenn er sehr, sehr nett ist, denkt, dass er der Mittelpunkt der Familie sein sollte. Manchmal denke ich, dass die Alleinerziehenden deswegen so bestraft werden sollen durch den Staat, weil das Leben allein eigentlich an sich sehr schön ist. Die ganze Freude, der ganze Genuss – ohne den Druck. Ohne die Unterdrückung.
Nils geht nach Hause und Ryan steckt den Kopf aus seinem Kinderzimmer. Na ja. Teeniezimmer.
»Ich will euch was zeigen!«, sagt er.
»Ich habe einen New York Cheesecake gekauft, in genau drei Minuten ist er offiziell aufgetaut«, sage ich.
Ryan macht an meinem Rechner einen Popsong aus Russland aus den 90er Jahren an – er hat so ein Russlandding im Moment –, und Leo fängt an, uns »eine neue Art von Tanz« zu zeigen. Diese neue Art von Tanz ist echt interessant, er dreht die Arme wild wie Räder und joggt auf der Stelle, dann hört er plötzlich auf und zeigt auf uns, Hip-Hop-Style. »So eine coole neue Tanzform!«, schwärmt Ryan. Zu mir flüstert er: »Er darf nie rausfinden, wie bescheuert er aussieht.«
Ryan tanzt auch und füttert mich ab und zu mit Cheesecake. Leo sagt: »Ich will auch Donut.« Irgendwie denkt er, dass alle Kuchen eine Art Donut sind.
Die Pandemie war (ist?) hart, und viele Alleinerziehende, besonders die, die keine Familie in der Nähe haben, waren viel zu viel allein. Es war manchmal gar nicht klar, ob die Überlebensstrategien dieser Frauen und ihrer Kinder überhaupt legal waren. Babysittingtauschgruppen? Sleepovers? Was war erlaubt und was war verboten? (Es wäre auch geil gewesen, wenn die in der Regierung, statt Krokodilstränen über die schwierige Situation der Alleinerziehenden zu vergießen, diese als Erstes berücksichtigt hätten – zum Beispiel support bubbles erlaubt oder Sonderregelungen festgelegt hätten.)
Aber die alleinerziehende Mutter, obwohl oft überstrapaziert, oft verarmt, viel zu oft müde oder sogar erschöpft, ist nicht so einsam wie die Hausfrau, die mit einem cis Mann zusammenlebt, der sie nicht schätzt und nie hilft. Ich denke oft, dass es sogar ein paar cis Männer gibt, die ihre Frauen dafür hassen, dass sie sie unterdrücken. Und diesen Frauen wird oft erzählt, dass sie sich unterdrücken lassen. Und dass sie sich nicht unterdrücken lassen sollen! Mit einfachen Ratschlägen wie Nils’ (»So, Freundchen, so geht das nicht weiter!«) wird die Verantwortung für die Situation den Opfern und nicht den Tätern gegeben.
Ich bin auch der Meinung, dass man viel kommunizieren muss in einer Partnerschaft, und dass man viel lernen kann über diese Kommunikation. Und trotzdem denke ich, dass es für viele, viele Frauen am einfachsten ist, der Unterdrückung zu entkommen, indem sie weggehen. Weggehen ist die einfachste Lösung. Abhauen, weggehen, Männer verlassen. Deinen Mann verlassen. LEAVE YOUR HUSBAND: Dieser Weg wird kein leichter sein – dieser Weg wird absichtlich härter gemacht von der Gesellschaft, vom Gesetzgeber –, aber diesen Weg gibt’s. LEAVE YOUR HUSBAND, GIRLS. There’s 50 ways to leave your Ehemann!
In diesem Buch will ich euch, meine Leser*innen, mit der Freude und den Problemen der Alleinerziehenden in Deutschland konfrontieren. Dem Mitleid, das sie erfahren, statt Solidarität. Und die klaren Lösungen vorstellen, die gefunden werden könnten, um ihre Lebensrealität – und die ihrer Kinder – zu verbessern.
Meine Mama und ich zusammen im Frauenhaus
Meine Mama ist im Mai 2021 gestorben. Ich hatte sie lange nicht gesehen, wegen der Pandemie. Sie starb zweimal, eigentlich, in der zweiten Nacht, nachdem ich zu Hause in England ankam, starb sie vor unseren Augen, langsam, aber auch schnell. In der ersten Nacht, nachdem ich angekommen war, hatten wir sie zwei Stunden lang versucht zu wecken – und ich glaube, wenn wir sie gelassen hätten, wäre sie im Schlaf gestorben.
Meine Mama hatte zehn Jahre lang Multiple Sklerose und im Herbst 2020 Covid. Nach ihrer Coronainfektion wurde sie nie wieder ganz gesund, aber sie war auch vorher nicht besonders gesund. Aber nach Covid konnte sie nicht mehr lächeln, nicht mehr essen und kaum noch sprechen.
Die Frau, die meine Mama bis zum Tod pflegte, war früher mein Stiefpapa. Ich weiß, dass ich es so nicht ausdrücken soll, aber ich weiß nicht, wie man das sonst erklären soll. Meine Eltern wurden irgendwann, 2010 glaube ich, geschieden, meine Mama wurde immer kränker und kränker, meine Tante Daphne (so nennen wir sie jetzt) kam sie jeden Tag besuchen, um sie zu pflegen: ihr mit der Toilette zu helfen, Tee zu geben, sie zu füttern, zu duschen, anzuziehen. Meine Mama wurde kränker und kränker, auch vor Corona.
An dem Tag, an dem meine Mama gestorben ist, waren wir bei ihr. Meine Tante, mein kleiner Sohn Leo und ich. Meine Mama hatte mir tagsüber gesagt, dass sie Angst vor dem Tod hatte, und ich, die kleine Narzisstin, die ich bin, bezog das alles auf mich.
»Du musst keine Angst haben, Mama«, sagte ich. »Ich bin nicht mehr süchtig nach Psychopathen. Ich werde mich ab jetzt nur noch in nette Männer verlieben, und mit dem Schreiben und so wirklich erfolgreich werden.«
Sie sagte: »OKAY!«, so laut, wie sie nur konnte. Jeder Satz, jedes Wort, war für sie anstrengend. Meinen großen Sohn Ryan hatte ich, obwohl er erst sechzehn Jahre alt war, ein paar Wochen alleine zuhause gelassen, in Deutschland. Die Waschmaschine war kaputt. Einer der letzten Sätze, die meine Mama sagte, war: »Ryan, Waschmaschine okay?« Ich wusste, sie wollte noch Oma sein, wollte uns noch beschützen. Ich log sie an und sagte, dass mein Kumpel Nils vorbeikommen wollte, um die Waschmaschine zu reparieren.
Und dann starb sie, abends. Sie war wach, aber auch nicht wach, Augen aus Glas, klein, ihr Gesicht kleiner denn je. Es war so, als ob sie Schluckauf hatte, sie japste nach Luft, und das Leben hat ihren Körper verlassen.
Und dann waren wir da, mit einer Leiche, und wir mussten uns um Sachen kümmern. Meine Tante, die immer da gewesen war, war plötzlich für die Behörden super unwichtig. War niemand. Wegen der Scheidung.
»Sind Sie ihre Schwester?«, fragte die Krankenhausdame taktvoll. »Was war Ihr Verhältnis?«
»Ich bin ihre Ex«, sagte meine Tante.
»Und Sie sind ihre …«
Meine Mama ist so weiß gewesen, und ich bin doch ziemlich dunkel, ich musste helfen.
»Die Tochter«, sagte ich. »Ich bin ihre Tochter.«
»Ach, dann sind Sie zuständig! Sie müssen die Urkunden unterschreiben!«
Es kam mir wie Betrug vor – ich fühlte mich wie eine Hochstaplerin, als ich unterschrieb und unterschrieb, wichtiger als meine Tante, näher an meiner Mama, die ich so lange nicht gesehen hatte, seit 2019 nicht, mit der ich so lange nicht zusammengelebt hatte, seit 1998. Meine Tante wusste alles über meine Mama, wie sie ihren Tee trank – »nicht so viel Milch, Cint!« –, welchen Joghurt man am besten nahm, wenn man versuchen wollte, dass sie doch ein paar Tropfen Nahrung zu sich nahm, bei welchen Radiosendungen man die Lautstärke hochdrehen sollte und schweigen musste, und bei welchen man einfach weiterredet. Und plötzlich war meine Tante niemand, und ich die nächste Verwandte.
Sie waren nett zu mir, die britischen Beamt*innen. Ich hatte mich, merkte ich, an Deutschland gewöhnt, an Beamt*innen aus Eis, nee, Stein, nee, Stahl. Wie ihre Gesichter dichtmachen, wie ihre Augen leer werden, ihr Mund zugemauert. »Sorry, so wird das nicht gemacht!« »Das geht nicht!« »So wird es aber gemacht, da kann ich leider nichts tun!« Die britischen Beamten waren mir fast suspekt mit ihrer Flexibilität. »WAS!«, riefen sie, voller Mitleid, »Ihr Sohn ist alleine in Deutschland? Wie alt ist er? Erst sechzehn? Ach du meine Güte, dann müssen wir eine Ausnahme machen!« Und sie organisierten alles, so dass wir schneller an die Sterbeurkunde kamen, trotz Regeln, trotz Corona. Eine Beamtin erzählte mir, sie glaubte, dass das, was sie tat, vielleicht illegal wäre, »aber was soll’s, wir müssen das anders klären, sonst kommen Sie nicht zu Ihrem Sohn zurück!«.
Ich ging, um die Sterbeurkunde meiner Mutter abzuholen, in ihrer Kleidung. Im Leben war sie immer sauer, wenn ich was von ihr ausleihen wollte, sie hat mir verboten, ihre »guten Sachen« zu nehmen – »ich bin behindert, aber ich werde trotzdem auf Partys eingeladen!«. Nach ihrem Tod bin ich ihre Hosen durchgegangen, ich weiß nicht warum. Und ich ging ihre Sterbeurkunde abholen in einer orangefarbenen Cordhose und rosafarbenen Strickjacke, und ich wusste, dass ich komisch aussah.
Auf ihrem Totenschein stand »Fortgeschrittene MS« und »Demenz«, aber ist sie daran wirklich gestorben? Ich stand vor dem Rathaus in Ilford und starrte die Dokumente an, die waren genauso fake, wie wenn sie von einer Hochstaplerin gefälscht worden wären. Ich denke, meine Mama ist an Long Covid gestorben, oder vielleicht ist sie einfach verhungert. Ich weiß es nicht. Ich denke, wir werden das niemals rausfinden, warum genau sie gestorben ist.
Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich 2004/2005 sechs Monate im Frauenhaus war. Ich gehe in meinem Privatleben ziemlich offen damit um, erwähne es auch ab und zu in Texten. Manchmal sagen mir deutsche Männer, die mich kennen, dass sie es komisch finden, dass sie nicht verstehen können, dass ich im Frauenhaus gewesen bin, und ich tue dann immer so, als ob ich nicht wüsste, was sie damit meinen. Aber ja, von Oktober 2004 bis März 2005 war ich im Frauenhaus, einem Frauenhaus in West-Berlin (damals sagten wir noch West-Berlin), mit meinem kleinen Sohn Ryan, der damals ein Säugling war.
Ich rede viel darüber, mit Freund*innen, aber auch mit Bekannten, und ich habe ziemlich viel darüber geschrieben.
Aber ich merke jetzt auch, dass ich irgendwie auch viel darüber geschwiegen habe.
Eine Sache erwähne ich nämlich kaum: dass meine Mutter mit mir dort war. Nur eine Woche. Aber sie war da. Ich weiß nicht, warum ich das so selten erwähne. Ich denke, dass es mir vielleicht peinlich ist. Meine Mama war sehr beliebt bei den anderen Frauen, bei den Bewohnerinnen, und weniger beliebt bei den Sozialarbeiterinnen: Sie war sehr entsetzt, dass es keine Rampe für Kinderwagen gab, und es wurde ihr in dieser Woche nicht langweilig, das zu sagen. Aber bei den Frauen, besonders denen in ihrem Alter, war sie trotz Sprachbarriere beliebt. Einmal kam ich rein in die große Küche, meine Mama war schon wach und am Tisch, ich hörte, wie sie einer deutschen Frau erzählte: My man is a good man, he doesn’t hit, he doesn’t drink.
Die hässliche Wahrheit ist, vielleicht, dass dies ein bisschen Fantasie war, wenn ich jetzt zurückgucke, auf meine Mama und ihre Männer.
Meine Mama hatte zwei Männer: meinen Papa, und dann meinen Stiefvater, der jetzt kein Mann mehr ist. Aber für meine Mama war diese Person, die sie liebt, ein Mann. Sie liebte ihn, wie eine Frau einen Mann liebt. Ich glaube, sie liebte Daphne auch – aber mehr wie eine Frau ihre Schwester liebt. (Und manchmal hasste sie Daphne, wie eine Frau ihre Schwägerin hasst.) Ich denke, wegen der Liebe, die meine Mama für meinen Stiefpapa als Mann empfand, ist es schwer, darüber zu sprechen, ohne manchmal diskriminierend Daphne gegenüber zu klingen.
Meine Mama war sehr jung, als sie meinen Vater heiratete – erst neunzehn Jahre alt, so alt, wie sie oft sagte, wie Diana, als sie Charles heiratete.
Sie war auch sehr jung, als sie meinen Stiefpapa kennenlernte. Mein Stiefpapa war damals der beste Freund meines Vaters, ein Familienfreund, könnte man sagen.
Diese Person, dieser Familienfreund, wurde später mein Stiefvater, aber nicht nur das, auch der leibliche Vater meiner Geschwister. Wir waren alle erwachsen, als sie entschieden hat, sie wollte Tante Daphne genannt werden. Sie wollte nicht Mama genannt werden, nie. Sie wollte dieses Wort für meine Mama lassen. Vielleicht hängt meine Schwierigkeit, über meine Kindheit zu reden, ohne diskriminierend zu werden, doch mit der Vaterrolle zusammen. Mit der Wichtigkeit des Vaters. Hier ist dein Stuhl, hier ist dein Platz, hier kommt deine Sendung im Fernsehen. In unserer Kindheit war meine Mama die Mama und mein Stiefpapa der Vater, so wie bei den Bären in dem berühmten Märchen. Der Stiefpapa kriegte von allem das Größte, den größten Teller, die größten Portionen.
Ich habe eine Freundin, die viel woker als ich ist, und die sagt: »So schade, dass deine Mama Daphne als Frau nicht akzeptieren konnte. Man verliebt sich in den Menschen, nicht ins Geschlecht.« Das Problem ist, glaube ich, dass meine Mama sich in das Geschlecht meines Stiefpapas verliebt hat. Für sie war ihr Partner ein Mann, und nicht nur ein Mann, sondern der intelligenteste, sexyste, interessanteste Mann der Welt. Und meine Mama liebte meinen Stiefvater, wie eine Frau einen Mann im Patriarchat lieben soll. Als sie neu zusammengekommen waren, hat mein Stiefpapa ihr gesagt, er mag Miniröcke, keine langen Röcke, und meine Mama saß abends an der Nähmaschine und hat alle ihre Röcke gekürzt.
Wie kam es aber dazu, dass meine Mama mit mir im Frauenhaus war?
Meine Mama war erst 47 Jahre alt, als Ryan geboren wurde. Objektiv betrachtet muss ich zugeben, dass es ein großer Fehler war, so früh Mutter zu werden – jedoch freue ich mich, dass ich meiner Mama dieses Oma-Erlebnis schenken konnte. Wenn ich mein Leben besser im Griff hätte, wäre sie nie, oder kaum, eine richtige Oma gewesen. Als mein jüngstes Kind geboren wurde, war sie schon so krank, dass sie nur im Bett lag, sie konnte mit ihm nicht diese Oma-Dinge machen: für ihn kochen, ihm eine Badewanne einlaufen lassen, mit ihm zum Park gehen. (Traurigerweise erinnert sich Ryan gar nicht daran, dass er mit der Oma diese Dinge gemacht hat, aber irgendwie ist das auch ein bisschen egal.)
Meine Mutter war auch nicht sauer, damals, als ich ihr gesagt habe, dass ich schwanger bin. Mit 23 Jahren, am Telefon aus einer Einzimmerwohnung in Schöneberg ohne Dusche, Klo im Treppenhaus, nur Ofenheizung. Sie hätte wahrscheinlich sauer sein dürfen, oder vielleicht sogar sauer sein sollen, aber sie hat sich nur gefreut. NUR gefreut. Nicht wie mein leiblicher Papa, der einen ganzen Tag lang enttäuscht war.
»Dann war deine Uni total umsonst«, sagte er vorwurfsvoll und legte auf. Er rief am nächsten Tag zurück – er hatte es verdaut. Sagte jetzt, er wäre »over the moon«. Er hatte nur ein bisschen Zeit gebraucht. Diese Zeit brauchte meine Mama gar nicht. Sie rief am nächsten Tag auch zurück und kündigte schon an, dass sie die »Nanna« sein wollte, und dass es ihr egal sei, wie Doris, die zweite Ehefrau meines Vaters, genannt werden wolle, aber auf jeden Fall nicht »Nanna«. Sie schlug Granny vor – »Granny Doris ist gut genug für sie«, sagte sie hämisch. »Ich bin die echte Nanna.«
Und ich blicke zurück auf alles – diese viel zu frühe Mutterschaft, die Schwangerschaft, die in einer Abtreibung hätte enden sollen, das Baby, das nicht geboren werden musste – und ich kann es nicht so richtig bereuen, diesen ganz objektiv betrachtet größten Fehler meines Lebens. Ich wusste nicht, als ich entschied, doch nicht abzutreiben, dass meine Mama relativ früh sterben würde. Ich ahnte es gar nicht, obwohl sie schon humpelte. Aber irgendwie gucke ich zurück und bereue das alles nicht, nicht nur.
Ich habe mal gelesen, dass man erst mit 34 Jahren ein Kind bekommen soll, wenn man den Planeten retten will. Ich wollte den Planeten retten, ich will die Erde retten, aber ich empfinde es so, dass der frühe Tod meiner Mutter die chaotische Entscheidung in meinen Zwanzigern, nicht abzutreiben, rechtfertigt.
Ich stand vor dem Rathaus in Ilford, in dieser Stadt, die alle hassen, ich stand da und starrte die Sterbeurkunde meiner Mama an. Ich trug die Kleidung meiner Mama, ich war die nächste Verwandte, ich kam mir wie eine Betrügerin vor. Auf der Sterbeurkunde stand, dass meine Mama Lehrerin war. Das war passiert, weil meine Tante plötzlich niemand mehr war, es wäre ihr Job gewesen zu sagen, was die Arbeit meiner Mama war. Die Wahrheit ist, sie war immer Hausfrau, und jahrelang krank, aber bevor sie krank wurde, war ihre letzte Stelle Englischlehrerin an einer privaten internationalen Schule. Es war ein bisschen eine Lüge, es war ein bisschen Fantasie. Und ich dachte, dass es gut war, dass ich Ryan bekommen und dieses leere Leben dieser kranken Frau mit Liebe und Freude gefüllt hatte. Vielleicht war das arrogant von mir. Wahrscheinlich sogar.
Meine Mama und ich, zusammen, im Frauenhaus in West-Berlin.
Wie kam es dazu, dass sie mit mir da war?
Ich erzähle diese Geschichte kompliziert, aber deswegen, weil sie eine komplizierte Geschichte ist. Es gibt keine klare Linie, hier 1955, meine Mama geboren, hier 1980, ich, hier 2004, Frauenhaus. Sondern Schichten und Schichten, wie Algen im Teich. Ich habe das Gefühl, dass es in jedem Satz, den ich über meine Mutter schreibe, Schichten und Schichten und Schichten von Geschichte gibt. Hier ist meine Mutter als Kind, hier ist meine Mutter als junge Erwachsene, hier bin ich. Hier ist meine tote Mama. Alle zusammen, alle gleichzeitig, wie Bakterien in einem Tropfen Teichwasser.
Oder vielleicht komme ich mir vor wie Hercule Poirot, wenn er versucht, Morde, die vor achtzehn Jahren passiert sind, noch mal zu untersuchen. Ich will etwas rausfinden, aber die Geschichten schwimmen zusammen, ich kann sie nicht voneinander trennen.
Ich war jung, als Ryan geboren wurde – erst 24 Jahre alt –, aber meine Mama war auch jung – erst 47! Okay, ein paar Tage später wurde sie 48, aber trotzdem, es kommt mir jetzt wahnsinnig vor: noch nicht 50, und schon Oma.
Sie humpelte schon, und wir wussten noch nicht, dass es deswegen war, weil sie MS hatte.
Mein Sohn Ryan ist im Urban-Krankenhaus geboren, ein Krankenhaus, das viel Wert aufs Stillen legte – und nicht so viel auf Menschlichkeit jungen Mamas gegenüber, vielleicht. Ryan wurde mit Kaiserschnitt geboren, nach 24 Stunden Wehen – ich dachte jahrelang, dass es sich um einen Notkaiserschnitt handelte, fand aber irgendwann raus, dass es doch nur ein Last-Minute-Wunschkaiserschnitt gewesen ist. Ryan wollte nicht gestillt werden – angeblich wollen das Kaiserschnittbabys oft nicht –, er schrie frustriert meine Brust an. Und die Krankenschwestern waren ziemlich ungeduldig und herzlos mit mir. Einmal, als es doch klappte, sagte ich zu einer, erleichtert, zufrieden: »Scheint so, als ob es doch klappt!« Sie schnaubte mich an, fast wütend: »In zwei Tagen gehen Sie nach Hause, und ich weiß nicht, wie er satt werden soll.«
An eine nette Krankenschwester erinnere ich mich noch: jung, hübsch, blass, ernst. Sie sagte einmal zu Ryans Vater: »Merken Sie gar nicht, dass Ihre Frau das schon hinkriegt, wenn Sie sie in Ruhe lassen?«
Dann ging er beleidigt weg, und es klappte auch diesmal mit dem Stillen.
Wir kamen an einem Samstag nach Hause, im Taxi, und das Stillen, das doch irgendwie immer besser und besser klappte, war immer noch ein Thema für uns. Es war schwer, Ryan anzulegen, ich machte mir Sorgen, dass ich nicht genug Milch produzierte. Einmal saß ich auf dem Boden, und Ryan trank, und ich spürte diese körperliche Erleichterung, diese körperliehe, fast sinnliche Befreiung, die du spürst, wenn deine Nippel, hart und heiß, plötzlich nachgeben, und dein Kind, hungrig und weich, richtig saugt. Ich atmete aus und sagte zu Ryans Papa:
»Siehst du? Es klappt.«
Er runzelte die Stirn und sagte: »Für mich sieht das nicht richtig aus!«
Ich: »Was meinst du?«
Er: »Der Winkel ist falsch. Das ist nicht so, wie die Hebamme es dir gezeigt hat.«
Jetzt sagte ich leise: »Geh weg, Paul.«
Er sagte: »Lass mich ein Foto für die Hebamme machen, die kann dir sagen, ob der Winkel richtig ist.«
Nachher, als Baby Ryan schlief, sagte er: »Das ist das Einzige, was ich dir nicht abnehmen kann, und du kriegst es nicht gebacken.«
Ich erinnere mich so genau an den Satz wegen dem Wort »gebacken«. Es war das erste Mal, dass ich es in diesem Kontext hörte.
Was ich nicht verstehen konnte: Angeblich war es ganz, ganz schlimm, dass ich nicht »gut genug« stillte – aber mit künstlicher Milch zu ergänzen ging auch nicht. Die Hebamme und Paul waren sich einig, dass das gar nicht ginge. Also sollte ich weitermachen, aber besser.
Ach so: mir Sachen abnehmen. Na ja. Ryans Papa arbeitete hart, er war verzweifelt, er war immer am Arbeiten in diesen Wochen nach der Geburt. Aber was nahm er mir wirklich ab? Ich weiß nicht, ob er mir wirklich was abnahm. Ich war in dieser Zeit immer unsicher, warum Ryan per Kaiserschnitt geboren werden musste – und ich erinnere mich immer daran, wie unsere Hebamme mir nach der Geburt seine lilafarbene Stirn zeigte, die so Markierungen wie eine Treppe hatte. Er sah aus wie diese Menschen aus Star Trek, mit den komischen Stirnen, die Klingonen. Und sie flüsterte mir zu: »Er hat so hart gearbeitet, der Kleine, aber er ging in die falsche Richtung.«
Und genauso war Ryans Papa: Paul war immer am Arbeiten, aber nicht am Helfen. Putzen, kochen, Tee kochen, Formulare ausfüllen, Geld verdienen? Nee. Er war ein fürsorglicher Vater, aber auch ein nutzloser, fauler Partner. Ich frage mich, was er über mich und diese Wochen sagen würde.
Er dachte, oder er sagte, dass er dachte, dass ich Ryan töten wollte. »Ich habe es in deinen Augen gesehen, dass du ihn töten willst!«, sagte er. Ich kriegte ein bisschen Angst bei dieser Aussage, aber ich glaubte nicht daran, nicht für eine Sekunde. Er dachte auch, dass ich lügen würde – ich hatte eine Ratte im Restmüll gesehen, und er schrie mich stundenlang an, bis ich »zugab«, dass ich gelogen hätte. Seine Regeln wurden strenger und strenger – und stranger und stranger. Manche Teller waren böse, alle Bilder mussten abgehängt werden. Mein Papa sollte uns nicht besuchen. Wir mussten den Wasserkocher wegschmeißen.
Die Hebamme war eine normale, fast langweilige Frau, und ich sehe es als ein Zeichen dafür, dass auch normale, langweilige Deutsche ein bisschen spinnen, denn sie empfand Pauls Ängste und Panik als normal. Paul und die Hebamme waren dicke Freunde – sie genoss es, dass er ihren Rat so ernst nahm. Ich durfte keinen Wasserkocher mehr haben, aber als sie sagte, dass man den Popo des Babys mit einem Fön trocknen sollte nach dem Baden, ging Paul raus und kaufte einen. Denn was die Hebamme sagte, war Gesetz. Ich glaube, in dieser Hinsicht war Paul einfach sehr, sehr deutsch.
Als Ryan ein paar Wochen alt war, kam meine Mama zu Besuch. Paul wollte das nicht, aber ich bestand darauf. Viele Leute – deutsche Verwandte von Paul und auch britische Verwandte von mir – sagten nachher, dass ich, wenn sie nicht gekommen wäre, Ryans Papa nie verlassen hätte.
Eine lange Zeit verstand ich das als Beleidigung für sie
… die schwierige Schwiegermama
… das Schwiegermonster
… meddling woman!
Aber seitdem sie tot ist, ist es für mich ein Kompliment geworden.
Ich hatte aber Angst vor Mamas Besuch. Ich dachte, sie würde sich mit Paul streiten, es würde vielleicht einen Machtkampf geben. Aber dieser Machtkampf blieb zuerst aus. Meine Mama war viel entsetzter über die Hebamme als über Paul. Als die Hebamme mir und meiner Mama sagte, ich müsste meinen Teekonsum auf ein bis zwei Tassen pro Tag reduzieren, japste meine Mama nach Luft.
»SHE’S BREASTFEEDING!«, sagte sie. »SIE MUSS MEHR TRINKEN, NICHT WENIGER!«
Die Hebamme erklärte ihr, dass es andere Tees gibt als schwarze, eine Info, die, glaube ich, bei meiner Mama irgendwie nie angekommen ist.
In Großbritannien ist die Hebamme, the midwife, nur bei der Geburt da, hinterher schickt das Bezirksamt so eine medizinische Expertin vorbei, eine Art medizinische Sozialarbeiterin, the health visitor.
Meine Mama hat nie so richtig realisiert, dass Jutta eine Hebamme und kein health visitor gewesen ist.
»It’s good the health visitors come over so often«, sagte sie. »But in England the health visitors MAKE you a cup of tea if you’re breastfeeding, and in Germany they tell you to drink water like you’re a prisoner in the Bastille or something!«
Über die Wassertemperatur in der Badewanne haben sie auch gestritten – die Wassertemperatur, die Jutta als geeignet empfahl, war für meine Mama viel zu hoch, außerdem fand sie, man sollte mit dem Ellenbogen und nicht mit einem Thermometer messen.
Es gab, soweit ich mich erinnere, nie einen tatsächlichen Streit zwischen meiner Mama und Ryans Papa. Paul. Nicht so wirklich. Die erste Woche verlief total friedlich, sie kam, sie kochte, sie putzte, ich stillte, Paul arbeitete wieder für die Uni. Alles in Butter.
Aber meine Mama hatte schon MS, nur wussten wir es nicht, sie wusste es nicht, die Ärzte wussten es nicht. Im Sommer bevor Ryan geboren wurde, war sie im Badezimmer hingefallen und ihre Kopfhaut musste genäht werden. Deswegen war sie sehr stur und sehr überzeugt davon, dass wir im Badezimmer eine Matte auf dem Boden brauchten und einen Handtuchhalter, den sie bei Ikea geholt hatte.
Mein Ex-Mann. Ryans Vater. Paul. Wie gut war seine mentale Gesundheit? In den Wochen, Monaten, Jahren nach der Trennung dachte ich, er sei völlig verrückt – ich habe auch sehr ableistisch über ihn gesprochen, beim Jugendamt, beim Familiengericht, beim Sozialamt, bei Freundinnen. Aber jetzt, wenn ich zurückgucke, denke ich, dass er nur »ein bisschen verrückt« war – so künstler-verrückt (Künstler dürfen verrückt sein! Oder? Warum eigentlich?) –, aber vor allem sehr, sehr überwältigt, überfordert, über- … etwas überetwas, ich weiß nicht was. Er wollte auf keinen Fall, dass Löcher in die Wand gemacht werden. Er hatte rausgefunden, dass eine Nachbarin in der Wohnung unter uns Krebs hatte, und er glaubte, dass dieser Krebs rein konnte in die Wände, wenn wir nicht vorsichtig wären. Irgendwie fand er die Wohnung, in der wir wohnten, gefährlich. Vor der Kirche gegenüber wuchsen Pilze, und er fand das komisch. Er sagte, wo Gott ist, sollten keine Pilze wachsen, und dachte, dass diese Pilze vielleicht ein Zeichen dafür waren, dass die Kirche den Teufel statt Gott zuhause hatte. Dann die Ratte im Restmüll, die krebserkrankte Nachbarin.
Es war alles sehr viel, für uns beide. Ich denke, die normalsten langweiligsten Menschen der Erde finden diese Zeit, nachdem das Kind geboren ist, sehr anstrengend – und wir waren nicht besonders normal oder langweilig. Paul war, ist, kein langweiliger Mensch. Bis heute finde ich es am interessantesten, wenn ich mit ihm quatsche, über Filme oder auch Politik.
Es war ihm alles zu viel, es war uns zu viel.
Meine Mama wollte unbedingt, dass er den Handtuchhalter anbrachte, er weigerte sich, wegen der Krebslöcher. Meine Mama sagte dann, dass sie es selbst machen würde. Bei einem Kaffee in einer hässlichen Bäckerei sagte er mir, dass er mich verlassen würde, wenn Löcher in die Wand kämen. Ich weinte. Ich bettelte. Könnten wir nicht einen Kompromiss machen – wir bringen diesen Scheiß-Handtuchhalter an, und dann, wenn meine Mama weg ist, nehmen wir ihn ab und spachteln die Löcher wieder zu. Er sagte, ich würde ihn nicht respektieren, wenn ich nicht auf ihn höre. Ich weinte. Es ist irgendwie alles so traurig, aber auch albern und ein bisschen lustig, oder? Ein doofer Handtuchhalter, eine Nachbarin mit Krebs, eine bossy Schwiegermama, ein enttäuschter Ehemann, und ich weine im Backshop. Meine Mama und ich gingen nachmittags einkaufen, und als wir nach Hause kamen, zeigte uns Paul, wie er Elefantenhaken an der Badezimmerwand mit Tesafilm aufgehängt hatte. Wenn ich Leuten diese Geschichte erzähle, denken sie, ich meine Tesa Powerstrips. Nee, es war Tesafilm. Ihm war wirklich alles ein bisschen zu viel. Und meine Mama war nicht beeindruckt.
Ich bin Poirot in Das unvollendete Bildnis. Jahre später – Jahre, Jahre später – versuche ich rauszukriegen, was wirklich passiert ist. Poirot findet raus, wer der wirkliche Mörder von Amyas Crale ist, einem brillanten Maler, der angeblich von seiner betrogenen Frau vergiftet wurde. Poirot interviewt die Zeugen – die fünf kleinen Schweinchen –, und sie erzählen die Geschichten, beschreiben die Tage. Bestimmt verwechsle ich, wie sie, manche Tage mit anderen. Bestimmt habe ich nicht an dem Tag mit den Elefantenhaken geweint. Aber so viel Zeit ist inzwischen vergangen, die Tage schwimmen ineinander.
Und ja, ich erinnere mich auch noch an die Liebe. Immer, wenn Paul mir Ryan übergab, sagte er: »Paketlieferung für dich! Kaninchenkuchen!«
Trank Ryan eigentlich genug, denke ich jetzt? Ich gucke Bilder an, und er sieht sehr hungrig aus, sehr dünn. Warum, verdammte Scheiße, gibt man diesen Babys, von denen man denkt, sie trinken nicht genug, ihre Mamas stillen nicht gut genug – nicht einfach ein bisschen Hippmilch? Ja, ich weiß warum: Man denkt, dass das Baby die Hippmilch dann besser finden würde und dass die Mama dann weniger Muttermilch produziert – aber wenn ich daran denke, wie ich verrückt gemacht wurde, möchte ich in eine Zeitmaschine steigen und dieser jungen Frau eine Packung Hippmilch geben und eine komplette Babyflaschenausrüstung. Und eine Umarmung. Eine lange, süße Umarmung.
Ich erzähle diese Geschichte kompliziert, weil sie kompliziert ist. Ich weiß nicht mehr, an welchem Tag es war, als Ryans Papa gewalttätig wurde. Ich weiß, dass meine Mama nicht zuhause war. Paul und ich hatten einen doofen Streit über die Krankenversicherung – ich als verwöhnte Britin, NHS-erzogen, fand die Vorstellung, dass ein kleines Baby unversichert blieb, bis man ein Formular ausfüllt, richtig beängstigend, richtig gruselig. Es war einfach der Horror für mich. (Und ich muss auch sagen, immer wenn ich in England bin mit meinen deutschen Kindern, fühle ich mich, trotz der offensichtlich niedrigeren Standards der NHS-Gesundheitsversorgung, irgendwie beschützter, aufgehobener, als ich mich in Deutschland fühle. Ich denke, dass es besser wäre, wenn alle Kinder in Deutschland über die Familienkasse und den Kindergeldbescheid versichert wären und nicht über ihre Eltern.) Ich hatte ein paar Tage zuvor mit der AOK telefoniert, und sie hatten versprochen, die Formulare zu schicken. Hatten sie aber nicht.
»Ich frage mich, warum sie die nicht geschickt haben!«, sagte ich zu Paul.
»Sie werden die schon schicken«, antwortete er.
»Nicht, dass wir später eine Rechnung von Jutta kriegen«, sagte ich.
Ich weiß, für jemanden, der in Deutschland – oder in den USA – sozialisiert worden ist, war meine Angst vor dieser Rechnung, ist eine Angst vor medical bills irrational. Aber eine Britin sieht nie so eine Rechnung. Und irgendwie … irgendwie ahnte ich, dass alles meine Verantwortung war. Paul wollte sich nicht ums Geld, um Bürokratie kümmern.
»Es kam doch heute ein Brief von denen«, sagte ich.
»Nur Werbung«, sagte Paul. »Kannst selber gucken.«
Ich guckte dann selber – und sah, dass es die Formulare für die Krankenversicherung mit einer Werbebroschüre drin waren. Bis heute verstehe ich nicht, warum die AOK so viel Werbung schickt, an Leute, die schon Mitglieder sind. Aber an jenem Tag bin ich nur auf Paul wütend geworden, der Streit eskalierte, Paul wurde handgreiflich. Meine Mama kam nach Hause.
Jetzt kommt der Plot-Twist, wie bei einem Krimi: THE BUTLER DID IT!
Ja, die Hebamme war’s.
Diese Frau, die Paul immer in seiner Panik unterstützt hatte, die irgendwie dieselbe panische, fürsorgliche Sprache sprach wie er, diese Frau, die Pauls Komplizin gewesen war – meine Mama rief sie an, und sie kam vorbei mit Broschüren darüber, wie man wegkommt von einem gewalttätigen Mann.
Für sie war die Sache ganz klar: Jemand, der seine Frau schlägt, egal warum, ein paar Wochen nach einer Kaiserschnittgeburt, während sie stillt – das kann und wird nur schlimmer werden. Sie überredete meine Mama und meine Mama überredete mich, im Grunde genommen, Paul zu verlassen.
»In Sicherheit zu gehen«, sagten sie beide.
War es wirklich Sicherheit, in die meine Mama und ich gingen, damals, mit der U-Bahn? Ich schrieb einen Zettel, wie ein Feigling, legte ihn hin.
»Übernachte bei Monika«, stand darauf. Eine feige Lüge. Bei einer U-Bahn-Station gab es keinen Fahrstuhl, ich musste den Kinderwagen auf der Rolltreppe halten, meine Kaiserschnittnarbe tat weh, es fühlte sich an, als ob die Schmerzen im Unterleib wackelten.
»Du musst jetzt sehr stark sein fürs Baby!«, sagte ich mir.
War ich das? War ich stark? War ich sehr stark? War ich sehr stark fürs Baby? Irgendwie schon, oder?
Ich war auch feige – ich legte einen Zettel Lüge hin wie ein Feigling. Ich war naiv, ich war dumm. Ich war eine dumme Ausländerin, die von Sozialhilfe lebte und ihr deutsches Baby hätte abtreiben sollen. Ich war von der NHS verwöhnt wie Paris Hilton von Gucci-Taschen, ich war verwöhnt, ich war verwirrt, ich war verzweifelt. Ich war kindisch und selbstsüchtig, ich war eine Diva.
Aber ich war auch stark – ich war sogar sehr stark –, ich war stark für das Baby.





























