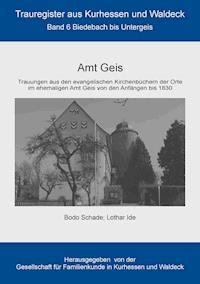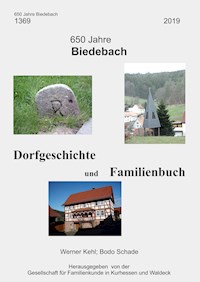
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dorfgeschichte, Familienbuch 650 Jahre wird Biedebach 2019 alt, gerechnet ab dem ersten urkundlichen Nachweis aus 1369. In diesem Buch wird versucht, die aus unterschiedlichen Quellen vorliegenden Daten aus der Geschichte Biedebachs greifbar zu bündeln und die in den Kirchenbüchern seit 1663 festgehaltenen Angaben über einzelne Personen und deren Familien der interessierten Bevölkerung zugänglich zu machen und zu erhalten, bevor sie für immer verloren gehen. Denn: Weil der Mensch leicht vergisst, muss das, was erhalten bleiben soll, schriftlich festgehalten werden. ca. 350 Familien lebten von 1663 bis ca. 1930 in diesem Ort. Ihre Daten werden in dem Familien zusammengefaßt und aus der Geschichte geholt. Von so manchen Zusammenhang zur großen Geschichte ist die Rede, die napolionische Zeit, die Entstehung des deutschen Reiches und sein Untergang, die Entstehung des dritten Reiches und sein Untergang, die Wandlung der Neuzeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 879
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Den historischen und heutigen Bewohnern des Ortes Biedebach
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Topographie und Verkehr
3.1 Allgemeine und naturräumliche Merkmale
3.2 Verkehrsanbindung
Gründung der ersten Höfe (eine fiktive Geschichte)
Der Name Biedebach gibt Rätsel auf
Belegte Daten und Fakten zur Geschichte
6.1 Urkundliche Ersterwähnung und Besitzverhältnisse
6.2 Was alte Landkarten berichten / Neue Erkenntnisse aus alten Landkarten
6.3 Verlauf der Grenzen nach amtlichen Beschreibungen im Raum Biedebach
6.3.1 Grenzverlauf zwischen Amt Geis und den Herrn von Riedesel
6.3.2 Die Grenze der Biedebacher Feldgemarkung
6.4 Veränderungen in der politischen und juristischen Verwaltung im Lauf der Zeiten
6.5 Verzeichnis der Amtspersonen
6.6 Heeneser und Gittersdorfer Wiesen
6.7 Teer- oder Pechhütten
6.8 Wüste Siedlungen in der Gemarkung
6.9 Besondere Dienste und Ereignisse
6.10 Der 30-jährige Krieg
6.10.1 Der Krieg und seine Folgen für die Menschen
6.10.2 Mannschaftsregister von 1639
6.11 Biedebacher Soldaten im Unabhängigkeitskrieg der USA
6.12 Die Entwicklung vom 18. Jahrhundert bis heute
6.12.1 Tabelle: Entwicklung des Dorfes nach Haushalten, Häusern und Einwohnern
6.12.2 Liste der heimatvertriebenen Familien
Schulwesen
7.1 Aller Anfang ist schwer: Über 10 Jahre Schulbau
7.2 Die modernste Schule weit und breit
7.3 Ökologisches Handeln 1952: „Unsere Birke“
7.4 Verzeichnis der in Biedebach tätigen Lehrer
Kirchliche Zugehörigkeit
8.1 Die Kirche in Untergeis als Gedenkstätte
8.2 Mehr als ein stummer Zeuge: Martin Apels Grabstein
8.3 Gedenktafeln für Biedebacher Kriegsteilnehmer
8.3.1 Deutsch-Französischer Krieg 1870/1871
8.3.2 Befreiungskrieg gegen Napoleon
8.4 Einrichtung eines Friedhofs in Biedebach
8.5 Erneuter Kirchspielwechsel
Brandversicherungsnummern werden zu Hausnummern
Familien und ihre Namen
10.1 Häufige Familiennamen vom 17. bis ins 19. Jahrhundert
10.2 Eine Auswahl bekannter Haus- und Familiennamen
Heimat ade -Auswanderung
Lustig-Groteskes aus der Zeit des Dritten Reiches
Amerikaner statt Osterhase
Vereine
14.1 Radfahrverein Wanderlust
14.2 Gesangverein
14.3 Weidegemeinschaft Biedebach e.V.
14.4 Freiwillige Feuerwehr Biedebach
Wasser und seine Bedeutung für das Dorf
Mundart
Bedeutende kommunale Maßnahmen (Liste)
Literaturverzeichnis und Quellenangaben
Familien des Ortsteils Biedebach der Gemeinde Ludwigsau (1663 bis 1920)
Vorwort
Kirchenbücher
Standesamt
Abkürzungen
Ackermann / Böttner (F1689)
Apel / Clebe(F2585)
Apel / Dippel(F2715)
Apel / Geist (F1376)
Apel / Hast (F743)
Apel / Hott (F4570)
Apel / Karpenstein (F4611)
Apel / Kehl (F2681)
Apel / Klosterbecker (F2593)
Apel / Knoth (F2671)
Apel / Krause (F5140)
Apel / NN (F25)
Apel / Paul (F396)
Apel / Pfaff (F1369)
Apel / Scheffer (F665)
Apel / Weich (F2705)
Apel / Wiederich (F952)
Apel / Wiegand(F1622)
Apel / Wiegand(F193)
Apel / Wiegand(F2666)
Arend / Heerd(F1620)
Axt / Opfer (F1770)
Bätz / Bätz(F4542)
Bätz / Eichmann (F2604)
Bätz / Grebe(F4560)
Bätz / lckler(F2572)
Bätz / Kehl (F2644)
Bätz / Landefeld (F3498)
Bätz / Schmitt (F2642)
Bätz / Will (F2722)
Bauer / Apel (F2683)
Bauer / Apel (F2663)
Bauer / Berg (F2636)
Bauer / Nuhn (F3493)
Bauer / Wenzel (F2603)
Baumgartl / Baumgartl (F5227)
Baumgartl / Grenzebach (F4615)
Berg / Apel (F1644)
Berg / Fuchs (F2613)
Berg / Glebe(F2691)
Berg / Most (F2651)
Bettenhausen / Apel (F1711)
Bettenhausen / Klosterbecker (F3514)
Bod / Gillmann (F1600)
Bod / Herwig (F692)
Bod / Jung (F500)
Bod / Schad (F693)
Bod / Schwarz(F1660)
Bodt / Apel(F320)
Bodt / Wigand(F321)
Bolz / Opfer (F2633)
Böttner / Freund (F3510)
Böttner / Geist (F3489)
Brand / Opfer (F2623)
Brandau / Apel (F2360)
Brandt / Bauer (F2672)
Brandt / Berg (F2652)
Braun / Bätz (F5234)
Braun / Besse (F2445)
Braun / Glebe (F2697)
Braun / Glebe (F2701)
Braun / Heiderich (F2584)
Briell / Bätz (F2667)
Burghardt / Fuchs (F2723)
Capp/ Geist (F1021)
Capp / NN (F1022)
Capp / NN (F458)
Clebe / Ecchard(F1539)
Clebe / Kümmel (F1640)
Clebe / NN (F1167)
Clebe / Will (F1184)
Croll / Capp(F752)
Croll / Opfer (F836)
Diegel / NN (F511)
Diegel / Ulrich (F510)
Ebert / Schad (F4593)
Ebert / Schuster (F4558)
Eckhard / Freund (F2625)
Eckhardt / Hassenpflug (F4588)
Erb / Motzez(F1156)
Fey / Pfaff(F4549)
Freund / Bettenhausen (F2635)
Freund / Croll (F834)
Freund / Fuchs (F1946)
Freund / Glim (F1262)
Freund / Klosterbecker (F2608)
Freund / Most (F2654)
Freund / Pfeiffer (F2656)
Freund / Pfort (F3528)
Freund / Wetzel (F2620)
Früh / NN (F1284)
Fuchs / Freund (F2627)
Fuchs / Gillmann (F1932)
Fuchs / Goßmann (F4572)
Fuchs / Hoßfeld (F2710)
Fuchs / Hoßfeld (F2674)
Fuchs / Kehl (F2669)
Fuchs / Opfer (F4539)
Fuchs / Rhode (F2578)
Fuchs / Riebolt(F1016)
Fuchs / Schuster (F4547)
Fuchs / Schuster (F2597)
Fuchs / Wetzel (F2682)
Fuchs / Wienhold (F2581)
Geist / Capp(F58)
Geist / NN (F199)
Geist / NN (F75)
Geist / Paul (F338)
Geist / Scheffer (F337)
Gillmann / Bickel (F2648)
Gillmann / Dehnhard (F4550)
Gillmann / Schmidt (F2703)
Gillmann / Schneider (F2568)
Gillmann / Wiegand (F2616)
Glebe / Apel(F2601)
Glebe / Brandt (F5151)
Glebe / Gillmann (F2698)
Glebe / Wiegand (F2611)
Glebe / Will (F2650)
Glebe / Zülch (F2638)
Gleim / Gundlach (F4565)
Gleim / Möller (F2711)
Gleim / Schwarz (F4604)
Götz / Zettl(F5658)
Grebe / Berg(F2587)
Grebe / Herwig (F2637)
Grebe / Heyer (F2720)
Grebe / Heyer (F2678)
Grebe / Jacob (F2664)
Grebe / Klee (F2599)
Grebe / Sieling (F2622)
Grenzebach / Brehm (F2721)
Grenzebach / Fuchs (F4563)
Grenzebach / Hassenpflug (F4548)
Grenzebach / Heyer (F2696)
Grenzebach / Knoth (F2670)
Grenzebach / Nadler (F4571)
Grunewald / Grebe (F2713)
Haas / Ackermann (F2595)
Hahn / Gleim (F4555)
Hahn / Schwarz (F2577)
Hartwig / Trapp (F3497)
Hartwig / Weppler (F946)
Hassenpflug / Braun (F2706)
Hassenpflug / Grenzebach (F2695)
Hassenpflug / Hildebrand (F2712)
Hassenpflug / Hildebrand (F2676)
Hassenpflug / Opfer (F2614)
Hassenpflug / Opfer (F2679)
Hassenpflug / Schmidt (F2357)
Hassenpflug / Wiegand (F2655)
Hassenpflug / Wiegand (F2645)
Hehnes / NN(F526)
Hehnes / Öst (F625)
Heiderich / Hehnes (F944)
Heiderich / Ickler (F1934)
Heiderich / Meßing (F1562)
Herget / Ackermann (F2589)
Herwig / Apel(F2594)
Herwig / Hießner(F2626)
Herwig / Paul (F2600)
Herwig / Studenroth (F2596)
Herwig / Wiegand (F1704)
Heußner / Grenzebach (F5613)
Heußner / Kehl (F5628)
Heyer / Bolz (F2643)
Heyer / Hahn (F2684)
Heyer / Heyer (F3496)
Heyer / Kehl (F2657)
Heyer / Möller (F2693)
Heyer / Paul (F2640)
Heyer / Scheffer (F2607)
Heyer / Schmidt (F4546)
Heyer / Schwarz (F2659)
Heyer / Wiegand (F4545)
Heyer / Wiegand (F2646)
Heyer / Wiegand (F2647)
Hildebrand / Fey (F4586)
Hildebrand / Grenzebach (F4557)
Hoffmann / NN (F1272)
Hofsommer / Schmidt (F4556)
Imhoff / Schröder (F5627)
Jacob / Schuster (F2685)
Jacob / Wiegand(F2641)
Käberich / Berg(F5131)
Karpenstein / Apel (F4619)
Karpenstein / Grenzebach (F2472)
Karpenstein / Riess (F2359)
Karpenstein / Stang (F2356)
Kehl / Albert (F2590)
Kehl / Baumgartl (F4603)
Kehl / Birkel(F2688)
Kehl / Borngrebe(F2707)
Kehl / Feik(F4543)
Kehl / Höhmann (F2704)
Kehl / Knoth(F2716)
Kehl / Knoth(F2662)
Kehl / NN (F4417)
Kehl / Schneider (F4554)
Kehl / Schneider (F4552)
Kehl / Schytrumpf (F5736)
Kehl / Stippich (F2692)
Kehl / Wiegand (F2632)
Kehres / Möller (F4540)
Kehres / Pfau (F5212)
Klee / Apel (F2592)
Klee / Döll (F2583)
Klee / Möller (F2570)
Klee / Sohl (F908)
Klee / Ziegler (F1655)
Klosterbecker / Möller (F1126)
Knoth / Ackermann (F3483)
Knoth / Grebe(F2661)
Knoth / Hahl (F2586)
Knoth / Kehl (F2631)
Knoth / Leimbach (F4433)
Knoth / Manns (F2677)
Knoth / Opfer (F2628)
Knoth / Opfer (F2624)
Knoth / Scheffer (F2588)
Knoth / Scheffer (F1673)
Knoth / Schuster (F2634)
Knoth / Schwarz (F2673)
Knoth / Wittich (F2687)
Krämer /Will (F5623)
Kunzmann / Glöckner (F5659)
Lesch / Glebe (F2709)
Lingelbach / Pfaff (F4541)
Lotz / Bolz(F2653)
Manß / Pfaff (F1160)
Mees / Bätz(F4538)
Michaelis / Dithmar (F2629)
Michaelis / Heyer (F2689)
Michaelis / Karpenstein (F4575)
Michaelis / Grenzebach (F4578)
Michaelis /Schaub (F4536)
Michaelis / Schmidt (F2675)
Michaelis / Schuster (F2602)
Möller / Briell (F2665)
Möller /Gillmann (F2690)
Möller / Hartwig (F2617)
Möller / Hott (F2686)
Möller / Klee (F3499)
Möller / Schaumburg (F5629)
Möller / Trübeler (F2658)
Möller / Zülch (F3500)
Most / Knoth (F5630)
Müller / NN (F646)
Opfer / Axt (F2598)
Opfer / Opfer (F2610)
Opfer / Scheffer (F2605)
Opfer / Wiegand(F1492)
Paul / Herwig (F587)
Paul / Hoß(F1384)
Paul / NN (F143)
Pfaff / Herwig (F2621)
Pfaff / Karpenstein (F2694)
Pfaff / Möller (F2708)
Pfaff / NN (F1295)
Pfaff / Schäfer (F2649)
Pfort / Heinz (F5586)
Pfort / Kehl (F2717)
Pippert / NN(F1189)
Reinhard / Schmidt (F2358)
Reith / Trapp (F2609)
Rohleder / Apel (F3522)
Rohrbach / Hoßfeld (F4544)
Rosenstock / Flügge (F5585)
Roßbach / Heyer (F2431)
Roßbach / Möller (F2680)
Roßbach / NN (F611)
Ruppel / Fischer (F2426)
Sand / Grebe(F2700)
Schade / Adam (F3505)
Schade / Hofmann (F1522)
Schade / Schuster (F4551)
Schade / Wambach (F2046)
Schaub / Knoth (F1955)
Scheffer / Clebe (F1699)
Scheffer / Fuchs (F1377)
Scheffer / Hott (F874)
Scheffer / NN (F90)
Scheffer / Schad(F450)
Scheffer / Schneider (F1597)
Scheffer / Schwalb (F235)
Scheffer / Wiegand (F790)
Scheuch / Hildemann (F4553)
Scheuch / Knoth (F5562)
Scheuch / Schmitt (F1568)
Schmidt / Dehnhard (F2618)
Schmidt / Glebe (F2702)
Schmidt / Horn (F3509)
Schmidt / Hott (F4561)
Schmitt / Kehres (F4584)
Schneider / Bätz (F2724)
Schneider / Herwig (F3516)
Schreiber / Berk(F4535)
Schreiber / Deiseroth (F4585)
Schreiber / Sippel (F2725)
Schuster / Hofmann (F3519)
Schuster / Kehl (F4784)
Schwarz / Geist (F1193)
Siering / Heyer (F4601)
Singer / Bätz (F4591)
Sohl / Geist (F1180)
Sondergeld / Hessenpflug (F5733)
Spruck / Freund (F2668)
Spruck / Fuchs (F4559)
Spruck / Kehl (F2714)
Steinhöfel / Kehl(F5624)
Stock / NN (F827)
Tannhäuser / Fuchs (F2718)
Theis / Kehl (F3524)
Tiegel / NN (F487)
Uebelacker / Heyer (F4587)
Vogeler / Wetzstein (F5619)
Wagner / Michaelis (F2719)
Watterodt / Möller (F4537)
Weidemann / Knoth (F2580)
Weißrock / Geist (F969)
Weißrodt / NN (F1143)
Weitzel / Scheffer (F385)
Wettlaufer / Kehl(F3485)
Wiegand / Apel(F305)
Wiegand / Apel(F684)
Wiegand / Apel(F730)
Wiegand / Apel(F2660)
Wiegand / Berg (F2591)
Wiegand / Berk (F2699)
Wiegand / Bieling (F2575)
Wiegand / Biling (F386)
Wiegand / Hott (F1251)
Wiegand / Kehl (F2619)
Wiegand / Opfer (F2630)
Wiegand / Pfaff (F2639)
Wiegand / Scheffer (F714)
Wiegand / Wetzel (F2612)
Wiegand / Wiederich (F657)
Wiegand / Wiegand (F1927)
Wiegand / Wiegand (F2606)
Wiegand / Wiegand (F1593)
Wigand / Berck(F2473)
Wigand/ Blumenstiel (F2582)
Wigand / Hildebrand (F2615)
Wigand / NN (F162)
Wigand / Scheffer (F1948)
Will / Hildebrandt (F2076)
Will / Scheffer (F3508)
Wurmnest / Wiegand (F3518)
NN / Apel (F5631)
NN / Apel (F3527)
NN / Apel (F3504)
NN / Berg(F5200)
NN / Berg(F5130)
NN / Berg(F5132)
NN / Bettenhausen (F3491)
NN / Brandt (F5622)
NN / Fuchs (F5612)
NN / Geist (F1374)
NN / Gillmann(F5138)
NN / Glebe(F4448)
NN / Karpenstein (F5240)
NN / Kehl(F4447)
NN / Knoth(F5566)
NN/Lotz(F5600)
NN / Möller (F3525)
NN / Möller (F3529)
NN / NN (F3520)
NN / NN (F999)
NN / Schade (F2440)
NN / Scheffer (F3490)
NN / Spruck(F5561)
NN / Wiegand (F3515)
NN / Wiegand (F5609)
NN / Wiegand(F3512)
NN / Wiegand (F5595)
Register der Familiennamen
Register der Orte
Register der Berufe und Ämter
Liste der Kriegsteilnehmer
Register der Auswanderer
IDs Familie / Personen
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Vorwort
2. Einleitung
3. Topographie und Verkehr
3.1 Allgemeine und naturräumliche Merkmale
3.2 Verkehrsanbindung
4. Gründung der ersten Höfe (eine fiktive Geschichte)
5. Der Name Biedebach gibt Rätsel auf
6. Belegte Daten und Fakten zur Geschichte
6.1 Urkundliche Ersterwähnung und Besitzverhältnisse
6.2 Was alte Landkarten berichten / Neue Erkenntnisse aus alten Landkarten
6.3 Verlauf der Grenzen nach amtlichen Beschreibungen im Raum Biedebach
6.3.1 Grenzverlauf zwischen Amt Geis und den Herrn von Riedesel
6.3.2 Die Grenze der Biedebacher Feldgemarkung
6.4 Veränderungen in der politischen und juristischen Verwaltung im Lauf der Zeiten
6.5 Verzeichnis der Amtspersonen
6.6 Heeneser und Gittersdorfer Wiesen
6.7 Teer- oder Pechhütten
6.8 Wüste Siedlungen in der Gemarkung
6.9 Besondere Dienste und Ereignisse
6.10 Der 30-jährige Krieg
6.10.1 Der Krieg und seine Folgen für die Menschen
6.10.2 Mannschaftsregister von 1639
6.11 Biedebacher Soldaten im Unabhängigkeitskrieg der USA
6.12 Die Entwicklung vom 18. Jahrhundert bis heute
6.12.1 Tabelle: Entwicklung des Dorfes nach Haushalten, Häusern und Einwohnern
6.12.2 Liste der heimatvertriebenen Familien
7. Schulwesen
7.1 Aller Anfang ist schwer: Über 10 Jahre Schulbau
7.2 Die modernste Schule weit und breit
7.3 Ökologisches
Handeln 1952: „Unsere Birke“
7.4 Verzeichnis der in Biedebach tätigen Lehrer
8. Kirchliche Zugehörigkeit
8.1 Die Kirche in Untergeis als Gedenkstätte
8.2 Mehr als ein stummer Zeuge: Martin Apels Grabstein
8.3 Gedenktafeln für Biedebacher Kriegsteilnehmer
8.3.1 Deutsch-Französischer Krieg 1870/1871
8.3.2 Befreiungskrieg gegen Napoleon
8.4 Einrichtung eines Friedhofs in Biedebach
8.5 Erneuter Kirchspielwechsel
9. Brandversicherungsnummern werden zu Hausnummern
10. Familien und ihre Namen
10.1 Häufige Familiennamen vom 17. bis ins 19. Jahrhundert
10.2 Eine Auswahl bekannter Haus- und Familiennamen
11. Heimat ade -Auswanderung
12. Lustig-Groteskes aus der Zeit des Dritten Reiches
13. Amerikaner statt Osterhase
14. Vereine
14.1 Radfahrverein Wanderlust
14.2 Gesangverein
14.3 Weidegemeinschaft Biedebach e.V.
14.4 Freiwillige Feuerwehr Biedebach
15. Wasser und seine Bedeutung für das Dorf
16. Mundart
17. Bedeutende kommunale Maßnahmen (Liste)
Literaturverzeichnis und Quellenangaben
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Hinterdorf um 1910
Abbildung 2: Haukuppe - Bereich des Basaltabbaus
Abbildung 3: Ehemaliger Steinbruch
Abbildung 4: Hauksgrund mit Köhlerplatte rechts vor dem Wald
Abbildung 5: Dicke Eiche im Frühjahr
Abbildung 6: Schwarzstorch am Eingang zum Hauksgrund
Abbildung 7: Hohlweg am Hauksberg
Abbildung 8: Bau der neuen Straße entlang der Gerteröder Triescher
Abbildung 9: Wappen der Schaden von Leibolds, die 1369 Bydenbach als Hersfelder Lehen besaßen
Abbildung 10: Digitalisate
Abbildung 11: Historische Karte um 1635
Abbildung 12: Vor dem Thierbach (umgedrückt)
Abbildung 13: Grenzstein
Abbildung 14: Bereich der ehemaligen Siedlung Riffelderode oder Richelrode am Talschluss des Hauksgrundes
Abbildung 15: In diesem Bereich war vermutlich die zweite Wüstung im Hauk
Abbildung 16: Alte Schule, Hs-Nr. 19 ca. 1928
Abbildung 17: Biedebacher Schule von 1883-1962
Abbildung 18: Vorderseite des Grabsteins von Martin Apel
Abbildung 19: Teilnehmer am Krieg 1870/1871, unten die beiden Biedebacher
Abbildung 20: Teilnehmer am Befreiungskrieg gegen Napoleon 1814 aus Untergeis, Gittersdorf und Biedebach
Abbildung 21: Ortsplan
Abbildung 22: Beleg für das Alter von Haus Nr.2
Abbildung 23: Haus Nr. 2 vorne in der Mitte, hinten links Haus Nr. 25 um 1940
Abbildung 24: Blick von der Sommerseite auf das Mitteldorf ca.1910
Abbildung 25: Haus und Wirtschaftsgebäude Hs.-Nr.7 1913
Abbildung 26: Hof Hassenpflug um 1965, Scheune ca. 1970 abgerissen, dort steht heute das Haus Maiworm
Abbildung 27: Haus Nr. 21 ca. 1925, Elisabeth Grenzebach geb. Hassenpflug und Änne Michaelis
Abbildung 28: Anwesen Kehres/Schmitt ca. 195
Abbildung 29: Heutiges Haus Hild vor ca. 50 Jahren, eines der letzten erhaltenen Fachwerkhäuser
Abbildung 30: Stempel des Biedebacher Radfahrer-Vereins Wanderlust
Abbildung 31: Weidegemeinschaft
Abbildung 32: Erster urkundlicher Nachweis für die Feuerwehr
Abbildung 33: Siegreiche Wettkampfgruppe 1977 in Tann
Abbildung 34: Hochwasser in 2012
1. Vorwort
650 Jahre wird Biedebach 2019 alt, gerechnet ab dem ersten urkundlichen Nachweis aus 1369.
In diesem Buch wird versucht, die aus unterschiedlichen Quellen vorliegenden Daten aus der Geschichte Biedebachs greifbar zu bündeln und die in den Kirchenbüchern seit 1663 festgehaltenen Angaben über einzelne Personen und deren Familien der interessierten Bevölkerung zugänglich zu machen und zu erhalten, bevor sie für immer verloren gehen.
Denn:
Weil der Mensch leicht vergisst, muss das, was
erhalten bleiben soll, schriftlich festgehalten werden.
2. Einleitung
Am 28. Dezember 2018 fand auf Anregung einiger Biedebacher Bürger im DGH eine Versammlung statt, auf der beschlossen wurde, anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Biedebachs im Jahre 1369 am 17. und 18. August 2019 das 650.-Ortsjubiläum in feierlichem Rahmen zu begehen.
Der anwesende Bürgermeister Wilfried Hagemann unterstützte dieses Vorhaben und präsentierte einen Entwurf zur Gestaltung einer solchen Feier. Ein Festausschuss wurde gegründet und mit der Planung beauftragt.
Dem Ausschuss gehören an: Sandra Beisheim, Daniela Ebert, Susanne Fliegner, Uwe Grenzebach, Irene Riemenschneider, Michael Schmidt.
Gerhard Schmitt wird Oldtimer-Kraftfahrzeuge präsentieren und Wulf König eine Ausstellung alter Fotos von Biedebach vorbereiten.
Der nordhessische Familienforscher Bodo Schade aus Bad Karlshafen hat angeboten, zum Dorfjubiläum ein sogenanntes Familienbuch zu verfassen, in welchem aus den seit 1663 geführten Kirchenbüchern die Namen sowie Angaben zu Taufe, Konfirmation, Heirat, und Beerdigung aller darin erfassten Biedebacher enthalten sind. Das Datum der Geburt und der Todestag können zusätzlich genannt sein.
Im günstigsten Fall können mit diesen Angaben die Vorfahren bis um 1600, also vor dem 30-jährigen Krieg, erforscht werden.
Der Autor dieser Zeilen versprach, Herrn Schade zu unterstützen, geschichtliche Daten zu recherchieren, aufzubereiten und einen Begleittext zum Familienbuch zu verfassen.
Zu berücksichtigen war dabei, dass dafür lediglich ein halbes Jahr Zeit zur Verfügung stand, sodass nur ausgewählte Fragestellungen bearbeitet werden konnten.
Ganz herzlich danken möchte ich allen, die mich bei der Erstellung dieser Schrift unterstützt haben.
3. Topographie und Verkehr
3.1 Allgemeine und naturräumliche Merkmale
Das heute noch gut 100 Einwohner zählende Dörfchen Biedebach ist seit 1972 einer der kleineren Ortsteile der Gemeinde Ludwigsau im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der Ort liegt idyllisch eingebettet in einem engen südwestlichen Seitental des Rohrbachs am nordöstlichen Rand des Knüllgebirges vorwiegend auf Buntsandsteinverwitterungsböden in ca. 350 Metern Höhe über dem Meeresspiegel.
Abbildung 1: Das Hinterdorf um 1910
Bewaldete Hügel umgeben das Dorf außer im Osten. Die höchsten Erhebungen sind im Südosten die Haukuppe mit 446 Metern (ehemaliger Vulkan, zum Wegebau wurde grauer Basalt gebrochen) und der Gebrannte Kopf mit 491 Meter im Nordwesten als höchster Punkt der Gemarkung.
Abbildung 2: Haukuppe - Bereich des Basaltabbaus
Am Südosthang des Caden (Köppel) befindet sich im Staatswald eine geschätzt vier bis fünf Hektar große Fläche, die durch bis zu ca. 20 Meter tief gegrabene Krater geprägt ist und wo inzwischen wieder Buchen wachsen. Es handelt sich um einen ehemaligen Steinbruch, der offenbar bis ins 19. Jahrhundert intensiv genutzt wurde, z. B. hier gebrochene rote Buntsandsteine fanden 1830 Verwendung zum Bau des alten Hersfelder Bürgerschulgebäudes, des späteren Mädchengymnasiums, der Luisenschule (Hersfelder Geschichtsblätter, Band 3, 2007, Seite 122).
Abbildung 3: Ehemaliger Steinbruch
Mit 1052 Hektar besitzt Biedebach die größte Gemarkung aller 13 Ludwigsauer Ortsteile, wobei mit über 900 Hektar der von Hessenforst bewirtschaftete Staatswald dominiert. Landwirtschaftlich genutzt werden ca. 115 Hektar der eigentlichen Feldgemarkung um das Dorf herum und die etwa 25 Hektar Naturwiesen im fünf Kilometer langen Hauksgrund mit seinen kleinen Seitentälern (z.B. Bärengraben, Dornhecken, Finstertal, Wichtelsdelle). Der Hauksgrund (bis nach 1600 Haubt grundt) im Süden der Gemarkung erstreckt sich nahezu parallel zum mittleren Geistal und gilt als besonders landschaftsprägendes Element mit hohem ökologischen Wert. Neben einem dichten Besatz mit Rot- und vor allem Schwarzwild (zum Leidwesen der Landwirte) wurden zwei Luchse sowie zahlreiche Bachkrebse ausgesetzt und der Schwarzstorch brütet hier. Bis in die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts waren Auerhähne im oberen Hauksgrund zu beobachten.
Abbildung 4: Hauksgrund mit Köhlerplatte rechts vor dem Wald
Abbildung 5: Dicke Eiche im Frühjahr
Abbildung 6: Schwarzstorch am Eingang zum Hauksgrund
3.2 Verkehrsanbindung
„Bei euch ist doch die Welt mit Brettern zugenagelt!“ Mit diesem Spruch versuchten Bewohner der Nachbardörfer früher die Biedebacher immer zu hänseln. Das, was sich dahinter verbirgt, soll jetzt beleuchtet werden.
Biedebach lag zwar nie direkt an Hauptverkehrswegen, aber auch nicht sehr weit entfernt von bekannten Höhenstraßen. Das Dorf befindet sich nur etwa zwei Kilometer nördlich der alten Verbindungsstraße zwischen Hersfeld und Homberg/Efze, dem „H-Weg“, und nur ca. 500 Meter südlich der davon im Bereich des Gebrannten Kopfes nach Osten abzweigenden „Alten Straße“, die das obere Geistal über das mittlere Rohrbachtal mit dem Fuldatal verband. So gelangte man z.B. über diese Straße vom Nonnenkloster in Aua (1190 bis 1229 ursprünglicher Sitz) nach Blankenheim (späterer Sitz dieses Klosters bis zur Säkularisation 1527, die ehemaligen Klosterkapellen sind heute Dorfkirchen).
Der „H-Weg“ führte vom Wehneberg kommend nördlich an der Haukuppe vorbei stets auf dem Höhenzug „Auf der Ecken“ entlang zum Gebrannten Kopf und über den Pommer weiter nach Nordwesten Richtung Homberg. Um von Biedebach zu dieser Straße oder in das südlich davon gelegene Geistal zu gelangen, wurde der sogenannte Kirchenweg benutzt, die Verbindungsstraße nach Untergeis und zur dortigen Kirche. Seit ca. 1565 war Biedebach im Kirchspiel Obergeis eingepfarrt und die Biedebacher gingen eine Stunde zu Fuß zur fünf Kilometer entfernten Filialkirche in Untergeis. Vom Dorf aus führte der Kirchenweg zunächst in gerader Linie schräg den Caden (Köppel) hinauf bis zum Waldrand, von dort dann den sehr steilen Südhang des Hauksbergs nahezu geradlinig hinab in den Hauksgrund, durchquerte diesen bei der „Dicken Eiche“, um schließlich ein Nebental (den langen Graben) hinaufführend bei den „Drei Danzbiche“ auf den „H-Weg“ zu treffen.
Die von den beiden alten Höhenstraßen nach Biedebach abzweigenden Zufahrtswege waren an den steilen Hängen durch die eisenbereiften Holzräder der Fuhrwerke tief ausgefahren und der gelockerte Boden wurde vom Regenwasser ins Tal gespült. Um nicht im aufgeweichten Boden stecken zu bleiben, „verlegten“ die Fuhrwerke ihre Fahrspur im Bedarfsfall einfach nach rechts oder links, so dass im Laufe der Jahre mehrere Wege nebeneinander entstanden. Das zeigen für den Kirchenweg am Hauksberg nördlich von der Dicken Eiche mehrere parallel verlaufende alte Hohlwege, die bis ca. zwei Meter tief „eingegraben“ sind. Im Bereich der Feldgemarkung hatte der Kirchweg bis zum Waldrand vor der Flurbereinigung bis 1910 einen etwas anderen Verlauf. Er führte ohne die heutige Haarnadelkurve einfach schräg den Köppel hinauf zum Wald. An einigen Stellen sind die alten Konturen des Weges noch im Ackerland zu erkennen (Felder Ebert, Schmitt, Grenzebach, Bätz, F. Kehl). Am westlichen Rand des ehemaligen Schulgrundstücks vor dem Wohnhaus Heß war er ausgefahren und damit tief in das Gelände eingeschnitten. Es war „die Hohl“, welche seit der Verkopplung und Wegeverlegung 1910 nach und nach mit Abfall verfüllt wurde.
Nur aus östlicher Richtung kommend steigt der das Rohrbach- und Biedebachtal aufwärts führende Weg bis auf das Stück über den „Langen Auesrain“ (heute vorbei am Aussiedlerhof Quade) eher allmählich an.
Nach Angaben aus §1 des Lager-, Stück- und Steuerbuchs von 1821, erstellt vom Revisor Koppen, liegt Biedebach
„6 Meilen von der Residenzstadt Cassel und 2 Stunden von der Stadt Hersfeld, größtenteils von Waldung eingeschloßen, grenzet mit deren Terminey gegen Morgen an die Tannische Feldmarck und die Gerterötter Triescher, gegen Mittag an den Herrschaftlichen Wald die Hohe Lied, gegen Abend an die Winterseite und gegen Mitternacht an die Sommerseite“.Nach F. Pfister, „Kleines Handbuch der Landeskunde von Kurhessen“ (1840) liegt„Im Thale aufwärts (...) hoch oben, in einem Seitengrund an der Haukuppe, Biedenbach“.
In den Jahrhunderten vor dem Zeitalter der Motorisierung war Biedebach eigentlich aus den in allen Himmelsrichtungen gelegenen Nachbarorten zu Fuß oder mit Fuhrwerken relativ gut über vergleichbare Wege unter ähnlichen Bedingungen zu erreichen. Besonders häufig befahren wurde mit Sicherheit der „Kirchenweg“ nach Untergeis. Nur so sind die fünf nebeneinander verlaufenden bis zu knapp zwei Meter Tiefe ausgefahrenen bzw. vom Regenwasser ausgespülten Hohlwege im Bereich des Hauksberges zu deuten.
Abbildung 7:Hohlweg am Hauksberg
Abbildung 8: Bau der neuen Straße entlang der Gerteröder Triescher
Erst 1928 bis1930 wurde die Verbindungsstraße nach Tann von damals Arbeitslosen mit Schotter befestigt und der steile Anstieg den Langen Auesrain hinauf „herausgenommen“, das heißt, die „Neue Straße“ wurde in das Tal an den Waldrand entlang der Tanner und Gerteröder Triescher verlegt. Mit der zunehmenden Motorisierung erlangte diese Kreisstraße 42 als einzige ausgebaute Zufahrtsstraße für das Dorf eine herausragende Bedeutung. Die Ausbaustrecke endet jedoch im Ort.
Im Volksmund wird dies mit der Formulierung umschrieben: „In der Biedebach ist die Welt mit Brettern zugenählt!“ Mit diesem Ausspruch versuchten Bewohner der Nachbarorte die Biedebacher häufig zu hänseln. Ein alter Biedebacher Kinderreim aus dem Jahr 1922 (Schulchronik) hingegen deutet diesen Sachverhalt positiv:
„Die Dann, die Dann, die Rohrboach,
Gerterod un Drunsboach,
Ebergäs un Engergäs,
die Biereboach leiht in der Mett vom Kräs!“
Auch heutzutage verlaufen moderne Verkehrswege nicht sehr weit weg von Biedebach. Wenige Kilometer westlich prägen die Autobahn A 5 (Frankfurt–Kassel) und die ICE-Trasse der Bahnstrecke Hannover-Würzburg mit großen Brücken und Tunneln (unter Gebranntem Kopf) die hügelige Mittelgebirgslandschaft.
Im knapp 10 Kilometer östlich gelegenen Fuldatal verlaufen die Bundesstraße 27 und die alte Bahntrasse Bebra–Fulda ebenfalls in Nord–Süd-Richtung.
In Bad Hersfeld befindet sich in ca. 15 Kilometer Entfernung die Autobahnanschlussstelle zur A 4 nach Osten (Eisenach, Erfurt, Dresden) und zur A7 nach Süden (Fulda, Würzburg)
4. Gründung der ersten Höfe (eine fiktive Geschichte)
Ungefähr im Jahr 800 n. Chr. treffen sich im östlichen Randbereich des Knüllgebirges in einem Dorf im oberen Geysa-Tal in der Morgendämmerung zwei kräftige, gesunde Bauernsöhne an der Dorflinde. Sie sind mit Proviant für einige Tag und Werkzeugen wie Axt, Säge, Hacke usw. ausgerüstet. Beide sind ungefähr 25 Jahre alt und haben im letzten Jahr eigene Familien gegründet. Die Bauernhöfe ihrer Eltern sind nicht groß und ergiebig genug, um eine zusätzliche junge Familie mit zu ernähren. Deshalb haben die beiden jungen Männer beschlossen, ihr Heimatdorf zu verlassen. Sie wollen an einem ihnen gut dafür geeignet erscheinendem Platz Land urbar machen und dort eigene Bauernhöfe gründen, um für sich und ihre jungen Familien eine Existenz aufzubauen, um den Lebensunterhalt zu sichern.
Die dafür ausgewählte Stelle, sie nennen sie in ihrer damaligen Sprache „Bidenebach“, werden sie nach knapp zwei Stunden Marsch in nordöstlicher Richtung über den Höhenzug Auf der Eck und quer durch den „Haubt grund“ am nördlichen Rand des noch zum Gericht Geys zählenden Gebiets kurz vor dem Besitz derer von Riedesel erreichen.
„Bidenebach“ bedeutet nach Auffassung des Germanisten Hans Bahlow „Sumpf- oder Schmutzwasser“. Ein solches durchwateten die Beiden vor einigen Jahren, als sie damals aus östlicher Richtung kommend über Stunden hinweg der Spur eines angeschossenen Hirschen gefolgt waren. Nach dem Erlegen des Tieres rasteten sie seinerzeit auf einer Lichtung im dichten Buchenwald und labten sich an einer frisch sprudelnden Quelle oberhalb des Zusammenflusses von drei Quellbächen zum dann sogenannten Bidenebach. In ihrem jeweiligen Oberlauf hatten sich die drei Quellbäche V-förmig in den mit reichlich Humus bedeckten Buntsandsteinverwitterungsboden im Wald eingegraben und dabei mit ziemlich hoher Fließgeschwindigkeit Humus und Boden abgetragen und fortgespült. Nach der Vereinigung zum Bidenebach floss dessen Wasser dann langsamer und Bodenteilchen lagerten sich ab. Hier erweiterte sich das Tal zu einem Kessel, durch den sich der Bach auf einer Länge von ca. 500 Metern nur mühsam seinen Weg talabwärts in Richtung Osten bahnte. Dieser Sumpf mit seinem brackigen Wasser hatte ihnen, aber noch mehr dem verfolgten Hirschen, damals alle noch vorhandenen Kräfte abverlangt. Nach erfolgreich abgeschlossener Jagd waren die beiden jungen Männer so fasziniert von diesem Platz, dass sie immer wieder darüber sprachen und sich schließlich entschlossen, dort mit ihren jungen Familien zu siedeln.
Dass ihre Entscheidung richtig war, zeigte sich schon nach wenigen Jahren, als zwei ihrer Geschwister in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ebenfalls Höfe gründeten. Zusammen bearbeiteten die vier Familien bzw. ihre Nachkommen über Jahrhunderte hinweg etwa 120 Hektar Äcker und Wiesen.
Nach F. Pfister (1840) hat sich „aus vier starken Höfen (...) seit Anfang des vorigen Jahrhunderts“ (gemeint sein dürfte das 18. Jahrhundert, doch da gab es bereits ca. 10 Hausgesessen) schließlich das bis heute erhaltene Dorf Biedebach entwickelt.
Dass die Gründung tatsächlich so ablief, ist recht unwahrscheinlich, doch wie sie sich wirklich abgespielt hat, ist völlig unbekannt. Es kann darüber nur spekuliert werden.
Nach Auffassung der Geschichtsforschung ist jedoch gesichert, dass Biedebach zwischen viertem und achten Jahrhundert n. Chr. in der Siedlungsperiode der Inneren Kolonisation entstanden ist. Es sind etwa zwei Drittel aller Ortschaften und es handelt sich dabei um die Dörfer mit den Endsilben „au – dorf – heim – feld – scheid – hausen – bach“. Ein Drittel dieser Orte wurde später wieder verlassen und damit wüst.
(nach Bruno Frießner: Die Orte des Kreises Hersfeld, Mein Heimatland Band 18, Nr. 6 September 1958)
5. Der Name Biedebach gibt Rätsel auf
Für viele Ortsnamen gibt es eindeutige, zutreffende Erklärungen. Untergeis ist eben das weit unten im Geistal liegende Dorf.
Biede(n)bach gab es ursprünglich drei Mal, bei Hersfeld als früheren Besitz der Schaden von Leibolds bzw. des Klosters Hersfeld, dann Biedebach südöstlich der Ortsmitte von Kirchheim unter der Grundherrschaft des Klosters Hersfeld sowie in der Schwalm (urkundlich Bidenebach). Als Ortsname existiert Biedebach nur einmal in Deutschland. Die Vorsilbe Bidene deutet wohl auf einen prähistorischen Bachnamen.
Soll die Herkunft des Namens Biedebach ermittelt werden, so ist lediglich eindeutig, dass sich die Nachsilbe auf den im Tal fließenden Wasserlauf bezieht. Für die Vorsilbe „biede“ sind einige Varianten ins Kalkül zu ziehen.
(Westlich von Treysa befindet sich 1197 eine später wüst gewordene Siedlung Biedenbach im Besitz des Klosters Spieskappel. Heute speist in diesem Bereich der aus zwei Armen bestehende Silberbach den Biedebachteich).
Was bedeutet der Name Biedebach nun wirklich?
Handelte es sich etwa um eine Siedlung an einem aus zwei „Armen“ bestehenden Bach, dessen schmutziges, sumpfiges Wasser in einem Grenzgebiet zweier Territorien ein Mühlrad antrieb?
Vermutlich wird die Bedeutung des Namens Biedebach ein ungelöstes Rätsel bleiben.
6. Belegte Daten und Fakten zur Geschichte
6.1 Urkundliche Ersterwähnung und Besitzverhältnisse
Erst nachdem bereits ungefähr 6 Jahrhunderte (das entspricht ca. 20 Generationen) Nachkommen der ersten Siedler in Biedebach gelebt und gearbeitet hatten, soll die erste überlieferte urkundliche Erwähnung erfolgt sein.
Nach übereinstimmenden Angaben von Reimer (Historisches Ortslexikon für Kurhessen, Marburg, 1926) und Ziegler (Das Territorium der Reichsabtei Hersfeld, Marburg, 1939) wird im Hersfelder Kopiar 5, 40 Bydenbach 1369 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Ziegler schreibt auf Seite 101 ihres Buches: „Biedebach gehörte ursprünglich den Schaden von Leibolds als Hersfelder Lehen.“
An dieser Stelle sollte jetzt eigentlich eine Kopie der Ersterwähnungsurkunde von Biedebach zu sehen sein. Da sich diese Urkunde nach den Recherchen von Dr. Vahl im Hessischen Staatsarchiv Marburg jedoch weder an der angegebenen noch an einer anderen durch handschriftliche Änderung notierten Stelle und auch nicht auf Seiten mit den entsprechenden Zahlendrehern befindet, sah sich Dr. Vahl „mangels Personal und Zeit“ nicht in der Lage, das gesamte K 248 nach solchen Einträgen zu durchsuchen. Letzteres hingegen empfahl er mir und benannte die erforderlichen Pfadangaben für die Suche im Internet. Meinen Versuchen war allerdings kein Erfolg beschieden, weil ich nicht in der Lage bin, die vermutlich gotische Schrift des Kopiars zu lesen. Im Übrigen war auch schon 1970 mein damaliger Versuch eine Kopie dieser Ersterwähnungsurkunde zu erhalten, fehlgeschlagen.
Mit der Einführung der Reformation lockerten sich im Raum Hersfeld um 1527 die seit Jahrhunderten vorgegebenen und streng eingehaltenen Regeln beim Ablauf des Gottesdienstes. Der eher konservativ eingestellten Landbevölkerung war das jedoch nicht immer recht, wird aus Obergeis berichtet.
Für einen Zeitraum von fast 230 Jahren sind mir Biedebach direkt betreffend keine belegten Daten überliefert. Als nächstes wird erst im Jahre 1595 gemeldet, dass Biedebach zum Kirchspiel Obergeis gehört.
Bezüglich der Besitzverhältnisse geschieht Bedeutsames in 1596, es wird berichtet:
„Im Jahre 1596 kaufte Abt Joachim alle und jedere (...) lehenguetter, rechtte und gerechttigkeitten im Biedenbach, die Annen Marien gebornner Schadin zum Leuboltz' zustanden.“ (StAM Urkunden Stift Hersfeld a 1596 Sept. 30, Or. Perg. mt 2 eingehängten Siegeln . Gedr Demme I Beilage 104 aus Kopialbuch)
Die anderen Schadischen Erben überließen im Jahre 1603 ebenfalls den halben Teil, den sie am Dorf Biedebach hatten, dem Hersfelder Abte. (StAM Urkunden Stift Hersfeld 1603 Okt. 5 Or. Pap. mit 3 aufgedrückten Siegeln.)
Das Dorf bestand damals aus vier Höfen, die Erbgüter gewesen waren. Frondienste brauchten die Einwohner nicht zu leisten.“ (Ziegler, 1939, s. 101)
Anmerkungen
Leiboltz (früher vermutlich Leibolds) ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Eiterfeld.
Die Familie der Schaden von Leibolds war in Unterufhausen begütert, heute ist Unterufhausen ebenfalls ein Ortsteil von Eiterfeld. (Ziegler, 1939, Seite 161)
Am 7. Mai 1538 war ein Johann Schade von Leibolds Schultheiß Amtmann in Hattenbach (Ziegler, 1939, Seite 181).
Abbildung 9: Wappen der Schaden von Leibolds, die 1369 Bydenbach als Hersfelder Lehen besaßen
Im Internet sind Digitalisate einsehbar, sowohl über den Verkauf ihres Lehens durch die Familien der Erben von Leibolds als auch über die Begleichung des Kaufpreises im Jahre 1603.
So erhielten 1603 Wilhelm von Boyneburg zu Borsch, Lukas Wilhelm von Romrod, Reinhard Ludwig von Romrod und deren Ehefrauen (die Schadischen Erbinnen) als Kaufpreis für die Hälfte Biedebachs 2.700 Gulden. Abt Joachim bezahlte 2003 Gulden sofort, der Rest sollte 1604 am Peterstag beglichen werden.
Die Tilgung erfolgte 1604, bestätigt wird der Vorgang 1605.
Abbildung 10: Digitalisate
Wilhelm von Boyneburg zu Borsch (Borsa) [Ortsteil von Geisa, Wartburgkr.] sowie Lukas Wilhelm und Reinhard Ludwig von Romrod zu Leibolz (Leuboltz) [heute Ortsteil von Eiterfeld, Lkr. Fulda] bekunden für sich und ihre Ehefrauen Sabine, Sibylle und Anna Sibylle, alle geborene Schade [von Leibolz], dass sie an Joachim [Roell], bestätigten Abt von Hersfeld, ihre bei Biedebach [Ortsteil der Gem. Ludwigsau, Lkr. Hersfeld-Rotenburg] gelegenen Güter, die von ihren Ehefrauen stammen und an sie heimgefallen sind, für 2700 Gulden, gerechnet zu je 26 Albus Hersfelder Münze, verkauft haben, bestätigen den Empfang der Kaufsumme und verzichten auf alle zukünftigen Ansprüche auf die verkauften Güter. Siegelankündigung und Ankündigung der Unterfertigung der Aussteller und ihrer Ehefrauen.
6.2 Was alte Landkarten berichten / Neue Erkenntnisse aus alten Landkarten
Neue, hoch interessante Informationen entnahm ich der Reproduktion einer alten Landkarte, die mir ein Nachbar zeigte: „ABBADIA Hersfeldensis Vulgo Stifft Hersfeldt 1635“
Die Sachverhalte im Bereich um den Bidenbach zeigt der folgende Ausschnitt.
Abbildung 11: Historische Karte um 1635
Zunächst fällt auf, der Ort Biedebach selbst ist gar nicht eingezeichnet, sondern nur der „Bidenbach“ mit seinem Verlauf. Um 1620 und auch 1628 gab es jedoch immerhin 10 oder 11 Haushalte und sicher die entsprechende Zahl Häuser, sogar 1673 kurz nach dem 30-jährigen Krieg existierten sechs Haushalte. Das bestätigen auch Kirchenbucheintragungen durch die entsprechende Anzahl verschiedener Familien(namen).
Die Karte enthält im Bereich der heutigen Gemarkung Biedebach in zwei Zeilen getrennt untereinander geschrieben die Eintragung „Scha den“ und weist damit dieses Gebiet als Besitz der Schaden von Leibolds aus. Die nördliche Grenze des Schadischen Territoriums ist identisch mit der späteren Grenze zwischen Amt Geis / Gemarkung Biedebach und dem Besitz derer von Riedesel. Im Osten beginnt sie entlang der Tanner und Gerteröder Triescher, führt den Terbach (Dierbach) hinauf bis an die Alte Straße auf dem Höhenkamm, dem sie bis ein Stück vor dem Behmer (Gebrannter Kopf) folgt. Soweit stimmt der Verlauf mit jüngeren Beschreibungen überein.
Unbekannt war mir bisher der im Süden eingezeichnete Grenzverlauf. Ein Stück weit vor dem Gebrannten Kopf schwenkt diese Grenze scharf nach Südosten und verläuft im südlichen Waldbereich des Hauksberg entlang des aus dem Hottenbach kommenden Wegs. Etwa in der Mitte des Haubt grundtes (Hauksgrundes) folgt die Grenze dem Bach talabwärts bis zu dessen Vereinigung mit dem Bidenbach an der Gemarkung Tann.
Der Hauksgrund inklusive des gesamten Forstbereiches südlich davon bis an den Rand der Feldgemarkungen von Allmershausen und Heenes zählt heute zusätzlich zur Gemarkung Biedebach.
Als nächstes heißt der damalige „Haupt grundt“ heute Hauksgrund, die Bezeichnungen „Caden“ für den den Hauksgrund vom Biedebachtal trennenden Höhenzug und den Namen „Auf der Ecken“ für den Höhenzug vom Gebrannten Kopf bis zur Haukuppe sind heute unbekannt / ungebräuchlich.
Im Bereich des Gebrannten Kopfes liest man „Behmet“. Es stellt sich die Frage, ob damit Böhmerwald gemeint sein könnte?
Auch der damalige „Luckersberg“ im Grenzbereich zwischen Tann und Gerterode hat heute eine andere Bezeichnung, er heißt Sommerberg.
Eine andere, zehn Jahre jüngere Landkarte „Territorium Abbatia Hersfeldensis, 1645“ weist die Gemarkung Biedebachs nicht mehr als Gebiet der „Schaden“ aus und zeigt damit die vertraglich 1596 bzw, 1603 festgelegten neuen Besitzverhältnisse. Es sind wieder nur der „Bidenbach“ und „Hauptbach“ (= Hauksbach, der erst in Tann in den Rohrbach mündet), nicht jedoch die Siedlung Biedebach eingezeichnet.
Unverständlich bleibt, warum der Ort Biedebach selbst als solcher fehlt.
6.3 Verlauf der Grenzen nach amtlichen Beschreibungen im Raum Biedebach
6.3.1 Grenzverlauf zwischen Amt Geis und den Herrn von Riedesel
Soweit durch historische Quellen belegt, gab es im Raum Biedebach keine größeren Grenzstreitigkeiten, obwohl die Gemarkungsgrenze oder zumindest ihr nördlicher Teil auch immer Territorialgrenze war.
Für 1642 und 1673 gibt es nahezu identische Grenzbeschreibungen (Ziegler, 1939, Seite 40/41, Seite 272 u. 273).
Bezüglich des Grenzverlaufs zwischen dem „Amt Geis mit den Herrn von Riedesel im Hessischen“ steht bei Ziegler, 1939, Seite 233 u. 234:
„Daselbsten der itzige schultheißeundt gerichtsschreiber Johan Pletsch des ampts Geyß nebst George Niedingen, Henrich undt Paul Scheffer undt anderen seinen ampts anbefohlenen von der Biedenbach auch gestanden, seindt wir nebenst edelbesagtem Riedtesell zur rechten handt an der wießen hinauff biß vor den Thierbach, daselbsten ein mahlstein stehet, gangen, forderst im tieffen graben, den Thierbach genant, hinauff, da sich der grabe wendet, uff einen eichenbaum undt darunter ein mahlstein, mit einem creutz gehawen, stehet, dan den bergk hinauff biß uff die Sange, wiederum uff einen mahlstein, von adr uff einen mahlstein zwischen den Riedteseln oberm Buchengraben am Herrgotts Ruck uff einen Stein, so der letzte zwischen den Riedteseln undt dem stifft Herßfeldt an der Thalheußer halla undat am Schmidts Graben, von dar uff der Flachen Dellen hindurch, daselbsten verschiedene gezeichnete beume undt etzliche, so niedergeknicket, stehen, uff einen großen Eichenbaum, da der wegk uff der rechten handt die höhe hinauß bis an die Kitzwießen, da die Wallensteinische grentze angehet (...).“
Diese Grenze verläuft auch heute noch als Gemarkungsgrenze zwischen Biedebach im Süden und Gerterode und Thalhausen im Norden bis zum Bereich des Gebrannten Kopfes. Bis zur hessischen Gebietsreform 1972 war diese ehemalige Territorialgrenze der Reichsabtei Hersfeld auch die Grenze zwischen den Landkreisen Rotenburg/Fulda und Hersfeld in diesem Raum. Ganz im Nordwesten, in der Nähe des Gebrannten Kopfes, begann der frühere Landkreis Fritzlar-Homberg.
Dass Paul Scheffer (1611–1684) und Henrich Scheffer (um 1620-1665) in Biedebach lebten, belegen Kirchenbucheintragungen und Henrich war sogar der damalige Gerichtsschöffe und Kirchensenioris in Biedebach.
Der „mahlstein“ vor dem Thierbach ist eine der letzten an dieser Grenze noch vorhandenen Grenzmarkierungen. Er stand unmittelbar links am Rand des nach Gerterode führenden Weges, ist allerdings umgedrückt und deshalb ist nur das nach Süden zeigende „v R“(von Riedesel) und nicht auch das auf der Nordseite eingemeißelte CL(Carl, Landgraf) zu sehen. In der Gemarkung Oberthalhausen nördlich des Hergertsrücks gibt es vier Walddistrikte mit den Namen „Überm-, Kleiner-, Großer- und Vorm Schmiedsgraben“.
Das Gebiet Wallenstein (z.B. Mühlbach, Saasen, Salzberg) zählte bis zur Gebietsreform 1972 zum damaligen Landkreis Fritzlar-Homberg, heute zum Schwalm-Eder-Kreis.
Grenzsteine mit Kennzeichnung „R“iedesel
Abbildung 12: Vor dem Thierbach (umgedrückt)
Abbildung 13: Grenzstein
6.3.2 Die Grenze der Biedebacher Feldgemarkung
In § 22 des Lager-, Stück- und Steuerbuches von 1821 steht über die Grenze der Biedebacher Feldgemarkung:
„Ist die Grenze um hiesige Feldmarck durchgehends regulair und mit keinen benachbarten Dörfern oder Herrschaftten strittig. Es fängt sich dieselbe an der Ecke des Herrschaftlichen Waldes der lange Außrein an, lauf an den Tannischen Trieschern, Land und Wiesen im Erlenstrauch genannt fort bis an die Gerterother Triescher dem Fuchsgraben, unter dessen Triescher weg bis zum 1ten, 2ten, 3ten und 4ten Grentzstein, wo sich sodann diese Triescher enden und der Herschaftliche Wald der Thierbach genannt, seinen Anfang nimmt, und von da unter demselben Weg von Aufwurf zu Aufwurf bis an die Sommerseite lauf, von diesem Wald wieder von Auf- zu Aufwurf bis in den Buchgraben über den Buchrück hin bis in die Winterseite, durch die Leimenkaute bis in die Rotheckers Delle, von da unter dem Herrschaftlichen Wald her bis in den Eichelgarten bis über den Untergeißern Weg, als an dem Herrschaftlichen Wald die Hohe Lied hinunter bis an den Stadtweg, über diesen Weg als an den vorgenannten Wald fort bis wieder auf den langen Außrein wo der Anfang gemacht worden ist.“
Es fällt auf, dass der Herrschaftliche Wald Thierbach sowie an der Sommerseite und am Buchgraben zur Feldgemarkung zählt. Heute handelt es sich um von Hessen Forst bewirtschafteten Staatswald außerhalb der eigentlichen Feldgemarkung.
6.4 Veränderungen in der politischen und juristischen Verwaltung im Lauf der Zeiten
Nach den Ämterbeschreibungen von 1642 und 1673 zählte Biedebach mit Obergeis, Untergeis, Gittersdorf und Aua sowie den Höfen Eisenberg und Erzebach sowie der Röhrichs- und der Liedemühle zum Amt Geis, über dessen Entstehung keine genauen Angaben vorliegen.
Es ist umstritten, ob sich das Dorf Obergeis um eine Villikation (Schenkung Karls des Großen) entwickelt hat.
Die Grundherrschaft besaß zunächst das Kloster Hersfeld, später die Landgrafschaft Hessen-Kassel.
Das Amt (Ober)Geis war einer der 13 Verwaltungsbezirke, in die das Territorium der Reichsabtei Hersfeld eingeteilt war.
Von einem Amtmann „yn der Geysa“ und einem „zugehörigenn Gericht“ wird zuerst 1394 berichtet (Ziegler, 1939, Seite 100). Sowohl „kriminale“ als auch „zivile Jurisdiktion“ wurden ausgeübt. Nach anderen Quellen gehörte die „peinliche Gerichtsbarkeit“ um 1673 jedoch zu Niederaula.
Im Hochgerichtsbereich Hersfeld ging 1182 die Verwaltungstätigkeit der früheren Burggrafen an den Fronhofsminister des Abtes, den „villicus“ über, der seitdem den Titel Schultheiß trägt.
Im 18. Jahrhundert lautete die Amtsbezeichnung „Grebe“, und so gab es in der gesamten Landgrafschaft Hessen-Kassel seit 1739 die Grebenordnung als Dienstanweisung für die Dorfvorsteher. Grebe war meist der größte Bauer. Er besaß eine Mittelstellung zwischen Dorfgemeinschaft und Herrscherhaus. Erst 1834 wurde der Grebe durch den Bürgermeister ersetzt (Reyer, 1983, Seite 74).
Von 1807 bis 1813 zählte Biedebach zum Kanton Hersfeld im Königreich Westfalen, wo Jerome, ein Bruder Napoleons, regierte. Wegen seiner „lockeren Lebensführung“ nannte ihn das Volk „König Lustig“. In dieser Zeit gab man dem Dorfvorsteher die französische Bezeichnung „maire“.
Ab 1866/1867, im Königreich Preußen, zählte Biedebach zur Provinz Hessen-Nassau im Regierungsbezirk Kassel und lag jetzt im Landkreis Hersfeld.
Am 31.12.1971 trat die bis dahin selbständige Gemeinde Biedebach in die neu gegründete Großgemeinde Ludwigsau ein. Seitdem gibt es im Ort lediglich noch einen Ortsvorsteher als Vorsitzenden des fünfköpfigen Ortsbeirates, welcher die Gemeindevertretung (Legislative) und den Gemeindevorstand (Exekutive) berät.
6.5 Verzeichnis der Amtspersonen
Bei einer Reihe von Männern sind im Kirchenbuch Bezeichnungen wie Gerichtsschöffe, Grebe und später Schultheiß oder Bürgermeister zu lesen, jedoch nur sporadisch für einzelne Jahre. Der komplette Amtszeitraum geht jedoch aus diesen Angaben nicht hervor. Die folgende Liste ist unvollständig und sicher zeitlich auch nicht immer ganz exakt, sie verschafft aber einen groben Überblick über die örtlichen Amtsinhaber im Verlauf der Jahrhunderte.
Name
ID
Lebenszeit
Amt
Bemerkung
Hans Apel
14759
*1606 † 1677
Gerichtsschöffe, Kirchensenioris
Henrich Scheffer
12969
*1620 † 1665
Gerichtsschöffe, Kirchensenioris
Joh. Henrich Wiegand
I3529
*1678 † 1738
Gerichtsschöffe, Kirchensenioris
Joh. Martin Wiegand
I1139
*1734 † 1799
Grebe 1769, 1774, 1775 Gerichtsschöffe 1799
Zacharias Axt
I7079
*1734 † 1800
Grebe 1781
Joh. Henrich Apel
I4133
*1738 †?
Grebe 1785 (zuvor Husar)
Joh. Justus Opfer
I7711
*1762 Niederaula †1820
Grebe 1800, 1801, 1805 Gerichtsschreiber 1820
Joh. Peter Bätz
I13262
*1778 † 1835
Grebe 1806, maire 1811 Maire-Adjunct 1813, Schulze 1818
Jakob Opfer
I5306
*1759 Gittersdorf †1821
Schultheiß 1821
Hs.-Nr.12
Joh. Adam Kehl
I13499
*1800 Unterhaun †1881
Bürgermeister 1830, 1834, 1836, 1840, 1841, 1842, 1844 (zuvor Musketier)
Hs.-Nr.2
Joh. Caspar Knoth
I13292
*1787 †1847
Bürgermeister 1836, 1840 Kirchensenioris 1844
Hs.-Nr.10
Johannes Heyer III
I13699
* 1815 Kalkobes + 1864
Bürgermeister 1852, 1854, 1862
Hs.-Nr.14
Wilh. Heinrich Jacob
I17855
*1843
Bürgermeister 1878, 1880 1880 Auswanderung
Hs.-Nr.3
Adam Wilh. Wiegand
I14015
*1856 † 1892
Bürgermeister 1882
Hs.-Nr.19¼
Bernhard Karpenstein
I6495
*1825 Heenes †1886
Bürgermeister 1881, 1883, 1886
Hs.-Nr.20
George Hassenpflug
I17973
*1864 †1944
Bürgermeister 1895
Hs.-Nr.12
Adam Fuchs
I17934
*1860 †1902
Bürgermeister 1902?
Hs.-Nr.21½
Wilh. Peter Bätz
I18024
*1869 †1956
Bürgermeister 1907, 1909,
Hs.-Nr.15
1912, 1917, 1921
Ludwig Grenzebach
I18138
*1884 † 1966
Bürgermeister? 1926–1933
Hs.-Nr.21
Adam Heinr. Bätz
I18233
*1897 †1976
per Dekret Bürgermeister 1933–1945
Hs.-Nr.6
Gohlke
Bürgermeister (von der Militärregierung eingesetzt)
Heinrich Hassenpflug
J18240
*1898 †1970
Bürgermeister 194 -1962
Hs.-Nr.19
Kurt Fuchs
*1934†
Bürgermeister 1962 -1971 Ortsvorsteher 1972 - 1976
Hs.-Nr.21½
August Grenzebach
I19807
*1930†
Ernst Baumgartl
I14028
*1925 Sauersack/Erzgeb
†
Niederaula
Ortsvorsteher 1980 - 1992
Bodo Zitzwitz
Ortsvorsteher 1993 -1997
Werner Kehl
Ortsvorsteher 1997 - 2006
Jörg Karpenstein
Ortsvorsteher 2006 - 2021
6.6 Heeneser und Gittersdorfer Wiesen
Es fällt weiter auf, dass die Wiesen des Hauksgrundes (noch) nicht erwähnt werden. Zählten sie zu Orten im Geisgrund? Die Wiesen oberhalb der Dicken Eiche bis zum Abzweig des Finstertals heißen „Heeneser Wiesen“, die unterhalb der Dicken Eiche bis zum Weg zur Schneider-Hütte „Gittersdorfer Wiesen“. Da die Gittersdorfer Familie Jacob entlang dieser Wiesen einige Hektar Fichtenwald besitzt, darf angenommen werden, dass auch diese Wiesen einmal Gittersdorfer Besitz waren. Entsprechendes gilt für die Heeneser-Wiesen. Erst irgendwann im 19. Jahrhundert im Verlauf einer Verwaltungsreform oder auch erst 1910 bei der Verkopplung dürften sie Biedebach zugeschlagen worden sein. Eventuell weil sie dann von Biedebachern gekauft und bewirtschaftet wurden, da die Anfahrtswege von Gittersdorf/ Heenes um einiges länger sind.
Ursprünglich zählten diese Wiesen sicher zu der später wüst gewordenen Siedlung oberhalb der Dicken Eiche, sie ist zwar nicht namentlich, zumindest aber durch Scherbenfunde belegt. Etwas Vergleichbares ist für ursprünglich zur Wüstung Richelrode zählende Wiesen im oberen Hauk dokumentiert. Dort übergab 1530 der Hersfelder Abt Wiesen an Bewohner zu Geisa, sie werden allerdings nicht „Geiser Wiesen“ genannt. Eine dieser Wiesen wurde bis vor ca. 30 Jahren von Untergeis aus bewirtschaftet (Familie Schaub) und gehört jetzt einer Hersfelder Familie (Grebe).
6.7 Teer-oder Pechhütten
Hinweisen möchte ich auch darauf, dass der gesamte Staatswald südlich des Hauksgrundes zur Gemarkung Biedebach zählt und diese damit an die Feldgemarkungen von Allmershausen und Heenes heranreicht. So wurden noch in der Biedebacher Gemarkung, aber nahe bei Allmershausen im Hottenbachtal und nahe bei Heenes im Beerengraben, Reste von Teer-oder Pechhütten gefunden, die aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammen. Es gab damals in diesem Bereich weit und breit den einzigen Nadelholzbestand, dessen Holz zur Teer- oder Pechherstellung benötigt wurde.
6.8 Wüste Siedlungen in der Gemarkung
Am Talschluss des Hauks, oberhalb der scharf nach links führenden Kurve des Weges, gab es eine Siedlung. Bereits im 13. oder mit Sicherheit aber im 14. Jahrhundert war sie wieder verlassen worden. Es handelt sich um Riffelderode oder Richelrode (Sippel, 1989). Südöstlich davon im flachen Hangbereich des Buchenwaldes befinden sich einige ehemaliger Ackermittelraine als Indizien. Im Jahr 1530 gab der Hersfelder Abt zwei Einwohnern zu Geisa eine „Wiese im Haugkgrunde zu„Riffelderode“(Landau, 1858). Nach Reimer (1926) trägt die entsprechende Urkunde auf der Rückseite die im 17. Jahrhundert gemachte Aufschrift „Richelrode“, demnach war damals dies die Schreibweise. Im Hangbereich oberhalb des 1985 dort ausgebaggerten Teiches fanden Dr. Sippel (124 Keramikscherben eines Linsenbodens am 28.4.1986), Familie Kehl (Mai 1986), Imhof (Herbst 1986) und Familie Waldeck (28.5.1987) weitere Keramikscherben, Bronzeblechstückchen und Kieselschieferabspliß, die überwiegend in das Hoch- und Spätmittelalter (12. bis 14. Jahrhundert) datiert werden. Zumindest eine Keramikscherbe schien karolingisch zu sein (Persönliche Mitteilung von Dr. Sippel, 2019). Zahlreiche Wandstücke mit teilweise alten Bruchstellen ergeben z.T. zusammengesetzt Teile von ein oder zwei Kugeltöpfen mit gerieftem Oberteil.
Nicht weit östlich unterhalb des befestigten Weges waren auf Maulwurfshaufen in der Wiese zahlreiche Stücke Hüttenlehm zu sehen.
Die Größe der gesamten Siedlungsfläche beträgt etwa 150 x 50 Meter (Dr. Sippel, in Fundberichte aus Hessen, 1991).
Am 31.05.2019 fand Dr. K. Sippel auf einer gemeinsamen Exkursion weitere drei kleine Scherbenstücke im von Schwarzwild durchwühltem Erdboden oberhalb des 1986 angelegten Teiches. Anschließend konnte er auf dem Bergrücken östlich des Gebrannten Kopfes parallel zur Alten Straße Ackerterrassen lokalisieren. Die zugehörigen in fast 500 Metern Höhe über dem Meeressiegel gelegenen Felder wurden vermutlich vom ca. einen Kilometer südwestlich im Tal gelegenen Richelrode aus bearbeitet.
Jeweils westlich und östlich von den beiden trigonometrischen Punkten auf dem Gebrannten Kopf befinden sich, im dichten Unterholz zur Zeit schwer zu erkennen, zwei Steinhaufen von ca. zehn Metern Länge. Es sind keine Grabhügel, wie früher beschrieben, sondern vermutlich aufgeschüttete Lesesteinhaufen.
Nach Aussage eines etwa 1990 auf einer Exkursion im Hauksgrund zufällig angetroffenen Geologen (mit Namen Völker oder Becker?) sollen diese Steine aus einem Steinbruch im Bereich des Finstertals stammen.
Das komplette Gipfelareal des Gebrannten Kopfes endet in Richtung Norden mit einer etwa einen Meter hohen halbkreisförmigen wallähnlichen Böschung, deren Bedeutung nicht bekannt ist.
Abbildung 14: Bereich der ehemaligen Siedlung Riffelderode oder Richelrode am Talschluss des Hauksgrundes
Abbildung 15: In diesem Bereich war vermutlich die zweite Wüstung im Hauk
Etwa 200 Meter oberhalb der Dicken Eiche in dem etwas breiteren Bereich des Tales, ungefähr dort wo das Finstertal nach Südwesten abzweigt, fand Familie Waldeck am 28.5.1987 im Bach 14 Keramikscherben, die aus dem Mittelalter stammen und im HLM in Kassel inventarisiert aufbewahrt werden. Zwei stattliche, sehr alt wirkende Haselnusshecken, vielleicht neben alten Steinhaufen wachsend, prägen das heutige Wiesengelände. Im höher gelegenen, trockeneren Bereich zum Finstertal hin können Feldreinkonturen als Überbleibsel ehemaliger Ackerflächen gedeutet werden.
Nach Landau (1858, Seite 50) sind die topografischen Bezeichnungen Hauggrund und Finstertal für 1523 und Hauk und Haukborn für 1564 belegt.
Jagdrechtlich betrachtet war der fünf Kilometer lange, schmale Hauksgrund im 20. Jahrhundert eine zwar zum bejagbaren Gebiet Biedebachs zählende Enklave, die aber gemeinsam mit dem umgebenden Staatswald vom Förster bejagt wurde und in der viel Wildschaden zu regulieren war. Durch gesetzliche Änderungen wurde der Hauk jagdrechtlich um 1985 dem Forstbezirk zugeschlagen, mit Bereichen des umgebenden Waldes in zwei Jagdreviere eingeteilt und an Privatpersonen zur Bejagung verpachtet mit der Maßgabe der vollen Wildschadenregulierung. Seit diesem Zeitpunkt existiert eine eigene Jagdgenossenschaft für dieses Gebiet, sie heißt „Jagdangliederungsgenossenschaft Hauksgrund“.
In der Schulchronik schreibt Lehrer Willing, dass alte Dorfbewohner immer mal von einer früheren Siedlung Böhmerwald westlich im Wald von Biedebach erzählten, ja einige wollten dort sogar alte Bruchsteine gesehen haben. Der Waldbereich nordwestlich vom alten Hauksweg gilt als „Böhmerwald“. Dort konnten jedoch keine entsprechenden Hinweise entdeckt werden. Kurz nach 1900 wurde dort mit Grabungen Wasser für den beabsichtigten Bau eines Forsthauses gesucht, aber nicht in ausreichender Menge gefunden. Für die in Biedebach damals angesiedelten Untergeiser Hilfsförster wurde schließlich um 1910 in Tann eine Forstdienststelle eingerichtet.
Sollte es eine Siedlung Böhmerwald gegeben haben, könnte diese m.E. im Waldbereich (süd)östlich der „Gehsier“ benannten Waldwiese und der davon nicht weit entfernten 1910 eingefassten „Waldquelle“ zu suchen sein. Der sich heute dort befindende Wildacker ist nicht völlig identisch mit der ursprünglichen Wiese. Der Acker wurde vor ca. 20 Jahren neu oberhalb der Wiese mit direktem Zugang vom Forstweg darüber angelegt.
6.9 Besondere Dienste und Ereignisse
Die Bewohner der ersten vier Höfe brauchten ursprünglich keine Frondienste zu leisten und auch 1821 war Biedebach zehntfrei (§ 32 des Lager-, Stück-u. Steuerbuches von 1821: „die hiesigen Ländereyen sind durchgehends Zehndfrey.“)). Allerdings waren den Bewohnern inzwischen einige besondere Dienste angelastet worden.
Sie waren z.B. später zu Fuhren am Heiligen Abend und zu Jagd- und Burgdiensten verpflichtet.
Als jedoch 1732 acht Wagen Steine zur Rotenburger Schleuse und Eichen zum Schloss nach Kassel gefahren werden sollten, verweigerten die Biedebacher die Ausführung. Daraufhin wurde das Dorf mit militärischer Exekution belegt. Über deren Ausgang ist nichts überliefert.
Nach altem Brauch hatten die Biedebacher neben vom herrschaftlichen Förster geschossenes Wild eine Wache zu stellen, bis das Tier durch Bewohner eines anderen Ortes abgeholt wurde. Als um 1731 der Förster einen Hirsch geschossen hatte, schafften ihn die Biedebacher auf gutes Zureden hin sogar ins Dorf. Dort verlangte der Förster aber zusätzlich, den Hirsch nach Gittersdorf zu fahren. Jedoch luden die Biedebacher den Hirsch vom Wagen ab und stellten nach altem Brauch eine Wache daneben. Der Förster muss diesen Tatbestand seinen Vorgesetzten gemeldet haben, denn alle Beteiligten erhielten vom Amtsvogt fünf Reichstaler Strafe und mussten den Fuhrlohn bezahlen. Dem Ortsvorsteher wurden bis zur Begleichung sogar zwei Ochsen gepfändet. Die Biedebacher klagten daraufhin bei der Oberrentkammer und baten darum, dass nicht ihr Amtsvogt Bilstein sondern eine andere Amtsperson die Untersuchung führen solle. Die Biedebacher könnten Recht bekommen haben, denn in § 33 des Stück-und Steuerbuches von 1821 sind solche Fuhrdienste nicht aufgeführt. Verpflichtet war Biedebach zu jährlichen Holzfuhren aus dem nahen Wald zum Oberamtmann ins Stift nach Hersfeld und zum Rentmeister auf dem Neuenstein. Pro Wagen gab es dafür drei Leibchen Brot und einen Schnaps bzw. zwei alb (Geld), zwei Handkäs und ein sechser Brot.
Andere zu erbringende Dienste sind in acht Punkten aufgelistet. Dazu zählen z.B. Hilfs- oder Geldleistungen bei Reparaturen auf dem Eichhof, im Stift, an der Mecklarer Schleuse und an der Untergeiser Kirche sowie vorspannen beim Durchmarsch von einheimischen oder fremden Truppen. Wenn der erste Schnee fiel, hatten drei Mann einen Tag die „Wolfsspuhr zu gehen“. Dem Pfarrer war „durch 4 Mann seyn Besoldungskorn nach Oberngeiß (zu) tragen.“
6.10 Der 30-jährige Krieg
6.10.1 Der Krieg und seine Folgen für die Menschen
Obwohl Biedebach fernab der großen Heeresstraßen lag, blieben die Bewohner nicht von den Auswirkungen und Greueltaten des Kriegsgeschehens verschont, was ganz besonders für den 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648 gilt.
Der Krieg hatte schon fünf Jahre getobt, als der kaiserliche Feldherr Tilly mit seinem gewaltigen Heer 1623 in Hersfeld einrückte und mit Unterbrechungen zwei Jahre dort sein Quartier hielt. Die Stadt und die umliegenden Dörfer hatten die Soldaten von 11 Reiterregimentern, acht Regimentern Fußvolk und das Personal der dazugehörigen Artillerie zu versorgen. Allein für die Obristen (geschätzt 15) wurden täglich benötigt: 40 Pfund Brot, 38 Pfund Fleisch, 8 Maß Wein, 38 Maß Bier, 4 Hennen, ein halbes Schaf oder Kalb
Der gewaltige Tross, der den Soldaten folgte, wurde in Privathäusern einquartiert. Selbst einem Landsknecht standen täglich 2 Pfund Brot, 1 Pfund Fleisch und 2 Maß Bier zu. In einer Verpflegungsordnung war festgelegt, dass einem Obristen sieben Reichstaler, 18 Diener, 14 Dienst-, Fuhr- und Wagenpferde zustanden, für die die Bevölkerung das nötige Stroh, Heu und den Hafer zu liefern hatte. Ein einziger Bauer soll täglich bis zu 50 Personen zu verpflegen gehabt haben (Willing, 2018, Seite 9).
Wie brutal im Raum Hersfeld die Kaiserlichen wüteten, erlebte der Feldherr Tilly persönlich im Oktober 1623. Er war dabei ein Regiment aus dem Rohrbachtal (auch in Biedebach?) in das Amt Grebenau zu verlegen. Da kam ihm die verwilderte Truppe entgegen und trieb an die 2.000 geplünderte Rinder und Schafe vor sich her. (Willing, 2018, Seite 10).
Selbst wenn man die Zahlen als „stark übertrieben“ ansieht, dürfte es auf den Bauernhöfen im Besengrund damals kein Vieh mehr gegeben haben, was für 1639 bestätigt wird (siehe Milbradt, Hilmar: Das Hessische Mannschaftregister von 1639, Frankfurt 1959).
Verstärkt wurden die Leiden der Bevölkerung zusätzlich durch die 1626 grassierende Pest. Über die Zahl der Toten in Biedebach gibt es keine mir bekannten Angaben.
Im Jahre 1636 verwandelten einfallende Kroaten Meckbach in einer Strafaktion in Schutt und Asche. Die Menschen flohen, sofern es ihnen überhaupt gelang, in die Wälder und verbargen sich dort.
In einem ihre Verzweiflung ausdrückenden Brief flehten 1637 Dekane, Ritter und Prälaten ihren Landgrafen an, einen Partikularfrieden abzuschließen. Er solle sich deshalb vor Augen führen,
„wie im abgewichenen Monat die Kaiserlichen mit unerhörtem Exempel die Bewohnerniedergehauen, die Zungen aus dem Halse und Nasen und Ohren abgeschnitten, die Augen ausgestochen, Nägel in Hände und Füße geschlagen, Pech, Blei und allerhand Unflat ihnen in den Leib gegossen, mit Sägen gesägt, mit Stricken zu Tode gewürgt, mit Pferden geschleift, das Weibvolk ohne Unterschiede des Alters und des Standes gequälet und geschändet, in die Kinder wie die wilden Tiere gefallen, diese im Backofen gebraten, die umliegenden Oerter verbrannt und andere barbarische Grausamkeiten verübten.“ (aus Schulchronik Meckbach S. 239. Aufzeichnungen von W. Södler, zitiert nach Willing, E. , 2018, Seite 11).
In der Biedebacher Schulchronik ist nachzulesen, dass der Landwirt George Hassenpflug Lehrer Jakob Willing um 1925 berichtete, nach überlieferten Erzählungen sei das Dorf „stark entvölkert“ gewesen.
„Die Äcker seien zum größten Teil wüst liegen geblieben. Die Domhecken der Grenzraine