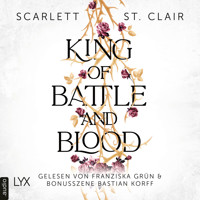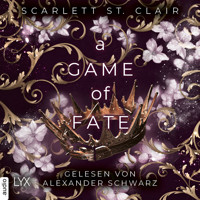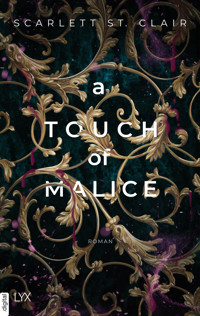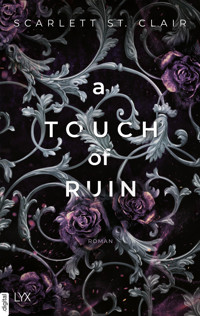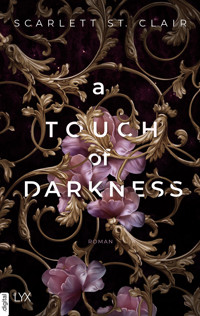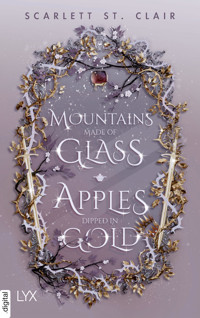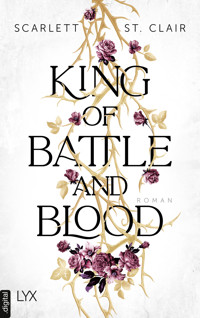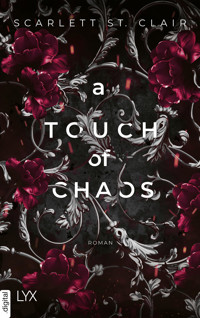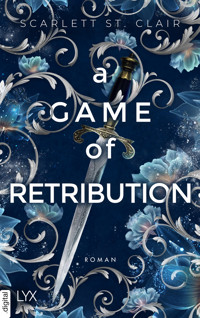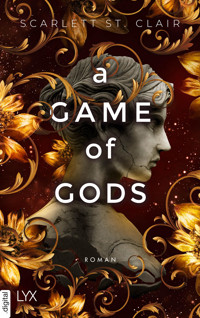
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Hades-Saga
- Sprache: Deutsch
Sie ist mein Alles. Meine erste Liebe, meine Ehefrau, die erste und letzte Königin der Unterwelt
Hades, der König der Unterwelt, will Persephone endlich offiziell zu seiner Braut machen. Doch ihre Mutter Demeter stellt sich ihnen in den Weg und straft New Greece mit zerstörerischen Schneestürmen, solange sie ihre Hochzeitspläne nicht aufgeben. Und nicht nur sie gefährdet das zukünftige Bündnis, denn auch der Halbgott Theseus verfolgt mithilfe der Triade, einer Gruppe, die unter dem Vorwand der Rebellion für Chaos sorgt, seine ganz eigene Agenda. Kann Hades das undurchschaubare Spiel der Götter gewinnen? Oder wird er sein Reich und Persephone für immer verlieren?
»Leidenschaft und Liebe, dass ich ihr von der ersten Seite an verfallen bin. Egal, ob Spannung, griechische Mythologie, Lügen und Geheimnisse oder Spice - all das und noch so viel mehr hat diese Geschichte zu bieten. Lasst euch in die Welt der Götter entführen!« CITY OF WORDS AND PAGES
Band 3 der HADES-Saga von Bestseller-Autorin Scarlett St. Clair
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Motto
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Siebenunddreißig
Kapitel Achtunddreißig
Kapitel Neununddreißig
Kapitel Vierzig
Kapitel Einundvierzig
Kapitel Zweiundvierzig
Kapitel Dreiundvierzig
Kapitel Vierundvierzig
Kapitel Fünfundvierzig
Anmerkungen zur Bonusszene
Bonusszene
Dionysos und Ariadne
Anmerkung der Autorin
Danksagungen
Die Autorin
Die Romane von Scarlett St. Clair bei LYX
Impressum
SCARLETT ST. CLAIR
A Game of Gods
Roman
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
ZU DIESEM BUCH
Hades, der König der Unterwelt, ist bereit, alles dafür zu tun, um seine anstehende Heirat mit Persephone zu retten. Er will die Göttin des Frühlings endlich offiziell zu seiner Braut machen. Doch ihre Mutter Demeter stellt sich ihnen in den Weg und straft ganz New Greece mit zerstörerischen Schneestürmen, solange sie ihre Hochzeitspläne nicht aufgeben. Und nicht nur sie gefährdet Hades’ und Persephones Liebe, denn auch der Halbgott Theseus verfolgt seine ganz eigene Agenda. Mithilfe der Triade, einer Gruppe, die unter dem Vorwand der Freiheit und Rebellion für Chaos sorgt, will er die Olympier stürzen. Wird Hades es schaffen, ihn zu stoppen, und das undurchschaubare Spiel der Götter gewinnen? Oder wird er sein Reich und Persephone für immer verlieren?
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Dieses Buch ist meinen Leser:innen gewidmet.
Diese Reihe ist eine Soap Opera.
Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid.
»Alles ist schöner, weil wir verdammt sind.«
– Homer, Die Odyssee
»Wir Liebenden fürchten alles.«
– Ovid, Metamorphosen
»Meine Rache ist meine Schuld.«
– Ovid, Metamorphosen
KAPITEL EINS
Hades
Hades stand nur wenige Schritte entfernt von einem brennenden Bauernhaus.
Nur das Gerippe war noch übrig, ein schwacher Umriss dessen, was das Haus einmal gewesen war, doch die Flammen tobten immer noch und füllten die Nacht mit Rauch und Asche. Zu seinen Füßen lag der Leichnam eines alten Mannes. Es war der Bauer, der in diesem Haus gelebt hatte. Sein Rücken war voller Einschusslöcher. Nahebei trieb seine Seele, ohne zu erkennen, dass sie seinen physischen Körper verlassen hatte, und verrichtete Dinge, von denen Hades nur annehmen konnte, dass sie seine nächtliche Routine darstellten. Dies war normal für einen Sterblichen, den ein plötzlicher Tod ereilt hatte.
Der alte Mann hatte es nicht kommen gesehen.
Nicht dass dies möglich gewesen wäre. Schließlich war sein einziges Pech, den Ophiotauros gesehen zu haben, ein Monster, halb Stier, halb Schlange, das außerdem ein prophezeiter Göttertöter war. Jemand hatte Wind davon bekommen und den Bauern besucht, um mittels vorgetäuschter Autorität mehr zu erfahren, und sobald dieser Jemand hatte, was er wollte, hatte er den Mann getötet.
Hades fühlte Thanatos’ Magie auflodern, als dieser sich neben ihm manifestierte, ein Schatten, der sich in die Nacht einfügte. Sein helles Haar und sein Gesicht fingen sogar den Widerschein der Flammen ein.
Keiner von ihnen sagte etwas – es war nicht notwendig. Es blieb nichts zu tun, als die Seele dieses Bauern in die Unterwelt zu geleiten. Sobald er sich im Asphodeliengrund befand, bestand die Möglichkeit, dass er ihnen sagen konnte, wer ihn ermordet hatte, doch Hades sorgte sich, dass es dann zu spät wäre. Bis dahin würde es mehr Sichtungen des Ophiotauros geben, und wer immer hinter ihm her war, würde eine Spur aus Leichen hinterlassen, bis er das Monster eingeholt hatte.
»Tode wie diese betrauere ich am meisten«, sagte der Gott des Todes.
»Du meinst Morde?«, fragte Hades.
»Er hatte nicht mehr lange auf dieser Erde, und trotzdem wurde ihm das bisschen Leben genommen.«
Hades sagte nichts, aber er war derselben Meinung.
Der Tod dieses Bauern war unnötig gewesen. Die einzige nützliche Information, die er zu bieten hatte, war die Bestätigung, dass der Ophiotauros lebte. Um dieses Gerücht zu bestätigen, hätte er nicht sterben müssen.
Hades würde denjenigen finden, der das getan hatte, und die Strafe würde rasch und angemessen ausfallen.
Sein Blick glitt vom Feuer hin zu der Seele des Bauern, der inzwischen verzweifelt versuchte, den brennenden Stall zu betreten, wahrscheinlich in dem Versuch, die Tiere darin zu erreichen, doch die waren bereits dahin.
»Schenke ihm Frieden«, sagte Hades.
An diesem Punkt in seinem langen Leben empfand er nicht häufig Mitgefühl für die Toten, doch in Augenblicken wie diesem, wenn die Grausamkeit der Menschheit am offensichtlichsten war, wog die Bürde, Erleichterung zu gewähren, schwer.
Thanatos nickte, breitete seine Flügel aus und trat zu der Seele hin.
Hades verließ den Schauplatz und begab sich auf das riesige Feld hinter dem Heim des Bauern, weit vom Schein des Feuers entfernt.
Über seinem Kopf leuchteten die Sterne so hell, dass die Welt Schatten warf, und sein eigener Schatten war der größte auf den schneebestäubten Grashalmen. Obwohl es Sommer war, war es eiskalt – ein fragwürdiges Geschenk von Demeter, der Göttin der Ernte.
Und das war kein Zufall.
An dem Abend, als er Persephone offiziell um ihre Hand gebeten und sie Ja gesagt hatte, hatte der Sturm begonnen. Es war Demeters Kriegserklärung und zugleich die Waffe ihrer Wahl, um sie beide auseinanderzutreiben. Es erschien unbedeutend, nur einige gefrorene Tropfen, doch es war der Beginn von etwas Schlimmerem.
Menschen würden sterben. Es war nur eine Frage der Zeit.
Und wenn das geschah, würde Persephone dann um ihre Liebe kämpfen, oder würde sie sich ihrer Mutter beugen, um die Welt zu retten?
Er hasste es, dass er Letzteres annahm.
Ihm wurde klar, dass dies eine furchtbare, eine unmögliche Lage war. Würde Demeter ihre Tochter wirklich lieben, hätte sie ihr dieses Ultimatum nie gestellt.
Hades dachte über all das nach, als er den Himmel betrachtete und sein Blick Sterne miteinander verband. Unter den Bildern, die sie ergaben, erkannte er Keto, das Meeresmonster, das von Herakles erschlagen worden war; Auriga, den griechischen Helden, der von Athene aufgezogen worden war; Aries, den goldenen Widder, dessen Vlies jedes Lebewesen heilen konnte; und Orion, den Jäger, der es gewagt hatte, Gaia zu verärgern. Doch Taurus, das Sternbild, das beim Tod des Ophiotauros während des Titanenkrieges in ihrer Mitte erschienen war, war fort.
Es war der Beweis, nach dem Hades gesucht hatte. Was Ilias gesagt hatte, stimmte – das Monster war wieder zum Leben erweckt worden. Nicht dass Hades ihm nicht geglaubt hatte, aber Gerüchte blieben Gerüchte.
»Verdammte Moiren«, knurrte er, und er verfluchte sie zu Recht. Lachesis, Klotho und Atropos hatten diese Auferstehung eingefädelt, doch er wusste, dass es nur dazu gekommen war, weil er Briareos getötet hatte – einen der Hekatoncheiren, der hunderthändigen Giganten, die den Olympiern während des Titanenkrieges geholfen hatten. Hera, die Göttin der Ehe, hatte eine Gelegenheit gesehen, sich an dem Giganten zu rächen, der Zeus geholfen hatte, seinen Fesseln zu entkommen, als sie, Apollo und Athene ihn zu stürzen versucht hatten.
»Eine Seele für eine Seele«, hatten die Moiren gesagt.
Er fühlte einen schmerzhaften Stich in der Brust, als er sich daran erinnerte, wie Briareos gestorben war. Ohne Kummer, ohne Betteln oder Zorn, nur mit friedlicher Akzeptanz. Vielleicht war dies das Schlimmste dabei gewesen, das Vertrauen, das der Gigant in ihn gesetzt hatte. Dass er geglaubt hatte, es sei für ihn an der Zeit gewesen, zu gehen, und nicht, dass sein Tod von einer anderen Gottheit befohlen worden war.
Und selbst als Hades Briareos’ Hand genommen und seine Seele aus dessen Körper gezogen hatte, wie einen Schatten, der aus der Dunkelheit gelöst wurde, hatte er gewusst, dass die Konsequenzen weitreichend sein würden, noch weiter als selbst die Moiren weben konnten. Denn sobald Zeus und Briareos’ Brüder Gyges und Kottos herausfanden, was er getan hatte, hätte er nicht länger deren Unterstützung und Treue. Nicht dass er glaubte, dass einer der Brüder ihn Zeus vorziehen würde. Er war schließlich nicht derjenige, der sie aus der Finsternis des Tartaros gerettet hatte. Doch sie waren Verbündete der Olympier im Krieg gegen die Titanen gewesen und hatten ihnen geholfen, die älteren Götter in die Tiefen des Tartaros zu verbannen. Es bedeutete, falls Hades sich als Gegner von Zeus wiederfinden würde, wovon er vor allem in Bezug auf seine Verlobung mit Persephone überzeugt war, würde er keine Hilfe von den beiden übrigen Giganten bekommen, und das konnte er ihnen nicht übelnehmen.
Hades hatte ihnen ihre Loyalität mit einer Hinrichtung vergolten.
Der Gott der Toten verließ das Feld und manifestierte sich in seinem Büro im Nevernight. Kaum war er erschienen, senkte sich Stille herab, greifbar und schwer. Er musterte die Versammelten: Ilias, Zofie, Dionysos und … Hermes.
Hades’ Blick fiel auf den Gott der Diebe, der es sich in seinem Sessel bequem gemacht und die Füße auf seinen Schreibtisch gelegt hatte. Ihre Blicke trafen sich, und im goldenen Gesicht des Gottes erschien ein schiefes Lächeln. Hades erwiderte seinen Blick finster, woraufhin Hermes hastig auf die Füße kam.
»Ich habe ihn nur warmgehalten!«, verteidigte er sich.
Hades erwiderte nichts und nahm Platz. Der Sessel war tatsächlich warm, was ihn dazu veranlasste, Hermes nur noch eindringlicher anzustarren.
»Nur das Beste für den König der Toten«, fügte Hermes mit einem frechen Grinsen hinzu und machte Anstalten, sich auf den Rand von Hades’ Obsidianschreibtisch zu setzen.
»Sollte auch nur eine deiner Pobacken diesen Tisch berühren, Hermes, mache ich Lava daraus.«
»Ist doch nicht so, als wären sie nackt«, entgegnete Hermes.
Hades warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
»Weißt du was? Die Couch ist sowieso viel bequemer«, meinte Hermes und setzte sich auf die Armlehne.
Hades wandte seine Aufmerksamkeit den Versammelten zu, insbesondere Dionysos. Dieser hielt sich im Hintergrund und war ganz offensichtlich kein Teil der Gruppe – wahrscheinlich, weil er es nicht sein wollte. Er trug eine dunkle Hose und einen beigen Pulli und war damit sehr viel lässiger gekleidet als üblich. Seine dicken Zöpfe waren nach hinten gebunden, und er hielt die Arme verschränkt. Er sah frustriert aus, und wenn Hades raten müsste, hatte dies weniger mit seiner Vorladung ins Nevernight zu tun, sondern vielmehr mit der sterblichen Kriminalpolizistin, die Dionysos in seinem Club beherbergte: Ariadne Alexiou.
Hades war überrascht, dass der Gott überhaupt gekommen war, obwohl das wahrscheinlich nur an seiner Neugier lag. Dionysos’ Beziehung zu den Olympiern war schwierig, was größtenteils an Heras Hass auf ihn lag. Das war auch der Grund, warum Dionysos sich schließlich für eine Seite entschieden hatte. Aber Hades war nicht dumm. Er wusste, dass das nicht bedeutete, dass Dionysos ihm gegenüber loyal wäre. Es bedeutete nur, dass der Gott des Wahnsinns loyal gegenüber sich selbst war.
»Der Ophiotauros wurde wieder zum Leben erweckt«, erklärte Hades. »Sein Sternbild ist nicht mehr am Himmel.«
Die Worte laut auszusprechen brachte ein gewisses Grauen mit sich, das Hades nicht zu empfinden erwartet hatte. Aber er war dafür verantwortlich, was bedeutete, dass er ebenso für die Konsequenzen verantwortlich war, falls das Geschöpf in die falschen Hände fiel.
»Ilias«, sagte Hades und sah dem Satyr, der neben Zofie stand, fest in die Augen. Sein Haar war so gelockt, wie seine Hörner gekrümmt waren. »Sag uns, was du über das Monster erfahren konntest.«
»Bisher gab es nur eine Sichtung. Ein Bauer außerhalb von Theben hat behauptet, er habe mitten in der Nacht ein seltsames Heulen gehört. Er dachte, eine seiner Kühe sei verletzt worden, aber als er nachsehen wollte, fand er eine Kreatur vor, halb Stier, halb Schlange, die sich um sie geschlängelt hatte. Als die Kreatur ihn bemerkte, sei sie durch das Gras davongeglitten.« Ilias zögerte kurz und ließ den Blick über die Versammelten schweifen. »Die Kuh hat nicht überlebt.«
Darauf folgte ein Herzschlag der Stille, und Hades fügte hinzu: »Der Bauer auch nicht.«
Ilias biss die Zähne zusammen.
»Gestern war er noch vollkommen wohlauf.«
»Und heute ist er tot«, erklärte Hades. »Voller Kugeln.«
»Also will noch jemand anderes als wir diese Kreatur finden«, meinte Dionysos. »Nicht überraschend, aber wer?«
»Wenn das mal nicht die entscheidende Frage ist.«
Hades musterte den Gott des Weins eindringlich. Nicht dass er Dionysos verdächtigte, etwas mit dem Tod des Bauern zu tun zu haben. Doch ihm war bewusst, dass dieser ebenso begeistert Monster sammelte wie Poseidon. Es war ein Grund, warum er es vorzog, den Gott im Auge zu behalten, trotz ihrer neuen und zerbrechlichen Allianz.
Dionysos’ Blick wurde skeptisch. »Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Kreatur wiedererweckt wurde?«
Die Anklage in Dionysos’ Stimme gefiel dem Gott der Toten gar nicht, aber Hades war nicht Dionysos, und er würde sich nicht vor seiner Verantwortung drücken.
»Weil ich einen Unsterblichen getötet habe«, sagte er.
Dionysos’ strenge Züge gaben nach, aber nicht aus Mitgefühl.
Sondern vor Schock.
»Dies ist das Werk der Moiren«, erklärte Hades.
»Also hast du uns hierher zitiert, um hinter dir aufzuräumen«, stellte Dionysos fest, und seine Stimme triefte vor Geringschätzung. »Typisch.«
»Tu nicht so verzagt, Dionysos«, sagte Hades. »Ich weiß doch, wie sehr du Monster magst.«
Er hätte noch mehr sagen können. Er wusste, dass der Gott Hera hasste, und eine Erwähnung, wie sie ihre Hand hier mit im Spiel hatte, hätte Dionysos verstummen lassen. Doch dies war gar nicht nötig. Denn Dionysos wollte hier sein, und er wollte den Ophiotauros in seinen Besitz bringen. Er würde also nach ihm suchen, auch wenn er beschloss, Hades nicht direkt helfen zu wollen.
»Wenn dies das Werk der Moiren ist«, warf Zofie ein, »könnt Ihr sie dann nicht einfach fragen, was sie gewebt haben?«
»Die Moiren sind Götter, so wie ich einer bin«, erklärte Hades. »Dass sie mir ihre Pläne mitteilen, ist ebenso unwahrscheinlich, wie dass ich ihnen meine mitteile.«
»Aber sie sind die Moiren. Kennen sie Eure Pläne nicht schon?«
Hades antwortete nicht. Es gab Gelegenheiten, da er Zofies Naivität schätzte. Heute Abend jedoch fand er sie frustrierend.
Es war schwer einzuordnen, wie die Moiren agierten. Wie bei den meisten Gottheiten basierten viele ihrer Entscheidungen auf ihrer Stimmung. Es war möglich, dass sie die Auferstehung des Ophiotauros nur eingefädelt hatten, um ihm eins auszuwischen, aber es war ebenso möglich, dass sie ein Ende der Olympier sehen wollten – Hades konnte nicht sagen, welche Wahl sie getroffen hatten oder ob sie überhaupt eine getroffen hatten. Er wusste nur eins, und das war eine Tatsache: Das Schicksal ließ sich nicht vermeiden, nur hinauszögern.
»Egal wie ihr Plan aussieht, wir brauchen auch einen«, sagte er.
»Ich verstehe nicht«, beharrte Zofie. »Die Moiren haben doch schon einen Ausgang beschlossen. Wofür planen wir?«
»Wir planen, um zu gewinnen«, erklärte Hades.
Das war alles, was sie tun konnten – und darauf hoffen, dass die Moiren noch auf ihre Seite gebracht werden konnten, falls sie bisher weder ihm noch den Olympiern ihre Gunst gewährt hatten. Doch dazu würde es ohne Taten nie kommen. Er wusste besser als alle anderen, dass die drei Schwestern ihre Freude daran hatten, dabei zuzusehen, wie die Götter ihnen in die Hände spielten, vor allem unter Leidensdruck.
Darauf folgte ein Herzschlag der Stille, dann ergriff Dionysos das Wort. »Wie lautet die Prophezeiung, die diese Kreatur so gefährlich macht?«
Da er nach dem Titanenkrieg geboren worden war, konnte er das nicht wissen.
»Wer immer seine Eingeweide verbrennt, wird die Macht erhalten, die Götter zu vernichten«, sagte Hermes.
»Bist du sicher, dass das die richtige Prophezeiung ist?«, fragte Dionysos und zog eine dunkle Augenbraue hoch.
»Vielleicht auch nur einen Gott?«, überlegte Hermes laut und zuckte mit den Schultern. »Könnte sein, dass ich ein oder zwei Wörter verdreht habe.«
»Ein oder zwei Wörter?«
»Immerhin ist das viertausend Jahre her«, verteidigte sich Hermes. »Versuch du mal, dich nach so langer Zeit an etwas zu erinnern!«
»Du scheinst kein Problem damit zu haben, einen Groll derart lange zu pflegen.«
»Und schon bedauere ich es, dass ich Zeus dabei geholfen habe, dein Leben zu retten«, entgegnete Hermes trocken.
Manchmal vergaß Hades, dass die beiden eine gemeinsame Geschichte verband, wenn auch eine ganz andere, die nichts mit ihrer Situation zu tun hatte: Hermes hatte einst dabei geholfen, Dionysos nach dessen Geburt zu retten, indem er ihn zu den Nysiaden brachte – Meeresnymphen, die auf dem Berg Nysa lebten.
»Vielleicht wäre es für alle besser gewesen, wenn du es nicht getan hättest«, meinte Dionysos.
Auf seine Worte wurde der Gott der Gaukler bleich, und bevor sich das angespannte Schweigen ausbreiten konnte, ergriff Hades das Wort. »Es ist eine Prophezeiung, Hermes. Ein anderes Wort oder zwei können die gesamte Bedeutung verändern.«
Hermes hob abwehrend die Hände. »Ich habe auch nie behauptet, ein Orakel zu sein.«
»Dann werden wir eines fragen müssen«, meinte Hades.
Vielleicht hatte sich die Prophezeiung ja verändert. Oder vielleicht gab es gar keine Prophezeiung. Doch noch in dem Augenblick, als ihm der Gedanke durch den Kopf ging, war ihm klar, dass das zu viel der Hoffnung wäre. Die Moiren hätten diese Kreatur nicht wieder erweckt, wenn sie nicht wollten, dass sie die Götter herausforderte.
»Und wir müssen den Ophiotauros vor den anderen finden.«
»Im Wettlauf mit wem?«, fragte Dionysos.
»Ich tippe auf Poseidon und seinen Nachwuchs«, meinte Hermes. »Der Mistkerl strebt immer nach Macht.«
Damit sprach Hermes indirekt etwas aus, an das auch Hades schon gedacht hatte. Der Ophiotauros konnte an Land leben, aber ebenso im Wasser. Poseidon würde jede Chance, Zeus zu stürzen, beim Schopf ergreifen – doch das würden Theseus und Hera auch tun. Hades wusste bereits, dass der Halbgott und die Göttin der Ehe zusammenarbeiteten, doch er hatte auch den Verdacht, dass der Gott des Meeres Theseus’ Verlangen, die Olympier zu stürzen, nährte. Ob er seinen Sohn tatsächlich für dazu fähig hielt, war eine andere Sache.
Manchmal fragte sich Hades, wer das ganze Spiel inszenierte und wer nur Mitspieler war, aber eins wusste er: Wenn er selbst zum Drahtzieher werden konnte, würde er die Chance ergreifen.
»Wir können nicht zulassen, dass der Ophiotauros im Meer Zuflucht findet«, erklärte Hades.
Damit wäre er im Territorium seines Bruders und gewissermaßen unerreichbar. Selbst wenn Hades Poseidon einen Handel anbot, würde Poseidon eine solche Waffe nie aufgeben.
»Dann verschwenden wir gerade wertvolle Zeit mit Reden, während wir suchen sollten«, meinte Dionysos.
»Das Problem, Dionysos, ist: wo anfangen?«, meinte Hades und sah den Gott an. »Es sei denn, du hast Informationen, die wir anderen nicht haben.«
Dionysos sagte nichts darauf.
»Wir müssen vorsichtig bei unseren Recherchen sein«, erklärte Ilias. »Auf dem Markt hat es sich schon herumgesprochen. Alle dort werden mit Eurer Beteiligung rechnen.«
Und das zu Recht, obwohl Hades klar war, dass es niemanden abschrecken würde. In der zwielichtigen Welt des Schwarzmarktes fürchteten nur wenige seinen Zorn, doch er nahm dies nicht als Beleidigung. Es war schließlich schwer, den Tod zu fürchten, wenn man ihm täglich ins Auge sah. Dennoch bedeutete es, dass er sich in einem regen Wettbewerb befände, um eine der vielleicht mächtigsten Waffen zu finden, die je gegen die Götter erschaffen worden waren.
»Dann sollten vielleicht meine Mänaden die Recherchen übernehmen«, schlug Dionysos vor, doch Hades ignorierte ihn und sah Ilias an.
»Setz Ptolemaios auf den Fall an, aber behalte ihn im Auge. In dieser Sache traue ich niemandem.«
»Nicht einmal mir, offenbar«, meinte Dionysos.
Hades richtete den Blick wieder auf den Gott des Weins. »Lass uns nicht so tun, als hättest du deine Attentäterinnen nicht schon auf Erkundung losgeschickt. Du wartest nicht auf meine Erlaubnis, du nimmst sie dir.«
Dionysos machte spitze Lippen und wandte den Blick ab. Hades konnte nicht sagen, ob er amüsiert oder verärgert war.
»Und was ist zu tun, wenn der Ophiotauros gefunden ist?«, fragte Zofie. »Werdet Ihr ihn töten?«
Hades antwortete nicht, denn er wusste keine Antwort auf ihre Frage. Er vermutete, das hing davon ab, was das Orakel über die Kräfte der Kreatur zu sagen hatte, obwohl er bezweifelte, dass alle anderen, die nach dem Ophiotauros suchten, zweimal darüber nachdenken würden, ob die Prophezeiung glaubhaft klang.
Das Monster versprach Geld, und ihnen lief die Zeit davon.
»Ihr könnt gehen«, erklärte Hades schließlich.
Er wollte zurück in die Unterwelt, zu Persephone. Dort wo er die ganze Nacht lang hätte sein sollen, um ihren warmen Körper geschmiegt, nachdem sie sich geliebt hatten. Dass er nicht an ihrer Seite geblieben war, machte ihn zornig. Selbst in der Nacht ihrer Verlobung war er fort gewesen, während sie schlief, um Informationen über den Ophiotauros zu sammeln und zu versuchen, herauszufinden, wo Demeter Zuflucht gesucht hatte.
Er versuchte, dies nicht als Omen zu sehen für das, was noch kommen sollte. Doch er wusste, dass vor ihnen ein Kampf lag. Er hatte immer gewusst, dass es nicht einfach sein würde, Persephone zu seiner Frau zu machen, wenn man bedachte, dass ihre Mutter eine seiner lautesten Kritikerinnen war. Und auch wenn ihm der Schnee, der mitten im Sommer draußen aufwirbelte, Sorgen machte, machte er sich noch mehr Sorgen wegen Zeus.
Sein Bruder hatte gern die Kontrolle, vor allem, wenn es um andere Gottheiten ging, und das beinhaltete ein Mitspracherecht darin, wen sie heirateten.
Bei dem Gedanken ballte Hades die Fäuste.
Er würde Persephone heiraten, ungeachtet aller Konsequenzen, denn am Ende war ein Leben ohne sie überhaupt kein Leben.
KAPITEL ZWEI
Dionysos
Dionysos verließ das Nevernight und kehrte ins Baccheia zurück, in die Suite, in der er für gewöhnlich wohnte, obwohl er ein eigenes Anwesen am Stadtrand von Theben besaß. Nicht weil er die eine Bleibe bequemer fand als die andere – er fand keine Bleibe besonders bequem –, sondern eher, weil er mit der Stille seines Heims nicht zurechtkam. Frieden brachte ihm keine Ruhe, sondern führte nur zu lauteren, penetranteren Gedanken.
Selbst jetzt war er nicht ganz frei von ihnen – von der endlosen Stimme in seinem Kopf, die ihm sagte, dass er nicht genug getan habe, dass er nicht genügte. Aber hier konnte er sie wenigstens übertönen mit dem Lärm, den Orgien, dem Wahnsinn.
Aus der Stille seiner Suite, die von den üblichen Zechern verlassen worden war, während er dem Ruf ins Nevernight gefolgt war, blickte er nun auf das alles herab. Trotz der frühen Morgenstunde wimmelte es in seinem Club vor Besuchern. Musik vibrierte bis in seine Seele und ließ sein Herz stocken. Laserlicht schnitt durch die Dunkelheit, hob verschwitzte und gerötete Gesichter hervor, beleuchtete Bekanntschaften und Liebespaare in sinnlicher Umarmung.
Der muffige Geruch von Schweiß mischte sich mit dem ungesunden Geruch von Drogen, der durch die Lüftungsschlitze drang, und brannte in seiner Nase.
Er war daran gewöhnt – an die Geräusche, die Gerüche, den Sex. Es war Teil der Kultur, die sich um seinen Kult herum gebildet hatte, als er diesen mit seinen Mänaden von Stadt zu Stadt geführt und dabei eine Spur aus Blut hinterlassen hatte. Und obwohl dieses Leben längst hinter ihm lag, würde er nie wirklich frei werden von dem Wahnsinn, mit dem Hera ihn geschlagen hatte.
Hin und wieder konnte er ihn immer noch fühlen. Ein subtiles Zucken, das seinen Körper ergriff, und wenn es sich ausbreitete, war es warm und gab ihm das Gefühl, als würde er von Nadeln durchbohrt. Es machte es ihm unmöglich, still zu sitzen, unmöglich, Ruhe zu finden.
Allein der Gedanke ließ seine Finger zittern. Er ballte sie zu Fäusten und hielt den Atem an in der Hoffnung, das Gefühl zu ersticken, bevor es ihm über den Rücken und in seine Adern kroch und ihn erneut überwältigte. Doch als er sich konzentrierte, registrierte er ein Geräusch, das von irgendwo in seiner Suite kam.
Ein keuchendes Stöhnen.
Er wandte sich von dem Fenster ab, das die Tanzfläche seines Clubs überblickte, und spähte in die Dunkelheit, sah aber niemanden.
Das Geräusch wurde rhythmischer, inzwischen auch noch von einem Klopfen begleitet.
Dionysos durchquerte den Raum zu einem Lagerkämmerchen hinter der Bar. Er drückte ein Ohr an die Tür, deren weiche Oberfläche mit dem gleichen Samt bezogen war, der die Wände säumte. Als er sicher war, dass die Laute von dort drin kamen, öffnete er die Tür.
In dem Kämmerchen befanden sich Silen und eine Frau, die er nicht kannte. Der Satyr lehnte an einer Seite des Schranks, während die Frau auf ihm ritt, die Beine um seine Taille geschlungen.
»Fuck!«, rief Silen, und die beiden erstarrten.
»Götterverdammt, Dad«, fauchte Dionysos.
Silen lachte atemlos. »Oh, Dionysos. Du bist es nur.«
Es war nicht das erste Mal, dass er Silen in flagranti beim Sex erwischte. Der Satyr war Teil seines Kults geworden, nachdem er dazu verflucht worden war, durch die Welt zu wandern. Sie hatten Tage im Mittelpunkt von Orgien verbracht, Vergnügen empfangen und geschenkt, so wie es die Natur seiner Huldigung war. Doch über die Jahre war das etwas geworden, das Dionysos immer weniger von einem Mann sehen wollte, den er als Vaterfigur zu sehen gelernt hatte.
Er schloss die Tür mit einem abrupten Knall, nahm sich dann eine Flasche Wein von der Auswahl an der Bar und schenkte sich ein Glas ein. Als er den ersten Schluck trank, ging die Tür erneut auf, und die Frau stolperte heraus.
Sie räusperte sich und schob sich das Haar hinters Ohr.
»Es tut mir so leid, Lord Dionysos. Ich wollte nicht …«
»Nichts, was dir leidtun muss«, fiel er ihr ins Wort, ohne sie anzusehen. Er trank noch einen Schluck. »Geh.«
Sie senkte den Kopf und stolperte davon. Ein Streifen hellen Lichts aus dem Flur drang durch die Dunkelheit, als sie ging.
Hinter ihm tauchte Silen auf. »Mir war nicht bewusst, dass du zurück bist«, meinte er. Dionysos stand von ihm abgewandt, aber er konnte das Klimpern hören, als Silen seinen Gürtel schloss.
»Wie lange wart ihr in diesem Schrank?«, fragte er.
Der Satyr zögerte. »Ich weiß gar nicht.«
Dionysos zog eine Augenbraue hoch und warf seinem Ziehvater einen Blick zu. »Woher weißt du dann überhaupt, dass ich weg war?«
»Ich weiß es immer, wenn du gehst«, meinte Silen. »Denn dann habe ich das Gefühl, dass ich wieder atmen kann.«
»Verdammt unhöflich«, meinte Dionysos, während Silen sich neben ihm an der Bar breitmachte. Der Satyr war einen Kopf kleiner als er, aber größer als jeder Satyr, der ihm je begegnet war. Wahrscheinlich lag es daran, dass Silen nicht nur ein Naturgeist war. Er war eine Naturgottheit. Er sah sogar anders aus als andere seiner Art. Dionysos hatte Satyrn mit Pferde- oder Ziegenfüßen und Schwänzen gesehen, aber Silen hatte die langen Ohren eines Esels und einen ebensolchen Schwanz. Allerdings hielt er diese Gestalt größtenteils durch seine Aura verborgen.
»Du hast mich bisher nie für meine Ehrlichkeit kritisiert«, meinte Silen, schenkte sich ein Glas Wein ein und leerte es, als wäre es Wasser. Das war typisch für ihn – er war der Gott der Trunkenheit, weswegen sie auch so lange so gut zusammengepasst hatten, da ihr Leben sich nur um Orgien gedreht hatte.
»Sollte ich heute damit anfangen?«
Silen trank die letzten Schlucke Wein, bevor er das Glas hörbar abstellte. »Dionysos, sogar du weißt, wovon ich spreche«, sagte er.
»Wenn du Weisheiten von dir geben willst, musst du noch viel betrunkener werden.«
»Das ist keine Weisheit. Sondern die Wahrheit. Du bist unerträglich geworden.«
»Warum? Weil ich nicht mehr mit dir Party mache?«
»Nun, das ist ein Grund«, sagte der Satyr. »Aber es ist mehr als das. Das weißt du.«
Dionysos stieß sich von der Bar ab und wandte sich seinem Ziehvater zu. »Erleuchte mich.«
»Du amüsierst dich nicht mehr«, erklärte Silen. »Und ich meine, überhaupt nicht mehr. Wie lange ist es her, seit du die Sau rausgelassen hast?«
Dionysos knirschte mit den Zähnen. »Ich bin nicht mehr derselbe, der ich einmal war, Silen.«
»Das ist keiner von uns«, antwortete der Satyr. »Aber das heißt nicht, dass wir das Leben nicht mehr genießen können.«
»Warst nicht du es, der sagte, es sei besser, gar nicht gelebt zu haben, und wenn wir schon leben müssen, dann sei es das Beste, früh zu sterben?«
»Nun ja, du bist noch nicht gestorben, also warum nicht noch etwas mehr Zeit damit verbringen, sich zu amüsieren?«
Dionysos verdrehte die Augen und trat hinter der Bar hervor.
»Du kannst so nicht weitermachen«, sagte Silen. »Du hast ihr zu viel Macht über dich gewährt.«
Dionysos wandte sich ihm zu. »Wenn wir darüber sprechen sollen, dann sage ihren Namen.«
Silen starrte ihn mit frustriertem Blick an. »Diese Suche nach Rache hat aus dir … jemand anderen gemacht.«
»Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass ich vielleicht genau das bin?«, fragte Dionysos. »Und dass die Person, der du vor all diesen Jahren begegnet bist und die du so sehr vermisst, von Hera geschaffen wurde?«
Silen schüttelte langsam den Kopf. »Nein. Das glaube ich nicht.«
»Du glaubst es nicht, weil du es nicht sehen willst.«
»Ich glaube es nicht!«
Sie redeten gleichzeitig, ihre Stimmen lauter und leidenschaftlich, und sobald die Worte heraus waren, wurde das Schweigen, das sich zwischen ihnen erstreckte, brennend.
Silen sprach zuerst. »Ich will sehen, dass du Glück findest«, sagte er und fuhr seufzend mit einer Hand durch sein dünnes, ergrauendes Haar. »Selbst wenn es nur ein klein wenig ist.«
»Vielleicht ist mir kein Glück bestimmt«, sagte Dionysos.
»Es ist eine Wahl, Dionysos«, sagte Silen eindeutig frustriert. »Du musst wählen.«
»Dann wähle ich Rache«, sagte Dionysos. »Und ich werde sie wählen, bis ich sie ausgeübt habe.«
»Was ist mit dem Mädchen?«, fragte der Satyr.
Dionysos fühlte, wie sein Körper sich bei der Erwähnung von Ariadne versteifte. »Sie ist eine Frau, kein Mädchen. Was ist mit ihr?«
»Sie ist hübsch«, meinte Silen.
Schon diese Beobachtung ärgerte Dionysos. Sie war nicht einfach nur hübsch. Sie war wunderschön, und er wurde jedes Mal daran erinnert, wenn er in ihr Gesicht blickte, fühlte es jedes Mal, wenn er denselben Raum wie sie betrat.
»Sie hasst mich«, sagte er.
»Weil sie im Augenblick nichts findet, das sie mögen kann«, entgegnete Silen.
»Vielleicht will ich ja gar nicht, dass sie mich mag.«
»Dein Schwanz sagt etwas anderes.«
»Schau nicht auf meinen Schwanz«, befahl Dionysos. »Das ist seltsam.«
»Ein Schwanz lügt nie«, erklärte sein Ziehvater. »Du magst sie.«
»Ich will Sex mit ihr. Ich mag sie nicht«, widersprach Dionysos.
»Klingt nach dem perfekten Beginn einer Beziehung.«
»Ja, nach einem ungesunden.«
»Hast du schon mal daran gedacht … ich weiß nicht … sie zu mehr zu machen als nur einer weiteren Mänade?«
»Ich kann sie zu gar nichts machen.«
»Natürlich kannst du das. Du hast sie schon zu einer unfreiwilligen Gefangenen gemacht.«
»Um sie zu schützen.«
Ob es ihr klar war oder nicht, obwohl das zu Beginn nicht der Fall gewesen war. Ursprünglich hatte er sie entführt und ins Baccheia gebracht, weil er den Verdacht hatte, dass sie als Ablenkung gedient hatte, damit Hera und Theseus die Graien entführen konnten. Zwar hatte sie genau das getan, aber sie hatte ihm auch gesagt, dass sie die Entscheidung dazu nur getroffen hatte, nachdem sie ihm begegnet war und ihn absolut unerträglich gefunden hatte.
Er biss die Zähne zusammen.
»Sie ist dir also wichtig«, meinte der Satyr.
»Sie ist ein Weg zum Ziel, Silen.«
Und mehr würde sie auch nicht sein.
»Nun, wenn sie ein Weg zum Ziel ist, dann lass uns hoffen, dass ihr Ziel dein Schwanz ist.«
Dionysos verließ seine Suite und nahm den Aufzug hinunter in den Keller – ein viel zu schlichter Begriff, um zu beschreiben, was der Untergrund seines Clubs wirklich war. Die meiste Anerkennung dafür gebührte den Mänaden, die eine eigene kleine Stadt daraus gemacht hatten. Es war ein riesiges Netzwerk aus Tunneln, die sich mit verschiedenen Teilen von New Athens verbanden, und mit dessen Hilfe sie spionierten, töteten und auf der Asche ihrer Vergangenheit ein neues Leben aufbauten.
Es war das völlige Gegenteil von dem, was Ariadne angenommen hatte – nämlich, dass er einen Sexhandelsring betriebe. Es war nicht das erste Mal, dass jemand Dionysos eines derart abscheulichen Vergehens beschuldigt hatte, aber dass sie es getan hatte, ärgerte ihn, und es beleidigte die Arbeit der Mänaden, die den Großteil ihrer Zeit damit verbrachten, andere junge Menschen vor Schicksalen zu retten, die ähnlich denen waren, denen sie selbst entkommen waren.
Er war sich auch nicht sicher, warum ihm das so viel ausmachte.
Die Mänaden wären nicht so effektiv, wenn ihr Geheimnis bekannt wäre, und die Tatsache, dass die Welt außerhalb seines Reiches glaubte, er betreibe Menschenhandel, war für gewöhnlich nützlich für seine Absichten. Es bedeutete nämlich, dass die Menschen, die derartige Dienste suchten, häufig zu ihm kamen, um Verbindungen herzustellen, und am Ende zum Ziel seiner Attentäterinnen wurden.
Es war harte Arbeit, riskante Arbeit … und aus irgendeinem Grund tat ihm Ariadnes Bereitschaft, das Schlimmste über ihn anzunehmen, weh.
Nicht dass ihn das kümmern sollte. Er kannte sie erst seit wenigen Wochen, und doch war sie da, unter seiner Haut, und grub sich noch tiefer hinein.
Manchmal, wenn er in ihrer Nähe war, war ihm, als habe Hera ihn erneut mit Wahnsinn geschlagen.
Als die Aufzugtüren aufgingen, trat er hinaus auf die Metallplattform, die den primären Wohnbereich der Mänaden überblickte. Er war groß, um die Anzahl der Frauen unterzubringen, die in den letzten Jahren hinzugekommen waren, obwohl nicht alle seine Attentäterinnen hier lebten. Er rechnete damit, den Raum so früh am Morgen verlassen vorzufinden, doch einige Mänaden waren wach und munter und standen mit verschränkten Armen da, den Blick zu der Fabrikdecke gerichtet, an der große Metallrohre und helle Leuchten hingen. Manche sahen irritiert aus, manche ärgerlich, und ein paar wirkten amüsiert. Aber ungeachtet ihrer gemischten Gefühle wusste er, dass sie alle lauschten.
Er seufzte, denn er wusste auch genau, wonach: Ariadne versuchte wieder einmal zu fliehen.
Er schüttelte den Kopf und trat näher an den Rand der Plattform. Er fragte sich, wie lange sie schon in dem Rohr war und wann sie aufgehört hatte, sich fortzubewegen – wahrscheinlich bei seiner Ankunft. Wahrscheinlich war sie jetzt dort oben und verfluchte ihn, obwohl er keinen Zweifel hatte, dass sie ihn so lange wie nur möglich warten lassen würde.
Dann hörte er ein leises Niesen und konzentrierte seine Macht auf die Stelle. Schrauben fielen aus ihren Löchern heraus, und das Gebilde neigte sich und knickte ein. Ariadne gab einen scharfen Aufschrei von sich, als sie herausfiel und auf den Boden aufkam. Für den Bruchteil einer Sekunde war Dionysos besorgt, dass sie sich beim Sturz verletzt haben könnte, doch sie rollte sich ab und funkelte ihn finster an.
Sie trug rissige Jeans, ein dazu passendes Shirt und eine Lederjacke, ihr dunkles Haar hing schwer über ihre Schultern. Sie war wunderschön, sogar wenn sie sauer war, und sauer war sie die ganze Zeit – zumindest auf ihn.
»Geht«, befahl er, und die Mänaden zerstreuten sich, verschwanden durch einen der dunklen Torbögen und ließen ihn mit Ariadne allein. Er musterte sie noch einmal kurz, bevor er die Treppe hinab in die Etage darunter stieg. Als er zu ihr ging, stand sie auf, klopfte sich den Staub ab und zuckte dabei zusammen. »Was tut weh?«, fragte er.
Sie erstarrte und sah ihn finster an. »Wenn du so besorgt wärst, mir wehzutun, hättest du zweimal nachdenken können, bevor du deine Kräfte gegen eine Sterbliche einsetzt.«
»Ich habe sie nicht gegen dich eingesetzt.«
»Dann haben wir beide sehr verschiedene Auffassungen davon, was das bedeutet.«
Er atmete tief durch, um seinen Frust zu unterdrücken, aber es klappte nicht. »Wenn du schon versuchen willst, zu fliehen, könntest du zumindest mein Angebot akzeptieren, dich auszubilden. Dann hättest du vielleicht Erfolg.«
»Ich bin ausgebildet«, fauchte sie.
»Darin, wie man Verhöre führt und eine Schusswaffe benutzt«, sagte er. »Welch nützliche Fähigkeiten gegen Götter.«
Sie holte aus und wollte ihn ins Gesicht schlagen. Er war nicht sicher, ob es ihr Versuch war, ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, oder eine instinktive Reaktion auf ihren Zorn, aber er fing ihre Faust ab, bevor sie auch nur in seine Richtung schwingen konnte.
Ihr Schmerzschrei überraschte ihn, und er ließ sofort los. Sie schlang die Finger um ihr rechtes Handgelenk und drückte es an ihre Brust.
»Zeig mir deine Hand«, forderte er.
»Alles in Ordnung.«
»Um der Liebe der Götter willen, Ariadne. Zeig her!«
Sie biss weiter die Zähne zusammen, und er hielt ihren Blick fest, als sie die Hand ausstreckte. Sie schien nicht gebrochen zu sein, und als er seine Hand darauf legte, bestätigte die Energie seinen Verdacht.
»Du hast sie dir verstaucht«, erklärte er.
»Du meinst, du hast sie mir verstaucht«, sagte sie.
Die Schuldgefühle trafen ihn hart, wie eine Woge, die ihn schwindlig machte. Er sah sie an. »Tut mir leid.«
Seine Entschuldigung erwischte sie anscheinend kalt, denn sie blinzelte. Einen Moment später wurde ihr klar, dass er immer noch ihre Hand hielt, und sie zog sie weg, um sie wieder an ihre Brust zu drücken.
Er räusperte sich. »Du brauchst Eis«, erklärte er und ging um sie herum. »Komm mit.«
Er durchquerte den Wohnbereich und ging durch einen langen dunklen Flur zur Küche. Dort legte er einen Schalter um, und fluoreszierendes Licht beleuchtete einen sterilen Raum aus rostfreiem Stahl, so eingerichtet, dass er Hunderte gleichzeitig verpflegen konnte. Angesichts der Tatsache, dass dieses unterirdische Netzwerk nötigenfalls Tausende beherbergen konnte, war das eine Notwendigkeit.
Er ging zu einer Reihe hoher Regale, fand nach etwas Stöbern eine Kiste mit Sandwichtüten und füllte eine mit Eis. Als er sich umdrehte, sah er, dass Ariadne in der Tür stand und ihn anstarrte.
»Was ist?«
»Kannst du nicht einfach … mit Magie einen Eisbeutel materialisieren?«
Er legte den Kopf schief, und seine Mundwinkel zuckten. »Ich glaube nicht, dass das der korrekte Gebrauch von Magie ist.«
»Du weißt, was ich meine«, schnaubte sie und wollte die Arme verschränken, aber der Schmerz schien sie daran zu erinnern, dass sie das nicht tun sollte.
Er ging zu ihr und gab ihr die Tüte. »Ich vermute, das hätte ich tun können«, meinte er. »Aber ich kann es auch selbst holen.«
Außerdem hatte er etwas Entfernung zwischen sie und sich selbst bringen müssen, und sei es nur für ein paar Sekunden.
Sie nahm das Eis und drückte es auf ihr Handgelenk. »Danke«, sagte sie, so leise, dass er es kaum hören konnte. Obwohl, in Wahrheit hatte er den Dank nicht verdient. Das war er ihr schuldig.
»Dass ich dich ausbilden will, war kein Scherz«, sagte er.
»Ich will keine deiner Mänaden sein«, antwortete sie.
»Dann sei keine«, sagte er. »Aber wenn du in dieser Welt bleiben willst, musst du wissen, wie man mehr tut, als nur eine Knarre mit sich herumzutragen.«
»Hör auf, zu unterstellen, dass ich nicht zu mehr fähig wäre, als eine Schusswaffe zu benutzen.«
»Kannst du denn irgendeine andere Waffe benutzen?«, fragte er.
Sie schwieg.
»Eine Knarre wird uns nicht helfen, wenn wir gegen Theseus antreten«, erklärte er.
Auf die Erwähnung ihres Schwagers reagierte sie immer gereizt, und er wusste, falls sie je hörte, dass er Theseus auch noch so nannte, würde sie richtig ausflippen. Ariadne hasste den Halbgott, und sie hatte auch jeden Grund dazu, denn Theseus zwang ihr seinen Willen auf, indem er ihre Schwester Phaedra als Geisel hielt und sie erpresste.
»Wo wolltest du überhaupt hin?«, fragte er kurz darauf. Als sie nicht antwortete, fuhr er fort: »Wolltest du zu ihm?«
Er kannte die Antwort und die Hintergründe – und doch erfüllte der Gedanke, dass sie sich zu Theseus schleichen wollte, mit brennender Eifersucht.
»Nein«, fauchte sie. »Ich wollte meine Schwester sehen.«
»Deine Schwester zu sehen ist das Gleiche, wie Theseus zu sehen«, sagte er. »Glaubst du wirklich, er gewährt dir Zugang zu ihr?«
»Nein!«, sagte sie. »Aber wenigstens weiß sie dann, dass ich es versucht habe.«
In ihren Augen glitzerten ungeweinte Tränen, und der Anblick bewirkte etwas in seiner Brust. Das gefiel ihm gar nicht, denn es brachte ihn dazu, dass er dumme Dinge für sie tun wollte.
»Habe ich denn nicht zugestimmt, dir bei der Rettung deiner Schwester zu helfen?«, fragte er.
»Hades hat zugestimmt, nicht du«, widersprach sie.
Er biss die Zähne zusammen, so fest, dass sein Kiefer schmerzte. »Er mag dem Handel zugestimmt haben, aber wir wissen beide, dass ich derjenige bin, der das Ganze durchziehen muss«, sagte er.
»Wenn ich eine solche Last bin, dann lass mich gehen«, entgegnete sie.
»Ich habe nie gesagt, du wärst eine Last.«
»Das musst du auch nicht«, antwortete sie und blickte zu Boden.
Dionysos starrte sie nur an. »Ich bin nicht daran interessiert, wieder aufzuwärmen, wie wir an diesen Punkt gelangt sind, oder auch nur, wie wir uns damit fühlen«, sagte er. »Was getan ist, ist getan, und wir haben Arbeit vor uns. Du willst deine Schwester befreien und Theseus zu Fall bringen, doch was du immer noch nicht begriffen hast, ist, dass Theseus nicht einfach irgendwer ist, und selbst wenn er es wäre, ist er ein Halbgott, der Sohn von Poseidon. Er ist tausendmal so stark, das heißt, um ihn zu Fall zu bringen, werden wir mehr brauchen.«
»Mehr wovon?«, fragte sie.
»Mehr von allem«, sagte er. »Mehr Zeit, mehr Planung, mehr Leute, mehr Waffen.«
»Ich bereite mich nicht auf eine Schlacht vor, Dionysos«, sagte sie. »Ich will nur meine Schwester wieder haben.«
»Schade«, meinte er. »Denn ohne einen Krieg wirst du sie nicht bekommen.«
Ihr Brustkorb hob sich schwer, als sie tief Luft holte, und er versuchte, nicht zu lange hinzustarren, damit sie nicht bemerkte, worauf seine Aufmerksamkeit sich gerichtet hatte.
»Du hast keine Ahnung, in was du da hineingeraten bist«, sagte er.
»Also, was willst du von mir?«
Ihre Frage überraschte ihn, aber nicht wegen dem, was sie gefragt hatte, sondern wegen der Gefühle, die sie in ihm auslöste – das Bewusstsein, wie leer er sich fühlte, und zugleich seine Sehnsucht, diese Leere zu füllen.
Aber diese Gedanken unterdrückte er schnell wieder. »Wir müssen Medusa finden«, erklärte er.
Medusa war eine Gorgone, die laut Gerüchten Männer mit einem Blick in Stein verwandeln konnte. Falls das stimmte, wäre sie eine wertvolle Waffe. Sobald er Gewisper auf dem Markt über ihre Macht gehört hatte, hatte er die Graien angeheuert, um ihm dabei zu helfen, sie zu finden, doch der Plan war nach hinten losgegangen, als Detective Alexiou beschloss, Theseus und Hera bei der Ergreifung der drei Schwestern zu helfen.
Wahrscheinlich hatte sie keine Ahnung, womit sie da beauftragt worden war, als sie ins Baccheia gekommen war. Theseus hatte einen Wolf zu einem Schaf gemacht, und Dionysos hasste es zu sehen, wie gut sie ihm folgte.
Seine Augen wurden schmal.
»Was, wenn sie dir nicht helfen will?«
»Es ist dein Job, sie zu überzeugen«, sagte er.
»Ich dachte, du hättest gesagt, dass du ihre Macht nicht brauchst.«
»In diesem Spiel geht es nicht darum, ob ich ihre Macht brauche, sondern darum, wer sie zuerst bekommt«, erklärte er. »Und du willst, dass ich sie zuerst bekomme, das verspreche ich dir.«
»Warum schickst du nicht deine Attentäterinnen?«
»Dies ist kein Job für sie«, erklärte er. »Sie muss davon überzeugt werden, dass es das Beste ist, sich auf unsere Seite zu stellen.«
»Und was, wenn ich nicht davon überzeugt bin?«
»Dann lass uns hoffen, dass du es bist, wenn wir sie finden.«
KAPITEL DREI
Hades
Hades erschien in seinem Gemach, in dem es dunkel war, abgesehen vom Feuer, das zu hell brannte, wie das blendende Feuer des Phlegethon. Fast wünschte er, es wäre aus und er müsste heute Nacht keine Flammen mehr sehen, denn das Leuchten erinnerte ihn daran, dass die Welt außerhalb dieses Raums sein Glück nicht wünschte.
Es weckte in ihm den Wunsch, wieder zum Einsiedler zu werden und die Welt auszusperren, wie er es zu Beginn seiner Herrschaft als König der Unterwelt getan hatte. Doch als sein Blick auf Persephone fiel, die schlafend in einem Meer aus schwarzer Seide lag, wusste er, dass das nicht ging. Sie war zu gesellig, zu liebevoll und zu engagiert, um die Oberwelt hinter sich zu lassen. Sie wollte die Welt retten, selbst die Teile, die ihre Freundlichkeit nicht verdient hatten, und weil sie das wollte, würde er es auch wollen.
Seufzend fuhr er sich durchs Haar und zog das Band heraus, das das Haar aus seinem Gesicht hielt. Er ging zur Bar, schenkte sich einen Whiskey ein und trank ihn zügig aus, bevor er sich auszog und zu Persephone ins Bett legte.
Er lag auf der Seite und beobachtete sie. Obwohl er sich so sehr nach ihr sehnte, wollte er ihren Schlaf nicht stören. Sogar im Schatten des Gemachs würde er ihr Gesicht erkennen, denn er hatte es sich eingeprägt – der Bogen ihrer Augenbrauen, die Rundung ihrer Wange, die Form ihrer Lippen. Sie war wunderschön, und ihr Herz war einfach nur gut. Er war sich sicher, dass ein Teil von ihm nie ganz glauben würde, dass sie ihm gehörte, dass sie zugestimmt hatte, ihn zu heiraten, trotz allem, was er gewesen war und allem, was er weiterhin sein würde, und obwohl es einen finstereren Teil in ihm gab, der wusste, dass Verlobungen enden konnten, ebenso wie Ehen.
Seine Erwartung war nicht so sehr die, dass Persephone ihn verließ, sondern eher die, dass die Welt sie beide gewaltsam trennen würde.
Persephones Seufzen holte Hades aus seinen Gedanken. Er konzentrierte sich auf ihr Gesicht und bemerkte, wie ihre Augen sich hinter den Lidern bewegten. Dann runzelte sie die Stirn, ihre Atemzüge wurden angestrengter, und ihr Brustkorb hob und senkte sich immer schneller.
»Persephone?«, flüsterte er, und sie wimmerte, presste den Kopf in ihr Kissen und bog den Rücken durch. Ihre Arme blieben über ihrem Kopf liegen, und sie hatte die Fäuste geballt, als würde jemand sie niederdrücken.
Dann wurde sie stocksteif und flüsterte einen Namen, der ihm das Blut gefrieren ließ.
»Pirithous.«
Hades stützte sich auf seinen Ellbogen, und Angst flutete durch seine Adern. Dieser Mann. Dieser Name.
Pirithous hatte Persephone entführt, dazu ermutigt von Theseus, nachdem er sie wochenlang gestalkt hatte. Hades konnte sich immer noch an die Einträge erinnern, die der Halbgott in sein Tagebuch geschrieben hatte, in denen er schilderte, was Persephone trug, ihre Begegnungen, und was er alles mit ihr anstellen wollte. Es war beunruhigend zu lesen gewesen und verlieh dem Albtraum ihrer Entführung noch eine weitere Ebene des Schreckens.
Dieselben Gefühle stiegen nun in ihm auf und zerrissen ihm das Herz. Es war ein vertrautes Gefühl. Er war schon zuvor mit ihr an diesem Punkt gewesen. Seit dem Tag, an dem Pirithous sie entführt hatte, hatte er sie im Schlaf verfolgt.
»Persephone«, flüsterte Hades und drückte die Hand flach auf ihren Bauch, doch bei seiner Berührung wimmerte sie. »Sch«, versuchte er sie zu beruhigen, doch da drang ein Schluchzen aus ihrer Kehle. Sie entwand sich ihm und setzte sich schwer atmend auf. Er ließ ihr Zeit, um sich zu sammeln. Denn er fürchtete, wenn er sie gleich nach ihrem Albtraum berührte, würde sie das nur noch mehr aufwühlen, obwohl er sie so unbedingt in seine Arme nehmen und sie beruhigen wollte, damit sie sich sicher fühlte.
Sie drehte den Kopf und schien sich zu entspannen, als ihr Blick auf ihn fiel, und plötzlich fühlte er sich nicht mehr so nutzlos. Manchmal sorgte er sich, dass er im Nachgang ihrer Entführung alles falsch gemacht hatte und dass er eines Tages vielleicht unwissentlich eine Erinnerung aus jener Nacht auslösen würde, und was sollte er dann tun? Wie könnte er das wiedergutmachen?
Es fühlte sich unmöglich an, für ihre Sicherheit zu sorgen.
»Geht es dir gut?«, fragte er.
Ihr Brustkorb hob sich, als sie Luft holte und ihn ebenso eindringlich musterte wie er sie. Sie war mehr als alles, was er sich je für sich vorgestellt hatte – wunderschön und anmutig, viel zu gut für die Dinge, die er in seinen vielen Lebzeiten getan hatte –, und doch blieb sie, ein beständiges Licht an seiner Seite, ein Leuchtfeuer, dem er durch die Dunkelheit folgen konnte.
Es waren diese stillen Momente, in denen er sich am stärksten von seiner Liebe zu ihr überwältigt fühlte.
»Du hast nicht geschlafen.«
Ihre Stimme war ein Flüstern, das über seine Haut glitt. Es weckte Verlangen in ihm, doch das fühlte sich falsch an.
»Nein«, antwortete er, setzte sich neben ihr auf und drehte sich so, dass er ihr Gesicht sehen konnte.
Sie war erhitzt, und ihre Augen waren heller als sonst, ein Zeichen dafür, dass sie im Traum nach ihrer Magie gegriffen hatte.
Hades strich mit dem Daumen über ihre Wange, und ihre Augen schlossen sich flatternd, als würde seine Berührung ihr ein Gefühl von Trost bieten. Der Gedanke brachte sein Herz aus dem Takt. In den Gefühlen, die sie in ihm weckte, lag Macht, und sie war die Einzige, die diese Macht je besessen hatte.
»Erzähl es mir«, bat er, obwohl er wusste, was sie sagen würde.
»Ich habe schon wieder von Pirithous geträumt.«
Hades ließ die Hand von ihrer Wange sinken und ballte sie zur Faust. Es zu wissen, war eine Sache, doch es zu hören, eine andere.
»Er tut dir weh, sogar noch im Schlaf«, stellte er fest. Pirithous verfolgte sie, obwohl seine Seele im Tartaros gefangen war – er verfolgte ihn, egal wie oft er den Halbgott zu Tode gefoltert hatte. »Ich habe dich enttäuscht an diesem Tag.«
»Wie hättest du wissen können, dass er mich entführen würde?«
»Ich hätte es wissen müssen.«
Hades war stolz darauf, alles zu wissen und alles vorauszuahnen. Er hatte alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, dafür gesorgt, dass Antoni Persephone zur Arbeit fuhr und von dort abholte, und er hatte Zofie zu ihrer Aegis bestimmt, die sie jederzeit beschützen sollte, selbst aus der Ferne. Er hatte ihr so viel Freiheit wie möglich gelassen. Wahrscheinlich zu viel, wenn man bedachte, dass sie für so viele ein Ziel war – für Feinde, die sie nicht einmal kannte. Aber er konnte sie nicht in einen Käfig sperren, selbst wenn dieser Käfig seine Unterwelt war.
»Du kannst nicht alles sehen, Hades«, flüsterte Persephone.
Sie versuchte, seinen Schmerz zu lindern, und sie konnte nicht wissen, dass ihre Worte es nur schlimmer machten. Es spielte keine Rolle, dass er nicht allwissend war. Er gab sich trotzdem die Schuld an dem, was geschehen war. Er hatte auch Zofie die Schuld gegeben, und als er sie von ihrem Auftrag als Persephones Aegis entbinden wollte, hatte seine Göttin sie verteidigt.
Er war nicht stolz auf seine Taten. Er hätte Persephone trösten müssen. Sie kämpfte damit. Er wusste es. Selbst wenn er mit ihr schlief, konnte er die Anspannung in ihrem Körper spüren, und er war sich überaus bewusst, wie viel Zeit es brauchte, bis sie sich wohlfühlte.
Dieser Mann, dieser Halbgott, war in ihre privateste und intimste Sphäre eingedrungen, und das machte ihn wütend.
Und das, so wurde ihm klar, war die Macht der Halbgöttlichen.
Ihre Macht war unbekannt, ihre Anzahl war unbekannt, und ein unbedeutender Sohn eines Olympiers hatte es geschafft, nicht nur irgendeine Göttin zu entführen, sondern seine Göttin.
Erneut konzentrierte er sich auf Persephone und ihre Worte, die tröstend gemeint gewesen waren.
»Du hast recht«, antwortete er. »Vielleicht sollte ich dann Helios bestrafen.«
Daraufhin warf sie ihm einen unbeeindruckten Blick zu.
»Würdest du dich dann besser fühlen?«
»Nein, aber es würde Spaß machen«, antwortete Hades. Er erwähnte nicht, dass er sich in den letzten Monaten so oft mit dem Sonnengott angelegt hatte, dass Helios ihm wahrscheinlich nie wieder helfen würde – was gar nicht so sehr Verlust als vielmehr Erleichterung war. Hades hegte ohnehin den Verdacht, dass der Gott sich entweder schon auf Heras Seite geschlagen hatte in ihrer Mission, Zeus zu stürzen, oder es noch tun würde.
Hades hatte es nur geschafft, der Königin der Götter zu drohen, damit sie sich seinem Willen unterwarf, um sicherzustellen, dass Hera zu seiner Verteidigung kommen würde, wenn Zeus gegen seine Heirat mit Persephone protestierte. Sie hatte zugestimmt, wenn auch nur widerwillig. Dabei war es nicht so, dass Hades Zeus’ Herrschaft als König der Götter nicht enden sehen wollte. Doch er wollte Persephone dabei an seiner Seite haben. Gemeinsam waren sie weit mächtiger als getrennt, doch das würde auch Zeus bemerken, und das machte ihn zur größten Gefahr für ihr gemeinsames Glück.
»Ich wünsche, ihn zu sehen«, sagte Persephone.
Er brauchte einen Augenblick, um zu verarbeiten, was sie gesagt hatte, denn seine Gedanken waren vollkommen anderswo gewesen. Er fühlte sich schuldig dafür, dass er an Zeus und Hera gedacht hatte, während sie sich wegen Pirithous gequält hatte.
Doch in ihrer Stimme lag eine Entschlossenheit, gegen die er nicht ankämpfen konnte – nicht dass er ihre Bitte ablehnen würde. Er hatte ihr dieses Versprechen in der Nacht gegeben, in der er sie gerettet hatte, wenn auch nicht genau so, wie sie es erbeten hatte.
Wenn du ihn folterst, darf ich dabei sein, hatte sie gesagt, und obwohl er zugestimmt hatte, hatte ihn das nicht davon abgehalten, sich in jener Nacht in den Tartaros zu begeben, um den Halbgott allein zu foltern – oder davon, seitdem beinahe jede Nacht zurückzukehren, um es wieder zu tun. Es war nicht so, dass er Persephones Bitte nicht ehren wollte. Doch er hatte darauf gewartet, dass sie es erneut aussprach, denn jetzt wusste er, dass sie bereit wäre.
Das Einzige, das ihn zögern ließ, war, dass sie, wenn sie diesen Teil des Tartaros besuchte, das Finsterste in ihm erkennen würde. Ihm war klar, dass sie den Zweck dieses Unterweltgefängnisses kannte, doch es zu sehen, war etwas ganz anderes, und das weckte in ihm die Angst, dass ihr am Ende vielleicht klar wurde, in wen sie sich verliebt hatte – oder dass sie erkannte, dass sie gar nicht verliebt war.
Er hielt ihrem unbewegten Blick stand und antwortete: »Wie du wünschst, meine Liebe.«
Hades brachte Persephone in den weißen Raum – eine seiner moderneren Folterkammern. Sie wurde dazu genutzt, ihren Insassen alle Sinneseindrücke zu rauben. Manchmal ließ Hades eine Seele wochenlang hier lebendig zurück, und bis er zurückkehrte, hatte diese Seele dann jedes Gefühl für sich selbst verloren. Diese Strafe gewährte er besonders gern jenen, die ihren Status und ihre Macht dazu nutzten, in der Oberwelt zu verletzen und zu töten. Wenn sie am Ende jedes Gefühl für ihr Selbst verloren hatten, machte es das Ganze umso befriedigender.
Hier hatte Hades Pirithous zuletzt zurückgelassen, nachdem er den größeren Teil seiner Zeit in der Unterwelt damit verbracht hatte, andere Foltermethoden durchzuprobieren, alte wie neue. Er hatte Knochen gebrochen und Knie zerschmettert, ihm die Hoden und den Schwanz abgeschnitten, ihn mit Honig bedeckt und von Insekten und Ratten abnagen lassen, bis seine Knochen blank waren.
Alles das und mehr hatte er getan, und seine Wut war nicht geringer geworden. Sogar jetzt konnte er sie in sich aufwallen fühlen, als er Pirithous ansah, der in der Mitte des Raums zusammengesunken auf einem Stuhl saß, festgehalten nur von einem Seil, das um seine Arme, seine Taille und seine Beine gebunden war. Seine Haut war bleichweiß, fast grau und bespritzt mit Schichten getrockneten Blutes von seinen vorherigen Folterungen. Er war kein schöner Anblick, und Hades fragte sich, was Persephone dachte, nun da sie sich Auge in Auge mit dem Halbgott wiederfand.
Sie stand still und reglos neben ihm, den Blick auf ihren Angreifer fixiert. Kurz darauf holte sie Luft, ein Laut, der deutlich in der Stille des Raums zu hören war.
»Ist er tot?«
Hades nahm an, dass sie flüsterte, weil sie befürchtete, Pirithous zu wecken.
»Er atmet, wenn ich es sage.«
Ihm wurde klar, dass ihre einzige Angst die war, dass dieser Mann sie vielleicht noch einmal verletzen könnte. Er ballte die Fäuste, als sie sich der Seele näherte, überwältigt von dem Drang, sie zurückzuziehen und in seiner Nähe zu behalten, damit sie ihn nur aus der Ferne betrachten konnte. Doch er wusste, wenn sie das Gefühl hätte, dass sie das nicht schaffen könnte, würde sie es auch nicht tun.
»Hilft es?«, fragte sie und drehte sich zu ihm um. Einen kurzen Moment lang konnte er nur daran denken, wie seltsam es war, etwas so Schönes an einem Ort wie diesem zu sehen. »Die Folter?«
Hades betrachtete ihr Gesicht.
Ihre Frage hatte etwas Unschuldiges an sich. Vielleicht war es die Annahme, dass er die Folter benutzte, um seine Wunden zu heilen, statt sie zu nähren, wie es bei Pirithous der Fall war. Ganz gleich, wie sehr Hades den Halbgott leiden ließe, es wäre niemals genug.
»Ich kann es nicht sagen.«
Ihr Blick ruhte noch einen Moment lang auf ihm, bevor sie sich umdrehte und um ihren Gefangenen herumging. Sie konnte nicht wissen, was das mit ihm anstellte und wie er sich dabei fühlte. Sie beherrschte diesen Ort wie eine Königin, und das, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein.
Sie blieb hinter dem Halbgott stehen, musterte ihn, und er konnte nur daran denken, dass sie noch nie schöner ausgesehen hatte, trotz ihrer Umgebung.
»Wieso tust du es dann?«
Einen Moment lang fragte er sich, ob sie das fragte, weil sie es missbilligte, doch sie schien weder über ihn noch den gefesselten Halbgott vor sich entsetzt zu sein, also antwortete er wahrheitsgemäß.
»Kontrolle.«
Etwas, wonach er täglich suchte, denn es war das Erste gewesen, das ihm genommen wurde, als sein Vater ihn bei seiner Geburt in einem Stück verschlungen hatte. Und dann, gerade als er glaubte, aus diesem schrecklichen Gefängnis befreit zu sein, fand er sich weiteren zehn Jahren Kampf gegenüber. Danach war Kontrolle gleichbedeutend mit einer finsteren Existenz gewesen. Es bedeutete, dass alle in seinem Reich sich so fühlen mussten, wie er sich gefühlt hatte – elend und gefoltert. Nach dem, was er gesehen hatte, hatte er geglaubt, dass niemand ein friedvolles Nachleben verdient habe.
Mit der Zeit hatte sich seine Vorstellung davon, was es bedeutete, die Kontrolle zu haben, weiterentwickelt, und sein Reich färbte ab auf die Welt darüber. Er strebte danach, sich die finstersten Teile zu eigen zu machen, und fütterte die Schattenseite von New Greece, bis Macht und Status sich nur über ihn erlangen ließen, und alle, die außerhalb dessen operierten, überdauerten nicht lange. Es gab nur wenige Ausnahmen, doch dazu zählten Dionysos und, seit sehr kurzer Zeit, Theseus, hauptsächlich durch die Hilfe seines Vaters.
Aber nicht einmal sie forderten ihn derart heraus wie Persephone.
Sie war in sein Leben gestürmt und trotzte ihm auf Schritt und Tritt, und er war nicht in der Lage, irgendeine Kontrolle über sie auszuüben. Sie ließ sich nicht kontrollieren, und in vielerlei Hinsicht konnte er ihr das nicht übelnehmen. Sie war eben erst den Fesseln der Autorität ihrer Mutter entronnen, und sich nun Auge in Auge mit ihm wiederzufinden – praktisch einem Fremden, der versucht hatte, ihr Regeln aufzudrücken –, da war es kein Wunder, dass sie rebelliert hatte.
Am Ende hatte sie nur das gewollt, was er gewollt hatte.
»Ich will Kontrolle«, sagte sie, und Hades war, als zerquetsche sie sein Herz.
Er wollte ihr Kontrolle geben.
Er streckte die Hand aus. »Ich werde dir helfen, sie zu erlangen.«
Sie kam ohne Zögern zu ihm, legte ihre Hand in seine und kam nahe zu ihm. Er drehte sie um, so dass ihr Rücken an seiner Brust ruhte, seine Finger gespreizt an ihrer Hüfte, besitzergreifend und im Bewusstsein, dass Pirithous bald erwachen würde. Hades wollte, dass der Halbgott daran erinnert wurde, was er getan hatte, dass er die falsche Göttin entführt und den falschen Gott herausgefordert hatte.
Mit ihr sicher in seinen Armen rief er seine Magie herbei wie einen Speer und zielte auf Pirithous. Der Halbgott holte scharf Luft, als habe er den Schmerz von Hades’ Macht gefühlt, und Persephone wurde stocksteif, als sie den Laut hörte. Hades kam näher, als könne er sie mit seinem Körper vor ihrer Angst abschirmen. Seine Lippen streiften ihre Ohrspitze, als er fragte:
»Weißt du noch, wie ich dich gelehrt habe, deine Magie zu nutzen?«
Er hatte es sie an einem Abend unter dem silbernen Blätterdach ihrer eigenen Bäume gelehrt. Als er sich an diesen Abend erinnerte – wie sein Körper ihren umfangen hatte, wie er sie berührt hatte, wie sie unter seinen Händen langsam warm und erregt geworden war –, loderte tief in seinem Bauch Verlangen auf, und so gern er es unterdrückt hätte, um sich nur auf ihren Besuch im Tartaros zu konzentrieren, machte Persephone ihm das ebenso schwer.
Sie schauderte, und ihr Po und ihre Schultern pressten sich an ihn.
Anscheinend musste er ihre Antwort nicht einmal hören, denn ihre Reaktion verriet ihm, dass sie sich daran erinnerte – und an das, was danach gewesen war.
Trotzdem antwortete sie.
»Ja.«
Hades Mundwinkel hoben sich, und als er sprach, streifte sein Mund über ihr Ohr und über ihren Hals.
»Schließe die Augen«, flüsterte er, während der Halbgott sich zu rühren begann, denn er wollte nicht, dass sie ihn ansehen musste.