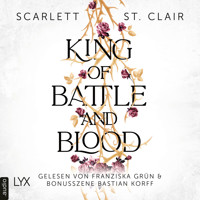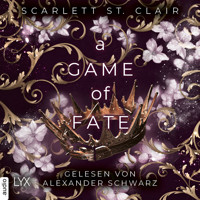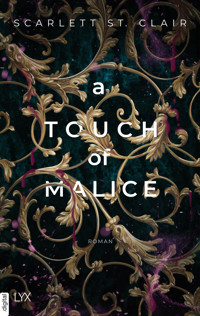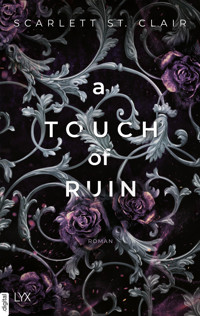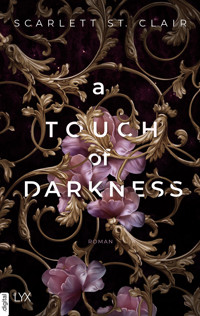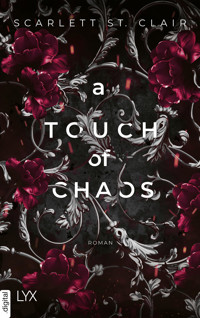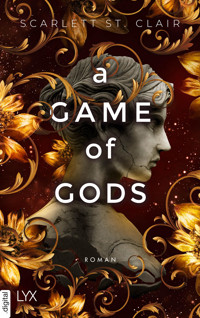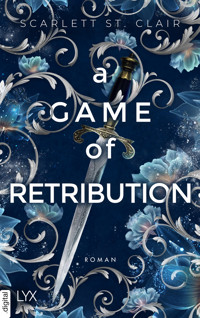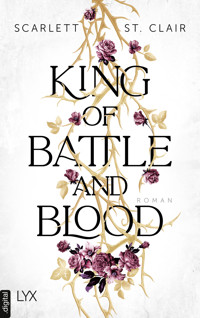
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie soll ihn hassen, hintergehen, töten - und sich auf keinen Fall in ihn verlieben!
Um das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Aleksandr Vasiliev heiraten - und töten. Doch in ihrer neuen Heimat angekommen merkt sie schnell, dass nichts, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt, wahr ist. So sehr sie sich auch dagegen wehrt, die Anziehungskraft zu Adrian ist unabwendbar, die Gefühle, die er in ihr auslöst, hat sie noch nie für jemanden empfunden. Aber sie darf sich auf keinen Fall in ihn verlieben und so ihre Mission aus den Augen verlieren: Sie muss ihn töten und sein gesamtes Reich in die Knie zwingen ...
»Spannend, düster, leidenschaftlich: Mit KING OF BATTLE AND BLOOD hat Scarlett St. Clair eine Welt erschaffen, die mich einfach nicht mehr loslässt.« JESSIWEDE.BOOKS
Auftakt der fesselnden KING-OF-BATTLE-AND-BLOOD-Trilogie von Bestseller-Autorin Scarlett St. Clair
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Bonusszene
Anmerkung der Autorin
Die Autorin
Die Romane von Scarlett St. Clair bei LYX
Impressum
Scarlett St. Clair
King of Battle and Blood
Roman
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
ZU DIESEM BUCH
Um den jahrelangen Krieg der Neun Häuser von Cordova zu beenden und zumindest das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian Aleksandr Vasiliev heiraten – und anschließend töten. Schweren Herzens verlässt sie ihre Heimat und folgt ihrem frisch angetrauten Ehemann in ein ihr unbekanntes Land, in dem die Sonne niemals scheint. Doch im Roten Palast angekommen merkt sie schnell, dass nichts von dem stimmt, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt. Denn der gefährliche Vampirfürst ist gütig, gerecht, einfühlsam und so ganz anders, als die Legenden es besagen. So sehr sie sich auch dagegen wehrt: Die Anziehungskraft zu ihm ist unabwendbar, die Gefühle, die er in ihr auslöst, hat sie noch nie für jemanden empfunden. Aber auf keinen Fall darf sie sich in ihn verlieben und so ihre Mission aus den Augen verlieren. Sie muss ihn töten und sein gesamtes Reich in die Knie zwingen, denn das Schicksal ihres Volkes liegt in ihren Händen …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für Ashley.
Die dieses Buch schon liebte,
noch bevor es überhaupt geschrieben war.
KAPITEL EINS
In den Randgebieten des Königreiches meines Vaters lagerte eine Armee von Vampiren. Die schwarzen Dächer ihrer Zelte sahen aus wie ein Ozean spitzer Wogen. Sie schienen sich meilenweit zu erstrecken und verschmolzen mit einem roten Horizont. Dies war der Himmel von Revekka, dem Imperium der Vampire, der diese Farbe schon seit meiner Geburt hatte. Es hieß, er sei von Dis, der Göttin des Geistes, verflucht worden, um vor dem Bösen zu warnen, das dort geboren war – dem Bösen, das mit dem Blutkönig begann. Doch zum Unglück für Cordova war der rote Himmel kein Anzeichen des Bösen, und somit gab es keine Warnung, als die Vampire ihre Invasion begannen.
Sie hatten sich gestern Nacht westlich der Grenze manifestiert, so als seien sie mit den Schatten gereist. Seitdem war alles ruhig und still, fast so, als habe ihre Präsenz alles Leben gestohlen. Nicht einmal der Wind rührte sich. Ein mulmiges Gefühl kroch mir wie Frost ins Herz und machte sich tief in meinem Bauch breit, als ich zwischen den Bäumen stand, nur wenige Schritte entfernt von der ersten Zeltreihe. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass dies das Ende war. Es zog hinter mir herauf wie ein Schatten und packte mich mit langen Fingern an den Schultern.
Ihrer Ankunft waren Gerüchte vorausgegangen. Gerüchte, dass Adrian Aleksandr Vasiliev – ich hasste es, seinen Namen auch nur zu denken – Jola dem Erdboden gleichgemacht, Elin geschändet, Siva erobert und Lita niedergebrannt hatte. Die Neun Häuser von Cordova fielen, eins nach dem anderen. Nun standen die Vampire vor meiner Türschwelle, und statt zu den Waffen zu rufen, hatte mein Vater, König Henri, um ein Treffen gebeten.
Er wollte mit dem Blutkönig verhandeln.
Die Entscheidung meines Vaters hatte gemischte Gefühle hervorgerufen. Manche wollten lieber kämpfen, als sich der Herrschaft dieses Monsters zu ergeben. Andere waren unsicher – hatte mein Vater den Tod auf dem Schlachtfeld gegen einen anderen Tod eingetauscht?
In der Schlacht gab es wenigstens Gewissheiten. Entweder man überlebte den Tag, oder man starb.
Unter der Herrschaft eines Monsters gab es keine Gewissheiten.
»Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass du so spät hierherkommst, und schon gar nicht so weit in ihre Nähe.«
Auch Commander Alec Killian stand mir gefährlich nahe, direkt hinter mir, sodass seine Schulter meinen Rücken streifte. An jedem anderen Tag hätte ich seine Nähe entschuldigt und seiner Hingabe als mein Geleitschutz angerechnet, doch ich wusste es besser.
Der Commander versuchte, Wiedergutmachung zu leisten.
Ich trat einen Schritt von ihm weg und drehte mich ein wenig um, um ihm einen mürrischen Blick zuzuwerfen und zugleich auf Distanz zu gehen. Alec – oder Killian, wie ich ihn lieber nannte – war Befehlshaber der Königlichen Garde. Die Position hatte er geerbt, als sein Vater, von dem er auch denselben Namen hatte, vor drei Jahren unerwartet verstarb.
Er erwiderte meinen Blick, und seine grauen Augen blickten stählern und sanft zugleich. Ich glaube, nur der Stahl wäre mir lieber gewesen, denn die Sanftmut weckte in mir den Wunsch, lieber noch zwei Schritte rückwärts zu treten. Es bedeutete, dass er Gefühle für mich hatte, doch jede Aufregung, die ich einst dabei empfunden hatte, seine Aufmerksamkeit zu erregen, war inzwischen verschwunden.
Nach außen hin war er alles, was ich geglaubt hatte, in einem Mann zu wollen – er war auf markante Art gut aussehend, mit einem Körper, der durch stundenlanges Training gestählt war. Seine Uniform, eine maßgeschneiderte marineblaue Tunika, eine Hose mit goldenen Verzierungen und ein lachhaft dramatischer goldener Umhang dienten dazu, seine Präsenz zu betonen. Er hatte dichtes dunkles Haar, und ich hatte ein paar Nächte zu viel mit diesen Haarsträhnen um meine Finger gewunden verbracht, während mein Körper erwärmt war, aber nicht entflammt in jener Leidenschaft, nach der ich mich wirklich sehnte. Am Ende war Commander Killian nur ein mittelmäßiger Liebhaber. Es hatte auch nicht gerade geholfen, dass ich seinen Bart nicht mochte, der so lang war, dass er die untere Hälfte seines Gesichts bedeckte. Ich konnte daher nicht sagen, welche Form sein Kinn hatte, aber ich nahm an, dass es kräftig war und zu seiner Präsenz passte – die mir langsam auf die Nerven ging.
»Ich stehe im Rang höher als du, Commander. Es liegt nicht in deiner Macht, mir zu sagen, was ich tun soll.«
»Nein, aber in der deines Vaters.«
Mir lief wieder ein Schauer der Verärgerung über den Rücken, und ich knirschte mit den Zähnen. Immer wenn Killian das Gefühl hatte, mich nicht kontrollieren zu können, behalf er sich damit, mit meinem Vater zu drohen. Und da fragte er sich, warum ich nicht mehr mit ihm schlafen wollte.
Statt meinen Zorn zur Kenntnis zu nehmen, grinste Killian nur, zufrieden, dass er einen Nerv getroffen hatte.
Er nickte in Richtung des Lagers. »Wir sollten bei Tageslicht angreifen, während sie schlafen.«
»Nur dass du damit Vaters Befehlen, den Frieden zu wahren, trotzen würdest«, entgegnete ich.
Früher hätte ich ihm zugestimmt – warum nicht die Vampire abschlachten, während sie schliefen? Schließlich war das Sonnenlicht ihre Schwäche. Doch Theodoric, der König von Jola, hatte seinen Soldaten genau das befohlen, und noch bevor sie ihren Angriff starten konnten, war die gesamte Armee von etwas überwältigt worden, das die Menschen die Blutpest nannten. Jene, die daran erkrankten, bluteten aus allen Körperöffnungen, bis sie starben, eingeschlossen König Theodoric und seine Gemahlin, die damit einen Zweijährigen zurückließen, der den Thron unter der Herrschaft des Blutkönigs erben sollte.
Wie sich herausstellte, hielt Sonnenlicht keine Magie auf.
»Werden sie uns so viel Respekt erweisen, wenn die Nacht kommt?«, konterte Killian. Der Commander hatte nie Scheu gehabt, seine Meinung über den Blutkönig und seine Invasion Cordovas auszudrücken. Ich verstand seinen Hass.
»Habe Vertrauen in die Soldaten, die du ausgebildet hast, Commander. Hast du sie denn nicht genau darauf vorbereitet?«
Mir war bewusst, dass ihm meine Antwort nicht gefiel. Ich konnte sein Stirnrunzeln förmlich im Rücken fühlen, denn wir wussten beide: Sollten die Vampire beschließen, anzugreifen, wären wir tot. Es brauchte fünf von uns, um einen von ihnen auszuschalten. Wir mussten schlicht darauf vertrauen, dass das Wort des Blutkönigs an meinen Vater das Leben unseres Volkes schützen würde.
»Auf Monster kann sich niemand vorbereiten, Prinzessin«, sagte Killian. Ich wandte den Blick von ihm ab und konzentrierte mich auf das Zelt des Königs, gut erkennbar an seinen Details in Blutrot und Gold, während Killian fortfuhr: »Ich bezweifle, dass selbst die Göttin Dis wusste, was aus ihrem Fluch werden würde.«
Es hieß, König Adrian habe Dis, die Göttin des Geistes, einst verärgert, und als Folge habe sie ihn dazu verflucht, nach Blut zu dürsten. Ihr Fluch verbreitete sich – manche Menschen überlebten die Verwandlung in einen Vampir, andere nicht. Seit ihrer Entstehung hatte die Welt keinen Frieden mehr gekannt. Ihre Präsenz hatte andere Monster hervorgebracht – all die Arten, die sich von Blut, von Leben, nährten. Ich habe nie etwas anderes gekannt, aber unsere Ahnen schon. Früher erinnerten sie sich noch an eine Welt ohne hohe Wälle und Tore um jedes Dorf, oder daran, wie es gewesen war, ohne Angst unter den Sternen zu wandeln, wenn die Dunkelheit kam.
Doch ich fürchtete das Dunkel nicht.
Ich fürchtete die Monster nicht.
Ich fürchtete nicht einmal den Blutkönig.
Aber ich hatte Angst um meinen Vater, um mein Volk, um meine Kultur. Denn Adrian Aleksandr Vasiliev war unausweichlich.
»Maßt du dir an zu wissen, was eine Göttin denkt?«, fragte ich.
»Du forderst mich ständig heraus. Habe ich etwas Falsches getan?«
»Hast du etwa Gefälligkeit erwartet, nur weil wir Sex hatten?«
Er zuckte zusammen, und dann runzelte er die Stirn. Endlich, dachte ich. Zorn.
»Du bist also aufgebracht«, stellte er fest.
Ich verdrehte die Augen. »Natürlich bin ich aufgebracht. Du hast meinem Vater eingeredet, dass ich Begleitschutz brauche.«
»Du schleichst dich nachts aus deinem Schlafgemach!«
Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass Sex mit Killian unangekündigte Besuche in meinem Schlafgemach bedeuten würde. Bis er es, wie immer, eines Nachts übertrieb und mein Gemach leer vorfand. Er hatte das ganze Schloss aus dem Schlaf geholt und eine komplette Armee den umgebenden Wald nach mir absuchen lassen, obwohl ich lediglich die Sterne betrachten wollte, etwas, das ich jahrelang oben auf den sanften Hügeln von Lara getan hatte. Doch das alles endete vor einer Woche. Nachdem man mich gefunden hatte, hatte mein Vater mich in sein Arbeitszimmer zitiert und mir einen Vortrag über den Zustand der Welt und die Bedeutung von Wachsamkeit gehalten – und mir dann Wachen und eine Ausgangsbeschränkung aufgezwungen.
Ich hatte protestiert. Schließlich war ich gut ausgebildet, eine Kriegerin, ebenso kompetent wie Killian. Ich konnte mich selbst verteidigen, zumindest innerhalb der Grenzen von Lara.
Nein, hatte mein Vater barsch gerufen, so schroff und unerwartet, dass ich zusammengezuckt war. Nach einem Moment der Stille und einem tiefen Atemzug hatte er hinzugefügt: Du bist zu wichtig, Issi.
Und in diesem Augenblick hatte er so gebrochen ausgesehen, dass ich kein weiteres Wort herausgebracht hatte – nicht vor ihm und nicht vor Killian.
Nun, eine Woche später, fühlte ich mich wie eingesperrt.
»Wenn du schon so erpicht darauf bist, meine Geheimnisse auszuplaudern, Commander, hast du auch zugegeben, mich zu ficken?«
»Hör auf, dieses Wort zu sagen«, stieß er hervor.
Wenigstens gab es doch etwas, worin er leidenschaftlich war, dachte ich. Trotzdem war sein Befehl nur eine weitere Provokation für mich.
»Und welches Wort sollte ich sagen?«, zischte ich. »Liebe machen? Wohl kaum.« Ich war nicht gerade nett zu ihm, aber wenn ich wütend war, dann wollte ich es den Verursacher meines Zorns auch fühlen lassen, und ich wusste, dass Killian es nun fühlte. Es war ein Wesenszug, den ich von meiner Mutter haben musste, angesichts der Tatsache, dass mein Vater seiner Wut nur selten Ausdruck verlieh. »Du scheinst zu glauben, dass das, was zwischen uns gewesen ist, mehr bedeutet.«
Er gab mir das Gefühl, als hätte er auf einmal ein Anrecht auf mich, und das gefiel mir gar nicht.
»Bin ich denn so furchtbar?«, fragte er leise.
Ich ballte die Fäuste, und für einen kurzen Moment krallten sich Schuldgefühle in mein Herz, doch ich schüttelte sie schnell ab. »Hör auf, mir die Worte im Mund umzudrehen.«
»Das versuche ich gar nicht, aber du kannst nicht leugnen, dass du unsere gemeinsame Zeit auch genossen hast.«
»Ich genieße Sex, Alec«, sagte ich ausdruckslos. »Aber er bedeutet mir nichts.«
Die Worte waren nur so dahingesagt, aber ich meinte sie ernst. Ich hatte nur deshalb beschlossen, mit Killian zu schlafen, weil er da gewesen war und ich ein Ventil gebraucht hatte. Das war mein erster Fehler gewesen. Denn es brachte mich dazu, gewisse Dinge zu übersehen, wie seine Neigung, meinen Vater über jede Bewegung von mir auf dem Laufenden zu halten.
»Das meinst du nicht ernst«, widersprach er.
»Killian.« Sein Name klang wie eine Warnung aus meinem Mund. Er hörte nicht zu, und wenn es etwas gab, das ich nicht ausstehen konnte, dann war es ein Mann, der überzeugt war, dass ich selbst nicht wusste, was ich wollte. »Wann wirst du es begreifen? Ich sage immer, was ich meine.«
Ich ging an ihm vorbei, und Killian griff nach meiner Hand. Ich entwand sie ihm und verpasste ihm einen Schlag in den Magen. Er stöhnte und fiel auf die Knie, während ich mich auf dem Absatz umdrehte.
»Isolde!«, keuchte er. »Wo gehst du hin?«
Ich ging weiter in den dichten Wald hinein. Die Blätter waren weich unter meinen Füßen, noch nass vom Morgentau. Ich wünschte, es wäre schon Frühling, wenn die Bäume üppig grün waren, dann hätte ich mich viel leichter unsichtbar machen können. Stattdessen ging ich zwischen bleichen skelettartigen Baumstämmen umher, unter einem Dach aus ineinander verflochtenen Ästen. Trotzdem war ich überzeugt, dass ich Killian abschütteln konnte. Ich kannte diese Wälder so gut wie mich selbst. Ich würde es ohne ihn zurück in die Festung schaffen, ganz wie es meine Absicht gewesen war, bevor er mir bis an die Grenze gefolgt war.
»Idiot«, flüsterte ich vor mich hin.
Mein Kiefer schmerzte davon, dass ich so fest die Zähne zusammengebissen hatte. Ich hasste Killian nicht, aber ich würde es auch nicht hinnehmen, eingesperrt zu werden. Ich war mir der Gefahren in der Welt wohl bewusst, und ich war dazu erzogen worden, jede Art Monster zu bekämpfen, sogar Vampire, auch wenn ich ihnen nicht gewachsen war. Aber das hatte ich wenigstens akzeptiert. Ginge es nach Killian, würden unsere Armeen genau jetzt gegen die Vampire kämpfen, und wahrscheinlich wären die meisten unserer Leute schon tot.
Als Menschen hatten wir kein Heilmittel, um gegen ihre Seuchen zu kämpfen, keine Fähigkeit, vor ihnen wegzulaufen, und keine Chance, ihrer Magie oder den Monstern, die sie erweckt hatten, entgegenzutreten. Wir waren geringer als sie und würden es immer sein, so lange nicht eine der Göttinnen die vielen und vielfältigen Gebete erhörte, die von den Frommen gesprochen wurden – was unwahrscheinlich war.
Die Göttinnen hatten uns schon vor langer Zeit verlassen, und manchmal hatte ich das Gefühl, ich sei die einzige Person, der das klar war.
Meine Schritte wurden langsamer, als ich den Geruch von Verfall in der Luft wahrnahm. Zuerst war er nur schwach, und einen kurzen Moment dachte ich, es wäre nur Einbildung.
Dann kroch mir die Kälte den Rücken hinauf, und ich blieb stehen.
Eine Striege war in der Nähe.
Striegen waren Menschen, die an der Blutpest gestorben und wieder von den Toten auferstanden waren. Furchterregende Kreaturen mit wenig Verstand, getrieben von ihrem Verlangen nach menschlichem Fleisch.
Der Geruch wurde stärker, und ich öffnete und schloss meine Faust und drehte mich langsam zu der ausgemergelten Kreatur herum.
Sie stand am Rande der Lichtung, nach hinten gebeugt, und starrte mich mit leeren Augen an. Die spärlichen Haare klebten mit verspritztem Blut am skelettartigen, hohlwangigen Gesicht. Das Monster starrte mich an, schnüffelte dann in der Luft, und ein Knurren drang aus seiner Kehle, während die Lippen sich zurückzogen, um lang gezogene Zähne zu offenbaren. Dann gab es einen furchterregenden Schrei von sich, fiel auf alle viere und raste auf mich zu.
Ich stellte mich breitbeinig hin und bereitete mich auf den Aufprall vor. Das Monster stürzte sich auf mich, und noch während es näher kam, stieß ich die Hand vor, in der ich den Dolch hielt, den ich immer in einer Hülle am Handgelenk trug. Er drang mühelos zwischen die Rippen der Kreatur. Ebenso schnell stieß ich mich ab und zog meine Klinge wieder zurück. Blut spritzte mir ins Gesicht, als die Striege rückwärts taumelte und mich wütend und gequält ankreischte.
Mein Treffer würde sie nur verwunden.
Um eine Striege zu töten, musste der Kopf vom Körper getrennt und dann beides verbrannt werden.
Nun, da das Monster geschwächt war, zog ich mein Schwert. Als das scharfe Metall singend aus seiner Scheide fuhr, zischte die Kreatur hasserfüllt und stürzte sich wieder auf mich. Sie traf auf meine Klinge, schlug mit ihrer Klauenhand nach mir und riss mir Gewand und Haut am Oberkörper auf. Ich gab einen kehligen Aufschrei von mir, als ich den Schmerz registrierte, der jedoch schnell von Zorn und Adrenalin verdrängt wurde. Ich zog das Schwert zurück und schwang es. Die Klinge war scharf, traf aber auf Widerstand, als sie in den Halsknochen der Striege fuhr. Ich stemmte den Fuß gegen ihren Brustkorb und riss meine Klinge wieder los. Als die Striege fiel, schlug ich noch einmal in ihren Hals, und als der Körper auf den Boden traf, landete der Kopf ein paar Schritte weiter.
Einen Moment lang stand ich schwer atmend da, und mein Oberkörper brannte dort, wo die Kreatur meine Haut zerfetzt hatte. Ich musste zu den Heilern. Wunden durch Striegen infizierten sich schnell. Doch bevor ich mich in Marsch setzte, trat ich gegen den Kopf der Striege, der daraufhin unter die Bäume an der Lichtung rollte.
Dass ich verletzt in die Festung zurückkehrte, wäre kein Vorteil für mich und meine Unabhängigkeit.
Plötzlich veränderte sich die Luft, und ich drehte mich um und hob die Klinge – die sofort auf eine andere prallte.
Der Aufprall überraschte mich, denn ich stand Auge in Auge mit einem Mann. Er war schön, eindrucksvoll, aber auf eine schroffe Weise. Seine Züge waren kantig – hohe Wangenknochen, ein scharf geschnittenes Kinn, gerade Nase, und alles umrahmt von blondem Haar, das ihm in sanften Wellen über die Schultern fiel. Seine Lippen waren voll und weich und seine Augen von scharf umrissenen Brauen überschattet. Doch es waren diese seltsamen Augen – blau, umrahmt von weiß – die meinen Blick fesselten, als er den Kopf neigte und mich ansprach.
»Was machst du so weit hier draußen?« Seine Stimme barg eine gewisse Faszination, mit einem seidigen Klang, der mir ein mulmiges Gefühl im Bauch verursachte.
Ich runzelte die Stirn bei seinen Worten und musterte ihn näher. Er trug eine schwarze Tunika, geschlossen mit goldenen Schnallen, und einen Waffenrock in derselben Farbe. Die Ränder waren mit Goldfaden bestickt. Es war eine feine Arbeit, aber nicht von meinem Volk gefertigt – unsere Muster waren weit komplizierter.
Ich musterte ihn misstrauisch. »Wer bist du?«, fragte ich.
Der Mann ließ sein Schwert sinken, als würde er mich nicht länger als eine Bedrohung sehen. Das wiederum weckte in mir den Wunsch, genau das zu sein – doch auch ich ließ den Arm sinken, und mein Griff um den Schwertgriff lockerte sich. Ich wollte es wieder fester greifen, aber ich konnte nicht.
»Ich bin vieles«, sagte er. »Mann, Monster, Liebhaber.«
Diesmal nahm ich in seinen Worten einen schwachen Akzent wahr – eine leichte Härte in der Aussprache, die ich nicht zuordnen konnte.
»Das ist keine Antwort«, sagte ich.
»Ich denke, du meinst, das ist nicht die Antwort, die du willst.«
»Du spielst mit mir.«
Sein Lächeln wurde breiter, und er sah auf eine sündige Art böse aus, auf eine Weise, die ich schmecken und fühlen wollte. Diese Gedanken ließen meine Haut prickeln, und mir wurde immer wärmer unter seinem Blick.
»Was willst du von mir?«, fragte er. Seine Stimme war tief, wie ein Schnurren, das mir tief im Bauch einen Schauer bescherte.
Ich schluckte schwer. »Ich will wissen, warum du hier bist.«
»Ich habe die Striege verfolgt, als sie die Richtung änderte.« Sein Blick fiel auf meinen Oberkörper. »Ich weiß nun, warum.«
Verunsichert hob ich die Hand und atmete zischend ein, als ich meine zerfetzte Haut berührte. Das plötzliche Auflodern von Schmerz machte mich benommen.
»Ich habe sie getötet«, brachte ich hervor, doch meine Zunge fühlte sich schwer im Mund an.
Seine Mundwinkel hoben sich. »Das sehe ich.«
»Ich sollte gehen«, flüsterte ich und hielt seinen Blick fest. Ich wollte, dass mein Körper sich fortbewegte, aber er fühlte sich viel zu locker an. Vielleicht machte sich die Infektion schon in meinem Blut breit.
»Solltest du«, pflichtete er mir bei. »Aber du wirst nicht.«
Bei seinen Worten schrillten Alarmglocken in meinem Verstand, und als er auf mich zukam, gewann ich unvermittelt meine Fähigkeit, mich zu bewegen, wieder zurück. Ich streckte die Hand seinem Bauch entgegen und zog meinen Dolch, aber seine Hand schloss sich um mein Handgelenk. Er zog mich mit einem Ruck vorwärts, sodass sein Körper sich an meinen presste, trotz meiner Wunde und trotz des Blutes. Er beugte sich über mich, packte mich am Kopf, sodass seine Finger sich in meine Kopfhaut bohrten, und einen Augenblick lang hatte ich Angst, dass er mich entweder küssen oder mir das Genick brechen würde. Stattdessen wurde sein Griff noch fester, sein Blick fixierte mich, und sein Daumen strich über meine Lippen.
»Wie ist dein Name?«, fragte er. Seine Stimme durchlief mich wie ein Schauder, und ich hörte mich antworten.
»Ich bin Isolde.« Die Antwort drang über meine Lippen, die gegen meinen Verstand kämpften, der wiederum gegen ihn wütete.
»Wer bist du?«
Wieder antwortete ich nicht aus eigenem Willen, und meine Stimme klang wie das Flüstern einer Liebenden. »Ich bin die Prinzessin des Hauses Lara.«
»Isolde«, wiederholte er meinen Namen, ein raues Grollen, das an meiner Brust vibrierte. »Meine Liebste.«
Dann beugte er sich vor, und seine Zunge strich über die Wunde an meinem Oberkörper. Ich konnte nicht atmen, mich nicht bewegen, nicht sprechen. Das Schlimmste dabei war, dass es sich gut anfühlte. Es fühlte sich besitzergreifend und unsittlich an, und ich erkannte, dass ich nicht länger versuchte ihn niederzustechen, sondern mich an ihn klammerte, während er es tat.
Als er sich von mir löste, waren seine vollen Lippen befleckt mit meinem Blut. Er schluckte, und seine Augen leuchteten, als er mich musterte, meine Augen, meine Lippen, meinen Hals. Sein eindringlicher Blick entfachte etwas tief in mir, und das Feuer breitete sich aus und weckte ein schmerzhaftes Sehnen in mir. Ich schämte mich, denn ich wusste, dass dieser Mann ein Soldat des Blutkönigs war, ein Vampir.
Ich wand mich in seinem Griff und war überrascht, als er mich freigab. Ich stolperte rückwärts, hob die Hand an meinen Oberkörper – und spürte glatte Haut. Ich war geheilt.
»Du bist ein Monster.«
»Ich habe dich geheilt«, sagte er, als würde ihn das weniger zu einem Monster machen.
»Ich habe nicht um deine Hilfe gebeten«, fauchte ich.
»Nein, aber du hast sie genossen.«
Ich sah ihn finster an. »Du hast mich kontrolliert.«
Das war der Grund, warum ich nicht fähig gewesen war, nach meinem Schwert zu greifen, warum mein Körper im Widerstreit mit meinem Verstand gelegen hatte, warum ich so plötzlich das drängende Verlangen fühlte, von dem Gewicht eines warmen Körpers niedergedrückt zu werden, der mich besser füllen konnte als alles, was ich je zuvor gehabt hatte. Ich war außer Kontrolle.
Und das war seine Schuld.
»Ich kann keine Emotionen kontrollieren.« Er sagte es so sachlich, dass es schwer war, ihn der Lüge zu bezichtigen.
Ich hob meine Klinge, und der Vampir lachte.
»Zorn steht dir, meine Liebste. Das gefällt mir.«
Ich machte ein finsteres Gesicht, aber mein Zorn machte sein Lächeln nur noch breiter, und seine Lippen entblößten schimmernd weiße Zähne, ohne jedes Zeichen, dass er sich soeben an meinem Blut genährt hatte. Mein Hass auf ihn wurde noch tiefer.
»Es ist noch heller Tag«, sagte ich. »Wie bist du in der Lage, unter uns zu wandeln?«
Vampire konnten sich nur in Revekka tagsüber draußen aufhalten, wo der rote Himmel die Sonnenstrahlen blockierte. Entwickeln sie sich etwa weiter? Der Gedanke bescherte mir ein neues Gefühl von Grauen tief in den Eingeweiden.
»Es ist kurz vor Sonnenuntergang«, erwiderte er. »Diese Zeit ist nicht so gefährlich für jemanden wie mich.«
Was bedeutet das?
Doch ich fragte ihn nicht, und er bot mir keine nähere Erklärung. Stattdessen neigte er den Kopf. »Wir werden uns wiedersehen, Prinzessin Isolde. Dafür werde ich sorgen.«
Sein Versprechen durchlief mich wie ein Schauer, als habe er den Göttinnen selbst einen Eid geschworen. Ich hob meine Klinge und griff an, aber als ich das Schwert schwang, verschwand er wie Nebel in der Morgensonne.
Als ich allein war, begann ich zu zittern.
Ich hatte eine Begegnung mit einem Vampir überlebt, der mein Blut gekostet hatte – und das Schlimmste dabei war, dass er recht gehabt hatte.
Es hatte mir gefallen.
KAPITEL ZWEI
Ich hatte bereits Opfer von Vampiren gesehen – Menschen, die an der Schwelle zur Verwandlung standen, bevor ihnen das Herz aus dem Körper geschnitten und sie verbrannt worden waren. Ich hatte auch Körper gesehen, denen jeder Tropfen Blut ausgesaugt worden war, sodass sie nicht mehr überlebensfähig waren. Aber ich war noch nie einem echten Vampir begegnet.
»Sie sehen aus wie wir, aber sie sind nicht wie wir«, hatte Killians Vater uns während der Ausbildung gewarnt. »Sie sind schnell. Sie werden euren Verstand kontrollieren und euer Blut trinken, und ihr werdet es nicht überleben. Und wenn doch, werdet ihr euch den Tod wünschen.«
Dies waren die Wahrheiten, die man mir über Vampire erzählt hatte.
Niemand hatte mir je gesagt, inwiefern sie wie wir waren – dass sie schön sein konnten, und dass ihre Berührung ein heftiges Begehren auslösen konnte, jenseits von allem, was ich je erlebt hatte. Alles in mir war derart angespannt, dass jeder Atemzug mich daran erinnerte, wie unbedingt ich berührt werden wollte.
»Isolde!«
Aber nicht von ihm.
Killians Stimme löste den Nebel in meinem Verstand auf. Er kam näher, doch ich wollte nicht von ihm eingeholt werden. Es gab zu viel auf dieser Lichtung, das einer Erklärung bedurfte – die Striege, mein zerrissenes Gewand, das Fehlen von Blut.
Ich drehte mich auf dem Absatz um und floh.
Es fühlte sich an, als habe sich die Entfernung bis zur Festung verdoppelt. Der Lauf war quälend, und ich wurde zunehmend wütend, denn ich fühlte immer noch die Nachwirkung meiner Begegnung mit dem Vampir. Mein Körper war warm, vor allem zwischen den Beinen, und mir war viel zu deutlich bewusst, wie schwer und empfindlich sich meine Brüste anfühlten, die sich durch den Wollmantel wund rieben, den ich eng um mich zog. Als ich die Bäume hinter mir ließ, fühlte ich ein schmerzhaftes Sehnen.
Das war Folter.
War das eine besonders grausame Form der Kriegsführung?
Ich umrundete die hohen Steinmauern, die sich Unheil verheißend erhoben und mich in kalte Schatten hüllten. Die Mauern waren ein komplexes System aus Forts, Bastionen und Türmen, die einen lückenlosen Ring um die Hohe Stadt Lara und Burg Fiora bildeten. Sie waren nach der Geburt der Monster – dem Beginn der Finsteren Ära – erbaut worden. Es gab vier Tore, die Zugang zur Hohen Stadt gestatteten, doch nur zwei wurden tatsächlich genutzt. Eins war für den Handel und führte in das Herz der Stadt. Das andere war für Diplomaten und bot eine angenehme Route über Kopfsteinstraßen zu den leuchtend weißen Türmen der Burg.
Die anderen beiden Tore waren nur symbolischer Natur. Eins war für Asha, die Göttin des Lebens, und das andere für Dis, die Göttin des Geistes. Früher wären sie zur Morgendämmerung geöffnet worden, um das Erwachen der Stadt zu markieren und die Balance zwischen Leben und Tod zu symbolisieren. Doch seit der Geburt der Vampire blieb das Tor von Dis versiegelt, eine Entscheidung, die vor sehr langer Zeit von den Königen der Neun Häuser gefällt worden war. Es gab ein paar Priesterinnen von Dis, die diese Entscheidung kritisierten und behaupteten, dass die Seuche der Monster nur schlimmer werden würde – und sie hatten sich nicht geirrt. Aus diesem Grund hatten alle Dörfer der Neun Häuser hohe Mauern und Tore, die sich vor Sonnenuntergang schlossen und nicht vor Sonnenaufgang wieder öffneten.
Außer heute Nacht.
Heute Nacht würden sich die Tore öffnen, um den Blutkönig und sein Volk hereinzulassen. Es wäre das erste Mal seit ihrer Erbauung, dass die Tore offen bleiben würden.
Ich näherte mich dem Diplomatentor. Für gewöhnlich ging ich gern durch das Handelstor und wanderte durch die Straßen, um meine Lieblingsverkäufer für Blumen und Fleischpasteten zu besuchen, doch nach meiner Begegnung im Wald musste ich mich umziehen, und ich brauchte Zeit für mich.
»Prinzessin«, grüßte einer der Wachposten am Tor. Sein Name war Nicolae. Er war jung und hatte ein teigiges, blasses Gesicht. Der andere, schweigend und stoisch, hieß Lascar. Er hatte braune Haut und war fast zu groß für das Wachhäuschen hinter ihm. Beide Soldaten waren neu in der Königlichen Garde. Ich mochte die neuen Rekruten, denn sie waren leicht zu beeinflussen. Ich musste nur lächeln, ihr Ego streicheln, und sie würden so tun, als hätten sie mich nie gesehen, wenn ich nachts durch die Tore hinausschlüpfte.
Doch das war, bevor sie letzte Woche alle mitten in der Nacht aus dem Schlaf geholt worden waren, um mich zu suchen, und bevor die zwei Wachposten, die mich hinausschlüpfen hatten lassen, unehrenhaft entlassen und auf die Pflichten eines Stallburschen degradiert worden waren.
»Zurück ohne Eskorte, wie ich sehe«, meinte Nicolae. Er gab sich Mühe, streng zu klingen, aber dafür leuchteten seine Augen zu sehr.
»Commander Killian ist an der Grenze geblieben«, sagte ich.
Nicolaes Blick richtete sich über meine Schulter, und er zog eine dunkle Augenbraue hoch. »Wirklich?«
Ich drehte mich um und sah Killian, der gerade zwischen den Bäumen hervorkam. Sein absurder Umhang flatterte drohend hinter ihm.
Ich drehte mich rasch um zu Nicolae und lächelte. »Er muss seine Meinung wohl geändert haben.«
»Braucht Ihr eine Eskorte zu …«
»Nein«, fiel ich ihm ins Wort, und um den Schlag abzuschwächen, legte ich ihm eine Hand auf die Schulter, während ich mit der anderen Hand meinen Mantel fest um mich zog. »Danke, Nicolae.«
Ich eilte durch das Tor und wurde sogleich von der gewaltigen Silhouette des Heiligtums von Asha auf der rechten Seite begrüßt. Der Stein war strahlend weiß, und die handbemalten bunten Fenster leuchteten in lebhaften Farben. Ihm gegenüber befand sich das bröckelnde Gebäude des Heiligtums von Dis. Das Gebäude selbst sah aus wie ein Schatten, erbaut aus Vulkangestein, das von den St.-Amand-Inseln importiert worden war. Die Fenster, die nicht zerbrochen oder zugenagelt waren, waren dunkel, spitz zulaufend und mit Bleiverglasung. Trotz seiner heruntergekommenen Erscheinung wurde es noch immer von einigen wenigen Priesterinnen bewohnt, doch weil nur sehr wenige das Heiligtum besuchten und die Priesterinnen nur gerufen wurden, wenn der Tod nahe war, fehlte ihnen das Geld zur Instandhaltung.
Ich hielt zu beiden Gebäuden gleichermaßen Distanz, als ich vorbeiging. Ich war nie gewillt gewesen, eine von beiden Göttinnen zu verehren. Mein Vater kritisierte mich dafür regelmäßig, doch ich hatte nicht den Wunsch, ihnen meine Loyalität zu erweisen – weder der, die Monster in unsere Welt gebracht hatte, noch der, die zugesehen hatte.
Jenseits der Heiligtümer gab es eine Reihe schön verputzter Gebäude – eine Mischung aus Wohnhäusern, Läden und Gasthöfen – alle mit Strohdächern und Blumenkästen voller bunter Blumen. Dahinter kam eine kurze Mauer, die den Beginn königlichen Bodens markierte. Eine Reihe Bäume bot Privatsphäre für Angehörige des Hofes, die die Gärten für Training oder Spiele nutzen wollten, wofür ich dankbar war. Die Hofdamen scharwenzelten um mich herum. Viele von ihnen mochte ich, aber es fiel mir schwer, zu erkennen, wer in seiner Freundlichkeit aufrichtig war, denn ich hatte viele im Verdacht, dass sie nur meine Gunst gewinnen wollten, weil ich eines Tages Königin sein würde.
Ich überquerte den weitläufigen Hof und ging dann an der Burgmauer entlang nach hinten, wo ich durch die Bediensteten-Quartiere eintrat, um Handarbeiten und dem Klatsch über den Blutkönig aus dem Weg zu gehen. Ich stieg eine schmale Treppe links vom Eingang hinauf, und die Reibung meiner Oberschenkel war fast unerträglich. Ich war gereizt, sowohl von dem Sehnen, das tief in meinem Bauch brannte, als auch von der Magie, die mich immer noch im Griff hielt, was für eine Magie das auch sein mochte. Wie konnte ich immer noch in diesem drängenden Verlangen nach Erlösung gefangen sein? Mit jedem Treppenlauf wurde mir heißer, und meine Gedanken wanderten zurück zu dem Moment, als der Vampir meinen Kopf gehalten, meine Lippen berührt und mir Worte entlockt hatte. Ich fragte mich, welche Laute er meiner Kehle wohl noch zu entlocken vermochte, während seine Finger andere empfindsame und pralle Regionen meines Körpers erforschten.
Deine Gedanken sind abstoßend, tadelte ich mich und rief mir dann etwas freundlicher in Erinnerung, dass ich diese Dinge nur dachte, weil ich unter irgendeinem Zauber stand.
Nach sechs Treppenläufen hatte ich mein Gemach erreicht. Darin angekommen, lehnte ich mich an die kratzige Holztür. Den größten Teil meines Aufstieges hatte ich den Atem angehalten, weil ich nicht aufhören konnte, an Sex zu denken, und an den Vampir, der wie eine Art schöner Retter ausgesehen hatte, aber in Wirklichkeit ein Monster war. Nun dachte ich an ihn, während meine Hand über meinen Bauch abwärts wanderte zwischen meine Beine, wo meine pralle Klitoris sich meiner Berührung entgegenstreckte. Ich stöhnte und rieb mich an meiner Hand, in dem drängenden Verlangen, Lust durch meinen Körper rauschen zu fühlen, zum Orgasmus zu kommen, damit ich damit vielleicht auch das Bild dieses Vampirs und seiner Magie loswerden konnte. Das war es doch, was er wollte – mich zu diesem Moment zu treiben – und er hatte nichts getan, um das zu verdienen. Er hatte nichts Erotisches gesagt, mich weder geküsst noch meine Haut liebkost, und doch tauchte sein Gesicht ungebeten in meinem Verstand auf.
Meine Wut war fast greifbar, und mir war, als könnte ich sein Lachen in meinem Kopf hallen hören – das von der Lichtung, amüsiert, finster, arrogant.
Bei der Göttin, ich hasste ihn.
Ich raffte meine Röcke mit den Händen, bis ich die Löckchen zwischen meinen Beinen fühlen konnte, und dann streiften meine Fingerspitzen über meine Klitoris. Sie streckte sich meiner Berührung entgegen, empfindsam vor Verlangen und immer noch so fest, dass sie fast hervortrat. Ich hielt den Atem an, als meine Finger sich immer mehr der heißen Feuchte zwischen meinen Beinen näherten, und ich konnte schwören, dass ich noch nie so feucht gewesen war.
Es muss Magie sein, dachte ich, und doch verkrampfte sich mein Bauch vor Anspannung, Scham und Schuldgefühl.
Ich strich mit dem Mittelfinger über meine Spalte und nahm die Feuchte dort auf – als es plötzlich hinter mir an der Tür klopfte.
Ich erstarrte, die Finger kurz davor, in meine Hitze einzutauchen.
»Meine Lady, seid Ihr dadrin?«
Nadia, meine Zofe, stand vor der Tür. Sie war schon seit meiner Geburt mein Kindermädchen gewesen, und wir hatten eine enge Bindung zueinander aufgebaut. Sie war die einzige Zofe oder Bedienstete in der Burg, mit der ich abseits ihrer üblichen Pflichten Zeit verbrachte. Es war eine Beziehung, die der Hof seltsam fand, und nur Mutige machten dazu Bemerkungen, doch das kümmerte mich nicht. Nadia war die Mutter, die ich nie gehabt hatte, und ich liebte sie.
Nur nicht genau jetzt. Genau jetzt wollte ich, dass sie wieder ging. Ich war nicht bereit, mein Streben nach Erlösung aufzugeben, also ließ ich einen Finger in mich gleiten und atmete leise aus.
»Meine Lady, ich weiß, dass Ihr dadrin seid.«
Wenn ich sie ignoriere, geht sie vielleicht wieder weg, dachte ich.
Ich war so nass, dass ich kaum irgendetwas fühlen konnte. Ich brauchte etwas mit mehr Umfang, brauchte das Gefühl, erfüllt und gedehnt zu werden. Ich schob noch einen Finger hinein, presste den Kopf fest an die Tür hinter mir, und meine Handfläche glitt meinen Körper hinauf an meine Brust und drückte sie, massierte und reizte sie durch die Fetzen meines Gewandes hindurch. Und die ganze Zeit dachte ich an dieses Monster im Wald. An das, das aussah wie ein Mann, das meinen Kopf in seinen großen Händen gehalten, meine Lippen mit seinen schlanken Fingern gestreichelt und seinen harten Körper an mich gedrückt hatte. Hätte er mich geküsst, wäre ich ihm erlegen. Ich hätte mich von ihm vögeln lassen, und wahrscheinlich hätte das meinen Tod bedeutet, aber wenigstens hätte ich auf meinem Weg zum Geist Leidenschaft kennengelernt.
»Meine Lady?«
Bei der verdammten Göttin.
Ich gab ein frustriertes Knurren von mir, nahm die Hand weg und ließ meine Röcke sinken. Dann drehte ich mich auf dem Absatz herum und öffnete schwungvoll die Tür.
»Was ist, Nadia?«, fragte ich barsch.
Wenn Nadia mich unbedingt unterbrechen musste, dann musste sie eben auch mit meiner Laune klarkommen – nur dass sie mich eben kannte und nicht einmal zuckte. Sie stand vor mir und sah überaus unbeeindruckt aus. Ihr langes dunkles Haar war zu Zöpfen geflochten und von Silber durchzogen, und diese Zöpfe umrahmten ihr dünnes Gesicht und bildeten einen krausen Heiligenschein. Doch ihre braune Haut war glatt, und nur um die noch immer tiefschwarzen und lebhaften Augen hatte sie Fältchen.
»Ich bin hier, um Euch bei den Vorbereitungen für heute Abend zu helfen.«
Ich sah sie an und blinzelte verständnislos. »Heute Abend?«
»Für die Ankunft des Blutkönigs.«
Ich verdrehte die Augen, trat von der Tür weg und drehte mich schwungvoll um, sodass der Rock um meine Beine wirbelte. Die Bewegung half, meinen Körper zu kühlen und die Anspannung in meinem Unterleib zu lindern.
»Mir ist egal, wie ich für den Blutkönig aussehe.«
»Mir wäre es auch lieber, wenn ich Euch nicht herausputzen müsste, aber Ihr seid eine Prinzessin, und als solche solltet Ihr auch wie eine aussehen, wenn Ihr an der Seite Eures Vaters steht.« Nadia folgte mir in mein Gemach und schloss die Tür hinter sich.
Mein Gemach war klein, und das Bett nahm viel Raum ein, sodass nur wenig mehr darin Platz fand als eine Truhe voll mit Andenken und einer Garderobe. Ich hätte eine große Suite haben können, aber ich hatte dieses Gemach gewählt wegen seiner Aussicht – das Fenster bot einen Blick auf den Garten meiner Mutter.
»Was habt Ihr überhaupt hier drin gemacht? Ihr habt lange gebraucht, um die Tür zu öffnen«, meinte Nadia und schürte das Feuer im Kamin.
Selbst wenn ich die Kälte gespürt hätte, hätte ich die glühende Asche nie angefacht. Ich hatte Angst vor Feuer, selbst wenn es eingeschlossen war. Ich mochte weder die Geräusche, das Knistern und Krachen, noch den Geruch von Rauch oder auch nur die Hitze, aber es war nun wirklich zu kalt, um ohne ein Feuer auszukommen. Also überließ ich es Nadia, es am Leben zu halten, und machte einen weiten Bogen darum, als ich am Kamin vorbeiging.
»Schlafen«, antwortete ich, ließ mich auf das Bett fallen und starrte hinauf auf den Baldachin aus blauem Samt.
Ich fühlte mich immer noch aufgewühlt, aber wahrscheinlich war es besser, dass Nadia mich gestört hatte. Andernfalls hätte ich weiter masturbiert mit dem Monster aus dem Wald in meinen Gedanken – wie es mich berührte, wie es roch und wie es sich anfühlte – und hätte mich dann noch mehr gehasst, als ich es jetzt schon tat.
Ich seufzte.
Du bist ein Opfer, sagte ich mir, obwohl ich es hasste, das zuzugeben. Man hatte uns schon in jungen Jahren gelehrt, dass Vampire sexuelle Kreaturen waren und häufig Zauber wirkten, die selbst die Frömmsten mit Lust erfüllten.
Dass ich nicht fromm war, half dabei nicht wirklich.
»Das stimmt nicht«, sagte Nadia und richtete sich von ihrem Platz vor dem Feuer auf. Sie deutete mit dem Schürhaken auf mich. »Ich habe Euch eben erst sechs Treppenläufe hinaufrennen sehen.«
»Ich hatte es eilig, mich schlafen zu legen.«
Sie zog eine Augenbraue hoch und ließ den Schürhaken sinken. »Und Commander Killian zu entfliehen, hörte ich.«
Ich verdrehte die Augen. »Commander Killian ist notgeil. Ich nicht.«
»Er würde einen feinen Ehemann abgeben«, konterte Nadia und klang so begeistert dabei, dass ich zurückschreckte.
Ich setzte mich auf und starrte sie an. »Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe?«
Nadia war einundvierzig und unverheiratet – was vollkommen in Ordnung war, nur nicht für sie. Sie wollte verheiratet sein, und ihre Meinung zu dem Thema war so ziemlich die gleiche wie die der Mehrheit der Cordovianer: Jede unverheiratete Frau über achtzehn galt als alte Jungfer. Die Eile, sich verheiraten zu wollen, rührte wohl daher, dass immer mehr Menschen jung starben.
Ich war sechsundzwanzig und vollkommen zufrieden damit, unverheiratet zu bleiben. Diese Tatsache gab ich auch lautstark kund – unter anderem –, was die königlichen Familien und ihre Standesgenossen ziemlich verstörend fanden. Häufig führte das Thema zu der ungebetenen Bemerkung, dass ich gezähmt werden müsse. Allerdings hatte der letzte Mann, der dies von sich gegeben hat, sich der Spitze meines Dolches gegenübergesehen.
Unnötig zu sagen, dass ich einen gewissen Ruf hatte. Aber ich würde keinen Mann akzeptieren, der glaubte, mich kontrollieren zu können. Mein Wunsch, unverheiratet zu bleiben, deckte sich auch mit meinen Gefühlen in Bezug auf Liebe. Liebe war ein Risiko, das ich nur für meinen Vater einzugehen bereit war, für Nadia und für mein Volk.
Mehr Liebe bedeutete, mehr zu verlieren.
»Ich habe gehört, was Ihr gesagt habt. Aber was ist denn falsch an notgeil? Er wäre Euch treu ergeben.«
»Und würde mich kontrollieren wollen.«
Und ich würde mit ihm schlafen müssen … regelmäßig. Ich krümmte mich innerlich, als ich mir ein Leben mit leidenschaftslosem Sex vorstellte. Das konnte ich nicht. Nein, Commander Killian war nicht der richtige Mann für mich.
»Ihr solltet nicht so wählerisch sein, Isolde. Ihr wisst, die männliche Bevölkerung schwindet unter den Vampiren. Bald wird es noch weniger Männer geben, unter denen Ihr wählen könnt.«
»Wer sagt denn, dass ich wählen muss?«
Vater hatte nie gesagt, dass ich heiraten müsse. Es gab keine politischen Allianzen zu schmieden, denn die Häuser waren vereint in ihrer Entschlossenheit, den Blutkönig zu besiegen, schon seit dem Aufstieg der Vampire … bis vor Kurzem. Bis mein Vater beschlossen hatte, vor ihm zu kuschen. Nun waren wir geächtet. Wenn ich bereits zuvor keine passende Braut abgegeben hatte, dann jetzt schon gar nicht. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass sich bald noch mehr Königreiche der Entscheidung meines Vaters anschließen würden, das Leben ihres Volkes über den Kampf zu stellen.
»Jede ehrenwerte Lady heiratet, Isolde.«
»Nadia, wir wissen beide, dass ich nicht ehrenwert bin.«
»Ihr könntet so tun«, konterte sie. »Ihr seid eine Prinzessin, gesegnet von der Göttin, und doch macht Ihr alles zum Gespött, was sie Euch geschenkt hat.«
Mein Gesicht wurde rot vor Zorn über Nadias Worte, und ich stand auf. Wäre sie jemand anderes in meinen Diensten gewesen, hätte ich sie entlassen, aber ich kannte Nadia. Sie war zutiefst religiös und eine hingebungsvolle Anhängerin von Asha – sie hatte ihre eigenen Gründe für ihren Glauben, ebenso wie ich meine hatte. Außerdem wusste ich, dass sie es gut meinte, aber das bedeutete nicht, dass ich ihre Ansichten teilen musste. Selbst wenn Cordova nicht mit Monstern verflucht worden wäre, könnte ich nie den beiden Göttinnen Loyalität erweisen, die mir meine Mutter genommen hatten, bevor ich auch nur eine Chance hatte, sie kennenzulernen.
Ich war überrascht, wie ruhig ich klang, als ich antwortete.
»Der Tag, an dem Asha die Welt von den Vampiren befreit, ist der Tag, an dem ich ihre Wohltaten ehre, Nadia. Bis dahin kann ich nur die sein, die ich bin.«
Sie seufzte, aber nicht enttäuscht, sondern resigniert – ihr Job war von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Sie sollte mich zu einer Lady erziehen, die geschniegelt und gestriegelt war und am Ende Königin von Lara werden würde. Was sie stattdessen bekommen hatte, war ich. Ich war mir noch nicht sicher, was ich war. Ungezähmt, wild, lebhaft – alles Worte, mit denen man mich schon beschrieben hatte. Was immer ich war, ich passte in keine Gussform, trotzdem glaubte ich nicht, dass mich das zu einer schlechten Prinzessin machte oder dass es mich zu einer schlechten Königin machen würde. Es machte mich zu jemandem, der bereit war, ohne einen König zu herrschen, auch wenn ich nicht sagen konnte, ob diese Welt schon dafür bereit wäre.
»Nun«, meinte Nadia. »Wenn Ihr schon die sein müsst, die Ihr seid, dann können wir Euch zumindest wie eine Prinzessin aussehen lassen. Was habt Ihr mit Eurem Gewand angestellt?«
Ich senkte den Blick auf meinen Brustkorb. In meiner Aufregung hatte ich ganz vergessen, dass es zerfetzt war.
»Oh. Ich bin auf dem Rückweg von der Grenze einer Striege begegnet.«
Ich sah keinen Grund, deswegen zu lügen. Wir alle waren im Kampf ausgebildet worden, da wir in der Finsteren Ära geboren waren. Es war eine Fähigkeit, die ebenso notwendig war wie Laufen lernen.
»Wärt Ihr bei Commander Killian geblieben, hättet Ihr nicht kämpfen müssen.«
»Ich kämpfe gern«, widersprach ich.
Nadia musterte mit schmalen Augen mein zerfetztes Mieder, und ich wusste, dass sie Eins und Eins zusammenzählte – zerfetztes, blutiges Kleid, aber keine sichtbaren Wunden.
»Außerdem hat sie mich kaum gestreift«, sagte ich schnell. »Das Blut ist von ihr. Du weißt ja, was passiert, wenn man eine Ader trifft.«
Nadia schüttelte den Kopf und zeigte zum Waschraum. »Bad. Jetzt.«
Ich gehorchte eilig und war froh, mir diesen Tag endlich vom Körper schrubben zu können. Vielleicht hatte ich ja Glück, und das Wasser löschte das tobende Feuer in mir, bevor es meine Knochen in Asche verwandelte.
KAPITEL DREI
Eine Stunde später war ich so weit, dass man mich meinem Vater präsentieren konnte. Ich ließ Nadia mein Kleid wählen, was eine Seltenheit war, und ich denke, in ihrer Aufregung vergaß sie den Anlass, denn sie wählte mein Lieblingskleid: himmelblaue Seide mit Perlenverzierungen, die sich wie loderndes Feuer von meiner braunen Haut abhoben. Der Ausschnitt war tief und rechteckig, und meine Brüste wölbten sich nach oben.
Nadia schnalzte mit der Zunge, ein Zeichen ihres Missfallens.
»Zu viel Brot«, meinte sie und versuchte – vergeblich –, meinen Ausschnitt höher zu ziehen.
»Wenn du denkst, du kannst mich damit abschrecken – das klappt nicht.«
Nadia kommentierte mein Gewicht kritisch, weil es ebenfalls ein Teil von mir war, der nicht ins Schema passte. Ich hatte große Brüste und breite Hüften. Einer meiner Oberschenkel hatte wahrscheinlich denselben Umfang wie ihre Taille. Aber auch das kümmerte mich nicht wirklich. Ich war fit, und ich konnte kämpfen. Das war mehr, als ich von ihr sagen konnte, einem Kindermädchen, das darin gescheitert war, eine sanftmütige Prinzessin aus mir zu machen.
Nadia legte mein Haar über meine Schultern nach vorn, und arrangierte die dichten, dunklen Wellen so, dass sie meine vollen Brüste kaschierten. Als sie damit fertig war, schob ich es prompt wieder nach hinten.
»Kann ich kündigen?«, fragte sie, während sie eine Perlentiara aus der Holztruhe am Fußende meines Bettes herausholte. Ich besaß nicht viele Kopfbedeckungen, denn was ich besaß, hatte meiner Mutter gehört, und viele Stücke kamen aus ihrer Heimat auf dem Atoll von Nalani. Sie stammte aus einem Inselvolk. Seefahrer, Weber und Gärtner – daher die Liebe meiner Mutter zum Gartenbau.
Ich lachte. »Und was würdest du mit deiner Zeit anfangen? Kissen besticken?«
»Lesen, vorlautes Kind«, antwortete Nadia unwirsch, aber ihre Antwort war scherzhaft und keinesfalls so voller Anspannung wie bei unseren früheren Auseinandersetzungen.
»Ich bin weit davon entfernt, ein Kind zu sein, Nadia.«
»Ihr seid ein Kind, bis Ihr heiratet«, sagte sie.
Ich verdrehte die Augen, strich mein Kleid glatt und betrachtete mich im Spiegel. Mein Leben lang hatte man mir gesagt, ich sähe aus wie meine Mutter. So sehr ich mich danach sehnte, das zu hören, gab mir das Kompliment doch jedes Mal das Gefühl, als habe mir jemand das Herz aus dem Leib geschnitten. Es war eine Erinnerung an ihre lange Abwesenheit in meinem Leben und an das Opfer, das sie gebracht hatte, damit ich leben konnte.
»Wieso muss ich meinen Vater begleiten, wenn er unseren Feind mit Gesprächen über Kapitulation unterhält?«
Ich stellte die Frage eher mir selbst als Nadia, doch sie teilte mir ihre Meinung trotzdem mit.
»Wenn Ihr wirklich über dieses Königreich herrschen wollt – mit oder ohne Ehemann – wird es von diesem Tag an unter der Vorherrschaft der Vampire geschehen. Ihr müsst lernen, mit wem Ihr es zu tun habt, und heute Abend findet Eure erste Lektion statt.«
Konnte das wirklich wahr sein? Von diesem Tage an sollte Lara dem Blutkönig Rechenschaft ablegen, einer Kreatur, die schon tausende meiner Art abgeschlachtet hatte? Es wirkte nicht real.
»Seid nur froh, Issi, dass der Blutkönig nicht nach einer Ehefrau gefragt hat.«
»Willst du dich freiwillig melden, Nadia?«
Sie sah mich finster an. »So sehr will nicht mal ich verheiratet werden.«
Auch wenn wir Witze machten, hatte sich doch den ganzen Tag über Grauen in meinem Herzen angesammelt. Heute würde die Welt sich verändern, und niemand von uns wusste, ob dies die bessere der zwei Optionen war. Ich musste einfach darauf hoffen, dass mein Vater die richtige Entscheidung getroffen hatte, als er sich der Herrschaft von König Adrian unterwarf – und ich hoffte darauf, dass Adrian, obwohl er ein Monster war, immer noch eine gewisse Menschlichkeit besaß.
Nadia folgte mir aus meinem Gemach und durch die schmalen Flure meines Flügels. Die Mauern der Burg bestanden ganz aus komplizierter Steinmetzarbeit, mit Backsteinen, die so gefügt waren, dass sie selbst ohne Ausschmückungen angenehm anzusehen waren. Doch trotz ihrer Schönheit und Kunstfertigkeit sickerte die Kälte hindurch und jagte mir Schauer über den Rücken. Noch schlimmer, meine Brustwarzen wurden hart und erinnerten mich an mein unstillbares Sehnen nach meinem Feind.
Unten an der Treppe blieb Nadia stehen.
»Zittert nicht unter dem Blick des Blutkönigs. Unterwerft Euch heute und erobert an einem anderen Tag.«
Nadias Worte waren meine Hoffnung, dass wir eine Waffe finden würden, die unseren Feind besiegen konnte. Sie ging und ließ mich allein, damit ich das Vorzimmer betreten konnte, wo mein Vater und ich auf die Ankunft des Blutkönigs warten würden, um dann in die große Halle zu treten. Meine Eingeweide verkrampften sich, als ich mich der Tür näherte, aber als ich klopfen wolle, hielt ich inne, als ich Commander Killians Stimme dahinter lauter werden hörte.
»Das ist eine Falle!«, sagte Killian.
»Wenn der König von Revekka beschließt, uns abzuschlachten, statt mit uns zu verhandeln, verrät das mehr über seine Contenance als über unsere«, antwortete mein Vater mit warmer und volltönender Stimme. Sie beruhigte mein Herz. Ich liebte meinen Vater sehr – er war alles, was ich seit dem Augenblick meiner Geburt hatte. Ich hatte nie erlebt, dass er eine impulsive Entscheidung traf, daher war mir klar, dass er auch jeden Aspekt dieser Kapitulation durchdacht hatte. Und das Wichtigste war, dass er stets im Sinn hatte, was unser Volk schützen würde.
»Denkt an Eure Tochter …«, versuchte es Killian.
»Vergesst nicht, wo Euer Platz ist, Commander!«
Die Stimme meines Vaters jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken, sodass ich mich kerzengerade aufrichtete. Aber ich war froh um seinen Zorn. Ich war gleichsam wütend über die Dreistigkeit des Commanders, anzunehmen, dass mein Vater nicht an mich gedacht hätte. Außerdem war dies größer als ich. Größer als ein Commander, dessen Ego unter dem Gedanken litt, sich einer größeren Macht unterwerfen zu müssen.
»Eben wegen Isolde habe ich dieser Waffenruhe zugestimmt. Ich will nicht, dass sie in einer Zukunft voller Gewalt leben muss.«
»Und doch wird sie sich einer Zukunft gegenübersehen, die noch weit unsicherer ist.«
Das nahm ich als mein Stichwort, um einzutreten. Entweder das, oder ich würde Commander Killian noch von Vaters Schwert an die Wand genagelt sehen. Und so sehr er mich auch ärgerte, es war jetzt nicht die Zeit, Blut zu vergießen, wenn Vampire an unserer Türschwelle standen.
Die Miene meines Vaters wurde zu einer entspannten Maske der Ruhe, als er mich sah, und ein trauriges Lächeln spielte um seine dünner werdenden Lippen. Er stand am Feuer, in einem schweren, pelzgesäumten Mantel, der seine schmächtige Statur größer wirken ließ. Mein Vater war nie ein besonders imposanter Mann gewesen, doch er hatte eine gewisse Präsenz, eine Aura, die Aufmerksamkeit gebot, und eine Stimme, die Dominanz vermittelte. Sein Haar war dunkel, wurde aber langsam grau. Das meiste Grau zeigte sich in seinem Bart, der am Kinn spitz zulief.
»Isolde«, grüßte mein Vater. »Mein Edelstein.«
»Vater«, grüßte ich, ging zu ihm und nahm seine ausgestreckte Hand. Er drückte mir einen Kuss auf die Wange.
»Du siehst wunderschön aus, wie immer.«
»Danke, Vater.« Ich lächelte, trotz dem, was uns bevorstand. Ich zog Trost aus der Tatsache, dass seine Kapitulation bedeutete, dass wir immer noch zusammen wären. Am Ende war das alles, was zählte.
»Commander Killian hat mir eben erzählt, dass du heute an der Grenze warst und dass du ohne ihn gegangen bist.«
Wenn Killian mich schon verraten wollte, dann sollte er zumindest die ganze Wahrheit sagen. Also auch den Teil erwähnen, wie ich ihn zurückgelassen hatte.
Wie geht es deinem Bauch?, wollte ich ihn schon fragen, aber ich schwieg. Dieser Vortrag sollte nicht noch länger dauern.
»Commander Killian hat mich ja eingeholt«, sagte ich und warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Issi«, sagte mein Vater mit einem warnenden Unterton in der Stimme. »Du kennst die Gefahr, die vor unserer Türschwelle lauert.«
»Ja, aber auch Commander Killian könnte nichts tun, falls ich von einem Vampir angegriffen würde. Schließlich braucht es eine Armee, um nur einen zu besiegen.«
Mein Vater seufzte. Er wusste, dass ich da nicht unrecht hatte.
»Es gibt noch andere Monster, Prinzessin«, argumentierte Killian angespannt.
Ich sah ihn an und begegnete seinem Blick, der dann auf meine Brüste fiel. Am liebsten wollte ich die Augen verdrehen, aber ich unterließ es.
»Im Töten von Monstern wurde ich ausgebildet. Noch einmal, ich weiß nicht, warum ich deinen Begleitschutz brauche.«
»Weil ich ihn angeordnet habe.« Die Stimme meines Vaters durchschnitt die Luft wie ein Peitschenhieb und lenkte meine Aufmerksamkeit auf ihn. »Das steht nicht zur Diskussion, Isolde. Ist das klar?«
»Kristallklar«, antwortete ich, angespannt und leicht errötet vor Frustration.
Mein Vater seufzte erneut, aber nun klang es mehr nach Erleichterung. Wahrscheinlich war er froh, dass ich nicht mehr widersprochen hatte. Ich tat es ihm zuliebe, denn ich wusste, wie beschwerlich diese Kapitulation für ihn gewesen war. Außerdem wusste ich, dass seine Sorge um mich von der Invasion des Blutkönigs herrührte, und ich wollte es ihm nicht noch schwerer machen. Andererseits würde ich noch sicherstellen, dass Killian meinen Zorn noch hören – und spüren würde.
Da klopfte es an die Tür, und Miron, der Herold, trat ein. Seine Uniform bestand aus einem dunkelblauen Wappenrock mit Goldrändern. Für gewöhnlich passte das gut zu seiner goldfarbenen Haut, doch heute sah er fahl aus, und als er sprach, glaubte ich zu wissen, warum – er hatte soeben den Blutkönig in Fleisch und Blut gesehen.
Er verneigte sich.
»Eure Majestät.« Seine Stimme zitterte, und er räusperte sich. »Der Blutkönig ist eingetroffen.«
Eine seltsame Anspannung erfüllte den kleinen Raum. Irgendwie fühlte sich dies hier falsch an. Der Blutkönig befand sich nicht nur direkt vor unseren Grenzen, sondern hatte sie auch überschritten. Vom heutigen Tage an würde er über uns herrschen.
Mein Vater sah mich lange an, drehte sich dann um und griff beim Gehen nach seinem Mantel, sodass er mit ihm herumschwang. Commander Killian streckte den Arm aus. Ich hätte ihm lieber ein Messer hindurchgestoßen, aber stattdessen akzeptierte ich seinen Arm.
»Warum trägst du das?«, fragte er und neigte den Kopf, sodass sein Atem über meine Wange streifte, als er sprach.
Ich hätte das mit dem Messer tun sollen, dachte ich.
Ich sah ihn nicht an, als ich antwortete: »Es steht dir nicht zu, meine Garderobe zu kommentieren, Commander.«
Seine Hand auf meiner spannte sich an.
»Du zeigst zu viel Haut. Versuchst du, den Blutkönig in Versuchung zu führen?«
»Vergiss nicht, wo dein Platz ist«, sagte ich, und meine Stimme klang ebenso eisig wie die meines Vaters.
»So habe ich es nicht gemeint – ich will dich nur beschützen.«
»Wovor? Vor hungrigen Blicken?«, fragte ich. Wir waren gerade durch die Türen des Vorzimmers geschritten und hatten die große Halle betreten, als ich mich zu ihm wandte und ihn herausforderte: »Deiner ist ebenso bedrohlich, Commander.«
Ich überquerte das Podest, auf dem der Thron meines Vaters stand, blieb zu seiner Linken stehen und ließ den Blick durch die große Halle schweifen. Es war ein beeindruckender Saal, reich geschmückt mit vergoldeten Spiegeln und aufwendigen Kronleuchtern. Über uns befand sich ein Baldachin aus blauer Seide, und im ganzen Saal hingen mit Goldlerchen geschmückte Banner in demselben Blau wie jenes, das von der Decke hing.
Es war still im Saal, obwohl er voller Menschen war – Wachen, Lords und Ladys waren von ihren Anwesen gekommen, um der Kapitulation beizuwohnen. Mein Vater hatte Wochen in eben diesem Saal verbracht, um sich ihre Sorgen anzuhören und ihre Argumente für und wider die Kapitulation abzuwägen. Zum Ende hin begann ich viele von ihnen zu verabscheuen, weil ihre Ängste nur darauf hinausliefen, dass sie ihre Ländereien, ihren Reichtum und ihren Status nicht unter dem Blutkönig verlieren wollten. Als würde das eine Rolle spielen, wo es bei dieser Frage doch gar nicht darum ging, ob man seinen Status behielt oder verlor. Es ging um Leben und Tod.
»Seine Majestät König Henri de Lara heißt König Adrian Aleksandr Vasiliev von Revekka willkommen.«
Diesmal klang Mirons Stimme sicher und kräftig. Ich hielt den Atem an und fixierte die Türen am anderen Ende der Halle. Die Menge, die bisher links und rechts eines Teppichläufers gestanden hatte, zog sich etwas weiter zurück, als die Wachen die Türen öffneten, um den Blutkönig zu offenbaren.
Ich schluckte ein Keuchen hinunter, eine berauschende Hitze breitete sich in meinem Körper aus, und ich wollte am liebsten aus meiner Haut fahren, als mein Blick auf ein bekanntes, hinreißend schönes Gesicht traf. Der Vampir, der mich auf der Lichtung gefunden hatte, der das Blut von meiner Haut geleckt und mich in eine Spirale des Begehrens gestürzt hatte, war Adrian, der Blutkönig.
Er hatte sich seit unserer Begegnung umgezogen und trug nun Blutrot anstelle von Schwarz. Goldringe schimmerten an seinem Mittel- und kleinen Finger, und auf seinem Kopf saß eine schwarze Zackenkrone. Sein Status war offensichtlich an der Art, wie er sich bewegte – königlich und selbstsicher –, und gleichzeitig war sein Gang der eines Raubtiers, und seine schwarzen Stiefel klackten über den Boden, als er einen tödlichen Schritt nach dem anderen auf meinen Vater zuging.
Ich hätte wissen sollen, dass er es ist, dachte ich und starrte ihn an. Doch mir war nicht der Gedanke gekommen, dass der König der Vampire Jagd auf eine Striege machen könnte. Waren sie nicht Monster, die von ihrer Art geboren waren?
Als er näher kam, glitt sein Blick von meinem Vater zu Killian und dann zu mir. Unsere Blicke trafen sich, und ich stieß langsam und bebend den Atem aus, als er mich von oben bis unten abschätzend musterte. Etwas an ihm riss einen Abgrund in meinem Bauch auf, und wieder war ich überwältigt von demselben leidenschaftlichen Hunger wie zuvor. Ich wollte von diesem Geschöpf verschlungen werden.
Meine Beine begannen zu zittern, und ich richtete den Blick auf meinen Vater, als er das Wort ergriff.
»König Adrian. Es ist ein düsteres Willkommen, das ich Euch ausspreche«, sagte er, und seine Stimme hallte durch den großen Saal.
»Aber gleichwohl ein Willkommen«, antwortete Adrian. Seine Stimme zog meine Aufmerksamkeit auf sich und hielt sie fest, und ich betrachtete seine Lippen, als er sprach – nicht mit der Stimme eines Monsters, sondern mit der eines Liebenden. »Und ich akzeptiere es.«
»Ihr und Eure Armee habt einen ziemlichen Ruf«, meinte mein Vater.
»Einen Ruf, der Euch über eine Kapitulation anstelle von Blutvergießen nachdenken ließ«, antwortete Adrian und neigte leicht den Kopf. »Das war klug.«
»Manche haben mich einen Feigling genannt«, sagte mein Vater. »Weil ich über Euer Angebot nachdachte.«
Die Anspannung in der großen Halle wuchs.
»Kümmert Euch, was andere denken, König Henri?«
»Mich kümmert mein Volk«, antwortete mein Vater. »Ich will es in Sicherheit wissen. Ist dies Euer Angebot, König Adrian? Dass Ihr die Sicherheit meines Volkes garantiert?«
Der Vampir betrachtete meinen Vater einen langen Moment und studierte ihn mit einer besonderen Eindringlichkeit, als versuche er zu entscheiden, ob mein Vater aufrichtig war.
»Wie viel Freiheit wollt Ihr für Euer Volk?«
Mein Vater antwortete nicht sofort. Endlich richtete ich den Blick auf ihn und sah, dass er sich vorbeugte.
»Verhandeln wir gerade, König Adrian?«
Der Vampir zuckte leicht mit den Schultern. »Ich habe ein Angebot.«
Vater wartete ab, und als Adrian nicht fortfuhr, fragte er nach: »Was ist das für ein Angebot?«
»Ich will Eure Tochter. Um sie zu heiraten natürlich«, fügte er dann hinzu, als sei ihm das eben erst eingefallen.
»Nein«, kam es augenblicklich von Commander Killian.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: