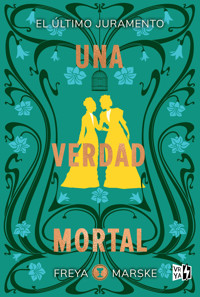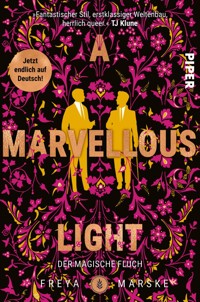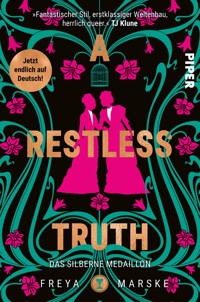
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Be Gay, Solve Crimes: Mord, Mysterien und Magie Maud ist entschlossen, ihrem Bruder Robin Blyth bei der Aufdeckung einer Verschwörung zu helfen. Dafür begleitet sie eine Verbündete Robins auf eine Reise mit einem Ozeandampfer. Womit sie nicht gerechnet hat: die alte Dame direkt am ersten Tag tot aufzufinden. Nun hat Maud nicht nur eine Leiche, sondern auch einen respektlosen Papagei und die gefährlich attraktive Schauspielerin Violet am Hals, die eine mysteriöse Rolle in all dem zu spielen scheint. Umgeben von nichts als der See und einem Schiff voller Verdächtiger muss Maud einen Mörder entlarven, ohne dabei selbst über Bord zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »A Restless Truth« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem australischen Englisch von Hannah Brosch und Julia Becker
© Freya Marske 2021
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »A Restless Truth«, Tordotcom, an Imprint of Pan Macmillan New York 2022
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Catherine Beck
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach einem Entwurf von Christine Foltzer
Coverabbildung: Will Staehle
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Epilog
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für alle, überall, die zu Hause festgesessen und von Abenteuern geträumt haben.
1
Elizabeth Navenby war für drei Dinge bekannt: Handarbeiten, mit den Toten reden und Übellaunigkeit selbst an den besten Tagen.
Dies war nicht der beste Tag. Seekrankheit hatte ihre Nerven strapaziert. Und gut gemeintem Geplapper über die Einrichtung der Kabine ausgesetzt zu sein und darüber, dass die Taschentücher schwenkende Menschenmenge, die den Kai in New York säumte, während die Lyric auslief, haargenau wie ein Taubenschwarm aussah – fand sie nicht auch? –, hatte kaum geholfen.
Daher hatte Elizabeth die gesprächige Miss Blyth, die für ein Mädchen ihres Alters wahrhaft abscheulich viel Energie besaß, das Schiff erkunden geschickt.
»Endlich«, sagte Elizabeth in die leere Kabine hinein. »Ich habe etwas Stille gebraucht.«
Es war nicht wirklich still. Doch das Brummen der Schiffsmotoren war nicht schwerer zu ignorieren als der übliche Lärm eines Nachmittags in Manhattan. Und die Einrichtung der Kabine war nun, da sie dieser ihre Aufmerksamkeit widmete, … hinreichend luxuriös. Wenn auch recht modern. Grüne Glaslampen hingen wie verschimmelte Schneeglöckchen von den Messingarmen des Kronleuchters. Die Stühle waren in einem helleren Grün gepolstert. Dorians Käfig stand auf einer niedrigen Kommode, deren Schubladen Tulpen-Intarsien mit langen, gewundenen Stängeln aufwiesen.
»Schätze, dir würde das zusagen, Flora«, sagte Elizabeth. »Du hast deine Innenräume immer gern mit Dingen von draußen dekoriert.«
Zu einer weiteren Welle der Übelkeit gesellte sich ein dumpfer Schmerz, als stecke ihr Knie in einem Maul mit stumpfen Zähnen. An Land waren Elizabeths Knie recht belastbar, doch sie waren es nicht gewohnt, ihren Körper gegen das Meer im Gleichgewicht halten zu müssen.
Mit unsicheren Schritten ging sie zum nächststehenden Stuhl und knüpfte einen Wärmezauber. Dessen gelbes Licht schimmerte schwach, spiegelte sich im glänzenden Holz der Kommode und verschwand dann, als sie die Magie auf ihr Bein anwandte. Hitze sickerte in ihr geplagtes altes Gelenk.
»Und ich will kein Wort darüber hören, dass ich einen Gehstock benutzen sollte«, sagte sie.
Einer der leitenden Stewards war einfältig lächelnd auf sie zugestürzt, sobald sie von der Landungsbrücke getreten waren. Sie hatte ihn im Verdacht gehabt, Miss Blyth schöne Augen machen zu wollen, doch stattdessen hatte er Elizabeth verdammt herablassend darüber belehrt, wie schwierig die Überfahrt für ältere und gebrechliche Personen sein konnte, dass die White Star Line sich ihrer kleinen Annehmlichkeiten für Passagiere der ersten Klasse rühmte, und ob sie zusätzlicher Kissen bedürfe – etwas Brühe oder Ingwertee, um ihren Magen zu beruhigen –, einen Gehstock …
An dieser Stelle hatte Elizabeth ihn einen aufdringlichen Wichtigtuer genannt und war an ihm vorbeigerauscht, wobei sie es Miss Blyth in ihrem Kielwasser überließ, um Entschuldigung zu bitten. Zwecklos. Männer würden niemals lernen, sich zu benehmen, wenn man sich bei ihnen entschuldigte.
»Gebrechlich!«, murmelte sie jetzt. »So eine Frechheit!«
»Frechheit«, wiederholte Dorian.
Das Wort hatte Elizabeth ihm beigebracht, nachdem sie diesen langweiligen alten Furz Hudson Renner dabei erwischt hatte, wie er an ihrem Pokertisch Holzringe trug. Es gab keine Entschuldigung dafür, an einem zivilisierten Glücksspielabend Illusionen zu verwenden, ganz gleich, wie viel von seinem Vermögen man in Investitionen verprasst hatte, von denen einem jeder hätte sagen können, dass sie töricht bis idiotisch waren.
Ächzend stand Elizabeth auf. Ihrem Knie ging es besser. Ihrem Magen nicht.
»Ich habe einfach nicht erwartet, an diesem Punkt in meinem Leben noch eine Reise zu unternehmen. Obwohl ich zugeben muss« – zähneknirschend – »letztes Mal, als ich den Atlantik überquert habe, erinnere ich mich, dass die Seekrankheit noch schlimmer war.«
Das letzte Mal war in die andere Richtung gewesen, als sie und ihr Mann England auf der Suche nach einem anderen Leben in Amerika hinter sich gelassen hatten. Jenes Schiff war viel kleiner gewesen. Kein bisschen wie dieser riesige Dampfer.
Elizabeth schnaubte bei der Erinnerung. »Der arme Ralph. Den ersten Tag verbrachte er damit, mir den Rücken zu reiben und Schüsseln zu leeren, ehe es mir wieder gut genug ging, dass ich mich daran erinnerte, eine von Seras magenberuhigenden Tonika eingepackt zu haben, und diese getrocknete Kamille aus deinem Garten …«
Das Maul der Trauer besaß keine stumpfen Zähne. Sie schnappten zu wie die Falle eines Wilderers.
Elizabeth stand da, die Hand um ihr silbernes Medaillon gekrampft, und unterdrückte mühsam den Drang, die Toten dafür zu verfluchen, dass sie gestorben waren. Sie wollte Magie auf diese grünen Lampen schleudern, nur um etwas zersplittern zu sehen. Die Erinnerung quälte sie, kehrte ihr Innerstes nach außen, knurrte ihr auf den Fersen. Flora hatte ihre Kamille in Magie eingesponnen, während diese gewachsen war. Sie hatte ihr Dinge zugeflüstert, bis selbst deren schwacher Duft am Rande eines Windhauchs ein schlaffördernder Zauber gewesen war, wie Finger auf den Augenlidern.
Langsam lockerte sich Elizabeths Griff um das Medaillon. Sie betrachtete ihre Handfläche, als könne sich das Sonnenblumenmuster in die Haut gedrückt haben.
Gewiss stand die Größe dieses Kummers in keinem Verhältnis. Sie und Flora hatten die spätere Hälfte ihres Lebens auf verschiedenen Kontinenten verbracht. Sie waren so alt, dass man damit rechnen musste, dass der Tod an die Tür klopfte.
Nichts davon machte einen Unterschied. Elizabeth hatte sich so leer gefühlt, tieftraurig und zugleich zornerfüllt, als Miss Blyth betreten mit der Neuigkeit von Floras Tod herausgeplatzt war.
Ihr Alter machte es nur schlimmer. Es war absurd. Elizabeth war zu alt, um durch die Gegend zu ziehen und einen Mord zu rächen. Natürlich würde sie es trotzdem tun. Selbst wenn ihre Knochen sich zu brüchig anfühlten, um die Wut zu enthalten, die sie antrieb.
»Ich weiß, ich weiß«, murmelte sie. »Solange noch Leben in mir ist, kann ich selbst entscheiden, was ich damit anfange.«
Elizabeth sprach nicht mit den Toten im Allgemeinen, sondern im Besonderen.
Vielmehr hatte sie schon lange, ehe die Bezeichnung zutraf, mit ihrer speziellen Toten gesprochen. Seit sie damals England verlassen hatte, redete sie mit Flora Sutton, als sei diese da – als verbinde das Medaillon sie nicht nur auf metaphorische Weise. Als hätten sie eine Möglichkeit gefunden, die Beschränkungen von Magie über gewaltige Entfernungen hinweg zu überwinden, und alle Worte, die sie sprach, würden wirklich über den Ozean zurück an Floras Ohren getragen.
In Anwesenheit von Miss Blyth hatte sie das unterlassen. Ihre Zunge war mit Worten vollgestopft, die sich unausgesprochen angesammelt hatten. Nun, da sie sie in Ruhe herauslassen konnte, rollten die gewichtigsten voran.
»Ich dachte, ich würde den genauen Moment kennen«, sagte Elizabeth Navenby zu ihrer abwesenden Toten. »Das dachte ich wirklich. Ich dachte – oh, dass ich mich mit flatterigem Herzen im Bett aufsetzen würde. Eine Schrecksekunde lang auf der Straße anhalten. Aber nein – man musste es mir ins Gesicht sagen, Monate, nachdem du schon unter der Erde lagst. Ich musste glotzen wie ein Fisch und erkennen, dass sogar nachdem – nachdem – niemand daran gedacht hatte, dass ich vielleicht ein verdammtes Telegramm zu schätzen gewusst hätte …«
Eine weitere Welle zorniger Trauer. Als spüre er es, stieß Dorian einen langen, krächzenden Seufzer aus.
Nein. Der verdammte Vogel war nicht empathisch, lediglich passiv-aggressiv, er bediente sich des Pathos zu krächzen als Hinweis darauf, dass er Aufmerksamkeit wollte. Oder Mittagessen.
Elizabeth nahm den Napf aus seinem Käfig und füllte ihn mit frischem Wasser. Hoffentlich würde Miss Blyth während ihrer Erkundung daran denken, die Stewards um Futter für ihn zu bitten. Unwahrscheinlich. Das Mädchen besaß ein Gehirn wie eine Elster. Sie hatten Glück, wenn sie zurück zur Kabine fand.
»Wenn du hier wärst, würdest du mir sagen, ich solle dem Mädchen gar nicht trauen.« Sie lachte schnaubend. »Du warst immer ein paranoides Geschöpf, Flora. Keine Sorge. Mir ist kein Wort über meinen Teil des Vertrags über die Lippen gekommen. Wir verraten nichts – nicht, solange es noch andere Möglichkeiten gibt. Das haben wir versprochen.«
Sie stellte den randvollen Napf wieder hinein. Dorian zwickte sie billigend in den Finger, als sie sich zurückzog.
Sie hatten es versprochen. Und dennoch war es allen Berichten nach die paranoide Flora selbst gewesen, die ihren Teil des Vertrags ihrem nichtmagischen Großneffen mitgegeben hatte – ihn mit einem Schweigezwang belegt und in den Tod geschickt und sich dann ihrerseits das Leben genommen hatte, um nichts auszuplaudern –, weil es keine andere Möglichkeit gegeben hatte.
Denn nach all den Jahrzehnten, die sie den Letzten Vertrag sicher verwahrt, seine drei Teile voneinander getrennt gehalten und es dadurch unmöglich gemacht hatten, daraus eine Waffe zu entwickeln, die allen Magiern in Großbritannien Macht entziehen würde, legte sich ein Netz über den Forsythia Club. Über die Frauen, die so arrogant und neugierig gewesen waren, diese Waffe überhaupt erst ans Licht zu zerren.
»Hybris«, sagte Elizabeth, als sei das Wort ein Zauber. Es schmeckte bitter auf ihren Lippen.
Sie schüttelte sich. Sinnlos, darüber nachzudenken. Widme dich lieber anderen Dingen.
Vielleicht etwas, um diesen Brechreiz zu unterdrücken. Sie hatte einen hilfreichen Zauber in ein Schultertuch für eine Nichte eingenäht, die unter einer schwierigen Schwangerschaft gelitten hatte – sie konnte sich gerade nicht an den genauen Zauber erinnern, doch ihn zusammenzusetzen würde eine Ablenkung darstellen.
Ihr Nähzeug befand sich in einer der Truhen. Als sie hinüberging, um es hervorzukramen, schlingerte das Schiff auf ganz besonders Übelkeit erregende Weise. Elizabeth biss die Zähne zusammen.
Nach einigen Augenblicken gestand sie sich ein, dass es sinnlos war, Krankheit mit Sturheit bezwingen zu wollen, und ging in das kleine Badezimmer der Kabine, um dort über einem Becken unangenehm zu würgen.
Jemand wählte diesen idyllischen Augenblick, um an die Kabinentür zu klopfen.
Elizabeth umfasste den Beckenrand und weigerte sich, zu reagieren. Sollten sie doch glauben, sie schliefe. Sie würde sich nicht von Stewards verhätscheln lassen. Eher würde sie ein Dornennest herbeizaubern und sich selbst hineinschleudern, als eine Brühe anzunehmen. Sie würde selbst hiermit fertigwerden.
Sobald ihr Magen damit aufhörte, ihren Brustkorb zu erklimmen.
Das Schloss klickte. Die Kabinentür öffnete sich mit einem sachten Knarren. Das war wohl Miss Blyth, die des Erkundens bereits müde war. Elizabeth betrachtete finster das Porzellan und wartete schicksalsergeben darauf, dass das muntere Geplapper wieder einsetzte.
Nichts.
Und in diesem Nichts: Schritte. Zu schwer, um von Miss Blyth zu stammen. Zu langsam. Vorsichtig.
Furcht strömte flutartig herein. Sie schaffte es, den Brechreiz teilweise zur Seite zu drängen. Elizabeth richtete sich auf. Dank der angelehnten Badezimmertür konnte man sie vom Hauptraum aus nicht sehen.
Der Betäubungszauber, den sie vorbereitete, stammte von Flora, aufgebaut mit einer Hand und festem Willen – sodass die andere Hand frei blieb, um einen schönen, schweren Kerzenhalter anzuheben, wie sie immer gescherzt hatten, für den Fall, dass der Zauber danebenging. Magie füllte ihre Hand wie Schnee.
Elizabeth holte tief Luft.
Mit der freien Hand schob sie die Badezimmertür auf. Das verdammte Ding knarrte und beraubte sie so der Chance auf einen Überraschungsangriff. Ein Fluch glitt ihr zwischen die Zähne. Sie erhaschte nur einen kurzen Blick – ein Mann, der abrupt den Kopf hob von dort, wo er sich über die Kommode gebeugt und ihre Habe begrapscht hatte –, ehe sie den Zauber auf ihn warf.
Das Knarren war Warnung genug gewesen. Er wich aus. Und … verflucht, jetzt knüpfte er selbst. Ein Magier.
Sie musste es noch einmal versuchen. Ein weiterer Zauber, schnell. Verdammt sollten sie sein, ihre steifen alten Hände. Sie hörte Flora sagen, indem sie endlich ihre Hälfte des Gesprächs aufnahm: Du verlässt dich noch zu sehr auf dieses Fadenspiel, Beth, das habe ich dir immer gesagt.
Flora hatte recht. Verflucht, Flora hatte immer recht. Doch Elizabeth war jetzt von ihren eigenen Schwächen gebunden. Der Zauber bildete sich nur mühsam zwischen ihren zitternden Fingern.
Es tut mir leid, Flora. Ich wollte sie so gern für dich umbringen.
Ihr Herz zitterte sogar noch mehr, sprang ihr halb aus der Brust vor lauter Furcht und heftigem Zorn. Sie fühlte sich benommen und erschüttert, sogar noch bevor den Händen des Mannes heiß riechende Magie entsprang und wie ein Blitz ihre Sinne umhüllte.
Es tut mir leid.
2
Sobald sie die Tür öffnete, wusste Maud, dass Mrs. Navenby tot war.
Sie war sich nicht sicher, woher genau sie es wusste. Sie war noch nie mit einer Leiche allein gewesen. Als Tochter eines Baronets war es unwahrscheinlich, öfter in eine solche Situation zu geraten.
Dennoch überkam sie die Gewissheit so schlagartig, als hätte jemand einen Eimer Wasser über ihr ausgeleert.
Mrs. Navenby lag auf dem Boden ausgestreckt. Ihre Augen standen offen, und der Ausdruck ihres wachsartigen, regungslosen Gesichts war nichts, was Maud länger als einige Sekunden betrachten wollte.
»Gütiger Himmel«, hörte Maud sich selbst quieken und sackte rückwärts gegen die Tür.
Absurderweise empfand sie Enttäuschung. Erstens hatte sie gequiekt. Zweitens hatte sie nicht die Gelegenheit ergriffen, Scheiße zu sagen. Zu keinem geringeren Anlass war sie mutig genug gewesen, und gewiss würde sie sich nie wieder in einer Situation befinden, in der Unflätigkeit so angemessen war.
»Waaaas?«, machte Dorian.
Maud kicherte los, als habe sie sauren Wein im Mund.
»Ganz meine Meinung«, sagte sie zu dem Papagei, und das brach den kalten Bann, der sie erstarrt an der Tür gehalten hatte.
Maud stürzte ins Zimmer. Prompt stolperte sie und fing sich auf einem Knie auf, als der Boden schwankte und sie sich mit dem Schuh in ihrem Rock verhedderte. Ihre Seemannsbeine waren noch nicht zurückgekehrt, und der Kapitän hatte ihnen gesagt, sie sollten mit einem kabbeligen Beginn der Reise rechnen.
Sie suchte nach einem Puls. Sie hatte keine Ahnung, ob sie an der richtigen Stelle fühlte. Es gab keine Spuren von Gewalteinwirkung auf der Haut und auch kein Blut – Maud schreckte zurück und tastete vorsichtig am Hinterkopf der Toten – im Haar. Vielleicht war sie an einem plötzlichen Hirnschlag gestorben. Vielleicht hatte ihr Herz aufgegeben.
Doch noch vor wenigen Stunden war Mrs. Navenby gesund und munter gewesen. Und Magie hinterließ nicht notwendigerweise Spuren, wenn sie tötete.
Bei einem Treffen der Suffragetten in London war Maud einmal einer Miss Harlow begegnet, die gerade Medizin an der Sorbonne studiert und anschauliche Geschichten von blutigen Verletzungen erzählt hatte und davon, wie man durch die Untersuchung von Leichen Anatomie lernte. Maud, sosehr sie sich auch danach sehnte, die Universität zu besuchen, glaubte nicht, dass sie genügend Mumm und einen so robusten Magen besaß, wie man es als Ärztin benötigte. Miss Harlow hatte einen menschlichen Schädel herumgereicht. Maud war mit dem Finger die Augenhöhlen entlanggefahren und hatte sich gefragt, welche Farbe diese Augen wohl zu Lebzeiten gehabt hatten. Dann war ihr flau geworden, und sie hatte den Schädel an Liza weitergegeben.
Und als ihre Eltern gestorben waren, war das bei einem Unfall in einem Automobil geschehen. Es hatte außer Frage gestanden, Maud darum zu bitten, die Leichen zu identifizieren. Das hatte Robin übernommen, während Maud sich in ihrem Zimmer eingeschlossen hatte, damit niemand sah, dass sie daran scheiterte zu weinen. Ihr Leben lang hatte Robin die unangenehmen Dinge übernommen, damit Maud sich darum nicht zu sorgen brauchte. Immer hatte er sie beschützt und sie niemals im Stich lassen.
Und jetzt ließ sie ihn im Stich bei der einen großen, lebenswichtigen Sache, von der sie ihm geschworen hatte, sie würde damit fertigwerden.
Mrs. Navenby war tot, was bedeutete, dass jemand auf diesem Schiff wusste, dass Mrs. Navenby ein möglicherweise gefährliches Objekt von ungeheurer Macht in ihrem Besitz hatte, und dass dieser Jemand es haben wollte.
Die alte Frau hatte sich geweigert, Maud zu verraten, welche ihrer Habseligkeiten ihren Teil des Zaubers darstellte, der als der Letzte Vertrag bekannt war. Das ist sicherer, hatte sie zu Maud gesagt, in dem bissigen Ton, der keine Diskussion duldete.
Und jetzt hatte Maud eine Leiche zu ihren Füßen und sechs ganze Tage der Atlantiküberquerung vor sich, saß auf einem Schiff mit mindestens einem Magier fest, der bereit war, zu töten, während Maud keine eigene Magie besaß und keine Ahnung hatte, was sie beschützte, und ob es nicht vielleicht sogar bereits entwendet worden war …
Maud rieb sich das Gesicht. Dämlich, dämlich.
Sie zwang sich dazu, sich zu fokussieren, während sie sich im Raum umsah. Sie hatte Mrs. Navenbys Gepäck teilweise ausgepackt, während sie noch im Hafen gelegen hatten. Der Raum sah nicht aus, als sei er durchsucht worden, doch es standen genügend Dinge halb geöffnet herum, dass es schwer festzustellen sein würde.
Maud inspizierte die Kommode mit roten Flecken im Gesicht und einem Panikpuls. Zahlreiche Kästchen voller Broschen und Ringe. Nippes. Was fehlte? Irgendetwas? Es gab ein Gesellschaftsspiel: Man starrte auf ein Tablett mit Gegenständen, ehe es weggenommen, umgeräumt und wieder vor einen hingestellt wurde. Manche Dinge waren hinzugefügt worden. Manche entfernt.
Robin war in diesem Spiel ganz hervorragend. Maud … nicht.
Doch sie hatte genau heute alles auf der Kommode angeordnet und eine gute Viertelstunde damit verbracht, die Dinge gemäß dem pingeligen Geschmack der alten Frau herzurichten, und …
Der Spiegel. Es hatte einen Handspiegel aus Silber mit einer dazugehörigen Haarbürste gegeben, beide schwer und kunstvoll verziert. Das war es, was fehlte.
Mauds Herzschlag beruhigte sich bei der Erkenntnis. Sie schaffte es, einige weitere fehlende Gegenstände zu identifizieren: einen versilberten Armreif, auf dem indische Elefanten abgebildet waren. Ein Silberfläschchen wie der Flachmann eines Gentlemans, das einen von Mrs. Navenbys Lieblingsdüften enthielt.
Silber. Silber. Der erste Teil des Vertrags, den Robin und sein Partner Edwin wiedergefunden hatten – und dann verloren –, waren drei Silberringe gewesen, die zu einer einzigen Silbermünze verschmolzen waren. Maud hatte nicht gefragt, ob Mrs. Navenbys Teil, die Tasse, aus demselben Material bestand.
Silber.
Ein einziger Blick bestätigte Mauds Ahnung, als sie den Kopf der Leiche angehoben hatte, um nach Blut zu tasten. Das Medaillon war fort. Schwer und oval mit einem Sonnenblumenmuster, und Maud hatte Mrs. Navenby noch nie gesehen, ohne dass sie es an einer Kette um ihren Hals trug. Sie hatte bemerkt, wie sehr die Frau daran hing, und bereits begonnen, die eine oder andere private Vermutung zu hegen.
Nun. Einige Gegenstände aus Silber fehlten, und reichlich wertvolle Schmuckstücke waren zurückgelassen worden, obwohl sie offen herumlagen.
Es war Mord, und zwar von jemandem, der genau wusste, wonach er suchte.
»Scheiße«, sagte Maud.
»Scheiße«, stimmte Dorian ihr zu.
***
»Sind Sie sicher, dass wir Ihnen nicht etwas Wasser holen können, Miss Cutler?«, fragte der Bootsmann. »Oder eine Tasse Tee?«
»Nein danke, Mr. Berry.« Maud lächelte schwach. »Aber es ist so liebenswürdig von Ihnen, mir das anzubieten.«
Der Sicherheitschef der Lyric besaß eine stämmige Figur und ein freundliches Gesicht mit einem rötlichen Schnurrbart, der sein Bestes tat, um dessen Oberlippe einzuhüllen, als hätte er ihn von einem größeren Verwandten geerbt und warte darauf, hineinzuwachsen. Er beäugte Maud mit der vertrauten Besorgnis eines Mannes, der sich nicht sicher war, ob das Mädchen vor ihm im Begriff stand, in Tränen auszubrechen.
Er beschloss, vorsichtshalber davon auszugehen, dass Maud zu aufgewühlt und zu feminin war, um zu wissen, was sie brauchte, und wies den nächsten Steward an, sofort eine Tasse Tee zu bringen.
Maud konzentrierte sich darauf, eine neutrale Miene beizubehalten. »Was geschieht jetzt mit ihr?«
»Ich nehme an, für ein junges Ding wie Sie mag es morbide klingen, Miss Cutler, doch die White Star Line ist auf tragische Vorfälle dieser Art gut vorbereitet. Dies ist nicht das erste Mal, dass einer unserer betagten Gäste während der Reise aus der Welt der Sterblichen verschieden und in eine bessere Welt übergegangen ist.« Mr. Berry berührte die Stelle zwischen seinen Schlüsselbeinen, an der unter seinem Hemd und der Uniformjacke ein Kreuz an einer Kette hängen mochte. »Wir werden dafür sorgen, dass sie respektvoll behandelt und an einem Ort verwahrt wird, wo sie – verzeihen Sie – nicht verdirbt.«
»Liebe Güte. Daran hatte ich nicht gedacht.« Maud biss sich auf die Zunge, um nicht zu fragen, ob sie einen zweiten Kühlraum hatten, der speziell für Leichen bestimmt war, und wenn nicht, ob den Passagieren der ersten Klasse bekannt war, dass das für deren Dessert verwendete Eis auch einem solchen Zweck diente. Mrs. Navenby hätte das amüsant gefunden.
»Kam ihr Ableben … sehr unerwartet?«
Grundsätzlich hasste Maud es zu lügen. Ihr war bewusst, dass dieses Prinzip für eine junge Frau, die derzeit unter falschem Namen reiste und vorhatte, eine verdeckte Ermittlung zu starten, in etwa so nützlich war wie ein Nadelkissen in einem Boxring.
Dennoch. Die Wahrheit war ein biegsames Schilfrohr. Man konnte es in allerlei Formen flechten, je nachdem, welche man brauchte.
Was Maud brauchte, war, dass niemand anderer eine Ermittlung wegen Raubmords in irgendeiner offiziellen Funktion durchführte. Das würde Besorgnis erregen, ihr in die Quere kommen und Mauds Feinde – die sich wahrscheinlich gerade zu ihrem Erfolg beglückwünschten – alarmieren.
Abgesehen davon las Maud Detektivgeschichten. Sie hatte die Leiche gefunden. Wenn auch nur der Hauch eines Verdachts bestand, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war, würde man sie verhören, und sie reiste schließlich unter falschem Namen. Wenn jemand anfing, ungelegene Dinge zu tun und ein Telegramm mit Erkundigungen zurück nach New York oder voraus nach London schickte, bestand das Risiko, dass besagter Jemand herausfand, dass Mrs. Navenbys entfernte und verarmte Verwandte Miss Maud Cutler frei erfunden war.
»Mrs. Navenby war … sich ihres Alters sehr bewusst. Nach Hause, nach England zurückzukehren war für sie eine Angelegenheit von einiger Dringlichkeit.«
Mr. Berry nickte. Er hatte aus diesen Sätzen eine Krankheit herausgehört, und das kam ihm gelegen.
»Nichtsdestotrotz.« Er tätschelte Maud die Schulter. »Ganz gleich, wie sehr man damit rechnet, es ist immer ein schwerer Schlag, diejenigen zu verlieren, die uns nahestehen.«
Mauds Augen füllten sich mit heißen Tränen. Es war eine Verschwendung. Eine verdammte dumme Verschwendung, und sie hatte ihren Bruder enttäuscht, und Mrs. Navenby sollte noch leben. Leute sollten nicht einfach andere Leute töten dürfen, nur weil sie ihnen im Weg standen, als wären sie nicht mehr als Dinge.
Der Bootsmann öffnete den Mund und wurde von einem empörten Krächzen unterbrochen. Der zurückkehrende Steward war im Vorbeigehen an Dorians Käfig gestoßen. Alle Anwesenden blickten auf. Dorian krächzte erneut, diesmal leiser, und begab sich auf den Boden des Käfigs, um seinen Kopf ungehalten in seinen Wassernapf zu senken.
»Mrs. Navenby hing sehr an ihrem Vogel«, sagte Maud entschuldigend.
»Ein reizendes Geschöpf, dessen bin ich mir sicher«, sagte Mr. Berry. »Nun möchten Sie sich vielleicht auf Ihr eigenes Zimmer zurückziehen und ruhen. Sicherlich können wir arrangieren – ah, da kommt ja der Tee. Rogers, benachrichtigen Sie die Küche, dass Miss Cutler in den nächsten Tagen ihre Mahlzeiten in ihrer Kabine einnehmen wird.«
»Nein«, sagte Maud rasch.
Augenbrauen hoben sich.
Um Zeit zu gewinnen, nahm Maud einen stärkenden Schluck Tee. Jetzt musste sie sich aus jeglicher Erwartung herauslavieren, dass sie in ihrem Zimmer blieb und dort dahinschmachtete, obwohl erforderlich war, dass sie draußen nach Antworten suchte. Und nach Mördern. Und nach dem gestohlenen Teil des Letzten Vertrags.
»Das ist … ich danke Ihnen für Ihre Rücksichtnahme, doch ich glaube, etwas glanzvolle, heitere Gesellschaft wird mir guttun. Mich ablenken. Ich muss gestehen, Mr. Berry, dass ich Mrs. Navenby nicht allzu gut kannte. Ich war erst seit Kurzem ihre Gesellschafterin, und sie war nicht die einfachste Dienstherrin.« Maud blickte hinunter auf die Untertasse, wo etwas Tee übergeschwappt war. Sie rief sich nicht Mrs. Navenbys Unbeherrschtheit und deren scharfe Zunge ins Gedächtnis, sondern eine Erinnerung an ihre eigene Mutter. Diese hatte anderen stets Honig um den Mund geschmiert, doch ihre falsche Freundlichkeit pflegte sich im Geist festzusetzen und einem den Atem zu nehmen.
Maud sagte: »Gewiss halten Sie mich für schrecklich herzlos.«
»Ganz und gar nicht«, sagte Mr. Berry sofort, und der in der Nähe verharrende Steward gab bekümmert einen Laut der Zustimmung von sich. Maud spähte unter ihren Wimpern hervor zu ihm hoch. Rogers war nicht viel älter als sie, mit einem hervorstehenden Hals und Pickeln am Kinn, und er errötete, als er ihrem Blick begegnete.
»Ich danke Ihnen beiden so sehr«, sagte sie sanft. »Ich werde mich tatsächlich hinlegen, bis es Abendessen gibt.«
Ihr angrenzender Raum war kleiner als die Hauptkabine, mit einem schmalen Bett, das an der Wand stand, und weniger vornehm eingerichtet. Viele der Kabinen besaßen solche Arrangements, für Familien mit Kindern oder jene, die mit persönlichen Bediensteten reisten. Mauds eigene Rolle einer Gesellschafterin stand eine Stufe über einer Dienstbotin, jedoch nicht wesentlich höher.
Sie schloss die Tür zwischen den Zimmern und lehnte sich dagegen. In der plötzlichen Stille, nun, da keine Blicke mehr auf ihr ruhten, fand das Schwanken des Schiffs sie erneut. Dieses Mal stemmte Maud die Schuhe in den Boden und stellte sich vor, sie sei ein Anker, der im Meeresgrund steckte, zwischen den Algen.
Sie hatte versagt. Sie war allein. Doch sie würde nicht in sechs Tagen zu ihrem Bruder zurückkehren und ihm diese Geschichte erzählen.
Maud ging zu ihrer Truhe und holte das Notizbuch heraus, das nahe dem Boden zwischen zwei Büchern steckte. Sie blätterte durch die Seiten, die mit kurzen Absätzen in Robins flüchtiger Handschrift beschrieben waren, mit gelegentlichen Anmerkungen in Edwins ordentlicherer Schrift. In der Mitte des Buchs gab es eine Porträtskizze einer Frau: eine lange Nase und ein entschlossenes Kinn, die Helligkeit ihres Haares war anhand der fehlenden Schraffur auf der oberen Hälfe der Seite offensichtlich.
Es brachte gewisse Vorteile, wenn der ältere Bruder Zukunftsvisionen hatte.
Maud ergriff ihr Verankert-Sein. Sie würde die Dinge richten. Sie würde den Magier – oder die Magier – auf diesem Schiff aufspüren und herausfinden, wer von ihnen Mrs. Navenby getötet hatte. Sie würde diese gestohlenen Gegenstände zurückbekommen, jeden davon. Sie würde jene Leute finden, die noch nicht wussten, dass sie ihre Verbündeten waren, und sie würde deren Unterstützung gewinnen.
Und dann würde sie triumphierend in Southampton von Bord gehen, und Robin wäre stolz auf sie, und es würde die erste wichtige und wertvolle Sache sein, die Maud Blyth, Tochter und Schwester eines Baronets, in ihrem gesamten kurzen, nutzlosen Leben vollbracht hatte.
3
Glanzvoll und heiter war die Gesellschaft in der Tat, als Maud an diesem Abend den Speisesaal der ersten Klasse zum Dinner betrat. In dem riesigen Raum wimmelte es von Menschen. An einer Längsseite des Saals befanden sich Türen, die hinaus auf eine Deckpromenade führten, und zu dieser dunklen Abendstunde waren die Fenster lediglich eine Leinwand, die die Helligkeit drinnen reflektierte. Elektrisches Licht und Tischkerzen leuchteten um die Wette und strahlten das Grün und Rot des Teppichs an sowie die dunklere grüne Polsterung der Stühle.
Einige Grüppchen prächtig gekleideter Leute verweilten noch im Stehen, wie Juwelenansammlungen an der Kehle einer Dame, doch die meisten saßen schon. Der Steward, der Maud die Tür geöffnet hatte, räusperte sich bedeutungsvoll.
Maud hatte früh da sein wollen, doch jetzt war sie spät dran. Sie war es nicht gewohnt, sich ohne die Hilfe einer Zofe zu einem förmlichen Dinner anzukleiden, und einige der Knöpfe an ihrem Abendkleid hatten sich als knifflig erwiesen. Das Kleid hatte den Kampf gegen Mauds kürzer werdenden Geduldsfaden gewonnen; bei dieser Auseinandersetzung war ein Knopf abgegangen. Sie hatte sich einen Schal übergeworfen, um es zu verbergen.
»Wo soll ich mich …?«
»Wo immer Sie möchten, Miss. Nur der Tisch des Kapitäns erfordert eine Einladung.« Der Steward deutete mit dem Kinn auf die andere Seite des Raums, wo die goldene Bordüre der Kapitänsmütze das Licht ebenso hell zurückwarf wie die glänzenden Gläser und die Silbergedecke.
Maud überflog das Gedränge. Es gab an mehreren Tischen vereinzelt leere Plätze. Sie hatte noch nie ein Dinner besucht, bei dem ihr Platz am Tisch nicht zuvor festgelegt worden war. Man hatte sie nie aufgefordert zu wählen. Jäh war sie von der Überzeugung erfüllt, dass das Stimmengewirr sofort zu eisigem Schweigen werden und alle Blicke sich auf sie richten würden, wenn sie die falsche Wahl traf.
Maud umklammerte mit einer behandschuhten Hand fest den Riemen ihrer Abendtasche und versuchte, die Hand dazu zu bringen, nicht zu zittern, während sie in einer gedankenlosen Reaktion auf ein Lachen, das zu laut war, um schicklich zu sein, den Kopf wandte.
An einem Tisch in der Nähe saß eine Frau mit schlicht frisiertem blonden Haar und in einem dunkelblauen Kleid, das ihre milchweißen Schultern umspielte, die noch von jenem Lachen bebten. Sie nahm gerade einen großen Schluck Champagner. Zu ihrer Rechten starrte eine Frau mittleren Alters sie mit einem Blick an, in dem sich Entsetzen und eine inständige Bitte mischten, die sich in einem so verkniffenen Mund manifestierte, dass die Frau damit Walnüsse hätte knacken können.
Zu ihrer Linken befand sich ein leerer Platz. Maud erkannte das in dem Augenblick, in dem die blonde Frau das Glas von ihren Lippen senkte und das kräftige, markante Profil offenbarte, das die mittleren Seiten von Robins Notizbuch zierte.
Mauds Herz hämmerte.
Im nächsten Moment war sie in Bewegung. Ohne Scham trat sie einem korpulenten Herrn mit einem Monokel auf den Fuß, der die blonde Frau eindeutig ebenfalls erspäht hatte und ebenso erpicht darauf war, den leeren Platz einzunehmen, und schob sich triumphierend an ihm vorbei, um eine Hand auf die Rückenlehne des Stuhls zu legen.
»Guten Abend.« Sie präsentierte dem gesamten Tisch ihre Grübchen. »Ist dieser Platz bereits vergeben, oder darf ich so frei sein?«
Sieben Augenpaare landeten auf ihr. Der Erste, der sprach, war einer der beiden Männer am Tisch, er saß direkt gegenüber von Mauds anvisiertem Stuhl. Er sah aus, als sei er etwa in Robins Alter, mit schweren Brauen und braunem Haar, das er mit Pomade zurückgestrichen hatte, aber hinter seinen Ohren begann es sich schon rebellisch zu kräuseln, und er hatte eine ernste, wenn auch nicht unfreundliche Miene.
»Unbedingt.« Sein Bariton klang, als stamme er aus dem Norden. »Gewiss würden wir uns über Ihre Gesellschaft freuen.«
Maud ließ sich auf dem Stuhl nieder, ehe irgendjemand diesem Willkommen widersprechen konnte. Als sei es ein Signal gewesen, tauchte ein weiterer Steward auf und goss ihr drei Zentimeter hoch Champagner ins Glas, und plötzlich gab es einen ganzen Schwarm dieser Männer, wie Elstern in einem Blumengarten, die anfingen, das Dinner zu servieren.
Maud schüttelte ihren Überwurf ab. Sie saß mit dem Rücken zu einem der Pfeiler, wahrscheinlich konnte sie es riskieren. Die Luft war stickig und warm, erfüllt von Essensduft und dem Parfum Hunderter Damen.
Nun. Es gab keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um eine Ermittlung zu starten.
Ehe sie auch nur die Handschuhe ausgezogen hatte, fand Maud durch höfliches Nachfragen heraus, dass der Gentleman aus dem Norden Mr. Chapman hieß, und der majestätische Haufen von Pelzen und Diamanten neben ihm war eine Mrs. Moretti. Links von Maud befanden sich zwei Frauen mit derselben Nase: ein Paar verheirateter Schwestern aus Boston, die jedes Jahr ihre Ehemänner zu Hause ließen und diese Reise unternahmen, um für die neueste Mode nach London und Paris zu fahren. Maud brachte raunend ihre Bewunderung für die üppige Perlenstickerei auf Mrs. Babcocks Kleid und die tropfenförmigen Smaragde an Mrs. Endicotts Ohren zum Ausdruck, und danach wandten die Schwestern sich wieder einander zu und ignorierten sie vollständig.
Maud atmete entschlossen ein, um die blonde Frau zu fragen, ob sie allein reiste, und war plötzlich überzeugt davon, dass der Champagner ihr Mut machen würde. Sie nahm rasch einen Schluck aus ihrem Glas.
Leider hatte sie vergessen, dass sie noch immer einatmete.
Es war vollkommen typisch dafür, wie dieser Tag verlief, dachte Maud verzweifelt röchelnd, dass ihre erste Begegnung mit der mysteriösen Blondine aus Robins Visionen – die ihr mit beinahe absoluter Gewissheit in diesem gefährlichen und magischen Abenteuer helfen sollte – darin bestand, dass besagte Frau ihr eine frische Serviette reichte, um die nun durchweichte Vorderseite ihres Kleids abzutupfen, während Maud mit einem Gestöber kalter Luftbläschen in der Nase hustete. Wahrscheinlich war sie auch krebsrot. Sie wurde immer rot, wenn sie hustete.
»Alles in Ordnung?« Amerikanisch, kühl und irritiert.
»Ja.« Ein pfeifender Atemzug, Prusten. Maud wollte sterben. »D-Danke. Meine Güte. Es tut mir so leid.«
»Nicht im Geringsten. Ich mag eine angemessen dramatische Eröffnungsnummer. Haben Sie schon einmal erwogen, auf die Bühne zu gehen? Ich könnte Sie mit allen am wenigsten angesehenen Produzenten in New York bekannt machen.«
»Violet«, heulte die Frau mit dem Walnussmund. »Bitte, meine Liebe.«
»Doch dafür müsste ich Ihren Namen kennen«, sagte die Frau auffordernd.
»Oh! Maud. Maud Cutler.«
»So. Violet Debenham.« Sie wandte sich auf ihrem Stuhl um und streckte Maud wie ein Mann die Hand hin. Noch mehr verlegene Hitze stieg Maud in die Wangen, als sie sich die Hände schüttelten. Miss Debenham hatte einen festen Griff. Ihre Augen waren von einem angenehmen Grau, und sie funkelten.
Miss Debenham reiste mit Mrs. Caroline Blackwood – blond, übertrieben sorgfältig gekleidet und mit einer Figur, die Maud unglücklicherweise an Hühnerknochen denken ließ – und dem Sohn dieser Dame, Clarence, einem jungen Mann, der dringend einer zusätzlichen Portion Kinn bedurfte. Clarence nickte Maud zu, während er den Blick irgendwo unterhalb ihres Ausschnitts angeheftet hatte.
»Und was führt Sie nach England, Miss Debenham?«, fragte Maud.
»Geld«, sagte Miss Debenham.
Ein gequälter Laut entfuhr Mrs. Blackwood. Miss Debenhams Augen funkelten sogar noch mehr, als sei die Aufmerksamkeit der Leute am Tisch ein Scheinwerfer, dessen Licht sie zu genießen wünschte.
»Eine entfernte Verwandte von uns ist kürzlich verstorben und hat mich als ihre Erbin eingesetzt. Eine reiche Verwandte. Daher nahmen meine liebe, besorgte Tante und mein Cousin es auf sich, nach New York zu kommen und mich davon zu erlösen, in jener Grube des Verfalls, der als die Bowery bekannt ist, auf der Bühne zu stehen, um mich stattdessen dem Schoß meiner mich liebenden Familie wiederzugeben. Ich stehe ewig in ihrer Schuld. Oder«, mit einem volltönenden Lachen, »das hoffen sie zumindest.«
Mrs. Blackwood zuckte leicht bei dem Wort Schuld.
»Erzähl doch keinen Unsinn, Violet«, sagte der junge Mr. Blackwood. »Ich musste dich quasi an den Haaren aus dem Laden herausschleifen.«
»Clarence«, fuhr seine Mutter ihn an.
»Clarence, du könntest nicht mal ein Kätzchen aus einem Sack zerren«, sagte Miss Debenham. »Es war das Geld, das mich hinausgeschleift hat.«
»Violet«, versicherte ihre Tante der Runde, »ist die Tochter eines englischen Gentlemans …«
»Er hat fünf von uns; ich bezweifle, dass er eine vermisst hat.«
»Die Tochter eines Gentlemans, in Wohlstand und Anstand aufgezogen …«
»Und jetzt auf der Bühne der Bowery?« Mrs. Moretti sah aus, als habe sie Blut geleckt. »Das muss ein ziemlicher Skandal gewesen sein.«
»Das war es in der Tat.«
»Violet«, stöhnte Mrs. Blackwood.
»Es geschah vor drei Jahren. Mir war nach einem Tapetenwechsel, und daher« – ein Zucken dieser wohlgeformten Schultern, wo eine schlichte Halskette aus filigranem Gold auf ihren Schlüsselbeinen drapiert lag – »packte ich meine Sachen und bestieg ein Schiff.«
»Ganz allein?«, fragte Maud, die das Gefühl hatte, einem energischen Badminton-Match zuzusehen.
»Allein.« Miss Debenham lächelte. Ihr Akzent war stärker, als Maud es bei jemandem erwartet hätte, die nur wenige Jahre von ihren heimischen Gestaden fort gewesen war. Es war auch nicht der vornehme Ton der Schwestern aus Boston, sondern ein rauchiges, schnodderiges Näseln, das Maud oft genug auf den Straßen von New York gehört hatte, jedoch nie in dessen Salons.
»Sie sind also Schauspielerin, Miss Debenham?« Begeisterte Fragen schwirrten Maud durch den Kopf. In den Kreisen ihrer Eltern konnte bei jeder Frau, die auf der Bühne arbeitete, davon ausgegangen werden, dass sie absolut lockere Sitten besaß.
Mit sechzehn hatte Maud einmal die Absicht geäußert, eine solche Frau zu werden. Ihre Mutter hatte ihr mit ihren grünen Augen – die so sehr Mauds eigenen glichen – einen hitzigen, giftigen Blick zugeworfen, und Maud hatte einen Moment lang die Aufmerksamkeit genossen. Dann hatte Lady Blyth eines ihrer milden, butterartigen Lachen hören lassen, wie sie sie in Gesellschaft von sich gab, und gesagt: »Auf was für seltsame Ideen du doch kommst, Maud.«
Und sich wieder von ihr abgewandt.
»Ich bin Darstellerin.« Miss Debenham funkelte sogar noch mehr. »Das meiste, was auf der Bühne einer Konzerthalle auftaucht, ist nicht direkt Shakespeare, wissen Sie.«
»Haben Sie jemals irgendwelche Magie gewirkt?«
Die Pause war nicht lang. Maud hielt ihre Miene unschuldig-hoffnungsvoll; die von Miss Debenham veränderte sich nicht, doch ihre Verwandten zuckten erneut unterdrückt zusammen. Aha. Gut.
»Magie?«, fragte Miss Debenham.
»Ist Bühnenzauberei denn in Amerika nicht beliebt? In London ist sie schwer in Mode. Der Bruder meiner Freundin hat uns einmal zu einem Auftritt von Mr. Houdini mitgenommen, und bevor dieser die Bühne betrat, gab es einen Mentalisten, der jedes Familienmitglied einer Frau namentlich aufzählte, und einen anderen Mann, der Gegenstände verschwinden ließ. Mr. Houdini ist Amerikaner, nicht wahr? Obwohl er vielleicht«, sinnierte Maud abgelenkt, »nach England gekommen ist, weil die Amerikaner sich weniger daraus machen, etwas in dieser Art zu sehen.«
Miss Debenhams ausdrucksvoller Mund zuckte. Maud bemerkte es mit dem Teil ihres Bewusstseins, der gerade nicht damit beschäftigt war, sich zu fragen, ob Mr. Houdini wohl tatsächlich ein Magier war. Bei der Vorstellung fühlte sie sich vage hinters Licht geführt.
»Mein Theater hat auch einige Bühnenzauberer engagiert, ja.« Miss Debenham hatte den Blick ihrer glitzernden grauen Augen nicht von Maud abgewandt.
»Leider gibt es auf dieser Welt einige Betrüger, die sich Mentalisten und Spiritisten nennen, um ein leichtgläubiges Publikum auszunehmen«, sagte Mrs. Moretti. »Das macht denjenigen von uns, die in dieser Hinsicht wahrhaft begabt sind, nur das Leben schwer.«
Der Scheinwerfer der allgemeinen Aufmerksamkeit schwenkte um. Maud knurrte der Magen, und ihr fiel auf, dass sie ihr Abendessen vernachlässigt hatte. Hastig nutzte sie die Gelegenheit, um einige große Mundvoll Möhren mit Kräutern und Fisch in weißer Sauce hinunterzubekommen.
»Wirklich, Ma’am?«, fragte Mr. Chapman.
»O ja.« Mrs. Moretti streichelte ihren Pelz. »In meinen eigenen Kreisen bin ich ein berühmtes Medium, und in New York konsultierten mich Damen wie … nun, ich werde deren Privatsphäre respektieren«, sagte sie eindrucksvoll, »doch seien Sie versichert, dass Sie staunen würden, würde ich sie nennen. Ich bin für die Geister der Verstorbenen äußerst empfänglich. Tatsächlich …« Sie beugte sich vor. Ein Zipfel des Pelzes sog sich mit Soße voll. »Haben Sie schon gehört, dass bereits eine Passagierin der Lyric gestorben ist? O ja. Kaum aus dem Hafen ausgelaufen. Ich hörte, wie einige Stewards sich darüber unterhielten, aber natürlich hatte ich schon den Verdacht, dass etwas Derartiges passiert war. Meine Sinne sind so darauf eingestimmt. Oh, haben Sie keine Angst, meine Liebe.« Sie wandte ihren beeindruckenden Blick Maud zu, die sich redlich bemühte, nicht zu lachen, während sie ein Stück Karotte im Mund hatte. »Es gibt keine negative oder übelwollende Energie an Bord. Ganz im Gegenteil. Ich bin überzeugt, die frommen Verstorbenen werden über uns wachen und während der gesamten Fahrt für unsere Sicherheit sorgen.«
»Wie beruhigend«, meinte Mrs. Endicott schwach.
Einen albernen Moment lang fragte sich Maud, ob sie vielleicht damit durchkommen könnte, so zu tun, als hätte der Todesfall keinen Bezug zu ihr. Doch früher oder später würde jemand am Tisch fragen, was Maud zurück nach England führte, und dann würde es verdächtig wirken, dass sie nichts gesagt hatte. Daher schluckte sie ihre Karotte hinunter und sagte: »Mrs. Navenby war diejenige, die gestorben ist. Die Frau, mit der ich reiste.«
Allgemeine Bestürzung und Gemurmel. Mrs. Moretti sah ungehalten aus, nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Maud achtete auf Reaktionen, während sie eine leicht erweiterte Version der Erklärung abgab, die sie auch dem Bootsmann gegeben hatte. Diese beinhaltete die erforderliche Unwahrheit, sie sei eine entfernte Verwandte von Mrs. Navenby und dem Ruf nach Amerika gefolgt, um der schnippischen alten Dame als Gesellschafterin zu dienen, weil sie in England keine Perspektiven und das Gefühl gehabt hatte, ihrem Bruder zur Last zu fallen.
»Meine Familie ist nicht mehr so begütert wie einst«, schloss sie, was den Vorteil hatte, dass es der Wahrheit entsprach.
»Und nun, da die alte Dame gestorben ist, nehme ich an, Sie hegen die Erwartung, dass sie Ihnen für Ihre Mühen etwas vermacht hat?« Mr. Blackwood lachte sie aus.
Maud, die schon von Experten verspottet worden war, verspürte nur einen schwachen Stich und streifte diesen ab wie eine Ameise bei einem Picknick.
Sie senkte den Blick auf ihren Teller. »Nein. Ich hege keine solche Erwartung.«
»Zumindest hatten Sie Gelegenheit, den Atlantik zu überqueren, und das gleich zweimal! Betrachten Sie es daher als Abenteuer«, sagte Miss Debenham. »Clarence, ich weiß, du kannst nicht anders, als so ein Ekel zu sein, aber wenn dich das nächste Mal der Drang überkommt, den Mund zu öffnen, könntest du etwas Brot hineinschieben.«
Mr. Blackwood öffnete tatsächlich den Mund. Dann zuckte er zusammen, warf seiner Mutter einen Blick zu und schloss ihn wieder.
»Ihr Kleid scheint von bemerkenswert feiner Machart zu sein, Miss Cutler«, sagte Mrs. Endicott.
»Danke«, sagte Maud. »Ich …«
»Ja, genau so eines habe ich für meine Tochter fertigen lassen.« Unbeeindruckt musterte sie Maud von oben bis unten. »Vor etlichen Jahren.«
Da Maud nun als arme Verwandte einsortiert worden war, schienen die meisten Leute am Tisch damit zufrieden, sie zu ignorieren. Sie brütete über diesem Problem, während sie eine Scheibe blutiges Roastbeef kaute, Miss Debenham nach mehr Champagner winkte und dann auf unerhörte Weise mit dem Kellner flirtete, zum steifen Unbehagen ihrer Verwandten. Es war gleich, was irgendjemand von Miss Maud Cutler hielt, die es gar nicht gab, nur dass Maud es benötigte, dass die Leute mit ihr redeten. Sie brauchte Informationen.
Während des Desserts hielt der Kapitän der Lyric eine kurze, förmliche Willkommensrede. Dieses Dinner am ersten Abend war eine besondere Geste, die im Preis für die Überfahrt in der ersten Klasse enthalten war. An den meisten anderen Abenden, wie auch beim Lunch, würde der Speisesaal als Restaurant fungieren. Der Kapitän erklärte, dass eine weitere offizielle Veranstaltung dieser Art am letzten Abend stattfinden würde, ehe sie in Southampton eintrafen, jedoch einem Ball ähnlicher, mit einem frühen Dinner und einer Verlosung, gefolgt von einer Orchesterdarbietung und Tanz.
Dann stellte der Kapitän die musikalische Unterhaltung des Abends vor: die gefeierte Mezzosopranistin Miss Elle Broadley, frisch aus einem Opernensemble in New York City, die engagiert worden sei, um während ihrer eigenen Übersiedlung nach England auf der Lyric aufzutreten, ehe sie in der Alten Welt nach weiterem Ruhm und Reichtum streben würde.
Miss Broadley war eine schwarze Frau, an deren Ohren ein atemberaubendes Paar Juwelen glitzerte. Sie trug ein rotes Kleid mit dunkleren Lagen aus Flor und Perlen. Ihre weißen Satinhandschuhe leuchteten gegen den dunklen Ton ihrer Haut. Ihre Haltung war tadellos, als sie mit einer Geste dem Begleiter am Konzertflügel in der Ecke signalisierte, dass sie bereit war.
Und während der nächsten Viertelstunde vergaß Maud, dass sie sich an Champagner verschluckt hatte, vergaß, dass Mrs. Navenby tot und der Teil des Vertrags verschwunden war, vergaß, dass irgendeine andere Magie als diese existierte. Die Stimme der Opernsängerin klang, als ob man mit der Hand zuerst in die falsche und dann in die richtige Richtung über ausgebreiteten Samt strich. Die Musik trug das Pochen von Sehnsucht und das Zerren unerträglichen Leids in sich, und etwas Heißeres und Dunkleres, das tief in Mauds Körper saß.
Als die Musik endete, verneigte Miss Broadley sich tief unter Applaus und begab sich gelassen aus dem Saal. Eine Dissonanz von Löffeln auf Tellern erfüllte ihre Abwesenheit.
»Sie haben die Musik genossen, Miss Cutler«, sagte Mr. Chapman.
Maud, die sich mühsam wieder aus den warmen Tiefen ihres Genusses hochkämpfte, nickte bloß.
»Sie ist hervorragend«, sagte Miss Debenham. »Ich wette, man zahlt ihr nur ein Drittel dessen, was sie wert ist.«
»Vielleicht könnte Miss Debenham etwas zum Unterhaltungsbudget des Schiffs beitragen, indem sie ihre Dienste einen Abend lang spendet«, sagte Mrs. Endicott.
»Eine fantastische Idee«, sagte Miss Debenham. »Es gibt eine Hosennummer, die ich letztes Jahr vorgeführt habe, die gut passen würde, auch wenn ich vermute, dass der Text … Tante Caroline, Clarence mag ja den Mund halten, wenn du ihn unter dem Tisch trittst, aber ich habe keine Angst vor ein paar Blutergüssen am Schienbein.«
Mr. Chapman äußerte hastig, dass er keine Schande darin sehe, mit harter Arbeit sein Geld zu verdienen, und dass der Reichtum seiner eigenen Familie von Baumwollfabriken stamme. Er war in Amerika gewesen, um mehr über den Stand der dortigen Baumwollindustrie zu erfahren und den Kauf einiger moderner Maschinen für die Fabriken seines Vaters in Erwägung zu ziehen.
»Es sind gewiss einige sehr neureiche Leute an Bord.« Mrs. Babcock entschied offenbar, dass sie nicht außen vor bleiben würde, wenn alle anderen am Tisch beabsichtigten, der Vulgarität dieses Gesprächsthemas zu frönen. »Haben Sie diesen rotgesichtigen Herrn am Kapitänstisch gesehen? Und die Frau neben ihm, die Rubine trägt, die eine Riesensumme wert sind? Das sind Mr. und Mrs. Frank Bernard. Er ist ein Industrieller. Sie haben zwei Töchter dabei – eindeutig in der Hoffnung, sie in England zu verheiraten. Stellen sich vor, sie könnten die Großeltern eines Duke oder Viscount werden, dessen bin ich mir sicher. England ist voller Landadelsfamilien, die auftreten, als wären sie gerade erst beim König zum Tee gewesen, aber keinen Penny besitzen.«
Maud stellte sich kurz Robins Gesicht vor, wenn sie sich mit einer Erbin anfreunden würde und diese mit nach Hause brächte, damit ihr Bruder sie heiratete. Die gesamte Runde war jetzt damit beschäftigt, so zu tun, als starre sie nicht in die Richtung der Kapitänstafel, während alle so intensiv hinüberstarrten, wie sie konnten.
»Sieht aus, als hätten sie einen guten Start hingelegt«, sagte Mrs. Moretti. »Jemand erzählte mir, dieser junge Rotschopf sei der Sohn eines Marquess. Und Mrs. Bernard lächelt diesen anderen Herrn so einfältig an, dass er ebenfalls von Rang sein muss.«
In Mauds Blickachse stand ein Pfeiler. Alles, was sie erkennen konnte, waren ein kleinerer Mann – rothaarig, ja – und ein größerer, dunkelhaariger.
»Donnerwetter, Mutter«, sagte Mr. Blackwood plötzlich. »Ist das nicht …«
Ein weiterer unsichtbarer Tritt wurde ausgeteilt. Aus irgendeinem Grund blickten nun beide Blackwoods zu Miss Debenham, als sei sie ein Pulverfass, das gefährlich dicht an eine Flamme gerollt war.
»Vi«, sagte Mr. Blackwood zu laut. »Erzähl uns doch noch mehr von …«
Doch Violet Debenham hatte die Augen aufgerissen.
»Oh, seht mal. Es ist der liebe Hawthorn.«
Maud umklammerte ihre Serviette. »Lord Hawthorn?«
»Sind Sie miteinander bekannt?«, fragte Mrs. Blackwood scharf. Die ganze Familie betrachtete Maud erneut mit demselben wachsamen Interesse wie zuvor, als sie Magie erwähnt hatte.
»Nicht persönlich. Ich glaube, ein Freund meines Bruders kennt ihn flüchtig.«
»Er und ich standen uns in der Tat einst sehr nahe«, sagte Miss Debenham. Maud fragte sich, ob Mrs. Blackwood ihre Schuhspitzen abnutzen würde.
»Violet, meine Liebe«, sagte die Frau durch die Zähne. »Ich glaube, Clarence fragte dich …«
Doch Miss Debenham drang mit ihrer Darbieterinnenstimme mühelos über die Unterbrechung hinweg. »Miss Cutler, meine Tante und mein Cousin wollen mich verzweifelt davon abhalten, Folgendes zu erwähnen: Ehe ich mich auf skandalöse Weise ruinierte, indem ich fortlief, um Vaudeville-Darstellerin in New York zu werden ist, hatte ich mich bereits auf wesentlich konventionellere Weise ruiniert.« Ein breites, löwenartiges Lächeln. »Mit Lord Hawthorns fähiger und gründlicher Unterstützung.«
Eine der Schwestern aus Boston verschluckte sich. Maud errötete ungläubig und stellte dann fest, dass ihr Blick gleichzeitig abzuschwenken versuchte, um Lord Hawthorn zu mustern, und bleiben wollte, wo er war, auf den zufriedenen Mund der Frau geheftet, die gerade diese explosive kleine Tatsache mit einem Tisch voller Fremder geteilt hatte.
»Ich denke noch immer zärtlich an ihn. Tatsächlich schaue ich vielleicht einmal nach, ob er irgendein Interesse daran hat, unsere Bekanntschaft zu erneuern. Es wäre nur höflich, solch einen alten Freund zu grüßen.«
»Violet!«
Das Mädchen schob ihren Stuhl zurück, nahm ihr Weinglas, als sei ihr das erst nachträglich eingefallen, und war unterwegs: eine große, schlanke Gestalt wie ein blauer Tintenstrich auf Papier, den goldenen Kopf hoch erhoben, als sie zum Kapitänstisch hinüberflirrte.
Die Blackwoods waren nun beide puterrot und wirkten aufs Peinlichste berührt. Die Boston-Schwestern hatten die Köpfe zusammengesteckt und tuschelten in entrüstetem Ton.
Maud wartete darauf, dass die Röte aus ihren Wangen wich. Noch nie war ihr jemand wie Violet Debenham begegnet. Wie erlangte man ein solches Selbstvertrauen und diese Fähigkeit, seine Verwandten nicht bloß mit Stöcken zu piken, sondern einen ganzen Armvoll Speere auf sie zu schleudern?
Warum hatte Maud niemals den Mut aufgebracht, sich zu ruinieren und in ein New Yorker Varieté durchzubrennen?
»Miss Cutler?« Mr. Chapman tat, was höflich war, und lenkte das Gespräch auf ein anderes Thema. Maud wich einigen Fragen über ihr Leben in England aus, indem sie vage über die Sehenswürdigkeiten plauderte, die ihr in New York gefallen hatten, doch ihre Aufmerksamkeit sprang immer wieder hinüber.
Lord Hawthorn. Also trafen Robins Visionen diesbezüglich vollkommen zu.
Maud entschuldigte sich und verließ den Speisesaal, noch ehe irgendjemand aus der Gruppe des Kapitäns vom Tisch aufgestanden war. Sie begab sich rasch in ihre eigene Kabine, wo sie einen Gegenstand aus ihrer Truhe holte und dann wieder hinausging. Sie versuchte, so zu schreiten, wie Miss Debenham es getan hatte: den Kopf hoch, mit einem Ziel. Als müsse sich jeder, der an ihr zweifelte, für einen Narren halten.
Und so machte die wahrheitsliebende Maud Blyth, die – wenn auch mit wenig Liebe – in Wohlstand und Anstand aufgezogen worden war, sich auf den Weg, um sich in der gefährlichen Abendstunde dreist in Lord Hawthorns Schlafzimmer zu lügen.
4
Der Steward, der Maud zu Lord Hawthorns Kabine begleitete, war leider nicht der junge und leicht zu beeindruckende Rogers. Stattdessen war es ein Mann namens Jamison mit kühlen Manieren, glattem Haar und ungewöhnlich großen Zähnen, der Mauds amerikanische Dollar bereitwillig einsteckte. Unterwegs taute er etwas auf, als Maud ihm atemlos Fragen über das Schiff stellte; auf die meisten davon kannte sie bereits die Antwort von ihrer Erkundung früher am Tag.
Manches davon erwies sich allerdings als nützlich: Sobald er das Geld in der Hand hatte, informierte Jamison sie über die Existenz eines Namensverzeichnisses, das in der Aufzughalle der ersten Klasse auslag und ihr in Zukunft die Umstände ersparen würde, die Zimmernummer einer Bekanntschaft zu erfragen.
»Gibt es für die zweite und dritte Klasse ähnliche Verzeichnisse?«, fragte Maud.
Eine vollständige Liste ihrer Verdächtigen und deren Kabinen wäre schon etwas. Wobei diese nicht das Personal des Schiffs umfassen würde, oder? Andrerseits, glaubte sie wirklich, dass ein mörderischer Magier sich die Mühe machen würde, eine Anstellung an Deck oder als Steward zu finden?
Nun – sie tat so, als stünde sie gewissermaßen in Diensten. Kein Grund auszuschließen, dass jemand anderes das ebenfalls tat. Und Bedienstete könnten besseren Zutritt haben …
»Eine vollständige Passagierliste?«, unterbrach Jamison Mauds Gedanken. »Nicht öffentlich. Ich nehme an, der Erste Offizier hat eine. Entschuldigen Sie, aber warum würden Sie so etwas sehen wollen?«
Maud ließ diesen Befragungsansatz hastig fallen und ging dazu über, Interesse an Jamisons Laufbahn bei der White Star Line zu zeigen. Allein in seiner Gesellschaft überkam sie ein neuer Schauder der Nervosität, nun da sie die gesamte Crew der Lyric in die Kategorie »möglicher Mörder« geschoben hatte.
»Sie sind ja fast so schlimm wie dieser Journalist, den wir an Bord haben, Miss«, sagte Jamison nach einer Weile. »Hier sind wir. Sie sagten, Seine Lordschaft erwarte Sie?«
»Er ist ein Freund der Familie.« Maud setzte ihr Grübchen ein. »Ich hatte gehofft, ihn zu überraschen.«
Auf ein Klopfen kam keine Antwort, und Jamison zuckte entschuldigend mit den Achseln. »Er ist wohl noch nicht vom Abendessen zurück. Zu dieser Stunde gehen die Herren häufig in den Rauchsalon.«
Maud hatte darauf gezählt, dass Lord Hawthorn diese Art von Gentleman sein könnte. »Dann werde ich in mehr Bequemlichkeit auf Seine Lordschaft warten, als dieser Korridor momentan bietet. Öffnen Sie bitte die Tür.«
Ein Blinzeln. »Das kann ich nicht.«
»Unsinn«, sagte Maud schnell. »Natürlich können Sie.«
Er runzelte die Stirn. »Wenn Sie eine Freundin der Familie sind, warum …«
»Oje.« Maud hielt sich eine Hand vor den Mund und lachte still. »Schauen Sie, möglicherweise war ich nicht ganz ehrlich darüber, weshalb ich hier bin. Wissen Sie, jemand hat mir beim Abendessen eine höchst faszinierende Geschichte über Lord Hawthorn erzählt. Und ich möchte sehr gern herausfinden, ob diese Geschichte wahr ist.« Mauds Zunge wollte weiterplappern, gelöst von Nervosität, doch sie zwang sich dazu, sich auf die Zunge zu beißen und ein, wie sie hoffte, anzügliches Lächeln aufzusetzen.
Sie wäre die Letzte gewesen, die sich selbst als glaubwürdige Kokette bezeichnet hätte. Doch Jamison hob abrupt die Augenbrauen, und einen Moment lang sah er beinahe väterlich aus, als verlange er gleich, dass sie eine Verwandte oder Anstandsdame präsentierte, die sie von diesem möglichen Sündenpfuhl fortbringen konnte.
Maud dachte daran, was Robin gesagt hätte, hätte er sie in dieser Lage gesehen, und schluckte ein hysterisches Glucksen hinunter.
»Glauben Sie, Seine Lordschaft wird etwas dagegen haben, mich in seinem Zimmer vorzufinden, unter diesen Umständen?«, fügte sie hinzu. »Treffender gefragt, glauben Sie, ich könnte ihm in irgendeiner Hinsicht schaden?«
Jamisons Miene räumte ein, dass er das für zweifelhaft hielt, doch er schüttelte den Kopf.
»Das ist mehr, als meine Stelle wert ist, jemanden in die Salonsuiten zu lassen, der dort nicht sein sollte.«
Maud wollte nicht hier stehen und diskutieren, während die anderen Bewohner dieses Flurs nach und nach vom Abendessen zurückkamen. Sie nahm ihre Ohrringe ab. Jede lange, tränenförmige Perle hing an einer Ansammlung kleinerer, in Gold gefasster Perlen. Sie gehörten Mrs. Navenby, und Maud war sich sicher, die alte Dame hätte gutgeheißen, wofür sie nun verwendet wurden.
»Bitte«, sagte sie und hielt sie ihm hin.
Jamisons Blick heftete sich auf den Schimmer von Gold und Creme.
»Wenn Seine Lordschaft etwas dagegen einzuwenden hat«, sagte Maud, »und bei den Sicherheitsleuten des Schiffs eine Beschwerde einlegt, werde ich behaupten, jemand anders hätte mir geholfen. Gibt es jemanden, den Sie namentlich nennen möchten? Vielleicht irgendeinen unangenehmen Tyrannen vom Personal des Schiffs?«
Jetzt trat ein anderer Ausdruck auf Jamisons Gesicht. »Galloway. Der Oberkellner. Er ist faul und ein Trinker, und er gibt immer den Neuen die Schuld, wenn seine schludrige Arbeit auffliegt.« Er wirkte überrascht, das gesagt zu haben, und beäugte Maud misstrauisch, als hätte sie einen Zaubertrick vollführt.
Natürlich hatte sie das nicht. Es gab immer einen Tyrannen.
»Da haben Sie sie.« Sie ruckelte die Ohrringe auf ihrer Handfläche. »Und wenn Sie bereit sind, das halbe Honorar herzugeben, um die Befriedigung zu erleben, dass Mr. Galloway entlassen wird, können Sie immer eine der Perlen in seine Sachen schmuggeln, und das wird ein noch stärkerer Beweis sein, dass er sie von mir angenommen hat.«
Jamison öffnete den Mund, dann schloss er ihn wieder. »Und was wenn, wie Sie sagen, Seine Lordschaft keine Einwände hat?«
»Dann tun Sie so, als hätte ein anderer Passagier die Perlen vermisst«, sagte Maud ungeduldig – musste sie wirklich alles selbst machen? »Oder, wenn Ihnen das lieber wäre, könnten Sie sie wieder zurückstehlen. So, denken Sie, wir können das hier etwas beschleunigen?«
Jamison ließ sie in die Kabine. Maud schenkte ihm ihr anerkennendstes Lächeln, als sich die Tür hinter ihr schloss.
Lord Hawthorns Salonsuite hatte ein großes Wohnzimmer mit einem offenen Flur zu dem kleineren Raum, in dem das Bett stand, sowie einer anderen Tür, die wahrscheinlich ins Bad führte, und – Maud schlenderte entzückt hinüber – das runde Bullauge saß in einer Tür, die zu einem privaten Stück Deck hinausführte, das von Glas umschlossen war wie eine hübsche kleine Terrasse. Das Wohnzimmer enthielt eine angemessen luxuriöse Sofagarnitur, eine Chaiselongue und einen Sessel, die sich um ein Tischchen gruppierten, sowie einen Schreibtisch, der neben einem Büfett mit herrlichen Intarsien stand, und einen höheren Tisch mit zwei zierlichen, schmallehnigen Stühlen. In der Mitte dieses Tisches stand eine Messingvase, deren Henkel die Gestalt von tauchenden Frauen besaßen, die die Arme ausstreckten.
Alles in allem war es wesentlich prachtvoller als die Kabine, die man Mrs. Navenby und Maud zur Verfügung gestellt hatte. Mit Luxus war zu rechnen gewesen: Schließlich handelte es sich bei dem Mann um den einzigen Sohn des Earl of Cheetham, und zusätzlich trug er noch einen eigenen Ehrentitel. Er hatte eine tote Schwester, eine angespannte Beziehung zu seinen Eltern und eine noch angespanntere zu der Gesellschaft von Magiern, in der er groß geworden war. Und er hatte seine gesamte eigene Magie verloren, soweit man wusste.
Dies waren die schlichten Tatsachen aus der Unterrichtung über den Baron Hawthorn, die Edwin Courcey Maud vor deren Abreise aus London mitgegeben hatte. Die gröberen Tatsachen beliefen sich im Wesentlichen darauf: Lord Hawthorn war nach Edwins fester Überzeugung ein arroganter, beleidigender, selbstsüchtiger Bastard.
Robin, der dem Mann nur einmal begegnet war, hatte dieser Einschätzung zugestimmt.
»Wobei er zumindest«, hatte er ergänzt, »die Art von Bastard ist, die es offen zeigt.«
Die Blyth-Geschwister hatten einen Blick gewechselt, der absolutes Verständnis ausgedrückt hatte. Ehrliche Ablehnung war Heuchlern und Lügnern jederzeit vorzuziehen.
Dank seiner Visionen war Robin sich sicher gewesen, dass Maud Lord Hawthorn auf einer ihrer Überfahrten begegnen würde. Am wahrscheinlichsten auf der Rückreise, da Hawthorn seit letztem Herbst in Amerika geweilt hatte. Was Edwin anging, so hatte dieser eingeräumt, dass man bei Hawthorn zumindest darauf vertrauen konnte, nicht auf der Seite der mörderischen Verbrecher zu stehen.
»Wende dich an ihn, falls du in Schwierigkeiten steckst«, hatte Robin Maud aufgetragen. »Er mag keine Magie besitzen, aber das weiß er, und er hat mehr als genug gewöhnliche Macht.«
»Es klingt, als würde er mir wahrscheinlich ins Gesicht lachen und mich fortschicken.«
»Wahrscheinlich«, pflichtete Edwin ihr bei.
»Maudie«, sagte Robin mit einem Grinsen für seine Schwester, »kann bemerkenswert hartnäckig sein, wenn ihr danach ist.«
Maud fuhr mit den Fingern über das glänzende helle Holz einer Stuhllehne. Ja. Das konnte sie. Nun, da sie allein und im Stillen war, ebbte die sprudelnde Improvisationsenergie, die sie durch das Gespräch mit Jamison getragen hatte, langsam ab.
Stimmen ertönten von der anderen Seite der Tür, und das Klicken eines Schlüssels im Schloss war zu hören. Maud holte tief Luft, bereitete sich vor und erstarrte. Stimmen. Plural.
Sie hatte geplant, mit Lord Hawthorn ein Gespräch unter vier Augen zu führen und sich zu weigern zu gehen, bis er sich bereit erklärte, ihr dabei zu helfen, den Mord an Mrs. Navenby aufzuklären. Sie hatte nicht geplant, dass dabei irgendjemand anderes zugegen war.
Es gab in diesem Zimmer keine großen, Maud-freundlichen Kleiderschränke und auch keine geeignete bis zum Boden reichende Tischdecke. Der schnellste Fluchtweg führte durch den Flur und ins Schlafzimmer. Sie nahm ihn just, als die Kabinentür sich zu öffnen begann.
»Beeindruckend«, sagte die Stimme, die nicht Hawthorn gehörte, weiblich und abrupt deutlich zu hören. »Ist hier auch noch jemand inbegriffen, der Ihnen mit Palmwedeln Luft zufächelt?«
Maud biss sich fest auf die Lippe, lehnte sich gegen das winzige Stück freie Wand zwischen dem Türrahmen und dem kastenförmigen Bettgestell und bebte vor Lachen. Die manische Energie war zurück, als hätte sie Metall berührt, nachdem sie über Wolle gelaufen war.
Es war Miss Debenham. Natürlich.
Als Lord Hawthorn sprach, tat er das mit tiefer Stimme, die klang, als wäre er in seinem ganzen Leben noch nie von irgendetwas beeindruckt gewesen. Man dachte sich dazu sofort breite Schultern und ein leicht spöttisches Lächeln.
»Behalten Sie ihn, wenn nötig«, sagte er, »aber gibt es irgendeinen Grund, aus dem Sie auf diesem schauderhaften Akzent bestehen, Violet? Oder genießen Sie es lediglich, meine Ohren zu quälen?«
Violet Debenham lachte. Als sie wieder sprach, klang ihre Stimme vollkommen anders. Jetzt hörte sie sich an wie die englische Lady, als die ihre Tante sie verzweifelt beschrieben hatte, auch wenn ihre Vokale amerikanisch glatt gebügelt worden waren.
»Sie sind nicht derjenige, den ich damit quälen wollte.«
»Erfreut, das zu hören. Ich nehme einen Drink.«