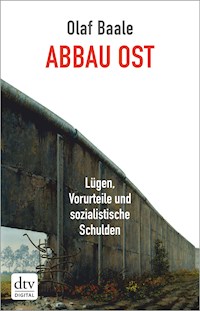
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine kurze Geschichte vom Ende der DDR Wölfe in Ostdeutschland Nach dem Fall der Mauer, der Entindustrialisierung des Ostens und dem nur in Teilen geglückten Neuanfang folgt nun die dritte Phase der deutschen Einigung: die Schadensbegrenzung. Das Beitrittsgebiet kann sich - von ein paar Ausnahmen abgesehen - nicht zur Wachstumsregion entwickeln. Soll man gleich den ehemaligen DDR-Bürgern den Umzug ins alte Bundesgebiet zu bezahlen und das Territorium der früheren DDR der Natur zu überlassen? Wie konnte es so weit kommen und vor allem, wie soll es jetzt weitergehen? Ein Buch voller Wut, Kraft und Hoffnung. Stand 4 Wochen auf der Taschenbuch-Bestsellerliste Sachbuch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Olaf Baale
Abbau Ost
Lügen, Vorurteile und sozialistische Schulden
Deutscher Taschenbuch Verlag
OriginalausgabeDeutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München© 2008 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MüncheneBook ISBN 978-3-423-40059-6 (epub)
www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Zwanzig Jahre danach. Ein Prolog in fünf Kapiteln
Mangel und Überfluss
Ehemalige DDR-Bürger
Mars Attacks!
Sozialisationstheorien
Letzte Nachricht von einem verlorenen Volk
Teil eins. Herrenloses Eigentum
Wendebestandsaufnahme
Geheime Verschlusssache b5 – 1158/89
Die postindustrielle Konsumgesellschaft
»Schicksalsschwere Stunden«
Westgeld
Das solidarische Opfer
Der Wert des Geldes
Neuanfang mit alten Schulden
Herr Schmidt aus Bernkastel-Kues
Der Präzedenzfall
Insichverbindlichkeiten einer geschlossenen Staatsverwaltungswirtschaft
Rangrücktrittserklärung auf Besserungsschein
Der Running Gag
Rückgabe vor Entschädigung
Wie sie stehen und liegen
Investitionen in die Vergangenheit
Der Küstenwald
Die Wahrung des Volksvermögens
Ein Vorgriff auf künftige Privatisierungserlöse
Anteilsscheine
Die Partei hat immer recht
Die Stille nach dem Schuss
Das geblümte Sofa
Die Ermessensfrage
Warten auf den Investor
Schulnoten für die ostdeutsche Wirtschaft
Ablasshandel in Wittenberg
Die kritische Teilungsmasse
Zero Reset
Die Braut möge sich schmücken
Parteienbündnis gegen die Wahrheit
Die abschließende Erfüllung der verbliebenen Aufgaben
Abschluss mit offenem Endzeitpunkt
Ein Rückblick auf dreizehn erfolgreiche Jahre
Richard Schröder verschrottet sein Volksvermögen
Altenheim und Tiefgarage
Die Treuhand als Winkelried
Clusterförderung
Mit leichtem Gepäck
Kulturfaktor Frau
Transferleistungen
Drei Engel für Deutschland
Die ehemalige DDR
Die ostdeutsche Tragödie
Teil zwei. Der große Verwaltungsakt
Wilde Kreaturen
Große Erwartungen
Die Entdeckung der Bürokratie
Hochsinnige Bürokraten
Aschersleben
Aufbauhilfe
Das Netzwerk
Der Letzte zahlt die Zeche
Fünf neue Nehmerländer
Das Schlimmste kommt noch
Die neue politische Klasse
Lernpatenschaften
Kämpfen um jedes Mitglied
Die späte Vereinigung
Endlich Demokratie!
Was bedeutet eigentlich Demokratie?
Leben wir in einer Demokratie?
Der breite linke und der schmale rechte Rand
Das Sozio-oekonomische Panel
Die verlorene Generation
Der kleine Mann
Frauen lieben Machos
Anspruch und Wirklichkeit
Stiftung Vereinigungsunrecht
Teil drei. Eine kurze Geschichte vom Ende der DDR
Die Häber-Protokolle
Forschung für den Tag X
Interzonenhandel
Unser Mann in Seoul
Das Züricher Modell
Der Vogel Strauß
Wandel durch Annäherung
Der talentierte Michail Sergejewitsch Gorbatschow
Waffenbrüder
Ökonomische Betrachtungen zu Mauer und Stacheldraht
Staat und Revolution
Die Opposition
Das erste Gebot
Der Berufsoppositionelle
Der Herbst des Patriarchen
UnbeKrenzte Demokratie
Die Asche unseres Parteivorsitzenden
Bewegte Bilder
Eine Meldung und ihre Geschichte
Der omnipotente Dr. Kohl
Kleines Büfett bei Helmut und Hannelore
Der kohlsche Umtauschkurs
Die letzten Volkskammerwahlen
Die wahnsinnig gewordenen Deutschen
Meckel hat nicht verstanden
Das Laienspielhaus
Vertrag ohne Partner
Günther Krause für die Deutsche Demokratische Republik
Kleine Lügen unter Feinden
Deutsche Irrtümer
Personenregister
Dieses Buch ist den ehemaligen Bürgern der DDR gewidmet.
ZWANZIG JAHRE DANACH
Ein Prolog in fünf Kapiteln
Mangel und Überfluss
Hans-Werner Sinn ist der Direktor des in München ansässigen ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, eines von bundesweit sechs führenden, ganz ähnlich strukturierten Forschungseinrichtungen. Sein Thema sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Das ifo-Institut trägt Wirtschaftsdaten zusammen und zeigt Entwicklungen auf, wobei es in erster Linie dem Direktor vorbehalten bleibt, die vielen Details analytischer Arbeit zusammenzufügen und daraus Änderungsvorschläge abzuleiten, die dann im günstigsten Fall von den politischen Entscheidungsträgern aufgegriffen und umgesetzt werden. Deutschland hat derzeit ungeheuerlichen Änderungsbedarf, im Grunde wissen die Verantwortlichen gar nicht, wo sie zuerst anfangen sollen. All jene, die sich noch gestern am Erfolgsmodell Deutschland wärmten, haben kalte Füße bekommen. Einige der Probleme sind so grundsätzlicher Natur, dass die Politiker davor kapitulieren. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland frustrieren zahllose Unternehmer, erschweren oder verhindern Unternehmensgründungen und zwingen Jahr für Jahr viele Tausende zur Aufgabe ihres Geschäfts. Selbst in Zeiten des konjunkturellen Aufschwungs profitieren viele Unternehmen nicht so, wie dies die weltwirtschaftliche Lage erwarten ließe. Der deutsche Fiskus bürdet Unternehmen und Arbeitnehmern immer größere Lasten auf, die Einkommensentwicklung hält mit anderen Industrienationen nicht mehr Schritt. Und am Ende eines weltweiten Nachfrageschubs gibt es ein noch böseres Erwachen.
Früher war das einmal anders. Wer das Wirtschaftswunder erlebt hat oder es aus den Erzählungen der Eltern kennt, dem fällt ein Bruch auf, der irgendwie zeitlich mit der deutschen Einigung zusammenfällt. Tatsächlich scheint im wiedervereinigten Deutschland kaum noch etwas so zu sein, wie es in der alten Bundesrepublik einmal war. Hans-Werner Sinn nutzte das zehnjährige Einigungsjubiläum zu einer prinzipiellen Analyse und sicherte sich, was die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem früheren Territorium der DDR betraf, die Meinungsführerschaft. Im Oktober 2000 veröffentlichte der Institutsdirektor seinen »Kommentar zur Lage der neuen Länder«, der die Beziehungen zwischen beiden Teilen Deutschlands und die öffentliche Wahrnehmung des Beitrittsgebiets nachhaltig verändern sollte. Anfangs erschien die Arbeit nur in englischer Sprache, eine an das westliche Europa gerichtete Rechtfertigung für die in Deutschland verloren gegangene Wirtschaftsdynamik. Erst nachdem der Erklärungsversuch anderen Industrienationen plausibel erschien, war es an der Zeit, auch dem deutschen Publikum eine »überarbeitete und veränderte Übersetzung« vorzulegen. Als erster rührte Hans-Werner Sinn damit an jene Wunden, von denen viele meinten, sie würden schon irgendwie verheilen, wenn nur genügend Zeit ins Land ginge. Aber da heilte nichts. »Die Vereinigung ist ökonomisch misslungen«, hieß es gleich zu Beginn des Aufsatzes. »Der Anpassungsprozess der ostdeutschen Wirtschaft ist bei einer Leistungskraft von etwa 60Prozent zu einem vorläufigen Stillstand gekommen, und immer noch kommt jede dritte Mark, die im Osten ausgegeben wird, aus den alten Bundesländern.« Auf 13 eng beschriebenen Seiten dokumentierte der Artikel ein krasses Missverhältnis zwischen der Arbeitsleistung und dem Konsumverhalten der Ostdeutschen. »Der zu sozialistischen Zeiten äußerst geringe Lebensstandard hat sich fast an westliche Verhältnisse angepasst.« Nach den Berechnungen des ifo-Instituts verfügt der ostdeutsche Haushalt wegen geringerer Warenpreise und Mieten im Durchschnitt »über mindestens 90Prozent des westdeutschen Nettoeinkommens«. Bei der Rente übertrifft der Osten nach den Münchener Analysen sogar den westlichen Standard. »Bemerkenswert ist, dass das Renteneinkommen eines durchschnittlichen ostdeutschen Rentenbeziehers höher als das eines westdeutschen Rentenbeziehers ist.« Danach erreichten die Rentenzahlungen in den neuen Ländern »real sogar 120Prozent der westlichen Durchschnittsrente«. Und das, obwohl die Ostrenten nach Auffassung des ifo-Instituts im Westen erarbeitet werden, denn »es darf nicht übersehen werden, dass die finanziellen Mittel, die den Ostdeutschen zur Verfügung stehen, die eigene Leistung bei weitem übertreffen«.
Die Ursachen dieser Fehlentwicklung lagen für Hans-Werner Sinn »im Fördergebietsgesetz, in der Holländischen Krankheit und im Mezzogiorno-Problem«. Das Fördergebietsgesetz hätte zur massenhaften Fehlleitung von Investitionen und zu der heute im Beitrittsgebiet allerorten sichtbaren Vernichtung von Kapital geführt. Die Abschreibungsvergünstigungen, die eigentlich Investitionsanreize schaffen sollten, fielen so üppig aus, dass echte ökonomische Erträge eine eher untergeordnete Rolle spielten und sich Investitionen allein schon durch Steuervergünstigungen auszahlten. Für zahlreiche neu erbaute Büros und Wohngebäude fanden sich keine Mieter. Hans-Werner Sinn sprach von »einem bedauerlichen Politikfehler, der den politischen Entscheidungsträgern nicht hätte unterlaufen dürfen«.
Die Holländische Krankheit (Dutch disease) geht zurück auf die holländischen Gasfunde, nach denen die kleine Nation ihre Wirtschaftskraft auf die Erschließung der Fundstätten konzentrierte. In der Folge wurde das verarbeitende Gewerbe stark vernachlässigt, Industrieexporte wurden durch Erdgasexporte verdrängt. »Zwar haben die fünf neuen Länder keinen Überfluss an natürlichen Rohstoffen«, doch »spielt es nämlich keine Rolle, ob die Zahlungen, die eine Region erhält, ein Geschenk der Natur oder ein Geschenk aus einer anderen Region sind«. Mit anderen Worten, die Ostdeutschen beuteten den üppig sprudelnden Quell westdeutscher Transferleistungen aus wie die Holländer seinerzeit ihre Erdgasvorkommen. Als Therapie für die Holländische Krankheit empfahl Hans-Werner Sinn »eine Senkung der West-Ost-Sozialtransfers«.
Doch die wichtigste Ursache für mangelnde Wirtschaftserfolge im Osten schien Hans-Werner Sinn das Mezzogiorno-Problem zu sein. Dieses Gleichnis bemüht die Wirtschaftsschwäche Süditaliens. Vom Schaft an abwärts bis zur Sohle, heißt es in der Studie, leide der Stiefel an den Folgen kollektiver Lohnverhandlungen. Die mächtigen Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen des Nordens hätten das Lohnniveau für ganz Italien festgelegt, wodurch die Unternehmen im Süden ihren wichtigsten Standortvorteil verloren, nämlich billige Arbeitskräfte. Arbeitslosigkeit und Stagnation seien die Folgen gewesen, die jetzt durch Sozialtransfers vom Norden in den Süden abgemildert werden müssten. Die Parallelen zwischen dem Osten und Westen Deutschlands waren für Hans-Werner Sinn offensichtlich, denn »die westdeutschen Konkurrenten bestimmten die Arbeitsbedingungen und die Löhne im Osten«. Gegen das Mezzogiorno-Problem empfahl der Wissenschaftler »Lohnmäßigung« und eine »aktivierende Sozialhilfe«, bei der Erwerbstätige Sozialleistungen vom Staat nur noch als Zuschüsse zu Billigjobs erhalten sollten. Aktivierend insofern, dass Arbeit, wie schlecht bezahlt auch immer, die Voraussetzung für die Zahlung von Sozialhilfe wäre.
Mit seinem »Kommentar zur Lage der neuen Länder« hatte Hans-Werner Sinn eine Duftmarke gesetzt, an deren Aura sich Deutschland erst gewöhnen musste. Selbst Wissenschaftler rümpften anfangs die Nase. Zwar hatte es auch vorher kritische Betrachtungen zum Einigungsprozess und zur wirtschaftlichen Entwicklung gegeben, aber nie zuvor hatte ein Beamter aus der sozialen Hängematte des Staates derart unverblümt über wirtschaftsliberales Gedankengut sinniert. Hans-Werner Sinn leugnete über weite Strecken seines Aufsatzes nicht nur, dass der Westen das Dilemma in den neuen Ländern erst verursacht hatte, er betrachtete sie auch als losgelöstes, eigenständiges Territorium, zog sozusagen noch einmal die innerdeutsche Grenze und machte, in seiner isolierten Betrachtungsweise, die ehemalige DDR für die anhaltende Wirtschaftsschwäche der Bundesrepublik verantwortlich.
Anfangs sprang kaum jemand auf diese Diskussionsplattform. Im Oktober 2000 gab es noch Hoffnungen, Deutschland könne sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Tatsächlich dauerte es nach der Veröffentlichung des Aufsatzes noch mehr als drei Jahre, ehe die Stimmung umschlug und die Thesen des Münchener Institutsdirektors in aller Munde waren. Und dann schließlich, im Frühjahr 2004, entluden sich die lange aufgestauten Ressentiments. Der deutsche Osten, das Versuchsterrain einer misslungenen Integration, wurde abgeschrieben. Plötzlich forderte der westliche vom östlichen Landesteil mehr Eigenständigkeit, als die Bundesrepublik Deutschland der Deutschen Demokratischen Republik selbst in vier Jahrzehnten Teilung zubilligen mochte. Was man bei Hans-Werner Sinn noch zwischen den Zeilen lesen musste, sprach der Hamburger Pensionär Klaus von Dohnanyi zu Beginn des Jahres 2004 öffentlich aus und erntete dafür im Westen der Republik tosenden Beifall. Die Sachverständigen hatten gerade wieder die Wachstumsprognosen nach unten korrigieren müssen, und es sah endgültig so aus, als könne der einstige Klassenprimus Deutschland nie wieder an seine alten Leistungen anknüpfen. Klaus von Dohnanyi lokalisierte die Gründe für den deutschen Leistungsabfall im Osten der Republik und sprach damit aus, wovon die meisten im alten Bundesgebiet lebenden Menschen ohnehin längst überzeugt waren. »Der ungebrochene innerdeutsche West-Ost-Transfer und andere Folgen der deutschen Vereinigung sind zu etwa zwei Dritteln für die heutige Wachstumsschwäche Deutschlands ursächlich.« Klaus von Dohnanyi war ein intimer Kenner des ostdeutschen Problems, als einer der führenden Treuhandberater hatte er tatkräftig daran mitgewirkt. Aber jetzt, da »die neuen Länder nach 1989 weitgehend entindustrialisiert wurden«, wollte es von Dohnanyi denen nicht so leicht machen, »die meinen, die alte Bundesrepublik setze heute nur einen Abstieg fort, der längst vor der Vereinigung eingesetzt habe«, denn »schließlich debattieren wir über Bevölkerungsentwicklung bis hin zu Renten und Arbeitslosigkeit nun schon 30Jahre«. Seine Überlegungen gipfelten in der Forderung, die Transferzahlungen schnellstens zu verringern, sonst »lähmt der Osten den Westen immer mehr, und dieser verliert schließlich die hohe Wettbewerbsfähigkeit, die er heute noch hat«.
Folgerichtig nahm sich im Frühjahr 2004 auch das Nachrichtenmagazin ›Der Spiegel‹ des Themas an. Die Titelseite zeigte einen Baum, umschlungen von einem schwarzrotgoldenen Band, der von zwei Herren in Businessanzügen mit Gießkannen begossen wurde. Dennoch war die Krone vertrocknet. Über dem schwarzrotgoldenen Band stand: »1250Milliarden Euro«, darunter: »Wofür?«, und zu Füßen der beiden Manager: »Wie aus dem Aufbau Ost der Absturz West wurde«. Im eigentlichen Text wurden die ›Spiegel‹-Autoren noch deutlicher. »Der Osten ist ein Landstrich mit weitgehend stillgelegter Wertschöpfung, der ohne ständigen Nachschub aus der westdeutschen Volkswirtschaft nicht lebensfähig wäre – zumindest nicht auf dem Niveau eines entwickelten Industrielandes. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf nach Abzug der Netto-Transferleistungen der Ex-DDR liegt unter dem Niveau von Portugal. Selbst viele der Beschäftigten in der Ex-DDR, offiziell sechs Millionen, sind keine Beschäftigten im produktiven Sinne. Das Kapital ihres Arbeitsplatzes und oft auch das Geld für ihren Lohn wurden zuvor größtenteils im Westen verdient.« Mittlerweile addierten sich die Transferleistungen, »die durch die Kassenhydraulik des deutschen Sozialstaats Richtung Osten gepumpt werden, zu einer Billionenbilanz. So werden jährlich rund 90Milliarden Euro aus dem produktiven Kern der westdeutschen Volkswirtschaft entnommen – um im Osten weitgehend wirkungslos zu verglühen.« Die ›Spiegel‹-Autoren recherchierten haarsträubende Beispiele, wie die Transfergelder, »die der Westen längst aus der eigenen Substanz begleichen muss«, sinnlos verpulvert wurden. »Die Aufbau-Ost-Milliarden sorgen bei Besuchern aus dem Westen immer wieder für Aufsehen: Am Strand des Badeortes Kühlungsborn tragen heute alle Toilettenhäuschen ein Reetdach. In Dresden wandeln Kunden der Bahn über granitbelegte Bahnsteige. In Cottbus gibt es eine beheizte Bahnhofshalle.«
Kein Zweifel, bei den ›Spiegel‹-Autoren, bei Klaus von Dohnanyi und bei Hans-Werner Sinn überwog die Enttäuschung, wobei ›Der Spiegel‹ noch eine ganz persönliche Kränkung zu verwinden hatte, denn im Osten der Republik erreichte »DIE NR.1« nie einen nennenswerten Leserkreis. All die journalistischen Recherchen und wissenschaftlichen Analysen zeigten eine tief sitzende Sehnsucht nach der alten Bundesrepublik. Aus westlicher Sicht war der deutsche Einigungsprozess ein kaum vorstellbares Verlustgeschäft. Nach einer beispiellosen Zerstörung von nahezu allem, was sich im deutschen Osten in viereinhalb Jahrzehnten Teilung an Eigenständigem herausbilden konnte und nach dem nur in Teilen geglückten wirtschaftlichen Neuanfang, begann nun das Jahrzehnt der Schuldzuweisungen und der Schadensbegrenzung. »Wo«, fragte die ostdeutsche CDU-Politikerin Angela Merkel besorgt, »waren die Menschen in den neuen Bundesländern?« Was dachten die Nutznießer dieses unvorstellbaren Geldsegens, jene, wie es ›Der Spiegel‹ ausdrückte, »47Prozent aller Erwachsenen in Ostdeutschland, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Sozialtransfers bestreiten«? Hatten möglicherweise sie ein gutes Geschäft gemacht?
Ehemalige DDR-Bürger
Die heutige Lage in der ehemaligen DDR ist in der Tat vollkommen anders als bei uns 1945.Das Regime hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Jeder sollte nur noch ein hirnloses Rädchen im Getriebe sein, ein willenloser Gehilfe. Ob sich heute einer dort Jurist nennt oder Ökonom, Pädagoge, Psychologe, Soziologe, selbst Arzt oder Ingenieur, das ist völlig egal: Sein Wissen ist über weite Strecken völlig unbrauchbar. Wir können den politisch und charakterlich Belasteten ihre Sünden vergeben, alles verzeihen und vergessen. Es wird nichts nützen; denn viele Menschen sind wegen ihrer fehlenden Fachkenntnisse nicht weiter verwendbar. Sie haben einfach nichts gelernt, was sie in eine freie Markwirtschaft einbringen könnten.
Arnulf Baring, Historiker und Publizist, in ›Deutschland, was nun? Ein Gespräch mit Dirk Rumberg und Wolf Jobst Siedler‹, Berlin 1991
Noch gibt es neun Millionen ehemalige DDR-Bürger. Sie sind die Letzten eines kleinen Volkes mitten in Europa. Es sind Menschen, die im zweiten deutschen Staat geboren und aufgewachsen sind oder den größten Teil ihres Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik verbracht haben. Die jüngsten ehemaligen DDR-Bürger waren 1989, als sich ihr Staat auflöste, zumindest 18Jahre alt. In den entscheidenden Phasen ihrer Sozialisation standen sie unter dem Einfluss eines, wie es im wiedervereinigten Deutschland heißt, realsozialistischen Herrschaftssystems. Äußerlich sind sie von anderen Deutschen nicht zu unterscheiden, und doch handelt es sich um einen außergewöhnlichen Menschenschlag. Ehemalige DDR-Bürger besitzen allein aufgrund ihrer Geburt und historischer Umstände, die sie nicht beeinflussen konnten, eine Identität, die sie aus der Masse deutscher Staatsbürger heraushebt und die sie, selbst wenn sie es wollten, nur schwer ablegen können. Sogar jene, die ihre angestammte Heimat verlassen haben und heute in westlichen Bundesländern oder im Ausland leben, verbindet ein reißfester Faden mit ihrer Vergangenheit. Sie ziehen, ob sie dies nun wollen oder nicht, immer wieder persönlich Bilanz und vergleichen ihr früheres mit dem heutigen Leben. Ihr Vergleichsmaßstab ist die DDR.Auch wenn die Erinnerungen mit den Jahren etwas verblassen, so treten Details, wenn es die Umstände nahelegen, wieder klar und deutlich hervor. Vielen erscheint es wie ein Fluch, sie distanzieren sich von ihrer Herkunft, sie verschließen die Augen und legen einen Grand Canyon zwischen sich und ihre Vergangenheit. Sie treiben die Assimilation im vereinigten Deutschland bis zur Selbstverleugnung. Andere bekennen sich zu ihrer Prägung und gewinnen zunehmend Gelassenheit. Allen gemeinsam ist, dass sie diese ostdeutsche Identität niemals gewollt haben, sie ist ihnen erst nach der Wiedervereinigung zugewachsen. Eigentlich wollten sie schon lange ganz normale Bundesbürger sein, doch die meisten sind es nie wirklich geworden und möchten es inzwischen auch gar nicht mehr werden. Der ›Sozialreport 2004‹ des Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrums Berlin-Brandenburg e. V. liefert »Daten und Fakten zur sozialen Lage in den neuen Bundesländern« und fragt nach den Hintergründen dieser Entwicklung. Zwar wird die Wiedervereinigung von den Ostdeutschen »insgesamt positiv bewertet«, auch gebe es, »von Einzelpersonen abgesehen, keine restaurativen Vorstellungen«, dennoch fühlen sich gerade mal 38Prozent der ehemaligen DDR-Bürger mit Deutschland stark oder ziemlich stark verbunden. Auf der anderen Seite gibt es bei fast drei Vierteln der Befragten ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit Ostdeutschland, dem früheren Territorium der DDR.Bei der Frage nach der »Selbstzuordnung und Identifikation mit dem bundesrepublikanischen System« fühlt sich überhaupt nur jeder Fünfte als »richtiger Bundesbürger«. Die jeweilige »Selbstzuordnung« steht in engem Zusammenhang mit dem sozialen Status und der Einkommenssituation. Bei den hohen Einkommen überwiegt »BRD-Orientierung«. Über ein Drittel derer, »die angeben, sich als richtige Bundesbürger zu fühlen«, sind Beamte. Dagegen ist eine »starke DDR-Orientierung« besonders bei den unteren Einkommen anzutreffen. Jeder Zehnte möchte die DDR wiederhaben. Zum großen Teil sind es Langzeitarbeitslose, die sich nach den alten Verhältnissen zurücksehnen. Doch die größte Gruppe ehemaliger DDR-Bürger, beinahe zwei Drittel der Befragten, möchte weder die DDR wiederhaben noch fühlen sich diese Menschen als richtige Bundesbürger. Ihre Situation ist menschheitsgeschichtlich ohne Beispiel. Dieser seltsame Grenzzustand, den alten Staat verloren, zum neuen aber keinen rechten Zugang gefunden zu haben, erinnert an das Lebensgefühl von Aussiedlern. Doch die meisten ehemaligen DDR-Bürger haben ihre Heimat niemals verlassen, sie leben immer noch innerhalb ihrer früheren Staatsgrenzen, oft in denselben Dörfern und Städten, in denselben Häusern und Wohnungen. Sie sind Ausländer im eigenen Land.
Mars Attacks!
Ich denke, dass während der DDR-Zeit tatsächlich so eine zarte Bitternis in alles reinspielte, auch in das Schöne. Das wurde nur scheinbar ausgetrieben durch den Radau des quietschbunten Betriebes, der nach der Wende über uns kam. Allerdings wäre es fatal, wenn man vergessen würde, dass es in der DDR neben dieser Tristesse auch eine wild aufschäumende Vitalität gab. Unter den repressiven Rahmenbedingungen brodelte das Leben.
Neo Rauch, im Interview mit dem ›Spiegel‹, Nr.38/2006
Wird die frühe Kindheit einmal ausgeklammert, so wächst die Zahl ehemaliger DDR-Bürger, die mittlerweile länger unter den Einflüssen des wiedervereinigten Deutschland leben als unter denen der DDR.Die stärkeren Eindrücke, weil existenziell bedrohlich, haben die allermeisten ohnehin in der Bundesrepublik gesammelt. Zu den prägenden Erfahrungen ehemaliger DDR-Bürger zählen weniger die Wendeeuphorie und die Währungsumstellung, als vielmehr die schnell einsetzende Ernüchterung. Ein ganzes, bereits in Auflösung begriffenes Volk litt plötzlich unter einem eklatanten Mangel an Gelassenheit. Die Frustration gipfelte in der späten Erkenntnis, dass sie damals alles Mögliche mit der gerade gewonnenen Freiheit anfangen konnten, der Zugang zu den westlichen Märkten stand ihnen auch ohne die übereilte Preisgabe ihres Gemeinwesens offen. Doch zu diesem Zeitpunkt standen sie bereits im Visier einer generalstabsmäßigen Übernahme. Eine fremde Zivilisation hatte sich in Stellung gebracht und errichtete auf ostdeutschem Boden ihr gewohntes Lebensumfeld. Wenn sich irgendwo etwas Ostdeutsches regte, wurde aus allen Rohren gefeuert. Existenzangst wurde zum bestimmenden Lebensgefühl.
Zwei Generationen sahen sich mit dem Niedergang von nahezu allem konfrontiert, woran sie geglaubt und wofür sie gearbeitet hatten. Ob etwas Sinn machte oder nicht, ob sich Strukturen bewährt hatten oder nicht, ob Vorhandenes weit kostengünstiger war als vermeintlich Neues, das war vollkommen egal. Ehemalige DDR-Bürger spielten »Alte Bundesrepublik Deutschland«, und das untertänigst, in ständiger Angst um den Arbeitsplatz. Die Stimmung sank unter den Gefrierpunkt. Noch heute gilt »ostdeutsch« als Makel und genügt für eine pauschale Ablehnung. Ein heute weltweit gefragter Künstler wie der in Leipzig lebende Maler Neo Rauch wurde im wiedervereinigten Deutschland geschnitten. Erst internationale Anerkennung verhalf ihm zu Aufmerksamkeit im eigenen Land, wobei weniger sein außergewöhnlicher Stil und seine Kunstfertigkeit thematisiert werden als vielmehr die bemerkenswerten Verkaufserlöse, die seine Bilder im Ausland erzielen. Nur wenige ehemalige DDR-Bürger hatten so ein Glück. Andere haben hart gearbeitet, waren wirklich gut in ihrem Beruf und haben dennoch nie einen Fuß auf den Boden bekommen. Meistens war es reine Glückssache, wer beruflich und finanziell vom Wandel profitierte. Im Nachhinein erscheint es geradezu grotesk, dass ausgerechnet die Staatsbediensteten einen guten Schnitt machten, während die Beschäftigten der gewerblichen Wirtschaft mit Massenentlassungen zu kämpfen hatten. Vergleichsweise gut kamen Rentner weg, sowohl jene, die bereits zum Zeitpunkt des Wandels im Ruhestand waren, als auch jene, die das Rentenalter im ersten Nachwendejahrzehnt erreichten oder sich durch die anfangs noch großzügigen Ruhestandsregelungen vor Arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen retten konnten. Und schließlich gab es jene Begnadeten, die beiden deutschen Gesellschaftsentwürfen das Beste abgewinnen konnten und das Leben in der DDR nicht weniger genossen haben als das im wiedervereinigten Deutschland. Und doch haben sie alle, ganz gleich ob erfolgreich und gescheitert, zufrieden oder unzufrieden, ob arbeitslos oder beruflich arriviert, ein ambivalentes Verhältnis zum deutschen Staat. Ehemalige DDR-Bürger möchten die Wendezeit nicht missen, bedauern aber, dass sie die gerade gewonnene Freiheit so schnell wieder aufgegeben haben. Sie beklagen den Zerfall der Gesellschaft und ziehen sich ins Private zurück. Sie verachten den deutschen Beamtenstaat und profitieren zugleich vom öffentlichen Jobwunder. Sie beobachten den Niedergang der westdeutschen Wirtschaft mit einer gewissen Häme und wünschen zugleich, die Regierung möge die Probleme endlich anpacken und in den Griff bekommen. Sie spüren, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann, und leben doch, als könne es noch ewig dauern.
Ehemalige DDR-Bürger sind die Meister in der Kunst des Verdrängens. In den zurückliegenden Jahren wurde ihnen zu viel zugemutet. Viele haben unter der ständigen Anspannung zu wenig auf sich selbst und auf ihre Familie geachtet. Einige sind krank geworden, viele Beziehungen sind zerbrochen. Erst seit einigen Jahren ist so etwas wie eine Besinnung zu spüren, ein Bekenntnis zu vertrauten Werten. Es werden Klassentreffen organisiert, man interessiert sich wieder dafür, was aus den anderen geworden ist, man knüpft an schon verloren geglaubte Freundschaften an und holt die alten Schwarzweißfotos aus dem Schrank.
Sozialisationstheorien
Schon seit dem Fall der Mauer erforschen westdeutsche Sozialwissenschaftler »die Differenzen in den gesellschaftspolitischen Einstellungen und Wertorientierungen von Ost- und Westdeutschen«. Im Laufe der Jahre haben sich drei Theorien über die Wertvorstellungen ehemaliger DDR-Bürger herausgebildet, die in Forscherkreisen eine unterschiedliche Wertschätzung genießen. Das begann, unmittelbar nach Auflösung des zweiten deutschen Staates, mit der Konservierungshypothese, nach der sich in der DDR-Bevölkerung westliche Wertvorstellungen aus den 50er Jahren konserviert hätten. Befragungen zeigten bei ehemaligen DDR-Bürgern eine strikte Leistungsorientierung und eine starke Ausrichtung an materiellen Werten. Das wurde keinesfalls negativ bewertet, sondern vielmehr freudig aufgenommen. Diese 50er-Jahre-Mentalität hatte in Westdeutschland das Wirtschaftswunder ermöglicht.
Mit dem Fortschreiten des Einigungsprozesses mehrten sich Zweifel an der Konservierungshypothese. Es passte nicht ins Bild, dass ehemalige DDR-Bürger das Leistungsprinzip befürworteten, sich aber andererseits sehr unduldsam gegenüber sozialen Unterschieden zeigten. Ostdeutsche bevorzugten das Gesellschaftsmodell des demokratischen Sozialismus, in dem soziale Gerechtigkeit und eine direkte Bürgerbeteiligung zentrale Rollen spielten, während Altbundesbürger eher einem liberalen Demokratiemodell zuneigten, in dem soziale Gerechtigkeit und direkte Bürgerbeteiligung nicht die Bedeutung erlangten wie in dem von ehemaligen DDR-Bürgern favorisierten Demokratiemodell. In marktwirtschaftlichen Verhältnissen, forderten die Ostdeutschen, müsse soziale Gerechtigkeit notfalls durch den Staat garantiert werden. Im Westen sozialisierte Wissenschaftler hielten sie deshalb für Heuchler. Wer das Leistungsprinzip wolle, so die westliche Sichtweise, müsse sich auch mit sozialen Ungerechtigkeiten abfinden. Für die ehemaligen DDR-Bürger aber bedeutete, und darin lag das deutsch-deutsche Missverständnis, soziale Gerechtigkeit vor allem Chancengleichheit. Für sie erforderte das Leistungsprinzip einen sportlichen Maßstab, nämlich gleiche Startbedingungen. Die heute in vielen Studien bewiesene Tatsache, dass über den Werdegang eines Bundesbürgers nicht seine Leistungen, sondern vor allem seine soziale Herkunft entscheidet, war die prägende Sozialisationserfahrung für Millionen ehemaliger DDR-Bürger im wiedervereinigten Deutschland. Dazu, wie sie zu sozialen Ungleichheiten stehen, die tatsächlich aufgrund von Leistungen, also unter gleichen Startbedingungen erworben werden, hat die Ostdeutschen bislang nie ein Soziologe befragt.
Dennoch war dieses Missverständnis die Geburtsstunde der Sozialisationstheorie. Die mangelnde Integrationsfähigkeit der Ostdeutschen wurde aus ihrer DDR-typischen Sozialisation erklärt, dort erworbene Wertorientierungen würden sich auch im vereinigten Deutschland als außerordentlich beständig erweisen. Die offizielle politische Zielkultur des SED-Regimes habe den DDR-Bürgern eigentümliche Orientierungen vermittelt, in denen sich Werte wie Wirtschaftswachstum, Leistungsprinzip und Aufstiegsorientierung mit einer dazu im Widerspruch stehenden egalitären Gesellschaft verbinden würden. Diese Wertvorstellungen ließen sich auch heute noch bei ehemaligen DDR-Bürgern nachweisen, weshalb daraus auf erfolgreiche Sozialisationsbemühungen des SED-Regimes geschlossen werden müsse.
Bis heute ist die Sozialisationshypothese die bestimmende Betrachtungsweise in wissenschaftlichen Publikationen. Gäbe es noch eine weitere, ostdeutsche Sichtweise, so würde sie sicher besagen, dass sich Ost- und Westdeutsche in ihren Wertvorstellungen nur wenig unterscheiden, wohl aber in ihren Erfahrungen mit zwei deutschen Gesellschaftsentwürfen und den Möglichkeiten ihrer Teilhabe im wiedervereinigten Deutschland. Neuere Forschungen untermalen dieses Bild. Untersuchungen der Verwaltungshochschule Speyer, bei denen Bürger nach ihren Orientierungen befragt und fünf sogenannten speyerischen Wertetypen zugeordnet wurden (vorrangig traditionell orientierte Menschen, Idealisten, hedonistisch und materiell Orientierte, aktive Realisten und perspektivlos Resignierte), hat sich gezeigt, dass es unter ehemaligen DDR-Bürgern einen besonders hohen Anteil aktiver Realisten gibt. Dieser Wertetyp gilt als der zukunftsfähigste überhaupt. »Aktive Realisten«, schreibt der Speyerer Soziologieprofessor Helmut Klages in seinem 2001 erschienenen Aufsatz ›Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?‹, »sind auf eine konstruktiv-kritikfähige und flexible Weise institutionenorientiert und haben verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten, sich in einer vom schnellen Wandel geprägten Gesellschaft zielbewusst und mit hoher Selbstsicherheit zu bewegen. Mit allen diesen Eigenschaften nähern sie sich am ehesten dem Sollprofil menschlicher Handlungsfähigkeiten unter den Bedingungen moderner Gesellschaften an.« Eine derartige, marktwirtschaftliche Verhältnisse bejahende Wertorientierung erfordert eine geringe Frustrationsanfälligkeit gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen. Die vom Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Technischen Universität Dresden im Jahr 2003 veröffentlichte Vergleichsstudie ›Seelische Gesundheit in Ost und West‹ stellt ehemaligen DDR-Bürgern auch in dieser Hinsicht gute Noten aus. »Entgegen früherer Befunde«, heißt es dort zusammenfassend, »treten psychische Störungen im Gebiet der früheren DDR seltener auf als in Westdeutschland. Auf einer individuellen Ebene, auf der sich letztlich psychische Störungen manifestieren, wirken Einwohner der neuen Bundesländer eher robuster.« Auch wenn der Osten inzwischen aufgeholt hat, spielen Drogen im neuen Bundesgebiet immer noch eine geringere Rolle, wobei Alkohol eine Ausnahme bildet. Die Autoren Frank Jacobi, Jürgen Hoyer und Hans-Ulrich Wittchen rätseln in der Studie, dass »Alkoholstörungen trotz höherer Raten gesundheitsschädlichen Konsums im Osten seltener sind«, und vermuten, »ob vielleicht geselliges Trinken verbreiteter, einsames (funktionales) Trinken aber seltener ist. Eine Erklärung zugunsten der neuen Bundesländer, dass Konkurrenz, Neid und die Neigung zum sozialen Vergleich für den Osten vielleicht doch weniger charakteristisch sind.«
Nicht alle Zumutungen konnten ehemalige DDR-Bürger durch »geselliges Trinken« kompensieren. Kaum zu verkraften waren die Aussagen von Kai Arzheimer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz, und von Markus Klein, Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentralarchiv für empirische Sozialforschung an der Universität Köln. In ihrem viel beachteten Aufsatz ›Gesellschaftspolitische Wertorientierungen und Staatszielvorstellungen im Ost-West-Vergleich‹ warnen sie, »dass das politische System zunehmend unter Stress geraten wird, sollten sich die politischen Orientierungen in Ost und West nicht mittelfristig einander angleichen.« Beide Autoren sind erklärte Anhänger der Sozialisationshypothese, nach der »die Wertorientierungen der Bürger in den neuen Ländern in einem spezifisch ostdeutschen Sozialisationsprozess erworben wurden und sich dementsprechend als relativ stabil erweisen«. Die beiden Wissenschaftler sorgen sich, »dass nachwachsende Generationen wiederum spezifisch ostdeutsche Wertorientierungen erwerben und auf diese Weise ein geschlossenes Milieu entstehen könnte«. Dann müsste die politische Kultur in Deutschland noch über Jahrzehnte gespalten bleiben, zumal »unsere Ergebnisse darauf hindeuten, dass bei der demokratischen Sozialisation der jungen Ostdeutschen mit einer niedrigen formalen Bildung erhebliche Defizite bestehen«. Doch es gibt auch Hoffnung. »Insbesondere ist über alle untersuchten Wertorientierungen hinweg unter den formal hochgebildeten Angehörigen der jüngsten Generation eine fast vollständige Annäherung zwischen Ost und West zu verzeichnen. Wenn sich der Trend in den nächsten Jahren fortsetzt«, heißt es bei Arzheimer und Klein zusammenfassend, »wird sich eine gesamtdeutsche politische Kultur nur langsam, nämlich über die Generationenfolge herausbilden.«
Noch gibt es neun Millionen ehemalige DDR-Bürger. Es werden schnell weniger. Im Jahr 2020 werden es gerade noch 5,6Millionen sein, um 2039 werden sich die letzten ehemaligen DDR-Bürger aus dem Erwerbsleben verabschieden, und 2063 sind die wenigen dann noch lebenden, in der DDR sozialisierten Bundesbürger bereits über 90Jahre alt. Ihr allmähliches Verschwinden ist die allgemein erwartete und von Wissenschaftlern propagierte Lösung der gesellschaftspolitischen Differenzen zwischen beiden Teilen Deutschlands.
Letzte Nachricht von einem verlorenen Volk
Die Weltkonjunktur gegen Ende des zweiten Nachwendejahrzehnts hat Ostdeutschland nie richtig erreicht. Der Westen profitierte, frühere Ostblockstaaten erstarkten wirtschaftlich und setzten, nach Jahren großer Anstrengungen, auf mehr Lebensqualität, nur Ostdeutschland hatte keine Perspektive. Aber die Medien verbreiteten gute Stimmung und die Menschen ließen sich nur zu gern anstecken, zu groß war ihre Sehnsucht nach ein bisschen Normalität. Es floss noch einmal reichlich Geld in die öffentlichen Kassen des Beitrittsgebiets. Doch das Ende war bereits abzusehen, der Westen hatte den Solidarpakt aufgekündigt. Jahr für Jahr sollte es weniger zusätzliches Geld geben, bis schließlich gar nichts mehr im Osten ankäme, weder innerdeutsche Solidarzahlungen noch aus Brüssel überwiesene Sonderförderung. Am schwersten aber wog, dass Ostdeutschland an der Schwelle zum »demografischen Wandel« stand und sich ein Bevölkerungsrückgang abzeichnete, wie es ihn seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr in Mitteleuropa gegeben hat. Nun, da fast eine Generation seit der deutschen Einigung vergangen war, wurde deutlich, das ein Generationswechsel nicht stattfinden würde, nur wenige rücken nach. Die neue Generation ist zahlenmäßig weit kleiner als zu DDR-Zeiten geborene Jahrgänge, und sie ist anders. Ihre Sozialisation ist westdeutsch, ihre Orientierung ist westlich, die Suche nach beruflichen Chancen führt ein Großteil fort aus Ostdeutschland. Die Eltern und Großeltern schauen ihnen nach und hoffen, dass sie die Kinder hin und wieder besuchen. Kaum jemand glaubt ernsthaft daran, dass sie wieder zurückkommen. Ihr Fortgang besiegelt das letzte Kapitel der deutschen Einigung. Die Eltern und Großeltern bleiben zurück in einer Region, wo prekäre Arbeitsverhältnisse nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind und ein langer Arbeitsmonat nicht viel mehr einbringt als das staatlich garantierte Existenzminimum. Sie bleiben zurück in einem Landstrich, wo die Hälfte aller Erwerbsfähigen auf staatliche Wohlfahrt angewiesen ist, wo jeder Zweite fürchtet, im Alter auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Es ist eine Region, in der bereits 43Prozent Rentner leben, wo sich vier von zehn Menschen zum »abgehängten Prekariat« zählen und mit ausgesprochen heiklen Lebensverhältnissen zurechtkommen müssen (Sozialstudie TNS Infratest vom April 2007). Es ist ein Landstrich, wo mehr als ein Drittel der Unternehmen von Pflichtbeiträgen für die Industrie und Handelskammer freigestellt sind, wo – wie in Mecklenburg-Vorpommern – 851Kommunen gerade mal 270Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen für sich verbuchen (Stand 2006) und damit nur einen Bruchteil ihrer Verwaltungskosten begleichen können. Es sind Städte und Gemeinden, wo besonders viele junge Frauen abwandern und ein Männerüberschuss herrscht. Es sind Problemgegenden darunter, wo sich bereits unter Grundschülern eine bisher nicht gekannte Aggressivität ausbreitet, wo schon die Jüngsten von Hunger und Verwahrlosung geprägt sind und kaum jemals die Chance auf ein bürgerliches Leben haben.
Niemand weiß, wo das noch hinführt. Die gravierendsten Auswirkungen der deutschen Einigung werden erst in den kommenden Jahren sichtbar und in der gesamten westlichen Welt auf Interesse stoßen. Die Zwangsläufigkeit der bevorstehenden Ereignisse macht Ostdeutschland zu einem Studienobjekt. Wenn die heutige Generation der Großeltern ihre letzte Ruhe findet, wird es kaum noch jemanden geben, der in die frei werdenden Mietwohnungen und Einfamilienhäuser zieht. Räumkommandos werden den Abriss ganzer Dörfer, Stadtteile und Wohnsiedlungen organisieren, um Vandalismus vorzubeugen. Mit dem Ableben der zahlenmäßig starken, vergleichsweise finanzkräftigen Rentnergeneration werden nach und nach viele der Einkaufszentren schließen, die in den 90er Jahren in größter Eile aus dem Boden gestampft wurden. Die Immobilienpreise werden noch drastischer fallen, Banken und Sparkassen mit den Wertberichtigungen kaum noch nachkommen. Immer mehr Kommunen werden Investitionskredite für die viel zu groß geratenen Wasserwerke und Kläranlagen, für leer stehende Gewerbegebiete und Verwaltungsgebäude nicht mehr bedienen können und nicht wissen, woher sie das Geld für die Bezahlung des öffentlichen Personals nehmen sollen. Spätestens dann wird sichtbar, was heute kaum jemand auszusprechen wagt: Die Bundesrepublik hat unter dem Banner der deutschen Einigung eine 108000Quadratkilometer große Problemregion mitten in Europa geschaffen und Millionen voller Vertrauen und Enthusiasmus in die Vereinigung gestartete Menschen betrogen und ihrer Existenzgrundlage beraubt.
Das Schlimmste ließe sich womöglich verhindern, wenn sich Deutschland sofort den Problemen stellen würde. Doch das neue Bundesgebiet wird im föderalen Verteilungskampf kaum noch wahrgenommen, schließlich steht auch der Westen vor eklatanten Problemen. Ihre schwerste Bewährungsprobe haben die ehemaligen DDR-Bürger noch vor sich. Unter rein ökonomischen Gesichtspunkten wäre es sinnvoll, die Regierung würde den ehemaligen DDR-Bürgern den Umzug in westdeutsche Bundesländer bezahlen und die ostdeutschen Verwaltungsgebiete – abgesehen von einigen Wirtschaftsstandorten – der Natur überlassen. Am Ende gibt es für alles eine Lösung. Wer kann schon genau sagen, wo Deutschland in zwanzig Jahren stehen und wie es dann im Osten aussehen wird. Das ist der Zeitpunkt, wo die letzten ehemaligen DDR-Bürger aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Was werden ihre Enkel und Urenkel über sie denken? Welches geschichtliche Verständnis wird kommenden Generationen über ehemalige DDR-Bürger und ihren untergegangenen Staat vermittelt? Werden im Westen sozialisierte Historiker dieses Bild entwerfen oder werden auch jene gehört, die nicht nur eine, sondern beide Seiten kennen, die Erfahrungen in beiden deutschen Gesellschaftsentwürfen sammeln konnten? Vieles deutet darauf hin, dass sich die einseitige, vom Westen dominierte Sichtweise fortsetzen wird. Das wiedervereinigte Deutschland hat nur wenig Nutzen aus dem viereinhalb Jahrzehnte währenden ost-westdeutschen Gesellschaftsexperiment gezogen. Der Westen ist völlig uninspiriert in die Wiedervereinigung gegangen. Mit Blick auf die beängstigenden Tatsachen müssen es – um in der Wortwahl der Soziologen zu bleiben – überwiegend materiell und hedonistisch orientierte Altbundesbürger gewesen sein, die sich den Osten angeeignet haben. Aufgrund ihrer stabilen, im Westen erworbenen Wertvorstellungen fehlte ihnen jegliches Feingefühl für die in mehr als vier Jahrzehnten erworbenen Besonderheiten und Vorzüge der im Osten lebenden Menschen. Sie meinten, sie seien auf die aktive Mitwirkung der ehemaligen DDR-Bürger nicht angewiesen.
Besitzt jemand nur so viel Vermögen, dass er davon nicht länger als ein paar Tage oder Wochen leben kann, denkt er wohl kaum daran, Einkünfte daraus zu erzielen. Er geht äußerst sparsam damit um und versucht durch seine Arbeit so viel zu verdienen, dass er Entnahmen ersetzen kann, bevor es vollständig aufgezehrt ist.
Adam Smith, ›Der Wohlstand der Nationen‹, London 1776
TEIL EINS
Herrenloses Eigentum
Wendebestandsaufnahme
Es blieb immer ein großes Mysterium, dass den DDR-Bürgern alles gehörte, sie aber kaum etwas wirklich besaßen. Eigentum, hieß es auch zu sozialistischen Zeiten, gibt Sinn für Ordnung. Und wer konnte den tiefen Sinn dieser Worte besser erfassen als jene deutschen Staatsbürger, denen »gesamtgesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln« oder Volkseigentum als die höchste Form materiellen Besitzes propagiert wurde. Die Besitzverhältnisse oder »Privateigentum an Produktionsmitteln« waren der Dreh- und Angelpunkt der marxistisch-leninistischen Theorie. Der eine oder andere hatte durchaus ein wenig, meist aus vorsozialistischen Zeiten überkommenen Besitz, beispielsweise ein altes Mehrfamilienhaus in der Innenstadt, an dem er oder die Familie über all die Jahrzehnte trotz erschreckend niedriger Mieteinnahmen festhielt. Eigentumswohnungen gab es nicht, wohl aber Wohneigentum in Form von Einfamilienhäusern. Allerdings übte Wohneigentum auf die meisten DDR-Bürger wegen der sehr niedrigen Mieten keinen besonderen Reiz aus. Entsprechend klein war die Zahl derer, die in den eigenen vier Wänden wohnten. Neben dieser über Wohnimmobilien verfügenden Minderheit gab es noch das Bodenreformland, der größte Immobilienbesitz von DDR-Bürgern überhaupt. Diese Landparzellen waren ihren Besitzern während der sowjetischen Besatzung zugeteilt worden, was zugleich einen gewissen Bestandsschutz darstellte. Die DDR-Regierung fühlte sich an die unter sowjetischer Aufsicht stehende und von ihr selbst betriebene Landaufteilung sozusagen moralisch gebunden. Auch wenn es sich bei dem Bodenreformland quasi um Privatbesitz handelte, so war dessen Bewirtschaftung an die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) gebunden. Allerdings wirtschafteten die Agrargenossenschaften nicht nur auf dem Bodenreformland ihrer Anteilseigner, sondern zum großen Teil auf staatlichen Acker- und Weideflächen. Privaten Acker- und Gartenbau und private Tierhaltung gestattete der sozialistische Staat nur in geringem Umfang. Die Abnahme dieser im Nebenerwerb erzeugten Produkte war allerdings staatlich garantiert, die stark subventionierten Preise waren für die Kleinerzeuger äußerst lukrativ.
Darüber hinaus existierten in der DDR kleine, privat geführte Unternehmen wie Elektroinstallationsfirmen, Klempnerbetriebe, Tischlereien, sogenannte Privatbäcker, Fleischerfachgeschäfte. All diese Betriebe hatten üblicherweise nicht mehr als zehn Beschäftigte. Sie kamen über eine kritische Größe nicht hinaus, da sie ansonsten mit der staatlichen Doktrin in Konflikt geraten wären und die Enteignung drohte. Verbreitet war dagegen genossenschaftliches Eigentum. Es gab Genossenschaften des Produktiven Handwerks (PGH), Konsumgenossenschaften, Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (AWG). Bis auf das Genossenschaftseigentum und den wenigen Privatbesitz gehörte die DDR zum weitaus größten Teil dem Volk. Auch wenn der Eigentumsbegriff ideologisch motiviert war und selbst die DDR-Bürger mit so abstrakten Begriffen wie Volkseigentum oder gesamtgesellschaftlichem Eigentum an Produktionsmitteln nicht viel anfangen konnten, so bestimmten die staatlich kontrollierten Eigentumsverhältnisse dennoch über vier Jahrzehnte ihre Lebenswirklichkeit. DDR-Bürger konnten keinen größeren Besitz erwerben oder sich eine Existenz aufbauen, ähnlich wie das in den marktwirtschaftlichen Verhältnissen der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft geschehen konnte. Alles, was die DDR-Bürger besaßen und wofür sie gearbeitet hatten, steckte in diesem Staat. Und dieses Volksvermögen hatte im Laufe von mehr als vier Jahrzehnten einen beachtlichen Umfang angenommen. Zum Zeitpunkt der Wendebestandsaufnahme zählte die ostdeutsche Volkswirtschaft 12354Unternehmen mit 45000Betriebsstätten. In den Volkseigenen Betrieben arbeiteten 4,1Millionen Menschen. Zu den Unternehmen gehörte beispielsweise das Kombinat VEB Deutfracht/Seereederei Rostock (DSR), unter dessen Flagge 172Frachtschiffe mit einem Raummaß von insgesamt 1,13Millionen Bruttoregistertonnen fuhren. Zum Volkseigentum gehörten 20000Gaststätten und Ladengeschäfte, 1839Apotheken, 390Hotels, zahlreiche Kinos, die gesamte Energie- und Wasserversorgung und die Betriebe des öffentlichen Nahverkehrs. Der größte Teil des ostdeutschen Wohnungsbestandes gehörte zum Volkseigentum. Die DDR hatte eines der weltweit am besten ausgebauten Kinderbetreuungssysteme. Auch ein Netz von Sportschulen mit einem bis heute nicht wieder erreichten Leistungsniveau gehörte dazu. Eher wenig Beachtung fand das Vermögen der Nationalen Volksarmee, unter anderem 369Kampfflugzeuge, 2761Panzer, 192Kriegsschiffe, 5000Artillerie-, Raketen und Flugabwehrsysteme, 7000 verschiedenste Radfahrzeuge, 1,3Millionen Handfeuerwaffen, dazu noch über 300000Tonnen Munition und riesige Materialvorräte. Der kleine deutsche Staat verfügte über 124000Immobilien, insgesamt 342000Hektar Liegenschaften. Ferner gehörten den DDR-Bürgern 1,8Millionen Hektar Ackerland und 2,1Millionen Hektar Wald.
Geheime Verschlusssache b5–1158/89
Die DDR konnte bis zum letzten Tag ihrer ökonomischen Existenz, bis zur Währungsunion und der Umstellung auf die DM am 1.7.1990 selbst unter den seit einem Dreivierteljahr dauernden Umbruchsbedingungen sowohl im Handel mit den ausländischen Partnern in Ost und West jede fällige Rechnung bezahlen als auch die Versorgung der Bevölkerung stabil gewährleisten.
Siegfried Wenzel: ›Was war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert geblieben? Versuch einer Abschlussbilanz‹, Berlin 2001
Schon kurz nach der Wende, als sich das Desaster abzuzeichnen begann, etablierte sich in der Öffentlichkeit das Bild von der maroden, völlig heruntergewirtschafteten und überschuldeten DDR, wobei der Westen bis heute beteuert, das wahre Ausmaß der Katastrophe sei anfangs weit unterschätzt worden. Abgesehen davon, dass ein erschreckendes Maß an Verantwortungslosigkeit darin liegt, eine gemeinsame Währung mit einem Staat anzustreben, über dessen Wirtschaftskraft und Verschuldungssituation man sich nicht recht im Klaren war, machten sich die SED-Funktionäre über die wirtschaftliche Lage der DDR weit weniger Illusionen als die zur Übernahme bereitstehenden westdeutschen Repräsentanten. Gleich zu Beginn seiner kurzen Regierungszeit im Herbst 1989 hatte Egon Krenz ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Mal ging es tatsächlich um die Wahrheit. Der Generalsekretär forderte »ein ungeschminktes Bild der ökonomischen Lage der DDR mit Schlussfolgerungen«. Am 28.Oktober 1989 wurde einem kleinen Kreis von Genossen das sogenannte »Schürer-Papier« zugestellt. Das Originaldokument liegt heute in der »Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR« und war, obwohl streng vertraulich, den westdeutschen Politikern und Beamten nicht verborgen geblieben. Das Schürer-Papier wurde maßgeblich vom langjährigen Planungsminister Gerhard Schürer, von Außenhandelsminister Gerhard Beil und vom Chef des DDR-Auslandsfirmenimperiums Alexander Schalck-Golodkowski erarbeitet. Zum damaligen Zeitpunkt war die DDR mit 49Milliarden D-Mark bei etwa 400 ausländischen Banken verschuldet. Dabei hatte die DDR nur etwa die Hälfte dieser Auslandskredite in Anspruch genommen und präsentierte den Banken die andere Hälfte als »Guthaben«. Über den wahren Charakter dieser Guthaben wurde peinliches Stillschweigen bewahrt, denn nur solange die Wahrheit nicht ans Licht kam, »trugen diese nicht mobilisierten Kredite ganz wesentlich zum Ansehen der DDR als solidem und zuverlässigem Kreditnehmer bei«. Die Planwirtschaftler rechneten fest damit, dass ihnen ausländische Banken über das Jahr 1989 hinaus jährlich acht bis zehn Milliarden D-Mark leihen würden und die tatsächlich zu finanzierende Schuldenlast, also abzüglich nicht mobilisierter Kreditanteile, sich bis 1995 auf maximal 45Milliarden D-Mark erhöhen würde. Dafür sollten dann jährlich etwa 8,7Milliarden D-Mark an Zinsen gezahlt werden. Zum Vergleich: Die fünf neuen Länder waren 2004 mit rund 71Milliarden Euro verschuldet. Ost- und Westberlin, die statistisch nicht mehr getrennt werden, hatten 2004 einen Schuldenstand von noch einmal 53,9Milliarden Euro. Dazu müssen auch noch die Bundesschulden gerechnet werden, die 2004 gemäß dem ostdeutschen Bevölkerungsanteil mit etwa 150Milliarden Euro zu Buche schlugen. Zu diesem Zeitpunkt wurde nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) im neuen Bundesgebiet etwa 80Prozent der Industrieproduktion der DDR erreicht.
Damit die DDR den Schuldendienst für die geplante Kreditaufnahme bis Mitte der 90er Jahre – weiter dachte offenbar niemand voraus – leisten konnte, hätte die ostdeutsche Wirtschaft, bei gleichbleibenden Importen von gut zwölf Milliarden D-Mark jährlich, ihre Exporte in den Westen innerhalb von nur fünf Jahren auf 24Milliarden D-Mark verdoppeln müssen. Das war, darüber herrschte Einigkeit in dem Planungskollektiv, in den damaligen planwirtschaftlichen Strukturen unmöglich. Und so mahnte das Schürer-Papier eindringlich jene wirtschaftlichen Veränderungen an, die der DDR das Tor zum Westen öffnen sollten. »Die Feststellung«, hieß es unmissverständlich, »dass wir über ein funktionierendes System der Leitung und Planung verfügen, hält einer strengen Prüfung nicht stand. Durch neue Anforderungen, mit denen die DDR konfrontiert war, entstanden im Zusammenhang mit subjektiven Entscheidungen Disproportionen, denen mit einem System aufwendiger administrativer Methoden begegnet werden sollte. Dadurch entwickelte sich ein übermäßiger Planungs- und Verwaltungsaufwand. Die Selbständigkeit der Kombinate und wirtschaftlichen Einheiten sowie der Territorien wurde eingeschränkt.« Die Arbeitsproduktivität in der DDR, klagten die Funktionäre, »liegt gegenwärtig um 40Prozent hinter der BRD zurück. In bestimmten Bereichen der Volkswirtschaft sind die Ausrüstungen stark verschlissen, woraus sich ein überhöhter und ökonomisch uneffektiver Instandhaltungs- und Reparaturbedarf ergibt. Darin liegt auch eine Ursache, dass der Anteil der Beschäftigten mit manueller Tätigkeit in der Industrie seit 1980 nicht gesunken ist, sondern mit 40Prozent etwa gleich blieb.«
Die Schlussfolgerungen des Schürer-Papiers liefen auf »eine an den Marktbedingungen orientierte sozialistische Planwirtschaft« hinaus und auf einen »demokratischen Zentralismus, wo jede Frage dort entschieden wird, wo die dafür nötige, größere Kompetenz vorhanden ist«. Dazu wurde eine Reihe von Maßnahmen, immer unter dem Damoklesschwert drohender Zahlungsunfähigkeit, gefordert, die geeignet waren, die DDR in mancherlei Hinsicht westlicher zu gestalten, als es selbst die alte Bundesrepublik war. »Es ist eine Umstrukturierung des Arbeitskräftepotenzials erforderlich, um das Missverhältnis zwischen produktiven und unproduktiven Kräften in der gesamten Wirtschaft und im Überbau zu beseitigen, d.h. drastischer Abbau von Verwaltungs- und Bürokräften sowie hauptamtlich Tätiger in gesellschaftlichen Organisationen und Einrichtungen. Die DDR ist interessiert, mit Konzernen und Firmen der BRD und anderen Ländern zu kooperieren, Lizenzen und Technologien zu übernehmen, Leasinggeschäfte durchzuführen sowie die Gestattungsproduktion weiter zu entwickeln, wenn der Aufwand refinanziert und ein Gewinn erreicht werden kann. Um der BRD den ernsthaften Willen der DDR zu unseren Vorschlägen bewusst zu machen, ist zu erklären, dass durch diese und weitergehende Maßnahmen der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit DDR – BRD noch in diesem Jahrhundert solche Bedingungen geschaffen werden könnten, die heute existierende Form der Grenze zwischen beiden deutschen Staaten überflüssig zu machen.«
Die postindustrielle Konsumgesellschaft
Als in Ostdeutschland nach und nach die Lichter ausgingen, erstrahlte der Westen nur umso heller. Unmittelbar an den Ostblock grenzte die erfolgreichste Industrienation Europas. So wie die Vereinigten Staaten und Japan hatte die Bundesrepublik eine erstaunliche Nachkriegskarriere absolviert und zählte zum Trio der erlesenen Volkswirtschaften. Während die japanische Kultur dem alten Kontinent immer fremd geblieben war und die Vereinigten Staaten Rassenschranken und soziale Gegensätze duldeten, wie sie in Westeuropa kaum auszuhalten wären, legte die Bundesrepublik um Wirtschaft und Sozialstaat eine rosarote Schleife und präsentierte sich als Musterschülerin der sozialen Marktwirtschaft. Wer auf der Strecke blieb oder dem Wettbewerb nicht gewachsen war, endete nicht auf der Straße, sondern konnte sich mit Arbeitslosengeld, zeitlich unbegrenzter Arbeitslosenhilfe, mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Umschulung, Weiterbildung oder der Aufnahme eines Studiums und gelegentlich ein wenig Schwarzarbeit gut über Wasser halten. Die Quelle dieses Reichtums, eine prosperierende, vornehmlich mittelständisch geprägte Wirtschaft, schien nahezu unerschöpflich. Die europäischen Nachbarn schauten mit Respekt auf den deutschen Wirtschaftsgiganten und verbargen ihren Neid hinter den üblichen Vorurteilen, denen das laute und unbescheidene Auftreten der Westdeutschen reichlich Nahrung bot. Noch in den 80er Jahren schien den Deutschen einfach alles zu gelingen. Junge Karrieristen aus aller Welt planten ein Praktikum in der Bundesrepublik und suchten hier, im Musterland der sozialen Marktwirtschaft, den Schlüssel zu Reichtum und Wohlstand. Viele waren fasziniert. Ein Blick auf die blank polierte bundesrepublikanische Oberfläche zauberte noch jedem ein Lächeln ins Gesicht.
Wer allerdings genauer hinschaute, dem erstarb das Lächeln. Während sich die Welt immer schneller veränderte und andere Staaten ihre Probleme anpackten, verharrte Deutschland in Selbstgefälligkeit. Der Leidensdruck war während der 80er Jahre in Westdeutschland noch nicht so groß wie in anderen Industrienationen, doch auch in der Bundesrepublik vollzogen sich Entwicklungen, die dringend korrigiert werden mussten. So tauchten im Bundestag bereits in den 70er Jahren erste Studien auf, die eindringlich vor der Weiterführung des »umlagefinanzierten« oder über Generationen finanzierten Sozialversicherungssystems warnten. Stark rückläufige Geburtenraten setzten nicht nur den oft bemühten, im rechtlichen Sinne nie wirklich geschlossenen Generationenvertrag außer Kraft, fortan wurde deutlich, dass die Bundesrepublik ihren Wohlstand zu Lasten künftiger Generationen finanzierte. All jene, die mit ihren Sozialversicherungssteuern den Ruhestand und die medizinische Versorgung der alten Generation bezahlten, würden als Rentner selbst nicht mehr in den Genuss jener Leistungen kommen, die sie während ihrer Berufstätigkeit anderen ermöglichten. Der Generationenvertrag, daran bestand schon damals keinerlei Zweifel, ließ sich allenfalls noch über eine Generation fortführen, bis dem System nach einer Phase immer schneller steigender Sozialversicherungsbeiträge der Kollaps drohte. Trotz dieser beängstigenden Prognose blieben die Verantwortlichen über zwei Jahrzehnte untätig und erweiterten die umlagefinanzierten Sozialversicherungen, sozusagen als höchste Form des sozialpolitischen Autismus, sogar noch Mitte der 90er Jahre durch die Einführung der Pflegeversicherung.
Die Probleme mit steigenden Sozialversicherungssteuern und einem Umlagesystem, bei dem die Alten auf Kosten der Jungen leben, beschrieben längst nicht alle Krankheitssymptome der rein äußerlich immer noch vital wirkenden alten Bundesrepublik. Schon seit Anfang der 70er Jahre stieg die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland kontinuierlich an. Zwar ließen sich am Verlauf der Arbeitslosenkurve die Konjunkturzyklen nachzeichnen, doch zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung hatte sich das Heer der Arbeitslosen über zwei Jahrzehnte ständig vergrößert. Bereits 1974 stieg die Arbeitslosenzahl auf über eine Million, verharrte sechs Jahre lang auf diesem Niveau, um sich dann binnen zweier Jahre auf zwei Millionen zu verdoppeln. Mitte der 80er Jahre näherte sich die Zahl der Arbeitslosen bedrohlich der Zweieinhalb-Millionen-Grenze. Die wirtschaftliche Stimmung in Westdeutschland Ende der 80er Jahre, Altbundesbürger werden sich erinnern, war überhaupt nicht gut. Neben leistungsstarken, global agierenden Konzernen und einem international wettbewerbsfähigen Mittelstand hatte sich in Westdeutschland eine träge und kostspielige Staatswirtschaft etabliert und auf dem Wege der Ämterpatronage feine Verästelungen in die Parteien und öffentlichen Verwaltungen ausgewachsen. Diese Staatswirtschaft trat erst seit der deutschen Einigung, im Zuge von Privatisierungsbestrebungen, nach und nach aus dem Schatten kommunaler Haushalte, sodass deren Beschäftigtenzahl (außer Post und Bundesbahn mit allein 789200Beamten, öffentlichen Arbeitern und Angestellten) vom Statistischen Bundesamt nicht einmal gesondert erfasst wurde. Manfred Röber, Leiter des Studienganges »Public Management« an der Berliner Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, schätzte in seiner 2001 veröffentlichten Studie ›Das Parteibuch– Schattenwirtschaft der besonderen Art?‹ den Anteil staatseigener Unternehmen an der Gesamtwirtschaft selbst heute noch, nach der Privatisierung von Post und Bahn und weiterer Staatsunternehmen, auf mindestens zwei Millionen Beschäftigte. Noch katastrophaler war, was sich die alte Bundesrepublik mit dem öffentlichen Dienst leistete. Im unmittelbaren westdeutschen Staatsdienst stiegen die Beschäftigtenzahlen zwischen 1950 und 1989 von 2,282Millionen auf 4,865Millionen Beamte, öffentliche Angestellte und Arbeiter. Allein zwischen 1950 und 1960 kamen 872000 öffentliche Beschäftigte hinzu, davon – nach Gründung der Bundeswehr am 5.Mai 1955 – knapp 150000Berufssoldaten. Zwischen 1960 und 1970 schufen die öffentlichen Verwaltungen 721000 neue Stellen und setzten im darauf folgenden Jahrzehnt weitere 782000Mitarbeiter auf die Gehaltslisten des Staates. Allein im Laufe des Jahres 1971 kam es in Westdeutschland zu 166000





























