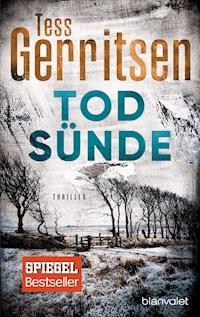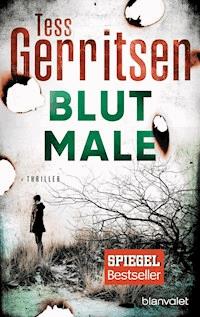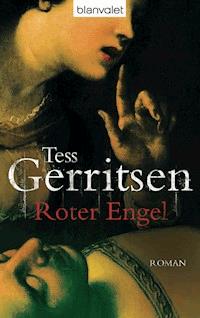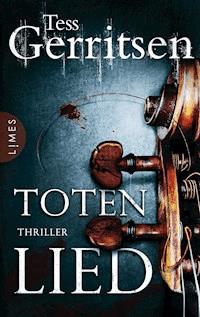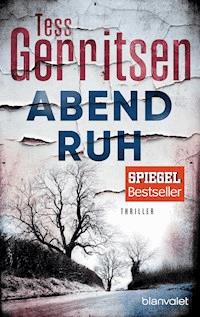
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli-&-Isles-Serie
- Sprache: Deutsch
Nirgends bist du sicher. Sie werden auch dich finden ...
Sie sind die einzigen Überlebenden schrecklicher Familientragödien. Erst wurden ihre Eltern und dann obendrein ihre Pflegefamilien brutal ermordet. In Abendruh, einem Internat in der Abgeschiedenheit Maines, sollen sie ihre Sicherheit wiedergewinnen und in ein normales Leben zurückfinden. Doch obwohl die Schule hermetisch gesichert ist, kommt es zu höchst beunruhigenden Vorfällen, und drei Jugendliche bangen um ihr Leben. Maura Isles, die eine persönliche Verbindung zu Abendruh hat, ist vor Ort, als die Bedrohung eskaliert …
Rizzoli & Isles – die Bestsellerserie im Überblick!
Band 1: Die Chirurgin
Band 2: Der Meister
Band 3: Todsünde
Band 4: Schwesternmord
Band 5: Scheintod
Band 6: Blutmale
Band 7: Grabkammer
Band 8: Totengrund
Band 9: Grabesstille
Band 10: Abendruh
Band 11: Der Schneeleopard
Band 12: Blutzeuge
Band 13: Mutterherz
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Tess Gerritsen
Abendruh
Ein Rizzoli-&-Isles-Thriller
Deutsch von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Last to Die« bei Ballantine Books, an imprint of the Random House Publishing Group, a division of Random House Inc., New York.
1. Auflage Copyright der Originalausgabe © 2012 by Tess GerritsenCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2013 Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHPublished by Arrangement with Tess Gerritsen Inc.Dieses Werk wurde im Auftrag von Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.Umschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: Getty Images/The Bridgeman Art Library; Detail aus Alexandre-François Deportes: Angriff einer Katze auf totes Wild, ca. 1770wr · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-09601-4www.blanvalet.de
Zum Andenken an meine Mutter, Ruby Jui Chiung Tom
Wir nannten ihn Ikarus.
Das war natürlich nicht sein richtiger Name. Meine Kindheit auf dem Bauernhof hat mich gelehrt, dass man einem Tier, das für die Schlachtbank bestimmt ist, nie einen Namen geben darf. Stattdessen sprach man von Schwein Nummer eins oder Schwein Nummer zwei, und man sah ihm niemals in die Augen, um nur ja nicht so etwas wie ein Bewusstsein, eine Persönlichkeit oder gar Zuneigung darin erkennen zu müssen. Wenn ein Tier einem vertraut, braucht es wesentlich mehr Entschlossenheit, ihm die Kehle durchzuschneiden.
Mit Ikarus hatten wir solche Probleme nicht. Weder vertraute er uns, noch hatte er die geringste Ahnung, wer wir waren. Aber wir wussten eine Menge über ihn. Wir wussten, dass er hinter hohen Mauern in einer Villa auf einem Hügel am Stadtrand von Rom lebte. Dass er und seine Frau Lucia zwei Söhne im Alter von acht und zehn Jahren hatten. Dass er, seinem enormen Reichtum zum Trotz, beim Essen einen eher einfachen Geschmack hatte und dass er fast jeden Donnerstag in seinem Stammlokal La Nonna aß.
Und dass er ein Monster war. Das war es auch, was uns in diesem Sommer nach Italien führte.
Die Jagd auf Monster ist nichts für zimperliche Gemüter. Und sie ist auch nichts für Leute, die sich an solche Banalitäten wie Gesetze oder Landesgrenzen gebunden fühlen. Monster halten sich schließlich nicht an Regeln, also können wir uns auch nicht daran halten, wenn wir eine Chance haben wollen, sie zu besiegen.
Doch wer die Regeln und Normen des zivilisierten Umgangs über Bord wirft, läuft Gefahr, selbst zum Monster zu werden. Genau das ist in jenem Sommer in Rom passiert. Damals habe ich das nicht erkannt; niemand von uns hat es erkannt.
Bis es zu spät war.
1
An dem Abend, als die dreizehnjährige Claire Ward hätte sterben sollen, stand sie in Ithaca auf dem Fensterbrett ihres Zimmers im zweiten Stock und überlegte hin und her, ob sie springen sollte oder nicht. Sechs Meter unter dem Fenster waren wild wuchernde Forsythiensträucher, die ihre Frühlingsblüte längst hinter sich hatten. Sie würden ihren Sturz abfedern, aber ohne Knochenbrüche würde es wahrscheinlich nicht abgehen. Sie sah zu dem Ahorn hinüber, beäugte den starken Ast, der sich so nahe zum Fenster hin reckte, dass sie ihn mit ausgestrecktem Arm fast berühren konnte. Bis zu diesem Abend hatte sie den Sprung noch nie gewagt, denn sie war nie dazu gezwungen gewesen. Bis zu diesem Abend war es ihr immer gelungen, sich unbemerkt aus dem Haus zu schleichen. Aber diese Abende der mühelos gewonnenen Freiheit gehörten der Vergangenheit an, denn Bob die Spaßbremse war ihr auf die Schliche gekommen. In Zukunft bleibst du schön zu Hause, wenn es draußen dunkel wird, junge Dame! Jetzt ist Schluss mit dem Herumstreunen!
Wenn ich mir bei diesem Sprung den Hals breche, dachte sie, dann ist es allein Bobs Schuld.
Ja, doch, diesen Ast konnte sie mit Sicherheit erreichen. Sie hatte an diesem Abend noch etwas vor, sie wollte Leute treffen, und sie konnte nicht ewig hier herumsitzen und ihre Chancen abwägen.
Sie ging in die Hocke, spannte die Muskeln zum Sprung an – und erstarrte plötzlich, als die Scheinwerfer eines Autos um die Ecke kamen. Der Geländewagen glitt wie ein schwarzer Hai unter ihrem Fenster vorüber und fuhr weiter die ruhige Straße entlang, als ob der Fahrer nach einem bestimmten Haus suchte. Sicher nicht nach unserem, dachte sie; nie tauchte irgendjemand Interessantes bei ihren Pflegeeltern auf, bei Bob »Spaßbremse« Buckley und seiner noch langweiligeren Gattin Barbara. Sogar ihre Namen waren langweilig, ganz zu schweigen von ihren Tischgesprächen. Wie war dein Tag, Schatz? Und deiner? Das Wetter hat sich gebessert, nicht wahr? Reichst du mir bitte die Kartoffeln?
In ihrer verstaubten Akademikerwelt war Claire die Fremde, das wilde Mädchen, das sie niemals verstehen würden, sosehr sie sich auch mühten. Und sie gaben sich wirklich Mühe. Wäre sie doch nur bei einer Familie von Künstlern oder Schauspielern oder Musikern untergekommen, bei Leuten, die die ganze Nacht aufblieben und wussten, wie man sich amüsiert. Bei ihrer Art von Leuten.
Der schwarze Wagen war verschwunden. Jetzt oder nie, dachte sie.
Sie holte tief Luft und sprang. Spürte das Rauschen der Nachtluft in ihren langen Haaren, als sie durch die Dunkelheit flog. Dann landete sie, geschmeidig wie eine Katze, und der Ast erzitterte unter ihrem Gewicht. Ein Kinderspiel. Sie kletterte auf einen tieferen Ast und wollte gerade springen, als der schwarze Geländewagen zurückkam. Wieder glitt er mit leise schnurrendem Motor vorbei. Sie sah ihm hinterher, bis er um die Ecke verschwand, dann ließ sie sich auf das nasse Gras fallen.
Ihr Blick ging zurück zum Haus, und sie rechnete schon damit, dass Bob zur Haustür hinausstürmen und sie anschreien würde: Rein mit dir, junge Dame, aber auf der Stelle! Doch die Außenbeleuchtung ging nicht an.
Jetzt konnte der Abend beginnen.
Sie zog den Reißverschluss ihrer Kapuzenjacke hoch und machte sich auf den Weg zum Stadtpark, wo die ganze Action war – wenn man es so nennen konnte. Zu dieser späten Stunde war die Straße ruhig, die meisten Fenster dunkel. Es war ein Viertel mit Lebkuchenhäuschen wie aus dem Bilderbuch, bevölkert von Professoren und Dozenten und glutenfreien, veganen Ehefrauen und Müttern, die alle in Lesegruppen waren. Zehn Quadratmeilen, umgeben von der wirklichen Welt, so lautete Bobs augenzwinkernde Definition der Stadt, doch er und Barbara gehörten tatsächlich hierher.
Claire wusste nicht, wo sie hingehörte.
Sie überquerte die Straße mit großen Schritten und kickte mit ihren ausgetretenen Stiefeln das tote Laub vor sich her. Einen Block weiter stand ein Trio von Teenagern, zwei Jungen und ein Mädchen, im Lichtkegel einer Straßenlaterne und rauchte Zigaretten.
»Hey«, rief sie ihnen zu.
Der größere Junge winkte. »Hey, Claire-Bear. Ich hab gehört, du hättest wieder Einzelhaft.«
»Für dreißig Sekunden vielleicht.«
Sie nahm die brennende Zigarette, die er ihr anbot, machte einen Lungenzug und atmete mit einem zufriedenen Seufzer aus. »Also, was geht ab heute Abend? Was wollen wir machen?«
»Hab gehört, drüben bei den Wasserfällen steigt ’ne Party. Aber wir brauchen ein Auto.«
»Was ist mit deiner Schwester? Sie könnte uns doch hinfahren.«
»Nee, Dad hat ihr die Autoschlüssel weggenommen. Lass uns noch ’ne Weile hier rumhängen und schauen, wer sonst noch aufkreuzt.« Der Junge hielt inne, runzelte die Stirn und spähte über Claires Schulter. »O Scheiße, sieh mal, wer da kommt.«
Sie drehte sich um und stöhnte, als ein dunkelblauer Saab neben ihr am Bordstein hielt. Das Beifahrerfenster wurde heruntergedreht, und Barbara Buckley sagte: »Steig ein, Claire!«
»Ich treffe mich bloß mit meinen Freunden.«
»Es ist fast Mitternacht, und morgen ist Schule.«
»Ist ja nicht so, als ob ich was Verbotenes mache.«
Vom Fahrersitz kommandierte Bob Buckley: »Steig sofort ein, junge Dame!«
»Ihr seid nicht meine Eltern!«
»Aber wir sind verantwortlich für dich. Es ist unser Job, dich zu einem anständigen Menschen zu erziehen, und genau das versuchen wir zu tun. Wenn du nicht sofort mit uns nach Hause kommst, dann … also, dann wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen.«
Ja, ja, ich mach mir vor Angst gleich in die Hose. Sie wollte schon loslachen, doch da fiel ihr plötzlich auf, dass Barbara einen Morgenmantel trug und dass Bobs Haare seitlich vom Kopf abstanden. Sie hatten sich so überhastet auf die Suche nach ihr gemacht, dass sie sich nicht einmal angezogen hatten. Sie sahen beide älter und müder aus, ein zerknittertes Ehepaar mittleren Alters, das aus dem Schlaf gerissen worden war und ihretwegen am nächsten Morgen völlig erschöpft aufwachen würde.
Barbara seufzte resigniert. »Ich weiß, dass wir nicht deine Eltern sind, Claire. Ich weiß, dass es dir nicht passt, bei uns zu wohnen, aber wir tun doch nur unser Bestes. Also steig jetzt bitte ein. Hier draußen bist du nicht sicher.«
Claire warf ihren Freunden einen genervten Blick zu, kletterte auf den Rücksitz des Saab und knallte die Tür zu. »Okay?«, sagte sie. »Jetzt zufrieden?«
Bob drehte sich zu ihr um. »Es geht hier nicht um uns. Es geht um dich. Wir haben deinen Eltern geschworen, dass wir uns immer um dich kümmern würden. Wenn Isabel noch am Leben wäre und dich jetzt sehen könnte, würde es ihr das Herz brechen. Außer Rand und Band, immer voller Zorn. Claire, du hast eine zweite Chance bekommen, und das ist ein Geschenk. Ich bitte dich, wirf es nicht weg.« Er seufzte. »Und jetzt schnall dich an, ja?«
Wäre er wütend gewesen, hätte er sie angebrüllt, dann hätte sie damit umgehen können. Aber der Blick, mit dem er sie ansah, war so kummervoll, dass sie ein ganz schlechtes Gewissen bekam. Weil sie sich so unmöglich benahm, weil sie ihre Güte mit Rebellion erwiderte. Es war nicht die Schuld der Buckleys, dass ihre Eltern tot waren. Dass ihr Leben so verkorkst war.
Während sie davonfuhren, saß sie zusammengekauert auf dem Rücksitz, reumütig, aber zu stolz, um sich zu entschuldigen. Morgen werde ich netter zu ihnen sein, dachte sie. Ich werde Barbara helfen, den Tisch zu decken, und vielleicht sogar Bobs Wagen waschen. Denn diese Kiste hat es wirklich verdammt nötig.
»Bob«, sagte Barbara, »was macht denn das Auto da vorn?«
Ein Motor heulte auf. Scheinwerfer kamen auf sie zu.
Barbara schrie: »Bob!«
Durch den Aufprall wurde Claire in ihren Gurt geschleudert, und ein entsetzliches Getöse zerriss die Nacht. Splitterndes Glas. Knirschendes Metall.
Und irgendjemand weinte, wimmerte leise. Sie schlug die Augen auf, sah, dass die Welt auf dem Kopf stand, und merkte, dass das Wimmern von ihr selbst kam. »Barbara?«, flüsterte sie.
Sie hörte einen gedämpften Knall, dann noch einen. Benzingeruch stieg ihr in die Nase. Sie hing in ihrem Gurt, und er schnitt ihr so tief in die Rippen, dass sie kaum atmen konnte. Blind tastete sie nach der Schnalle. Sie löste sich mit einem Klick, Claires Kopf schlug unten auf, und ein jäher Schmerz schoss ihr in den Nacken. Irgendwie gelang es ihr, sich umzudrehen, sodass sie flach dalag, vor sich das zerschmetterte Fenster. Der Benzingeruch war jetzt stärker. Sie wälzte sich zum Fenster hin, dachte an Flammen, an sengende Hitze, die das Fleisch auf ihren Knochen zum Kochen brachte. Raus hier, raus. Solange noch Zeit bleibt, Bob und Barbara zu retten! Sie schlug die letzten Glassplitter aus dem Rahmen, und sie fielen klirrend auf den Asphalt.
Zwei Füße tauchten in ihrem Blickfeld auf und blieben vor ihr stehen. Sie starrte zu dem Mann auf, der ihr den Fluchtweg versperrte. Sein Gesicht konnte sie nicht sehen, nur seine Silhouette. Und die Waffe, die er in der Hand hielt.
Reifen kreischten, als ein weiterer Wagen mit röhrendem Motor auf sie zuschoss.
Claire wich erschrocken in den Saab zurück, wie eine Schildkröte, die sich in den Schutz ihres Panzers verkriecht. Sie zog sich vom Fenster zurück, hielt sich die Arme über den Kopf und fragte sich nur, ob die Kugel diesmal wehtun würde. Ob sie spüren würde, wie sie in ihren Schädel eindrang. Sie rollte sich so fest zusammen, dass sie nur noch das Geräusch ihres eigenen Atems hörte, das Rauschen des Bluts in ihren Adern.
Fast hätte sie die Stimme überhört, die ihren Namen rief.
»Claire Ward?« Es war eine Frau.
Ich muss wohl tot sein. Und das da ist ein Engel, der mit mir redet.
»Er ist weg. Du kannst jetzt rauskommen, die Gefahr ist vorbei«, sagte der Engel. »Aber du musst dich beeilen.«
Claire schlug die Augen auf und spähte durch ihre Finger auf das Gesicht, das sie seitwärts durch das kaputte Fenster anstarrte. Ein schlanker Arm streckte sich nach ihr aus, und Claire duckte sich ängstlich weg.
»Er wird wiederkommen«, sagte die Frau. »Also beeil dich.«
Claire ergriff die dargebotene Hand, und die Frau zog sie heraus. Glassplitter regneten klirrend herab, als Claire auf den Asphalt rollte. Allzu schnell setzte sie sich auf, und die nächtliche Szenerie drehte sich um sie. Sie erhaschte einen kurzen Blick auf das Wrack des Saab, der sich überschlagen hatte, dann musste sie den Kopf schon wieder senken.
»Kannst du aufstehen?«
Langsam hob Claire den Kopf.
Die Frau war ganz in Schwarz gekleidet. Ihr Haar war zum Pferdeschwanz gebunden, und die blonden Strähnen schimmerten hell im Schein der Straßenlaterne. »Wer sind Sie?«, flüsterte Claire.
»Mein Name ist nicht wichtig.«
»Bob … Barbara …« Claire sah zu dem auf dem Dach liegenden Wagen. »Wir müssen sie da rausholen! Helfen Sie mir.« Claire kroch zur Fahrerseite und riss die Tür auf.
Bob Buckley fiel heraus auf die Straße, die blicklosen Augen weit aufgerissen. Claire starrte auf das Einschussloch in seiner Schläfe. »Bob«, stöhnte sie. »Bob!«
»Du kannst ihm nicht mehr helfen.«
»Barbara … Was ist mit Barbara?«
»Es ist zu spät.« Die Frau packte sie an den Schultern und schüttelte sie kräftig. »Sie sind tot, verstehst du? Sie sind beide tot.«
Claire schüttelte den Kopf, den Blick immer noch auf Bob geheftet. Auf die Blutlache, die sich jetzt um seinen Kopf herum ausbreitete wie ein dunkler Heiligenschein. »Das kann doch nicht wirklich passieren«, wisperte sie. »Nicht schon wieder.«
»Komm, Claire.« Die Frau ergriff ihre Hand und zog sie hoch. »Komm mit mir. Wenn dir dein Leben lieb ist.«
2
An dem Abend, als der vierzehnjährige Will Yablonski hätte sterben sollen, stand er im Dunkeln auf einer Wiese in New Hampshire und hielt Ausschau nach Aliens.
Er hatte die komplette Ausrüstung beisammen, die er für seine Suche brauchte. Da war sein 10-Zoll-Dobson-Spiegel, den er drei Jahre zuvor von Hand geschliffen hatte, als er erst elf Jahre alt gewesen war. Er hatte zwei Monate daran gearbeitet, zuerst mit grobem 80-körnigen Sandpapier, dann nach und nach mit immer feinerer Körnung, um das Glas zu formen, zu glätten und zu polieren. Mithilfe seines Vaters hatte er seine eigene Altazimut-Montierung gebaut. Das 25-mm-Plöss-Okular war ein Geschenk seines Onkels Brian, der Will half, die ganzen Geräte nach dem Abendessen hinaus aufs Feld zu schleppen, wann immer der Himmel klar war. Aber Onkel Brian war eine Lerche, keine Eule, und um zehn Uhr abends war er immer schon reif fürs Bett.
Und so stand Will allein auf dem Feld hinter dem Bauernhaus seiner Tante und seines Onkels, wie an den meisten Abenden, wenn es keine Wolken gab und der Mond nicht schien, und suchte den Himmel nach kosmischen Staubhaufen ab, besser bekannt als Kometen. Sollte er je einen neuen Kometen entdecken, dann wusste er schon genau, wie er ihn nennen würde: Komet Neil Yablonksi, zu Ehren seines verstorbenen Vaters. Ständig wurden neue Kometen von Amateur-Astronomen entdeckt – warum sollte es das nächste Mal nicht ein vierzehnjähriger Junge sein? Sein Vater hatte ihm einmal gesagt, es brauche dafür nur Hingabe, ein geübtes Auge und eine Menge Glück. Es ist eine Schatzsuche, Will. Das Universum ist wie ein Strand, und die Sterne sind Sandkörner, die das, was du suchst, verdecken.
Für Will war die Schatzsuche immer noch so spannend wie am ersten Tag. Immer noch verspürte er dieses Kribbeln, jedes Mal, wenn er und Onkel Brian die Ausrüstung aus dem Haus trugen und sie in der Abenddämmerung aufbauten, die gleiche gespannte Erwartung, weil dies die Nacht sein könnte, in der er den Kometen Neil Yablonski entdeckte. Und dann hätte sich die ganze Mühe endlich gelohnt, die zahllosen Nachtwachen, bei denen er sich mit heißer Schokolade und Schokoriegeln auf den Beinen gehalten hatte. Und es würde sogar die Beleidigungen aufwiegen, die seine ehemaligen Klassenkameraden in Maryland ihm ins Gesicht geschleudert hatten. Fettsack. Michelin-Männchen.
Die Kometenjagd war kein Hobby, bei dem man einen braun gebrannten Athletenkörper bekam.
Heute hatte er seine Suche wie üblich bald nach der Abenddämmerung begonnen, denn Kometen waren am besten kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang zu sehen. Aber die Sonne war schon vor Stunden untergegangen, und immer noch hatte er keine Schweifsterne erspäht. Er hatte ein paar vorbeiziehende Satelliten beobachtet und einmal das kurze Aufflackern eines Meteors, aber nichts, was er in diesem Himmelssektor nicht schon einmal gesehen hätte. Er richtete das Teleskop auf einen anderen Sektor, und der unterste Stern der Canes Venatici kam in sein Blickfeld. Die Jagdhunde. Er erinnerte sich an die Nacht, in der sein Vater ihm den Namen dieses Sternbilds beigebracht hatte. Eine kalte Nacht, in der sie beide bis zur Morgendämmerung aufgeblieben waren. Sie hatten sich mit Schlucken aus der Thermoskanne gewärmt und sich ab und zu einen Snack …
Plötzlich schnellte er hoch und drehte sich um. Was war das für ein Geräusch? Ein Tier? Oder bloß der Wind in den Bäumen? Er stand mucksmäuschenstill da und lauschte angestrengt, doch die Nacht war mit einem Mal unnatürlich still, so still, dass er seinen eigenen Atem extrem laut hörte. Onkel Brian hatte ihm versichert, dass in diesen Wäldern keine gefährlichen Tiere hausten, aber wie er so allein in der Dunkelheit stand, konnte Will sich alle möglichen Kreaturen mit scharfen Zähnen vorstellen. Schwarzbären. Wölfe. Pumas.
Mit flatternden Nerven wandte er sich wieder seinem Teleskop zu und verschob den Ausschnitt. Und da war plötzlich dieser Staubhaufen, genau in der Mitte des Okulars. Ich hab ihn gefunden! Komet Neil Yablonski!
Nein. Nein, du Idiot, das war kein Komet. Er seufzte enttäuscht auf, als ihm klar wurde, dass das Ding in seinem Okular der M3 war, ein Kugelsternhaufen. Etwas, das jeder halbwegs brauchbare Astronom erkennen würde. Ein Glück, dass er nicht Onkel Brian geweckt hatte, um es ihm zu zeigen – das wäre todpeinlich gewesen.
Ein knackender Zweig ließ ihn erneut herumfahren. Da bewegte sich etwas im Wald. Ganz eindeutig – da war irgendetwas.
Die Explosion schleuderte ihn nach vorn. Er fiel hart mit dem Gesicht voran ins Gras und blieb benommen liegen. Irgendwo flackerte ein Licht, wurde immer heller, und als er den Kopf hob, sah er, dass die Bäume orangefarben schimmerten. Im Nacken spürte er einen heißen Luftzug, wie den Atem eines Ungeheuers. Er drehte sich um.
Das Haus brannte lichterloh. Die Flammen loderten auf wie Finger, die nach dem Himmel krallten.
»Onkel Brian!«, schrie Will. »Tante Lynn!«
Er rannte auf das Haus zu, doch eine Feuerwand versperrte ihm den Weg und ließ ihn zurückprallen, so höllisch heiß, dass jeder Atemzug in seiner Kehle brannte. Würgend und hustend taumelte er rückwärts und roch den Gestank seiner eigenen angesengten Haare.
Hol Hilfe! Die Nachbarn! Er drehte sich zur Straße um, lief ein paar Schritte und hielt gleich wieder inne.
Eine Frau kam auf ihn zu. Ganz in Schwarz gekleidet, schlank und geschmeidig wie ein Panther. Ihre blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, und im flackernden Schein des Feuers traten ihre Gesichtszüge scharf hervor.
»Helfen Sie mir!«, schrie er. »Meine Tante und mein Onkel … Sie sind im Haus!«
Sie sah zum Bauernhaus hinüber, das jetzt vollends von Flammen eingehüllt war. »Es tut mir leid. Aber für die beiden ist es zu spät.«
»Es ist nicht zu spät! Wir müssen sie retten!«
Sie schüttelte betrübt den Kopf. »Ich kann ihnen nicht helfen, Will. Aber dich – dich kann ich retten.« Sie streckte die Hand aus. »Komm mit mir. Wenn dir dein Leben lieb ist.«
3
Es gab Frauen, denen stand Rosa gut. Es gab Frauen, die konnten Schleifchen und Spitzen tragen, konnten in seidenglänzendem Taft herumstöckeln und dabei bezaubernd feminin aussehen.
Jane Rizzoli gehörte nicht zu diesen Frauen.
Sie stand im Schlafzimmer ihrer Mutter, starrte die Gestalt in dem hohen Spiegel an und dachte nur: Erschießt mich. Erschießt mich auf der Stelle.
Das glockenförmige Kleid war bonbonrosa, mit einem Rüschendekolleté von den Dimensionen eines Clownskragens. Der Rock war bauschig mit Reihen über Reihen von noch mehr abartigen Rüschen. Um die Taille war eine Schärpe mit einer riesigen rosa Schleife geschlungen. Selbst Scarlett O’Hara wäre entsetzt gewesen.
»Oh, Janie, schau dich nur an«, rief Angela Rizzoli und klatschte entzückt in die Hände. »Du bist so wunderschön, du wirst mir noch die Schau stehlen. Bist du nicht auch begeistert?«
Jane blinzelte nur, zu perplex, um auch nur ein Wort herauszubringen.
»Natürlich musst du dazu High Heels tragen, um das Ganze abzurunden. Stilettos aus Satin, würde ich sagen. Und ein Strauß mit rosa Rosen und Schleierkraut. Oder ist das altmodisch? Findest du, dass ich lieber auf modern machen sollte, mit Callas oder so was in der Art?«
»Mom …«
»Das Kleid muss ich dir in der Taille noch enger nähen. Wie kommt es eigentlich, dass du so abgenommen hast? Isst du nicht genug?«
»Ist das dein Ernst? Das soll ich tragen?«
»Was stört dich denn daran?«
»Es ist … rosa.«
»Und du siehst wunderbar darin aus.«
»Hast du mich jemals in Rosa gesehen?«
»Ich nähe ein Kleidchen genau wie das da für Regina. Ihr werdet so süß nebeneinander aussehen! Mutter und Tochter im Partnerlook!«
»Regina ist süß. Ich bin es definitiv nicht.«
Angelas Unterlippe begann zu zittern. Ein Warnsignal, so subtil wie das erste Zittern der Kontrollanzeige eines Kernkraftwerks. »Ich habe das ganze Wochenende an diesem Kleid gearbeitet. Jeden Stich, jede Rüsche habe ich eigenhändig genäht. Und jetzt willst du es gar nicht anziehen, nicht mal zu meiner Hochzeit?«
Jane schluckte. »Das habe ich nicht gesagt. Nicht direkt jedenfalls.«
»Ich sehe es dir am Gesicht an. Du hasst es.«
»Nein, Mom, es ist ein tolles Kleid.« Für ein Barbiepüppchen vielleicht.
Angela sank aufs Bett nieder, und ihr Seufzer hätte einer sterbenden Opernheldin gut angestanden. »Weißt du, vielleicht sollten Vince und ich einfach heimlich heiraten. Dann wären alle glücklich, oder? Dann müsste ich nicht mit Frankie herumstreiten. Und ich müsste mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wer auf die Gästeliste kommt und wer nicht. Und du müsstest nicht ein Kleid tragen, das du hasst.«
Jane setzte sich zu ihr aufs Bett, wobei der Taftstoff sich über ihrem Schoß aufblähte wie eine Riesenportion Zuckerwatte. Sie drückte ihn glatt. »Mom, deine Scheidung ist ja noch nicht mal durch. Du kannst dir für die Planung alle Zeit der Welt nehmen. Das ist doch das Schöne an einer Hochzeit, meinst du nicht? Du musst nichts überstürzen.« Sie blickte auf, als die Türklingel ertönte.
»Vince wird allmählich ungeduldig. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er sagt, er will endlich seine Braut zum Altar führen. Ist das nicht süß? Ich komme mir vor wie in dem Madonna-Song Like a virgin …«
Jane sprang auf. »Ich geh schon hin.«
»Wir sollten einfach in Miami heiraten«, rief Angela, als Jane hinausging. »Das würde alles wesentlich vereinfachen. Und billiger wäre es auch, weil ich nicht die ganze Verwandtschaft zum Essen einladen müsste!«
Jane öffnete die Haustür. Auf der Schwelle standen die zwei Männer, die sie an diesem Sonntagmorgen am allerwenigsten sehen wollte.
Ihr Bruder Frankie lachte, als er das Haus betrat. »Was willst du denn mit dem hässlichen Kleid?«
Ihr Vater, Frank senior, stapfte hinterdrein und verkündete: »Ich bin gekommen, um mit deiner Mutter zu sprechen.«
»Dad, das ist jetzt kein guter Zeitpunkt«, sagte Jane.
»Ich bin hier. Also ist es ein guter Zeitpunkt. Wo ist sie?«, fragte er und sah sich im Wohnzimmer um.
»Ich glaube nicht, dass sie mit dir reden will.«
»Sie muss mit mir reden. Wir müssen diesem Irrsinn ein Ende machen.«
»Irrsinn?«, echote Angela und trat aus dem Schlafzimmer. »Du bist der Richtige, von Irrsinn zu reden.«
»Frankie sagt, du willst das wirklich durchziehen«, sagte Janes Vater. »Du willst diesen Mann tatsächlich heiraten?«
»Vince hat mir einen Antrag gemacht. Ich habe Ja gesagt.«
»Was ist mit der Tatsache, dass wir immer noch verheiratet sind?«
»Das steht bloß noch in den Papieren.«
»Ich werde sie nicht unterschreiben.«
»Was?«
»Ich sagte, ich werde die Papiere nicht unterschreiben. Und du wirst diesen Typen nicht heiraten.«
Angela lachte ungläubig. »Du hast doch mich sitzen lassen!«
»Ich wusste ja nicht, dass du dir gleich den Nächsten angeln würdest.«
»Was hätte ich denn machen sollen – daheim rumsitzen und mich vor Sehnsucht verzehren, nachdem du mich wegen ihr verlassen hattest? Ich bin immer noch eine junge Frau, Frank! Die Männer begehren mich. Sie wollen mit mir schlafen!«
Frankie stöhnte: »Mein Gott, Ma!«
»Und weißt du was?«, setzte Angela noch einen drauf. »Ich hatte noch nie so guten Sex!«
Jane hörte ihr Handy im Schlafzimmer klingeln. Sie ignorierte es und packte ihren Vater am Arm. »Ich glaube, du gehst jetzt besser, Dad. Komm, ich begleite dich zur Tür.«
»Ich bin froh, dass du mich verlassen hast, Frank«, sagte Angela. »Jetzt habe ich mein Leben wieder, und ich weiß, wie es ist, wenn man geschätzt wird.«
»Du bist meine Frau. Du gehörst immer noch zu mir.«
Janes Handy, das vorübergehend verstummt war, läutete erneut, so beharrlich, dass sie es nicht ignorieren konnte. »Frankie«, flehte sie, »nun hilf mir doch, Herrgott noch mal! Wir müssen ihn aus dem Haus schaffen.«
»Komm schon, Dad«, sagte Frankie und klopfte seinem Vater auf den Rücken. »Lass uns ein Bier trinken gehen.«
»Ich bin hier noch nicht fertig.«
»Doch, das bist du«, sagte Angela.
Jane rannte zurück ins Schlafzimmer und kramte das klingelnde Handy aus ihrer Tasche. Sie versuchte, die streitenden Stimmen in der Diele zu ignorieren, als sie sich meldete: »Rizzoli.«
»Wir brauchen dich hier«, sagte Detective Darren Crowe. »Wie schnell kannst du kommen?« Kein höfliches Vorgeplänkel, kein bitte oder würde es dir etwas ausmachen – einfach nur Crowe mit seiner üblichen charmanten Art.
Sie entgegnete ebenso brüsk: »Ich habe keine Bereitschaft.«
»Marquette setzt drei Teams ein. Ich habe die Leitung bei diesem Fall. Frost ist gerade gekommen, aber wir könnten eine Frau gebrauchen.«
»Habe ich da gerade richtig gehört? Hast du tatsächlich gesagt, dass du die Hilfe einer Frau brauchst?«
»Hör zu, unser Zeuge steht zu sehr unter Schock, um uns irgendetwas Brauchbares erzählen zu können. Moore hat schon versucht, mit dem Jungen zu reden, aber er meint, du hättest vielleicht mehr Glück bei ihm.«
Mit dem Jungen. Bei dem Wort hielt Jane erschrocken inne. »Euer Zeuge ist ein Kind?«
»Dreizehn oder vierzehn, schätze ich. Er ist der einzige Überlebende.«
»Was ist passiert?«
Am anderen Ende der Leitung waren Stimmen zu hören, die knappen Wortwechsel der Spurensicherer, und das Echo vieler Schritte, die in einem Zimmer mit Parkettboden umhergingen. Sie konnte Crowe vor sich sehen, wie er mit seiner Hollywoodfrisur inmitten des Trubels stand, breitschultrig und mit geschwellter Brust. »Es ist ein verdammtes Blutbad hier«, sagte er. »Fünf Opfer, davon drei Kinder. Die Jüngste dürfte kaum älter als acht Jahre sein.«
Ich will das nicht sehen, dachte sie. Nicht heute. Und auch an keinem anderen Tag. Dennoch rang sie sich dazu durch zu fragen: »Wo bist du?«
»Das Haus ist am Louisburg Square. Die gottverdammten Übertragungswagen blockieren hier alles, also musst du wahrscheinlich ein, zwei Straßen weiter parken.«
Sie blinzelte überrascht. »Es ist in Beacon Hill passiert?«
»Genau. Auch die Reichen erwischt’s hin und wieder.«
»Wer sind die Opfer?«
»Bernard und Cecilia Ackerman, fünfzig beziehungsweise achtundvierzig Jahre alt. Und ihre drei Adoptivtöchter.«
»Und der Überlebende? Ist er ihr Sohn?«
»Nein. Sein Name ist Teddy Clock. Er lebt seit ein paar Jahren bei den Ackermans.«
»Er lebt bei ihnen? Ist er ein Verwandter?«
»Nein«, antwortete Crowe. »Er ist ihr Pflegekind.«
4
Als Jane auf den Louisburg Square trat, entdeckte sie den vertrauten schwarzen Lexus, der zwischen den kreuz und quer parkenden Einsatzfahrzeugen des Boston PD stand, und sie wusste, dass Maura Isles, die Rechtsmedizinerin, bereits am Tatort war. Nach der Anzahl der Übertragungswagen zu schließen, waren auch sämtliche Fernsehsender der Stadt vertreten, und das war nicht weiter verwunderlich: Wenige Wohnlagen in Boston waren so begehrt wie dieser Platz mit seinem schmucken kleinen Park und den vielen Schatten spendenden Bäumen. Die Häuser rings um den Square waren im Stil des Greek Revival erbaut. Hier wohnte sowohl altes als auch neues Geld, von Industriemagnaten über die vornehmen Familien der Bostoner »Brahmanen« bis hin zu einem ehemaligen Senator. Aber nicht einmal ein Viertel wie dieses war immun gegen Gewalt. Auch die Reichenerwischt’s hin und wieder, hatte Detective Crowe gesagt, aber wenn es sie erwischte, schaute die ganze Welt hin. Hinter der Polizeiabsperrung rangelten sich Scharen von Schaulustigen um die besten Plätze. Beacon Hill war ein beliebtes Ziel für Reisegruppen, und heute kamen diese Touristen voll auf ihre Kosten.
»He, sieh mal! Da ist Detective Rizzoli.«
Jane entdeckte die Fernsehreporterin, die mit ihrem Kameramann auf sie zusteuerte, und hob die Hand, um ihre Fragen abzuwehren. Selbstverständlich ignorierten sie sie und verfolgten sie quer über den Platz.
»Detective, wir haben gehört, es gäbe einen Zeugen!«
Jane bahnte sich ihren Weg durch die Menge und zischte: »Polizei. Lassen Sie mich durch.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!