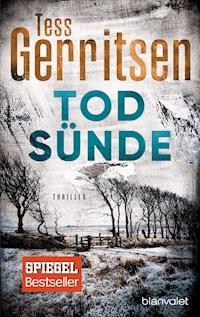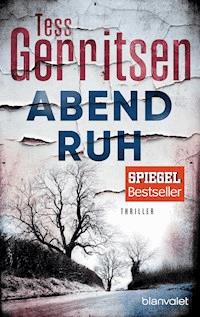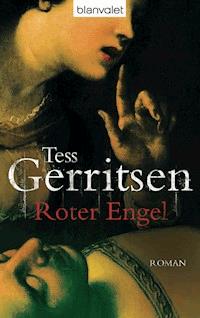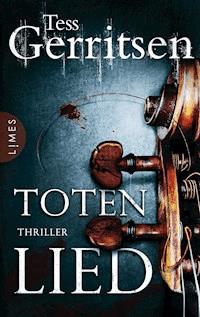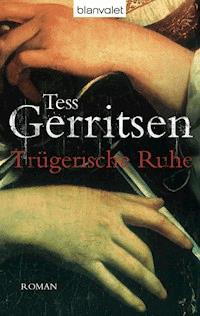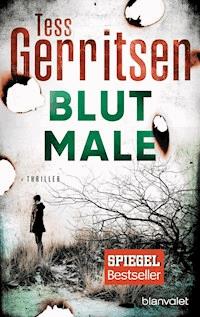
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli-&-Isles-Serie
- Sprache: Deutsch
"Peccavi – ich habe gesündigt!“
Eine junge Frau wird verstümmelt aufgefunden – ihre Leiche wurde offensichtlich für ein satanisches Ritual missbraucht. Bei der Autopsie entdeckt Gerichtsmedizinerin Maura Isles, dass die abgetrennte Hand der Toten einer anderen Frau gehört haben muss. Dann stirbt eine Kollegin aus Detective Jane Rizzolis Team, die einen Geschichtsprofessor observiert hatte. Auch ihr Körper ist gezeichnet. Während Jane den undurchsichtigen Professor und die Mitglieder seiner obskuren Stiftung »Mephisto« unter die Lupe nimmt und überall auf eine Mauer des Schweigens trifft, findet Maura an ihrer Haustüre Blutmale …
Rizzoli & Isles – die Bestsellerserie im Überblick!
Band 1: Die Chirurgin
Band 2: Der Meister
Band 3: Todsünde
Band 4: Schwesternmord
Band 5: Scheintod
Band 6: Blutmale
Band 7: Grabkammer
Band 8: Totengrund
Band 9: Grabesstille
Band 10: Abendruh
Band 11: Der Schneeleopard
Band 12: Blutzeuge
Band 13: Mutterherz
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Tess Gerritsen
Blutmale
Ein Rizzoli-&-Isles-Thriller
Deutsch von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »The Mephisto Club« bei Ballantine Books, a division of Random House Inc., New York.
1. AuflageCopyright der Originalausgabe © 2006 by Tess GerritsenCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2006 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Published by Arrangement with Terry Gerritsen Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.Umschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: akg-images, Berlin; Detail aus Palma Giovane: Die Entehrung der Lucretia, um 1570wr · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-03955-4www.blanvalet.de
Für Neil und Mary
»Vertilge alle Seelen, welche der Torheit ergeben sind,und die Nachkommen der Wächter; denn sie haben dieKinder der Menschen unterdrückt.«
Das Buch Henoch, X:18 (2. Jahrhundert v. Chr.)Übersetzt von A. G. Hoffmann
1
Sie sahen aus wie die perfekte Familie.
Der Gedanke drängte sich dem Jungen auf, als er am offenen Grab seines Vaters stand, als er dem Priester zuhörte, wie er Plattitüden aus der Bibel vorlas. Nur eine kleine Gruppe hat sich an diesem warmen, drückenden Junitag versammelt, um Montague Saul die letzte Ehre zu erweisen – nicht mehr als ein Dutzend Menschen. Viele von ihnen hatte der Junge gerade erst kennengelernt. Die letzten sechs Monate hatte er im Internat verbracht, und manche dieser Leute sah er heute zum ersten Mal. Die meisten interessierten ihn nicht im Geringsten.
Nur die Familie seines Onkels – die interessierte ihn sehr wohl. Sie war es wert, dass er sich näher mit ihr beschäftigte.
Dr. Peter Saul hatte große Ähnlichkeit mit seinem verstorbenen Bruder Montague. Er war schlank, ein intellektueller Typ mit einer Brille, die ihm ein eulenhaftes Aussehen verlieh, und schütterem braunem Haar, das irgendwann unweigerlich einer Glatze weichen würde. Seine Frau Amy hatte ein rundes, freundliches Gesicht, und sie warf ihrem fünfzehnjährigen Neffen unentwegt besorgte Blicke zu, als müsse sie sich beherrschen, um ihn nicht auf der Stelle an ihre Brust zu drücken. Teddy, der Sohn der beiden, war zehn Jahre alt, ein Knabe mit streichholzdünnen Armen und Beinen. Ein kleiner Klon von Peter Saul, bis hin zu der runden Gelehrtenbrille.
Und dann war da noch ihre Tochter Lily. Sechzehn Jahre alt.
Ein paar Strähnen hatten sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst und klebten in der schwülen Hitze an ihren Wangen. Sie schien sich unbehaglich zu fühlen in ihrem schwarzen Kleid, und wie ein nervöses Fohlen trat sie immer wieder von einem Fuß auf den anderen, als wollte sie jeden Augenblick davonrennen. Als wäre sie in diesem Moment überall lieber als auf diesem Friedhof, umschwirrt von lästigen Fliegen.
Sie sehen so normal aus, so gewöhnlich, dachte der Junge. So anders als ich. Da fing Lily plötzlich seinen Blick auf, und ein Schauer der Verwunderung überlief ihn. Des gegenseitigen Erkennens. In diesem Augenblick konnte er geradezu spüren, wie ihr Blick die dunkelsten Windungen seines Gehirns durchdrang und all die geheimen Orte erforschte, die niemand sonst je zu sehen bekam. Die er nie einem Menschen offenbart hatte.
Beunruhigt wandte er den Blick ab, richtete ihn auf die anderen Menschen, die um das Grab herumstanden. Die Haushälterin seines Vaters. Den Anwalt. Die beiden Nachbarn. Flüchtige Bekannte, die nur gekommen waren, weil es sich so gehörte, nicht aus wirklicher Zuneigung. Sie hatten Montague Saul nur als den stillen Wissenschaftler gekannt, der vor Kurzem aus Zypern zurückgekehrt war, der sich tagaus, tagein nur mit seinen alten Büchern und Karten und irgendwelchen Tonscherben befasst hatte. In Wirklichkeit hatten sie den Mann gar nicht gekannt. So wenig wie seinen Sohn.
Endlich war die Zeremonie beendet, und die Trauergäste nahmen den Jungen in die Mitte, eine Amöbe aus Mitgefühl, bereit, ihn zu verschlingen. Sie versicherten ihm, wie furchtbar leid es ihnen tue, dass er seinen Vater verloren habe. Und das so bald nach ihrer Rückkehr in die Staaten.
»Immerhin hast du noch deine Familie hier, die dir hilft«, sagte der Geistliche.
Familie? Ja, diese Leute sind wohl meine Familie, dachte der Junge, als der kleine Teddy schüchtern auf ihn zutrat, gedrängt von seiner Mutter.
»Du bist jetzt mein Bruder«, sagte Teddy.
»Tatsächlich?«
»Mom hat dein Zimmer schon fertig vorbereitet. Es ist gleich neben meinem.«
»Aber ich bleibe hier. Im Haus meines Vaters.«
Verwirrt sah Teddy seine Mutter an. »Kommt er denn nicht mit zu uns?«
»Du kannst doch nicht ganz allein wohnen, Schatz«, beeilte sich Amy Saul zu sagen. »Vielleicht gefällt es dir ja in Purity so gut, dass du ganz bei uns bleiben willst.«
»Meine Schule ist in Connecticut.«
»Ja, aber das Schuljahr ist jetzt um. Im September kannst du natürlich wieder auf dein Internat gehen, wenn du das möchtest. Aber den Sommer über wirst du bei uns wohnen.«
»Ich werde hier nicht allein sein. Meine Mutter holt mich zu sich.«
Es war lange Zeit still. Amy und Peter wechselten Blicke, und der Junge konnte erraten, was sie dachten. Seine Mutter hat ihn doch schon vor langer Zeit im Stich gelassen.
»Sie wird mich zu sich holen«, beharrte er.
»Darüber reden wir später, mein Sohn«, sagte Onkel Peter mit sanfter Stimme.
In der Nacht lag der Junge wach in seinem Bett im Reihenhaus seines Vaters und lauschte dem Gemurmel der Stimmen seiner Tante und seines Onkels, die aus dem Arbeitszimmer im Erdgeschoss heraufdrangen. Es war dasselbe Zimmer, in dem Montague Saul sich in den vergangenen Monaten mit der Übersetzung seiner brüchigen alten Papyrusfetzen abgemüht hatte. Dasselbe Zimmer, in dem er vor fünf Tagen einen Schlaganfall erlitten hatte und an seinem Schreibtisch zusammengebrochen war. Diese Leute hatten dort nichts verloren, inmitten der kostbaren Schätze seines Vaters. Sie waren Eindringlinge in seinem Haus.
»Er ist doch noch ein Junge, Peter. Er braucht eine Familie.«
»Wir können ihn ja wohl kaum mit Gewalt nach Purity mitschleifen, wenn er es nicht will.«
»Mit fünfzehn Jahren hat man in diesen Dingen keine Wahl. Die Erwachsenen müssen für einen entscheiden.«
Der Junge stand auf und schlüpfte zur Tür hinaus. Lautlos stieg er bis zur Mitte der Treppe hinunter, um ihre Unterhaltung zu belauschen.
»Und sei mal ehrlich, wie viele Erwachsene hat er denn in seinem Leben kennengelernt? Dein Bruder zählt ja wohl kaum. Er war doch immer viel zu sehr in seine Mumien vertieft, um überhaupt wahrzunehmen, dass da noch ein Kind im Haus war.«
»Das ist nicht fair, Amy. Mein Bruder war ein guter Mensch.«
»Ein guter Mensch, aber weltfremd. Was muss das für eine Frau gewesen sein, die auch nur auf die Idee kommen konnte, ein Kind mit ihm zu haben? Und dann macht sie sich aus dem Staub und lässt Monty den Jungen allein großziehen? Ich begreife nicht, wie eine Frau so etwas tun kann.«
»Monty hat seine Sache ja wohl nicht so schlecht gemacht. Der Junge kriegt in der Schule glänzende Noten.«
»Das ist dein Kriterium für einen guten Vater? Die Tatsache, dass der Junge glänzende Noten bekommt?«
»Und außerdem ist er ein sehr beherrschter junger Mann. Du hast doch gesehen, wie gefasst er bei der Beerdigung war.«
»Er ist starr vor Schock, Peter. Hast du heute auch nur eine einzige Gefühlsregung in seinem Gesicht erkennen können?«
»Monty war ganz genauso.«
»Kaltblütig, meinst du?«
»Nein, ein Intellektueller. Ein Kopfmensch.«
»Aber tief drinnen muss der Junge doch den Schmerz fühlen, das weißt du genau. Ich könnte heulen, wenn ich daran denke, wie sehr ihm seine Mutter in diesem Moment fehlt. Wie er immer wieder steif und fest behauptet, dass sie ihn zu sich nehmen wird, wo wir doch genau wissen, dass sie es nicht tun wird.«
»Das wissen wir doch gar nicht.«
»Wir haben die Frau ja nie kennengelernt! Da schreibt Monty uns eines Tages aus Kairo, dass er jetzt einen kleinen Sohn hat. Nach allem, was wir wissen, könnte er ihn auch aus dem Schilf gefischt haben – wie den kleinen Moses.«
Der Junge hörte die Dielen über sich knarren und blickte sich zum oberen Treppenabsatz um. Zu seinem Erstaunen sah er seine Cousine Lily über das Geländer auf ihn herabstarren. Sie beobachtete ihn, studierte ihn wie eine exotische Kreatur, die sie noch nie zuvor gesehen hatte, als wollte sie herausfinden, ob er gefährlich war.
»Oh«, rief Tante Amy. »Du bist ja auf!«
Seine Tante und sein Onkel waren gerade aus dem Arbeitszimmer gekommen und blickten vom Fuß der Treppe zu ihm auf. Und sie schienen auch ein wenig bestürzt angesichts der Tatsache, dass er wahrscheinlich ihr ganzes Gespräch mitgehört hatte.
»Geht es dir gut, Schatz?«, fragte Amy.
»Ja, Tante.«
»Es ist schon so spät. Solltest du nicht lieber wieder ins Bett gehen?«
Aber er machte keine Anstalten, nach oben zu gehen. Er blieb auf der Treppe stehen und dachte darüber nach, wie es wäre, bei diesen Leuten zu wohnen. Was er von ihnen lernen könnte. Es würde den Sommer interessant machen, bis seine Mutter ihn holen käme.
Er sagte: »Tante Amy, ich habe meinen Entschluss gefasst.«
»Welchen Entschluss?«
»Wo ich den Sommer verbringen will.«
Sie nahm sofort das Schlimmste an. »Bitte überstürze nichts! Wir haben ein wirklich schönes Haus, direkt am See, und du hättest dein eigenes Zimmer. Komm uns doch wenigstens einmal besuchen, ehe du dich endgültig entscheidest.«
»Aber ich habe mich schon entschieden, mit euch zu kommen.«
Seiner Tante verschlug es für einen Augenblick die Sprache. Dann ließ ein Lächeln ihr Gesicht erstrahlen, und sie eilte die Treppe hinauf, um ihn in die Arme zu schließen. Sie roch nach Dove-Seife und Breck-Shampoo. So gewöhnlich, so durchschnittlich. Dann bekam er von seinem grinsenden Onkel Peter einen Klaps auf die Schulter – seine Art, seinen neuen Sohn willkommen zu heißen. Ihr Glück war wie ein Netz aus Zuckerwatte, das ihn in ihre Welt hineinzog, wo alles eitel Sonnenschein, Liebe und Lachen war.
»Die Kinder werden so froh sein, dass du mit uns kommst!«, sagte Amy.
Er warf einen Blick zum oberen Treppenabsatz, aber Lily war verschwunden. Sie hatte sich unbemerkt davongeschlichen. Ich muss ein Auge auf sie haben, dachte er. Denn sie hat schon jetzt ein Auge auf mich.
»Du gehörst jetzt zu unserer Familie«, sagte Amy.
Während sie zusammen die Treppe hinaufstiegen, erzählte sie ihm bereits von ihren Plänen für den Sommer. All die Orte, die sie ihm zeigen würde, all die besonderen Gerichte, die sie für ihn kochen würde, wenn sie wieder zu Hause wären. Sie schien glücklich, ja geradezu freudetrunken, wie eine Mutter mit ihrem neugeborenen Baby.
Amy Saul ahnte nicht, was sie sich da ins Haus zu holen planten.
2
Zwölf Jahre später.
Vielleicht war es ja ein Fehler.
Dr. Maura Isles blieb vor dem Eingang der Kirche Unserer lieben Frau vom Himmlischen Licht stehen, unschlüssig, ob sie eintreten sollte oder nicht. Die Gottesdienstbesucher waren schon hineingegangen, und sie stand allein in der nächtlichen Dunkelheit, wo Schneeflocken lautlos auf ihren unbedeckten Kopf herabrieselten. Durch die geschlossenen Kirchentüren hörte sie die Organistin »Nun freut euch, ihr Christen« anstimmen, und sie wusste, dass inzwischen alle ihre Plätze eingenommen haben mussten. Wenn sie vorhatte, sich ihnen anzuschließen, sollte sie allmählich hineingehen.
Sie zögerte, weil sie nicht wirklich zu den Gläubigen gehörte, die sich dort drinnen zur Messe versammelt hatten. Doch die Musik lockte sie, wie auch die Aussicht auf die Wärme und auf den Trost vertrauter Rituale. Hier draußen auf der dunklen Straße stand sie allein. Allein an Heiligabend.
Sie stieg die Stufen hinauf und betrat das Gebäude.
Trotz der späten Stunde waren die Bänke voll besetzt mit Familien, die Kinder schlaftrunken, aus den Betten geholt, um an der Mitternachtsmesse teilzunehmen. Mit ihrem verspäteten Eintreffen zog Maura mehrere Blicke auf sich, und als die Klänge von »Nun freut euch, ihr Christen« verhallten, schlüpfte sie rasch auf den ersten freien Platz, den sie finden konnte, in einer der hinteren Reihen. Gleich darauf musste sie sich mit der ganzen Gemeinde wieder erheben, als der Einzugsgesang einsetzte. Pater Daniel Brophy trat an den Altar und bekreuzigte sich.
»Die Gnade und der Friede unseres Vaters im Himmel und unseres Herrn Jesus Christus sei allezeit mit euch«, sagte er.
»Und mit deinem Geiste«, murmelte Maura im Chor mit der Gemeinde. Selbst nach all den Jahren, die sie der Kirche ferngeblieben war, kamen ihr die Antworten immer noch ganz natürlich über die Lippen, durch all die Sonntage ihrer Kindheit tief in ihr Gedächtnis eingeprägt. »Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.«
Daniel hatte ihr Kommen nicht bemerkt, doch Maura war nur auf ihn fixiert. Auf sein dunkles Haar, seine anmutigen Gesten, seine wohlklingende Baritonstimme. Heute Nacht konnte sie ihn ohne Scham ansehen, ohne Verlegenheit. Heute Nacht konnte sie ihn gefahrlos anstarren.
»Gib uns die ewige Seligkeit im Himmelreich, wo er mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit, amen.«
Maura ließ sich auf die Bank niedersinken, hörte ringsum gedämpftes Husten, das Wimmern müder Kinder. Auf dem Altar flackerten Kerzen, ein Symbol für Licht und Hoffnung in dieser Winternacht.
Daniel begann zu lesen: »Und der Engel sprach zu ihnen: ›Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird …‹«
Das Lukasevangelium, dachte Maura, die den Text sogleich erkannte. Lukas, der Arzt.
»›Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln …‹« Er hielt inne, als sein Blick plötzlich Maura streifte. Und sie dachte: Bist du so überrascht, mich heute Nacht hier zu sehen, Daniel?
Er räusperte sich, blickte auf seinen Text hinunter und las weiter: »›Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.‹«
Obwohl er nun wusste, dass sie inmitten seiner Schäflein saß, mied er jeden weiteren Blickkontakt mit ihr. Weder während des »Cantate Domino« und des »Dies Sanctificatus« noch während der Kollekte oder der Eucharistiefeier. Während die anderen Gottesdienstbesucher um sie herum sich erhoben und sich im Mittelgang anstellten, um die Kommunion zu empfangen, blieb Maura auf ihrem Platz sitzen. Wenn man nicht an Gott glaubte, war es Heuchelei, die Hostie zu sich zu nehmen und vom Messwein zu trinken.
Was tue ich dann eigentlich hier?
Dennoch blieb sie bis zum Ende auf ihrem Platz sitzen, wartete den Schlusssegen und die Entlassung ab.
»Gehet hin in Frieden!«
»Dank sei Gott dem Herrn!«, antwortete die Gemeinde.
Die Messe war beendet, und die Menschen begannen, zum Ausgang zu schlurfen, während sie ihre Mäntel zuknöpften und die Handschuhe anzogen. Auch Maura erhob sich und trat gerade in den Mittelgang, als sie aus dem Augenwinkel sah, wie Daniel sie auf sich aufmerksam zu machen versuchte, wie er sie mit stummen Gesten anflehte, nicht zu gehen. Sie setzte sich wieder, spürte die neugierigen Blicke der Leute, die an ihrer Bank vorbeikamen. Sie wusste, was sie sahen, oder was sie zu sehen glaubten: eine einsame Frau, begierig nach den tröstenden Worten eines Geistlichen am Heiligen Abend.
Oder sahen sie etwa mehr?
Sie erwiderte die Blicke nicht. Während die Kirche sich leerte, blickte sie starr geradeaus, fixierte mit unbewegter Miene den Altar. Und dachte dabei: Es ist spät, und ich sollte nach Hause gehen. Ich weiß nicht, was es bringen soll, noch länger hierzubleiben.
»Hallo, Maura.«
Sie blickte auf und sah Daniel in die Augen. Die Kirche war noch immer nicht ganz leer. Die Organistin packte ihre Noten zusammen, und einige der Chorsänger zogen sich noch die Mäntel an, doch in diesem Moment war Daniels Aufmerksamkeit so auf Maura konzentriert, dass sie ebenso gut der einzige Mensch weit und breit hätte sein können.
»Es ist lange her, dass Sie zuletzt hier waren«, sagte er.
»Das stimmt wohl.«
»Das letzte Mal war im August, nicht wahr?«
Du hast es dir also auch gemerkt.
Er setzte sich zu ihr auf die Bank. »Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen.«
»Es ist schließlich Heiligabend.«
»Aber Sie sind doch nicht gläubig.«
»Trotzdem habe ich meine Freude an den Riten. An den Liedern.«
»Das ist der einzige Grund, weshalb Sie gekommen sind? Um ein paar Weihnachtslieder zu singen? Um ein paar Mal Amen und Dank sei Gott dem Herrn zu sagen?«
»Ich wollte ein wenig Musik hören. Und unter Menschen sein.«
»Erzählen Sie mir nicht, dass Sie heute Abend ganz allein sind.«
Sie zuckte mit den Schultern und lachte. »Sie kennen mich doch, Daniel. Ich bin nicht gerade der gesellige Typ.«
»Ich dachte nur … Ich meine, ich hatte angenommen …«
»Was?«
»Dass Sie mit jemandem zusammen sein würden. Gerade heute Nacht.«
Das bin ich auch. Ich bin mit dir zusammen.
Sie verstummten beide, als die Organistin mit ihrer prall gefüllten Notentasche den Mittelgang herunterkam. »Gute Nacht, Pater Brophy.«
»Gute Nacht, Mrs. Easton. Und vielen Dank, Sie haben wieder mal wunderbar gespielt!«
»Es war mir ein Vergnügen.« Die Organistin warf Maura noch einen letzten prüfenden Blick zu und ging dann weiter in Richtung Ausgang. Sie hörten, wie die Tür zufiel, und dann waren sie endlich allein.
»Also, warum hat es so lange gedauert?«, fragte er.
»Nun ja, Sie wissen ja, wie das ist in unserer Branche – gestorben wird immer. Einer unserer Rechtsmediziner musste vor ein paar Wochen wegen einer Rückenoperation ins Krankenhaus, und wir mussten für ihn einspringen. Ich hatte alle Hände voll zu tun, das ist alles.«
»Sie hätten trotzdem mal zum Hörer greifen und einfach anrufen können.«
»Ja, ich weiß.« Das galt auch für ihn, aber getan hatte er es nie. Daniel Brophy würde nie auch nur einen Schritt vom rechten Pfad abweichen, und das war vielleicht auch ganz gut so – es genügte, dass sie selbst ständig gegen die Versuchung ankämpfen musste.
»Und was hat sich bei Ihnen so getan?«, fragte sie.
»Sie wissen, dass Pater Roy letzten Monat einen Schlaganfall hatte? Ich habe seine Aufgaben als Polizeigeistlicher übernommen.«
»Detective Rizzoli hat es mir erzählt.«
»Ich war vor einigen Wochen an diesem Tatort in Dorchester. Sie wissen schon – der Polizeibeamte, der erschossen wurde. Ich habe Sie dort gesehen.«
»Ich habe Sie aber nicht gesehen. Sie hätten doch hallo sagen können.«
»Na ja, Sie waren so beschäftigt. Voll konzentriert, wie üblich.« Er lächelte. »Sie können ganz schön grimmig dreinschauen, Maura. Wussten Sie das?«
Sie lachte. »Vielleicht ist das mein Problem.«
»Ihr Problem?«
»Dass ich die Männer abschrecke.«
»Mich haben Sie nicht abgeschreckt.«
Wie könnte ich auch?, dachte sie. Dein Herz kann niemand brechen, weil du es nicht herschenken darfst. Sie sah demonstrativ auf ihre Uhr und stand auf. »Es ist sehr spät, und ich habe schon viel zu viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen.«
»Es ist ja nicht so, als hätte ich irgendetwas Dringendes zu erledigen«, sagte er, als er sie zum Ausgang begleitete.
»Sie sind Seelsorger für eine ganze Gemeinde. Und es ist schließlich Heiligabend.«
»Wie Sie sicherlich bemerkt haben, habe auch ich heute Nacht nichts Besseres vor.«
Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. Da standen sie nun allein in der Kirche, atmeten den Duft von Kerzenwachs und Weihrauch ein, vertraute Gerüche, die ihr die Weihnachtsfeste, die Mitternachtsmessen ihrer Kindheit in Erinnerung riefen. Die Tage, als der Besuch einer Kirche noch nicht dieses Gefühlschaos auslösen konnte, das sie jetzt empfand. »Gute Nacht, Daniel«, sagte sie und wandte sich zur Tür.
»Wird es erneut vier Monate dauern, bis wir uns wiedersehen?«, rief er ihr nach.
»Ich weiß es nicht.«
»Unsere Gespräche haben mir gefehlt, Maura.«
Wieder zögerte sie, die Hand schon erhoben, um die Tür aufzudrücken. »Mir haben sie auch gefehlt. Vielleicht sollten wir gerade deswegen in Zukunft darauf verzichten.«
»Es gibt nichts, wofür wir uns schämen müssten.«
»Noch nicht«, sagte sie leise, den Blick nicht auf ihn gerichtet, sondern auf die schwere, geschnitzte Tür, die zwischen ihr und dem Entrinnen stand.
»Maura, lassen Sie uns nicht so auseinandergehen. Es gibt keinen Grund, weshalb wir nicht weiterhin …«
Ihr Handy klingelte.
Sie angelte es aus ihrer Handtasche. Um diese nächtliche Stunde konnte ein läutendes Telefon nichts Gutes bedeuten. Während sie den Anruf annahm, spürte sie, wie Daniel sie ansah, und sie war sich ihrer eigenen nervösen Reaktion auf seinen Blick vollauf bewusst.
»Dr. Isles«, meldete sie sich. Ihre Stimme klang unnatürlich kühl.
»Frohe Weihnachten«, sagte Detective Jane Rizzoli. »Wundert mich, dass du um diese Zeit nicht zu Hause bist. Da hab ich’s nämlich zuerst versucht.«
»Ich bin in die Mitternachtsmesse gegangen.«
»Echt? Aber es ist doch schon eins! Ist die Messe denn noch nicht aus?«
»Doch, Jane. Die Messe ist aus, und ich wollte gerade gehen«, antwortete Maura in einem Ton, der alle weiteren Fragen unterband. »Was liegt an?«, fragte sie, denn ihr war längst klar, dass Jane ihr nicht bloß frohe Weihnachten wünschen wollte, sondern einen dienstlichen Grund für ihren Anruf haben musste.
»Die Adresse ist Prescott Street 210, East Boston. Ein Wohnhaus. Frost und ich sind vor etwa einer halben Stunde hier eingetroffen.«
»Einzelheiten?«
»Ein Todesopfer – eine junge Frau.«
»Ein Mord?«
»Allerdings.«
»Du scheinst dir sehr sicher zu sein.«
»Das wirst du verstehen, wenn du erst mal hier bist.«
Maura beendete das Gespräch und bemerkte, dass Daniel sie immer noch ansah. Aber der Augenblick für Wagnisse, für Worte, die sie beide vielleicht hinterher bereuen würden, war vorbei. Der Tod war ihnen dazwischengekommen.
»Sie müssen zu einem Einsatz?«
»Ich habe heute Nacht Bereitschaft.« Sie verstaute das Handy wieder in ihrer Tasche. »Ich habe hier in der Stadt keine Familie, deswegen habe ich mich freiwillig gemeldet.«
»Ausgerechnet in dieser Nacht?«
»Die Tatsache, dass heute Weihnachten ist, macht für mich keinen Unterschied.«
Sie knöpfte ihren Mantelkragen zu und trat aus der Kirche hinaus in die Nacht. Er folgte ihr nach draußen und sah ihr von der Treppe aus nach, als sie durch den Neuschnee zu ihrem Wagen ging. Sein weißes Messgewand flatterte im Wind, und als sie sich umdrehte, sah sie, wie er die Hand hob, um ihr zum Abschied zuzuwinken.
Er winkte immer noch, als sie davonfuhr.
3
Die pulsierenden blauen Lichter dreier Streifenwagen durchbrachen das filigrane Muster des fallenden Schnees und ließen alle, die sich diesem Ort näherten, wissen, dass hier etwas passiert war. Etwas Schreckliches. Maura merkte, wie die vordere Stoßstange ihres Lexus über Eis schrammte, als sie ihn möglichst dicht an dem aufgeschichteten Schneewall parkte, um Platz für andere Fahrzeuge zu lassen. Um diese Stunde, am frühen Weihnachtsmorgen, würden die einzigen Fahrzeuge, die sich durch diese schmale Straße zwängten, wie ihres zum Gefolge des Todes gehören. Sie nahm sich einen Moment Zeit, um sich für die anstrengenden Stunden zu wappnen, die ihr bevorstanden. Ihre müden Augen waren wie hypnotisiert von all den flackernden Lichtern, ihre Arme und Beine fühlten sich taub an, und das Blut in ihren Adern schien wie träger Schlamm zu fließen. Wach auf!, dachte sie. Die Arbeit ruft.
Sie stieg aus, und der Schwall eisiger Luft, der sie erfasste, riss sie aus ihrer Schläfrigkeit. Sie stapfte durch den frischen Pulverschnee, der wie weiße Federn vor ihren Stiefeln aufstob. Obwohl es schon halb zwei war, brannte in einigen der bescheidenen Einfamilienhäuser in der Nachbarschaft noch Licht, und durch ein Fenster, das mit Schablonenbildern von fliegenden Rentieren und Weihnachtssternen geschmückt war, sah sie die Silhouette eines neugierigen Anwohners, der aus seinem warmen Haus in die Nacht hinausstarrte – eine Nacht, die nun nicht mehr still, nicht mehr heilig war.
»Hallo, Dr. Isles?«, rief ein Streifenpolizist, ein älterer Cop, der ihr irgendwie bekannt vorkam. Er selbst wusste offenbar ganz genau, wer sie war. Sie wussten alle, wer sie war. »Wie kommt’s, dass es ausgerechnet Sie heute Nacht erwischt hat?«
»Dasselbe könnte ich Sie fragen, Officer.«
»Tja, wir haben wohl beide den Kürzeren gezogen.« Er lachte auf. »Na, dann fröhliche Weihnachten.«
»Ist Detective Rizzoli drin?«
»Ja, sie und Frost haben den Tatort gefilmt.« Er deutete auf ein Haus, in dem alle Lichter brannten, einen kastenförmigen kleinen Bau, eingezwängt zwischen mehrere ältere, leicht heruntergekommene Wohnhäuser. »Inzwischen dürften sie wohl fertig sein und nur noch auf Sie warten.«
Plötzlich hörte sie jemanden heftig würgen. Sie blickte sich zur Straße um und sah eine blonde Frau, die gebückt dastand und ihren langen Mantel raffte, um den Saum nicht zu bekleckern, während sie sich in den Schnee erbrach.
Der Streifenpolizist schnaubte verächtlich. »Was die da im Morddezernat verloren hat, ist mir schleierhaft«, raunte er Maura zu. »Kam angerauscht, als wäre das hier ’ne Folge von Cagney und Lacey. Hat uns alle rumkommandiert. Die knallharte Ermittlerin. Dann geht sie rein, wirft einen Blick auf den Tatort, und im nächsten Moment kommt sie schon wieder rausgerannt und reihert in den Schnee.« Er lachte.
»Ich habe sie noch nie gesehen. Sie ist beim Morddezernat?«
»Wie ich höre, hat sie gerade erst vom Drogen- und Sittendezernat gewechselt. Der Commissioner und seine geniale Idee, den Frauenanteil zu erhöhen. Die wird sich nicht lange halten, wenn Sie mich fragen.«
Die Kriminalbeamtin wischte sich den Mund ab und wankte mit unsicheren Schritten zur Verandatreppe, wo sie auf die Stufen niedersank.
»Hey – Detective!«, rief der Streifenbeamte. »Wollen Sie nicht vielleicht ein bisschen Abstand zum Tatort halten? Wenn Sie noch mal kotzen müssen, dann machen Sie’s wenigstens irgendwo, wo keine Spuren gesichert werden müssen.«
Ein jüngerer Polizist, der in der Nähe stand, kicherte in sich hinein.
Die blonde Kriminalbeamtin sprang sofort wieder auf, und im grellen, pulsierenden Schein des Blaulichts war ihre beschämte Miene zu erkennen. »Ich glaube, ich setze mich mal kurz in meinen Wagen«, murmelte sie.
»Ja, tun Sie das, Ma’am.«
Maura sah zu, wie die Frau sich in den Schutz ihres Fahrzeugs zurückzog. Welche Gräuel erwarteten sie in diesem Haus?
»Doc«, rief Detective Barry Frost ihr zu. Er war gerade aus dem Haus gekommen und stand auf der Veranda, in eine Windjacke gehüllt, den Kopf eingezogen. Seine blonden Haare standen in Büscheln ab, als hätte er sich gerade erst aus dem Bett gewälzt. Er hatte schon immer einen recht fahlen Teint gehabt, aber im gelblichen Schein der Außenbeleuchtung sah er noch kränklicher aus als sonst.
»Ist wohl ziemlich übel da drin, wie?«, meinte sie.
»Nicht gerade ein Anblick, den man sich an Weihnachten freiwillig antun würde. Ich dachte mir, ich geh lieber mal kurz vor die Tür und schnappe ein bisschen frische Luft.«
Sie blieb am Fuß der Treppe stehen, als sie das Gewirr von Schuhspuren auf der schneebedeckten Veranda bemerkte. »Ist es okay, wenn ich hier durchgehe?«
»Klar. Die Abdrücke stammen alle von unseren Leuten.«
»Was ist mit Fußspuren des Täters?«
»Hier draußen haben wir nicht viel gefunden.«
»Wie denn – ist er etwa durchs Fenster reingeflogen?«
»Sieht aus, als hätte er hinter sich hergefegt. Man kann hier und da noch die Wischspuren erkennen.«
Sie runzelte die Stirn. »Offenbar ein Täter, der auf jedes Detail achtet.«
»Warten Sie ab, bis Sie sich da drin umgesehen haben.«
Sie stieg die Stufen hinauf. Auf der Veranda legte sie Schuhüberzieher und Latexhandschuhe an. Aus der Nähe betrachtet sah Frost noch übler aus; sein Gesicht wirkte eingefallen und blutleer. Doch dann holte er tief Luft. »Ich kann mit Ihnen reingehen«, erbot er sich tapfer.
»Nein, lassen Sie sich ruhig noch ein bisschen Zeit. Rizzoli kann mich herumführen.«
Er nickte, doch er sah sie dabei nicht an, sondern starrte auf die Straße hinaus, mit der verbissenen Konzentration eines Mannes, der sich alle Mühe gibt, sein Abendessen bei sich zu behalten. Sie überließ ihn seinem Kampf gegen die Übelkeit und griff nach dem Türknauf, auf das Schlimmste gefasst. Erst vor wenigen Augenblicken war sie völlig erschöpft hier angekommen, hatte sich schütteln müssen, um wach zu werden; jetzt aber spürte sie, wie ihre Nerven vor Spannung kribbelten, als stünde sie unter Strom.
Sie betrat das Haus. Drinnen blieb sie mit pochendem Herzen stehen und sah sich um. Der Anblick hatte absolut nichts Erschreckendes. Die Diele war mit Eichenparkett ausgelegt, das abgetreten aussah. Durch die Zwischentür konnte sie ins Wohnzimmer sehen, das mit billigen Möbeln eingerichtet war, die nicht zueinander passten: ein durchgesessenes Futonsofa, ein Knautschsessel, ein Bücherregal, zusammengeschustert aus Sperrholzbrettern und Hohlblocksteinen. Bis jetzt hatte sie noch nichts gesehen, was nach dem Tatort eines Gewaltverbrechens aussah. Das Schlimmste stand ihr noch bevor – sie wusste, dass es in diesem Haus auf sie wartete, denn sie hatte es in Barry Frosts Augen gespiegelt gesehen, und im aschfahlen Gesicht der Kriminalbeamtin.
Durch das Wohnzimmer gelangte sie ins Esszimmer, wo sie einen Kiefernholztisch mit vier Stühlen erblickte. Doch es waren nicht die Möbel, die ihre Aufmerksamkeit fesselten, sondern die vier Gedecke, die auf dem Tisch arrangiert waren wie für eine Familienmahlzeit. Ein Abendessen für vier Personen.
Über einen der Teller war eine Leinenserviette gebreitet. Der Stoff war mit Blut bespritzt.
Vorsichtig ergriff sie eine Ecke der Serviette mit Zeigefinger und Daumen und hob sie an. Als sie sah, was auf dem Teller lag, prallte sie entsetzt zurück und rang nach Luft.
»Wie ich sehe, hast du die linke Hand gefunden«, sagte eine Stimme.
Maura fuhr herum. »Du hast mir einen tierischen Schrecken eingejagt.«
»Willst du dich mal so richtig gruseln?«, fragte Detective Jane Rizzoli. »Dann komm mit.« Sie machte kehrt und führte Maura durch einen Flur. Genau wie Frost sah Jane aus, als wäre sie gerade erst aus dem Bett gekrochen. Ihre Hose war zerknittert, ihr dunkles Haar ein krauses Lockengewirr. Doch im Gegensatz zu Frost schritt sie furchtlos aus, mit ihren Papierüberziehern an den Schuhen, die raschelnd über den Boden schleiften. Von allen Detectives, die regelmäßig in Mauras Sektionssaal zu Gast waren, war Jane diejenige, die sich am ehesten ganz nach vorn an den Tisch drängte und den Hals reckte, um besser sehen zu können. Und auch jetzt zeigte sie keine Spur von Unschlüssigkeit, als sie den Flur entlangmarschierte. Es war Maura, die zurückblieb, den Blick auf die Blutstropfen auf dem Fußboden gerichtet.
»Bleib auf dieser Seite«, sagte Jane. »Wir haben hier ein paar undeutliche Fußabdrücke, die in beide Richtungen gehen. Eine Art Sportschuh. Sie sind inzwischen einigermaßen trocken, aber ich möchte nichts verwischen.«
»Wer hat den Vorfall gemeldet?«
»Es war ein Notruf. Kam kurz nach Mitternacht rein.«
»Von wo kam der Anruf?«
»Aus diesem Haus.«
Maura runzelte die Stirn. »Das Opfer? Hat sie noch versucht, Hilfe zu holen?«
»Es war keine Stimme zu hören. Jemand hat einfach nur den Notruf gewählt und dann den Hörer neben das Telefon gelegt. Die erste Streife war zehn Minuten nach dem Anruf hier. Der Cop fand die Tür unverschlossen, ging durch bis ins Schlafzimmer und wäre fast aus den Latschen gekippt.« Jane blieb vor einer Tür stehen und wandte sich zu Maura um. Ein warnender Blick. »Hier wird’s so richtig heftig.«
Die abgetrennte Hand war schon schlimm genug.
Jane trat zur Seite, um Maura einen Blick ins Schlafzimmer werfen zu lassen. Sie konnte das Opfer nirgends entdecken; das Blut war alles, was sie sah. Der menschliche Körper enthält im Durchschnitt fünf Liter davon. Die gleiche Menge roter Farbe reicht aus, um ein kleines Zimmer bis in den letzten Winkel einzufärben. Genau dieses Bild bot sich Mauras fassungslosem Blick dar, als sie durch die offene Tür starrte. Es sah aus, als hätten übermütige Hände das ganze Zimmer mit leuchtend roten Luftschlangen übersät, die weißen Wände, die Möbel, die Bettwäsche.
»Arterielles Blut«, sagte Rizzoli.
Maura konnte nur stumm nicken, während ihr Blick den bogenförmigen Blutspritzern folgte, während sie die Horrorgeschichte las, die in Rot an diese Wände geschrieben war. Als Medizinstudentin im vierten Jahr hatte sie während ihrer Famulatur in der Notaufnahme einmal mit angesehen, wie das Opfer einer Schießerei auf dem OP-Tisch verblutet war. Als der Blutdruck des Patienten rapide gefallen war, hatte der Assistenzarzt der Chirurgie in seiner Verzweiflung eine Notfall-Laparotomie durchgeführt, in der Hoffnung, die inneren Blutungen stillen zu können. Er hatte den Bauch des Patienten aufgeschnitten, worauf eine Blutfontäne aus der zerrissenen Aorta geschossen war, die Kittel und Gesichter der Ärzte bespritzt hatte. In den letzten chaotischen Sekunden, während sie hektisch absaugten und sterile Tücher in die Bauchhöhle stopften, war das Einzige, worauf Maura sich noch konzentrieren konnte, das viele Blut. Sein glänzender Schimmer, sein fleischartiger Geruch. Sie hatte in das offene Abdomen gegriffen, um einen Retraktor zu fassen, und die warme Flüssigkeit, die die Ärmel ihres Kittels tränkte, hatte sich angefühlt wie ein handwarmes Vollbad. An diesem Tag im OP hatte Maura gesehen, welch schockierende Blutfontänen selbst ein schwacher arterieller Druck auslösen konnte.
Jetzt, als sie die Wände des Schlafzimmers betrachtete, war es wieder das Blut, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zog, das die Geschichte der letzten Sekunden im Leben des Opfers erzählte. Als der erste Schnitt geführt wurde, hat das Herz des Opfers noch geschlagen; es hat noch einen Blutdruck erzeugt. Dort über dem Bett war die erste Fontäne in hohem Bogen an die Wand gespritzt, wie aus einem Maschinengewehr abgefeuert. Nach einigen wenigen kräftigen Spritzern wurden die Ausschläge schwächer. Der Organismus hatte versucht, den fallenden Druck auszugleichen; die Arterien hatten sich verengt, die Pulsfrequenz zugenommen. Doch mit jedem Herzschlag laugte der Körper sich selbst noch weiter aus, beschleunigte sein eigenes Ende. Wenn dann am Ende der Druck ganz abfiel und das Herz stillstand, spritzte das Blut nicht mehr aus den Wunden, sondern versiegte zu einem schwachen Rinnsal. Dies war der Tod, den Maura an diesen Wänden, auf diesem Bett dokumentiert sah.
Dann hielt sie inne, und ihr Blick blieb an einem Detail haften, das sie inmitten all der Blutspritzer zunächst übersehen hatte. Ein Detail, bei dessen Anblick die feinen Härchen in ihrem Nacken sich schlagartig aufrichteten. An eine Wand waren mit Blut drei Kreuze gemalt, die auf dem Kopf standen. Und darunter eine Reihe kryptischer Symbole.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Maura leise.
»Wir haben keine Ahnung. Wir haben uns auch schon den Kopf darüber zerbrochen.«
Maura konnte den Blick nicht von dem Schriftzug wenden. Sie schluckte. »Verdammt, womit haben wir es hier eigentlich zu tun?«
»Wart nur ab, bis du den Rest gesehen hast.« Jane ging um das Bett herum und deutete auf den Boden. »Das Opfer liegt hier. Jedenfalls der größte Teil von ihm.«
Erst als Maura Jane auf die andere Seite des Bettes folgte, konnte sie die Frau sehen. Sie war nackt und lag auf dem Rücken. Durch das Ausbluten hatte ihre Haut die Farbe von Alabaster angenommen, und Maura fühlte sich plötzlich an ihren Besuch im British Museum erinnert, an einen Raum mit Dutzenden von Fragmenten römischer Statuen. Im Lauf der Jahrhunderte hatte der Marmor Risse bekommen, Köpfe waren abgebrochen, Arme abgefallen, bis nur noch anonyme Torsos übrig waren. Und das war es, was sie jetzt sah, als sie auf die Leiche hinabblickte. Eine zerbrochene Venus. Ohne Kopf.
»Sieht aus, als hätte er sie hier auf dem Bett getötet«, sagte Jane. »Das würde die Spritzer an der Wand dort erklären, und das ganze Blut auf der Matratze. Danach hat er sie auf den Boden gezerrt, vielleicht, weil er eine feste Unterlage brauchte, um sie zu zerlegen.« Jane atmete tief ein und wandte sich ab, als sei sie plötzlich an ihre Grenze gestoßen, als könne sie den Anblick der Leiche nicht länger ertragen.
»Du sagst, es hat nach dem Notruf zehn Minuten gedauert, bis die Streife hier war«, sagte Maura.
»Ja, richtig.«
»Was hier passiert ist – diese Amputationen, das Abschneiden des Kopfes –, das muss mehr als zehn Minuten in Anspruch genommen haben.«
»Das ist uns auch klar. Ich glaube nicht, dass es das Opfer war, das die Notrufnummer gewählt hat.«
Das Geräusch einer knarrenden Diele ließ sie beide herumfahren, und sie sahen Barry Frost in der Tür stehen. Er schien nicht allzu erpicht darauf, zu ihnen ins Zimmer zu kommen.
»Die Spurensicherung ist da«, sagte er.
»Sag ihnen, sie können reinkommen.« Jane machte eine Pause. »Du siehst nicht gerade aus wie das blühende Leben.«
»Ich denke, ich halte mich noch ganz gut. Unter den Umständen.«
»Wie geht’s Kassowitz? Hat sie sich ausgekotzt? Wir könnten hier ein wenig Hilfe gebrauchen.«
Frost schüttelte den Kopf. »Sie sitzt noch in ihrem Wagen. Ich glaube kaum, dass ihr Magen schon für das hier bereit ist. Ich hole die Spusis.«
»Sag ihr, sie soll sich mal ein bisschen zusammenreißen!«, rief Jane ihm nach, als er schon wieder verschwunden war. »Ich hasse es, wenn eine Frau mich so enttäuscht. Damit bringt sie unser ganzes Geschlecht in Verruf.«
Mauras Blick ging zurück zu der verstümmelten Leiche auf dem Boden. »Habt ihr auch …«
»Den Rest von ihr gefunden?«, vollendete Jane den Satz. »Ja. Die linke Hand hast du ja schon gesehen. Der rechte Arm liegt in der Badewanne. Und jetzt wird’s allmählich Zeit, dass ich dir die Küche zeige.«
»Was gibt es da zu sehen?«
»Noch mehr Überraschungen.« Jane setzte sich in Richtung Flur in Bewegung.
Als Maura sich umdrehte, um ihr zu folgen, erblickte sie plötzlich ihr Bild im Schlafzimmerspiegel. Es starrte sie mit müden Augen an, das schwarze Haar strähnig und feucht von geschmolzenem Schnee. Aber es war nicht der Anblick ihres eigenen Gesichts, der sie erstarren ließ. »Jane«, flüsterte sie. »Sieh dir das an.«
»Was?«
»Im Spiegel. Diese Symbole.« Maura drehte sich um und starrte die Schrift an der Wand an. »Siehst du das? Das ist Spiegelschrift! Das sind keine Symbole, das sind Buchstaben, die man nur rückwärts lesen muss.«
Janes Blick ging zuerst zur Wand und dann zum Spiegel. »Ist das ein Wort?«
»Ja. Es heißt Peccavi.«
Jane schüttelte den Kopf. »Vorwärts oder rückwärts, mir sagt das immer noch nichts.«
»Es ist Latein, Jane.«
»Und was heißt es?«
»Ich habe gesündigt.«
Einen Augenblick lang starrten die beiden Frauen einander nur an. Dann lachte Jane unvermittelt auf. »Also, das ist ja vielleicht eine bizarre Beichte. Glaubt der Typ vielleicht, dass ein paar ›Ave Maria‹ seine ›Sünde‹ aus der Welt schaffen können?«
»Vielleicht bezieht das Wort sich ja nicht auf den Mörder. Sondern auf das Opfer.« Sie sah Jane an. »Ich habe gesündigt.«
»Eine Strafe«, sagte Jane. »Ein Racheakt.«
»Es ist ein denkbares Motiv. Sie hat irgendetwas getan, womit sie den Täter verärgert hat. Sie hat sich gegen ihn versündigt. Und das ist seine Vergeltung.«
Jane atmete tief durch. »Gehen wir in die Küche.« Sie führte Maura den Flur entlang. An der Küchentür blieb sie stehen und sah Maura an, die auf der Schwelle verharrte, zu geschockt von dem, was sie sah, um auch nur ein Wort hervorzubringen.
Auf den Fliesenboden war mit einer Art Kreide ein großer roter Kreis gezeichnet. Er war umringt von fünf schwarzen Klecksen – Wachs, das geschmolzen und anschließend erstarrt war. Kerzen, dachte Maura. In der Mitte des Kreises – so platziert, dass die Augen sie anstarrten – lag der abgetrennte Kopf einer Frau.
Ein Kreis. Fünf schwarze Kerzen. Ein Opferritual.
»Und jetzt soll ich also wieder nach Hause zu meinem kleinen Töchterchen gehen«, meinte Jane. »Morgen früh werden wir alle um den Weihnachtsbaum herumsitzen, unsere Geschenke auspacken und so tun, als ob Frieden auf Erden herrscht. Aber ich werde die ganze Zeit an … dieses Ding denken müssen … wie es mich anstarrt. Fröhliche Weihnachten – pah.«
Maura schluckte. »Wissen wir, wer sie ist?«
»Na ja, ich habe darauf verzichtet, ihre Freunde und Nachbarn ranzuschleppen, um mir ihre Identität zweifelsfrei bestätigen zu lassen. Sagen Sie, kommt Ihnen der Kopf da auf dem Küchenboden zufällig bekannt vor? Aber aufgrund des Führerscheinfotos neige ich zu der Annahme, dass es sich um Lori-Ann Tucker handelt. Achtundzwanzig Jahre alt. Braunes Haar, braune Augen.« Jane lachte plötzlich auf. »Dürfte hinkommen, wenn man die ganzen Einzelteile zusammensetzt.«
»Was weißt du über sie?«
»In ihrer Handtasche haben wir den Coupon eines Gehaltsschecks gefunden. Sie hat drüben im Naturwissenschaftlichen Museum gearbeitet. Wir wissen nicht, als was, aber nach dem Haus und den Möbeln zu urteilen« – Jane warf einen Blick in Richtung Esszimmer – »hat sie nicht gerade zu den Großverdienern gehört.«
Sie hörten Stimmen, knarrende Schritte – die Kriminaltechniker waren da. Sofort richtete Jane sich kerzengerade auf, um den Neuankömmlingen wenigstens äußerlich mit ihrer gewohnten Selbstsicherheit entgegenzutreten. Die furchtlose Detective Rizzoli, die sie alle kannten.
»Hallo, Jungs«, sagte sie, als Frost mit zwei Männern der Spurensicherung die Küche betrat. »Eine schöne Bescherung, was?«
»Mein Gott«, murmelte einer der beiden. »Wo ist denn der Rest des Opfers?«
»Über mehrere Räume verteilt. Vielleicht fangt ihr am besten im …« Sie verstummte und spannte schlagartig alle Muskeln an.
Das Telefon auf dem Küchentresen klingelte.
Frost stand am nächsten dran. »Was denkst du?«, fragte er und sah Rizzoli an.
»Geh ran.«
Vorsichtig nahm Frost mit seiner behandschuhten Hand den Hörer ab. »Hallo? Hallo?« Nach einigen Sekunden hängte er ihn wieder ein. »Aufgelegt.«
»Was sagt die Anruferkennung?«
Frost drückte auf den Knopf, um sich die Liste der eingegangenen Anrufe anzeigen zu lassen. »Es ist eine Bostoner Nummer.«
Jane zog ihr Handy aus der Tasche und sah sich die Nummer auf dem Display an. »Ich versuche mal zurückzurufen«, sagte sie und wählte. Schweigend stand sie da und lauschte. »Es geht niemand ran.«
»Ich will mal nachsehen, ob diese Nummer schon einmal angerufen wurde«, sagte Frost. Er tippte sich durch die Liste der eingegangenen Anrufe und der gewählten Nummern. »Okay, hier haben wir den Notruf. Das war um 0:10 Uhr.«
»Unser Täter, der auf sein Werk aufmerksam machen wollte.«
»Und dann ist da noch ein Anruf, kurz vor dem Notruf. Eine Nummer in Cambridge.« Er blickte auf. »0:05 Uhr.«
»Hat unser Täter zweimal von diesem Apparat aus angerufen?«
»Wenn es der Täter war.«
Jane starrte das Telefon an. »Denken wir doch mal scharf nach. Er steht hier in der Küche. Er hat sie gerade umgebracht und zerstückelt. Hat ihr die Hand abgeschnitten, den Arm. Und ihren Kopf hier auf dem Boden platziert. Wieso sollte er da jemanden anrufen? Um mit seiner Tat zu prahlen? Und wen kann er angerufen haben?«
»Finde es heraus«, sagte Maura.
Wieder benutzte Jane ihr Handy; diesmal, um die Nummer in Cambridge anzurufen. »Es läutet. Okay, jetzt schaltet sich der AB ein.« Sie hielt inne, und ihr Blick schnellte zu Maura. »Du wirst nicht glauben, wem diese Nummer gehört.«
»Wem?«
Jane legte auf und wählte die Nummer erneut. Sie reichte Maura das Handy.
Maura hörte es viermal klingeln. Dann sprang der Anrufbeantworter an, und eine Bandansage lief ab. Sie erkannte die Stimme sofort, und es überlief sie eiskalt.
Sie haben den Anschluss von Dr. Joyce P. O’Donnell erreicht. Ich würde sehr gerne hören, was Sie mir zu sagen haben, also hinterlassen Sie doch bitte eine Nachricht, und ich werde Sie so bald wie möglich zurückrufen.
Maura brach die Verbindung ab und starrte Jane an, die genauso perplex schien wie sie selbst. »Wieso sollte der Täter Joyce O’Donnell anrufen?«
»Ich glaub’s nicht«, sagte Frost. »Das ist ihre Nummer?
»Wer ist denn die Frau?«, fragte einer der Kriminaltechniker.
Jane sah ihn an. »Joyce O’Donnell«, antwortete sie, »ist ein Vampir.«
4
So hatte Jane sich den Weihnachtsmorgen nicht vorgestellt.
Sie saß mit Frost in ihrem Subaru, der auf der Brattle Street parkte, und starrte die große weiße Villa im Kolonialstil an. Bei Janes letztem Besuch war es Sommer gewesen, und ihr war aufgefallen, wie makellos gepflegt der Vorgarten war. Jetzt, als sie Haus und Garten in einer anderen Jahreszeit sah, war sie aufs Neue beeindruckt von den geschmackvollen Details – vom schiefergrauen Anstrich der Fenster- und Türrahmen bis hin zu dem imposanten Weihnachtskranz an der Haustür. Das schmiedeeiserne Gartentor war mit Kiefernzweigen und roten Bändern geschmückt, und durch das Wohnzimmerfenster erspähte sie einen mit glitzerndem Schmuck behängten Christbaum. Das war eine Überraschung – dass selbst Blutsauger Weihnachten feierten.
»Wenn du ein Problem damit hast«, sagte Frost, »kann ich auch mit ihr reden.«
»Denkst du, ich werde damit nicht fertig?«
»Ich meine ja bloß – das muss dir doch ganz schön schwerfallen.«
»Es dürfte mir höchstens schwerfallen, ihr nicht an die Gurgel zu gehen.«
»Siehst du? Genau das meine ich. Deine Einstellung zu ihr kommt dir in die Quere. Du und diese Frau, ihr habt eine Vorgeschichte, und die beeinflusst alles. Du kannst nicht neutral sein.«
»Man kann unmöglich neutral sein, wenn man weiß, wer sie ist. Und was sie tut.«
»Rizzoli, sie tut einfach nur das, wofür sie bezahlt wird.«
»Das tun Huren auch.« Nur dass Huren niemandem Schaden zufügen, dachte Jane, den Blick starr auf Joyce O’Donnells Haus gerichtet. Ein Haus, das mit dem Blut von Mordopfern bezahlt war. Huren stolzieren nicht in schicken St.-John-Kostümen im Gerichtssaal herum und sagen als Gutachter zugunsten von Schlächtern aus.
»Ich sage ja nur, dass du versuchen solltest, die Ruhe zu bewahren, okay?«, sagte Frost. »Wir müssen sie ja nicht mögen. Aber wir können es uns nicht leisten, sie zu verärgern.«
»Denkst du, das habe ich vor?«
»Schau dich doch nur an. Du hast ja schon die Krallen ausgefahren.«
»Das ist reine Selbstverteidigung.« Jane stieß die Autotür auf. »Weil ich weiß, dass diese Hexe versuchen wird, mir die Augen auszukratzen.« Sie stieg aus und versank bis zu den Knöcheln im Schnee, doch sie spürte die Kälte kaum, die durch ihre Socken drang. Was sie frösteln ließ, waren nicht die niedrigen Temperaturen. Ihr Blick war auf das Haus gerichtet, ihre Gedanken schon bei der bevorstehenden Begegnung mit einer Frau, die Janes geheime Ängste nur allzu gut kannte. Und die es auch verstand, diese Ängste auszunutzen.
Frost stieß das Tor auf, und sie gingen den geräumten Gartenweg entlang. Die Steinplatten waren vereist, und Jane musste sich so konzentrieren, um nicht auszurutschen, dass ihr ganz schwindlig war, als sie die Verandastufen erreichten und sie Mühe hatte, das Gleichgewicht zu halten. Nicht die besten Voraussetzungen für eine Begegnung mit Joyce O’Donnell. Und es wurde auch nicht besser, als die Haustür aufging und O’Donnell sich ihnen in ihrer gewohnten Eleganz präsentierte: das blonde Haar zu einer gepflegten Kurzhaarfrisur gestylt, die pinkfarbene Button-down-Bluse und die Khakihose maßgenau auf den athletischen Leib geschneidert. Mit ihrem abgetragenen schwarzen Hosenanzug, die Aufschläge der Hose feucht von geschmolzenem Schnee, kam Jane sich dagegen vor wie eine arme Bittstellerin an der Pforte des Herrenhauses. Und genau dieses Gefühl will sie mir auch vermitteln.
O’Donnell begrüßte sie mit einem kühlen Nicken. »Da sind Sie ja.« Sie trat nicht sofort zur Seite – eine Verzögerung, die demonstrieren sollte, dass sie und nur sie hier in ihrem eigenen Revier das Sagen hatte.
»Dürfen wir reinkommen?«, fragte Jane schließlich. Dabei wusste sie natürlich, dass O’Donnell nicht wirklich die Absicht hatte, ihnen den Zutritt zu verwehren. Dass das Spiel bereits begonnen hatte.
O’Donnell winkte sie herein. »Am ersten Weihnachtstag beschäftige ich mich eigentlich lieber mit anderen Dingen«, sagte sie.
»Wir auch, das können Sie mir glauben«, konterte Jane. »Und das Opfer hatte sich den Tag sicher auch anders vorgestellt.«
»Wie ich Ihnen bereits sagte, ist die Aufnahme schon gelöscht«, sagte O’Donnell, während sie ins Wohnzimmer vorranging. »Sie können sich das Band gerne anhören, aber da ist nichts zu hören.«
Seit Janes letztem Besuch hatte sich im Haus nicht viel verändert. Sie erblickte die gleichen abstrakten Gemälde an den Wänden, die gleichen Orientteppiche mit ihren satten Farben. Das einzig neue Element war der Weihnachtsbaum. Die Bäume von Janes Kindertagen waren nicht gerade Zeugnisse erlesenen Geschmacks gewesen: die Zweige behängt mit einem bunten Sammelsurium von billigem Schmuck – alles, was stabil genug war, um frühere Weihnachtsfeste im Hause Rizzoli unbeschadet überstanden zu haben. Und Lametta – Unmengen von Lametta. Las-Vegas-Bäume, so hatte Jane sie immer genannt.
Doch an diesem Baum hing nicht ein einziger Lamettafaden. Stattdessen zierten Kristallprismen und silberne Tränen die Zweige und warfen die Strahlen der Wintersonne wie tanzende Lichtsplitter auf die Wände. Sogar ihr verdammter Weihnachtsbaum verursacht mir Minderwertigkeitsgefühle.
O’Donnell ging hinüber zum Anrufbeantworter. »Das ist alles, was ich noch habe«, sagte sie und drückte die Abspieltaste. Die digitale Stimme meldete: »Sie haben keine neuen Nachrichten.« O’Donnell sah die beiden Ermittler an. »Ich fürchte, die Aufzeichnung, nach der Sie gefragt haben, existiert nicht mehr. Als ich gestern Abend nach Hause kam, habe ich alle Nachrichten abgehört und sie jeweils sofort gelöscht. Als ich zu Ihrem Anruf kam, mit Ihrer Bitte, die Aufzeichnung nicht zu löschen, war es bereits zu spät.«
»Wie viele Nachrichten waren es insgesamt?«, fragte Jane.
»Vier. Ihre war die letzte.«
»Der Anruf, für den wir uns interessieren, müsste gegen 0:10 Uhr eingegangen sein.«
»Ja, und die Nummer ist auch noch im Speicher.« O’Donnell drückte eine Taste und ging zurück zu dem Anruf von 0:10 Uhr. »Aber wer immer um diese Zeit angerufen hat, hat nichts aufs Band gesprochen.« Sie sah Jane an. »Es war keine Nachricht aufgezeichnet.«
»Was haben Sie gehört?«
»Das sagte ich doch bereits. Da war nichts zu hören.«
»Irgendwelche Hintergrundgeräusche? Ein Fernseher, Verkehr?«
»Nicht einmal schweres Atmen. Nur ein paar Sekunden Stille, und dann das Klicken, als aufgelegt wurde. Deswegen habe ich es sofort gelöscht. Es war nichts zu hören.«
»Ist Ihnen die Nummer des Anrufers bekannt?«, fragte Frost.
»Sollte ich sie kennen?«
»Das fragen wir Sie«, entgegnete Jane. Die Schärfe in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
O’Donnell erwiderte ihren Blick, und Jane registrierte das verächtliche Blitzen in diesen Augen. Als ob ich es nicht wert bin, dass sie sich mit mir abgibt. »Nein, ich habe die Telefonnummer nicht erkannt«, sagte O’Donnell.
»Sagt Ihnen der Name Lori-Ann Tucker etwas?«
»Nein. Wer ist das?«
»Sie wurde letzte Nacht ermordet – in ihrem eigenen Haus. Dieser Anruf kam von ihrem Telefon.«
O’Donnell schwieg einen Moment und mutmaßte dann durchaus vernünftig: »Da hat sich vielleicht jemand verwählt.«
»Das glaube ich kaum, Dr. O’Donnell. Ich glaube, dieser Anruf sollte Sie erreichen.«
»Warum sollte jemand mich anrufen und dann kein Wort sagen? Es war wahrscheinlich so, dass sie die Ansage auf meinem Anrufbeantworter hörte, merkte, dass sie sich verwählt hatte, und einfach auflegte.«
»Ich glaube nicht, dass es das Opfer war, das Sie angerufen hat.«
Wieder schwieg O’Donnell, diesmal ein wenig länger als zuvor. »Ich verstehe«, sagte sie schließlich. Sie ging zu einem Sessel und setzte sich, doch nicht etwa, weil sie erschüttert gewesen wäre. Im Gegenteil, sie wirkte vollkommen ruhig und gelassen, wie sie dort in ihrem Sessel saß – wie eine Monarchin auf dem Thron. »Sie denken, es war der Mörder, der mich angerufen hat.«
»Die Vorstellung scheint Sie ja nicht im Geringsten zu beunruhigen.«
»Ich weiß noch nicht genug, als dass es mich beunruhigen könnte. Ich weiß überhaupt nichts über diesen Fall. Also, warum erzählen Sie mir nicht mehr?« Sie wies auf das Sofa, eine Einladung an ihre Besucher, Platz zu nehmen. Es war das erste Mal, dass sie sich zu einer Andeutung von Gastfreundschaft hinreißen ließ.
Weil wir ihr etwas Interessantes zu bieten haben, dachte Jane. Sie wittert Blut. Und das ist genau das, wonach diese Frau giert.
Das Sofa war blütenweiß, und Frost zögerte, ehe er sich darauf niederließ, als hätte er Angst, den Stoff zu beschmutzen. Aber Jane würdigte das Möbelstück keines weiteren Blickes. Sie pflanzte sich mit ihrer vom Schnee feuchten Hose darauf, ohne den Blick von O’Donnell zu wenden.
»Das Opfer ist eine achtundzwanzigjährige Frau«, sagte Jane. »Sie wurde letzte Nacht gegen Mitternacht ermordet.«
ENDE DER LESEPROBE