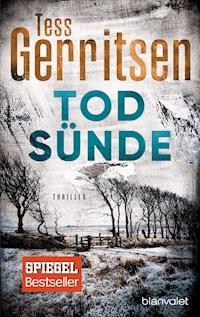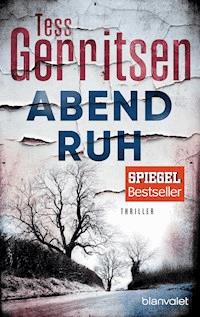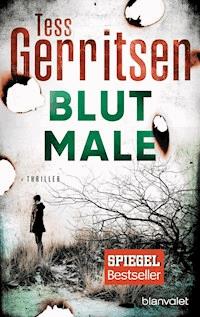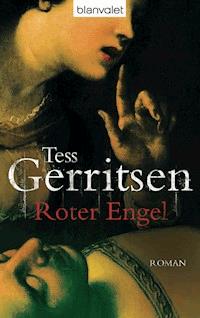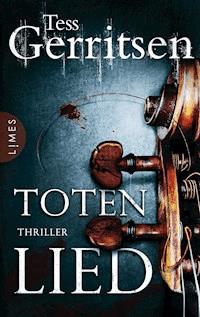9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli-&-Isles-Serie
- Sprache: Deutsch
»Das Böse erkennt man erst, wenn Jane Rizzoli es entlarvt.« Berliner Kurier
Vor dem Haus der Pathologin Maura Isles wird eine Frau erschossen. Detective Jane Rizzoli glaubt zunächst, ihre Kollegin selbst sei das Opfer, bis Maura von einem Kongress zurückkehrt – erschöpft, aber lebendig. Schockiert erfährt Maura, die weder von einer Schwester noch von ihren leiblichen Eltern etwas weiß, dass es sich bei der Leiche um ihren Zwilling handelt.
Unterstützt von Detective Rick Ballard beginnt sie, nach ihrer Herkunft zu forschen. Und gerät dabei in einen blutigen Albtraum aus Habgier und Gewalt ...
Verpassen Sie auch nicht »Spy Coast – Die Spionin« und »Die Sommergäste«, Tess Gerritsens brillante neue Thrillerreihe über eine Gruppe aus ehemaligen Spionen, die noch lange nicht zum alten Eisen gehören!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Vor dem Haus der Pathologin Maura Isles wird eine Frau erschossen. Detective Jane Rizzoli glaubt zunächst, ihre Kollegin selbst sei das Opfer, bis Maura von einem Kongress zurückkehrt – erschöpft, aber lebendig. Schockiert erfährt Maura, die weder von einer Schwester noch von ihren leiblichen Eltern etwas weiß, dass es sich bei der Leiche um ihren Zwilling handelt. Unterstützt von Detective Rick Ballard beginnt sie, nach ihrer Herkunft zu forschen. Und gerät dabei in einen blutigen Albtraum aus Habgier und Gewalt ...
Autorin
So gekonnt wie Tess Gerritsen vereint niemand erzählerische Raffinesse mit medizinischer Detailgenauigkeit und psychologischer Glaubwürdigkeit der Figuren. Bevor sie mit dem Schreiben begann, war die Autorin selbst erfolgreiche Ärztin. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Thriller Die Chirurgin, in dem Detective Jane Rizzoli erstmals ermittelt. Seither sind Tess Gerritsens Thriller um das Bostoner Ermittlerduo Rizzoli & Isles von den internationalen Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Maine.
Weitere Informationen zu Tess Gerritsen und ihren Büchern finden Sie unter: www.tess-gerritsen.de
Von Tess Gerritsen bereits erschienen Gute Nacht, Peggy Sue · Kalte Herzen · Roter Engel · Trügerische Ruhe · In der Schwebe · Leichenraub · Totenlied
Die Rizzoli-&-Isles-ThrillerDie Chirurgin · Der Meister · Todsünde · Schwesternmord · Scheintot · Blutmale · Grabkammer · Totengrund · Grabesstille · Abendruh · Der Schneeleopard · Blutzeuge
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Tess Gerritsen
Schwesternmord
Thriller
Deutsch von Andreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Body Double« bei Ballantine Books, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2004 by Tess Gerritsen
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2005 by Limes Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by Arrangement with Tess Gerritsen Inc.
Dieses Werk wurde im Auftrag von Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture/Yvonne Röder
WR · Herstellung: wag
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-02999-9V005www.blanvalet.de
Für Adam und Danielle
Prolog
Dieser Junge beobachtete sie schon wieder.
Die vierzehnjährige Alice Rose versuchte, sich auf die Matrize mit den zehn Fragen zu konzentrieren, die vor ihr auf dem Tisch lag, doch ihre Gedanken waren nicht bei der englischen Literatur, die sie im ersten High-School-Jahr durchgenommen hatten, sie waren bei Elijah. Sie konnte den Blick des Jungen spüren wie einen Strahl, der auf ihr Gesicht gerichtet war; sie fühlte seine Wärme auf ihrer Wange – und merkte, wie sie errötete.
Konzentrier dich, Alice!
Die nächste Frage konnte sie nur mit Mühe entziffern, weil die Umdruckmaschine die Buchstaben verschmiert hatte.
Charles Dickens wählt für seine Figuren häufig Namen, die bestimmte Charakterzüge widerspiegeln. Nenne einige Beispiele und erkläre, warum die Namen zu den betreffenden Figuren passen.
Alice kaute auf ihrem Bleistift herum und kramte in ihrem Gedächtnis nach einer Antwort. Aber sie konnte einfach nicht denken, solange er am Pult neben ihr saß, so nahe, dass sie seinen Duft riechen konnte – eine Mischung aus Kiefernölseife und Holzrauch. Männliche Düfte. Dickens, Dickens – was interessierte sie dieser Charles Dickens mit seinem Nicholas Nickleby und überhaupt die ganze todlangweilige englische Literatur, solange der schöne Elijah Lank sie anschaute? Gott, er sah wirklich so unglaublich gut aus, mit seinen schwarzen Haaren und seinen blauen Augen. Tony-Curtis-Augen. Das hatte sie gleich gedacht, als sie Elijah zum ersten Mal gesehen hatte: Er sah wirklich aus wie Tony Curtis, dessen wunderhübsches Gesicht sie von den Seiten ihrer Lieblingszeitschriften Modern Screen und Photoplay anstrahlte.
Sie senkte den Kopf, so dass ihr das Haar ins Gesicht fiel, und warf verstohlene Seitenblicke durch den Vorhang aus blonden Strähnen. Und ihr Herz machte einen Sprung, als sie feststellte, dass er tatsächlich sie ansah – und zwar nicht so verächtlich und von oben herab wie all die anderen Jungen an ihrer Schule; diese gemeinen Kerle, die ihr nur das Gefühl gaben, beschränkt und schwer von Begriff zu sein. Diese Jungen, deren spöttisches Getuschel sie ständig begleitete – aber immer so leise, dass sie nicht verstehen konnte, was sie sagten. Sie wusste, dass sie von ihr redeten, weil sie dabei in ihre Richtung schauten. Das waren dieselben Jungen, die das Foto einer Kuh an die Tür ihres Schließfachs geheftet hatten; dieselben, die immer Muuh! machten, wenn sie auf dem Flur aus Versehen mit ihnen zusammenstieß. Aber Elijah – er sah sie ganz anders an. Mit schmachtenden Glutaugen. Wie ein Filmstar.
Ganz langsam hob sie den Kopf und erwiderte seinen Blick, nicht mehr durch den schützenden Schleier ihrer Haare, sondern offen und unverwandt. Er war schon fertig mit dem Test, hatte das Blatt mit den Fragen umgedreht und den Stift in sein Pult gelegt. Seine volle Aufmerksamkeit war auf sie gerichtet, und sein Blick schlug sie so in den Bann, dass es ihr fast den Atem raubte.
Er mag mich. Ich weiß es. Er mag mich.
Ihre Hand ging zu ihrem Hals, zum obersten Knopf ihrer Bluse. Ihre Finger strichen leicht über ihre Haut, und die Stelle, wo sie sie berührt hatten, war plötzlich ganz heiß. Sie dachte an Tony Curtis, wie er den Blick seiner Glutaugen auf Lana Turner richtete – diesen Blick, bei dem jedes Mädchen weiche Knie bekommen und vor Verlegenheit kein Wort herausbringen würde. Diesen Blick, der unmittelbar vor dem unvermeidlichen Kuss kam. Das war die Stelle, an der das Kinobild jedes Mal unscharf wurde. Warum musste das so sein? Warum verschwamm das Bild immer genau dann, wenn man unbedingt sehen wollte, was…
»Die Zeit ist um! Bitte alle abgeben.«
Schlagartig richtete Alices Blick sich wieder auf ihr Pult, auf die Matrize mit den zehn Testfragen, von denen sie erst die Hälfte beantwortet hatte. O nein! Wo war nur die Zeit geblieben? Sie wusste doch alle Antworten. Sie brauchte nur noch ein paar Minuten…
»Alice. Alice!«
Sie blickte auf und sah Mrs. Meriweather vor sich stehen, die Hand ausgestreckt.
»Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Du musst jetzt abgeben.«
»Aber ich…«
»Keine Ausreden. Du musst endlich lernen zuzuhören, Alice.« Mrs. Meriweather schnappte sich Alices Arbeit und ging damit nach vorne. Obwohl Alice die Worte kaum verstehen konnte, wusste sie genau, dass die Mädchen in der Bank hinter ihr über sie tuschelten. Sie drehte sich um und sah, wie sie die Köpfe zusammensteckten, verstohlen kicherten und die Hände vor den Mund hielten. Alice kann von den Lippen lesen, wir dürfen sie nicht sehen lassen, dass wir über sie reden.
Jetzt fingen auch ein paar von den Jungen an zu lachen und zeigten mit den Fingern auf sie. Was war denn da so komisch?
Alice blickte nach unten. Zu ihrem Entsetzen sah sie, dass ihre Bluse oben weit offen stand. Der Knopf war abgefallen.
Es läutete zum Schulschluss.
Alice schnappte sich ihre Schultasche, presste sie fest an die Brust und verließ fluchtartig das Klassenzimmer. Sie wagte es nicht, irgendjemandem in die Augen zu schauen, während sie hinausstürmte, den Kopf gesenkt, mit einem dicken Kloß im Hals und Tränen in den Augen. Sie ging schnurstracks zur Toilette, wo sie sich in einer Kabine einschloss. Andere Mädchen kamen herein und drängten sich lachend und schwatzend vor dem Spiegel, um sich zurechtzumachen, während Alice sich hinter der verriegelten Tür versteckte. Sie konnte die verschiedenen Parfüms riechen, sie spürte den Luftzug, der jedes Mal durch den Raum wehte, wenn jemand die Tür aufstieß. Diese verwöhnten Mädchen mit ihren nagelneuen Twinsets. Die verloren niemals einen Knopf; die würden niemals mit billigen Röcken von der Stange und Schuhen mit Pappsohlen in die Schule kommen.
Geht weg. Könnt ihr nicht einfach alle verschwinden?
Endlich kehrte Ruhe ein.
Alice presste ein Ohr an die Tür der Kabine und horchte angestrengt, ob noch irgendjemand in der Toilette war. Dann spähte sie durch den Spalt und sah, dass niemand vor dem Spiegel stand. Erst jetzt wagte sie sich aus ihrem Versteck hervor.
Auch der Flur lag leer und verlassen, alle waren nach Hause gegangen. Niemand mehr da, der sie quälen konnte. Mit ängstlich hochgezogenen Schultern ging sie den Korridor entlang, vorbei an den verbeulten Schließfachtüren und den Plakaten, die den Halloween-Ball in zwei Wochen ankündigten. Ein Ball, zu dem sie ganz bestimmt nicht gehen würde. Die demütigende Erfahrung der Tanzveranstaltung von letzter Woche steckte ihr noch in den Knochen und würde sie wahrscheinlich bis ans Ende ihrer Tage verfolgen. Die zwei Stunden, die sie mutterseelenallein an der Wand gestanden hatte, vergeblich hoffend, dass einer der Jungen sie endlich auffordern würde. Als dann schließlich doch ein Schüler auf sie zugekommen war, hatte er sie nicht etwa auf die Tanzfläche gebeten. Stattdessen hatte er sich plötzlich zusammengekrümmt und ihr auf die Schuhe gekotzt. Das war’s – das war ihr letzter Ball gewesen. Erst zwei Monate war sie in dieser Stadt, und schon wünschte sie sich, ihre Mutter würde ihre Sachen packen, ihre Familie schnappen und wieder von hier wegziehen, irgendwohin, wo sie ganz von vorne anfangen konnten. Wo endlich alles anders wäre.
Nur leider wird es nie anders.
Alice trat aus dem Haupteingang der Schule hinaus in die Herbstsonne. Sie beugte sich über ihr Fahrrad, um das Schloss aufzusperren, und war so vertieft in ihr Tun, dass sie gar nicht hörte, wie Schritte sich näherten. Erst als sein Schatten auf ihr Gesicht fiel, merkte sie, dass Elijah neben ihr stand.
»Hallo, Alice.«
Sie fuhr hoch, und das Fahrrad landete scheppernd auf der Seite. O Gott, sie war eine solche Idiotin. Wie konnte sie nur so ungeschickt sein?
»Das war ganz schön schwer, nicht wahr?« Er sprach langsam und deutlich. Das war noch etwas, was sie an Elijah mochte: Im Gegensatz zu ihren anderen Klassenkameraden war seine Aussprache immer klar; er nuschelte nie. Und er ließ sie immer seine Lippen sehen. Er kennt mein Geheimnis, dachte sie. Und trotzdem will er mein Freund sein.
»Und, hast du alle Fragen beantwortet?«, fragte er.
Sie bückte sich, um ihr Rad aufzuheben. »Die Antworten habe ich alle gewusst. Ich hätte bloß mehr Zeit gebraucht.« Als sie sich aufrichtete, bemerkte sie, dass sein Blick auf ihre Bluse gerichtet war. Auf die Stelle, wo der Knopf fehlte. Errötend verschränkte sie die Arme vor der Brust.
»Ich habe eine Sicherheitsnadel«, sagte er.
»Was?«
Er griff in die Hosentasche und zog eine Nadel hervor. »Ich verliere auch andauernd Knöpfe. Ich weiß, wie peinlich das ist. Komm, ich mach sie dir fest.«
Sie hielt den Atem an, als er nach dem Kragen ihrer Bluse griff, und sie konnte das Zittern kaum unterdrücken, als er seinen Finger unter den Stoff schob, um die Nadel zu schließen. Spürt er, wie mein Herz klopft? Weiß er, dass mir von seiner Berührung ganz schwindlig wird?
Als er zurücktrat, ließ sie die Luft aus ihren Lungen entweichen. Sie schaute nach unten und sah, dass die Bluse jetzt züchtig geschlossen war.
»Besser so?«, fragte er.
»Oh – ja!« Sie hielt kurz inne, um sich zu sammeln, ehe sie mit majestätischer Würde fortfuhr: »Vielen Dank, Elijah. Das war sehr aufmerksam von dir.«
Einige Sekunden verstrichen. Über ihnen krächzten die Krähen, und das Herbstlaub umhüllte die Äste der Bäume wie lodernde goldene Flammen.
»Ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht bei etwas helfen könntest, Alice«, sagte er.
»Wobei denn?«
Oh, was für eine dumme, dumme Antwort! Du hättest einfach Ja sagen sollen! Ja, ich würde alles für dich tun, Elijah Lank.
»Es geht um dieses Referat für Bio. Ich brauche einen Partner, der mir bei meinem Projekt hilft, und ich weiß nicht, wen ich sonst fragen könnte.«
»Was ist es denn für ein Projekt?«
»Ich zeig’s dir. Wir müssen oben an unserem Haus vorbei.«
An seinem Haus. Sie war noch nie bei einem Jungen zu Hause gewesen.
Sie nickte. »Ich fahr nur schnell bei uns vorbei, um meine Tasche abzustellen.«
Er zog sein Rad aus dem Ständer. Es war fast so ramponiert wie ihres; die Schutzbleche waren rostig, der Kunststoffbezug des Sattels rissig. Dieser alte Drahtesel machte ihn in ihren Augen gleich noch sympathischer. Wir sind ein richtiges Paar, dachte sie. Tony Curtis und ich.
Sie fuhren zuerst zu ihrem Haus. Sie bat ihn nicht herein; es wäre ihr zu peinlich gewesen, wenn er ihre schäbigen Möbel gesehen hätte, die Wände, von denen die Farbe abblätterte. Sie lief nur rasch hinein, warf ihre Tasche auf den Küchentisch und stürmte wieder hinaus.
Leider hatte Buddy, der Hund ihres Bruders, in diesem Moment dieselbe Idee. Sie wollte gerade die Haustür hinter sich zumachen, als ein kleines schwarz-weißes Bündel an ihr vorbeischoss.
»Buddy!«, rief sie. »Komm sofort zurück!«
»Er folgt nicht besonders gut, wie?«, meinte Elijah.
»Weil er ein dummer Hund ist. Buddy!«
Der Köter sah sich kurz nach ihr um, wedelte mit dem Schwanz und trottete weiter die Straße hinunter.
»Ach, was soll’s«, sagte sie. »Er wird schon irgendwann zurückkommen.« Sie stieg auf ihr Rad. »Wo wohnst du eigentlich?«
»Ganz oben an der Skyline Road. Warst du schon mal dort?«
»Nein.«
»Ist ’n ziemlich langer Anstieg. Meinst du, du schaffst das?«
Sie nickte. Für dich tue ich alles.
Sie radelten von ihrem Haus los. Alice hoffte, dass er durch die Main Street fahren würde, vorbei an der Milchbar, wo die Jungs und Mädels sich immer nach der Schule trafen, um die Jukebox laufen zu lassen und Limo zu trinken. Sie werden uns zusammen vorbeifahren sehen, dachte sie, und die Mädchen werden sich die Mäuler zerreißen. Sieh mal da: Alice – und Elijah mit den blauen Augen.
Aber er führte sie nicht die Main Street entlang. Stattdessen bog er ab und fuhr die Locust Lane hoch, wo es kaum Häuser gab, nur die Rückseiten von ein paar Geschäften und den Mitarbeiterparkplatz der Neptune’s-Bounty-Konservenfabrik. Na ja, egal. Immerhin fuhr sie mit ihm, das war doch schon was. So dicht hinter ihm, dass sie zusehen konnte, wie seine Oberschenkel sich strafften, wenn er in die Pedale trat, und seinen Hintern auf dem Fahrradsitz bewundern konnte.
Er drehte sich zu ihr um, und sein schwarzes Haar flatterte im Wind. »Geht’s noch, Alice?«
»Alles klar.« Dabei war sie in Wirklichkeit schon ziemlich außer Puste, denn inzwischen hatten sie den Ort hinter sich gelassen und fuhren den Berg hoch. Elijah musste jeden Tag mit dem Rad die Skyline Road hochfahren; für ihn war das also nichts Besonderes. Er schien kaum außer Atem, und seine Beine bewegten sich rhythmisch auf und ab wie die Kolben eines starken Motors. Aber sie keuchte schon heftig und musste verzweifelt strampeln, um überhaupt nachzukommen. Plötzlich erblickte sie im Augenwinkel ein schwarz-weißes Fellbündel. Sie schaute genauer hin und sah, dass Buddy ihnen gefolgt war. Auch er sah erschöpft aus, die Zunge hing ihm weit aus dem Maul, während er ihnen nachhetzte.
»Lauf nach Hause!«
»Was sagst du?« Elijah drehte sich zu ihr um.
»Es ist schon wieder dieser blöde Hund«, stieß sie atemlos hervor. »Er rennt uns immer noch nach. Er wird – er wird sich verlaufen.«
Sie warf Buddy einen finsteren Blick zu, doch das dumme Tier trabte weiter munter neben ihr her. Na schön – mach, was du willst, dachte sie. Renn dir nur die Lunge aus dem Leib. Ist mir doch egal.
Sie fuhren immer weiter den Berg hinauf. Die Straße wand sich in breiten Serpentinen, und ab und zu erhaschte sie zwischen den Bäumen hindurch einen Blick auf Fox Harbor unten im Tal, auf das Wasser, das wie getriebenes Kupfer in der Nachmittagssonne glitzerte. Dann wurde der Wald zu dicht, und sie konnte nur noch die Bäume in ihrem leuchtend roten und orangefarbenen Laubkleid sehen, und vor sich die kurvige, mit Blättern übersäte Straße.
Als Elijah endlich anhielt, waren Alices Beine so müde, dass sie kaum stehen konnte. Von Buddy war weit und breit nichts zu sehen; sie hoffte nur, dass er allein nach Hause finden würde, denn sie würde ganz bestimmt nicht nach ihm suchen. Nicht jetzt; nicht, wenn Elijah vor ihr stand und sie anlächelte, mit seinen funkelnden blauen Augen. Er lehnte sein Rad an einen Baum und warf seine Tasche über die Schulter.
»Wo ist denn nun euer Haus?«, fragte sie.
»Es ist die Einfahrt dort drüben.« Er deutete auf einen rostigen Briefkasten ein Stück weiter die Straße entlang.
»Gehen wir denn nicht zu euch?«
»Nein, meine Cousine ist krank; sie war heute nicht in der Schule. Sie hat die ganze Nacht gekotzt, da gehen wir lieber nicht rein. Mein Projekt ist sowieso da draußen im Wald. Lass dein Rad einfach stehen; von hier ab müssen wir zu Fuß gehen.«
Sie stellte ihr Rad neben seines an den Baum und folgte ihm. Von dem langen Anstieg zitterten ihr immer noch die Beine. Sie stapften durch den Wald. Hier standen die Bäume dicht an dicht, der Boden war mit einer dicken Laubschicht bedeckt. Tapfer folgte sie ihm und wedelte sich die Mücken aus dem Gesicht. »Wohnt deine Cousine denn bei euch?«, fragte sie.
»Ja, sie ist letztes Jahr zu uns gezogen. Wahrscheinlich bleibt sie ganz bei uns. Sie kann ja sonst nirgends hin.«
»Haben deine Eltern denn nichts dagegen?«
»Es ist nur mein Dad. Meine Mutter ist tot.«
»Oh.« Sie wusste nicht, was sie erwidern sollte. Schließlich murmelte sie einfach nur: »Das tut mir Leid«, aber er schien es nicht gehört zu haben.
Das Unterholz wurde immer dichter, und die Dornen zerkratzten ihre nackten Beine. Sie hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Er marschierte einfach immer weiter, während sie mit ihrem Rock in einem Brombeerstrauch hängen blieb.
»Elijah!«
Er gab keine Antwort, sondern stapfte weiter durchs Unterholz wie ein unerschrockener Forscher, die Schultasche über die Schulter geworfen.
»Warte!«
»Willst du es nun sehen oder nicht?«
»Doch, aber…«
»Dann komm jetzt.« Seine Stimme hatte mit einem Mal einen ungehaltenen Unterton angenommen, der sie erschreckte. Er war ein paar Meter vor ihr stehen geblieben und blickte sich zu ihr um. Ihr fiel auf, dass seine Hände zu Fäusten geballt waren.
»Okay«, erwiderte sie kleinlaut. »Ich komm ja schon.«
Nach wenigen Metern tat sich plötzlich eine Lichtung auf. Sie erblickte ein paar steinerne Grundmauern – die einzigen Überreste eines alten, längst verfallenen Gehöfts. Elijah wandte sich zu ihr um. Die Nachmittagssonne, die durch die Baumkronen fiel, malte Lichtflecken auf sein Gesicht.
»Hier ist es«, sagte er.
»Was?«
Er bückte sich und zog zwei Holzplanken zur Seite, unter denen ein tiefes Loch zum Vorschein kam. »Schau mal da rein«, forderte er sie auf. »Ich habe drei Wochen gebraucht, um das auszuheben.«
Langsam trat sie an die Grube heran und blickte hinein. Die Sonne stand schon so tief, dass der Boden der Grube im Schatten lag. Nur mit Mühe konnte sie eine Schicht aus trockenem Laub erkennen, die sich in der Grube angesammelt hatte. Über den Rand hing ein Seil.
»Ist das eine Bärenfalle oder so was Ähnliches?«
»Wäre möglich. Wenn ich ein paar Zweige drauflegen würde, um das Loch zu verdecken, könnte ich alles Mögliche fangen. Sogar einen Hirsch.« Er zeigte in die Grube. »Schau mal genau hin – kannst du es sehen?«
Sie beugte sich weiter vor. Irgendetwas schimmerte ganz schwach in dem schwarzen Loch zu ihren Füßen; kleine weiße Flecken, die zwischen den Blättern hervorblitzten.
»Was ist das?«
»Das ist mein Projekt.« Er griff nach dem Seil und zog daran.
Das Laub am Boden der Grube raschelte und teilte sich. Alice sah mit großen Augen zu, wie das Seil sich straffte und Elijah einen Gegenstand aus der Grube zog. Einen Korb. Er hievte ihn hoch und stellte ihn auf den Boden. Dann fegte er das Laub zur Seite und legte das weiße Etwas frei, das sie am Boden der Grube hatte schimmern sehen.
Es war ein kleiner Schädel.
Er zupfte noch ein paar Blätter weg, und sie sah Büschel von schwarzem Fell und dürre Rippen. Eine höckrige Kette aus Knochen – das Rückgrat. Beinknochen, so zart und dünn wie kleine Zweige.
»Na, ist das nichts? Sie riecht schon gar nicht mehr«, sagte er. »Liegt jetzt schon fast sieben Monate da unten. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war noch ein bisschen Fleisch dran. Toll, wie auch das nach und nach verschwindet. Im Mai, kaum dass es ein bisschen warm geworden war, ging es plötzlich rasend schnell mit der Verwesung.«
»Was ist es?«
»Kannst du das nicht erkennen?«
»Nein.«
Er ergriff den Schädel und drehte ihn ein wenig, bis er sich von der Wirbelsäule löste. Sie zuckte zurück, als er ihn ihr zuwarf.
»Nicht!«, kreischte sie.
»Miau!«
»Elijah!«
»Na, du wolltest doch wissen, was es ist.«
Sie starrte die leeren Augenhöhlen an. »Es ist eine Katze?«
Er nahm eine Einkaufstüte aus seiner Schultasche und begann die Knochen hineinzulegen.
»Was willst du mit dem Skelett machen?«
»Das ist mein naturwissenschaftliches Projekt. Vom Kätzchen zum Knochengerüst in sieben Monaten.«
»Wie bist du an die Katze rangekommen?«
»Hab sie gefunden.«
»Du hast einfach so eine tote Katze gefunden?«
Er blickte auf. Mit einem Lächeln in seinen blauen Augen. Aber es waren keine Tony-Curtis-Augen mehr; diese Augen jagten ihr Angst ein. »Wer sagt denn, dass sie tot war?«
Ihr Herz pochte plötzlich wie wild. Sie trat einen Schritt zurück. »Du, ich glaube, ich muss jetzt nach Hause.«
»Warum?«
»Hausaufgaben. Ich muss meine Hausaufgaben machen.«
Er war behände aufgesprungen und stand jetzt vor ihr. Das Lächeln war verschwunden, war einem Ausdruck ruhiger Erwartung gewichen.
»Wir… sehen uns dann in der Schule«, sagte sie. Sie wich zurück und blickte verstohlen nach links und nach rechts, doch der Wald sah nach jeder Richtung gleich aus. Von wo waren sie gekommen? Wohin sollte sie sich wenden?
»Aber du bist doch gerade erst gekommen, Alice«, sagte er. Er hielt etwas in der Hand. Erst als er es über den Kopf hob, sah sie, was es war.
Ein Stein.
Der Schlag zwang sie in die Knie. Sie kauerte auf der Erde, ihr wurde schwarz vor Augen, und ihre Arme und Beine waren ohne Gefühl. Sie spürte keinen Schmerz, nur eine dumpfe, ungläubige Verwunderung darüber, dass er sie geschlagen hatte. Sie begann zu kriechen, doch sie konnte nicht sehen, wohin sie sich bewegte. Dann packte er sie an den Fußgelenken und riss sie zurück. Ihr Gesicht schrammte über die Erde, als er sie mit den Füßen voran zu der Grube schleifte. Sie versuchte ihre Beine loszureißen, sie wand sich, wollte schreien, doch ihr Mund füllte sich mit Erde und kleinen Zweigen. In dem Moment, als ihre Füße über den Rand rutschten, bekam sie ein junges Bäumchen zu fassen und hielt sich krampfhaft daran fest, während ihre Beine schon über den Grubenrand hingen.
»Lass los, Alice«, befahl er.
»Zieh mich hoch! Zieh mich hoch!«
»Lass los, hab ich gesagt!« Er packte einen Stein und ließ ihn auf ihre Hand niederfahren.
Sie schrie auf und musste das Bäumchen loslassen; mit den Füßen voran rutschte sie in die Grube und landete auf einem Bett aus totem Laub.
»Alice. Alice.«
Benommen von ihrem Sturz blickte sie zu dem kreisförmigen Stück Himmel auf und sah die Umrisse seines Kopfes. Er beugte sich über den Rand der Grube und starrte auf sie herab.
»Warum tust du das?«, schluchzte sie. »Warum?«
»Es hat nichts mit dir zu tun. Ich will einfach nur sehen, wie lange es dauert. Sieben Monate bei einem Kätzchen. Was denkst du, wie lange es bei dir dauern wird?«
»Das kannst du nicht mit mir machen!«
»Bye-bye, Alice.«
»Elijah! Elijah!«
Die Holzplanken schoben sich über die Öffnung, und der Lichtfleck verfinsterte sich. Das letzte Stückchen Himmel verschwand vor ihren Augen. Das passiert nicht wirklich, dachte sie. Das ist nur ein schlechter Scherz. Er will mir Angst einjagen. Er wird mich ein paar Minuten hier unten schmoren lassen, und dann wird er zurückkommen und mich rausholen. Natürlich wird er zurückkommen.
Dann hörte sie plötzlich dumpfe Schläge auf der Abdeckung der Grube. Steine. Er beschwert die Bretter mit Steinen.
Alice rappelte sich auf und versuchte aus dem Erdloch zu klettern. Sie fand nur eine dürre, vertrocknete Ranke, die in ihren Händen sogleich zerfiel. Verzweifelt krallte sie ihre Finger in die Erde, doch sie fand nirgendwo Halt. Keine fünf Zentimeter konnte sie sich hochziehen, dann rutschte sie schon wieder ab. Ihre Rufe hallten schrill in der Dunkelheit.
»Elijah!«, schrie sie.
Doch die einzige Antwort war das Poltern der Steine, die schwer auf das Holz fielen.
1
Pensez le matin que vous n’irez peut-êtrepas jusqu’au soir,Et au soir que vous n’irez peut-êtrepas jusqu’au matin.Bedenke jeden Morgen, dass du vielleicht den Tagnicht überleben wirst,Und jeden Abend, dass du vielleicht die Nachtnicht überleben wirst.
INSCHRIFT AUF EINER TAFEL IN DEN KATAKOMBEN VON PARIS
Über einer Mauer aus kunstvoll gestapelten Oberschenkel- und Schienbeinknochen starrten ihr die leeren Augenhöhlen einer Reihe von Schädeln entgegen. Es war Juni, und sie wusste, dass zwanzig Meter über ihr in den Straßen von Paris die Sonne schien. Dennoch fröstelte Dr. Maura Isles bei ihrem Gang durch die düsteren unterirdischen Passagen, deren Wände fast bis zur Decke von menschlichen Überresten gesäumt waren. Sie war vertraut mit dem Tod, stand mit ihm praktisch auf Du und Du; unzählige Male hatte sie ihm in ihrem Autopsiesaal ins Gesicht geblickt, doch selbst sie war von den Dimensionen dieser makabren Ausstellung überwältigt, von der schieren Menge von Knochen, die in diesem Tunnellabyrinth unter den Straßen der Stadt des Lichts lagerten. Der Rundgang von einem Kilometer Länge führte sie nur durch einen kleinen Teil der Katakomben. Zahlreiche Seitenstollen und mit Knochen gefüllte Kammern waren für Touristen nicht zugänglich, ihre dunklen Eingänge gähnten verlockend hinter verschlossenen Eisentoren. Hier ruhten die sterblichen Überreste von sechs Millionen Parisern, von Menschen, die einst die Sonnenwärme auf ihren Gesichtern gespürt, die Hunger und Durst und Liebe empfunden hatten, die das Pochen des Herzens in ihrer Brust und den Luftstrom ihres eigenen Atems gespürt hatten. Diese Menschen hätten sich wohl niemals vorstellen können, dass ihre Knochen einst aus ihrer Ruhestätte auf dem Friedhof ausgegraben und in dieses düstere Beinhaus unter der Stadt verfrachtet würden.
Dass sie eines Tages hier ausgestellt sein würden, wo Horden von Touristen sie begaffen konnten.
Um Platz für den stetigen Strom von Leichen zu schaffen, mit dem die überfüllten Pariser Friedhöfe nicht mehr fertig wurden, hatte man die Knochen vor über eineinhalb Jahrhunderten exhumiert und in das weit verzweigte Stollennetz dieser unterirdischen Steinbrüche verfrachtet. Die Arbeiter, die mit der Überführung der Gebeine betraut worden waren, hatten sie nicht einfach achtlos auf Haufen geworfen; nein, sie hatten sich ihrer makabren Aufgabe mit einem Sinn für Ästhetik entledigt; hatten die Knochen mühsam aufgeschichtet und zu wunderlichen Mustern zusammengesetzt. Wie pedantische Steinmetze hatten sie hohe Mauern errichtet, gegliedert durch abwechselnde Schichten von Schädeln und langen Knochen, und hatten so den Verfall in eine künstlerische Aussage umgewandelt. Und sie hatten Tafeln mit grimmigen Sinnsprüchen angebracht, die all jene, die durch diese Gänge schritten, daran erinnerten, dass der Tod niemanden verschont.
Mauras Blick fiel auf eine dieser Tafeln, und sie ließ den Strom der Besucher an sich vorbeiziehen, um die Inschrift zu lesen. Während sie sich mit ihrem lückenhaften Schulfranzösisch mühte, den Spruch zu übersetzen, hörte sie das Echo von Kinderlachen, das von den Wänden der düsteren Gänge widerhallte – ein Geräusch, das so gar nicht in diese Umgebung zu passen schien. Dann vernahm sie eine Männerstimme, die mit näselndem texanischem Akzent murmelte: »Das ist doch der glatte Wahnsinn, Sherry, findest du nicht? Da läuft’s mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich das sehe…«
Das texanische Ehepaar ging weiter, ihre Stimmen verhallten, und bald war kein Laut mehr zu hören. Jetzt war Maura ganz allein in der Kammer, wo sie den Staub der Jahrhunderte einatmete. Im schwachen Schein der Tunnelbeleuchtung war im Lauf der Jahrzehnte auf einer Gruppe von Schädeln Schimmel gewachsen und hatte sie mit einer grünlich glänzenden Schicht überzogen. In der Stirn eines Schädels klaffte ein einzelnes Einschussloch wie ein drittes Auge.
Ich weiß, wie du gestorben bist.
Die Kälte der Tunnelluft war ihr in die Glieder gekrochen. Doch sie verharrte an Ort und Stelle, fest entschlossen, diese Inschrift zu übersetzen und ihr Entsetzen zu unterdrücken, indem sie ihr Gehirn mit dieser banalen Quizaufgabe beschäftigte. Komm schon, Maura. Drei Jahre Französisch auf der High School, und du scheiterst an so einem simplen Satz? Es war jetzt eine persönliche Herausforderung, die alle Gedanken an Tod und Sterblichkeit vorübergehend vergessen ließ. Dann füllten sich die Worte allmählich mit Sinn, und ein kalter Schauer durchfuhr sie…
Glücklich, wer stets die Stunde seines Todes vor Augen hatUnd sich jeden Tag auf das Ende vorbereitet.
Plötzlich wurde ihr bewusst, wie still es geworden war. Keine Stimmen, keine hallenden Schritte. Sie machte kehrt und verließ die düstere Kammer. Wie hatte sie so weit hinter die anderen Touristen zurückfallen können? Sie war allein in diesem Tunnel, allein mit den Toten. Sie musste an plötzliche Stromausfälle denken und malte sich aus, wie sie in der völligen Dunkelheit in die falsche Richtung gehen würde. Sie hatte von einer Gruppe von Pariser Arbeitern gehört, die sich vor hundert Jahren in den Katakomben verirrt hatten und schließlich verhungert waren; und sie beschleunigte ihren Schritt, um zu den anderen aufzuschließen, sich wieder zu den Lebenden zu gesellen. Sie hatte das Gefühl, dass der Tod ihr in diesen dunklen Gängen allzu nahe auf den Leib rückte. Die Schädel schienen sie voller Grimm anzustarren, ein Chor von sechs Millionen Seelen, der sie für ihre morbide Neugier schalt.
Wir waren einmal so lebendig wie du. Glaubst du wirklich, dass du der Zukunft entkommen kannst, die du hier vor dir siehst?
Als sie endlich aus den Katakomben auftauchte und auf die sonnige Rue Remy Dumoncel hinaustrat, atmete sie tief durch. In diesem Moment genoss sie geradezu den Verkehrslärm und das Gedränge, als sei ihr soeben ein zweites Leben geschenkt worden. Die Farben schienen leuchtender, die Gesichter freundlicher. Mein letzter Tag in Paris, dachte sie, und jetzt erst weiß ich die Schönheit dieser Stadt so richtig zu schätzen. Sie hatte den größten Teil der vergangenen Woche hinter den geschlossenen Türen von Tagungssälen verbracht, als Teilnehmerin an der Internationalen Konferenz zur Forensischen Pathologie. Es war ihr kaum Zeit fürs Sightseeing geblieben, und selbst die Besichtigungen, die von den Veranstaltern der Tagung organisiert worden waren, hatten alle mit Tod und Krankheit zu tun gehabt: das Medizinmuseum, der alte Sektionssaal.
Die Katakomben.
Welch eine Ironie, dass die lebhafteste Erinnerung, die sie von ihrer Parisreise mit nach Hause nehmen würde, die an eine Ansammlung menschlicher Gebeine sein würde. Das ist doch irgendwie krank, dachte sie, als sie in einem Straßencafé saß, eine letzte Tasse Café noir schlürfte und sich ein Erdbeertörtchen munden ließ. In zwei Tagen werde ich wieder in meinem Autopsiesaal stehen, umgeben von blitzendem Edelstahl, in einem fensterlosen Raum, in den kein Sonnenstrahl dringt. Werde die kühle, gefilterte Luft aus der Klimaanlage atmen. Und dieser Tag wird mir wie eine ferne Erinnerung an das Paradies erscheinen.
Sie nahm sich Zeit, all die Eindrücke in sich aufzunehmen. Den Duft des Kaffees, den Geschmack des köstlichen Buttergebäcks. Den Anblick der geschniegelten Business-Typen mit Handy am Ohr, der Frauen mit ihren aufwendig geknoteten Schals, die im Wind flatterten. Sie gab sich der Fantasie hin, die gewiss im Kopf jedes Amerikaners herumspukte, der schon einmal in Paris gewesen war: Wie wäre es, wenn ich meinen Flug einfach Flug sein ließe? Wie wäre es, einfach hier zu bleiben, hier in diesem Café, in dieser wundervollen Stadt, und nie mehr wegzugehen?
Aber schließlich stand sie doch auf, verließ das Café und hielt ein Taxi an, um sich zum Flughafen bringen zu lassen. Sie riss sich von der Fantasie los, von Paris – aber nur, weil sie sich geschworen hatte, dass sie eines Tages wiederkommen würde. Sie wusste nur noch nicht, wann.
Ihr Rückflug hatte drei Stunden Verspätung. Die drei Stunden hätte ich auch mit einem Spaziergang an der Seine zubringen können, dachte sie, als sie verärgert in der Wartehalle von Charles de Gaulle saß. Drei Stunden, in denen ich das Marais erkunden oder in den Läden von Les Halles hätte stöbern können. Stattdessen saß sie hier im Flughafengebäude fest, wo sich so viele Passagiere drängten, dass sie Mühe hatte, überhaupt einen Sitzplatz zu ergattern. Als sie dann endlich an Bord der Air-France-Maschine gehen konnte, war sie müde und gründlich missgestimmt. Das eine Glas Wein, das sie zum Essen trank, genügte, um sie in einen tiefen, traumlosen Schlaf fallen zu lassen.
Sie wachte erst wieder auf, als das Flugzeug schon im Landeanflug auf Boston war. Ihr Kopf schmerzte, und die grellen Strahlen der untergehenden Sonne blendeten sie. Das Kopfweh wurde noch schlimmer, als sie in der Gepäckausgabe stand und zusah, wie ein Koffer nach dem anderen auf das Förderband rutschte – keiner davon ihrer. Und es steigerte sich zu einem gnadenlosen Hämmern, als sie wenig später in der Warteschlange stand, um eine Verlustanzeige für ihren verschwundenen Koffer aufzugeben. Als sie schließlich lediglich mit ihrem Handgepäck in ein Taxi stieg, war es schon dunkel, und sie wünschte sich nur noch ein heißes Bad und eine tüchtige Dosis Ibuprofen. Erschöpft ließ sie sich in die Polster sinken und schlief erneut ein.
Sie schreckte hoch, als das Taxi plötzlich bremste.
»Was ist denn hier los?«, hörte sie den Fahrer sagen.
Sie streckte sich, rieb sich den Schlaf aus den Augen und sah vor sich flackerndes Blaulicht. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie die Situation erfasst hatte. Dann erkannte sie, dass sie in ihre Straße eingebogen waren, und sie setzte sich mit einem Ruck auf, plötzlich hellwach und tief beunruhigt über das, was sie da sah. Am Straßenrand parkten vier Streifenwagen der Polizei von Brookline; das Flackern ihrer Rundumlichter durchschnitt die Dunkelheit.
»Sieht nach einem Notfall aus«, sagte der Fahrer. »Das ist doch Ihre Straße, oder?«
»Ja, und das da vorn ist mein Haus. Genau in der Mitte des Blocks.«
»Wo die ganzen Polizeiautos stehen? Ich glaube kaum, dass die uns durchlassen werden.«
Wie zur Bestätigung seiner Worte kam ein Streifenpolizist auf den Wagen zu und bedeutete ihnen umzukehren.
Der Taxifahrer steckte den Kopf aus dem Fenster. »Ich muss einen Fahrgast absetzen. Die Dame wohnt hier in der Straße.«
»Tut mir Leid, Kumpel. Der ganze Block hier ist abgesperrt.«
Maura beugte sich vor und sagte zum Fahrer: »Hören Sie, lassen Sie mich einfach hier raus.« Sie bezahlte, nahm ihre Tasche und stieg aus. Noch vor wenigen Sekunden hatte sie sich matt und benommen gefühlt; jetzt schien die Luft des warmen Juniabends förmlich vor Spannung zu vibrieren. Sie ging langsam auf die Gruppe der Schaulustigen zu, und ihre Unruhe wuchs, als sie all die Einsatzfahrzeuge vor ihrem Haus erblickte. War einem ihrer Nachbarn etwas zugestoßen? Eine ganze Reihe furchtbarer Möglichkeiten schoss ihr durch den Kopf. Selbstmord. Mord. Sie dachte an Mr. Telushkin, den unverheirateten Ingenieur für Robotertechnik, der gleich nebenan wohnte. Hatte er nicht auffallend niedergeschlagen gewirkt, als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte? Sie dachte auch an Lily und Susan, ihre Nachbarinnen auf der anderen Seite; zwei lesbische Anwältinnen, die wegen ihres Engagements für die Rechte von Homosexuellen oft im Rampenlicht standen und entsprechend gefährdet waren. Dann erblickte sie Lily und Susan, die am Rand des Menschenauflaufs standen und beide sehr lebendig aussahen, und ihre Befürchtungen konzentrierten sich wieder auf Mr. Telushkin, den sie nicht unter den Schaulustigen entdecken konnte.
Lily blickte sich um und sah Maura auf die Gruppe zukommen. Doch sie winkte ihr nicht zu, sondern starrte sie nur wortlos an und stieß Susan heftig in die Seite. Susan drehte sich um, und ihre Kinnlade klappte herunter. Jetzt richteten sich auch die verwunderten Blicke der anderen Nachbarn auf Maura.
Warum schauen sie mich alle so an?, fragte sich Maura. Was habe ich denn getan?
»Dr. Isles?« Ein Streifenpolizist vom Brookline-Revier stand plötzlich vor ihr und glotzte sie mit offenem Mund an. »Sie… Sie sind es doch, oder?«, fragte er.
Was für eine blöde Frage, dachte sie. »Das da ist mein Haus. Was geht hier eigentlich vor, Officer?«
Der Polizist ließ den Atem stoßartig entweichen. »Äh, ich denke, Sie sollten besser mitkommen.«
Er nahm sie am Arm und führte sie durch die Menge. Die Nachbarn wichen scheu zur Seite, wie um einem Todeskandidaten Platz zu machen, der auf dem Weg zur Hinrichtung war. Die Stille war unheimlich; das einzige Geräusch war das Knacken und Rauschen der Polizeifunkgeräte. Sie kamen zu einer Sperre aus gelbem Polizeiband; ein paar der Stangen, zwischen denen es gespannt war, steckten in Mr. Telushkins Vorgarten. Er ist so stolz auf seinen Rasen; da wird er alles andere als begeistert sein – das war ihr erster, absolut sinnloser Gedanke. Der Streifenpolizist hob das Band an, und sie schlüpfte mit gesenktem Kopf darunter hindurch. Es war der Tatort eines Verbrechens, den sie gerade betrat.
Das wurde ihr schlagartig klar, als sie eine vertraute Gestalt in der Mitte des abgesperrten Bereichs stehen sah. Obwohl noch der Vorgarten zwischen ihnen lag, hatte Maura Detective Jane Rizzoli von der Mordkommission sofort erkannt. Inzwischen im achten Monat schwanger, glich die kleine und zierliche Rizzoli einer reifen Birne in einem Hosenanzug. Ihre Anwesenheit war ein weiteres beunruhigendes Detail. Was hatte eine Ermittlerin des Boston Police Department hier in Brookline verloren, außerhalb ihres normalen Zuständigkeitsbereichs? Rizzoli sah Maura nicht kommen; ihr Blick war starr auf ein Auto gerichtet, das vor Mr. Telushkins Haus am Straßenrand geparkt war. Fassungslos schüttelte sie den Kopf, von dem ihre wirren schwarzen Locken wie immer in alle Richtungen abstanden.
Es war Rizzolis Partner Barry Frost, der Maura als Erster entdeckte. Er schaute kurz in ihre Richtung, wandte sich wieder ab und riss einen Sekundenbruchteil später den Kopf herum, um sie anzustarren. Sein Gesicht war kreidebleich. Wortlos zupfte er seine Partnerin am Ärmel.
Rizzoli erstarrte; das pulsierende Blaulicht der Streifenwagen erhellte ihre ungläubige Miene. Dann begann sie wie in Trance auf Maura zuzugehen.
»Doc?«, fragte Rizzoli leise. »Sind Sie es wirklich?«
»Wer soll ich denn sonst sein? Warum stellt mir eigentlich jeder hier diese Frage? Warum starrt ihr mich alle an, als wäre ich ein Geist?«
»Weil…« Rizzoli brach ab und schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre zerzausten Locken flogen. »Mensch, einen Moment lang hab ich wirklich gedacht, Sie sind ein Geist.«
»Was?«
Rizzoli drehte sich um und rief: »Pater Brophy?«
Maura hatte den Priester noch gar nicht gesehen, der ein wenig abseits stand. Jetzt trat er aus dem Schatten; sein weißer Kragen leuchtete auffallend hell. Sein sonst so attraktives Gesicht wirkte eingefallen, seine Miene geschockt. Wieso ist Daniel hier? Normalerweise wurde ein Priester nur dann zum Tatort gerufen, wenn die Familie eines Opfers geistlichen Beistand wünschte. Ihr Nachbar Mr. Telushkin war aber nicht katholisch, er war Jude. Er hätte keinen Grund gehabt, nach einem Priester zu verlangen.
»Könnten Sie sie bitte ins Haus bringen, Pater?«, sagte Rizzoli.
»Will mir vielleicht mal jemand erklären, was hier vor sich geht?«, fragte Maura.
»Gehen Sie ins Haus, Doc. Bitte. Wir erklären es Ihnen gleich.«
Maura spürte, wie Brophy den Arm um ihre Hüfte legte; sein fester Griff ließ sie wissen, dass jetzt nicht der rechte Zeitpunkt war, sich zu sträuben. Dass sie sich ganz einfach Rizzolis Anweisungen fügen sollte. Und so ließ sie sich von ihm zu ihrer Haustür führen. Sie spürte seine Körperwärme, registrierte den heimlichen Kitzel, den seine physische Nähe in ihr auslöste. So verunsichert war sie durch seine Gegenwart, dass ihre Finger ihr nicht recht gehorchen wollten, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte. Sie kannten sich nun schon einige Monate und verstanden sich sehr gut, aber sie hatte Daniel Brophy noch nie zu sich nach Hause eingeladen. Und ihre jetzige Reaktion erinnerte sie noch einmal daran, warum sie so strikt darauf geachtet hatte, eine gewisse Distanz zu wahren. Sie traten ein und gingen ins Wohnzimmer, wo dank der Zeitschaltuhr das Licht schon brannte. Sie blieb einen Moment lang vor der Couch stehen, unsicher über den nächsten Schritt.
Es war Pater Brophy, der das Kommando übernahm: »Setzen Sie sich«, sagte er und wies auf die Couch. »Ich bringe Ihnen etwas zu trinken.«
»Sie sind doch hier der Gast. Ich sollte Ihnen eigentlich etwas anbieten«, erwiderte sie.
»Nicht unter diesen Umständen.«
»Ich weiß ja gar nicht, was die Umstände sind.«
»Detective Rizzoli wird es Ihnen sagen.« Er ging hinaus und kam kurz darauf mit einem Glas Wasser zurück – nicht gerade das Getränk, für das sie sich in diesem Moment entschieden hätte; allerdings schien es irgendwie unangemessen, einen Priester zu bitten, ihr eine Flasche Wodka zu holen. Sie nahm einen kleinen Schluck von dem Wasser; sein Blick machte sie nervös. Er setzte sich in den Sessel gegenüber von ihr und ließ sie dabei keine Sekunde aus den Augen, als fürchtete er, sie könne sich in Luft auflösen.
Endlich hörte sie Rizzoli und Frost ins Haus kommen. Sie vernahm ihre Stimmen in der Diele; gedämpft unterhielten sie sich mit einer dritten Person, deren Stimme Maura nicht erkannte. Geheimnisse, dachte sie. Warum haben sie alle Geheimnisse vor mir? Was ist es, das ich nicht wissen darf?
Sie blickte auf, als die beiden Detectives ins Wohnzimmer traten. Bei ihnen war ein Mann, der sich als Detective Eckert vom Revier Brookline vorstellte – ein Name, den sie vermutlich in fünf Minuten wieder vergessen haben würde. Ihre ganze Aufmerksamkeit war auf Rizzoli gerichtet, mit der sie schon zusammengearbeitet hatte. Eine Frau, die sie mochte und respektierte.
Die Detectives nahmen Platz; und Rizzoli und Frost sahen Maura über den Couchtisch hinweg an. Sie fühlte sich in die Ecke gedrängt – vier gegen eine, alle Augen auf sie gerichtet. Frost zog Stift und Notizbuch aus der Tasche. Wieso machte er sich Notizen? Warum hatte sie plötzlich das Gefühl, dass ihr ein Verhör bevorstand?
»Wie geht es Ihnen, Doc?«, fragte Rizzoli mit sanfter, besorgter Stimme.
Maura musste über die banale Frage lachen. »Es ginge mir wesentlich besser, wenn ich wüsste, was hier gespielt wird.«
»Dürfte ich Sie fragen, wo Sie heute Abend gewesen sind?«
»Ich komme gerade vom Flughafen.«
»Was haben Sie da gemacht?«
»Ich war in Paris. Ich hatte einen Direktflug von Charles de Gaulle. Es war ein langer Flug, und ich bin absolut nicht in der Stimmung für irgendwelche Fragespielchen.«
»Wie lange waren Sie in Paris?«
»Eine Woche. Der Hinflug war letzten Mittwoch.« Maura glaubte einen anklagenden Unterton in Rizzolis direkten Fragen entdeckt zu haben, und aus ihrer leichten Verärgerung wurde allmählich Wut. »Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie meine Sekretärin Louise fragen. Sie hat den Flug für mich gebucht. Ich habe dort an einer Konferenz teilgenommen…«
»An der Internationalen Konferenz zur Forensischen Pathologie. Ist das korrekt?«
Maura stutzte. »Das wissen Sie schon?«
»Louise hat es uns gesagt.«
Sie haben Fragen über mich gestellt. Schon vor meiner Rückkehr aus Paris haben sie mit meiner Sekretärin gesprochen.
»Sie hat uns gesagt, dass die Maschine um siebzehn Uhr in Logan landen sollte«, sagte Rizzoli. »Jetzt ist es fast zehn. Wo sind Sie in der Zwischenzeit gewesen?«
»Unser Abflug von Charles de Gaulle hat sich verspätet. Irgendwas mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Die Fluggesellschaften sind ja inzwischen so paranoid; wir konnten froh sein, dass wir nach drei Stunden endlich abheben durften.«
»Sie sind also mit drei Stunden Verspätung gestartet.«
»Das sagte ich doch gerade.«
»Um wie viel Uhr sind Sie gelandet?«
»Ich weiß es nicht genau. So gegen halb neun.«
»Sie haben für die Fahrt von Logan hierher anderthalb Stunden gebraucht?«
»Mein Koffer ist nicht aufgetaucht. Ich musste bei Air France eine Verlustanzeige aufgeben.« Maura brach ab; sie war mit ihrer Geduld am Ende. »Verdammt noch mal, ich will jetzt endlich wissen, was das alles soll! Ich habe ein Recht, das zu erfahren, ehe ich irgendwelche weiteren Fragen beantworte. Werfen Sie mir irgendetwas vor?«
»Nein, Doc. Wir werfen Ihnen gar nichts vor. Wir versuchen nur, den Zeitrahmen zu ermitteln.«
»Den Zeitrahmen für was?«
Jetzt schaltete Frost sich ein. »Haben Sie irgendwelche Drohungen erhalten, Dr. Isles?«
Sie sah ihn verwirrt an. »Was?«
»Kennen Sie irgendjemanden, der einen Grund haben könnte, Ihnen etwas anzutun?«
»Nein.«
»Sind Sie sicher?«
Maura lachte frustriert auf. »Na ja, kann man sich jemals absolut sicher sein?«
»Es muss doch den einen oder anderen Prozess gegeben haben, bei dem Sie sich mit Ihrer Aussage bei irgendjemandem extrem unbeliebt gemacht haben«, sagte Rizzoli.
»Nur, wenn man sich mit der Wahrheit unbeliebt macht.«
»Sie haben sich im Gerichtssaal Feinde gemacht. Sie haben geholfen, Täter hinter Gitter zu bringen.«
»Das haben Sie ja wohl auch, Jane. Einfach nur, indem Sie Ihren Job gemacht haben.«
»Haben Sie irgendwelche spezifischen Drohungen erhalten? Briefe oder Anrufe?«
»Meine Nummer steht nicht im Telefonbuch. Und Louise gibt niemals meine Adresse heraus.«
»Was ist mit der Post, die Sie im Rechtsmedizinischen Institut erhalten haben?«
»Dann und wann bekommen wir schon mal einen verrückten Brief. Das geht jedem von uns so.«
»Verrückt?«
»Ja, von Leuten, die irgendetwas von grünen Männchen aus dem Weltraum oder von Verschwörungen faseln. Oder die uns beschuldigen, die Wahrheit über eine Autopsie zu vertuschen. Solche Briefe legen wir einfach unter ›S‹ wie Spinner ab. Außer natürlich, wenn es sich um eine offene Drohung handelt; dann leiten wir das Schreiben an die Polizei weiter.«
Maura sah, wie Frost etwas in sein Notizbuch kritzelte, und sie fragte sich, was er wohl geschrieben hatte. Inzwischen war sie so sauer, dass sie am liebsten aufgesprungen wäre und ihm das verdammte Notizbuch aus der Hand gerissen hätte.
»Doc«, fragte Rizzoli mit leiser Stimme, »haben Sie eine Schwester?«
Die Frage traf sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie starrte Rizzoli an; ihre Verärgerung war plötzlich wie weggeblasen. »Wie bitte?«
»Haben Sie eine Schwester?«
»Wieso fragen Sie mich das?«
»Ich muss es nun einmal wissen.«
Maura seufzte vernehmlich. »Nein, ich habe keine Schwester. Und Sie wissen genau, dass ich adoptiert wurde. Wann sagen Sie mir endlich, worum es hier überhaupt geht?«
Rizzoli und Frost tauschten einen kurzen Blick.
Frost klappte sein Notizbuch zu. »Ich denke, es wird Zeit, dass wir es ihr zeigen.«
Sie gingen zur Haustür, Rizzoli voran. Maura trat hinaus in die warme Sommernacht, grell erleuchtet wie ein Rummelplatz von den flackernden Lichtern der Streifenwagen. Ihre innere Uhr war noch auf Pariser Zeit eingestellt, und dort war es jetzt vier Uhr morgens; sie sah alles wie durch einen Schleier der Erschöpfung, und der ganze Abend kam ihr surreal vor, wie ein böser Traum. Kaum war sie zur Tür hinaus, richteten sich auch schon alle Blicke auf sie. Sie sah ihre Nachbarn, die sich auf der anderen Straßenseite hinter der Absperrung drängten und sie anstarrten. Als Gerichtsmedizinerin war sie es gewohnt, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen, auf Schritt und Tritt von Polizei und Medien beobachtet zu werden, doch die Aufmerksamkeit, die ihr an diesem Abend entgegenschlug, war irgendwie anders. Aufdringlicher, geradezu beängstigend. Sie war froh, als Rizzoli und Frost sie in die Mitte nahmen, wie um sie vor neugierigen Blicken zu schützen. Zusammen gingen sie auf den dunklen Ford Taurus zu, der vor Mr. Telushkins Haus am Straßenrand stand.
Maura hatte den Wagen noch nie gesehen, doch den bärtigen Mann mit Latexhandschuhen an den fleischigen Händen, der daneben stand, erkannte sie sofort. Es war Dr. Abe Bristol, ihr Kollege aus der Gerichtsmedizin. Abe war ein echter Gourmand, und seine Leibesfülle spiegelte seine Vorliebe für üppige Speisen. Sein Gürtel konnte den überschüssigen Bauchspeck kaum im Zaum halten. Er starrte Maura an und sagte: »Junge, Junge; das ist wirklich verblüffend. Fast wäre ich selbst drauf reingefallen.« Er deutete mit dem Kopf auf den Wagen. »Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet, Maura.«
Vorbereitet worauf?
Ihr Blick ging zu dem geparkten Taurus, und im Schein der Rundumleuchten konnte sie die Umrisse einer Gestalt erkennen, die zusammengesunken über dem Lenkrad hing. Die Windschutzscheibe war mit dunklen Spritzern übersät. Blut.
Rizzoli leuchtete mit ihrer Taschenlampe die Beifahrertür an. Maura verstand zuerst nicht, was sie ihr zeigen wollte; sie war noch ganz auf das blutbespritzte Fenster konzentriert. Dann sah sie, worauf der Lichtstrahl von Rizzolis Maglite gerichtet war. Direkt unter dem Türgriff waren drei parallele Schrammen zu sehen, tief in den Lack geritzt.
»Wie Spuren von Krallen«, sagte Rizzoli. Sie krümmte die Finger, als wollte sie die Kratzbewegung nachahmen.
Maura starrte die Schrammen an. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Keine Krallen. Die Klaue eines gewaltigen Raubvogels.
»Und jetzt kommen Sie mal mit auf die Fahrerseite«, sagte Rizzoli.
Maura stellte keine Fragen, als sie mit Rizzoli um das Heck des Taurus herumging.
»In Massachusetts zugelassen«, sagte Rizzoli. Der Strahl ihrer Taschenlampe streifte das Nummernschild. Doch es war nur ein Detail, im Vorübergehen registriert; Rizzoli ging gleich weiter zur Fahrertür, wo sie stehen blieb und Maura ansah.
»Das ist es, was uns alle so fertig gemacht hat«, sagte sie. Sie leuchtete mit der Taschenlampe in den Wagen.
Der Strahl fiel direkt auf das Gesicht der Frau, das zum Fenster gewandt war. Ihre rechte Wange ruhte auf dem Lenkrad, ihre Augen waren offen.
Maura verschlug es die Sprache. Geschockt starrte sie auf die elfenbeinfarbene Haut, die schwarzen Haare, die vollen Lippen, die leicht geöffnet waren, als sei die Frau überrascht worden. Maura fuhr taumelnd zurück; ihr war, als seien ihre Knochen plötzlich aus Gummi, ihr wurde schwindlig, und sie hatte das Gefühl, hilflos zu treiben, ohne festen Boden unter den Füßen. Eine Hand packte sie am Arm, gab ihr Halt. Es war Pater Brophy, der unmittelbar hinter ihr stand. Sie hatte ihn gar nicht bemerkt.
Jetzt begriff sie, warum alle so fassungslos auf ihren Anblick reagiert hatten. Sie starrte die Leiche auf dem Fahrersitz an, das Gesicht im hellen Schein von Rizzolis Taschenlampe.
Das bin ich. Diese Frau da bin ich.
2
Sie saß auf der Couch und nahm einen Schluck von ihrem Wodka mit Soda. Die Eiswürfel klirrten im Glas. Zum Teufel mit klarem Wasser – dieser Schock verlangte nach einer härteren Medizin, und Pater Brophy war so verständnisvoll gewesen, ihr einen kräftigen Drink zu mixen und ihr das Glas kommentarlos in die Hand zu drücken. Es kommt schließlich nicht jeden Tag vor, dass man sich selbst als Leiche sieht. Dass man zu einem Tatort kommt und ohne Vorwarnung mit seinem leblosen Doppelgänger konfrontiert wird.
»Es ist nur ein Zufall«, flüsterte sie. »Die Frau gleicht mir eben, das ist alles. Viele Frauen haben schwarze Haare. Und ihr Gesicht – in dem Auto da draußen kann man ihr Gesicht doch gar nicht richtig erkennen.«
»Ich weiß nicht, Doc«, sagte Rizzoli. »Die Ähnlichkeit ist ziemlich erschreckend.« Sie ließ sich in den Sessel sinken und seufzte, als ihr hochschwangerer Leib in den weichen Kissen versank.
Arme Rizzoli, dachte Maura. Frauen im achten Monat sollten sich nicht mit Mordermittlungen herumschlagen müssen.
»Ihre Frisur ist anders«, sagte Maura.
»Die Haare sind ein bisschen länger, das ist alles.«
»Ich habe einen Pony. Die Frau nicht.«
»Finden Sie nicht, dass das ein ziemlich oberflächliches Detail ist? Sehen Sie sich doch ihr Gesicht an. Sie könnte Ihre Schwester sein.«
»Warten wir doch ab, bis wir sie bei besserem Licht sehen können. Vielleicht gleicht sie mir dann gar nicht mehr.«
»Die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen«, warf Pater Brophy ein. »Wir haben es alle gesehen. Sie gleicht Ihnen aufs Haar.«
»Und dazu kommt, dass sie in einem Wagen sitzt, der in Ihrer Straße geparkt ist«, fügte Rizzoli hinzu. »Praktisch vor Ihrer Haustür. Und das hier hatte sie auf dem Rücksitz.« Rizzoli hielt einen transparenten Plastikbeutel hoch. Maura konnte sehen, dass er einen Artikel aus dem Boston Globe enthielt. Die Schlagzeile war so groß, dass sie sie auch über den Couchtisch hinweg lesen konnte.
GERICHTSMEDIZINERIN:RAWLINS-BABY WURDE MISSHANDELT
»Das ist ein Foto von Ihnen, Doc«, sagte Rizzoli. »Die Bildunterschrift lautet: ›Pathologin Dr. Maura Isles beim Verlassen des Gerichtssaals nach ihrer Aussage im Rawlins-Prozess.« Sie sah Maura in die Augen. »Das Opfer hatte diesen Zeitungsausschnitt bei sich im Wagen.«
Maura schüttelte den Kopf. »Aber warum?«
»Das fragen wir uns auch.«
»Der Rawlins-Prozess – das war vor fast zwei Wochen.«
»Erinnern Sie sich daran, diese Frau im Gerichtssaal gesehen zu haben?«
»Nein. Ich habe sie noch nie im Leben gesehen.«
»Aber offenbar hat die Frau Sie gesehen. Zumindest in der Zeitung. Und dann taucht sie hier auf. Wollte sie mit Ihnen sprechen? Ihnen auflauern?«
Maura starrte auf ihr Glas. Der Wodka stieg ihr schon zu Kopf. Es ist noch keine vierundzwanzig Stunden her, dachte sie, da bin ich durch die Straßen von Paris spaziert. Habe den Sonnenschein genossen, die köstlichen Düfte aus den Straßencafés. Wie habe ich es geschafft, in so kurzer Zeit in diesen Albtraum hineinzuschlittern?
»Haben Sie eine Schusswaffe im Haus, Doc?«, fragte Rizzoli.
Mauras Miene verhärtete sich, sie straffte die Muskeln. »Was soll diese Frage?«
»Aber nein, ich will Sie doch gar nicht beschuldigen. Ich habe mich bloß gefragt, ob Sie eine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen.«
»Ich besitze keine Waffe. Ich habe oft genug gesehen, was die Dinger mit einem menschlichen Körper anrichten können. So was kommt mir nicht ins Haus.«
»Okay. War ja nur eine Frage.«
Maura nahm noch einen Schluck von ihrem Wodka. Sie brauchte die flüssige Stärkung, ehe sie die nächste Frage stellte: »Was wissen Sie über das Opfer?«
Frost nahm sein Notizbuch zur Hand und blätterte es durch wie ein penibler Beamter. So vieles an Barry Frost erinnerte Maura an einen sanftmütigen Bürokraten, jederzeit bereit, den Bleistift zu zücken und sich eine Notiz zu machen. »Laut Führerschein, den wir in ihrer Handtasche gefunden haben, heißt sie Anna Jessop, ist vierzig Jahre alt und wohnt in Brighton. Der Wagen ist auch auf den Namen Jessop zugelassen.«
Maura hob den Kopf. »Das ist nur ein paar Meilen von hier.«
»Bei der Adresse handelt es sich um eine Wohnanlage. Die Nachbarn scheinen nicht viel über sie zu wissen. Wir versuchen zurzeit noch, die Vermieterin zu erreichen, damit sie uns in die Wohnung lässt.«
»Sagt Ihnen der Name Jessop irgendetwas?«, fragte Rizzoli.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kennen niemanden, der so heißt.«
»Kennen Sie irgendjemanden in Maine?«
»Wieso fragen Sie mich das?«
»Sie hatte ein Strafmandat wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Tasche. Offenbar ist sie vor zwei Tagen von einer Streife angehalten worden, als sie auf dem Maine Turnpike in Richtung Süden fuhr.«
»Ich kenne niemanden in Maine.« Maura holte tief Luft. »Wer hat sie gefunden?«, fragte sie.
»Ihr Nachbar Mr. Telushkin hat die Polizei angerufen«, antwortete Rizzoli. »Er hat seinen Hund ausgeführt, und dabei ist ihm der Taurus aufgefallen, der vor seinem Haus parkte.«
»Wann war das?«
»Gegen zwanzig Uhr.«
Natürlich, dachte Maura. Nach Mr. Telushkin konnte man die Uhr stellen, wenn er jeden Abend um die gleiche Zeit seinen Hund ausführte. Typisch Ingenieur – immer korrekt und berechenbar. Aber heute Abend war er dem Unberechenbaren begegnet.
»Hat er denn nichts gehört?«
»Er sagt, er habe ungefähr zehn Minuten vorher ein Geräusch gehört, das er für eine Fehlzündung hielt. Aber niemand hat gesehen, wie es passierte. Nachdem er den Taurus entdeckt hatte, rief er die Polizei an und meldete, dass seine Nachbarin Dr. Isles gerade erschossen worden sei. Die Kollegen von Brookline waren als Erste am Tatort, zusammen mit Detective Eckert hier. Frost und ich sind gegen neun eingetroffen.«
»Warum eigentlich?«, entgegnete Maura. Das war die Frage, die sich ihr sofort gestellt hatte, als sie Rizzoli auf dem Rasen vor ihrem Haus entdeckt hatte. »Warum sind Sie in Brookline? Das ist doch gar nicht Ihr Revier.«
Rizzoli sah Detective Eckert an.
Ein wenig verlegen antwortete dieser: »Na ja, wissen Sie, wir hatten letztes Jahr nur einen einzigen Mord hier in Brookline. Da dachten wir, unter den gegebenen Umständen wäre es wohl sinnvoll, sich an Boston zu wenden.«
Ja, das schien allerdings sinnvoll, wie Maura zugeben musste. Brookline war kaum mehr als eine reine Schlafstadt, eine friedliche Oase inmitten der Metropole Boston. Das Boston Police Department hatte im vergangenen Jahr sechzig Tötungsdelikte untersucht. Übung macht den Meister, auch wenn es um Mordermittlungen geht.
»Wir hätten uns hier sowieso eingeschaltet«, erklärte Rizzoli. »Nachdem wir gehört hatten, wer das Opfer war. Wer angeblich das Opfer war.« Nach einer Pause fuhr sie fort: »Ich muss zugeben, ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass Sie es vielleicht nicht sein könnten. Ich habe einen Blick auf das Opfer geworfen und ganz selbstverständlich angenommen…«
»Das ging uns allen so«, sagte Frost.
Es war eine Weile still.
»Wir wussten, dass Sie heute Abend aus Paris zurückkommen sollten«, sagte Rizzoli. »Das haben wir von Ihrer Sekretärin erfahren. Das Einzige, was wir uns nicht erklären konnten, war der Wagen. Wieso Sie in einem Auto sitzen, das auf eine andere Frau zugelassen ist.«
Maura leerte ihr Glas und stellte es auf dem Couchtisch ab. Ein Drink, mehr konnte sie heute Abend nicht vertragen. Schon jetzt fühlten ihre Arme und Beine sich taub an, und sie hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Die Lampen tauchten den Raum in ein warmes Dämmerlicht, und sie nahm die Konturen nur noch verschwommen wahr. Das geschieht alles nicht wirklich, dachte sie. Ich sitze im Flugzeug, irgendwo über dem Atlantik, und schlafe – und wenn ich aufwache, werde ich feststellen, dass wir gerade gelandet sind. Dass das alles nie passiert ist.
»Wir wissen nichts über Anna Jessop«, sagte Rizzoli. »Wir wissen nur das, was wir alle mit eigenen Augen gesehen haben – dass sie Ihnen aufs Haar gleicht, Doc. Mag sein, dass ihre Haare ein bisschen länger sind. Mag sein, dass es den einen oder anderen Unterschied gibt. Aber die Sache ist die: Wir sind darauf hereingefallen. Wir alle, ohne Ausnahme. Und wir kennen Sie.« Sie hielt einen Moment inne. »Sie ahnen schon, worauf ich hinauswill, nicht wahr?«
Ja, Maura ahnte es, aber sie wollte es nicht aussprechen. Sie saß nur da, den Blick starr auf das Glas auf dem Couchtisch gerichtet. Auf die schmelzenden Eiswürfel.
»Wenn wir darauf hereingefallen sind, könnte es einem anderen ebenso gegangen sein«, sagte Rizzoli. »Auch der Person, die ihr diese Kugel in den Kopf gejagt hat. Es war kurz vor zwanzig Uhr, als Ihr Nachbar die vermeintliche Fehlzündung hörte. Um die Zeit wurde es schon dunkel. Und da war sie; sie saß in einem geparkten Wagen, ein paar Meter von Ihrer Einfahrt entfernt. Jeder, der die Frau in diesem Wagen sah, musste annehmen, dass Sie es waren.«
»Sie glauben, dass der Anschlag mir galt«, sagte Maura.
»Das ist doch einleuchtend, oder?«
Maura schüttelte den Kopf. »Für mich ergibt das alles keinen Sinn.«
»Sie sind durch Ihren Job sehr exponiert. Sie sagen bei Mordprozessen aus. Sie stehen in der Zeitung. Sie sind unsere Königin der Toten.«
»Nennen Sie mich nicht so.«
»Alle Cops nennen Sie so. Auch die Presse. Das wissen Sie doch, oder nicht?«
»Das heißt noch lange nicht, dass mir dieser Spitzname gefällt. Ehrlich gesagt, ich kann ihn überhaupt nicht leiden.«
»Aber es ist unbestreitbar so, dass Sie auffallen. Nicht nur wegen Ihrer Tätigkeit, sondern auch wegen Ihres Aussehens. Sie wissen doch, dass die Männer sich nach Ihnen umdrehen, nicht wahr? Sie müssten ja blind sein, um das nicht zu bemerken. Eine so gut aussehende Frau kann sich der Aufmerksamkeit der Herren der Schöpfung immer gewiss sein. Hab ich Recht, Frost?«
Frost zuckte zusammen; offensichtlich hatte sie ihn mit ihrer Frage überrumpelt. Das Blut schoss ihm in die Wangen. Der arme Frost, bei jeder Gelegenheit lief er rot an. »Na ja, ist doch nur menschlich, oder?«, gab er zu.
Maura sah Pater Brophy an, der ihren Blick jedoch nicht erwiderte. Sie fragte sich, ob er den gleichen Anziehungskräften unterworfen war wie sie und alle anderen. Sie wollte, dass es so war; sie wollte glauben, dass Daniel nicht immun war gegen die Art von Gedanken, die ihr im Kopf herumgingen.
»Eine hübsche Frau, die im Licht der Öffentlichkeit steht«, sagte Rizzoli. »Ein Stalker heftet sich an ihre Fersen, sie wird vor ihrem eigenen Haus überfallen. Das passiert nicht zum ersten Mal. Wie hieß noch mal diese Schauspielerin drüben in L.A.? Die damals ermordet wurde?«
»Rebecca Schaefer«, sagte Frost.
»Genau. Und dann der Fall Lori Hwang hier bei uns. Sie erinnern sich doch, Doc.«