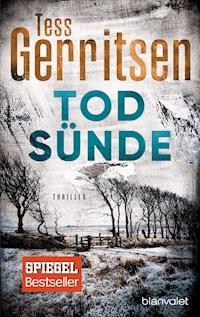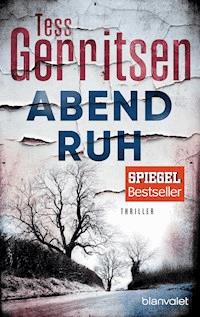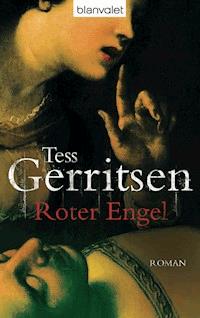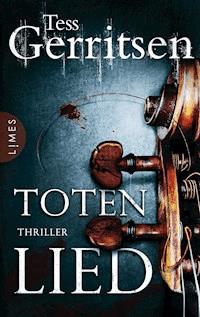9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Spenderherz führt auf die Spur eines eiskalten Verbrechens ...
Assistenzärztin Abby DiMatteo ist außer sich: Nachdem ihr eine der begehrten Stellen im Transplantationsteam des Bayside-Hospitals in Boston angeboten wurde, bekommt sie es bei ihrer ersten Operation mit fragwürdiger Krankenhauspolitik zu tun. Eines der raren Spenderherzen soll an die keineswegs todkranke Frau des schwerreichen Victor Voss gehen. Abby wird misstrauisch und beginnt eigene Nachforschungen anzustellen. Nicht ahnend, wen sie sich damit zum Feind macht – und aus welcher dunklen Quelle dieses Herz stammt …
Für noch mehr nervenzerreißende Spannung aus der Feder von Thrill-Königin Tess Gerritsen lesen Sie auch »Spy Coast – Die Spionin« oder die Fälle für Detective Jane Rizzoli und Pathologin Maura Isles!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Autorin
So gekonnt wie Tess Gerritsen vereint niemand erzählerische Raffinesse mit medizinischer Detailgenauigkeit und psychologischer Glaubwürdigkeit der Figuren. Bevor sie mit dem Schreiben begann, war die Autorin selbst erfolgreiche Ärztin. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Thriller Die Chirurgin, in dem Detective Jane Rizzoli erstmals ermittelt. Seither sind Tess Gerritsens Thriller von den internationalen Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Maine.
Von Tess Gerritsen bereits erschienen
Gute Nacht, Peggy Sue · Kalte Herzen · Roter Engel · Trügerische Ruhe · In der Schwebe · Leichenraub · Totenlied · Das Schattenhaus · Die Studentin
Die Rizzoli-&-Isles-Thriller
Die Chirurgin · Der Meister · Todsünde · Schwesternmord · Scheintot · Blutmale · Grabkammer · Totengrund · Grabesstille · Abendruh · Der Schneeleopard · Blutzeuge · Mutterherz
Die Martini-Club-Thriller
Spy Coast – Die Spionin · Die Sommergäste
Buch
Assistenzärztin Abby DiMatteo ist außer sich: Nachdem ihr eine der begehrten Stellen im Transplantationsteam des Bostoner Bayside-Hospitals angeboten wurde, bekommt sie es bei ihrer ersten Operation mit fragwürdiger Krankenhauspolitik zu tun. Eines der raren Spenderherzen soll an die keineswegs todkranke Frau des schwerreichen Victor Voss gehen. Abby wird misstrauisch und beginnt eigene Nachforschungen anzustellen. Nicht ahnend, wen sie sich damit zum Feind macht – und aus welcher dunklen Quelle dieses Herz stammt …
Tess Gerritsen
KALTE HERZEN
Thriller
Deutsch von Kristian Lutze
Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Harvest« bei Pocket Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Neuausgabe 2025 by Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Taschenbuchausgabe Februar 2003
by Blanvalet, einem Unternehmen
der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright der Originalausgabe © by Tess Gerritsen 1996
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 1997 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition is published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, New York.
Covergestaltung: © www.buerosued.de
Coverdesign und -motiv: Trevillion Images / Ute Klaphake
SH · Herstellung: DiMo · SaVo
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978 3 641 16413-3
www.blanvalet.de
Für Jacob, meinen Mann und besten Freund
Danksagung
Herzlich danke ich Emily Bestler für ihr freundliches und verständnisvolles Lektorat, David Bowman dafür, dass er mich von seinen Kenntnissen über die russische Mafia profitieren ließ, und den Transplantationskoordinatoren Susan Pratt vom Penobscot Bay Medical Center und Bruce White vom Maine Medical Center für die durch sie eröffneten unschätzbaren Einblicke ins Organspendeverfahren. Ebenso gilt mein Dank Patty Kahn für ihre Hilfe bei der Benutzung des Computers der medizinischen Bibliothek, John Sargent aus Rockland, Maine, für seine Beratung und Roger Pepper für die vertrauensvolle Überlassung von Untersuchungsmaterial.
Nicht zu vergessen mein ganz besonderer Dank an Meg Ruley und Don Cleary von der Jane Rotrosen Agency. Sie haben dieses Buch überhaupt erst möglich gemacht.
Eins
Er war klein für sein Alter, kleiner als die anderen Jungen, die in der Unterführung in Arbats-Kaya bettelten, doch mit elf hatte er schon alles ausprobiert. Er rauchte seit vier Jahren Zigaretten, stahl, seit er acht war, und ging seit zwei Jahren auf den Strich. Letzteres mochte Jakov nicht besonders, aber Onkel Mischa bestand darauf. Wie sollten sie sonst Brot und Zigaretten kaufen? Als kleinster und blondester von Onkel Mischas Jungen trug Jakov die Hauptlast des Geschäfts. Die Freier bevorzugten immer die jungen und blonden. Das Fehlen seiner linken Hand schien sie nicht zu stören; die meisten bemerkten den verkümmerten Stumpf gar nicht. Sie waren zu angetan von seinem zierlichen Wuchs, seinen blonden Haaren und seinen unerschrockenen blauen Augen.
Jakov sehnte sich danach, zu alt für dieses Geschäft zu werden und sich seinen Lebensunterhalt durch Taschendiebstähle zu verdienen wie die anderen Jungen. Jeden Morgen, wenn er in Onkel Mischas Wohnung aufwachte, und jeden Abend vor dem Einschlafen packte er mit seiner gesunden Hand das Kopfteil seiner Pritsche und reckte sich in der Hoffnung, seiner Größe wenigstens ein paar Millimeter hinzuzufügen. Jakov war klein, weil er aus einer verkümmerten Linie stammte. Die Frau, die ihn vor acht Jahren in Moskau allein zurückgelassen hatte, war auch verkrüppelt gewesen. Jakov konnte sich kaum an die Frau erinnern, genauso wenig wie an irgendetwas anderes von seinem Leben in der Stadt. Er wusste, was Onkel Mischa ihm erzählt hatte, und glaubte davon höchstens die Hälfte. Für das zarte Alter von elf Jahren war Jakov nicht nur kleinwüchsig, sondern auch ungewöhnlich helle.
Deshalb betrachtete er den Mann und die Frau, die mit Onkel Mischa am Esstisch über Geschäfte sprachen, auch mit natürlicher Skepsis.
Das Paar war in einem großen schwarzen Wagen mit getönten Scheiben vorgefahren. Der Mann hieß Gregor und trug einen Anzug mit passender Krawatte und Schuhe aus echtem Leder. Nadja, die Frau, war eine Blondine in einem Rock und einer Jacke aus edler Wolle. Sie trug einen Hartschalenkoffer. Nadja war keine Russin, das war allen vier Jungen in der Wohnung sofort klar. Vielleicht Amerikanerin oder Engländerin. Sie sprach fließend russisch, aber mit einem Akzent.
Während die beiden Männer bei einer Flasche Wodka das Geschäftliche beredeten, wanderte der Blick der Frau durch die winzige Wohnung. Sie registrierte die an die Wand gerückten alten Feldbetten, die Haufen dreckiger Laken und die vier in ängstlichem Schweigen zusammengekauerten Jungen. Nadja hatte hellgraue Augen, schöne Augen, und sie musterte die Jungen nacheinander. Zuerst betrachtete sie Pjotr, der mit fünfzehn der älteste war, dann den dreizehnjährigen Stepan und den zehnjährigen Alexei.
Und zuletzt sah sie Jakov an.
Jakov war es gewohnt, von Erwachsenen auf diese Art gemustert zu werden, und er erwiderte ihren Blick ruhig. Ungewohnt war es, so rasch übergangen zu werden. Normalerweise ignorierten die Erwachsenen die älteren Jungen, aber diesmal war es der hagere, pickelige Pjotr, der die Aufmerksamkeit der Frau auf sich zog.
»Sie tun das Richtige, Mikhail Isayevich«, sagte Nadja zu Mischa. »Diese Kinder haben hier keine Zukunft. Wir bieten ihnen eine einmalige Gelegenheit!« Sie lächelte den Jungen zu.
Stepan, der Dummkopf, grinste zurück wie ein verliebter Idiot.
»Sie wissen, dass sie kein Englisch sprechen«, sagte Onkel Mischa. »Nur das eine oder andere Wort.«
»Kinder schnappen so was schnell auf, praktisch mühelos.«
»Sie werden Zeit brauchen zum Lernen. Die Sprache, das Essen …«
»Unsere Agentur kennt die Anpassungsprobleme und Bedürfnisse der Jungen. Wir arbeiten mit zahlreichen russischen Kindern, Waisen wie diese. Für eine Weile werden sie eine Spezialschule besuchen, um die notwendige Zeit zur Umstellung zu erhalten.«
»Und wenn sie es nicht schaffen?«
Nadja zögerte. »Hin und wieder gibt es Ausnahmen, Kinder mit emotionalen Problemen.« Ihr Blick wanderte über die vier Jungen. »Gibt es einen, der Ihnen besondere Sorgen macht?«
Jakov wusste, dass er derjenige mit den Problemen war, von denen sie sprachen. Derjenige, der selten lachte und nie weinte. Derjenige, den Onkel Mischa sein »kleines Steinmännchen« nannte. Jakov wusste nicht, warum er nie weinte. Wenn den anderen Jungen weh getan wurde, vergossen sie große Tränen. Jakov dagegen schaltete einfach ab. Totale Mattscheibe, so wie im Fernsehen spätabends, wenn die Sender abgeschaltet hatten. Kein Programm, keine Bilder, nur dieses beruhigende weiße Flimmern.
»Sie sind alle gute Jungen«, versicherte Onkel Mischa. »Prachtburschen.«
Jakov musterte die drei anderen Jungen. Pjotr hatte eine vorstehende Stirn und leicht vorgebeugte Schultern wie ein Gorilla. Stepan hatte komische Ohren, klein und faltig, dazwischen ein Hirn von der Größe einer Walnuss. Alexei lutschte am Daumen.
Und ich, dachte Jakov und betrachtete den Stumpf seines Unterarms, habe bloß eine Hand. Warum nennen sie uns Prachtkerle? Doch genau das war es, was Onkel Mischa nicht aufhörte zu beteuern. Und die Frau nickte. Ja, es waren gute Jungen, gesunde Jungen.
»Selbst ihre Zähne sind in Ordnung!«, betonte Mischa. »Kein bisschen verfault. Und sehen Sie, wie groß Pjotr ist.«
»Der da sieht ein bisschen unterernährt aus.« Gregor zeigte auf Jakov. »Und was ist mit seiner Hand passiert?«
»Er wurde schon so geboren.«
»Die Strahlung?«
»Ansonsten ist er vollkommen intakt. Ihm fehlt nur die Hand.«
»Das sollte kein Problem sein«, sagte Nadja und erhob sich von ihrem Stuhl. »Wir müssen aufbrechen. Es wird Zeit.«
»Schon so bald?«
»Wir haben einen Terminplan einzuhalten.«
»Aber ihre Kleidung?«
»Die Agentur wird sie neu einkleiden. Und besser.«
»Muss denn alles so schnell gehen? Haben wir keine Zeit, uns voneinander zu verabschieden?«
Ein Anflug von Verärgerung blitzte in den Augen der Frau auf. »Aber nur einen Moment. Wir wollen unsere Anschlüsse nicht verpassen.«
Onkel Mischa sah seine Jungen an, seine vier Jungen, die weder durch Blutsbande noch Liebe, sondern allein durch gegenseitige Abhängigkeit und Bedürftigkeit an ihn gebunden waren. Er umarmte einen nach dem anderen. Als er zu Jakov kam, drückte er ihn ein wenig enger und länger. Onkel Mischa roch nach Zwiebeln und Zigaretten. Es waren vertraute Gerüche, gute Gerüche. Doch Jakov zog sich instinktiv zurück. Er mochte es nicht, umarmt oder berührt zu werden, von niemandem.
»Denk immer an deinen Onkel«, flüsterte Mischa. »Wenn du reich bist in Amerika, denk daran, wie ich mich um dich gekümmert habe.«
»Ich will nicht nach Amerika«, sagte Jakov.
»Es ist das Beste so. Für euch alle!«
»Ich will bei dir bleiben, Onkel! Ich will hierbleiben!«
»Du musst fahren!«
»Warum?«
»Weil ich es so entschieden habe.« Onkel Mischa packte seine Schulter und schüttelte sie kräftig. »Ich habe entschieden!«
Jakov sah zu den anderen Jungen hinüber, die sich gegenseitig angrinsten, und dachte: Sie sind glücklich darüber. Warum bin ich der Einzige, der Zweifel hat?
Die Frau nahm Jakov bei der Hand. »Ich bringe sie zum Wagen. Gregor kann noch eben den Papierkram erledigen.«
»Onkel?«, rief Jakov.
Aber Mischa hatte sich bereits abgewandt und starrte aus dem Fenster.
Nadja führte die Jungen in den Flur und die Treppe hinunter. Sie mussten drei Stockwerke herabsteigen. Das Trampeln der Füße und der Lärm der Jungen hallten laut in dem leeren Treppenhaus wider.
Sie waren schon im Erdgeschoss, als Alexei auf einmal stehen blieb. »Wartet! Ich habe Shu-Shu vergessen!«, rief er und begann, wieder nach oben zu laufen.
»Komm zurück!«, rief Nadja. »Du kannst nicht da hochlaufen!«
»Ich kann ihn nicht hierlassen!«, antwortete Alexei.
»Komm sofort zurück!«
»Ohne Shu-Shu kommt er nicht mit.«
»Wer zum Teufel ist Shu-Shu?«, fauchte sie.
»Sein ausgestopfter Hund. Er hat ihn schon ewig.«
Sie blickte im Treppenhaus nach oben, und in diesem Moment sah Jakov in ihren Augen etwas, was er nicht verstand.
Er sah Furcht.
Sie stand da, scheinbar vor der Wahl, ob sie Alexei folgen oder ihn aufgeben sollte. Als der Junge mit dem zerfledderten Shu-Shu die Treppe hinunterkam, schien die Frau vor Erleichterung gegen das Geländer zu sinken.
»Ich habe ihn!«, rief Alexei mit dem ausgestopften Tier im Arm.
»Jetzt aber los«, sagte die Frau und scheuchte sie hinaus.
Die vier Jungen drängelten sich auf den Rücksitz des Wagens. Es war sehr eng, und Jakov musste halb auf Pjotrs Schoß sitzen.
»Kannst du deinen knochigen Arsch nicht woanders hintun?«, knurrte Pjotr.
»Wohin denn? In dein Gesicht?«
Pjotr schubste ihn. Er schubste zurück.
»Hört auf!«, befahl die Frau auf dem Vordersitz. »Benehmt euch.«
»Aber hier hinten ist nicht genug Platz«, nörgelte Pjotr.
»Dann macht Platz. Und seid still!« Die Frau blickte zum dritten Stock des Hauses hoch, zu Mischas Wohnung.
»Worauf warten wir?«, fragte Alexei.
»Auf Gregor. Er unterschreibt die Papiere.«
»Wie lang dauert das noch?«
Die Frau lehnte sich zurück und starrte geradeaus. »Nicht lange.«
Das war knapp, dachte Gregor, als Alexei die Wohnung zum zweiten Mal verließ und die Tür hinter sich zuschlug. Wäre der kleine Stinker auch nur einen Moment später gekommen, wäre die Hölle los gewesen. Wie kam diese dämliche Nadja dazu, den Bengel noch einmal nach oben zu lassen? Er war von Anfang an dagegen gewesen, mit Nadja zu arbeiten. Aber Reuben hatte auf einer Frau bestanden. Einer Frau würden die Leute vertrauen.
Die Schritte des Jungen verhallten im Treppenhaus, bevor unten eine Tür schlug.
Gregor drehte sich zu dem Zuhälter um.
Mischa stand am Fenster und starrte auf die Straße zu dem Wagen, in dem die vier Jungen saßen. Er drückte seine Hand an die Scheibe, die Finger waren zu einem Lebewohl gespreizt. Als er sich zu Gregor umdrehte, standen tatsächlich Tränen in seinen Augen.
Aber seine ersten Worte galten dem Geld. »Ist es in dem Koffer?«
»Ja«, erwiderte Gregor.
»Alles?«
»Zwanzigtausend amerikanische Dollar. Fünftausend Dollar pro Kind. Auf diesen Preis hatten wir uns geeinigt.«
»Ja«, seufzte Mischa und strich sich mit der Hand über das Gesicht, ein Gesicht, in dessen Furchen sich die Wirkung von zu viel Wodka und zu vielen Zigaretten deutlich abzeichnete. »Sie werden auch bestimmt von anständigen Familien adoptiert werden?«
»Nadja wird sich darum kümmern. Sie liebt Kinder, müssen Sie wissen. Deshalb hat sie sich für diese Tätigkeit entschieden.«
Mischa brachte ein mattes Lächeln zustande. »Vielleicht könnte sie auch für mich eine amerikanische Familie finden.«
Gregor musste ihn vom Fenster weglocken. Er wies auf den Koffer auf dem Tisch. »Los, zählen Sie nach, wenn Sie wollen.«
Mischa ging zu dem Koffer und ließ das Schloss aufschnappen. Er enthielt ordentlich gebündelte Stapel amerikanischer Banknoten. Zwanzigtausend Dollar, genug für all den Wodka, den ein Mann brauchte, um seine Leber zu ruinieren. Wie billig es heutzutage ist, die Seele eines Menschen zu kaufen, dachte Gregor. Auf den Straßen des neuen Russlands konnte man alles bekommen, eine Kiste israelischer Orangen, ein amerikanisches Fernsehgerät, das Vergnügen eines weiblichen Körpers. Gelegenheiten boten sich überall, wenn man sie zu ergreifen wusste.
Mischa stand da und starrte auf das Geld, sein Geld, doch es war kein triumphierender Blick, sondern eher einer des Ekels. Er stützte sich, den Kopf gesenkt, mit beiden Händen auf den Koffer.
Gregor trat hinter ihn, hob den Lauf der schallgedämpften Automatik an Mischas schütteren Hinterkopf und feuerte zwei Kugeln in das Gehirn des Mannes. Blut und graue Masse spritzten an die Wand. Mischa stürzte kopfüber zu Boden und riss den Tisch mit sich. Der Koffer fiel auf den Teppich neben ihn.
Gregor ergriff den Koffer, bevor die Blutlache ihn erreichte. An den Kofferseiten klebten Gewebefetzen. Der Mann ging ins Bad und wischte die Spritzer mit Klopapier ab, das er in der Toilette wegspülte. Als er wieder in das Zimmer kam, in dem Mischa lag, war das Blut schon über den Boden in den Teppich gesickert.
Gregor sah sich in dem Zimmer um und vergewisserte sich, dass er seine Arbeit erledigt hatte, ohne Spuren zu hinterlassen. Er war versucht, die Wodkaflasche mitzunehmen, entschied sich jedoch dagegen. Er hätte erklären müssen, warum er Mischas kostbare Flasche dabeihatte, und Gregor besaß keine Geduld mit Kinderfragen. Das war Nadjas Part.
Er verließ die Wohnung und ging nach unten, wo Nadja mit ihren Schützlingen im Wagen wartete. Sie sah Gregor fragend an, als er hinter das Steuer rutschte.
»Sind alle Papiere unterschrieben?«, fragte sie.
»Ja, alle.«
Nadja lehnte sich zurück und stieß einen hörbaren Seufzer der Erleichterung aus. Sie hat keine Nerven für so etwas, dachte Gregor, als er den Wagen anließ. Egal, was Reuben sagt, die Frau war eine Belastung.
Auf dem Rücksitz entstand Unruhe. Gregor blickte in den Rückspiegel und erkannte, dass die Jungen sich gegenseitig hin und her schubsten. Alle, bis auf Jakov, der starr geradeaus guckte. Als sich ihre Blicke im Spiegel trafen, hatte Gregor das unheimliche Gefühl, dass ihn aus diesem Kindergesicht die Augen eines Erwachsenen anstarrten.
Dann wendete sich der Junge ab und kniff seinen Nachbarn in die Schulter. Der Rücksitz war ein einziges Gewimmel zappelnder Körper und rudernder Arme und Beine.
»Benehmt euch!«, ermahnte Nadja. »Könnt ihr nicht still sein? Bis Riga haben wir eine lange Fahrt vor uns.«
Die Jungen beruhigten sich. Einen Moment lang herrschte Stille auf dem Rücksitz. Dann sah Gregor, wie der Kleine mit den erwachsenen Augen seinen Nachbarn mit dem Ellenbogen knuffte.
Darüber musste Gregor lächeln. Kein Grund zur Besorgnis, dachte er. Sie waren schließlich doch bloß Kinder.
Zwei
Es war Mitternacht, und Karen Terrio kämpfte dagegen an, dass ihr die Augen zufielen, kämpfte, den Wagen auf der Straße zu halten.
Sie war jetzt seit fast zwei Tagen unterwegs. Direkt nach Tante Georginas Beerdigung war sie aufgebrochen und hatte seitdem keinen Halt gemacht, außer für ein kurzes Nickerchen oder einen Hamburger und Kaffee. Jede Menge Kaffee. Die Beerdigung ihrer Tante war zu einer verschwommenen Erinnerung verblasst. Welke Gladiolen, namenlose Cousinen, lasche Sandwiches. Und Verpflichtungen, so verdammt viele Verpflichtungen.
Jetzt wollte sie nur noch nach Hause.
Sie wusste, dass sie besser noch einmal anhalten und ein kurzes Nickerchen machen sollte, bevor sie weiterfuhr. Aber sie war schon so nah, nur noch fünfzig Meilen von Boston entfernt. Beim letzten Dunkin Donuts hatte sie drei weitere Tassen Kaffee getankt. Das hatte geholfen, zumindest ein wenig. Der Koffeinschub hatte sie von Springfield bis Sturbridge gebracht, aber jetzt ließ seine Wirkung nach. Und obwohl sie sich wach fühlte, sackte ihr Kopf immer wieder nach vorne, und sie war eingeschlafen, sei es auch nur für eine Sekunde.
In der vor ihr liegenden Dunkelheit lockte ein Burger-King-Schild. Sie verließ den Highway.
Im Restaurant bestellte sie Kaffee und einen Blaubeer-Muffin. Um diese Nachtzeit saßen nur ein paar vereinzelte Gäste an den Tischen, und alle trugen die gleiche blässliche Maske der Erschöpfung im Gesicht. Highway-Gespenster, dachte Karen. Es waren dieselben müden Seelen, die jede Raststätte des Landes zu bevölkern schienen. In dem Lokal war es unheimlich still. Jeder konzentrierte sich darauf, wach zu bleiben und wieder auf die Straße zu kommen.
Am Nebentisch saß eine deprimiert aussehende Frau mit zwei kleinen Kindern, die beide stumm ihre Kekse kauten. Sie waren so blond und wohlerzogen, dass sie Karen an ihre eigenen Töchter erinnerten. Morgen hatten sie Geburtstag. Nur noch diese Nacht, in der sie schlafend in ihren Betten lagen, trennte sie davon, dreizehn zu sein. Einen Tag weiter entfernt von ihrer Kindheit.
Wenn ihr aufwacht, dachte sie, bin ich zu Hause.
Sie ließ sich ihren Pappbecher noch einmal mit Kaffee füllen, verschloss ihn mit einem Plastikdeckel und kehrte zu ihrem Wagen zurück.
Nun fühlte sie sich ganz klar im Kopf. Sie konnte es schaffen. Nur eine Stunde und fünfzig Meilen, und sie stände vor ihrer Haustür. Sie ließ den Wagen an und verließ den Parkplatz.
Fünfzig Meilen, dachte sie. Nur noch fünfzig Meilen.
Zwanzig Meilen weiter parkten Vince Lawry und Chuck Servis hinter einem rund um die Uhr geöffneten Supermarkt und leerten ihr letztes Sixpack Bier. Seit vier Stunden tranken sie ohne Pause. Es war nur ein freundschaftlicher kleiner Wettbewerb, wer am meisten Budweiser vertrug, ohne alles wieder auszukotzen. Chuck war ein Bier im Vorsprung. Die Gesamtzahl hatten sie aus den Augen verloren; die mussten sie morgen früh ausrechnen, wenn sie die leeren Bierdosen auf dem Rücksitz zusammenzählten.
Aber Chuck war auf jeden Fall im Vorsprung und prahlte auch damit, was Vince sauer machte, weil Chuck, verdammt noch mal, in allem besser war. Außerdem war es kein fairer Wettkampf. Vince hätte noch eine Runde geschafft, aber das Bud war alle. Und jetzt trug Chuck sein übliches selbstgefälliges Grinsen zur Schau, obwohl er wusste, dass es kein fairer Wettbewerb war.
Vince stieß die Fahrertür auf und stieg aus.
»Wo gehst du hin?«, fragte Chuck.
»Nachschub holen.«
»Mehr schaffst du doch sowieso nicht.«
»Du kannst mich mal«, erwiderte Vince und stolperte über den Parkplatz auf die Tür des Supermarkts zu.
Chuck lachte. »Du kannst nicht mal mehr richtig laufen!«, rief er aus dem Fenster.
Arschloch, dachte Vince. Und ob er laufen konnte. Na also, das ging doch ganz prima. Er wollte einfach in den Laden schlendern und zwei weitere Sixpacks mitnehmen. Sein Magen war aus Eisen. Bis auf die Tatsache, dass er alle paar Minuten pissen musste, spürte er nichts.
Beim Betreten des Ladens stolperte er – verdammt hohe Schwelle, dafür könnte man den Besitzer verklagen –, fing sich jedoch gleich wieder. Er nahm drei Sixpacks aus der Kühltheke und taumelte zur Kasse, wo er einen Zwanzig-Dollar-Schein auf den Tresen legte.
Der Kassierer betrachtete das Geld und schüttelte den Kopf. »Ich kann es nicht annehmen«, sagte er.
»Was soll das heißen, Sie können es nicht annehmen?«
»Ich darf an einen alkoholisierten Kunden kein Bier verkaufen.«
»Wollen Sie etwa behaupten, ich wäre betrunken?«
»So ist es.«
»Hören Sie, das ist Geld, oder nicht? Wollen Sie mein Geld nicht?«
»Ich will bloß nicht verklagt werden. Also stell das Bier wieder weg, Junge. Oder noch besser, warum kaufst du dir nicht einen Kaffee oder so? Ein Hotdog?«
»Ich will kein Hotdog.«
»Dann schieb einfach ab, Junge. Los.«
Vince schob ein Sixpack über den Tresen. Es rutschte über die Kante und fiel krachend zu Boden. Er wollte gerade das zweite vom Tresen wischen, als der Kassierer eine Waffe zog. Vince erstarrte.
»Los, verpiss dich«, befahl der Kassierer.
»Ist ja gut!« Vince machte einen Schritt zurück und hob kapitulierend die Hände. »Ist ja gut, ich habe ja verstanden.«
Beim Rausgehen stolperte er wieder über die verdammte Schwelle.
»Und wo ist das Bier?«, fragte Chuck.
»Sie haben keins mehr.«
»Das kann nicht sein.«
»Das Bier ist ausverkauft, klar?« Vince ließ den Motor an und trat auf das Gaspedal. Quietschend schoss der Wagen vom Parkplatz.
»Wohin fahren wir jetzt?«, fragte Chuck.
»Einen anderen Laden suchen.« Vince blinzelte in die Dunkelheit. »Wo ist die Auffahrt? Die muss doch hier irgendwo sein.«
»Gib es auf Mann. Du schaffst nie im Leben noch ’ne Runde, ohne zu kotzen.«
»Wo ist die verdammte Auffahrt?«
»Ich glaube, du bist schon dran vorbei.«
»Nein, da ist sie.« Vince riss den Wagen nach links, dass die Reifen über den Bürgersteig quietschten.
»Du«, sagte Chuck, »du, ich glaube nicht …«
»Ich habe noch beschissene zwanzig Dollar zum Versaufen übrig. Die werden das Geld schon nehmen. Irgendjemand wird es schon nehmen.«
»Vince, du fährst in die falsche Richtung!«
»Was?«
»Du fährst in die falsche Richtung!«, brüllte Chuck.
Vince schüttelte den Kopf und versuchte, sich auf die Straße zu konzentrieren. Aber die Lichter waren zu hell und blendeten ihn. Er hatte das Gefühl, dass sie immer greller wurden.
»Fahr rechts!«, schrie Chuck. »Es ist ein Auto! Fahr rechts!«
Vince fuhr rechts.
Die Lichter auch.
Er hörte ein Kreischen, unvertraut und gespenstisch.
Nicht Chucks, sondern sein eigenes.
Dr. Abby DiMatteo war so müde wie in ihrem ganzen Leben noch nicht. Sie war jetzt seit dreißig Stunden ununterbrochen auf den Beinen, wenn man das zehnminütige Nickerchen im Röntgenzimmer nicht mitzählte. Und sie wusste, dass man ihr die Erschöpfung ansah. Beim Händewaschen auf der Wachstation hatte sie kurz in den Spiegel geblickt und entsetzt die dunklen Ringe unter ihren Augen und ihre zerzauste schwarze Mähne registriert. Es war schon zehn Uhr vormittags, und sie hatte noch nicht geduscht, ja nicht einmal die Zähne geputzt. Zum Frühstück hatte sie ein hartgekochtes Ei und eine Tasse gesüßten Kaffee zu sich genommen, die ihr eine aufmerksame OP-Schwester in der Intensivchirurgie vor einer Stunde in die Hand gedrückt hatte. Wenn Abby Glück hatte, fand sie wenigstens Zeit zum Mittagessen. Wenn sie noch mehr Glück hatte, konnte sie das Krankenhaus um fünf Uhr verlassen und um sechs zu Hause sein. Im Augenblick wäre es schon der schiere Luxus gewesen, sich in einen Stuhl fallen lassen zu können.
Doch während der Montagsvisite setzte sich niemand. Garantiert nicht, wenn der diensthabende Arzt Dr. Colin Wettig war, Professor für Chirurgie am Bayside-Hospital. Als pensionierter General der Armee genoss Dr. Wettig den Ruf, knappe und gnadenlose Fragen zu stellen. Abby hatte eine Heidenangst vor dem General, genau wie alle anderen Assistenzärzte auch.
Elf von ihnen standen jetzt in einem Halbkreis aus weißen Kitteln und grünen OP-Anzügen in der Intensivchirurgie. Ihre Blicke waren auf den Chefarzt gerichtet. Sie wussten, dass jeder von ihnen mit einer Frage attackiert werden konnte. Wer dann keine Antwort wusste, musste sich einer längeren Prozedur persönlicher Demütigung unterziehen.
Die Gruppe hatte bereits vier frisch operierte Patienten begutachtet und Behandlungspläne und Prognosen erörtert. Jetzt stand sie um Bett elf der Intensivchirurgie, Abbys Neuaufnahme. Es war an ihr, den Fall vorzutragen.
Obwohl sie ein Klemmbrett in der Hand hielt, stützte sie sich nicht auf ihre Notizen. Sie präsentierte den Fall aus dem Gedächtnis, den Blick fest auf das Gesicht des Generals gerichtet. Er lächelte nicht.
»Die Patientin ist eine vierunddreißigjährige Frau weißer Hautfarbe. Ein Rettungsteam brachte sie gegen ein Uhr heute Morgen nach einer Frontalkollision auf der Route 90. Sie wurde vor Ort intubiert und stabilisiert und dann mit dem Rettungshubschrauber hierhertransportiert. Bereits bei ihrer Ankunft in der Notaufnahme zeigten sich verschiedenste Verletzungen. Sie hatte offene und imprimierte Schädelfrakturen, einen Bruch des linken Schlüsselbeins und des linken Oberarmknochens sowie schwere Riss-Quetsch-Wunden der Gesichtsweichteile. Meine Erstuntersuchung ergab, dass die Frau von mittlerer Statur und in gutem Ernährungszustand ist. Sie zeigte keinerlei Reaktionen auf alle Stimuli mit Ausnahme einiger zweifelhafter Strecksynergismen …«
»Zweifelhaft?«, fragte Dr. Wettig nach. »Was soll das heißen? Zeigte sie Strecksynergismen oder nicht?«
Abby spürte ihr Herz pochen. Mist, er hatte es schon auf sie abgesehen. Sie schluckte und erläuterte: »Manchmal zeigt sich nach starken Schmerzreizen eine Streckung der Extremitäten und manchmal nicht.«
»Wie würden Sie das unter Verwendung der Glasgow-Koma-Skala interpretieren?«
»Nun ja, da eine Nichtreaktion mit eins bewertet wird und eine Beantwortung mit Strecksynergismen mit zwei, würde ich vorschlagen, die Patientin mit … mit eineinhalb einzustufen.«
Im Kreis der Assistenzärzte erhob sich verlegenes Gelächter.
»Eine Bewertung von eineinhalb gibt es nicht«, erklärte Dr. Wettig.
»Das ist mir bewusst«, sagte Abby. »Aber diese Patientin passt nicht sauber in …«
»Fahren Sie einfach mit Ihrem Untersuchungsbericht fort«, unterbrach er sie.
Abby machte eine Pause und blickte in die Runde der Gesichter. Hatte sie es schon vermasselt? Sie war sich nicht sicher. Sie atmete tief und fuhr fort: »Sie hatte einen Blutdruck von neunzig zu sechzig und einen Puls von hundert. Sie war bereits intubiert. Sie zeigte keinerlei Spontanatmung. Sie wurde mit einer Frequenz von fünfundzwanzig Atemzügen pro Minute vollautomatisch beatmet.«
»Warum haben Sie eine Frequenz von fünfundzwanzig gewählt?«
»Um sie hyperventilieren zu lassen.«
»Warum?«
»Um den Kohlendioxidgehalt des Blutes zu senken und damit das Hirnödem zu minimieren.«
»Fahren Sie fort.«
»Die Kopfuntersuchung zeigte, wie bereits erwähnt, sowohl offene als auch imprimierte Schädelfrakturen des linken Os parietale und Os temporale. Schwere Schwellungen und Riss-Quetsch-Wunden des Gesichtes erschwerten es, nach Brüchen der Gesichtsknochen zu suchen. Ihre Pupillen waren weit und reaktionslos. Ihre Nase und ihr Hals …«
»Oculocephale Reflexe?«
»Ich habe sie nicht überprüft.«
»Nicht?«
»Nein, Sir. Ich wollte eine Manipulation der Halswirbelsäule vermeiden. Ich musste von möglichen Verschiebungen der Wirbelkörper ausgehen.«
An seinem knappen Nicken erkannte sie, dass die Antwort akzeptabel gewesen war. Abby beschrieb ihre Untersuchungsergebnisse: die normalen Atemgeräusche, den reinen und regelmäßigen Herzschlag, den befundlosen Bauch. Als sie die neurologischen Ergebnisse zusammengefasst hatte, fühlte sie sich selbstbewusster, fast kühn. Warum auch nicht? Sie wusste, was sie hier tat.
»Welchen Eindruck hatten Sie«, fragte Dr. Wettig, »bevor Sie die Röntgenergebnisse kannten?«
»Aufgrund der reaktionslosen, mittelweiten Pupillen habe ich vermutet, dass möglicherweise eine Quetschung des Mittelhirns vorlag, wahrscheinlich ausgelöst durch einen akuten subduralen oder epiduralen Bluterguss.« Sie hielt inne und fügte mit leiser Gewissheit hinzu: »Was durch die Computertomografie bestätigt wurde. Sie zeigte eine große linksseitige Subduralblutung mit bedrohlicher Veränderung der Mittellinie. Die Neurochirurgie wurde hinzugezogen, um eine notfallmäßige Schädelöffnung durchzuführen.«
»Sie sagen also, dass Ihr erster Eindruck absolut korrekt war, Dr. DiMatteo?«
Abby nickte.
»Dann wollen wir mal sehen, wie die Dinge heute Morgen stehen«, bemerkte Dr. Wettig und trat an das Bett. Er leuchtete mit einer Untersuchungslampe in die Augen der Patientin. »Pupillen reaktionslos.« Er presste seinen Fingerknöchel kräftig gegen das Brustbein. Die Patientin blieb schlaff und bewegte sich nicht. »Keine Reaktionen auf Schmerzreize. Weder Extension noch sonstige.«
Alle anderen Assistenzärzte waren vorgetreten, doch Abby blieb am Fußende stehen, sie hatte den Blick auf den bandagierten Kopf der Patientin gerichtet. Während Wettig mit seiner Untersuchung fortfuhr, mit einem Reflexhammer auf Sehnen schlug und Ellenbogen und Knie beugte, spürte Abby, wie ihre Aufmerksamkeit auf einer Welle der Müdigkeit davontrieb. Sie starrte weiter auf den Kopf der Patientin. Deren Haar war dicht und dunkelbraun gewesen, mit Blut und Glassplittern verklebt, bevor sie es rasiert hatten. Auch in ihre Kleidung hatten sich Splitter gegraben. In der Notaufnahme hatte Abby geholfen, die Bluse der Frau aufzuschneiden. Sie war aus blauer und weißer Seide mit einem Donna-Karan-Label. Es war diese Kleinigkeit, die in Abbys Gedächtnis haften geblieben war. Nicht das Blut und die gebrochenen Knochen oder das zerschundene Gesicht, es war das Label, Donna Karan. Das war eine Marke, die sie selbst schon getragen hatte. Sie dachte daran, dass diese Frau irgendwo, irgendwann in einem Laden gestanden und eine Reihe von Blusen durchgesehen haben musste, während die Bügel leise quietschend über den Ständer glitten …
Dr. Wettig richtete sich auf und sah die Schwester der Intensivchirurgie an. »Wann wurde der Bluterguss drainiert?«
»Sie kam heute Morgen um vier aus dem Aufwachraum.«
»Vor sechs Stunden?«
»Ja, das wären jetzt sechs Stunden.«
Wettig wandte sich Abby zu. »Warum ist ihr Zustand dann unverändert?«
Abby schreckte aus ihren Gedanken und bemerkte, dass alle sie ansahen. Sie blickte auf die Patientin und sah, wie sich deren Brust mit jedem Zischen des Beatmungsgeräts hob und senkte, hob und senkte.
»Vielleicht … Es könnte sich um eine nach der Operation aufgetretene Schwellung handeln«, erklärte sie und blickte zum Monitor. »Der Schädeldruck ist etwas erhöht auf zwanzig Millimeter.«
»Denken Sie, dass das hoch genug ist, um die Pupillenreaktion zu verändern?«
»Nein, aber …«
»Haben Sie sie unmittelbar nach der Operation untersucht?«
»Nein, Sir. Sie wurde in die Neurochirurgie überstellt. Ich habe nach der Operation mit dem dortigen Assistenzarzt gesprochen, und er hat mir gesagt …«
»Ich frage nicht den neurochirurgischen Assistenzarzt, ich frage Sie, Dr. DiMatteo. Sie haben einen subduralen Bluterguss diagnostiziert. Warum sind die Pupillen dann sechs Stunden nach der Operation noch immer weit und reaktionslos?«
Abby zögerte. Der General beobachtete sie, genau wie alle anderen. Die demütigende Stille wurde nur durch das Zischen des Beatmungsgeräts unterbrochen.
Dr. Wettig blickte gebieterisch in die Runde der Assistenzärzte. »Gibt es irgendjemanden, der Dr. DiMatteo bei der Beantwortung der Frage helfen kann?«
Abby richtete sich auf. »Ich kann die Frage selbst beantworten.«
Dr. Wettig wandte sich ihr mit hochgezogenen Brauen zu. »Ja?«
»Die Veränderung der Pupillenreaktion und die Haltung der Extremitäten waren Zeichen für eine schwere Mittelhirnverletzung. In der vergangenen Nacht glaubte ich, die Ursache hierfür wäre der subdurale Bluterguss, der das Mittelhirn nach unten drückt. Aber da sich der Zustand der Patientin nicht verbessert hat, habe ich mich wohl … ich meine, ich vermute, dass ich mich geirrt habe.«
»Sie vermuten?«
Sie stieß einen Seufzer aus. »Ich habe mich geirrt.«
»Und wie lautet Ihre Diagnose jetzt?«
»Eine Blutung im Mittelhirn. Sie könnte durch die Scherkräfte verursacht worden sein oder durch eine den subduralen Bluterguss verursachende Schädigung der Hirnsubstanz. Die Veränderung hätte bei der Computertomografie noch nicht zu sehen sein können.«
Dr. Wettig schaute Abby einen Moment lang mit undurchdringlicher Miene an. Dann wandte er sich den anderen Assistenzärzten zu. »Eine Blutung im Mittelhirn ist eine vernünftige Annahme. Zusammen mit einer Reaktion auf der Glasgow-Koma-Skala von eins …«, er warf einen Blick zu Abby und verbesserte sich dann, »… eineinhalb ist die Prognose ungünstig. Die Patientin hat keine spontane Atmung, keine Spontanbewegungen, und sie scheint alle zentralen Reflexe verloren zu haben. Im Moment habe ich keine anderen Vorschläge als die Durchführung aller lebenserhaltenden Maßnahmen. Außerdem rege ich an, sie als Organspenderin in Betracht zu ziehen.« Er nickte Abby kurz zu und ging dann zum nächsten Patienten weiter.
Ein Assistenzarzt drückte Abbys Arm. »Gratuliere, DiMatteo«, flüsterte er. »Mit Glanz und Gloria.«
Abby nickte müde. »Danke.«
Die leitende chirurgische Assistenzärztin Dr. Vivian Chao war eine Legende unter den anderen Assistenzärzten am Bayside-Hospital. Zwei Tage nach Beginn ihres ersten Bereitschaftsdienstes, so ging die Geschichte, erlitt ihre Kollegin einen Zusammenbruch und musste unkontrolliert schluchzend in die Psychiatrie eingeliefert werden. Vivian war gezwungen einzuspringen. Als alleinige Assistenzärztin hatte sie ohne Unterbrechung neunundzwanzig Tage Bereitschaft. Sie brachte ihre Sachen in den Bereitschaftsraum und verlor umgehend fünf Pfund wegen der gnadenlosen Diät des Kantinenessens. Neunundzwanzig Tage lang verließ sie das Krankenhaus nicht.
Am dreißigsten Tag endete ihr Dienst, und sie ging zu ihrem Wagen, um festzustellen, dass der vor einer Woche abgeschleppt worden war. Der Parkplatzwächter hatte angenommen, das Fahrzeug sei zurückgelassen worden.
Ihre nächste Durchlaufstation war die Gefäßchirurgie. Vier Tage nach Beginn ihres Dienstes wurde der mit ihr diensttuende Assistenzarzt von einem Bus angefahren und mit einem Beckenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Wieder musste irgendjemand einspringen.
Vivian Chao schlug ihr Lager erneut im Bereitschaftsraum auf.
In den Augen der anderen Ärzte hatte sie damit männliche Qualitäten gezeigt. Das war ein herausgehobener Status, der später beim jährlichen Belobigungsessen dadurch gewürdigt wurde, dass man ihr ein Paar Hanteln schenkte.
Als Abby die Vivian-Chao-Geschichten gehört hatte, fand sie es schwierig, diesen eisenharten Ruf mit ihrem ersten Eindruck von Vivian in Einklang zu bringen. Sie sah nur eine wortkarge Chinesin, die so klein war, dass sie zum Operieren auf einem Fußbänkchen stehen musste. Obwohl Vivian bei den Visiten selten etwas sagte, sah man sie stets furchtlos und mit einem Ausdruck kühler Leidenschaftslosigkeit in der ersten Reihe stehen.
In ihrer gewohnt distanzierten Art trat Vivian an jenem Nachmittag in der chirurgischen Intensivstation auch auf Abby zu. Die schwamm mittlerweile in einem Meer der Erschöpfung. Jeder Schritt war eine Anstrengung, jede Entscheidung ein Akt schierer Willenskraft. Sie bemerkte nicht einmal, dass Vivian neben ihr stand, bis sie sagte: »Ich habe gehört, Sie haben ein Schädelhirntrauma AB positiv aufgenommen.«
Abby blickte von ihren Krankenblättern auf, in denen sie die Daten diverser Patienten nachgetragen hatte. »Ja, gestern Nacht.«
»Lebt der Patient noch?«
Abby blickte zu Bett elf. »Kommt drauf an, was man unter Leben versteht.«
»Herz und Lunge in gutem Zustand?«
»Sie funktionieren.«
»Wie alt?«
»Sie ist vierunddreißig. Warum?«
»Ich habe einen Patienten durch den Studentenkreis verfolgt. Schwäche der Auswurfleistung im Endstadium. Seine Blutgruppe ist AB positiv. Er wartet auf ein neues Herz.« Vivian ging zu dem Regal mit den Krankenblättern. »Welches Bett ist es?«
»Elf.«
Vivian zog das Krankenblatt heraus und klappte den Metalldeckel auf. Als sie die Seiten überflog, zeigte ihr Gesicht keine Regung.
»Sie ist nicht mehr meine Patientin«, erläuterte Abby. »Ich habe sie in die Neurochirurgie überstellt. Sie entlasten dort einen subduralen Bluterguss.«
Vivian las einfach weiter in der Krankenakte.
»Ihre Operation liegt erst zehn Stunden zurück«, fuhr Abby fort. »Es scheint mir ein wenig verfrüht, schon an Organspenden zu denken.«
»Wie ich sehe, zeigt sie bis jetzt keinerlei neurologische Veränderungen.«
»Nein. Aber es besteht immer noch die Möglichkeit …«
»Bei einer Gesamtpunktzahl von drei auf der Glasgow-Skala? Das glaube ich nicht.« Vivian schob die Krankenakte zurück ins Regal und ging zu Bett elf.
Abby folgte ihr.
Sie blieb in der Tür stehen und beobachtete, wie Vivian eine knappe Untersuchung durchführte, genau wie sie operierte, ohne Zeit oder Energie zu verschwenden. In ihrem ersten Jahr als Assistenzärztin hatte Abby Vivian oft in der Chirurgie zugesehen und deren kleine, flinke Hände bewundert. Sie hatte ehrfürchtig beobachtet, wie diese zierlichen Finger perfekte Knoten geknüpft hatten. Im Vergleich dazu kam Abby sich immer ungeschickt vor. Sie hatte Stunden und Meter über Meter an Garn investiert und an den Griffen ihrer Schreibtischschubladen chirurgische Knoten geübt, und obwohl sie die Technik einigermaßen gemeistert hatte, wusste sie, dass sie nie Vivian Chaos magische Hände besitzen würde.
Als sie jetzt zusah, wie Vivian Karen Terrio untersuchte, fand sie die Effizienz dieser Hände zutiefst erschreckend.
»Keine Reaktion auf Schmerzreize«, bemerkte Vivian.
»Es ist noch zu früh.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.« Vivian zog einen Reflexhammer aus der Tasche und begann, die Sehnen abzuklopfen. »Sie ist AB positiv?«
»Ja.«
»Ein Glücksfall.«
»Ich verstehe nicht, wie Sie so etwas sagen können!«
»Mein Patient auf der Intensivstation ist AB positiv. Und er wartet seit einem Jahr auf ein Herz. Dies ist das passendste, das bisher eingegangen ist.«
Abby sah Karen Terrio an und erinnerte sich wieder an die blau-weiße Bluse. Was hatte die Frau gedacht, als sie sie zum letzten Mal zugeknöpft hatte? Vielleicht ganz profane Gedanken. Bestimmt keine Gedanken an den Tod oder Gedanken an ein Krankenhausbett, Infusionsschläuche oder Maschinen, die Luft in ihre Lunge pumpten.
»Ich würde gern eine lymphozytäre Kreuzprobe machen lassen, um sicher zu sein, dass beide Patienten kompatibel sind. Wir sollten auch eine Typisierung für die anderen Organe veranlassen. Ein EEG wurde schon gemacht, oder nicht?«
»Sie ist nicht mehr meine Patientin«, wiederholte Abby. »Und ich halte es ohnehin für verfrüht. Bis jetzt hat noch nicht einmal jemand mit ihrem Mann geredet.«
»Irgendjemand wird es tun müssen.«
»Sie hat Kinder. Die werden Zeit brauchen, bis sie die grausame Realität wirklich begriffen haben.«
»Die Organe haben nicht viel Zeit.«
»Ich weiß. Ich weiß, dass es geschehen muss. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, erst zehn Stunden nach der Operation.«
Vivian ging zum Waschbecken, um sich die Hände abzuspülen. »Sie erwarten doch nicht ernsthaft ein Wunder, oder?«
Eine Schwester der chirurgischen Intensivstation tauchte neben dem Bett auf. »Ihr Mann und ihre Kinder sind da. Sie warten darauf, sie zu sehen. Brauchen Sie noch lange?«
»Ich bin fertig«, erklärte Vivian, warf das zerknüllte Papierhandtuch in den Mülleimer und verließ den Raum.
»Kann ich sie reinschicken?«, fragte die Schwester Abby.
Abby sah Karen Terrio an. In diesem Augenblick begriff sie mit geradezu schmerzhafter Deutlichkeit, was ein Kind sehen musste, wenn es auf dieses Bett blickte. »Warten Sie«, sagte Abby. »Noch nicht.« Sie trat rasch an das Bett und strich die Laken glatt. Sie befeuchtete ein Papierhandtuch und wischte den getrockneten Schleim von der Wange der Frau. Und sie hängte den Urinbeutel auf die andere Seite des Bettes, wo man ihn nicht sehen konnte. Dann trat sie einen Schritt zurück und warf einen letzten Blick auf Karren Terrio. Ihr wurde klar, dass weder sie noch sonst jemand irgendetwas tun konnte, was den Schmerz, der diesen Kindern bevorstand, lindern konnte.
Abby seufzte und nickte der Krankenschwester zu. »Sie können jetzt reinkommen.«
Um halb fünf an diesem Nachmittag konnte Abby sich kaum noch darauf konzentrieren, was sie schrieb. Sie hatte jetzt seit dreiunddreißigeinhalb Stunden Bereitschaft. Die Nachmittagsvisite war erledigt, es war endlich Zeit, nach Hause zu gehen.
Doch als sie die letzte Krankenakte zuklappte, wanderte ihr Blick wieder zu Bett elf. Sie trat an das Fußende des Bettes, starrte wie benommen auf Karen Terrio und überlegte verzweifelt, ob nicht noch etwas, irgendwas getan werden konnte.
Die Schritte in ihrem Rücken hörte sie nicht.
Erst als eine Stimme sagte: »Hallo, schöne Frau«, drehte Abby sich um und sah Dr. Mark Hodell, der sie mit seinen blauen Augen strahlend anlächelte. Es war ein Lächeln, das allein Abby galt, und sie hatte es den ganzen Tag über schmerzlich vermisst. An den meisten Tagen schafften es Abby und Mark, eilig zusammen Mittag zu essen oder sich zumindest im Vorübergehen zuzuwinken. Heute jedoch waren sie sich noch gar nicht begegnet, und sein Anblick erfüllte sie mit stiller Freude. Er beugte sich herab, um sie zu küssen. Dann trat er einen Schritt zurück und musterte ihr zerzaustes Haar und ihren OP-Anzug. »Muss eine üble Nacht gewesen sein«, murmelte er mitfühlend. »Wie viele Stunden hast du geschlafen?«
»Ich weiß nicht, eine halbe Stunde vielleicht.«
»Ich habe läuten hören, dass du mit dem General über fünfzehn Runden gegangen bist.«
Sie zuckte die Schultern. »Sagen wir, er hat mit mir nicht den Boden gewischt.«
»Das ist schon ein Triumph.«
Sie lächelte. Ihr Blick wanderte wieder zum Bett, und ihr Lächeln verblasste. Karen Terrio wirkte verloren inmitten all der Apparaturen. Das Beatmungsgerät, die Infusionspumpen, die Saugschläuche und Monitore für EKG, Blut- und Hirndruck, ein Gerät zum Messen jeder Körperfunktion. Warum sollte man sich im neuen Zeitalter der Technologie noch die Mühe machen, den Puls zu fühlen oder die Hände auf eine Brust zu legen? Wozu brauchte man Ärzte, wenn Maschinen die Arbeit erledigen konnten?
»Ich habe sie gestern Nacht aufgenommen«, erläuterte Abby. »Vierunddreißig Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter. Es sind Zwillinge. Sie waren eben noch hier. Und das Merkwürdige war: Sie wollten sie nicht anfassen, Mark. Sie standen bloß da und haben geguckt, haben sie nur angeguckt. Aber sie haben sie nicht berührt. Ich habe die ganze Zeit gedacht: Ihr müsst! Ihr müsst sie jetzt berühren, weil es eure letzte Chance sein könnte. Die letzte Gelegenheit, die ihr habt. Aber sie wollten nicht. Und ich glaube, eines Tages werden sie sich wünschen …« Sie schüttelte den Kopf und fuhr sich rasch mit der Hand über die Augen. »Ich habe gehört, der andere Typ war ein betrunkener Geisterfahrer. Weißt du, was mich anwidert, Mark? Und ich meine, wirklich anwidert? Er wird überleben. In diesem Moment sitzt er oben in der Orthopädie und jammert über ein paar Knochenbrüche.« Abby holte erneut tief Luft, und mit dem anschließenden Seufzer schien all ihre Wut verflogen. »Ich soll eigentlich Leben retten. Stattdessen wünsche ich mir, dass sie einen Typ von der Autobahn kratzen.« Sie wandte sich von dem Bett ab. »Zeit, nach Hause zu gehen.«
Mark strich ihr mit der Hand über den Rücken. Es war eine gleichermaßen tröstende und besitzergreifende Geste. »Komm«, sagte er. »Ich bringe dich zum Wagen.«
Sie verließen die Station und nahmen den Aufzug. Als die Türen zuglitten, spürte Abby, wie ihre Knie nachgaben, und sie schmiegte sich an Mark. Sofort nahm er sie in die warme Geborgenheit seiner Arme. Dies war ein Ort, an dem sie sich sicher fühlte und schon immer sicher gefühlt hatte.
Noch vor einem Jahr war ihr die Gegenwart von Mark Hodell alles andere als beruhigend erschienen. Abby war Ärztin im Praktikum gewesen, Mark der diensthabende Thoraxchirurg. Er war nicht irgendein Bereitschaftsarzt, sondern der Topchirurg des Herztransplantationsteams im Bayside-Hospital. Sie hatten sich im OP der Unfallchirurgie kennengelernt. Der damalige Patient, ein zehnjähriger Junge, war in einem Krankenwagen eingeliefert worden. Er hatte einen Pfeil in der Brust – das Resultat eines Geschwisterstreits, kombiniert mit einem denkbar schlecht gewählten Geburtstagsgeschenk. Mark hatte sich schon die Hände desinfiziert und seinen OP-Anzug übergestreift, als Abby den Saal betrat. Es war ihre erste Woche als Assistenzärztin, und sie war nervös gewesen, eingeschüchtert von der Vorstellung, dem berühmten Dr. Hodell zu assistieren. Sie trat an den Operationstisch und warf einen schüchternen Blick zu dem Mann, der ihr gegenüberstand. Was sie trotz seiner Maske sah, war eine breite, intelligente Stirn und ein Paar wunderschöner blauer Augen. Sehr direkt und sehr neugierig.
Sie operierten gemeinsam. Das Kind überlebte.
Einen Monat später fragte Mark Abby, ob sie mit ihm ausgehen wollte. Sie lehnte zweimal ab. Nicht weil sie nicht mit ihm ausgehen wollte, sondern weil sie dachte, dass sie es nicht tun sollte.
Ein Monat verstrich, und er fragte sie erneut. Diesmal war die Versuchung stärker. Sie nahm an.
Vor fünfeinhalb Monaten war Abby in Marks Haus in Cambridge eingezogen. Zunächst war es nicht leicht gewesen, das Zusammenleben mit einem einundvierzigjährigen Junggesellen zu üben, der sein Leben – und auch sein Haus – noch nie mit einer Frau geteilt hatte. Doch als Mark sie jetzt in seinen Armen hielt und stützte, konnte sie sich nicht vorstellen, mit einem anderen Menschen zu leben oder einen anderen Mann zu lieben.
»Meine arme Abby«, murmelte er. Sein warmer Atem blies in ihr Haar. »Brutal, nicht?«
»Ich bin für so was nicht gemacht. Was mache ich hier eigentlich?«
»Du machst das, wovon du immer geträumt hast. Das hast du mir jedenfalls erzählt.«
»Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was mein Traum überhaupt war. Ich bin dabei, ihn aus den Augen zu verlieren.«
»Ich glaube, es hatte etwas damit zu tun, Leben zu retten.«
»Stimmt. Und jetzt stehe ich hier und wünsche mir, der Betrunkene in dem anderen Auto wäre tot.«
»Abby, im Moment machst du die härteste Phase durch. Du hast noch zwei Tage auf der Unfallchirurgie. Du musst nur noch zwei Tage überstehen!«
»Na super! Danach fange ich in der Thoraxchirurgie an.«
»Im Vergleich hierzu ist die ein Kinderspiel. Unfallchirurgie ist immer am brutalsten. Du musst die Zähne zusammenbeißen und durch, wie alle anderen auch.«
Sie vergrub sich tiefer in seinen Armen. »Würdest du allen Respekt für mich verlieren, wenn ich in die Psychiatrie wechseln würde?«
»Jeglichen. Ohne Zweifel.«
»Du bist gemein!«
Lachend küsste er sie auf ihr Haar. »Das denken viele, aber du bist die Einzige, die es laut aussprechen darf.«
Sie traten aus dem Fahrstuhl und verließen das Krankenhaus. Es war schon Herbst, doch seit sechs Tagen schwitzte Boston unter einer septemberlichen Hitzewelle. Als sie über den Parkplatz gingen, spürte sie, wie ihre letzten Kraftreserven dahinschmolzen. Bis zu ihrem Wagen konnte sie kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen. Das ist es, was mit uns passiert, dachte sie. Es ist das Feuer, durch das wir gehen, um Chirurgen zu werden. Die langen Tage, der geistige und emotionale Raubbau, die Stunden, die man weiterdrängte, während andere Fragmente des Lebens von einem abfielen. Sie wusste, dass das schlicht ein gnadenloser, aber notwendiger Ausleseprozess war. Mark hatte es überlebt, also würde sie es auch schaffen.
Er umarmte und küsste sie noch einmal. »Meinst du, du kommst sicher nach Hause?«, fragte er.
»Ich schalte den Wagen einfach auf Autopilot.«
»In einer Stunde bin ich auch zu Hause. Soll ich Pizza mitbringen?«
Gähnend rutschte sie hinter das Steuer. »Für mich nicht.«
»Willst du nichts zu Abend essen?«
Sie ließ den Motor an. »Heute«, seufzte sie, »will ich nur noch ein Bett.«
Drei
In der Nacht kam ihr die Erkenntnis wie ein kaum hörbares Flüstern oder die sanfte Berührung eines Elfenflügels: Ich sterbe! Diese Einsicht schreckte Nina Voss nicht. Wochenlang hatte sie sich durch die Wechselschichten von drei Krankenschwestern und die täglichen Besuche von Dr. Morissey mit seinen ständig höheren Dosen von Furosemid eine heitere Gelassenheit bewahrt. Und warum sollte sie nicht gelassen sein? Ihr Leben war reich gesegnet gewesen. Sie hatte Liebe, Freude und Staunen gekannt. Mit ihren sechsundvierzig Jahren hatte sie die Sonne über den Tempeln von Karnak aufgehen sehen, war durch die dämmrigen Ruinen von Delphi gewandert und hatte in Nepal die Hänge des Himalaya erklommen. Und sie hatte jenen Seelenfrieden gefunden, der sich nur dann einstellt, wenn man den zugewiesenen Platz in Gottes Universum annimmt und akzeptiert. In ihrem Leben gab es nur noch zwei Dinge, die sie bedauerte: Sie hatte nie ein eigenes Kind in den Armen gehalten. Und Victor würde allein zurückbleiben.
Die ganze Nacht hatte ihr Mann an ihrem Bett gewacht, ihr in den langen Stunden beschwerlichen Atmens und Hustens die Hand gehalten, durch den Wechsel der Sauerstoffflasche und die Besuche von Dr. Morissey hindurch. Selbst im Schlaf hatte sie Victors Gegenwart gespürt. Manchmal hörte sie ihn durch den Nebel ihrer Träume in der Morgendämmerung sagen: »Sie ist noch so jung! So jung! Kann man nicht noch etwas, irgendwas, unternehmen?«
Etwas! Irgendwas! So war Victor. Er glaubte nicht an das Unvermeidliche.
Aber Nina tat es.
Sie schlug die Augen auf und sah, dass die Nacht endlich vorüber war und die Sonne in ihr Schlafzimmerfenster schien, das Fenster mit dem weitläufigen Blick auf ihren geliebten Rhode-Island-Sund. In den Tagen vor ihrer Krankheit, bevor die Herzerkrankung ihr die Kräfte geraubt hatte, war Nina bei Anbruch der Dämmerung bereits meist wach und angezogen gewesen. Sie war auf den Balkon ihres Schlafzimmers getreten und hatte den Sonnenaufgang beobachtet. Selbst wenn der Nebel dicht über dem Sund hing und das Wasser kaum mehr als ein silbriges Zittern im Dunst war, stand sie da und spürte, wie sich die Erde in ihre Richtung neigte und ihr der Morgen entgegenströmte.
Ich habe so viele Morgenröten erlebt, und ich danke dir, Herr, für jede einzelne, dachte sie.
»Guten Morgen, Liebes«, flüsterte Victor.
Nina wandte sich dem Gesicht ihres Mannes zu. Er lächelte sie an. Manche Menschen, die Victor anblickten, sahen das Antlitz der Macht. Andere erkannten Genialität oder Skrupellosigkeit. Doch als Nina Voss ihren Mann an diesem Morgen anblickte, sah sie nur Liebe. Und Erschöpfung.
Sie streckte die Hand nach ihm aus. Er ergriff sie und drückte sie an seine Lippen. »Du musst ein wenig schlafen, Victor«, sagte sie.
»Ich bin nicht müde.«
»Aber ich sehe doch, dass du müde bist.«
»Nein, bin ich nicht.« Er küsste erneut ihre Hand, seine warmen Lippen auf ihrer kühlen Haut. Einen Moment lang sahen sie sich an. Sauerstoff zischte leise durch die Schläuche in ihren Nasenlöchern. Durch das offene Fenster hörte man die Wellen des Ozeans gegen die Felsen rauschen.
Nina schloss die Augen. »Weißt du noch damals …« Ihre Stimme erstarb, als sie innehielt, um Luft zu holen.
»Wann?«, fragte er leise.
»Der Tag … als ich … mein Bein gebrochen habe.«
Es war in der Woche gewesen, als sie sich in Gstaad kennengelernt hatten. Er hatte ihr später erzählt, dass er beobachtet hatte, wie sie im Schuss eine Piste hinuntergesaust war. Er war ihr bergab gefolgt, im Lift wieder hinauf und ein zweites Mal talwärts. Das war vor fünfundzwanzig Jahren gewesen.
Seither waren sie jeden Tag ihres Lebens zusammen gewesen.
»Ich wusste es«, flüsterte sie. »In diesem Krankenhaus, als du an meinem Bett gewacht hast, wusste ich es.«
»Was wusstest du, Liebes?«
»Dass du der Einzige für mich warst.« Sie öffnete die Augen und lächelte ihn erneut an. Erst jetzt sah sie die Träne, die seine zerfurchte Wange hinabrollte. Victor weinte doch nicht! Sie hatte ihn noch nie weinen sehen, kein einziges Mal in fünfundzwanzig gemeinsamen Jahren. Sie hatte Victor immer für den Starken und Tapferen gehalten. Als sie jetzt in sein Gesicht blickte, erkannte sie, wie sehr sie sich geirrt hatte.
»Victor«, flüsterte sie und drückte seine Hand. »Du darfst keine Angst haben.«
Rasch und fast wütend wischte er sich mit der Hand über das Gesicht. »Ich werde das nicht zulassen. Ich werde dich nicht verlieren.«
»Das wirst du nie.«
»Nein, das reicht mir nicht! Ich möchte dich hier auf der Erde. Bei mir!«
»Victor, wenn es eins gibt, was ich weiß …«, sie atmete tief ein und rang nach Luft, »… dann, dass die Zeit … die wir hier haben … nur ein sehr kleiner Teil … unserer Existenz ist.«
Sie spürte, wie er vor Ungeduld erstarrte und sich zurückzog. Er stand auf und ging an das Fenster, wo er stehen blieb und über den Sund blickte. Sie fühlte, wie die Wärme seiner Hand auf ihrer Haut nachließ, fühlte, wie die Kälte zurückkam.
»Ich werde mich darum kümmern, Nina«, sagte er.
»Es gibt Dinge … in diesem Leben … die wir nicht ändern können.«
»Ich habe bereits Maßnahmen ergriffen.«
»Aber Victor …«
Er drehte sich um und sah sie an. Seine vom Fenster gerahmten Schultern schienen alles Licht der Morgenröte zu verdecken. »Es wird alles geregelt, Liebes«, sagte er. »Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen.«
Es war einer dieser warmen und wunderbaren Abende, die Sonne ging gerade unter, Eiswürfel klirrten in Gläsern, parfümierte Damen in Seide und Voile schwebten vorbei. Als Abby im von einer Mauer umgebenen Garten von Dr. Bill Archer stand, erschien ihr selbst die Luft magisch. Clematis und Rosen rankten an einer gitterartigen Pergola, der weitläufige Rasen war mit bunten Blumen gesprenkelt. Dieser Garten war der ganze Stolz und die Freude von Marilee Archer, deren tiefe Altstimme vernehmlich botanische Namen rezitierte, als sie die Frauen der anderen Ärzte von Blumenbeet zu Blumenbeet führte.
Archer stand mit einem Whiskey-Cocktail in der Hand auf der Terrasse und lachte. »Marilee kann mehr Latein als ich.«
»Ich habe auf dem College drei Jahre Latein belegt«, erklärte Mark. »Aber ich kann mich nur noch an das erinnern, was ich im Medizinstudium gelernt habe.«
Sie standen um einen gemauerten Grill, Bill Archer, Mark, der General und zwei chirurgische Assistenzärzte. Abby war die einzige Frau in diesem Kreis. Das war etwas, woran sie sich nie gewöhnt hatte. Manchmal vergaß sie es für einen Augenblick oder zwei, doch dann blickte sie sich in dem Raum um, in dem die Chirurgen gerade versammelt waren, und verspürte das gewohnte Unbehagen darüber, dass sie ausschließlich von Männern umgeben war.
Zu Archers Hausfest waren natürlich auch die Ehefrauen der Ärzte eingeladen, doch sie schienen sich in einem Paralleluniversum zu bewegen, das nur wenige Berührungspunkte mit dem ihrer Männer zu besitzen schien. Wenn sie bei den Chirurgen stand, schnappte Abby manchmal von Weitem einen Fetzen des Gespräches der Ehefrauen auf. Es waren Unterhaltungen über Damastrosen, Reisen nach Paris oder die Zubereitung von Speisen. Dann fühlte Abby sich in beide Richtungen gezogen, als ob sie über der Kluft zwischen Männern und Frauen stünde, einen Fuß auf der einen, den anderen auf der anderen Seite, ohne ganz zu einer der beiden Welten zu gehören.
Es war Mark, der sie in dieser Männerrunde verankerte. Er und Bill Archer, ebenfalls ein Thoraxchirurg, waren enge Kollegen. Archer war der Chef des Transplantationsteams und einer der Ärzte, die Mark vor sieben Jahren an das Bayside-Hospital geholt hatten. Es war nicht überraschend, dass sich die beiden Männer so gut verstanden. Beide verlangten viel von sich und anderen, waren sportlich und von geradezu besessenem Ehrgeiz. Im OP arbeiteten sie als Team, doch außerhalb des Krankenhauses erstreckte sich ihre freundschaftliche Rivalität von den Skipisten Vermonts bis auf die Gewässer der Massachusetts Bay. Beide hatten im Marblehead-Jachthaften eine J-35er Segeljolle liegen, und in der laufenden Regattasaison stand es im Wettkampf zwischen Archers Red Eye und Marks Gimmie Shelter sechs zu fünf. Mark hatte vor, das Ergebnis an diesem Wochenende auszugleichen. Er hatte schon Rob Lessing, den anderen Assistenzarzt im zweiten Jahr, für die Mannschaft angeheuert.
Was hat es nur mit Männern und Booten auf sich?, fragte sich Abby. Männer und ihre Segelmaschinen! Ihre testosterongespeisten Hightechgespräche waren für Abby das reinste Kauderwelsch. In diesem Kreis gehörte die Bühne den Männern mit ergrauendem Haar. Archer mit seiner graumelierten Mähne, Colin Wettig, schon vornehm ergraut, und Mark, der mit einundvierzig an den Schläfen erste silberne Strähnen bekam.
Als sich das Gespräch der Pflege von Schiffsrümpfen und den verschiedenen Kielbauarten sowie den astronomischen Preisen von Spinnakern zuwandte, schweifte Abbys Aufmerksamkeit ab, und sie bemerkte die beiden Spätankömmlinge, Dr. Aaron Levi und seine Frau Elaine. Aaron war der Kardiologe des Transplantationsteams und ein geradezu peinlich schüchterner Mann. Er hatte sich schon mit einem Drink in eine entlegene Ecke des Gartens zurückgezogen und beobachtete schweigend und mit hängenden Schultern das Treiben. Elaine sah sich suchend nach einem Brückenkopf der Konversation um.
Das war Abbys Chance, dem Gerede über Boote zu entfliehen. Sie löste sich von Mark und ging zu Elaine herüber.
»Mrs. Levi? Schön Sie wiederzusehen.«
Elaine lächelte. »Abby, nicht wahr?«
»Ja, Abby DiMatteo. Ich glaube, wir sind uns schon einmal auf dem Picknick der Assistenzärzte begegnet.«
»Ach ja, richtig. Es gibt so viele Assistenzärzte, dass ich Probleme habe, sie auseinanderzuhalten. Aber an Sie erinnere ich mich.«
Abby lachte. »Bei nur drei Frauen in der Ausbildung zum chirurgischen Facharzt ragen wir schon irgendwie heraus.«
»Es ist schon viel besser als früher, als es überhaupt keine Frauen gab. In welcher Abteilung arbeiten Sie zurzeit?«
»Ich fange morgen in der Thoraxabteilung an.«
»Dann werden Sie ja mit Aaron zusammenarbeiten.«
»Wenn ich das Glück habe, bei irgendwelchen Transplantationen zu assistieren.«
»Ganz bestimmt! Das Team hatte in letzter Zeit so viel zu tun. Sie bekommen sogar schon Überweisungen aus dem Massachusetts General, was Aaron eine echte innere Befriedigung ist.« Elaine beugte sich zu Abby hinüber. »Vor Jahren haben sie ihn als Facharzt abgelehnt, und jetzt schicken sie ihm ihre Patienten.«
»Das Einzige, was das Massachusetts General dem Bayside-Hospital voraushat, ist der Harvard-Nimbus«, bemerkte Abby. »Sie kennen doch Vivian Chao, oder nicht? Unsere leitende Assistenzärztin?«
»Natürlich.«
»Sie hat ihr Medizinstudium in Harvard als eine der zehn besten ihres Jahrgangs abgeschlossen. Doch als sie sich dann um eine Stelle als Assistenzärztin beworben hat, war Bayside ihre erste Wahl.«
Elaine wandte sich ihrem Mann zu. »Hast du das gehört, Aaron?«
Widerwillig blickte der von seinem Drink auf. »Was?«
»Vivian Chao hat Bayside dem Mass Gen vorgezogen. Wirklich, Aaron, hier bist du schon ganz oben. Warum solltest du wegwollen?«
»Weg?« Abby sah Aaron überrascht an, doch der Kardiologe starrte nur seine Frau an. Was Abby am rätselhaftesten fand, war deren plötzliches Schweigen. Gelächter und Gesprächsfetzen wehten über den Rasen herüber, doch in dieser Ecke des Gartens sagte keiner ein Wort.
Aaron räusperte sich. »Nur ein Gedanke, mit dem ich spiele«, erläuterte er. »Raus aus der Stadt, aufs Land ziehen, verstehen Sie? Jeder hat Tagträume vom Leben auf dem Land, aber wirklich hinziehen will keiner.«
»Ich jedenfalls nicht«, sagte Elaine.
»Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen«, warf Abby ein. »Belfast, in Maine. Ich konnte es kaum erwarten, dort wegzukommen.«
»So stelle ich mir das auch vor«, sagte Elaine. »Jeder brennt darauf, in die Zivilisation zu kommen.«
»Na ja, so schlimm war es nun auch wieder nicht.«
»Aber Sie würden nicht dorthin zurückkehren, oder?«
Abby zögerte. »Meine Eltern sind tot, und meine beiden Schwestern sind aus Maine weggezogen. Also habe ich keinen Grund, dorthin zurückzukehren, während ich eine Menge Gründe habe, hierzubleiben.«
»Es war bloß eine Gedankenspielerei«, betonte Aaron und nahm einen großen Schluck von seinem Drink. »Ich habe es nie ernsthaft erwogen.«
In dem nachfolgenden verlegenen Schweigen hörte Abby, wie ihr Name gerufen wurde. Sie drehte sich um und sah Mark, der ihr zuwinkte.
»Entschuldigen Sie«, bat sie und ging über den Rasen zu ihm.
»Archer gibt eine Führung durch sein inneres Heiligtum«, sagte Mark.
»Welches innere Heiligtum?«
»Komm mit. Du wirst schon sehen.« Er nahm ihre Hand und führte sie über die Terrasse ins Haus und die Treppe hinauf in den ersten Stock. Abby war bisher erst einmal im ersten Stock von Archers Haus gewesen, als sie die Ölgemälde auf der Galerie bewundern sollte.
Heute Abend wurde sie zum ersten Mal in das Zimmer am Ende des Flures gebeten.
Archer erwartete sie bereits. Auf einer Sitzgruppe aus Ledersesseln hatten schon Dr. Frank Zwick und Dr. Raj Mohandas Platz genommen. Doch Abby nahm kaum Notiz von den Anwesenden; der Raum selbst schlug sie in Bann.
Sie stand in einem Museum für alte medizinische Instrumente. In Vitrinen waren eine Reihe von ebenso faszinierenden wie beängstigenden Geräten ausgestellt. Sie sah Skalpelle und Nierenschalen, Gefäße für Blutegel, Geburtszangen mit Backen, die den Schädel eines Neugeborenen zermalmen konnten. Über dem Kamin hing ein Ölgemälde: der Kampf zwischen dem Tod und einem Arzt um das Leben einer jungen Frau. Aus den Lautsprechern der Stereoanlage tönte ein Brandenburgisches Konzert.
Archer drehte die Musik leiser, und das Zimmer wirkte auf einmal sehr still. Nur die Musik flüsterte verhalten im Hintergrund.
»Kommt Aaron?«, fragte Archer.
»Er weiß Bescheid. Er wird bestimmt jeden Moment hier sein«, antwortete Mark.
»Gut.« Archer lächelte Abby zu. »Was halten Sie von meiner kleinen Sammlung?«
Sie betrachtete den Inhalt einer Vitrine. »Wirklich faszinierend. Bei manchen Instrumenten könnte ich nicht einmal sagen, wozu man sie benutzt hat.«
Archer wies auf eine seltsame Apparatur mit Rollen und Zahnrädern. »Das ist ein interessantes Gerät. Damit wurden schwache Stromstöße erzeugt, die an allen möglichen Körperteilen angewendet wurden. Angeblich hat es von Frauenleiden bis Diabetes gegen fast alles geholfen. Komisch, nicht wahr? Welchen Unsinn uns die medizinische Wissenschaft glauben machen wollte!«
Abby blieb vor dem Ölgemälde stehen und betrachtete das schwarz gewandete Abbild des Todes. Der Arzt als Held, der Arzt als Eroberer, dachte sie. Und das Objekt seiner Rettung war natürlich eine Frau. Eine schöne Frau.
Die Tür ging auf.
»Da ist er ja«, bemerkte Mark. »Wir haben uns schon gefragt, wo du bleibst, Aaron.«
Aaron betrat das Zimmer. Er sagte nichts, sondern nickte nur, als er auf einem der Stühle Platz nahm.
»Darf ich Ihr Glas noch einmal nachfüllen, Abby?«, fragte Archer.
»Danke, nein.«
»Nicht einen kleinen Schuss Brandy? Mark fährt doch, oder?«
Abby lächelte. »Also gut. Danke.«
Archer schenkte Abby nach und gab ihr das Glas zurück. Ein eigenartiges Schweigen hatte sich über den Raum gelegt, als ob jeder auf die Erledigung dieser Formalität gewartet hätte. Dann fiel ihr auf, dass sie die einzige anwesende Assistenzärztin war. Bill Archer gab alle paar Monate eine Party wie diese, um die Assistenzärzte zu begrüßen, die turnusmäßig ihren Dienst in den Abteilungen Thorax- und Unfallchirurgie angetreten hatten. Im Moment mochten sechs oder sieben von ihnen unten im Haus oder im Garten sein, doch hier oben in Archers Privatgemach war nur das Transplantationsteam versammelt.
Und Abby.
Sie setzte sich neben Mark auf das Sofa und nippte an ihrem Drink. Sofort spürte sie die Wärme des Brandys und ihre Erregung über diese besondere Aufmerksamkeit. Anfangs hatte sie diese fünf Männer mit Ehrfurcht betrachtet und sich schon privilegiert gefühlt, Archer oder Mohandas nur bei einer Operation assistieren zu dürfen. Und obwohl ihre Beziehung mit Mark sie in diesen gesellschaftlichen Kreis eingeführt hatte, hatte sie nie vergessen, wer diese Männer waren und welche Macht sie über ihre eigene Karriere hatten.
Archer nahm ihr gegenüber Platz. »Ich habe viel Gutes über Sie gehört, Abby. Vom General. Bevor er eben gegangen ist, hat er Ihnen ein paar wundervolle Komplimente gemacht.«