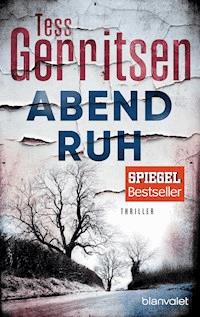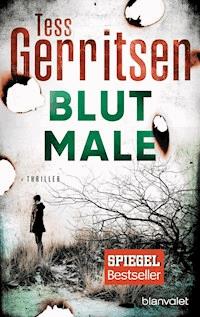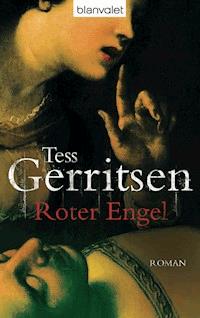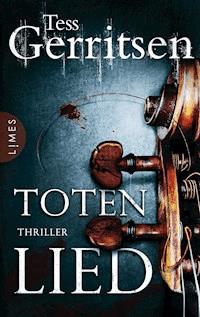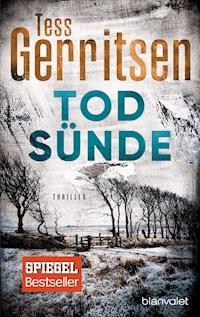
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli-&-Isles-Serie
- Sprache: Deutsch
Der dritte Fall für Rizzoli & Isles – von Weltklasseautorin Tess Gerritsen!
In einem Kloster nahe Boston ist die Novizin Camille Maginnes brutal erschlagen worden. Bei der Autopsie findet die Pathologin Maura Isles heraus, dass die junge Frau kurze Zeit vor ihrem Tod entbunden haben muss – doch von dem Kind fehlt jede Spur. Dann wird eine zweite Frauenleiche gefunden, bei der Maura Anzeichen für eine frühere Lepra-Erkrankung feststellt. Detective Jane Rizzoli und Maura Isles vermuten eine Verbindung der beiden Fälle. Und die Entdeckung eines grausamen Geheimnisses gibt ihnen auf schreckliche Weise Recht …
Verpassen Sie auch nicht »Spy Coast – Die Spionin« und »Die Sommergäste«, Tess Gerritsens brillante neue Thrillerreihe über eine Gruppe aus ehemaligen Spionen, die noch lange nicht zum alten Eisen gehören!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für meine Mutter, Ruby J. C. Tom, in Liebe
Prolog
ANDHRA PRADESH INDIEN
Der Mann weigerte sich strikt, ihn auch nur einen Meter weiter zu fahren.
Kurz nachdem sie die verlassene Octagon-Fabrik passiert hatten, war die Teerstraße in einen halb zugewucherten Feldweg übergegangen. Jetzt, ein oder zwei Kilometer weiter, klagte der Fahrer, dass das Gestrüpp ihm den Lack zerkratze und der Wagen in den Schlammlöchern, die sich nach den jüngsten Regenfällen gebildet hatten, stecken zu bleiben drohe. Und dann? Dann würden sie hier festsitzen, hundertfünfzig Kilometer von Hyderabad entfernt. Howard Redfield ließ die lange Litanei der Einwände über sich ergehen und wusste doch, dass das alles nur Vorwände waren, die von dem wahren Grund für die Weigerung des Fahrers ablenken sollten. Niemand gibt gerne zu, dass er Angst hat.
Redfield hatte keine andere Wahl. Er würde zu Fuß weitergehen müssen.
Er beugte sich vor, um dem Fahrer ins Ohr zu sprechen, und ranziger Schweißgeruch stieg ihm in die Nase. Aus dem mit klappernden Holzperlen behängten Rückspiegel starrten die dunklen Augen des Fahrers ihn an.
»Sie warten doch hier auf mich, nicht wahr?«, fragte Redfield. »Bleiben Sie einfach auf der Straße stehen.«
»Wie lange?«
»Eine Stunde vielleicht. So lange, wie es eben dauert.«
»Ich sage Ihnen doch, da gibt es nichts zu sehen. Es ist niemand mehr dort.«
»Warten Sie einfach hier, okay? Warten Sie. Ich zahle Ihnen das Doppelte, wenn wir wieder in der Stadt sind.«
Redfield schnappte sich seinen Rucksack, stieg aus und tauchte augenblicklich in ein Meer von Feuchtigkeit ein. Er hatte keinen Rucksack mehr getragen, seit er als junger, mittelloser Collegestudent durch Europa getrampt war, und er kam sich ein wenig komisch vor, als er sich ihn nun, als einundfünfzigjähriger Mann, über die hängenden Schultern streifte. Aber er würde den Teufel tun, in dieser Waschküche von einem Land auch nur einen Schritt ohne seine Grundausstattung zu machen – eine Flasche mit abgekochtem Trinkwasser, Insektenschutzmittel, Sonnencreme und Durchfallmedizin. Und seine Kamera – die konnte er unmöglich zurücklassen.
Schwitzend stand er in der Nachmittagssonne, blickte zum Himmel und dachte: Na großartig – die Sonne geht bald unter, und in der Dämmerung kommen die Moskitos aus ihren Löchern. Hier ist euer Abendessen, ihr kleinen Mistviecher.
Er marschierte los. Der Weg war von hohem Gras überwuchert; er stolperte über eine Furche und sank mit seinen Trekkingschuhen knöcheltief im Matsch ein. Offenbar war hier schon seit Monaten kein Fahrzeug mehr entlanggekommen, und die Natur hatte sich ihr Territorium rasch zurückerobert. Redfield blieb stehen, rang keuchend nach Luft, schlug nach Insekten. Als er sich umdrehte, war von dem Wagen nichts mehr zu sehen. Das beunruhigte ihn. Konnte er sich darauf verlassen, dass der Fahrer auf ihn warten würde? Der Mann hatte ihn nur widerstrebend so weit gefahren, und mit jedem Kilometer, den sie auf der immer holpriger werdenden Straße zurückgelegt hatten, war er nervöser geworden. Da draußen seien böse Menschen, hatte der Fahrer gesagt; schreckliche Dinge seien in dieser Gegend passiert. Sie könnten beide verschwinden, und wer würde sich dann die Mühe machen, nach ihnen zu suchen?
Redfield kämpfte sich weiter vor.
Die feuchte Luft schien immer dichter zu werden. Er konnte das Wasser in der Flasche schwappen hören, und schon jetzt quälte ihn der Durst, doch er wollte keine Pause machen. Es würde nur noch eine gute Stunde hell sein, und er hatte keine Zeit zu verlieren. Im Gras summten die Insekten, über ihm in den Kronen der Bäume schrien Vögel – das nahm er jedenfalls an, auch wenn die Geräusche nichts mit irgendwelchen Vogelstimmen gemein hatten, die er kannte. Alles an diesem Land kam ihm fremd und unwirklich vor, und in einer albtraumhaften Trance setzte er einen Fuß vor den anderen, während der Schweiß ihm die Brust hinabrann. Mit jedem Schritt schien sein Atem schneller zu gehen. Laut Karte konnten es nicht mehr als zweieinhalb Kilometer sein, doch der Marsch schien sich endlos hinzuziehen, und das Insektenschutzmittel, mit dem er sich erneut eingerieben hatte, schien die Moskitos nicht abzuschrecken. Ihr nervöses Gesumme tönte ihm in den Ohren, und bald war sein Gesicht von juckenden Quaddeln überzogen.
Erneut stolperte er in eine tiefe Furche und landete auf den Knien im hohen Gras. Da hockte er nun und spuckte einen Mund voll Grünzeug aus, entmutigt und erschöpft, am Ende seiner Kräfte. Er beschloss, dass es an der Zeit war, umzukehren. Die Segel zu streichen und nach Cincinnati zurückzufliegen. Es war nun mal weniger gefährlich, ein Feigling zu sein – und wesentlich bequemer.
Er seufzte und wollte sich eben mit der Hand am Boden abstützen, um sich aufzurichten, als er plötzlich erstarrte, den Blick auf die Erde gerichtet. Dort, zwischen den Grashalmen, glitzerte es metallisch. Es war nur ein billiger Blechknopf, aber in diesem Moment erschien er ihm wie ein Zeichen, ein Talisman. Er steckte ihn in die Hosentasche, rappelte sich auf und ging weiter.
Nach nur wenigen hundert Schritten weitete sich die Straße plötzlich zu einer von hohen Bäumen umstandenen Lichtung. Am anderen Ende erblickte er ein einzelnes Gebäude, einen niedrigen Bau aus Hohlblocksteinen mit rostigem Blechdach. Trockene Zweige trieben raschelnd in dem leichten Wind, der durch das Gras strich.
Das ist es, dachte er. Hier ist es passiert.
Sein Atem schien plötzlich zu laut. Mit pochendem Herzen streifte er seinen Rucksack ab, zog den Reißverschluss auf und nahm seine Kamera heraus. Du musst alles dokumentieren, dachte er. Octagon wird versuchen, dich als Lügner hinzustellen. Sie werden alles daransetzen, deine Aussagen in Zweifel zu ziehen, und deshalb musst du dir deine Verteidigung zurechtlegen. Du musst beweisen können, dass du die Wahrheit sagst.
Er trat auf die Lichtung hinaus und ging auf einen Haufen schwarzer Zweige zu. Als er die Äste mit der Schuhspitze anstieß, stieg ihm der beißende Geruch verkohlten Holzes in die Nase. Er wich zurück, und ein eiskalter Schauer überlief ihn.
Es waren die Überreste eines Scheiterhaufens.
Mit verschwitzen Fingern nahm er die Schutzkappe vom Objektiv und begann zu fotografieren. Das Auge an den Sucher gedrückt, schoss er ein Foto nach dem anderen. Eine niedergebrannte Hütte. Eine Kindersandale im Gras. Ein bunter Stofffetzen, herausgerissen aus einem Sari. Wohin er blickte, sah er ins Angesicht des Todes.
Er schwenkte nach rechts. Eine grüne Wand glitt vor seinem Objektiv vorüber. Gerade wollte er das nächste Foto schießen, als sein Finger auf dem Auslöser mitten in der Bewegung erstarrte.
Eine Gestalt huschte am äußersten Rand des Bildausschnitts vorüber.
Er ließ die Kamera sinken und hob den Kopf, starrte zum Waldrand hinüber. Doch es war nichts mehr zu sehen, nur die Äste, die sich im Wind wiegten.
Da – hatte sich da nicht am Rand seines Gesichtsfelds etwas bewegt? Nur für einen Sekundenbruchteil hatte er eine dunkle Gestalt zwischen den Bäumen erblickt. War es ein Affe gewesen? Er musste weiterfotografieren. Das Tageslicht schwand rapide.
Er ging an einem gemauerten Brunnen vorbei auf das Gebäude mit dem Blechdach zu. Das hohe Gras streifte seine Hosenbeine, während seine Blicke nach links und rechts schossen. Als er näher kam, erkannte er, dass die Mauern des Gebäudes von Rauch geschwärzt waren. Vor dem Eingang lag ein Haufen Asche mit verkohlten Aststücken darin. Noch ein Scheiterhaufen.
Er machte einen Bogen darum und warf einen Blick durch die offene Tür.
Zuerst konnte er in dem Dämmerlicht kaum etwas erkennen. Die Nacht brach schon herein, und drinnen war es noch dunkler, eine Palette von Schwarz- und Grautönen. Er verharrte einen Moment regungslos, während seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Mit wachsendem Erstaunen registrierte er das Glitzern von frischem Wasser in einem irdenen Krug. Den Duft von Gewürzen. Wie war das möglich?
Hinter ihm knackte ein Zweig.
Er wirbelte herum.
Auf der Lichtung stand eine einsame Gestalt. Das Rauschen in den Bäumen ringsum hatte sich gelegt, und selbst die Vögel waren verstummt. Die Gestalt kam mit merkwürdig ungelenken Bewegungen auf Redfield zu und blieb wenige Schritte vor ihm stehen.
Die Kamera fiel ihm aus den Händen. Er wich entsetzt zurück, den Blick auf die Gestalt geheftet.
Es war eine Frau. Und sie hatte kein Gesicht.
1
Man nannte sie die »Königin der Toten«.
Zwar wagte es niemand, den Spitznamen in ihrer Gegenwart auszusprechen, doch ab und zu hörte sie, wie sich die Leute ihn hinter ihrem Rücken zuflüsterten, wenn sie zwischen Tatort, Leichenschauhaus und Gerichtssaal ihrem düsteren Geschäft nachging. Bisweilen konnte sie einen Unterton von finsterem Sarkasmus aus den Kommentaren heraushören: Ach, sieh da, die Herrin der Unterwelt holt wieder eine arme Seele in ihr Reich! Manchmal schwang auch ein nervöses Tremolo in den geflüsterten Bemerkungen mit, wie in dem Getuschel der Frommen, wenn ein gottloser Fremder vorübergeht. Es war die Unruhe derer, die nicht begreifen konnten, warum sie freiwillig in den Fußstapfen der Toten wandelte. Macht ihr das vielleicht Spaß?, fragten sie sich. Übt die Berührung von erkaltetem Fleisch, der Geruch der Verwesung einen solchen Reiz auf sie aus, dass sie dafür den Lebenden den Rücken kehrt? Sie finden das einfach nicht normal – sie werfen ihr verstörte Blicke zu und registrieren Details, die sie nur in ihrer Überzeugung bestärken, dass sie ein ziemlich schräger Vogel ist. Die elfenbeinfarbene Haut, das rabenschwarze Haar mit dem schlichten Kleopatra-Schnitt; die grellrot geschminkten Lippen, wie eine blutige Wunde. Wer außer ihr trägt denn zu einer Leichenuntersuchung Lippenstift? Aber vor allem ist es ihre unerschütterliche Ruhe, die diese Beobachter beunruhigt, die kühle, hoheitsvolle Miene, mit der sie einen grausigen Anblick aufnimmt, bei dem sich ihnen selbst der Magen umdreht. Im Gegensatz zu ihnen wendet sie sich nicht angewidert ab. Im Gegenteil, sie beugt sich herab, geht ganz nahe heran, tastet – und schnuppert.
Und später schwingt sie dann unter den grellen Lampen ihres Autopsiesaals das Skalpell.
So wie jetzt. Ruhig führte sie die Klinge durch die gekühlte Haut, durch das gelblich glänzende subkutane Fett. Ein Mann, der eine Vorliebe für Hamburger und Pommes frites gehabt hatte, dachte sie, als sie zu einer gewöhnlichen Gartenschere griff, um die Rippen zu durchtrennen und den dreieckigen Schild des Brustbeins anzuheben, wie man die Tür eines Tresors öffnet, um an die darin verborgenen Juwelen heranzukommen.
Das Herz lag in seinem schwammigen Bett aus Lungengewebe. Neunundfünfzig Jahre lang hatte es das Blut durch die Adern von Mr. Samuel Knight gepumpt. Es war mit ihm gewachsen, mit ihm gealtert, hatte sich verändert in dem Maße, wie aus seinem einst jugendlich-muskulösen Körper allmählich diese Ansammlung von Fettpolstern geworden war. Jede Pumpe versagt irgendwann den Dienst, so auch das Herz in Mr. Knights Brust. Er hatte in seinem Hotelzimmer in Boston vor dem Fernseher gesessen, ein Glas Whisky aus der Minibar neben sich auf dem Nachttisch, als es seinen letzten Schlag getan hatte.
Sie stellte keine Spekulationen darüber an, welches seine letzten Gedanken gewesen waren, oder ob er vielleicht Schmerzen oder Angst empfunden hatte. Auch wenn sie seinen Körper in allen intimen Einzelheiten erkundete, auch wenn sie seine Haut aufschlitzte und sein Herz in den Händen hielt, blieb Mr. Samuel Knight für sie ein Fremder – stumm und anspruchslos, bereit, ihr seine sämtlichen Geheimnisse zu offenbaren. Die Toten sind geduldig. Sie beklagen sich nicht, sie drohen und sie schmeicheln nicht.
Die Toten verletzen uns nicht; das tun nur die Lebenden.
Mit ruhigen, effizienten Bewegungen schnitt sie nun die Thoraxorgane heraus und legte das Herz vorsichtig in eine Schale. Draußen fiel der erste Schnee des Dezembers, kleine weiße Flocken, die mit leisem Knistern an die Fensterscheiben prasselten und sich auf den Asphalt senkten. Doch hier im Labor waren die einzigen Geräusche das Plätschern des Wassers und das Surren des Ventilators. Mauras Assistent Yoshima glitt lautlos durch den Raum; es war beinahe unheimlich, wie er ihren Anweisungen zuvorkam und immer dann an ihrer Seite auftauchte, wenn sie ihn brauchte. Sie arbeiteten erst anderthalb Jahre zusammen, und doch funktionierten sie schon wie ein einziger Organismus, verbunden durch die Telepathie zweier logisch denkender Gehirne. Sie musste ihn nicht bitten, die Lampe neu auszurichten – es war bereits passiert: Der Lichtstrahl fiel auf das bluttriefende Herz, und die Schere hielt er auch schon in der Hand, sie musste sie nur noch entgegennehmen.
Die dunkel gefleckte Wand der rechten Herzkammer und die weißliche Narbe an der Spitze des Organs erzählten ihr die traurige Geschichte dieses Herzens. Durch einen Myokardinfarkt, der sich vor Monaten oder gar Jahren ereignet hatte, war bereits ein Teil der linken Ventrikelwand zerstört worden. Und irgendwann innerhalb der letzten vierundzwanzig Stunden war es dann zu einem neuerlichen Infarkt gekommen. Eine Thrombose hatte die rechte Koronararterie verstopft und damit die Blutversorgung des rechten Kammermuskels unterbunden.
Sie resezierte Gewebe für die Histologie, doch sie wusste bereits, was sie unter dem Mikroskop finden würde. Blutgerinnsel und nekrotisiertes Gewebe. Die Invasion der weißen Blutkörperchen, die wie eine Armee zur Verteidigung herbeiströmten. Vielleicht hatte Mr. Samuel Knight die Beschwerden in seiner Brust schlicht für Sodbrennen gehalten. Ein allzu üppiges Mittagessen – hätte mich wohl doch bei den Zwiebeln ein bisschen zurückhalten sollen. Nun, ein Beutel Maaloxan würde sicher Abhilfe schaffen. Oder womöglich hatte es noch bedrohlichere Anzeichen gegeben, die er aber geflissentlich ignoriert hatte: das Druckgefühl auf der Brust, die Kurzatmigkeit. Gewiss war es ihm nicht in den Sinn gekommen, dass er einen Herzinfarkt hatte.
Dass er tags darauf seinen massiven Herzrhythmusstörungen erliegen würde.
Jetzt lag das Herz aufgeschnitten auf dem Sektionsbrett. Ihr Blick fiel auf den seiner Organe beraubten Brustkorb. So endet also deine Dienstreise nach Boston, dachte sie. Ein Fall ohne große Überraschungen. Keine Anzeichen für einen gewaltsamen Tod – wenn man von der schleichenden Gewalt absieht, die du deinem eigenen Körper zugefügt hast, Mr. Samuel Knight.
Die Sprechanlage knackte. »Dr. Isles?« Es war Louise, ihre Sekretärin.
»Ja?«
»Detective Rizzoli ist am Apparat und will Sie sprechen. Können Sie den Anruf annehmen?«
»Ja, ich gehe dran.«
Maura streifte die Latexhandschuhe ab und ging zum Wandtelefon. Yoshima, der am Waschbecken gestanden und Instrumente gespült hatte, drehte den Wasserhahn zu. Er wandte sich zu ihr um und beobachtete sie mit seinen ruhigen Tigeraugen. Yoshima wusste genau, was ein Anruf von Rizzoli bedeutete.
Als Maura schließlich auflegte, fing sie seinen fragenden Blick auf.
»Heute geht es früh los«, meinte sie. Dann zog sie ihren Kittel aus und machte sich auf, um ein neues Opfer in ihr Reich zu holen.
Der morgendliche Schneefall war mittlerweile in eine tückische Mischung aus Schnee und Eisregen übergegangen, und von den Räumfahrzeugen der Stadt war weit und breit nichts zu sehen. Vorsichtig lenkte sie den Wagen den Jamaica Riverway entlang. Zischend pflügten die Reifen durch den tiefen Schneematsch, und die Scheibenwischer kratzten über die vereiste Windschutzscheibe. Es war der erste Schnee dieses Winters, und die Autofahrer hatten sich noch nicht auf die veränderten Bedingungen eingestellt. Einige Pechvögel waren bereits von der Straße abgekommen, und einmal passierte sie einen Streifenwagen, der mit flackerndem Blaulicht am Straßenrand stand. Ein Polizist und der Fahrer eines Abschleppwagens waren ausgestiegen und blickten in den Straßengraben, wo ein verunglücktes Auto auf der Seite lag.
Die Räder ihres Lexus begannen nach links auszubrechen, und für einen Moment sah es so aus, als steuerte sie direkt auf den Gegenverkehr zu. In Panik stieg sie auf die Bremse und spürte, wie das elektronische Stabilitätsprogramm des Wagens in Aktion trat. Mit wild pochendem Herzen lenkte sie ihr Fahrzeug auf ihre eigene Spur zurück. Verdammter Mist, dachte sie. Ich ziehe wieder nach Kalifornien. Sie verlangsamte die Fahrt zu einem ängstlichen Schleichen, ohne sich daran zu stören, dass die Leute hinter ihr zu hupen begannen und sie den ganzen Verkehr aufhielt. Na los, überholt mich doch, ihr Idioten. Ich habe schon zu viele Fahrer von eurer Sorte auf den Sektionstisch gekriegt.
Bald hatte sie Jamaica Plain erreicht, ein Stadtviertel im Bostoner Westen mit alten Villen und Herrenhäusern, ausgedehnten Grünflächen, ruhigen Parkanlagen und Spazierwegen am Fluss. Im Sommer bot diese grüne Oase Zuflucht vor dem Lärm und der unerträglichen Hitze der Bostoner City, doch an einem Tag wie diesem, wenn der Himmel verhangen war und ein eisiger Wind über die öden Grasflächen fegte, überwog der Eindruck von Trostlosigkeit und Leere.
Die Adresse, zu der man sie bestellt hatte, wirkte ebenfalls wenig einladend. Das Gebäude lag abseits der Straße hinter einer hohen, von Efeu überwucherten Steinmauer. Ein Schutzwall gegen die Außenwelt, dachte sie. Alles, was sie von der Straße aus sehen konnte, waren die gotisch anmutenden Türme eines Schieferdachs und ein einzelnes, hohes Giebelfenster, das sie wie ein dunkles Auge anzustarren schien. Der Streifenwagen, der neben dem Eingangstor parkte, bestätigte ihr, dass sie hier richtig war. Nur wenige andere Fahrzeuge waren bereits eingetroffen – die Stoßtrupps, die der Armee von Polizisten und Spurensicherungs-Experten vorangingen.
Sie parkte auf der anderen Straßenseite und stieg aus, den Kopf gesenkt, um sich vor dem ersten eisigen Windstoß zu schützen. Als sie den Fuß auf den Boden setzte, rutschte sie aus und konnte den Sturz nur noch vermeiden, indem sie sich krampfhaft an der Autotür festhielt. Als sie sich hochzog, spürte sie, wie ihr eiskaltes Wasser über die Waden rann – der Saum ihres Mantels war in den Schneematsch geraten.
Einige Sekunden lang stand sie einfach nur reglos und erschrocken da, während der Schneeregen ihr ins Gesicht peitschte. Es war alles so schnell gegangen.
Ihr Blick fiel auf den Streifenwagen und den Beamten, der darin saß. Sie sah, dass er sie beobachtete. Gewiss hatte er auch ihren Ausrutscher mitbekommen. In ihrem Stolz verletzt, schnappte sie sich ihren Koffer vom Vordersitz, schlug die Tür zu und schritt unter Aufbietung ihrer ganzen Würde über die vereiste Straße auf das Haus zu.
»Alles in Ordnung, Doc?«, rief ihr der Streifenpolizist durch das offene Wagenfenster zu. Es wäre ihr lieber gewesen, wenn er sich nicht so besorgt gezeigt hätte.
»Ja, alles klar.«
»Mit den Schuhen müssen Sie wirklich aufpassen. Im Hof ist es noch glatter.«
»Wo ist Detective Rizzoli?«
»Sie sind alle in der Kapelle.«
»Und wo finde ich die?«
»Sie können sie nicht verfehlen. Es ist die Tür mit dem großen Kreuz.«
Sie ging weiter bis zum Tor, fand es jedoch verschlossen. An der Mauer war eine eiserne Glocke befestigt. Sie zog an dem Seil, und der altertümliche Klang des Läutens verhallte im Geriesel des Eisregens. Direkt unter der Glocke war eine Bronzetafel befestigt, deren Inschrift von einer braunen Efeuranke teilweise verdeckt wurde.
GRAYSTONES ABBEY ORDEN DER SCHWESTERN UNSERER LIEBEN FRAU VOM HIMMLISCHEN LICHT »Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.Darum bittet den Herrn der Ernte, dass erArbeiter in seine Ernte sende.«
Auf der anderen Seite des Tores tauchte plötzlich eine ganz in Schwarz gekleidete Frau auf. Sie hatte sich so lautlos genähert, dass Maura erschrocken zusammenzuckte, als sie das Gesicht bemerkte, das sie durch die Gitterstäbe anblickte. Es war ein uraltes Gesicht, so zerfurcht und zerklüftet, dass es in sich zusammenzufallen schien; doch die Augen waren hell und wach wie die eines Vogels. Die Nonne sprach kein Wort, sondern sah Maura nur fragend an.
»Ich bin Dr. Isles vom Rechtsmedizinischen Institut«, sagte Maura. »Die Polizei hat mich herbestellt.«
Das Tor tat sich quietschend auf.
Maura trat in den Hof. »Ich möchte zu Detective Rizzoli. Ich glaube, sie ist in der Kapelle.«
Die Nonne zeigte auf die gegenüberliegende Seite des Innenhofs; dann wandte sie sich ab und überließ es Maura, den Weg zur Kapelle zu finden. Sie selbst verschwand hinter der nächsten Tür.
Schneeflocken wirbelten zwischen den Nadeln des Eisregens umher und umtanzten wie Schmetterlinge ihre schwerfälligeren Vettern. Der kürzeste Weg wäre quer über den Hof gewesen, doch das Pflaster war mit einer Eisschicht überzogen, und Maura hatte schon erfahren müssen, wie ungeeignet ihre profillosen Sohlen für diese Witterung waren. Also zog sie es vor, sich an den überdachten Gang zu halten, der um den Innenhof herum führte. Hier war sie zwar vor dem Eisregen geschützt, doch der offene Bogengang bot kaum Schutz vor dem Wind, der durch ihren Mantel drang. Die Kälte erinnerte sie wieder einmal daran, wie unbarmherzig der Dezember in Boston sein konnte. Sie hatte den größten Teil ihres bisherigen Lebens in San Francisco verbracht, wo der Anblick einer Schneeflocke ein seltenes Vergnügen war und nicht etwa eine Qual – wie diese spitzen Nadeln, die durch die Arkaden wehten und ihr ins Gesicht peitschten. Sie hüllte sich fester in den Mantel und drückte sich dicht an die Hauswand mit den dunklen Fenstern. Von draußen drang das leise Rauschen des Verkehrs auf dem Jamaica Riverway an ihr Ohr. Bis auf die alte Nonne, die sie eingelassen hatte, schien das Kloster verlassen.
Umso mehr erschrak sie, als sie plötzlich in drei Gesichter blickte, die sie von einem Fenster aus anstarrten. Die Nonnen standen schweigend und reglos da, wie dunkel gewandete Geister hinter Glas, und beobachteten die Fremde, die in ihren stillen Zufluchtsort eingedrungen war. Die drei Augenpaare folgten ihr in einer einzigen Bewegung, als sie an dem Fenster vorüberging.
Der Eingang zur Kapelle war mit gelbem Absperrband umspannt, das in der Mitte durchhing und bereits mit einer Eiskruste überzogen war. Sie hob es an, schlüpfte darunter hindurch und schob die schwere Tür auf.
Ein greller Lichtblitz traf ihre Augen, und sie erstarrte in der Bewegung, während hinter ihr die Tür mit einem leisen Seufzen ins Schloss fiel. Sie blinzelte und wartete, bis das Nachbild verschwunden war, das sich in ihre Netzhäute eingebrannt hatte. Als sie wieder klar sehen konnte, erblickte sie Reihen von Holzbänken, weiß getünchte Wände und – am anderen Ende der Kapelle – einen Altar, über dem ein riesiges Kruzifix hing. Es war ein kalter, schmuckloser Raum, dessen Atmosphäre durch die Buntglasfenster, die nur trübe Schlieren von Licht einließen, noch zusätzlich verdüstert wurde.
»Stopp – passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten!«, sagte der Fotograf.
Maura blickte auf den Steinboden zu ihren Füßen und sah Blut. Und Fußabdrücke – ein chaotisches Gewirr von Spuren, dazwischen medizinische Abfälle: Spritzenhüllen und aufgerissene Verpackungen. Die Hinterlassenschaften eines Notarztteams. Aber keine Leiche.
Sie ließ den Blick in einem weiteren Radius schweifen und erfasste das von Fußabdrücken verschmutzte Stück weißen Stoffs im Mittelgang, die roten Spritzer auf den Bänken. Es war so kalt in dem Raum, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte, und die Temperatur schien noch weiter zu sinken – die Kälte drang ihr bis ins Mark, als sie die Reihe von Blutflecken sah, die sich über die Bänke hinzog, und sofort begriff, was hier geschehen war.
Der Fotograf knipste eifrig weiter, und jeder Blitz war wie eine Attacke auf Mauras Augen.
»He, Doc!« Hinter den Bänken in der Nähe des Altars tauchte ein dunkler Haarschopf auf. Detective Jane Rizzoli richtete sich auf und winkte ihr zu. »Das Opfer ist hier hinten.«
»Was ist denn mit dem Blut hier an der Tür?«
»Das stammt von dem zweiten Opfer, Schwester Ursula. Die Sanis haben sie ins St. Francis gebracht. Dort im Mittelgang ist noch mehr Blut, und da sind auch Fußabdrücke, die wir gerne sichern würden, also gehen Sie besser links um die Bänke herum und bleiben ganz dicht an der Wand.«
Maura zog rasch ein Paar Überschuhe aus Plastik an und ging dann vorsichtig an der Wand entlang nach vorne. Erst als sie die vorderste Bank passiert hatte, erblickte sie die Leiche der Nonne. Sie lag auf dem Rücken, und der Stoff ihres Ordensgewands war wie eine dunkle Lache, die in einen noch größeren, blutroten See überging. Beide Hände steckten in Plastikhüllen, die verhindern sollten, dass mikroskopische Spuren verwischt wurden. Maura registrierte mit einem leisen Schock, wie jung das Opfer war. Die Nonne, die sie eingelassen hatte, war eine ältere Frau gewesen, ebenso wie die drei, die sie im Fenster erblickt hatte. Diese Frau jedoch war wesentlich jünger. Es war ein Gesicht von ätherischer Zartheit, die blassblauen Augen in einem seltsam verklärten Blick erstarrt. Ihr Kopf war entblößt, das blonde Haar auf Streichholzlänge geschnitten. Die aufgeplatzte Kopfhaut und der verformte Schädel zeugten von den brutalen Schlägen, die sie getötet hatten.
»Ihr Name ist Camille Maginnes. Schwester Camille. Stammt aus Hyannisport«, sagte Rizzoli. Sie klang nüchtern und ungerührt, wie ein weiblicher Philip Marlowe. »Schwester Camille war die erste Novizin hier seit fünfzehn Jahren. Im Mai wollte sie ihr ewiges Gelübde ablegen.« Nach einer Pause fuhr sie fort: »Sie war erst zwanzig.« Ihre Stimme bebte jetzt vor Zorn, ein Riss in der coolen Fassade.
»So jung.«
»Ja. Er muss auf sie eingedroschen haben wie ein Irrer.«
Maura streifte Handschuhe über und machte sich daran, die Verletzungen zu inspizieren. Die Mordwaffe hatte gezackte Risswunden in der Kopfhaut hinterlassen, aus denen Knochensplitter ragten. Ein Klumpen grauer Hirnmasse war ausgetreten. Die Gesichtshaut war weitgehend unversehrt, jedoch dunkelviolett angelaufen.
»Sie lag auf dem Bauch, als sie starb. Wer hat sie umgedreht?«
»Die Schwestern, die sie gefunden haben«, antwortete Rizzoli. »Sie haben nach einem Puls gesucht.«
»Um wie viel Uhr wurden die Opfer gefunden?«
»Heute Morgen gegen acht.« Rizzoli warf einen Blick auf ihre Uhr. »Vor fast zwei Stunden.«
»Wissen Sie, was passiert ist? Was haben die Schwestern Ihnen erzählt?«
»Es war nicht leicht, ihnen irgendwelche brauchbaren Angaben zu entlocken. Es sind nur noch vierzehn Nonnen übrig, und sie stehen alle unter Schock. Sie haben sich hier sicher gefühlt. In der Hand Gottes. Und dann bricht so ein Wahnsinniger in ihr Kloster ein.«
»Gibt es Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen?«
»Nein, aber es dürfte auch nicht allzu schwierig gewesen sein, auf das Grundstück zu gelangen. Die Mauern sind ganz mit Efeu überwuchert – da kann man mühelos drüberklettern. Und es gibt auch noch eine Hinterpforte, die auf ein freies Feld führt, wo die Nonnen ihre Gärten haben. Der Täter könnte auch auf diesem Weg eingedrungen sein.«
»Fußspuren?«
»Hier drin gibt’s ein paar. Aber draußen dürfte so ziemlich alles zugeschneit sein.«
»Wir wissen also nicht, ob er tatsächlich eingebrochen ist. Er könnte auch durch den Haupteingang eingelassen worden sein.«
»Es ist ein strenger Orden, Doc. Normalerweise lassen sie hier niemanden rein, bis auf den Pfarrer, der die Messe liest und den Nonnen die Beichte abnimmt. Und dann ist da noch die Frau, die ihnen im Haushalt hilft. Sie darf ihre kleine Tochter mitbringen, wenn sie keinen Babysitter findet. Aber das war’s dann auch schon. Sonst kommt ohne Erlaubnis der Äbtissin niemand hier rein. Und die Schwestern müssen drin bleiben. Sie dürfen das Kloster nur verlassen, um zum Arzt zu gehen, oder aus dringenden familiären Gründen.«
»Mit wem haben Sie bis jetzt gesprochen?«
»Mit der Äbtissin, Mutter Mary Clement. Und mit den beiden Schwestern, die die Opfer gefunden haben.«
»Was haben die Ihnen erzählt?«
Rizzoli schüttelte den Kopf. »Nichts gesehen, nichts gehört. Ich bezweifle auch, dass wir von den anderen sehr viel erfahren werden.«
»Wieso?«
»Haben Sie denn nicht gesehen, wie alt die alle sind?«
»Das heißt doch nicht, dass sie nicht ihre fünf Sinne beisammen haben.«
»Eine sitzt nach einem Schlaganfall im Rollstuhl, und zwei andere haben Alzheimer. Die meisten schlafen in Zimmern ohne Fenster zum Hof, also werden sie kaum irgendwas gesehen haben.«
Zunächst beugte Maura sich nur über Camilles Leiche, ohne sie zu berühren. Sie gönnte der Toten einen letzten Moment der Würde. Jetzt kann dir nichts mehr etwas anhaben, dachte sie. Sie begann den Schädel abzutasten und fühlte, wie die losen Knochenfragmente unter der Haut aneinander rieben. »Es waren mehrere Schläge. Am Scheitel und am Hinterkopf …«
»Und das blau angelaufene Gesicht? Sind das nur Totenflecke?«
»Ja. Und sie lassen sich nicht wegdrücken.«
»Die Schläge kamen also von hinten und von oben.«
»Der Täter war vermutlich größer als sie.«
»Oder sie hat am Boden gekniet, und er hat direkt vor ihr gestanden.«
Mauras Hände verharrten reglos auf dem kühlen Fleisch der Toten. Vor ihrem inneren Auge sah sie die junge Nonne vor ihrem Mörder knien, sah die brutalen Schläge auf ihren gesenkten Kopf niederfahren, und das erschütternde Bild ließ sie innehalten.
»Was ist das nur für ein Untier, das unschuldigen Nonnen den Schädel einschlägt?«, fragte Rizzoli. »Was ist bloß los mit dieser beschissenen Welt?«
Rizzolis Ausdrucksweise ließ Maura zusammenfahren. Sie konnte sich zwar nicht erinnern, wann sie zuletzt eine Kirche betreten hatte, und sie hatte schon vor Jahren aufgehört, an Gott zu glauben, doch solche lästerlichen Worte an einem geweihten Ort empfand sie immer noch als unpassend – so tief saßen die Regeln, die man ihr als Kind eingebläut hatte. Selbst heute noch, da Geschichten von Heiligen und Wundern für sie nur noch Hirngespinste waren, würde ihr im Angesicht des Kreuzes niemals ein Fluch über die Lippen kommen.
Aber Rizzoli war so wütend, dass es ihr völlig gleichgültig war, welche Worte aus ihrem Mund hervorsprudelten, geweihter Ort hin oder her. Ihre Frisur war noch zerzauster als sonst, eine wilde schwarze Mähne, in der geschmolzene Schneeflocken glitzerten. Die blasse Haut spannte sich über scharf hervortretende Wangenknochen, und ihre Augen funkelten vor Wut wie glühende Kohlen im Halbdunkel der Kapelle. Gerechter Zorn war immer schon Jane Rizzolis Lebenselixier gewesen, das, was sie dazu trieb, Ungeheuer in Menschengestalt zu jagen. Heute jedoch schien ihre Wut zur Fieberglut gesteigert, und ihr Gesicht war schmaler als sonst, als ob das Feuer sie nun von innen verzehrte.
Maura wollte es nicht noch weiter schüren. Sie bemühte sich, mit unbewegter Stimme zu sprechen, ihre Fragen nüchtern zu formulieren. Ganz die Wissenschaftlerin, der es um Fakten und nicht um Emotionen zu tun war.
Sie fasste Schwester Camilles Arm und prüfte, ob das Ellenbogengelenk sich beugen ließ. »Es ist schlaff. Keine Totenstarre.«
»Also weniger als fünf oder sechs Stunden?«
»Es ist allerdings ziemlich kalt hier.«
Rizzoli lachte tonlos auf und stieß dabei eine weiße Dampfwolke aus. »Was Sie nicht sagen.«
»Knapp über null Grad, schätze ich. Das verzögert normalerweise das Eintreten der Totenstarre.«
»Wie lange?«
»Fast unbegrenzt.«
»Was ist mit ihrem Gesicht? Mit den Totenflecken?«
»Die können schon nach einer halben Stunde auftreten. Das hilft uns nicht sehr viel weiter bei der Bestimmung des Todeszeitpunkts.«
Maura öffnete ihren Koffer und griff nach dem chemischen Thermometer, um die Umgebungstemperatur zu messen. Mit einem Blick auf die diversen Schichten von Kleidung, in die das Opfer gehüllt war, beschloss sie, die Rektaltemperatur erst zu messen, nachdem die Tote in das Leichenschauhaus gebracht worden war. Das Licht war schlecht; es würde ihr nicht erlauben, mit ausreichender Sicherheit eine Vergewaltigung auszuschließen, ehe sie das Thermometer einführte. Beim Versuch, den leblosen Körper eines Opfers zu entkleiden, konnte es passieren, dass man wertvolle Mikrospuren vernichtete. Stattdessen nahm sie nun eine Spritze heraus, um Glaskörperflüssigkeit für die Bestimmung der postmortalen Kaliumkonzentration zu entnehmen. Das war eine Methode, den Todeszeitpunkt näher einzugrenzen.
»Was können Sie mir über das andere Opfer sagen?«, fragte Maura, während sie die Nadel in den linken Augapfel senkte und die Glaskörperflüssigkeit langsam in das Röhrchen zog.
Rizzoli stöhnte angesichts der Prozedur angewidert auf und wandte sich ab. »Bei dem Opfer, das an der Tür gefunden wurde, handelt es sich um Schwester Ursula Rowland, achtundsechzig. Muss ganz schön zäh sein, die Alte. Angeblich hat sie die Arme bewegt, als sie sie in den Rettungswagen geschoben haben. Sie sind gerade mit ihr weggefahren, als Frost und ich hier eintrafen.«
»Wie schwer war sie verletzt?«
»Ich habe sie selbst nicht gesehen. Das Letzte, was wir vom St.-Francis-Hospital gehört haben, war, dass sie im OP sei. Multiple Schädelfrakturen und Gehirnblutungen.«
»Wie bei diesem Opfer hier.«
»Genau. Wie bei Camille.« Wieder schwang Zorn in Rizzolis Stimme.
Maura richtete sich auf und schlang fröstelnd die Arme um den Leib. Ihre Hosenbeine hatten sich mit dem Wasser aus dem durchtränkten Saum ihres Mantels vollgesogen, und sie hatte das Gefühl, dass ihre Waden in Eisblöcken steckten. Am Telefon hatte man ihr gesagt, der Tatort sei in einem geschlossenen Raum, also hatte sie Schal und Handschuhe im Wagen gelassen. Doch in dieser ungeheizten Kapelle war es kaum wärmer als draußen auf dem mit Schnee und Eis bedeckten Innenhof. Sie steckte die Hände in die Manteltaschen und fragte sich, wie Rizzoli, die auch weder Schal noch Handschuhe trug, es so lange in dieser Kälte aushielt. Rizzoli schien eine eigene Wärmequelle in sich zu tragen – das Fieber ihrer Wut und Empörung; und obwohl ihre Lippen bereits blau anliefen, schien sie es nicht eilig zu haben, einen wärmeren Raum aufzusuchen.
»Warum ist es hier eigentlich so kalt?«, fragte Maura. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihnen Vergnügen macht, hier Messen zu feiern.«
»Das tun sie auch nicht. Dieser Teil des Gebäudes wird im Winter gar nicht genutzt – es wäre zu teuer, ihn zu heizen. Und sie sind ja auch nur noch eine Hand voll. Für die Messe benutzen sie eine kleine Kapelle, die zum Wohntrakt gehört.«
Maura musste an die drei Nonnen denken, die sie durch die Fensterscheibe gesehen hatte, alle drei nicht mehr die Jüngsten. Diese Schwestern waren wie heruntergebrannte Kerzen, die eine nach der anderen erloschen.
»Wenn die Kapelle nicht genutzt wird«, fragte sie, »was haben die Opfer dann hier getan?«
Rizzoli seufzte und ließ dabei eine Dampfwolke entweichen, die einem fauchenden Drachen gut angestanden hätte. »Das weiß kein Mensch. Die Äbtissin sagt, sie habe Ursula und Camille zuletzt gestern Abend gegen neun Uhr beim Gebet gesehen. Als sie nicht zum Morgengebet erschienen, machten die Schwestern sich auf die Suche nach ihnen. Sie hätten nie damit gerechnet, sie hier zu finden.«
»All diese Schläge auf den Kopf. Das sieht nach blinder Wut aus.«
»Aber sehen Sie sich das Gesicht an«, sagte Rizzoli und deutete auf Camille. »Er hat sie nicht ins Gesicht geschlagen. Das Gesicht hat er verschont. Das deutet doch auf ein eher unpersönliches Motiv hin. Als ob er es nicht auf sie selbst abgesehen hätte, sondern auf das, was sie darstellt. Das, wofür sie steht.«
»Autorität?«, fragte Maura. »Macht?«
»Seltsam. Ich hätte eher auf so etwas wie Glaube, Liebe und Hoffnung getippt.«
»Nun ja, ich war eben auf einer katholischen Oberschule.«
»Sie?« Rizzoli lachte ungläubig auf. »Das hätte ich jetzt nicht gedacht.«
Maura sog die eisige Luft tief in ihre Lungen und blickte zu dem Kreuz auf, während sie an ihre Jahre auf der Holy Innocents Academy zurückdachte. Und an die erlesenen Qualen, die ihre Geschichtslehrerin Schwester Magdalene ihr hatte zuteil werden lassen. Es waren keine körperlichen, sondern seelische Qualen gewesen, die diese Frau denjenigen Mädchen zugefügt hatte, die in ihren Augen – und ihr Blick war untrüglich – ein Übermaß an Selbstvertrauen an den Tag legten. Im Alter von vierzehn Jahren waren Mauras beste Freunde nicht Menschen, sondern Bücher gewesen. Sie hatte den Unterrichtsstoff stets mühelos bewältigt und war auch noch stolz darauf gewesen. Damit hatte sie sich den Zorn von Schwester Magdalene zugezogen. In Mauras eigenem Interesse musste dieser sündhafte Stolz in ihrem Herzen unterdrückt und durch christliche Demut ersetzt werden. Schwester Magdalene hatte sich mit grimmiger Begeisterung dieser Aufgabe gewidmet. Sie hatte Maura vor der ganzen Klasse lächerlich gemacht, hatte ihre tadellosen Aufsätze mit bissigen Randbemerkungen versehen und jedes Mal vernehmlich geseufzt, wenn Maura die Hand gehoben hatte, um eine Frage zu stellen. Am Ende war Maura nur resigniertes Schweigen geblieben.
»Sie haben mich immer ziemlich eingeschüchtert«, sagte Maura. »Die Nonnen, meine ich.«
»Ich dachte, Sie hätten vor gar nichts Angst, Doc.«
»Ich habe vor vielen Dingen Angst.«
Rizzoli lachte. »Bloß nicht vor Leichen, wie?«
»Es gibt auf dieser Welt vieles, wovor man sich mehr fürchten muss als vor Leichen.«
Sie ließen Camille auf ihrem Lager aus kaltem Stein zurück und gingen an der Wand der Kapelle entlang zurück zum Eingangsbereich, zu der blutbefleckten Stelle am Boden, wo Schwester Ursula noch lebend gefunden worden war. Der Fotograf hatte seine Arbeit beendet und war gegangen; jetzt waren Maura und Rizzoli allein in der Kapelle, zwei Frauen, deren Stimmen von den kahlen Wänden widerhallten. Maura hatte immer geglaubt, ein Gotteshaus sei ein universeller Zufluchtsort, wo selbst die Seele des Ungläubigen Trost suchen und finden konnte. Aber für sie gab es keinen Trost an diesem kalten Ort, einem Ort des Grauens, wo der Tod blutige Ernte gehalten hatte, ohne jede Rücksicht auf die Symbole des Heiligen.
»Sie haben Schwester Ursula genau hier gefunden«, sagte Rizzoli. »Sie lag mit dem Kopf zum Altar, die Füße zeigten zur Tür.«
Als hätte sie sich vor dem Kruzifix in den Staub geworfen.
»Dieser Kerl ist eine verdammte Bestie«, stieß Rizzoli wütend hervor, ihre Worte abgehackt und scharf wie Eissplitter. »Wir haben es mit einem Monster zu tun, einem Verrückten. Oder mit irgendeinem bekifften Arschloch, das nur irgendwas klauen wollte.«
»Wir wissen nicht sicher, ob es ein Mann war.«
Rizzoli machte eine ungehaltene Geste in Richtung von Schwester Camilles Leiche. »Glauben Sie etwa, das ist das Werk einer Frau?«
»Eine Frau kann sehr wohl mit einem Hammer zuschlagen. Und einem Menschen den Schädel einschlagen.«
»Wir haben einen Fußabdruck gefunden. Da, ungefähr in der Mitte des Gangs. Sah mir ganz nach einem Männerschuh aus, schätzungsweise Größe 45.«
»Einer der Sanitäter vielleicht?«
»Nein, die Abdrücke der Jungs vom Rettungsdienst können Sie hier vorne an der Tür sehen. Der im Mittelgang sieht anders aus. Der ist von ihm.«
Der auffrischende Wind ließ die Fensterscheiben klirren, und die Tür knarrte, als ob unsichtbare Hände daran rüttelten. Rizzolis Lippen waren blau vor Kälte, ihr Gesicht war leichenblass, doch immer noch schien es sie nicht zu drängen, sich in einen wärmeren Raum zurückzuziehen. Das war typisch Rizzoli – viel zu stur, als dass sie als Erste die Segel gestrichen hätte. Zu stur, um zuzugeben, dass sie am Ende ihrer Kräfte war.
Maura blickte auf den Steinboden herab, auf dem Schwester Ursula gelegen hatte, und sie konnte Rizzolis intuitiver Einschätzung nicht widersprechen, dass dieser Überfall die Tat eines Geisteskranken war. Es war der schiere Wahnsinn, der aus diesen Blutflecken sprach. Aus den Schlägen, die Schwester Camilles Schädel zertrümmert hatten. Entweder Wahnsinn oder abgrundtiefe Bosheit.
Ein eiskalter Schauer lief ihr über den Rücken. Fröstelnd richtete sie sich auf und starrte das Kruzifix an. »Mir ist schrecklich kalt«, sagte sie. »Kann man sich hier irgendwo aufwärmen? Und vielleicht eine Tasse Kaffee trinken?«
»Sind Sie hier fertig?«
»Ich habe gesehen, was es zu sehen gibt. Alles andere wird uns die Autopsie verraten.«
2
Sie traten aus der Kapelle ins Freie und stiegen über das Absperrband, das sich inzwischen ganz vom Türrahmen gelöst hatte und mit einer Eisschicht überzogen am Boden lag. Der Wind wehte ihnen Schneeflocken ins Gesicht und zerrte an ihren Mänteln, als sie mit zusammengekniffenen Augen den überdachten Gang entlangstapften. Nach einer Weile traten sie durch eine Tür in eine düstere Diele, und Maura spürte einen kaum merklichen Hauch von warmer Luft an ihren vor Kälte tauben Wangen. Es roch nach Eiern und alter Farbe, vermischt mit dem muffigen Geruch einer vorsintflutlichen Heizung, die mehr Staub als Wärme auszustrahlen schien.
Sie folgten dem Klappern von Geschirr und gingen einen schwach beleuchteten Korridor entlang, der sie zu einem in helles Neonlicht getauchten Raum führte – in dieser Umgebung ein irritierend modernes Detail. Grell und unbarmherzig schien es in die zerfurchten Gesichter der Nonnen, die an einem ramponierten Esstisch saßen. Es waren ihrer dreizehn – eine Unglückszahl. Ihre Aufmerksamkeit war von bunt geblümten Stoffquadraten, Seidenbändern und Schalen mit getrocknetem Lavendel und Rosenblättern in Anspruch genommen. Handarbeitsstunde, dachte Maura, während sie zusah, wie arthritische Hände in Schalen mit Kräutern griffen und Duftsäckchen mit Seidenbändern verschnürten. Eine der Nonnen saß zusammengesunken und schief in einem Rollstuhl. Eine Hand lag zu einer Klaue verkrampft auf der Armlehne, und eine Gesichtshälfte hing herab wie bei einer Wachsmaske, die zu nahe ans Feuer geraten ist. Die grausamen Folgen eines Schlaganfalls. Und doch war sie es, die die beiden Eindringlinge als Erste bemerkte. Sie stöhnte leise, worauf die anderen Schwestern aufblickten und Maura und Rizzoli fragend ansahen.
Maura blickte in die verhutzelten Gesichter, schockiert über die Gebrechlichkeit, die sie darin sah. Das waren nicht die strengen Ebenbilder der Autorität, die sie von ihrer Schulzeit her kannte; nein, es waren die Gesichter verwirrter, verängstigter Frauen, die von ihr eine Erklärung für diese Tragödie erhofften. Ihr war nicht wohl in ihrer Haut; es ging ihr wie einer erwachsenen Tochter, wenn ihr zum ersten Mal klar wird, dass sie und ihre Eltern die Rollen getauscht haben.
»Kann mir jemand sagen, wo Detective Frost ist?«, fragte Rizzoli.
Die Frage wurde von einer gehetzt aussehenden Frau beantwortet, die soeben mit einem Tablett voller frisch gespülter Kaffeetassen aus der angrenzenden Küche gekommen war. Sie trug einen verblichenen blauen Pullover mit Fettflecken, und zwischen den Seifenblasen an ihrer linken Hand blitzte ein Ring mit einem winzigen Diamanten auf. Keine Nonne, dachte Maura, sondern die Haushaltshilfe, die dieser immer gebrechlicher werdenden Gemeinschaft zur Hand ging.
»Er spricht noch mit der Äbtissin«, sagte die Frau. Sie deutete mit einem Kopfnicken zur Tür, und eine Strähne ihres braunen Haars fiel ihr in die von Sorgenfalten gezeichnete Stirn. »Ihr Büro ist am anderen Ende des Flurs.«
Rizzoli nickte. »Ich kenne den Weg.«
Aus dem harten Licht des Speisesaals tauchten sie wieder in den düsteren Korridor ein. Maura spürte einen Luftzug, einen eiskalten Hauch – als ob gerade ein Geist an ihr vorübergehuscht wäre. Sie glaubte nicht an ein Leben nach dem Tod, doch wenn sie in den Fußstapfen von kürzlich Verstorbenen wandelte, fragte sie sich bisweilen, ob die Toten nicht eine Art Spur hinterließen, so etwas wie ein schwaches Energiefeld, das jeder, der an diesem Ort vorbeikam, spüren konnte.
Rizzoli klopfte an die Tür des Büros der Äbtissin, worauf eine zittrige Stimme »Herein!« rief.
Als Maura den Raum betrat, stieg ihr köstlicher Kaffeeduft in die Nase. Sie erblickte mit dunklem Holz verkleidete Wände und einen Schreibtisch aus Eichenholz, über dem ein schlichtes Kruzifix hing. Hinter dem Schreibtisch saß eine Nonne mit gebeugtem Rücken, deren Brillengläser ihre Augen wie blaue Seen erscheinen ließen. Sie schien mindestens so alt wie ihre Mitschwestern drüben im Refektorium, und ihre Brille wirkte so schwer, dass man unwillkürlich befürchtete, ihr Gewicht müsse die zerbrechliche Frau auf die Schreibtischplatte hinabziehen. Doch die Augen, die Maura durch die dicken Gläser musterten, waren hellwach und intelligent.
Rizzolis Partner Barry Frost stellte sofort seine Kaffeetasse ab und erhob sich höflich von seinem Platz. Frost war die Verkörperung des netten Jungen von nebenan; der einzige Cop im ganzen Morddezernat, der es fertig brachte, einen Vernehmungsraum zu betreten und den Verdächtigen glauben zu machen, sein bester Freund sei gerade zu Besuch gekommen. Er war zudem der Einzige im Team, der absolut kein Problem damit zu haben schien, mit der launischen Rizzoli zusammenzuarbeiten, die jetzt gerade neidisch seine Kaffeetasse beäugte. Es war ihr keineswegs entgangen, dass ihr Partner hier in diesem geheizten Zimmer gesessen und Kaffee geschlürft hatte, während sie in der Kapelle gefroren hatte.
»Ehrwürdige Mutter«, sagte Frost, »darf ich Ihnen Dr. Isles vom Rechtsmedizinischen Institut vorstellen. Doc, das ist Mutter Mary Clement.«
Maura ergriff die Hand der Äbtissin. Sie fühlte sich gichtig an, die Haut wie trockenes Papier über bloßen Knochen. Während sie sie schüttelte, bemerkte Maura ein Stück beigefarbenen Stoffs, das unter dem schwarzen Ärmel hervorlugte. Das war also der Trick, mit dem die Nonnen es in diesen schlecht geheizten Räumen aushielten – unter ihrer wollenen Tracht trug die Äbtissin lange Unterwäsche.
Verzerrte blaue Augen fixierten sie durch die dicken Gläser. »Vom Rechtsmedizinischen Institut? Heißt das, Sie sind Ärztin?«
»Ja. Ich bin Pathologin.«
»Sie untersuchen also Todesursachen?«
»Richtig.«
Die Äbtissin hielt inne, als müsste sie all ihren Mut zusammennehmen, um die nächste Frage zu stellen. »Sind Sie schon in der Kapelle gewesen? Haben Sie sie gesehen…«
Maura nickte. Sie wollte der Frage zuvorkommen, von der sie schon wusste, dass sie kommen würde, doch sie brachte es einfach nicht fertig, in Gegenwart einer Nonne ihre guten Manieren über Bord zu werfen. Auch mit ihren vierzig Jahren konnte der Anblick einer schwarzen Tracht sie immer noch nervös machen.
»Hat sie…« Mary Clements Stimme erstarb zu einem Flüstern. »Hat Schwester Camille sehr leiden müssen?«
»Leider kann ich Ihre Frage noch nicht beantworten. Dazu muss ich erst die Ergebnisse der… Untersuchungen abwarten.« Sie hatte Autopsie sagen wollen, doch das Wort schien zu kalt, zu technisch für Mary Clements behütete Ohren. Und es widerstrebte ihr auch, die furchtbare Wahrheit zu enthüllen: dass sie nämlich eine ziemlich präzise Vorstellung davon hatte, was mit Camille passiert war. Jemand hatte der jungen Frau in der Kapelle aufgelauert, hatte ihr nachgesetzt, als sie in Panik durch den Mittelgang auf den Altar zugelaufen war, und ihr dabei den weißen Novizinnenschleier vom Kopf gerissen. Dann waren seine Schläge auf ihren Schädel niedergefahren, bis das Blut auf die Bänke gespritzt war, doch sie war noch ein paar Schritte weiter getaumelt, bis sie schließlich gestrauchelt und vor ihm auf die Knie gesunken war. Aber selbst jetzt hatte der Täter noch nicht genug gehabt. Immer und immer wieder hatte er auf sie eingeschlagen und ihre Schädeldecke zertrümmert wie eine Eierschale.
Maura wich Mary Clements Blick aus und hob die Augen für einen kurzen Moment zu dem Holzkreuz, das hinter dem Schreibtisch an der Wand hing, doch auch der Anblick dieses eindrucksvollen Symbols vermochte ihr keinen Trost zu spenden.
Rizzoli brach das Schweigen. »Wir haben die Schlafzimmer noch nicht gesehen.« Wie üblich war sie die Sachlichkeit in Person, ganz auf den nächsten notwendigen Schritt konzentriert.
Mary Clement blinzelte die Tränen weg, die ihr in die Augen gestiegen waren. »Ja. Ich wollte eben Detective Frost nach oben bringen, um ihm die Zimmer der beiden zu zeigen.«
Rizzoli nickte. »Also gut, wir wären dann so weit.«
Die Äbtissin führte sie über eine unbeleuchtete Treppe hinauf ins Obergeschoss. Nur ein schwacher Schein von Tageslicht sickerte durch die Buntglasfenster herein. An sonnigen Tagen schmückte wohl eine bunte Farbpalette die Wände des Treppenhauses, doch an diesem düsteren Wintermorgen waren lediglich verschiedene Schattierungen von Grau zu sehen.
»Die meisten Zimmer im oberen Stock stehen jetzt leer. Im Laufe der Jahre mussten immer mehr Schwestern ins Erdgeschoss umziehen«, erklärte Mary Clement, während sie langsam Stufe um Stufe erklomm und sich dabei an das Geländer klammerte, als würde sie sich daran hochziehen. Maura rechnete jedem Moment damit, dass sie hinterrücks die Treppe hinunterfallen würde, und so blieb sie dicht hinter ihr und zuckte jedes Mal zusammen, wenn die Äbtissin in ihrem schwankenden Anstieg innehielt. »Schwester Jacinta hat ein schlimmes Knie, also wird sie auch nach unten umziehen. Und Schwester Helen ist neuerdings ziemlich kurzatmig. Es sind nur noch so wenige von uns übrig …«
»So ein großes Haus macht ja sicher auch viel Arbeit«, meinte Maura.
»Groß und alt.« Die Äbtissin blieb stehen, um einen Moment zu verschnaufen. Mit einem betrübten Lachen fügte sie hinzu: »Alt wie wir selbst. Und so teuer im Unterhalt. Wir dachten schon, wir müssten es verkaufen, aber Gott hat einen Weg gefunden, es uns zu erhalten.«
»Wie das?«
»Letztes Jahr hat sich ein großzügiger Spender gefunden. Jetzt haben wir mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Das Schieferdach ist neu, und wir haben den Dachstuhl isolieren lassen. Als Nächstes wollen wir eine neue Heizung einbauen lassen.« Sie drehte sich zu Maura um. »Ob Sie es glauben oder nicht, im Vergleich zum letzten Jahr kommt uns das Haus schon richtig wohnlich vor.« Die Äbtissin holte tief Luft und setzte ihren mühevollen Anstieg fort. Sie konnten die Perlen ihres Rosenkranzes klappern hören. »Wir waren einmal fünfundvierzig Schwestern hier im Haus. Als ich damals nach Graystones kam, waren hier alle Zimmer belegt. In beiden Flügeln. Aber heute fehlt es uns an Nachwuchs.«
»Wie lange sind Sie schon hier, Ehrwürdige Mutter?«, fragte Maura.
»Ich bin mit achtzehn als Postulantin in den Orden eingetreten. Da gab es einen jungen Mann, der mich gerne geheiratet hätte. Ich fürchte, es hat seinen Stolz sehr verletzt, als ich ihn abwies, um mich Gott zuzuwenden.« Sie blieb auf der Treppe stehen und wandte sich um. Zum ersten Mal bemerkte Maura das Hörgerät unter dem straff anliegenden Schleier. »Das können Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen, oder, Dr. Isles? Dass ich einmal so jung war?«
Nein, das konnte Maura nicht. Sie konnte sich Mary Clement unmöglich anders vorstellen, als sie sie jetzt vor sich sah: als eine gebrechliche Greisin. Gewiss nicht als begehrenswerte Frau, der die Männer den Hof machten.
Endlich war die Treppe bewältigt, und ein langer Gang erstreckte sich vor ihnen. Hier oben war es wärmer, fast behaglich, weil sich die warme Luft unter den niedrigen dunklen Decken sammelte. Die freiliegenden Dachbalken sahen aus, als wären sie mindestens hundert Jahre alt.
Die Äbtissin ging weiter bis zur zweiten Tür und verharrte mit der Hand auf dem Knauf. Endlich drehte sie ihn um und öffnete die Tür. Aus dem Zimmer fiel fahles Licht auf ihr Gesicht. »Das ist Schwester Ursulas Kammer«, sagte sie leise.
Der Raum war kaum groß genug, um ihnen allen Platz zu bieten. Frost und Rizzoli traten ein, während Maura in der Tür stehen blieb und den Blick über volle Bücherregale und Blumentöpfe mit blühenden Usambaraveilchen schweifen ließ. Das durch einen Mittelpfosten geteilte Fenster und die niedrige Balkendecke verliehen dem Raum eine mittelalterliche Atmosphäre. Eine ordentliche kleine Dachkammer, geeignet für Gebet und stilles Studium, ausgestattet nur mit einem Bett, einer Kommode und einem Schreibtisch mit Stuhl.
»Ihr Bett ist gemacht«, sagte Rizzoli mit einem Blick auf die säuberlich eingesteckten Laken.
»So haben wir es heute Morgen vorgefunden«, sagte Mary Clement.
»Ist sie gestern Abend nicht schlafen gegangen?«
»Es ist wohl wahrscheinlicher, dass sie sehr früh aufgestanden ist. Wie es ihre Gewohnheit ist.«
»Wie früh?«
»Sie ist oft schon Stunden vor den Laudes auf den Beinen.«
»Den Laudes?«, fragte Frost.
»Das ist unser Morgengebet um sieben Uhr. Diesen Sommer war sie immer schon in aller Frühe draußen im Garten. Die Gartenarbeit ist ihr Steckenpferd.«
»Und im Winter?«, fragte Rizzoli. »Was macht sie da so früh am Morgen?«
»Ob sommers oder winters, es gibt immer viel zu tun – für diejenigen unter uns, die noch arbeiten können. Aber so viele von unseren Mitschwestern sind inzwischen zu gebrechlich. Dieses Jahr mussten wir Mrs. Otis für die Arbeit in der Küche einstellen. Und selbst mit ihrer Hilfe können wir den Haushalt kaum noch bewältigen.«
Rizzoli öffnete die Tür des Wandschranks. Sie erblickten eine schmucklose Kollektion in Schwarz- und Brauntönen. Kein Farbtupfer, keine Verzierung. Es war die Garderobe einer Frau, für die ihre Arbeit für Gott wichtiger als alles andere war, die auch die Auswahl ihrer Kleider ganz dem Dienst des Herrn unterordnete.
»Sind das alle Kleider, die sie besitzt? Was man hier in dem Schrank sieht?«, fragte Rizzoli.
»Wir legen ein Armutsgelübde ab, wenn wir dem Orden beitreten.«
»Heißt das, dass Sie alles aufgeben müssen, was Sie besitzen?«
Mary Clement lächelte geduldig, wie eine Mutter, deren Kind gerade eine ziemlich absurde Frage gestellt hat. »Es ist gar keine so große Entbehrung, Detective. Wir behalten unsere Bücher und auch ein paar persönliche Erinnerungsstücke. Wie Sie sehen, hat Schwester Ursula Freude an ihren Usambaraveilchen. Aber es stimmt, wir lassen fast alles zurück, wenn wir hier eintreten. Dies ist ein kontemplativer Orden, und wir halten uns fern von den Zerstreuungen der Welt außerhalb des Klosters.«
»Entschuldigen Sie bitte, Ehrwürdige Mutter«, sagte Frost. »Ich bin nicht katholisch und weiß leider mit diesem Begriff nichts anzufangen. Was bitte ist ein kontemplativer Orden?«
Seine Frage war unaufdringlich und von Respekt geprägt, und so schenkte Mary Clement ihm ein wärmeres Lächeln als zuvor Rizzoli. »Ein kontemplativer Mensch führt ein beschauliches, nach innen gerichtetes Leben. Ein Leben in Gebet, stiller Andacht und Meditation. Das ist der Grund, weshalb wir uns hinter Mauern zurückziehen und Besucher in der Regel abweisen. Für uns ist die Abgeschiedenheit ein Segen.«
»Und was ist, wenn eine von ihnen die Regeln verletzt?« , fragte Rizzoli. »Schmeißen Sie sie dann raus?«
Maura sah, wie Frost bei der derb formulierten Frage seiner Partnerin zusammenzuckte.
»Unsere Regeln basieren auf Freiwilligkeit«, antwortete Mary Clement. »Wir halten sie ein, weil wir es so wollen.«
»Aber es muss doch immer mal wieder vorkommen, dass irgendeine Nonne eines Morgens aufwacht und sagt: ›Heute hätte ich mal Lust, an den Strand zu gehen.‹«
»Das kommt nicht vor.«
»Es muss aber doch vorkommen. Sie sind schließlich auch nur Menschen.«
»Es kommt nicht vor.«
»Niemand bricht die Regeln? Niemand klettert über die Mauer?«
»Wir haben es nicht nötig, die Abtei zu verlassen. Mrs. Otis kauft für uns Lebensmittel ein, und für unsere spirituellen Bedürfnisse ist Pater Brophy da.«
»Was ist mit Briefen? Oder Anrufen? Selbst in einem Hochsicherheitsgefängnis dürfen die Insassen ab und zu mal telefonieren.«
Frost schüttelte den Kopf, seine Miene wirkte gequält.
»Wir haben ein Telefon hier im Haus, für Notfälle«, antwortete Mary Clement.
»Und das dürfen alle benutzen?«
»Warum sollten sie das tun wollen?«
»Was ist mit Post? Dürfen Sie Briefe bekommen?«
»Manche von uns ziehen es vor, keine Post anzunehmen.«
»Und wenn man einen Brief schreiben will?«
»An wen?«
»Spielt das eine Rolle?«
Mary Clements Miene war zu einem verkrampften »Herr-schenke-mir-Geduld«-Lächeln erstarrt. »Ich kann mich nur wiederholen, Detective. Wir sind keine Gefangenen. Wir haben dieses Leben freiwillig gewählt. Wer mit den Regeln nicht einverstanden ist, dem steht es frei, zu gehen.«
»Und wie soll so jemand in der Welt da draußen zurechtkommen?«
»Sie scheinen zu glauben, dass wir keine Ahnung von jener Welt haben. Aber einige der Schwestern haben in Schulen oder in Krankenhäusern gedient.«
»Ich dachte, Sie dürften das Kloster nicht verlassen.«
»Manchmal ruft uns Gott zu Aufgaben, für die wir diese Mauern verlassen müssen. Vor einigen Jahren fühlte Schwester Ursula die Berufung, im Ausland zu dienen, und ihr wurde Exklaustration gewährt – das ist die Erlaubnis, außerhalb des Klosters zu leben, ohne jedoch das Gelübde aufzugeben.«
»Aber sie ist wiedergekommen.«
»Ja, letztes Jahr.«
»Es hat ihr also nicht gefallen da draußen in der Welt?«
»Ihre Mission in Indien war nicht einfach. Und sie war von Gewalt überschattet – Terroristen haben ihr Dorf überfallen. Danach ist sie zu uns zurückgekommen. Hier konnte sie sich wieder sicher fühlen.«
»Sie hatte keine Familie, zu der sie hätte gehen können?«
»Ihr nächster Verwandter war ein Bruder, der vor zwei Jahren gestorben ist. Wir sind jetzt ihre Familie, und Graystones ist ihr Zuhause. Wenn Sie der Welt überdrüssig sind und Trost brauchen, Detective«, fragte die Äbtissin mit sanfter Stimme, »gehen Sie dann nicht auch nach Hause?«
Die Frage schien Rizzoli aus der Fassung zu bringen. Ihr Blick ging zu dem Kruzifix an der Wand, zuckte aber ebenso schnell wieder weg.
»Ehrwürdige Mutter?«
Die Frau mit dem fettbespritzten Pullover stand vor der Tür und schaute mit teilnahmslosem, gleichgültigem Blick zu ihnen herein. Noch mehr Strähnen ihres braunen Haars hatten sich aus dem Pferdeschwanz gelöst und hingen ihr wirr um das hagere Gesicht. »Pater Brophy sagt, er ist auf dem Weg hierher, um sich um die Reporter zu kümmern. Aber es haben schon so viele angerufen, dass Schwester Isabel den Hörer ausgehängt hat. Sie weiß einfach nicht, was sie ihnen sagen soll.«
»Ich komme sofort, Mrs. Otis.« Die Äbtissin wandte sich an Rizzoli. »Wie Sie sehen, haben wir alle Hände voll zu tun. Bitte lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Ich bin unten, wenn Sie mich brauchen.«
»Bevor Sie gehen«, erwiderte Rizzoli, »sagen Sie uns bitte noch, welches Schwester Camilles Zimmer ist?«
»Es ist die vierte Tür.«
»Und es ist nicht abgeschlossen?«
»An diesen Türen gibt es keine Schlösser«, antwortete Mary Clement. »Die hat es noch nie gegeben.«
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »The Sinner« bei Ballantine Books, a division of Random House Inc., New York.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2003 by Tess Gerritsen Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Dieses Werk wurde vermittelt durch die LiterarischeAgentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-09337-2
www.limes-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe