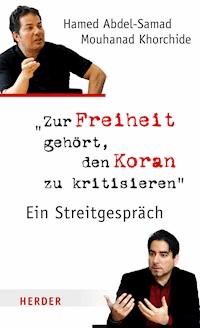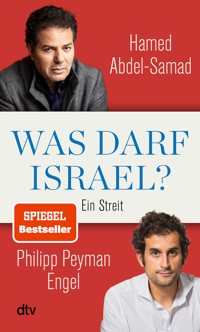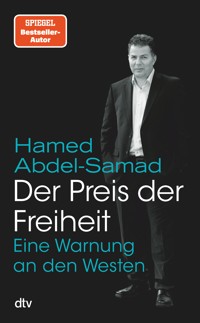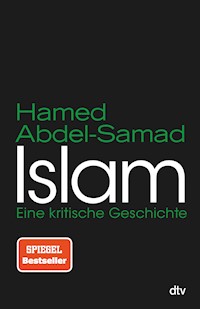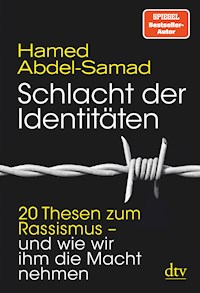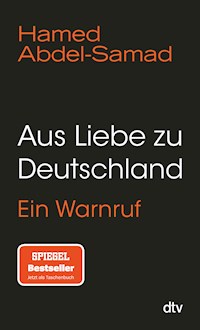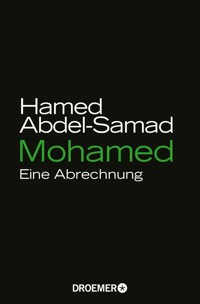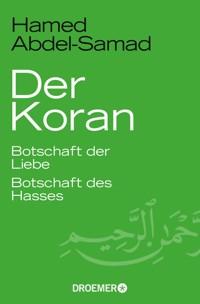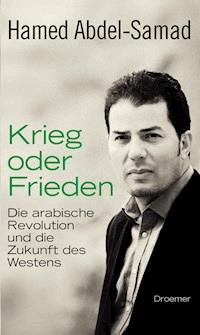7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Streng religiös erzogen, schließt sich Hamed Abdel-Samad als Student der radikalen Muslimbruderschaft an. Doch dort findet er keine Antworten auf seine Fragen. Da beschließt er, nach Deutschland zu gehen, in der Hoffnung, sich endlich kritisch mit dem Islam auseinandersetzen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hamed Abdel-Samad
Abschied vom Himmel
Mein Leben zwischen Gewalt und Freiheit
Knaur e-books
Über dieses Buch
Hamed Abdel-Samads Kindheit ist geprägt von tiefer Religiosität und brutaler Gewalt. Als junger Mann wendet er sich dem radikalen Islam zu, findet aber auch dort nicht den ersehnten Halt und entschließt sich, Ägypten zu verlassen. Erst in Deutschland kann er sich von seiner Vergangenheit lösen. Abdel-Samad zählt heute zu den namhaften deutschsprachigen Vermittlern zwischen arabischer Welt und Europa. Sein Engagement für den Arabischen Frühling und seine entschiedene Kritik am politischen Islam führten dazu, dass Fanatiker eine Mord-Fatwa gegen ihn erwirkt haben. Von seinem Leben unter ständiger Gefahr und auch von einer mehrtägigen Entführung durch Kriminelle erzählt er in der erweiterten Neuausgabe seiner Autobiografie.
Inhaltsübersicht
Für Connie, die Liebe, die mich stützt und schmerzt
Einführung
Vor zwölf Jahren saß ich in einer geschlossenen Anstalt am Rande der Stadt Erfurt und konnte mit niemandem reden. Mein Psychiater und mein Psychotherapeut wünschten sich, dass ich ihnen etwas über mein Leben erzähle und darüber, was mich gerade bedrückt, damit sie mich besser einschätzen und die richtigen Maßnahmen ergreifen konnten. Doch ich blieb stumm, obwohl es in mir vor lauter Geschichten, Bildern und unterdrückten Schreien brodelte. Also beschränkte sich meine Therapie auf die Gabe von Psychopharmaka, und mein Alltag bestand im Wesentlichen aus stundenlangem Starren an die Decke meines Zimmers.
Es war nicht das erste Mal, dass ich mich in so einer Situation befand, zehn Jahre war ich in einer ähnlichen Klinik in München gewesen, auch dort war ich mit Medikamenten vollgestopft worden, die mein Gehirn lähmten. Nun war ich zum zweiten Mal Gefangener meiner Geschichte und meiner Gedanken geworden. Doch diesmal spürte ich ein Funken von Widerstand in mir. Ich fragte mich, warum ich erneut in dieses dunkle Loch gefallen war, obwohl sich meine Lebensumstände wesentlich verbessert hatten. Denn anders als vor zehn Jahren war ich gut integriert in Deutschland, hatte einen guten Job an der Universität und gerade meine Traumfrau geheiratet. Warum hatte ich erneut die Kontrolle über mein Leben verloren? Was war schiefgelaufen?
Diese Frage beschäftigte mich Tag und Nacht. Was war schiefgelaufen? Mir war klar, dass das Ganze wenig mit Deutschland und meinen aktuellen Lebensumständen zu tun hatte. Sondern mit Ägypten und meinem früheren Leben dort. Dorthin zurück reichten die Wurzeln jenes Übels, das mich immer wieder lähmte. Es war wie eine Höhle, die zu betreten ich bisher nie gewagt hatte. Im tiefsten Inneren wusste ich, dass ich genau das tun musste, wenn ich geheilt werden wollte.
Ohne mir darüber im Klaren zu sein, welche Konsequenzen das haben könnte, welche Probleme sich daraus ergeben könnten, fing ich eines Tages an, mir selbst Geschichten aus meinem Leben zu erzählen. Ich besorgte mir Papier und einen Stift, und ein Diktiergerät. Wie besessen schrieb ich stundenlang, mal auf Arabisch, mal auf Deutsch, mal auf Englisch und gelegentlich auf Japanisch. Wenn meine Hand zu verkrampfen drohte, die Buchstaben immer unleserlicher wurden, wechselte ich auf das Diktiergerät. Wenn meine Stimme brüchig wurde, die Emotionen mich überwältigten, nahm ich wieder Stift und Papier zur Hand. So entstanden die ersten Skizzen, aus denen später dieses Buch wurde.
Da ich nie vorhatte, die Texte zu veröffentlichen, konnte ich alles erzählen, ohne Hemmungen und ohne Rücksicht auf Verluste. Als ich sie später zu einem Buch bündelte, stand ich vor der Entscheidung, alles so zu belassen, wie ich es niedergeschrieben oder aufgenommen hatte, oder einige Erzählungen zu streichen, um mich nicht bloßzustellen oder angreifbar zu machen. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschieden, nichts zu verändern. Mir war klar, dass die Texte aus einer persönlichen Notsituation heraus entstanden waren, geschrieben mit einem Tunnelblick. Nicht alle Dimensionen meiner Geschichte konnte ich erfassen, nicht alle Facetten abdecken, dennoch waren die darin enthaltenen Reflexionen authentisch und hatten es verdient, auch so gehört zu werden.
Das Buch war ein Erfolg sowohl in Ägypten als auch in Deutschland. Es wurde viel besprochen und diskutiert. Doch erstaunlicherweise wurde es in Ägypten positiver aufgenommen als in Deutschland. In meinem Heimatland würdigten die Rezensenten sowohl die literarische Qualität als auch den Mut, den ich gezeigt hatte, indem ich das Schweigen über hartnäckige Tabuthemen wie die Vergewaltigung von Kindern gebrochen hatte. Natürlich gab es auch wütende Reaktionen, vor allem in jenem Dorf in Ägypten, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Von Menschen, die sich in meiner Erzählung wiedererkannten. Aber Intellektuelle und Literaturkritiker begrüßten das Buch als eine neue Form von Literatur, erkannten darin eine ernstzunehmende Gesellschaftskritik.
In Deutschland gab es zwar ebenfalls einige lobende Artikel, eine Reihe von Rezensenten warf mir aber vor, mit dem Buch Vorurteile über den Islam und über Muslime zu schüren. Ein Vorwurf, der mir seitdem bei jeder Veröffentlichung begegnet. Was mich dagegen überwältigte, waren die vielen persönlichen Zuschriften, die ich sowohl aus Deutschland als auch aus der arabischen Welt bekam. Darin bedanken sich viele Menschen bei mir dafür, dass ich diese Geschichte mit ihnen teilte. Manche erkannten darin ihre eigene Geschichte wieder, für einige war die Lektüre dieses Buches Anlass, über sich selbst und die Gesellschaft, in der sie leben, zu reflektieren.
In meiner neuen Heimat wurde ich durch die Veröffentlichung beinahe schlagartig bekannt. Ich wurde Teil des Diskurses über Islam und Migration und bekam den medialen Titel »Islamkritiker« verliehen, obwohl ich in erster Linie ein Gesellschaftskritiker bin. Es folgten einige Bücher über Ägypten, die islamische Welt und die islamische Geschichte. Später unternahm ich im Auftrag der ARD eine Reise mit dem Journalisten Henryk M. Broder durch Deutschland und Europa, um die Seele und die Probleme des alten Kontinents zu erforschen. Für Arte reiste ich mit einer Kollegin durch Europa, um die Vielfalt muslimischen Lebens dort aufzuzeichnen. Ich wurde Mitglied der Islamkonferenz und hatte dort mit den Vertretern der konservativen Islamverbände viele Auseinandersetzungen über die Zukunft des Islam in Deutschland. 2011 wurde ich Zeuge der Revolution in Kairo und war Teil der Massen, die den Präsidenten Husni Mubarak zum Sturz brachten. Voller Hoffnung sehnte ich mich nach einer demokratischen Zukunft meines Landes, einer Zukunft, in der Freiheit und Menschenrechte endlich Fuß fassen würden. Doch es kam anders. Auf die Mubarak-Diktatur folgte die religiöse Diktatur, dann kam die Armee zurück und nahm den Bürgern wieder jene Freiheiten, die sie sich am Tahrir-Platz erkämpft hatten. Ich selbst geriet ins Visier, weil ich den politischen Islam mit dem Faschismus verglich. Im ägyptischen Fernsehen sprachen drei prominente Geistliche 2013 eine Fatwa gegen mich aus. Da ich Morddrohungen auch aus Deutschland bekam, stehe ich seitdem unter Polizeischutz.
Als Opfer sehe ich mich deswegen nicht. Im Gegenteil, zeigen die Überreaktionen konservativer Kreise doch, wie sehr man dort einen offenen Diskurs fürchtet. Im Jahr 2015 startete ich einen YouTube-Kanal mit dem Titel »Box of Islam«, in dem ich mich an die arabische Welt richte. Innerhalb kurzer Zeit erreichte der Kanal hunderttausend Abonnenten, meine Vorträge dort kamen auf über zwanzig Millionen Klicks, was extrem ungewöhnlich ist bei historischen oder religionskritischen Themen. Ich erhielt Einladungen nach Marokko, Tunesien, in den Irak, nach Kanada und die USA, um dort Vorträge zu halten. Einige dieser Einladungen nahm ich an. Muslime dort empfingen mich als Aufklärer und diskutierten mit mir leidenschaftlich über das, was sich in muslimischen Gesellschaften ändern muss. In Deutschland haftet mir dagegen leider immer noch das Etikett Islamkritiker an, für manche Kreise bin ich sogar ein Islamhasser. Auch wenn mich diese Reduzierung manchmal ärgert, erzählt sie doch mehr über meine Kritiker als über mich. Ich werde meine Gedanken trotz aller Anfeindungen, trotz aller Drohungen weiter mitteilen.
Deshalb hat das Schreiben heute für mich auch einen anderen Stellenwert als vor zehn Jahren. Ich schreibe heute nicht mehr, um einen Weg aus dem dunklen Tunnel der Krankheit zu finden. Es ist zu einer anderen Form der Befreiung geworden. Heute verstehe ich meine Geschichte und auch das Leid, das mir zugefügt wurde, in einem größeren Kontext. Aber weil mir diese Sichtweise erst mit dem nötigen Abstand möglich geworden ist, habe ich die ursprüngliche Fassung des Buches weder verändert noch kommentiert. Mit den neu hinzugekommenen Kapiteln will ich nicht nur ergänzen, was in den letzten zehn Jahren geschah, sondern auch Denkprozesse erläutern und einen kritischen Blick zurückwerfen.
Erster Teil
Grüß Gott, Deutschland
Am Tag, als ich das Visum für Deutschland erhielt, lief ich ziellos durch die Straßen von Kairo, sah Häuser an, beobachtete Menschen, roch die Menge, die frittierten Falafeln und die Abgase.
Kairo lächelt müde. Wie ausgestreckte Finger richten sich die Minarette klagend gegen den Himmel und brüllen unaufhörlich den Namen Gottes. Gott selbst aber schweigt und überlässt Kairo seinem Schicksal. Stillstand, Konfusion, Lärm und Smog. Man nennt unsere Hauptstadt »die Siegreiche«, ich finde »die Besiegte« passender. Nur in einem blieb Kairo siegreich: Es besiegte seine Einwohner und begrub sie unter sich.
Es wurde Nacht, und ich lief noch immer wie benommen durch das Zentrum der Stadt, den Reisepass in der Hand, und nahm die westlichen Verheißungen auf: Die Verkehrslawine, die kalten Leuchtreklamen, die engen Touristenbasare und der bestialische Gestank der Industrieabgase machten mir Angst vor der Fremde. Plötzlich stand ich an einer Straße, die zu betreten ich mich 19 Jahre lang geweigert hatte. Aber dieses Mal wagte ich den Gang zum Haus meines Großvaters. Jenem Ort, wo ich die schönsten und schrecklichsten Momente meiner Kindheit erlebt hatte. Ich weiß nicht, warum ich mir das antat.
Vielleicht erinnerte mich der alte Mann, der die ganze Nacht vor der deutschen Botschaft wartete, an meinen Großvater. Vielleicht wollte ich eine Wunde als Andenken mitnehmen, bevor ich Ägypten für immer verließ. Oder ich suchte den Schmerz als Rechtfertigung für meine Flucht aus dem Land. Alles schien unverändert. Das Restaurant, die Cafés und die Bäckerei. Das Hochhaus, wo mein Großvater früher wohnte, stand nicht mehr. An seiner Stelle klaffte eine Baugrube. Die Fundamente versprachen ein großes, modernes Gebäude, aber sie versprachen auch ein Haus ohne Seele. Die Eisenstangen, die aus dem Fundament wuchsen, erinnerten an die Stacheln eines vertrockneten Kaktusbaums.
Die Dachgeschosswohnung meines Großvaters und die Werkstatt des Automechanikers im Erdgeschoss waren verschwunden. Zwischen ihnen lag die längste Treppe der Welt. Von dort oben beobachtete ich als Kind jeden Tag mit Begeisterung die Welt unter mir. Und dort unten zerbrach mein Leben.
Ich habe nicht geweint und spürte keinen Schmerz. Die schönen und schrecklichen Erinnerungen wechselten sich ab. Schließlich winkte ich der Baulücke, wo einmal mein Zuhause gewesen war, ging weg und glaubte, es sei ein Abschied für immer. Ich ahnte noch nicht, dass nicht nur die letzten 19 Jahre, sondern auch die folgenden eine Flucht vor diesem Ort waren.
Botschaft der Erlösung
Bevor ich nach Deutschland kam, war für mich »Deutschland« mit Namen, Bildern und Ereignissen verbunden: Rilke und Goethe, Hitler und Göring. Die Ruinen und der Wiederaufbau. Das geteilte Deutschland und das der friedlichen Wiedervereinigung. Disziplin und Zielstrebigkeit, »Made in Germany« und natürlich die deutsche Fußballnationalmannschaft, die fast jedes Spiel gewann, obwohl sie nicht besonders attraktiv spielte. Deutschland war für mich das Land von Martin Luther und das Land der Freizügigkeit; das Land von Marx und Mercedes, der Dichter, Philosophen und Helden, das aber keine Helden mehr haben darf. Das Land der Kreuzritter, die mit mir verwandt sein sollen. Im ägyptischen Fernsehen hatte ich Bilder vom Fall der Berliner Mauer, marschierende Neonazis und brennende Asylantenheime gesehen. Außerdem hatte ich vage Vorstellungen von freizügigen, gutgebauten Blondinen, die halbnackt auf der Straße laufen. Ein ägyptischer Film aus den achtziger Jahren vermittelte mir das Bild eines reichen Deutschland, in das ein ungebildeter junger Ägypter auswandert, binnen kurzer Zeit Millionär wird und eine bildhübsche Deutsche heiratet.
Ich wusste einiges über die deutsche Literatur, aber wenig über die politische und soziale Realität. Mein Deutschlandbild war, wie das der Mehrheit der Ägypter, vorwiegend positiv, auch weil Deutschland keine koloniale Vergangenheit in der arabischen Welt hatte. Das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte wird von Arabern ausgeblendet oder bagatellisiert. Da Ägypten jahrelang mit Israel in Konflikt stand, lernten wir in der Schule weder etwas über das jüdische Volk noch über den Holocaust. Manche Ägypter leugnen den Holocaust, andere versuchen ihn zu rationalisieren, wieder andere heißen ihn gut.
Meine erste direkte Erfahrung mit Deutschland machte ich vor meiner Abreise. Es war eine Begegnung voller Verbitterung und Schamgefühle. Im Frühjahr 1995 ging ich zur deutschen Botschaft im vornehmen Kairoer Stadtteil Zamalek, um ein Visum zu beantragen. Ich nahm ein Taxi, um meine eigens dafür gekaufte Kleidung nicht in den überfüllten Bussen zerknittern zu lassen. Mich überraschten die Massen von jungen Ägyptern, die in der Aprilhitze vor der Botschaft standen, als umrundeten sie die Kaaba. Doch von den Tausenden, die ins gelobte Land der »Ungläubigen« wollten, durften pro Tag nur 50 Pilger in den deutschen Palast, und diese hatten ihre Plätze bereits in der vorigen Nacht ergattert. Die arroganten Sicherheitsangestellten der Botschaft versuchten vergeblich, die Massen zu verscheuchen. Wohin sollten sie gehen? Seit Jahren bestand ihr Leben aus einem nie endenden Warten: Warten auf eine Chance, Warten vor einer eisernen Tür, mit der blassen Hoffnung, dass sie sich irgendwann öffnet.
Was für eine Schizophrenie. Wie oft haben wir den Westen verflucht und ihn für unser Elend verantwortlich gemacht. Und am Ende bleibt uns nichts übrig, als an den Türen seiner Botschaften zu warten, um Einlass zu finden? Ich ging weg und kam am frühen Abend zurück. Zwanzig Wartende standen bereits da. Einer wollte seinen Bruder besuchen und dann untertauchen. Vier wollten, wie ich, studieren, einer wollte eine alte deutsche Touristin heiraten, die er als Kellner in einem Hotel kennengelernt hatte. Der Rest wusste nicht recht, was er in Deutschland suchte. Sie wollten weg. Einige warteten, weil die Schlange vor der deutschen Botschaft kürzer war als die vor der amerikanischen. Fast alle waren junge gebildete Männer, die Ägypten gut gebrauchen könnte, die aber keine Perspektive mehr hatten. Sie waren zwar gut ausgebildet, verfügten aber nicht über die nötigen Beziehungen, die ihnen einen guten Job verschaffen würden. Auch ein siebzig Jahre alter Mann stellte sich an. Vielleicht wollte er einen Familienangehörigen besuchen, dachte ich. Er lehnte sich gegen die Mauer und schwieg. Im Gegensatz zu uns beiden waren alle auf die Nacht vorbereitet. Ein junger Mann bot dem Alten ein Kissen an, aber der lehnte ab. Mir fiel auf, dass er keine Bewerbungsmappe bei sich hatte. Irgendwann wurde ein mobiler Kiosk aufgebaut, wo die wachsende Menge vor der Botschaft Tee und Snacks kaufen konnte. Die Chancenlosigkeit vieler gab zumindest einem Teeverkäufer die Gelegenheit, sein Brot zu verdienen. Ich bewundere die Flexibilität der Ägypter, wenn es um die Schaffung von Arbeitsplätzen geht. Wer keinen Job findet, nimmt eine Handvoll Taschentücher, verkauft sie in den Bussen oder an Ampeln und nennt sich Geschäftsmann.
Schon vor Mitternacht waren die begehrten ersten fünfzig Plätze besetzt, trotzdem blieben auch diejenigen, die später kamen, in der Hoffnung, dass einer aufgeben oder dass die Botschaft vielleicht mehr Bewerber einlassen würde. Man redete und lachte und phantasierte, wie das Leben in Deutschland wohl ausschauen könnte, auch wenn der Mehrheit bewusst war, dass ihre Chance auf ein Visum so groß war wie auf einen Sechser im Lotto.
Das Gelächter der jungen Männer weckte den Alten. Verbittert musterte er uns. Später lehnte er sich erneut gegen die Mauer der Botschaft und schlief wieder ein. Irgendwann waren wir alle eingenickt. Von der Morgensonne wurde ich geweckt. Der erste Mann in der Schlange klammerte sich auch noch im Schlaf an die Tür der Botschaft. Der illegale Teeverkäufer packte ein und verschwand. Der Alte saß nach wie vor gegen die Wand gelehnt und starrte ins Nichts. Bald richtete sich jeder auf, und wir standen in der Schlange, um unsere Plätze gegen die Neuankommenden zu verteidigen. Kurz bevor die Botschaft öffnete, drängte sich ein junger Geschäftsmann durch und stand vor dem alten Mann. Gerade als ich ihm zu Hilfe eilen wollte, sah ich, wie er dem Alten fünf Pfund gab: »Jetzt können Sie nach Hause gehen!« Ein wohlhabender Geschäftsmann, der es sich leisten konnte, andere für sich stundenlang warten zu lassen, hatte sich einen Platz in der Schlange reservieren lassen. Ich schämte mich dafür. Hat der Geschäftsmann den Alten ausgenutzt oder ihm einen Verdienst ermöglicht? Als ich an der Reihe war und eingelassen wurde, stand ich vor einem ägyptischen Botschaftsangestellten, der Deutsch sprach.
Ich musste einräumen, noch kein Deutsch zu sprechen, enttäuscht, dass meine Zukunft immer noch in den Händen eines Ägypters lag. Nachdem ich seine unendlichen Fragen über mein Leben in Deutschland, die Finanzierung meines Aufenthalts und die Krankenversicherung beantwortet hatte, nahm er meine Papiere an und sagte, dass ich erst mein Visum bekommen könne, wenn die Ausländerbehörde in Deutschland zustimmen würde. Ich verließ die Botschaft, rezitierte aus dem Koran: »Oh, Allah, führe uns aus diesem Lande heraus, dessen Menschen ungerecht sind.«
Auf in das Land ohne Helden
Ich hörte nicht die Laute des an den grünen Ufern des Nils erwachenden Tages. Über der großen Wüste standen letzte Sandwolken. Seit einer Woche hatte ein ungewöhnlich starker Wind geblasen. Nächtliche Stürme hatten Sand auf unserem Dorf abgeladen, alles schien verschüttet, entrückt, vergangen.
Eine zornige Angst trug mich ins Ungewisse. Nichts konnte ich mitnehmen außer meinen diffusen Erwartungen. Der Wagen fuhr an. Ich entfernte mich langsam von meinem Fleckchen Elend. Vorbei am Bananenfeld, wo ich als Heranwachsender oft die Grenzen des Erlaubten überschritten hatte. Mein Blick lag schwermütig auf den Wellen des Nils. Die Geschichte dieses ewigen Stroms war auch meine Geschichte: Ein König, der nicht herrscht, ein kastrierter Löwe – gefangen hinter einem Staudamm, ein Fluss ohne Flut und ohne Schlamm. Bald begrüßte mich der Smog über Kairo. Das Verkehrschaos war nicht so übel wie sonst, als wollte mich mein Land rasch loswerden.
»Pass auf und bring keine Schande über unsere Familie. Die Frauen in Europa sollen sehr gefährlich sein«, warnte mich mein Cousin Mahmoud, der mich zum Flughafen begleitete. »Aber weißt du was? Bring deinem Cousin eine hübsche Blonde mit!«, sagte er lächelnd zum Abschied.
Viel zu kalte Luft strömte aus der Klimaanlage. Eine Flugbegleiterin, die mit Make-up vergeblich versucht hatte, ihr Alter zu vertuschen, bat mich freundlich, mich anzuschnallen. Das Flugzeug rollte Richtung Startbahn, die Turbinen brüllten auf, wir hoben ab und stiegen in den blauen Mittag über Kairo. Auf in das Land ohne Helden. Auf in das Land von Hölderlin, Schopenhauer und Nietzsche. Ein Gefühl der Befreiung und Angst zugleich durchströmte mich. Der Befreiung von der Last und dem Zwang der Kollektivgesellschaft, aber auch der Angst davor, alles zu verlieren; Angst, Wanderer zwischen den Welten zu werden, fähig zwar, ein Ufer zu verlassen, aber unfähig, ein neues zu erreichen.
Mein Vater stand meiner Reise nach Deutschland sehr skeptisch gegenüber, er glaubte, ich sei zu sensibel für die soziale Kälte in Europa. Das religiöse Oberhaupt der Zwanzigtausend-Seelen-Gemeinde konnte nicht hinnehmen, dass sein Sohn ein Dasein unter »Ungläubigen« dem Leben als Imam, als sein Nachfolger, vorzog. Er hatte mir prophezeit, dass ich mit leeren Händen und gebrochenem Mut wieder nach Ägypten zurückkehren würde.
Er war sehr verärgert gewesen, dass ich ihm meine Entscheidung erst einen Tag vor der Abreise mitgeteilt hatte. Daraufhin hatte er meinen Reisepass, das Flugticket und die anderen Unterlagen versteckt. So verwirrt und verunsichert hatte ich ihn noch nie erlebt. Ich sah in seinen Augen das Scheitern seines Traums. Nach langen Verhandlungen gelang es meiner Mutter, ihn zur Herausgabe der Papiere zu bewegen, und meiner Abreise stand nichts mehr im Wege.
Der Abschied verlief ohne Umarmung, unter Spannung und Tränen. Mein Vater vermochte nicht, mir Lebewohl zu wünschen. »Nur Allah allein hat die Macht!«, waren seine Abschiedsworte. Sie erinnerten mich an den Ausspruch des Prometheus: »Niemand ist frei außer Zeus!«
Wie gebannt starrte ich aus dem Fenster auf mein Land. Immer schneller floss das Häusermeer unter uns dahin. Von hier oben aus konnte ich die Weite des Nildeltas erahnen. Größer aber ist der Nil selbst, der das Delta mit seinen beiden Armen machtvoll gefangen hält. Und noch gewaltiger ist die Wüste, die wiederum den Fluss und sein Delta umschlingt und die Grenzen des Lebens markiert. Rasend schnell verschwand das Land, und die Maschine schwebte über dem Meer.
Waren die Deutschen nicht alle blond, blauäugig und gestählt? Mein Sitznachbar im Flugzeug war dagegen eine kleine, dickliche Gestalt, mit dünnem Haar auf dem ungepflegten Kopf. Er entsprach überhaupt nicht meiner Vorstellung eines Deutschen.
»Was haben Sie in Deutschland vor?«, fragte er mich in schlechtem Englisch.
»Ich werde dort an der Universität studieren«, antwortete ich knapp.
»Und was?«
»Politikwissenschaft.«
»Politik? Interessant! Und warum gerade in Deutschland?«
»Wegen der deutschen Fußballnationalmannschaft, die immer die Weltmeisterschaft gewinnt, obwohl sie schlecht spielt!«
»Nein, das war früher mal. Heute gewinnt sie keinen Blumentopf mehr.«
Da half es nur noch, mich schlafend zu stellen.
Grüß Gott, Deutschland
Kurz bevor die Maschine in Frankfurt landete, sah ich aus dem Fenster: Grün in einer unvorstellbaren Vielfalt. Gegen dieses Grün war mein Nildelta ein blasser Fleck. Urplötzlich begann ich diese Farbe zu fürchten. Sie vermittelte mir ein Gefühl der Arroganz, des Sattseins, der Unbesiegbarkeit.
Gebannt verließ ich die kalte Maschine, passierte den Saugrüssel der Immigration und stand in der Flughafenhalle. Wieder überwältigten mich die Farben und vor allem die Gerüche. Ich roch Blütenpollen, europäischen Kaffee, Alkohol und Schweiß, stark aufgetragene, seelenlose Parfüms. Bald übertönte allerdings der Geruch von Desinfektionsmitteln alles andere.
Ich stand vor dem Passbeamten und bildete mir ein, dass er zögerte, den Eintrittsstempel in meinen Pass zu drücken. Ich las in seinen Augen: »Aha, noch ein Kamelflüsterer aus der Wüste, der von unserem Wohlstand profitieren will?«
Antonia wartete auf mich im Flughafen. Sie hatte etwas zugenommen und war ein wenig gealtert. Sie umarmte mich herzlich und war sehr glücklich: »Du hast es tatsächlich getan. Ich bin so stolz auf dich!«, sagte sie grinsend. Ich bin doch nur davongelaufen, mehr nicht. Aber da sie es unbedingt so sehen wollte, ließ ich ihr die Illusion meines Heldentums.
»Ich arbeite wieder als Lehrerin und habe ein neues Auto«, sagte sie. Das wusste ich bereits. Vom Geruch des neuen Autos wurde mir schon beim Einsteigen schlecht. Die Art, wie Antonia aussah und redete, war anders als damals. Als ich sie vor drei Jahren zum ersten Mal am Kairoer Flughafen sah, wirkte sie natürlicher und trauriger. Heute empfand ich ihre Blicke und viele ihrer Worte als leer.
Fünfzehn Grad kälter als in Kairo. Eine lange Fahrt auf der Autobahn. Augsburg. Ein modernes Haus am Waldrand. Eine geräumige helle Wohnung mit teuren Designermöbeln, alles weiß, alles sauber. Die übertriebene Ordnung provozierte mich. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte, vielleicht eine kleine Einzimmerwohnung, die zu einer rebellischen Linken mit Hang zur Mystik passt. Wie kann ich, ein Chaot, diese Ordnung ertragen, geschweige denn bewahren? Ich saß neben ihr auf dem Sofa und entdeckte ein Bild auf dem Schreibtisch gegenüber. Ein Bild von uns beiden, entstanden am Tag, als wir uns zum ersten Mal in Kairo trafen.
»Ich hoffe, es ist nicht so kalt für dich hier.«
Ich verneinte, obwohl ich auf dem Ledersofa fror.
Niemand ist frei außer Zeus
Drei Jahre davor traf ich Antonia zum ersten Mal. Es war der letzte Tag des Jahres 1992, und ich hatte Nachtschicht. Ein Polizeioffizier kam in mein Büro im Kairoer Flughafen und fragte, ob ich Französisch könne. Es gäbe in der Ankunftshalle eine Touristin, die sich weigere, den Flughafen zu verlassen, und offenbar kein Englisch spreche. Ich ging mit dem Polizeibeamten in die Halle und sah die Frau mit untergeschlagenen Beinen auf einem Stuhl sitzend. »Parlez-vous français?«, fragte ich. »Yes, I speak French, English, German and Spanish«, antwortete sie. Der Offizier war verblüfft. Ich bat ihn zu gehen und versprach, zu berichten, was das Problem der Frau sei. Sie war schön und elegant, etwa Ende dreißig. Sie trug ein rotes Stirnband, das ihre grünen Augen betonte. Sie trug ihre roten Haare kurzgeschnitten und neben ihr lag ein roter Reisekoffer. Die Spannung in ihrem Gesicht war nicht zu übersehen.
»Kann ich irgendetwas für Sie tun?«
»Ägyptern kann man nicht vertrauen!«
»Ich weiß.«
Sie schaute mir in die Augen und lächelte traurig. Ihr Lächeln war von jener Melancholie, der Hoffnung innewohnte. Hoffende Melancholie hatte mich in den wenigen Werken der deutschen Literatur, die ich bis dahin gelesen hatte, am meisten fasziniert. Die Frau wirkte verbittert und mystisch. Sie hatte einem Reiseagenten das Geld für ihren Aufenthalt in Kairo, Luxor und Assuan überwiesen und hätte von ihm am Flughafen empfangen werden sollen. Doch der Agent war nicht gekommen, und es gab für sie auch keine Reservierung im Safir Hotel, wo sie logieren sollte. Mir fiel zwar eine durchaus plausible Entschuldigung für den Reiseagenten ein, denn in der Silvesternacht ging es immer drunter und drüber. Aber ich hatte keine Lust, meine Landsleute in Schutz zu nehmen, und schwieg. Ich konnte sie davon überzeugen, die Halle zu verlassen und draußen in der Cafeteria zu warten. Sie stimmte unter der Bedingung zu, dass ich mit ihr ginge. Als wir in der Cafeteria saßen, öffnete sie den Koffer und gab mir eine Krawatte, ein selbst gemaltes Bild, ein mystisches Gedicht und einen goldenen Damenring zum Geschenk. Ich nahm alles an, nur den Ring wies ich zurück. »Dafür habe ich keine Verwendung.«
»Haben Sie denn keine Freundin?«
»Sollte ich ihr jemals einen Ring schenken wollen, dann will ich ihn selbst kaufen.«
»Ich dachte, Ägypter nehmen alles, was ihnen in die Finger kommt, aber anscheinend sind Sie eine Ausnahme.«
Ich wollte ihr nicht verraten, dass ich genauso wie meine Landsleute bin und auch an allen Krankheiten, die in dieser Gesellschaft verbreitet sind, leide. Sie ahnte nicht, dass ich gerade darauf hoffte, ihr ein teures Hotel in Kairo vermitteln zu können, um die Provision einzustreichen. Aber ich war auch irgendwie weitergehend an dieser mysteriösen Frau interessiert. Sie schien keine der üblichen Pauschaltouristinnen zu sein, die auf der Suche nach Abenteuer, Spaß oder Erholung waren, sondern sie wirkte, als sei sie auf der Flucht.
Sie weinte, als ich sie fragte, warum sie an so einem Tag allein sei. »Meine kleine Tochter wollte nicht mit mir kommen. Sie sagte, sie habe keine Zeit für mich. Ihr Vater hat ihr erzählt, dass ich keine gute Mutter sei. Und wahrscheinlich hat er sogar recht. Ich bin keine gute Mutter, niemand ist perfekt.« Diesen Satz wiederholte sie immer wieder.
Ich wollte nicht tiefer in sie dringen und fragte nach der Zeichnung, die sie mir gegeben hatte: ein Zeichen, das Gott symbolisierte, mehrere Zeichen für die Religionen der Welt und die Menschen. Alle Symbole waren umschlossen von einem Kreis mit einem Loch in der Mitte. Die kleinen Symbole fielen durch das Loch aus dem Kreis heraus. Nur Gott, dessen Symbol größer war als das Loch, blieb im Kreis zurück.
»Gott hat die Welt so erschaffen, dass alle und alles außer ihm vergeht, selbst der Glaube an ihn ist vergänglich, er selbst aber nicht«, erklärte sie.
»Warum?«
»Weil niemand frei ist außer Zeus!«
Ich wusste nur wenig von griechischer Mythologie. Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl, musste dafür dreißig Jahre leiden. Am Ende erkannte er doch seine Grenzen und fand seine Freiheit in der Demut vor den Göttern. »Niemand ist frei außer Zeus!« Es muss der gleiche Geist sein, der seinerzeit auch Faust inspiriert hatte. »Kann es sein, dass alles aus dem Loch in die Freiheit hinausfällt, und nur Gott alleine in seinem Kreis gefangen bleibt?«, fragte ich. Ihr Lächeln blieb die Antwort.
Sie fing an, ihre Geschichte zu erzählen, und beschloss sie mit Worten aus dem Gedicht, das sie mir gegeben hatte: »Ich bin durch Himmel und Hölle gegangen, ich habe gerichtet und bin gerichtet worden, und am Ende sah ich, dass ich in allem bin und dass alles in mir ist.«
Sie hieß Antonia, und wir unterhielten uns, bis der Tag anbrach. Sie bat einen Kellner in der Cafeteria des Flughafens, ein Foto von uns zu machen.
Ich war von dieser Frau fasziniert. Ich wunderte mich, dass eine Frau, die ich nicht kannte und die in einem völlig anderen Kulturraum lebte, ähnlich über Gott und die Welt dachte wie ich. Irgendwann kehrte sie nach Deutschland zurück, aber wir blieben in Kontakt. Zwei Außenseiter, die mit sich selbst und mit ihrer Welt überfordert waren, freundeten sich an und leckten sich über eine Entfernung von dreitausend Kilometern gegenseitig ihre Wunden.
Wo bin ich bloß gelandet?!
Drei Jahre nach dieser nächtlichen Begegnung im Kairoer Flughafen reiste ich nach Deutschland. Ich war 23, etwas furchtsam und doch voller Neugier auf das Leben und die Menschen. Antonia stand wieder fest im Leben, fuhr einen Toyota Corolla und wählte CSU, sie war aber immer noch einsam und unsicher, und obwohl ich aus dem Orient kam, unterschied ich mich darin kaum von ihr. Ich kam nicht, um nach Arbeit oder Wohlstand zu betteln, und fühlte mich dennoch wie ein Almosenempfänger. Ich bettelte um Wärme und Verständnis.
Als Antonia mich im Bett in ihre Arme nahm, roch ich nur ihr kaltes, abweisendes Parfüm. Sie war nicht die materialistische Nymphomanin, für die viele aus meinem Kulturkreis Europäerinnen hielten. Im Gegensatz zu meiner Mutter war sie eine spirituelle Frau, die in mir nach einem Hafen suchte. Ich wusste, dass ich dieser Hafen nicht sein konnte, genauso wenig wie ich mit ihr den Kulturkampf Ost gegen West auszutragen vermochte. Ich habe es zwar versucht, aber es funktionierte nicht. Um als Repräsentant des Orients aufzutreten, war ich zu gleichgültig und zu wenig männlich. Oft genug war ich in meinem Land von dieser Männlichkeit verletzt worden, so dass ich sie nicht als Kampfmittel einsetzen konnte.
Fast alles erschien mir fremd in diesem Deutschland: die Sprache, die Menschen, die Autos, das Essen, die Wohnungen, eben alles. Deutschland war für mich wie ein kompliziertes Gerät, für das es keine Gebrauchsanweisung gibt. Mir fehlten die vertrauten Stimmen, Farben, Temperaturen, Gerüche und Gegenstände, die ein Mensch braucht, um seine inneren Strukturen zu stabilisieren. Mir fehlten sogar meine Stereotype über Deutschland. Ich war beinahe enttäuscht, keine marschierenden Neonazis und vor allem keine halbnackten, blonden Frauen auf den Straßen anzutreffen.
Ich spielte den frommen Muslim und gab vor, nur mit meiner Ehefrau im gleichen Bett schlafen zu können. An einem regnerischen Freitag standen wir vor dem Standesbeamten, der uns skeptisch anschaute. Ich trug einen dunklen Anzug, den Antonia für mich gekauft hatte, auch ihren weißen Blumenstrauß hatte sie gekauft. Ihre beiden Kinder aus erster Ehe, Emmy und Felix, und ein halbes Dutzend ihrer Freunde sahen uns ebenfalls nachdenklich an, als wir uns das Jawort gaben. Im Grunde war es auch kein »Ja«, sondern ein »Es ist mir egal«. Alles war uns beiden lieber als unsere früheren Leben. Es war ein »Nein« zur Vergangenheit.
»Es regnet, das heißt, dass es eine glückliche Ehe sein wird«, sagte der Standesbeamte anschließend, um die angespannte Stimmung zu lockern. Antonia und ich lächelten verlegen. Antonia fuhr selbst, da ich kein Auto lenken konnte, und wir gingen gemeinsam mit ihren Freunden nach Hause. Spontan entschloss ich mich, ein aufwendiges ägyptisches Gericht zu kochen. Ich entzog mich damit der inszenierten Heiterkeit im Wohnzimmer und konnte mich stundenlang in der Küche verkriechen. Antonias Tochter, Emmy, kam mir nach und schaute mich freundlich an: »Geht es dir gut? Brauchst du Hilfe?« Ich lächelte und schüttelte den Kopf.
Es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion und keiner von uns beiden wusste genau, wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen sollte. Es war nicht mehr als ein rebellischer Akt gegen unsere Vergangenheit gewesen. Ich suchte die Zuneigung, die ich nie bekommen hatte, und Antonia eine Entschuldigung für das Scheitern ihrer ersten Ehe. Natürlich hatte Antonia auch die Lohnsteuerklasse drei und ich den deutschen Pass vor Augen.
Eigentlich hätten wir uns in dieser Nacht lieben sollen, aber die Kinder Antonias schliefen im Nebenzimmer. Ich wollte ihren Eindruck nicht noch erhärten, dass ich bloß ein bezahlter Liebhaber ihrer Mutter sein könnte. »Kaum zu glauben, wir haben geheiratet«, war das Intimste, was Antonia in dieser Nacht gesagt hatte. Ich lächelte wortlos. Auch in der folgenden Nacht kam es nicht zum Liebesakt.
Irgendwann war uns klar, dass wir in dieser Beziehung nur ein Mittel zur Flucht und später eines aus dieser Beziehung heraus suchten. Nicht nur der Altersunterschied von 18 Jahren, sondern auch die Unterschiede in der Art des Denkens und unsere Lebensrhythmen ließen unsere Partnerschaft ins Leere laufen. Konflikte waren vorprogrammiert.
Kurz nach unserer Heirat standen zwei wichtige Termine auf dem Plan: Beim Notar galt es, eine Gütertrennung zu vereinbaren und zu unterschreiben, dass im Falle einer Scheidung beide auf Unterhalt verzichten. Das betraf natürlich vor allem mich, da ich nichts besaß und die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering war, dass ich je höhere Einkünfte erzielen würde. Wir betraten das Büro eines gutaussehenden jungen, blonden Notars, der uns höflich begrüßte.
»Kann er wenigstens Englisch?«, fragte der Notar Antonia, nachdem sie ihm gesagt hatte, dass ich noch kein Deutsch kann. Er sah arrogant aus, schien mir aber nur unsicher zu sein.
»Ja«, sagte Antonia und schaute mich an. Ich bemühte mich, locker zu wirken, und spielte das Spiel mit. Eigentlich war das logisch. Ein junger Ausländer heiratet eine ältere Frau, die sich absichern will. Wie sonst hätte er mit mir umgehen sollen? Einige Tage später sollten wir wiederkommen, um die Vereinbarung zu unterschreiben.
Das war ein Vorgeschmack auf den nächsten Termin: Ausländerbehörde. Ein kleiner Beamter, ungepflegt, penetrante Stimme, der mich an meinen Sitznachbarn im Flugzeug erinnerte. »Herr …, ach, der Herr mit dem schwierigen Namen, Abdul-Irgendwas«, rief er. So viel Deutsch verstand ich schon. Ich betrat das Zimmer mit Antonia. »Bitte sprechen mein Name … ich heiße Hamed Abdel-Samad, bitte sprechen mein Name!«, bat ich ihn. Er schaute mich erstaunt an.
»Ich muss auch deutsche Name sprechen. Ich muss sprechen Ausländerbehörde, Aufenthaltsgenehmigung, warum Sie mein Name nicht sprechen?«, schrie ich ihn an. Antonia genierte sich und versuchte, mich zu beruhigen. Der Beamte blieb ruhig und behauptete, es gäbe zu viele Ausländer mit komplizierten Namen. Er könne sich nicht alle merken.
Nachdem Antonia sich für mein schlechtes Benehmen entschuldigt und zehn Mark für seine Kaffeekasse hinterlassen hatte, verließen wir das Amt. Ich verstand nicht, was vor sich ging, und hielt es für Schmiergeld. »Das ist doch kein Schmiergeld. Wir sind nicht in Ägypten!« Ich ärgerte mich, weil sie so tat, als ob nur in Ägypten Korruption herrschte und Deutschland das Paradies der Unschuld sei. Es folgte eine schulmeisterliche Belehrung darüber, wie man sich in Deutschland zu verhalten habe, da man sonst als vulgär gelte. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte der Beamte womöglich die Polizei gerufen.
»Polizei? Wegen einer lauten Stimme?«, fragte ich verwundert. »Bei uns kommt die Polizei nur, wenn Blut geflossen ist, und selbst dann ist es nicht sicher, dass sie kommt!«, versuchte ich sie wieder aufzumuntern, aber es funktionierte nicht.
»Deine Gefühlsschwankungen sind beängstigend. Wie kann jemand, der gerade so rumgeschrien hat wie du, Witze machen?«
»In Ordnung. Wenn du keine Witze hören willst, hier etwas Ernstes: Ich werde die Gütertrennung und die Unterhaltsvereinbarung nicht unterschreiben. Ich bin deinetwegen nach Deutschland gekommen und hatte von dir keine Absicherung verlangt. Ich habe alles in Ägypten hinter mir gelassen, meine Familie und meinen Beruf, um mit dir zusammen zu sein. Wenn du nicht gekommen wärst, um mich am Flughafen abzuholen, wäre ich verloren gewesen in diesem Land. Wenn du immer noch unsicher bist, kannst du gerne die Scheidung einreichen!«, sagte ich bestimmt.
Sie war beeindruckt und schwieg. Wie konnte sie ahnen, dass das, was ich sagte, nicht im Geringsten der Wahrheit entsprach? Nichts über mein Leben in Ägypten wusste sie wirklich.
Sie lenkte ein und sprach mich nicht mehr auf die Vereinbarung an. Diese Ehe war immerhin ein Projekt für sie. Auch wenn dieses Projekt zum Scheitern verdammt war, sollte dieses Scheitern nicht schon nach wenigen Tagen sichtbar werden. Nicht nur ihr Verantwortungsgefühl mir gegenüber, sondern auch ihre Angst, dass ihr Exmann sich ins Fäustchen lachen würde, ließ sie einlenken.
Bald lernte ich unseren Nachbarn kennen, einen gepflegten Rentner, der das Haus nie ohne seinen Hund verließ. Mittags saß er auf dem Balkon und las die »Süddeutsche Zeitung«, kurz vor dem Sonnenuntergang ging er mit dem Hund spazieren. Wir grüßten uns stets wortlos, aber freundlich, bis er mich eines Tages auf der Treppe ansprach. Zu meinem Erstaunen sprach er meinen Namen fehlerfrei aus: »Herr Abdel-Samad, ich sammle für einen Schuhschrank für Sie!« Auch nachdem er mit großer Anstrengung das Gleiche in Englisch wiederholte, konnte ich nicht verstehen, was er meinte. Ich lächelte blöd und ging. Antonia erklärte mir, dass unser Nachbar es wohl unhygienisch fände, wenn ich meine Schuhe immer vor der Wohnungstür ausziehe, und wollte das auf ironische Weise zum Ausdruck bringen. Auch wenn diese Art von Humor nicht die meine war, verstand ich, und zog meine Schuhe nicht mehr vor der Wohnung aus. Erst als er mich grinsend mit »Gut so!« lobte, entschloss ich mich, in gesteigertem Maße rückfällig zu werden. Ich fragte mich, wie er wohl vor 55 Jahren gewesen war. Nur das Bild eines Hitlerjungen war in meinem Kopf. Der andere Nachbar, der über uns wohnte, war ein junger gesunder Mann, der seine Freundin täglich beglückte. Er roch immer nach Bier und Tabak. Jeden Tag hörten wir das Stöhnen und Schreien seiner Freundin. Antonia lachte, ich fand es widerlich.
Antonia versuchte, mir die deutschen Tugenden nahezubringen; sich etwa am Telefon mit Namen zu melden, gleichgültig, ob man anruft oder angerufen wird, bei einer roten Ampel die Straße nicht zu überqueren, auch wenn kein Auto in Sicht ist. Aber anscheinend waren die Krankheiten meines »Systems« auch in der Fremde allgegenwärtig. Einmal ließ ich eine Mutter mit ihrem fünfjährigen Buben an einer roten Ampel stehen und überquerte die Straße. Da rief der kleine Junge nach mir: »Du Arsch.«
Verärgert ging ich zu ihm und wollte ihm und seiner Mutter erklären, dass Disziplin den Deutschen zum Wirtschaftswunder verholfen hatte, mit der gleichen Disziplin jedoch auch der Holocaust organisiert wurde. Ich schaute dem Kleinen in die Augen. Er war ein hübscher Junge. Statt ihn zu tadeln, entschuldigte ich mich für mein Benehmen, wartete bis es wieder Grün wurde und ging weiter. Ich konnte mich nicht ständig mit jedem anlegen, sonst würde ich mir das Leben selbst zur Hölle machen. Von nun an versuchte ich, mich besser einzufügen.
»Was muss man tun, um wie die Deutschen zu sein, außer Wurst essen und Bier trinken?«, fragte ich Antonia. Beides war mir zuwider.
»Zuerst musst du lernen, gescheit Deutsch zu sprechen.«
»Im Schwabenland?«
»Dann musst du auch lernen, Auto zu fahren!«, sagte sie.
Zwei Wochen später sollte sie ihre Meinung revidieren: »Hamed, ich glaube, Autofahren ist nichts für dich. Du versuchst gleich beim dritten Mal Vollgas zu geben, dafür sind meine Nerven zu schwach und das Auto zu neu.«
Mein erster Schnee war faszinierend. Als ich die Flocken sah, empfand ich das erste Mal, seit ich in Deutschland war, Glück. Ich verpackte mich in meine dicksten Klamotten und lief wie ein Kind durch den Schnee. Ich liebte das Knirschen unter meinen Schuhen.
»Wollen wir in die Berge? Dort gibt es noch mehr Schnee«, fragte Antonia.
Eine Bandscheibenvorwölbung und eine mehrwöchige schmerzhafte Behandlung waren die Folgen unseres Skiurlaubs. Das kommt wohl davon, wenn ein Ägypter versucht, Ski zu fahren.
»Gibt es irgendetwas Deutsches, das nicht lebensgefährlich ist?« Antonia schlug klassische Konzerte vor. Mir gefiel Rachmaninow sehr – er war kein Deutscher, aber das kümmerte uns nicht. Auch »Die kleine Nachtmusik« kannte ich von früher, und Mozarts Vater stammte aus Augsburg, wie ich erfuhr.
Eine Besichtigung von Neuschwanstein, ein Spaziergang in der Fuggerei, eine Aufführung der Augsburger Puppenkiste, ein Ausflug zum Starnberger See. Antonia versuchte mich mit allem, was Augsburg und seine Umgebung zu bieten hat, zu beeindrucken. Der Süden Deutschlands bezaubert zwar durch seine landschaftliche Schönheit, aber ich konnte nur selten eine der vielen Spritztouren mit Antonia genießen. Bei einem Ausflug zum Königssee saßen wir auf einer Bank, vor uns die idyllische Kulisse. Himmel, Berge und See hätten nicht besser harmonieren können. Die Schönheit der Natur zerriss mich, ich musste die Augen schließen. Ein gläubiger Muslim würde eine solche Szene mit »Masha’allah« kommentieren, »Lob sei dem Herrn«. Ich dagegen brach eine Diskussion über die abstoßende Sexualmoral und den unmäßigen Alkoholkonsum der Deutschen vom Zaun, die wie Tiere arbeiten und wie Tiere Spaß haben. »Die Regeln des Korans sollten eigentlich auch in diesem Land angewendet werden, sonst wird die Gesellschaft zerfallen«, betonte ich. Antonia versuchte mir zu erklären, dass Sexualität und Alkohol ein Teil der Freiheit seien, die sie über alles schätzt.
Dieses Wort »Freiheit« war genauso provozierend wie die idyllische Landschaft.
»Zur Hölle mit eurer Freiheit!«, sagte ich und schwieg.
Antonia wusste, dass in diesem Augenblick eine Diskussion mit mir sinnlos war. Wir fuhren, wie so oft, schweigsam nach Hause zurück.
Einmal fragte mich Antonia, ob ich das Konzentrationslager Dachau besuchen wolle.
»Was soll ich in Dachau?«
»Das ist ein Stück deutscher Geschichte, und ich dachte, es würde dich interessieren.«
Ich wollte nicht. Das KZ war mir gleichgültig. »Ihr Deutschen müsst euch an das Leiden der Juden erinnern, weil ihr es verschuldet habt. Aber was habe ich damit zu tun? Meine Familie und ich haben die Juden nicht als Opfer, sondern als Täter erlebt. Deutschland wurde nie angemessen für sein Verbrechen bestraft. Die Palästinenser und Araber haben euch die Strafe abgenommen. Warum habt ihr den Juden nicht das Staatsgebiet Bayerns als neue Heimat angeboten? Warum zahlt immer der Schwächere für das Verbrechen des Mächtigeren? Ich kämpfe mit meinen eigenen Erinnerungen, Antonia, und brauche eure nicht.«
»Ich glaube, du verstehst das nicht. Dachau ist nicht nur ein Teil der deutschen Geschichte, sondern auch ein Mahnmal, aus dem die ganze Welt etwas lernen muss«, sagte sie.
»Glaubst du, dass die Menschen tatsächlich so lernfähig sind? Hast du nicht gesehen, was in Vietnam, Ruanda, Palästina, Tschetschenien und Bosnien passiert ist? Das alles geschah nach dem Holocaust. Und eure Gedenkstätte konnte nichts daran ändern.«
Aber ein anderes Denkmal wollte ich besuchen: das Grab von Rudolf Diesel in Augsburg.
»Woher kennst du Diesel und sein Grab?«, wunderte sich Antonia, da sogar viele Augsburger davon nichts wussten.
»Ich hab mal in einer ägyptischen Zeitung gelesen, dass die Augsburger es abgelehnt hatten, für sein Begräbnis zu sorgen, weil sie annahmen, dass er Selbstmord begangen hat. Und dass einer seiner Schüler aus Japan für ihn 44 Jahre später ein Grabmal auf eigene Kosten errichten ließ.«
Ich ging zum Grab Diesels und zitierte ein paar Passagen aus dem Koran für seine Seele. Neben Mozarts Vater hat Augsburg zwei berühmte Söhne: Diesel und Brecht. Lange Zeit strafte die Stadt ihre Zöglinge mit Nichtachtung, weil sie sich wenig um ihre Heimat kümmerten. Der viel bejubelte Brecht soll über seine Vaterstadt gesagt haben: »Das Schönste an Augsburg ist der Schnellzug nach München.«
Antonias Versuche, mich aus meiner Lethargie herauszuholen, waren wenig erfolgreich. Ich wurde ohne erkennbaren Grund immer unruhiger. Sie entdeckte bald, dass der selbstbewusste, sensible Ägypter, den sie am Flughafen von Kairo getroffen hatte, nur die Fassade eines gebrochenen, zerstreuten Mannes war, der die Schwachstellen seiner Kultur lieber in sich begrub, als sie sich vor Augen zu führen. Ich idealisierte meine Religion und betete demonstrativ vor Antonia, die zwar vom Islam fasziniert war, aber eine nüchterne Distanz behielt. Zunehmend wurde ich sowohl finanziell als auch emotional von Antonia abhängig. Ich sah nur »ihr« Deutschland und traf nur die wenigen Freunde, die sie hatte. Als Lehrerin hatte sie vormittags immer recht und nachmittags immer frei. Sie war weiterhin der »Mann« im Hause, traf alle Entscheidungen, erledigte für mich alle amtlichen Angelegenheiten. Auf den Ämtern sprachen die Sachbearbeiter nur mit ihr. Ich war der »er«. Ich fühlte mich regelrecht entmannt. Fast jeder zweifelte an der Ernsthaftigkeit unserer Ehe. Viele dachten, es handele sich lediglich um eine Scheinehe, einige sahen in mir sogar nur den bezahlten Liebhaber. Und schließlich fingen auch Antonia und ich an, den Sinn unserer Ehe infrage zu stellen. Hatte ich dafür Ägypten verlassen? Um von einer Abhängigkeit in die nächste zu geraten?
Deutsche Sprache, schwere Sprache
Ich belegte gleich zwei Kurse, um Deutsch zu lernen, an einer privaten Schule in Augsburg und an der Universität in München. Das erlaubte mir, eine deutsche Großstadt kennenzulernen. Ich konnte Brecht verstehen, München war lebendiger und einladender als Augsburg. Dort lief ich alleine auf der Straße und ging zur Universität, alles ohne Antonias Hilfe. Ich lernte Deutsch und schloss auch meine ersten Freundschaften. Viele Ausländer lebten in der Stadt, und im Gegensatz zu Augsburg sprachen die meisten Deutschen Englisch. Ich war sehr glücklich, als mich eine italienische Studentin zu einem Spaziergang im Englischen Garten einlud. Ich lief neben ihr im Garten und stellte mir vor, ich wäre noch 17 und sie wäre meine Freundin. Dann würde ich ihre Hand halten und ihr sagen, wie wunderschön ihre Augen seien. Bevor ich meine Gedanken weiterziehen ließ und mir den ersten Kuss vorstellte, sprach sie unvermittelt von ihrem Freund, den sie über alles liebte. Aus der Traum. Doch wenn sie einen Freund hatte, wie konnte sie einfach mit mir spazieren gehen? Warum ging ein gläubiger Muslim, der verheiratet war, mit einem hübschen Mädchen spazieren und ließ seiner Phantasie freien Lauf?
Dennoch waren die Tage, die ich in München verbrachte, mein wirkliches Leben. Mir machte es Spaß, Deutsch zu lernen. Ich konnte es kaum erwarten, Rilke und Goethe auf Deutsch zu lesen. Ich übersprang zwei Levels im Deutschkurs und bestand nach vier Monaten den Eignungstest für das Studium. Die Struktur des deutschen Satzes und das Prinzip der Wortbildung zeigten mir, dass es sehr schwer sein würde, das Gedankengebäude dieses Landes zu durchblicken. Selbst-Über-Windung, Ver-Antwortung, Ent-Scheidung, Bier-Garten, Wahr-Haftig-Keit, Beziehungs-Arbeit sind Beispiele für Wörter, die mich faszinierten und mir nur eine Ahnung davon gaben, warum die Deutschen großartige Philosophen waren. Natürlich waren das nicht gerade die Wörter, die ich im Sprachkurs lernte, aber bald kamen sie mir entgegen und beschäftigten mich zusehends. Es mussten diese Wörter und die melancholische Abgeschiedenheit der Berge sein, die Nietzsche, Heidegger und Husserl zu ihren großen Gedanken über Zeit, Dasein und Wahrheit gebracht hatten.
Diese bedrückende Ernsthaftigkeit musste Satiriker wie Loriot und sympathische Anarchisten wie den Pumuckl hervorbringen. Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben, dass die Deutschen mich irgendwann zum Lachen bringen würden, bis ich die beiden im Fernsehen sah. Ich lachte aus vollem Herzen, als ich sah, wie Loriot die Ernsthaftigkeit der Deutschen belächelte und wie der rothaarige Pumuckl sie mit seinem Chaos dekonstruierte. Mir gefielen auch Harald Schmidt und später sogar Stefan Raab, weil sie sich über Deutschland lustig machten.
Obwohl ich lieber in München studiert hätte, schrieb ich mich in Augsburg ein, um Fahrtkosten zu sparen. Ich hatte bislang keinen Job und wollte Antonia nicht überfordern. Das Gebäude der Universität Augsburg war eine betonierte Bausünde der siebziger Jahre. Aber der Teich hinter dem Campus war idyllisch. Die Lehrangebote waren mager und das Bildungssystem zu kompliziert, um von einem Ausländer verstanden zu werden. Es gab keinen Stundenplan, wie ich es aus Ägypten gewohnt war, und so musste ich meine Vorlesungen und Seminare selbst wählen.
Diese verfluchte Freiheit. Zum Glück war der Studienberater der Universität ein Freund von Antonia. Außerdem war er Araber. Ein unglaublich sympathischer Mensch namens Durgham. Er war der Einzige an der Uni, an dessen Tür kein Schild mit der Aufschrift »Bitte nicht stören« hing. Durgham schrieb stattdessen »Herzlich willkommen«. Er war mein Trauzeuge und half mir, den Vorlesungsdschungel ein wenig zu durchblicken; er gab mir Tipps, wo ich arabische Studenten treffen konnte. Ich sagte ihm, dass ich keine Araber kennenlernen wolle.
Durgham war 60 Jahre alt und lebte seit 35 Jahren in Deutschland. Er sprach und dachte wie ein Deutscher und war dennoch gläubiger Muslim. Eine seltene Kombination, denn die Einwanderung führt viele Muslime in die totale Assimilierung oder den totalen Rückzug in die traditionellen Strukturen. Ich erfuhr von ihm, dass er erst vor wenigen Jahren zum Glauben zurückgefunden hatte. Der Körper wird schwächer, der Tod kommt näher, also flirtet man wieder mit Gott und wird gläubig.
Dazu kam, dass seine Bemühungen, sich einzufügen, kaum von Deutschen anerkannt wurden. Auch nach 35 Jahren sah man in ihm nur den Ausländer. »Man wird nicht Deutscher, sondern man ist als solcher geboren«, sagte er ironisch. Aber im Gegensatz zu den meisten Konvertiten, die in der Regel fanatisch und kompromisslos in ihrer Religiosität wurden, war Durgham ein rationaler und liberaler Mensch. Deshalb wurde er oft von muslimischen Emigranten als ungläubig abgetan, und so suchte er, wie ich, kaum Kontakt zu Arabern. »Die Deutschen sehen mich nicht als einen von ihnen und die Muslime auch nicht. Wie schön, dass ich wenigstens eine Familie habe«, sagte er.
Durgham und seine deutsche Frau Anna besuchten uns oft am Wochenende. Sie war eine liebevolle Frau, künstlerisch begabt und sehr spirituell. Dem Anschein nach war es eine perfekte Familie, aber mich machte die Art, wie Durgham Anna vor uns küsste und verwöhnte, skeptisch. Es sah unecht aus. Ich sagte Antonia, dass diese Beziehung inszeniert sei. Sie warf mir vor, meine Unzufriedenheit auf andere zu projizieren. Drei Monate später reichte Anna die Scheidung ein, weil Durgham sie jahrelang mit einer Studentin betrogen hatte. Die Beziehung zerbrach und unsere Freundschaft auch. »Ein arabischer Mann plus eine germanische Frau ist die Hölle«, war Durghams Fazit seiner Ehe.