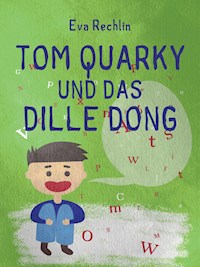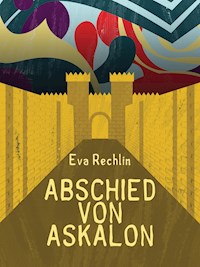
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Es ist das Jahr 285 nach Christus. In Askalon werden die Geschwister Tobija und Debora von einer Pflegefamilie großgezogen. Eines Tages erfahren die beiden jedoch von einer riesigen Erbschaft, die ihr bisheriges Leben schlagartig auf den Kopf stellt. Während Debora in Askalon bleibt, bricht Tobija sofort nach Alexandria auf. Doch Debora erhält immer unglaublichere Nachrichten über ihren Bruder, weswegen sie sich schließlich doch zu dem äußerst gefährlichen Weg durch die Wüste aufbricht. Als sie schließlich in Alexandria angekommen ist, wird sie vor eine wichtige Entscheidung gestellt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Eva Rechlin
Abschied von Askalon
SAGA Egmont
Abschied von Askalon
Copyright © 1996, 2017 Eva Rechlin og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711754245
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Ein Bote aus Ägypten
Römisches Imperium 285 n. Chr.
unter der Regierung von Kaiser Diokletian
Die Wellen des Mittelmeers leckten auf den sandigen Strand vor Askalon, auf dem ein junger Mann vorwärts taumelte, erschöpft und doch wie von Eile getrieben. Weit vor sich sah er die helle Stadt über der Steilküste, übergossen vom roten Licht der rasch ins Meer sinkenden Sonne. Bei Gaza hatte ein Fischerboot den müden Boten an Land gesetzt. Thomas kam von Alexandria im westlichen Nildelta, und er ahnte, daß die Botschaft, die er von dort nach Askalon bringen sollte, auf unheimliche Art dringend sein mußte. Allzu verstohlen war ihm die versiegelte Papyrusrolle zusammen mit einer Handvoll Münzen zugesteckt worden, und er hatte die leise Bitte der verschleierten Absenderin noch im Ohr:
»Bring es nach Askalon zu Bruder Samuel, bitte gleich! Nimm notfalls eine Schiffspassage. Und Vorsicht!«
Ja, mit Hilfe von so viel Geld war er ungewohnt schnell bis Gaza gekommen. Und nun eilte er den Weg am Strand entlang, wo er vor zeitraubenden Militärkontrollen sicherer war als auf der parallel verlaufenden Römerstraße. Thomas war fest entschlossen, sein Ziel noch vor einbrechender Dunkelheit zu erreichen. Sich dort nach dem Wanderprediger Samuel durchzufragen, konnte nicht schwer sein. Zwischen Nildelta, Gaza, Askalon, Caesarea und bis Tyrus hinauf kannte jeder Bruder Samuel.
Thomas kletterte zur Steilküste hinauf, wo die Stadt begann. Der kurze Aufstieg nahm ihm den Atem, und er wischte sich den Schweiß von Stirn und Nacken, zog die knielange Tunika unter seinem Gürtel zurecht, ordnete die sich vor der Brust kreuzenden Riemen von Versorgungsund Botentasche und ging auf einige kleinere Häuser am grün umwachsenen Stadtrand zu. Nach Bruder Samuel mußte er nicht lange fragen. Die Leute wiesen ihm den Weg zu einem Gehöft am nördlichen Stadtrand, zwischen Römerstraße und Meer:
»Dort wohnt Samuel, wenn er in Askalon weilt, in der großen Familie von Sebastian und Miriam, den mit Kindern Gesegneten! Und auch mit Hunden Geschlagenen«, wie einer seiner Wegweiser lachend warnte.
Als die lindernde Nachtkühle über Askalon fiel, erreichte Thomas sein Ziel zwischen Meer und Wüste, im fruchtbaren Küstenland der römischen Provinz Judäa.
Die Hunde hätten einen erfahrenen Boten wie ihn ohnehin nicht abgeschreckt, er verstand sich auf den richtigen Umgang mit ihnen, außerdem sah er in dem »kläffenden« Rudel eher Spielgefährten der mindestens fünf Kinder von Sebastian und Miriam. Die lebhafte Familie schien ein Fest zu feiern. Thomas traf sie in dem ummauerten Hof am prasselnden Feuer, über dem sich ein Spieß mit Hühnchen drehte. Überwältigt vom köstlichen Bratenduft blieb der junge Fremde am Toreingang stehen. Sein schon länger nicht mehr gestillter Durst schnürte ihm die Kehle zu, als er zum Gruß ansetzte:
»Friede mit euch…« Seine Stimme versagte.
Ein junges Mädchen trat mit einem Krug Wasser auf ihn zu: »Trink erst einmal!«
Mit beiden Händen griff Thomas danach und trank gierig das erfrischende Naß. Als er den Krug wieder absetzte, hatten sich sämtliche Familienmitglieder neugierig um ihn versammelt. Der Älteste stellte sich und die Seinen vor.
»Du scheinst einen gewaltigen Weg hinter dir zu haben, komm erst einmal herein, iß und trink mit uns und ruh dich aus, das Weitere wird sich finden.«
»Ist Brüder Samuel nicht hier? Ihn suche ich, seinetwegen komme ich von Alexandria! Eine wichtige Nachricht, eilig…«
Schlagartig wurde es still. Vater Sebastian kratzte sich den bereits ergrauenden Schopf und blickte fragend auf seine Frau Miriam:
»Wann wollte Samuel von Joppe zurück sein?«
»So bald wie möglich, jeden Tag also! Du bist hier genau richtig, um ihn abzuwarten.«
»Ich bin Thomas. Samuel kennt mich. In Joppe ist er? Also noch weiter nordwärts?«
»Ganz sicher längst auf dem Rückweg.«
»Dann muß ich ihm entgegen.«
»Jetzt? In der Nacht? So eilig kann nichts sein, daß ein Bote sich dafür zum Löwenfraß anbietet. Diese Nacht ruhst du dich bei uns aus, jetzt wird erst einmal gegessen und getrunken. Ihr, Kinder, jagt die Hunde aus dem Hof, Tobija, sorge du dafür!«
Der größte und wohl auch älteste riß einen Fetzen fettglänzender Haut von einem Brathühnchen und lockte damit die ganze Hundemeute in ihren Zwinger. Das älteste der Mädchen brachte dem fremden Gast eine Schüssel Wasser und Tücher, damit er sich den Staub abwaschen konnte. »Ich bin Debora«, sagte sie, während sie mit den Tüchern bei Thomas stehenblieb, »Tobija ist mein Bruder.«
»Und die anderen? Seid ihr nicht alle Geschwister?«
Vater Sebastian mischte sich ein:
»Tobija und Debora sind Waisen und unsere Pflegekinder, nur der Rest ist eigene Brut. Helft der Mutter, Kinder! Bringt mehr Wasser mit Wein und Brot!«
»Kommt deine Nachricht aus Alexandria von den reichen Schwestern Angela und Agatha?« fragte Debora leise.
»Ihr kennt sie hier?« Überrascht hob Thomas den Kopf. »Wir wissen von ihnen. Tobija und ich sind mit ihnen verwandt. Haben sie dich geschickt?«
»Nur eine von ihnen.«
»Nur eine? Welche? Sie machen sonst immer alles gemeinsam! Warum guckst du weg?«
Thomas wich aus:
»Sie war verschleiert. Außerdem kenne ich sie nicht näher. Wieso verwandt?«
»Unsere Mutter Kora kam vor sechzehn Jahren aus Alexandria hierher. Sie war die einzige Verwandte der reichen Eugenios-Schwestern, ihre Kusine.«
»Ihre einzige Verwandte?« Thomas starrte Debora fassungslos an.
»Sie folgte Simon, unserem Vater. Das hat den Tanten in Alexandria nicht gepaßt, er war nur Fischer, verstehst du?«
»Und ihr seid die einzigen Kinder von Kora, du und…?«
»Und Tobija, ja, aber es gibt keine Verbindung zwischen uns und den alten, reichen Tanten. Womöglich wissen sie gar nichts von uns. Setz dich zu den anderen ans Feuer und iß! Ich räum’ das hier fort.«
Sebastian zog den Gast an seine Seite, und Miriam bewirtete ihn mit Brot und Wein und einem halben Hühnchen: »Greif zu, Thomas! Siehst aus, als hättest du seit Alexandria nichts mehr zu dir genommen.«
»O doch. Ich fuhr bis Gaza auf einem Küstenfrachter mit. Es gab fast vierzig Tage lang Fisch.«
»Wie bei uns«, sagte eines der Kinder, »da hattest du Glück, daß du gerade heute kamst.«
»Und was feiert ihr?«
Thomas beobachtete, wie Eltern und Kinder fragend auf Tobija blickten, der in der Glut stocherte und neue Äste nachlegte, die sich knisternd mit bläulichen Flämmchen entzündeten. Auch Debora sah ihren Bruder erwartungsvoll an:
»Sag du es ihm, Tobija!«
»Was schon! Daß ich Fischer werde? Habe ich eine andere Wahl?«
»Er hat es sich wirklich lange überlegt, ob auch er Fischer werden soll wie sein Vater Simon«, erkärte Miriam dem Gast.
»Den das Meer sich holte«, erwiderte Tobija düster, »vor drei Jahren, so wie vor ihm den Großvater. Verstehst du, Thomas, daß mir die Entscheidung nicht leicht fiel? Ich bin vierzehn, andere in meinem Alter haben es längst gelernt!«
Der selber noch junge Gast lächelte dem Jüngeren ermutigend zu:
»Ich verstehe ja – es ist eine Entscheidung fürs Leben. Gott wird dich beschützen, Tobija, er ist Herr über das Meer und den Sturm.«
Tobija nickte, halb spöttisch lächelnd, halb bitter, als dächte er: Das sagen sie alle. Dann blickte er den späten Besucher prüfend an und fragte:
»Gibt es Neuigkeiten aus Alexandria? Was ist so wichtig für den guten alten Samuel? Ich kann’s mir denken – meine Tanten Angela und Agatha Eugenios schicken dich. Welche Gemeinde ist diesmal in Not?«
Mit einem hilfesuchenden Blick zu Debora antwortete Thomas unsicher:
»Deine Tanten?«
»Du kannst ruhig offen reden. Alle hier wissen, daß unsere Mutter ihre ungetreue einzige, sehr viel jüngere Kusine war. Was also wollen sie von Samuel? Er ist unser Vormund!«
Ruhig mischte sich Vater Sebastian ein:
»Laß unseren Gast in Frieden speisen. Er soll reden oder schweigen, wie er es will. Du mußt wissen, Thomas, daß die beiden reichen Schwestern sehr viel Gutes tun. Sie versorgen viele christliche Gemeinden an Samuels Route mit Spenden, und zwar regelmäßig! Das ist nicht selbstverständlich. Wir alle sind ihnen dankbar.«
»Ich nicht«, widersprach Tobija, »ich finde das selbstverständlich, wenn sie so reich sind. Hast du ihren Reichtum gesehen, Thomas? Du warst doch dort!«
»Das sieht man nicht einfach so. Natürlich bewohnen sie ein großes Haus in bester Lage. Ihr Reichtum besteht überhaupt aus großen Häusern in sämtlichen Stadtvierteln, im ägyptischen, im jüdischen und die meisten wohl im vornehmen griechischen Viertel.«
»Aber wohnen können sie doch nur in einem Haus«, meinte Sebastians Jüngster.
Die Älteren lachten und klärten ihn auf:
»Häuser kann man vermieten! Da brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Die Häuser bringen das Geld von ganz allein. Wie viele Häuser sind es denn? Drei, fünf oder mehr?«
»Viel mehr, ganze Straßenzüge, dazu viele Geschäfte. O ja, die Damen Angela und Agatha zählen zur besten Gesellschaft und sind hoch angesehen in Alexandria.«
»Nicht nur in Alexandria«, versuchte Vater Sebastian das Thema zu beenden, »sondern auch bei uns hier im einstigen Philisterland. Von wo stammst du, Thomas?«
»Aus der Römergarnison Aelia Capitolina.«
»Aus Jerusalem, also bist du kein Jude? Ich meine, weil uns die Stadt doch verboten ist.«
»Christen nicht. Entschuldigt, wenn mir plötzlich die Augen zufallen wollen. Seit dem Morgengrauen war ich unterwegs, den ganzen heißen Tag lang. Und morgen muß ich früh weiter…«
Miriam und Debora standen auf, dem Gast ein Nachtlager herzurichten, doch er bat, im Hof schlafen zu dürfen, in der angenehmen Nachtkühle, gegen die ein einfaches Laken genüge. Er sei es gewohnt, auf Sand zu schlafen, wollte nicht einmal eine Strohschütte. Und die Gastgeber verstanden ihn: Genauso halte es auch der alte Samuel, jedenfalls in den Sommermonaten. Und da sie selber in dieser heißen Jahreszeit auf den flachen, ummauerten Dächern von Wohnhaus und Ställen schliefen, brachten sie nur die Ledertaschen von Thomas sicher im Hausinnern unter. Debora kümmerte sich darum. Es fiel Thomas auf, wie verständig sie Miriam in allem zur Hand ging, obwohl er sie nicht älter als zwölf oder dreizehn schätzte. Debora scheuchte die vom Essen träge gewordenen jüngeren Kinder auf das Dach, sie redete vor der Hofmauer beschwichtigend auf die Hündchen ein, zog das hölzerne Hoftor zu und verriegelte es, während Tobija mit den Wein- und Wasserkrügen im Hausinnern verschwand. Das noch glühende Feuerchen überließen sie sich selbst, schoben nur den lockeren hellen Sand wallartig herum. Thomas sah Vater Sebastian als letzten im schwachen Licht verschwinden. Er selbst fühlte sich schwer wie Blei, streckte sich auf dem Sand aus, starrte zum indigoblauen Nachthimmel und nahm die tausend flimmernden Sterne mit in seine tiefen Träume.
Nichts bemerkte er mehr von den zwei Mandelaugen über dem Dachmäuerchen, die hellwach auf ihn niederblickten. Debora als einzige dachte nicht an Schlaf. Als sie überzeugt war, daß alle schliefen, schlich sie leise nach unten, tastete nach einer Öllampe und ging auf nackten Sohlen in den Hof. Der fremde Gast hatte sich dicht an der Hauswand niedergelassen, sie hörte seine tiefen Atemzüge. Debora tastete am schwach glühenden Feuerrest nach einem glimmenden Zweig, mit dem sie ihr Lämpchen anzündete. Erst drinnen zog sie den Docht höher, damit er genügend Licht gab. Sie selber hatte die Taschen des Boten in der Küche verstaut. Die Münzen in der Kuriertasche klimperten aneinander, als Debora sie hastig aus dem Versteck holte und öffnete. Erschreckt blickte sie um sich, als müßte das leise Klirren alle Schläfer wie Schellenklang geweckt haben. Doppelt vorsichtig griff sie in die Tasche und zog eine versiegelte Papyrusrolle ans Licht. Es war ein einfaches Tonsiegel, unordentlich gepreßt wie in höchster Eile, sein Zeichen kaum erkennbar und nach der langen Wegstrecke bis zum Zerbröckeln ausgetrocknet. Mit einem Messer hantierte Debora behutsam, bis sich das ganze Siegel abheben ließ und sie den Papyrus aufrollen konnte. Sie erkannte griechische Schriftzeichen, die sie ebenso lesen konnte wie lateinische oder die in Judäa üblichen aramäischen der jüdisch-palästinensischen Sprache. Im römischen Imperium, einem Vielvölkerstaat, war Mehrsprachigkeit nichts Besonderes, doch was auf dem feinen Papyrus mit griechischen Buchstaben geschrieben stand, war in der koptischen Sprache Ägyptens abgefaßt, die das Mädchen nur bruchstückhaft kannte. Enttäuscht versuchte sie, den Inhalt zu entziffern. Das Schreiben war offensichtlich von Tante Angela, der älteren der reichen Schwestern abgefaßt, mit zittriger Hand, und – so viel begriff Debora bei der mühsamen Lektüre – Angela fürchtete sich vor ihrer einzigen Schwester Agatha! War das zu fassen? Galten die beiden nicht als unzertrennlich in ihrer schwesterlichen Liebe?
Ja, von Liebe handelte die Botschaft an Samuel, von der großen, schmerzlichen, einzigen Liebe ihres Lebens, das konnte Debora erraten. Er sollte wissen, daß Angela ihn von Anfang an geliebt und nie damit aufgehört hatte. Aber warum gestand Angela Samuel ihre Liebe gerade jetzt, nachdem sie sie offenbar mehr als dreißig Jahre lang unterdrückt hatte? Warum jetzt solche Eile? Es folgten einige wirre, schwer verständliche Zeilen, dann das Wort »Tod«. Daß es zu Ende gehe mit ihr, daß sie sich nach dem Tod sehne – Tod, ihre einzige Hoffung, Wiedersehen im Tod, Befreiung durch den Tod… Debora starrte auf den Papyrus und begriff, daß eine Sterbende ihn vollgekritzelt hatte, deren Kraft sich von Zeile zu Zeile sichtlich erschöpft hatte. Und die schwachen, zittrigen Zeilen verschwammen vor Deboras Augen, weil ihr unwillkürlich die Tränen kamen und sich in ihr zum ersten Mal überhaupt ein Gefühl für die ferne Verwandte in Alexandria regte. O gnädiger Gott, in was für ein Leben läßt Du mich blicken! In meinen Gedanken lebten die reichen Schwestern in Überfluß und Glück, in endlosen Freuden, märchenhaft glanzvoll, herrlich und zufrieden! Aber der Brief war noch nicht zu Ende, Debora wollte auch vom letzten Absatz das Nötigste begreifen. Es war die Rede von den Kindern, »Koras Kindern«, die Samuel nach Alexandria bringen solle… stand das wirklich dort? Nach meinem Tod – Koras Kinder – nach Alexandria – Agatha nicht allein lassen.
Debora war plötzlich, als brenne der Papyrus in ihren Händen. Sie horchte ängstlich ins finstere Haus und nach oben zum offenen Dachgeschoß. Alles war still… Sie wollte den Brief auf der Stelle loswerden, er machte ihr Angst. Wie hatte sie sich in kindlicher Neugier hinreißen lassen, ihn überhaupt zu öffnen? Fahrig rollte sie den kostbaren Papyrus zusammen, und das Siegel fiel ihr wieder ein. Noch war es ganz. Sie mußte den Papyrus noch einmal auf- und anders wieder zurollen, bis das Siegel an seine ursprüngliche Stelle paßte. Aber wie es befestigen? Es war nicht aus Harz oder Lack, die Flamme des Öllämpchens also keine Hilfe. Debora versuchte es mit Speichel, doch der Ton war längst zu trocken. In der Not fiel ihr nichts Besseres ein, als es mit einer Fingerspitze Mehl aus Miriams Vorratskrügen zu versuchen. Wenigstens bis morgen oder übermorgen mußte es halten! Sie rieb den Brei aus Speichel und Mehl unter das halbe Tonsiegel und preßte es mit den Handballen ein Weilchen zusammen. Dann ließ sie vorsichtig los. Dem Himmel sei Dank, es hielt! Unsicher schob Debora die Papyrusrolle zurück in die Botentasche, die sie neben der Versorgungstasche von Thomas verstaute. Im flackernden Lichtschein hatte sie auf dem Grund der Tasche funkelnde Geldstücke gesehen. Viel mußte der reichen Tante Angela daran gelegen haben, ihren Boten auf dem schnellsten Wege zu Bruder Samuel zu schicken. Und Samuel, dachte Debora, ist unser Vormund. Er wird eine Entscheidung fällen müssen.
»Gütiger Gott, entscheide Du und laß auch mich in dieser Nacht fest schlafen.« Sie löschte die Ölflamme, und plötzlich fürchtete sie sich.
Debora verbrachte die Nacht überwiegend schlaflos, nur für Minuten sackte sie in wilde Träume ab, aus denen sie um so ratloser wieder aufwachte. Nun gut, sie hatte sich von einer ihr jetzt unheimlichen Neugier verleiten lassen, einen fremden Brief zu lesen. Sie hatte erfahren müssen, daß es in dem Brief unter anderem auch um sie und ihren Bruder Tobija ging, um Koras Kinder. Durch ihre Mutter war sie mit der Absenderin des Briefes verwandt, doch nie hatte Debora den frühzeitigen Verlust der Mutter so schmerzlich empfunden wie in dieser Nacht! Mit ihr hätte sie jetzt offen sprechen, ihre Neugier, den Verrat an der Vertrauensseligkeit anderer, beichten können, aber ihre Mutter war seit zwei Jahren tot. Und Tobija, der sich gerade durchgerungen hatte, zu den Fischern in die Lehre zu gehen und der so impulsiv reagieren konnte, ihm durfte sie sich nicht anvertrauen.
Unruhig wälzte sie sich hin und her, und ein Entschluß wuchs in ihr und stand bis zum Morgen fest: Sie würde dabei sein wollen, wenn Samuel diesen Brief aus Alexandria erhielt und ihn öffnete. Sie mußte wissen, ob er bemerkte, daß der Papyrus geöffnet worden war! Allein deshalb wollte sie darauf bestehen, den jungen Boten aus Ägypten zu begleiten, wenn er Samuel entgegenziehen wollte. Debora sah die Sterne bereits verblassen, als sie noch einmal und endlich tiefer einschlief. Sie würde den Schlaf brauchen, um ihre Absicht durchzusetzen.
Auf der Suche
Pünktlich wie jeden Morgen vor Sonnenaufgang krähten Miriams Hähne. Schlagartig wurde es auf den zwei Flachdächern munter. Tobija fiel auf, daß seine Schwester, sonst als erste auf den Beinen, fest weiterschlief, ausgerechnet an einem für ihn wichtigen Tag. Er rüttelte sie an der Schulter:
»He, Debora, aufwachen! Soll das ein Spaß sein, Schwesterchen?« Nur mühsam kam sie zu sich, blinzelte ihn sekundenlang verständnislos an, um im nächsten Augenblick zu fragen:
»Ist er schon weg? Ich muß mit ihm!«
Tobija lachte arglos:
»Ich bin noch nicht fort, natürlich gehst du mit mir zu den Fischern, wenigstens beim ersten Mal!«
»Wieso mit dir? Der Bote aus Ägypten – mit ihm muß ich gehen, Samuel entgegen. Er ist doch noch da?«
»Wie kommst du auf sowas? Er ist ein Bote, also erfahren mit Straßen und Wegen. Außerdem kennt er Samuel…« Sie hatte sich schnell aus ihrer Schlafdecke gewickelt, den Gürtel um die Tunika gelegt und lief bereits die schmale Treppe hinab in den Hof. Tobija blickte ihr verblüfft nach. Wie konnte Debora, eben noch in tiefstem Schlaf, zu einem derartigen Entschluß kommen? Thomas begleiten! Etwas mußte vorgefallen sein, und er, ihr engster Vertrauter, hatte es nicht bemerkt. Obwohl sie wußte, was dieser Tag für ihren Bruder bedeutete, schien ihr etwas anderes wichtiger zu sein – plötzlich war er alarmiert und rannte hinter ihr her nach unten. Auf der letzten Treppenstufe hielt Sebastian ihn auf:
»Was ist los? Erst rast Debora ohne Gruß und Kuß an uns vorbei… Solltet ihr nicht längst im Hafen bei den Fischern sein? Sie werden vom Fang zurückkehren und…«
»Und Debora hat es verschlafen! Ja, ich auch. Sie will mit dem Boten nach Joppe gehen! Wißt ihr davon? Ausgerechnet heute!«
Vom Hof her hörte sie Debora mit Thomas reden, den sie wohl eben erst geweckt hatte, denn seine Stimme klang verschlafen, und er gähnte mehrmals laut. Kopfschüttelnd fragte Vater Sebastian:
»Warum will Debora mit dem Boten gehen? Hat sie dir das gesagt, Tobija?«
»Kein Wort.«
»Laß mich den Gast zum Frühstück hereinbitten, vielleicht ist ja alles nur ein Hirngespinst.«
Nein, es war kein Irrtum. Ihre Begründung, warum sie den Boten begleiten wollte, klang halbwegs einleuchtend:
»Ich weiß, in welchen Gehöften und Zelten, bei welchen Freunden er einkehrt, das weiß Thomas nicht. Also wird er mich brauchen können.« Natürlich hielten sie ihr dagegen: »Unmöglich, daß ein junges Mädchen allein mit einem fremden Mann fortgeht!« Selbst Thomas sagte ihr das. Schweigend hörte Tobija eine Weile zu. Es wirkte absolut launenhaft und unvernünftig, wie sich Debora an diesem Morgen aufführte, das paßte nicht zu ihr. Allein, daß sie die besondere Bedeutung dieses Tages für den Bruder völlig zu vergessen schien, obwohl sie deswegen allesamt gestern abend gefeiert hatten – nein, das paßte nicht zu ihr. Ihm entging nicht, daß auch Miriam das normalerweise vernünftige Mädchen mit eigenartigem Gesichtsausdruck beobachtete – nachdenklich, ahnungsvoll. Zwei, dreimal glitten ihre Blicke zu der Sitzbank, unter der die beiden Taschen des Boten über Nacht verwahrt worden waren. Schließlich bückte sich Miriam, zog die Taschen hervor und legte sie auf die Steinbank. Augenblicklich verstummte Deboras Redeschwall. Das hätte verräterisch wirken müssen, hätte nicht sofort Miriam das Wort ergriffen. Sachlich stellte sie fest:
»So oder so müssen wir die Versorgungstasche mit neuem Proviant füllen. Bringt Brot her, Kinder, und von dem frischen guten Käse. Und Äpfel!« Debora fand die Sprache wieder:
»Meinen Vorrat trage ich selber im Beutel. Ich brauche nicht so viel wie ein Mann.«
»Damit dürften wir meinen ersten Lehrtag bei den Fischern wohl abschreiben?« meldete sich nun Tobija zu Wort. »Denn natürlich kann ich, als älterer Bruder, meine Schwester nicht allein mit einem Fremden ziehen lassen. Das ist wohl klar, oder? Ich gehe mit.« Fragend blickte er sich um. Miriam und Sebastian sahen sich ratlos an, als liefe etwas schief, das sie im Grunde zu verantworten hatten, und Sebastian fragte Tobija schließlich:
»Macht es dir so wenig aus, die Fischerei immer wieder auf die lange Bank zu schieben?«
In Wirklichkeit fühlte sich Tobija ausgesprochen erleichtert über die nochmalige Galgenfrist, doch mochte er seinen Pflegevater nicht enttäuschen. Ausweichend antwortete er:
»Wir gehen am Hafen vorbei und geben Bescheid.«
»Welchen Bescheid?«
»Daß etwas Unerwartetes dazwischengekommen sei. Familienangelegenheiten werden wir sagen. So genau geht es keinen etwas an. Wer weiß, was in dem eiligen Brief aus Alexandria steht? Vielleicht wird Samuel sogar froh sein?«
»Also dreimal Wegzehrung«, schnitt Miriam weiterem Palaver das Wort ab, »und jetzt laßt uns das Frühstücken nicht vergessen. Möchtest du das Morgengebet sprechen, Thomas?«
Der überrumpelte Gast schüttelte etwas hilflos den Kopf. Mit halb erhobenen Händen reihte er sich in die Tischrunde ein und lauschte mit gesenktem Gesicht, als Vater Sebastian mit den Psalmworten begann:
»Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinen Namen, du Höchster, zu singen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten deine Treue…«
Thomas schien auch nach zwei Stunden noch unschlüssig, ob er sich über die beiden Weggefährten freuen oder ärgern sollte. Wenigstens waren sie in Fußmärschen geübt und hielten mit ihm Schritt. Bis Joppe waren es fast zwei Tagesmärsche, da jetzt, im brütenden Hochsommer, eine ausgiebige Mittagsrast dringend notwendig wurde. Askalon samt seinem Hafen lag bald hinter ihnen.
»Die Fischer«, meinte Thomas, »schienen nicht gerade auf dich gewartet zu haben, Tobija. Oder täusche ich mich?«
»Es stört mich nicht, wenn diese Analphabeten über mich spotten. Einen Lehrling, der sieben Jahre lang Lesen, Schreiben, Sprachen, die Rechenkunst und manches andere studierte – auf so einen haben sie sowieso nicht gewartet.«
»Nicht zu vergessen die heiligen Schriften«, warf Debora ein, »und ich durfte alles mit ihm lernen. Unsere Eltern wollten es so, besonders unsere Mutter. Sie war nämlich sehr gebildet, hatte in Alexandria sogar die berühmte christliche Katechetenschule besucht. Ja, die reichen Tanten ließen sie erstklassig erziehen, ihre einzige jüngere Verwandte. Leider ist sie nur zweiunddreißig Jahre alt geworden, ein Jahr älter als unser Vater.«
»Simon ist also ertrunken?« fragte Thomas.
»Das ist auch so etwas«, fiel Tobija lebhaft ein, »das die Fischer an mir nicht mögen. Daß mein Vater ebenso wie mein Großvater ertrunken ist. Als klebte Unglück an uns, verstehst du?«
»Das bildest du dir ein«, protestierte Debora, »die meisten Fischerfamilien in Askalon haben Tote im Meer zu beklagen!«
Thomas spürte, daß die Geschwister deswegen uneins waren, und er versuchte schleunigst abzulenken:
»Wieso hat eigentlich die reiche und hochgebildete Erbin Kora aus Alexandria einen Fischer aus Askalon geheiratet? Sie muß wohl noch ziemlich jung gewesen sein!«
»Neunzehn, kein bißchen zu jung. Und was für eine Frage: Natürlich heirateten sie, weil sie sich liebten!«
»Natürlich. Sie liebten sich. Seht ihr eurer Mutter ähnlich?«
»Debora«, sagte Tobija, »das sagen alle, die unsere Mutter kannten.«
»Also war sie nicht nur reich und gebildet, sondern obendrein sehr… mh, also, sagen wir, sehenswert?«
»Sie war schön!« belehrte ihn Tobija, dessen Schwester den Kopf plötzlich gesenkt hielt. »Sie war so schön, daß sie unserem Vater auf der Stelle auffiel, als er einmal bis nach Alexandria gelangte! Das Nildelta zählt nicht gerade zu den Fanggründen judäischer Fischer. Die Ägypter würden sich das auch verbitten. Dort muß es ja bunt zugehen. Warst du schon öfter im Delta, Thomas?«
»Oft genug. Aber, wenn nicht als Fischer, wie kam euer Vater nach Alexandria?«
»Ganz einfach: Mit Samuel. Einen Wanderprediger wie Samuel begleiten zu dürfen, gilt als Ehre! Besonders jüngere Brüder und Schwestern aus den Gemeinden möchten mit ihm gehen. Einmal im Leben wollte das auch unser Vater. Er begegnete Samuel, als dieser mit den Fischern von Askalon nach Rapha fuhr. Er hat es uns oft erzählt, wie er durch Samuel auch die reichen Schwestern Eugenios kennenlernte.«
»Als wäre Samuel immer alt gewesen«, meinte Thomas lachend, »heute ist er drei- oder vierundfünfzig, wie er mir erzählt hat.«
Debora war unvermittelt stehengeblieben. Sie sah sich zweifelnd um, schüttelte den Kopf und schlug vor, vom Strand nach Osten abzubiegen und auf der Römerstraße weiterzugehen, die Samuel, wenn er allein unterwegs war, des besseren Schutzes wegen bevorzugte. Außerdem ließe er sich gern von Wagen mitnehmen.
Thomas war einverstanden, zumal sie sich der etwas landeinwärts gelegenen Ortschaft Ashdod näherten und die Sonne längst steil über ihnen brannte. Höchste Zeit, einen Brunnen und Schatten zu suchen und zu rasten.
Auf der Straße hielten sie jedes Wagengespann und jeden Reiter an und fragten, ob ihnen Samuel begegnet wäre? Einer wußte, daß jener sich vor ungefähr zwei Tagen von Joppe südwärts auf den Rückweg nach Askalon gemacht hatte.
»Samuel hatte es nicht eilig, er wollte im Wadi Jamnia Nomaden oder Hirten besuchen, müßte sich jetzt also ebenfalls Ashdod nähern, wenn auch aus entgegengesetzter Richtung.« Als die drei das gehört hatten, beschlossen sie, bei Ashdod unmittelbar an der Straße zu rasten, damit ihnen der Gesuchte ja nicht entginge. Im spärlichen Schatten eines Wacholdergebüschs ließen sie sich im Straßenstaub nieder, tranken ausgiebig, aßen ein wenig und warteten, daß die Sonne den Zenit überschritt. Besorgt beobachteten beide, daß Debora, kaum daß sie sich im warmen Sand ausgestreckt hatte, einschlief. Leise fragte Thomas:
»Macht sie etwa schlapp? Hält sie nicht viel aus?«
Tobija schüttelte nachdrücklich den Kopf:
»Im Gegenteil, sie kann zäh sein wie ein Esel und stundenlang lebendig wie ein Delphin.«
In Wirklichkeit kam es ihm auch merkwürdig vor, und er dachte daran, wie unausgeschlafen und fahrig sie am Morgen gewesen war – und wie aufgeregt sie darum gekämpft hatte, Thomas zu begleiten. Eine Ahnung dämmerte ihm, die er sofort wieder verscheuchte. Wie konnte er Debora verdächtigen? Und hätte sie ein Geheimnis vor ihm verbergen können?
»Laß mich zuerst wachen«, schlug er Thomas vor, »ich kann jetzt nicht einmal dösen, ich bin viel zu gespannt auf Samuel. Er ist unser Vormund, sogar amtlich. Unsere Eltern hatten ihn bald nach Deboras Geburt dazu bestimmt, vorsichtshalber.«
»Auch ich bin zu munter«, gestand Thomas. Sie unterhielten sich leise: »Wie alt ist deine Schwester?«
»Zwei Jahre jünger als ich.«
»Und du bist vierzehn?«
»Nur noch wenige Wochen, auch Debora ist schon eher dreizehn. Wir waren noch nie getrennt. Das stört mich nämlich an der Fischerei: Daß ich meine kleine Schwester so lange allein lassen muß.«
»Aber ihr habt die liebevollsten Pflegeeltern, außerdem ist Debora keine kleine Schwester, sondern bald heiratsfähig.« Tobija lachte.
»Debora eine Frau? Was hast du bloß für Augen?«
Thomas blieb ernst:
»Klare. Du bist ein typischer großer Bruder. Ist ja gut und richtig, daß du sie beschützt. Und wenn du schon fünfzehn bist, wirst du ja auch bald ein Mann.«
»Ich mag solches Gerede nicht. Was interessiert dich überhaupt ihr Alter?« erwiderte Tobija düster.
»Mich interessieren meine Weggefährten, besonders wenn sie so reizend und gebildet sind wie ihr beide. Daß ihr füreinander eintretet, ist verständlich, nachdem ihr die Eltern so früh entbehren mußtet. Ist eure Mutter auch ertrunken?« »Nein. Sie hat Vaters Tod ja noch ein Jahr überlebt, aber frag mich nicht, wie! Kränklich war sie wohl von Anfang an, vielleicht auch nur zu zart für das harte Leben einer Fischersfrau. Die Tanten in Alexandria hatten sie sehr verwöhnt. Weißt du, sie hat viel von ihnen erzählt, denn es war ihr nicht gleichgültig, daß sie sie enttäuscht hatte, mit der Heirat, meine ich. Sie hat buchstäblich alle Brücken nach Alexandria hinter sich abgebrochen, so sehr liebte sie Simon. Kein Wunder, daß die reichen Tanten die junge Erbin verstießen.« Verstohlen musterte Thomas den Jungen neben sich und fragte:
»Findest du das einleuchtend? Hätten die Tanten nicht Verständnis für das junge Paar haben können?«
»Aber er war ein Fischer, Thomas! Kein kultiviertes Heim, keine vornehme Erziehung, keine wirtschaftliche Sicherheit. Er besaß nur ein einigermaßen seetüchtiges Fischerboot und die elterliche Hütte am Strand. Wie sollten die Tanten verstehen, daß Kora dafür alles zurückließ, was sie ihr zu bieten hatten? Ich meine, sie empfanden ihre Kusine Kora als undankbar. Meine Mutter hat es selber so genannt – undankbar!«
»Hat Koras Geschichte nicht auch eine andere Seite?«
»Ja, gewiß, dafür hat sie sich ja entschieden, aber findest du nicht auch, daß man beide Seiten verstehen muß? Einfach abgesprungen, ins kalte Wasser, trotz ihrer Zerbrechlichkeit muß sie eine riesige Kraft in sich gehabt haben. Meinst du nicht auch?«
»Ihr Gewissen«, sagte Thomas.
»Wäre denn jede andere Entscheidung gewissenlos gewesen? Sie war verliebt.«
»Sie liebte, Tobija.«
»Manchmal, stelle ich mir vor, kann Liebe auch ziemliche Verrücktheit sein, eine schöne Verrücktheit meinetwegen. Was aber hat das mit Gewissen zu tun? Ich sehe dir an, was du denkst, Thomas. Du denkst, daß es mir nicht zusteht, die Sache zu beurteilen.«
»Hauptsache, du ver-urteilst nicht, Tobija. Eure Mutter konnte nur einen Weg gehen.«
Tobija nickte, schwieg ein Weilchen, sagte schließlich leise: »Aber wir kommen in ihrer Geschichte auch noch vor. Wir, ihre Kinder.«
»Und Simons Kinder!« mahnte Thomas.
»Jaja, und Simons. Da kommen welche aus Ashdod.«
»Von Süd nach Nord, wie wir. Immer noch kein bißchen müde, Tobija? Gut, dann behalte du die Straße im Auge. Ich strecke mich lieber für ein kurzes Nickerchen aus. Daß der Schatten so schmal fällt, ist nicht meine Schuld. Guck nicht wie ein Geier, ich komm’ ihr schon nicht zu nahe.« Schroff wandte sich Tobija zur Straße um und murmelte etwas, das Thomas, der sich neben die fest schlafende Debora im spärlichen Schatten auf den Boden legte, nicht verstand. Er reckte die Arme hoch, verschränkte die Hände hinter seinem Kopf und schloß die Augen. Still lauschte er Deboras tiefen Atemzügen.
Nördlich von Ashdod querten die Römerstraße zwei Wadis, zu denen die drei jungen Leute wenig später aufbrachen. Statt zu schlafen, hatte Thomas nachgedacht und den Geschwistern erklärt:
»Wenn Samuel Hirten oder Nomaden aufsuchen wollte, müssen wir ab hier in sämtlichen Wadis Bescheid geben, daß wir ihn suchen. Ach, statt zu schwatzen, hätten wir längst einige nordwärts Reitende darauf hinweisen sollen! Kommt, laßt uns das Versäumte nachholen. Notfalls müssen wir, um ganz sicher zu gehen, dort übernachten, wo die Straße auf ein Wadi trifft.«
Debora blieb schläfrig, bis die lehmhellen Würfel der Häuser von Ashdod hinter ihnen im Sonnenglast verschwammen.
»Ich möchte bloß wissen, weshalb du heute so müde bist«, knurrte Tobija, »das bißchen wäßriger Wein gestern abend kann’s nicht sein.«
»So wäßrig war der gar nicht«, behauptete Debora, »außerdem bin ich nicht müde. Habt ihr nicht auch geschlafen?« »Und wie!« schwindelte Thomas. »Da kommen Reiter hinter uns. Anhalten!«
Es war seit Ashdod das vierte Mal, daß sie Reitern ihre Suche nach »dem alten Wanderprediger Samuel« mit auf den Weg gaben.
Als sie schließlich an das erste Wadi gelangten, mußten sie feststellen, daß die Straße über einen Knotenpunkt verlief, an dem sich drei ausgetrocknete Flußbetten mit ihren Geröllmassen zu einem Wadi vereinigten. Unschlüssig blieben die drei stehen. Was war zu tun!
»Genau an diesem Knotenpunkt wollen wir unser Nachtlager aufschlagen und warten«, entschied der erfahrene Bote Thomas, »so oder so müßte Samuel hier vorbeikommen, ob von Norden oder aus einem der Wadis.«
Sie suchten sich unter den im angeschwemmten Geröll herumliegenden Felsbrocken den größten aus. In seinem kargen Schutz und Schatten wollten sie lagern und dort die nötigen Äste für ein Feuerchen zusammentragen. Tobija kletterte auf den Felsbrocken, um sich einen Überblick zu verschaffen. Er beschattete seine Augen mit der flachen Hand, plötzlich rief er:
»Zurück, Thomas! Zur Straße! Ich sehe ihn kommen!« Und er streckte seinen Arm nach Norden aus.
Sie ließen ihre Vorratsbeutel bei dem großen Stein liegen und liefen an den Straßenrand. Ja, er war es, auch Debora erkannte von weitem die schmale Gestalt mit dem mannshohen Wanderstab.
Samuel ging in weiße und rote Stoffbahnen gehüllt, die er wie einen losen Umhang auch über seinen Kopf zu ziehen pflegte. In seinem Alter war das nützlich bei jedem Wetter, hielt ihm brennende Sonne ebenso vom Leib wie Nässe, Kühle oder Wind. Sein spärliches Gepäck trug er in Beuteln unter der leichten Stoffülle seines Umhangs. Aber er ging nicht wie ein alter Mann, sondern hochaufgerichtet und zügig wie in Eile. Er mußte von Reitern gehört haben, daß man nach ihm suchte.
»Er ist allein«, sagte Debora leise und lief ihm entgegen. Sie sah deutlich sein Erschrecken, als er sie erkannte. Aber sie lachte und winkte und rief schon von weitem: »Friede, Friede! Fang mich auf, Samuel, halt mich fest!«
Er blieb stehen und öffnete weit seine Arme, in die sie sich lachend stürzte und zur Begrüßung sein silberstoppeliges Gesicht küßte: »Friede mit dir, Samuel. Und keine Sorge! Wir wollten dem Boten aus Alexandria nur den Weg zeigen.«
Samuel drückte sie sanft an sich, strich ihr über das dunkle Haar und fragte:
»Ist es Thomas? Er ist kein Anfänger auf dem römischen Straßennetz, da muß euch schon eine besondere Neugierde plagen! Sagtest du, aus Alexandria? Etwas Ernstes?«
»Ein Brief. Gestern abend traf Thomas damit bei uns ein und wollte heute gleich weiter. Er ist nett. Kennst du ihn schon länger?«
Debora ging neben Samuel, der sie von der Seite lächelnd musterte.
»Daß er sehr nett ist, weißt du ja schon – was könnte ich dir also noch über ihn verraten?«
»Später«, sagte sie hastig, weil die beiden jungen Männer sich näherten und den viel älteren respektvoll begrüßten. Samuel hielt Tobijas Hand kurz fest und fragte:
»Wolltest du nicht längst bei den Fischern sein?«
»Hätte ich meine Schwester allein mit einem Fremden gehen lassen sollen? Die Fischer schwimmen mir ja nicht fort.« Samuels Blick schien sich zu verdunkeln, aber dann fuhr er dem hitzigen Jungen mit der Hand beschwichtigend über den lockigen Schopf und wandte sich lächelnd Thomas zu: »Ein guter Platz für ein Nachtlager.«
Debora ließ die beiden Männer nicht aus den Augen. Auf einmal fühlte sie sich unbehaglich. Was sollte sie tun, wenn Samuel bemerkte, daß an dem Briefsiegel hantiert worden war? Samuel zu belügen, das würde sie nicht fertigbringen.
Sie durfte sich kein Wort, keinen Blick entgehen lassen. Im Augenblick war ihr das wichtiger als der sicher folgenschwere Briefinhalt.
Thomas, der seine Botentasche die ganze Zeit bei sich getragen hatte, reichte sie Samuel halb offen und sagte:
»Außer einem Brief auch Geld, einfach eine Handvoll in die Tasche geworfen, nicht gezählt. Ich habe davon nur das Nötige für die Schiffspassage bis Gaza genommen. Von dort bin ich gestern gleich weitergelaufen und kam abends in Askalon an.«
»Ein Brief von den Schwestern Eugenios also?«
»Nicht von beiden Schwestern, nur von Angela. Obendrein in größter Hast und Heimlichkeit. Sie war verschleiert, aber ich erkannte sie.«
Ruckartig blieb Samuel stehen und fragte, plötzlich heiser: »Nur von Angela? Heimlich? Bist du sicher, daß Agatha nichts davon weiß?«
»Ganz sicher.«
»Gib mir den Brief!« Sie hatten den Lagerstein noch nicht ganz erreicht. Samuels Hände zitterten, als er die Papyrusrolle aus der Hand von Thomas nahm. Er verschwendete nicht ein Sekunde daran, das Siegel zu prüfen. In höchster Ungeduld riß er es einfach ab, ließ es achtlos auf den sandig-steinigen Wadigrund fallen und rollte den Papyrus mit gestreckten Armen vor seinen Augen auf. Debora, erlöst und dankbar, stand halb hinter Samuel und starrte auf die griechischen Buchstaben, die in so ungewohnter Sprache redeten. Plötzlich begann die Schrift vor ihr auf und niederzutanzen, aber nicht ihre kurze Schwäche war daran schuld, sondern das Zittern von Samuels Händen, während er mit sichtlich wachsender Erschütterung den Brief las. Mit Schrecken sah Debora, wie sich der große, kluge, allzeit gefaßte, stets Trost wissende Mann vor ihren Augen in ein Häufchen Elend verwandelte und auf dem Stein, zu dem sie ihn geführt hatte, in sich zusammensank. Und zum ersten Mal sah sie Samuel weinen. Die Tränen quollen über seine staubigen, braunen Wangen, versickerten in Falten und Barthaaren, und er tat nichts, um sie zu verbergen, als wüßte er nicht einmal, daß er weinte. Debora legte sanft ihre Hand auf sein Knie, aber sie wußte nicht, wie sie ihn trösten könnte. Wenn er doch selber keinen Trost wußte, er, Samuel!
Daß auch sie weinte, merkte sie erst, als er den Papyrus sinken ließ und die Hand nach ihr ausstreckte, um ihr die Tränen vom Gesicht zu streicheln.
»Ist es so schlimm?« stammelte sie.
»Sie ist tot«, flüsterte er schluchzend, »ich weiß es. Tot!« Er schloß die Augen, und Debora fürchtete, er könnte hintenüber vom Stein stürzen. Kaum hörbar bat er:
»Laß mich allein, Kind. Nur ein Weilchen.«
»Ja, Samuel.«
Sie stand auf, um das Nötigste für ein Nachtmahl vorzubereiten. Und während der geübten Handgriffe kam ihr Verstand wieder in Gang, und sie dachte: Wie kann eine Tote einen Brief schreiben, ihn sogar noch auf den Weg bringen? Wie sehr muß Samuel jener ihr so fremden Frau verbunden sein, daß er ihren Tod über solche Entfernung hinweg erraten, ja spüren kann? Kann Liebe so machtvoll sein? Also mußte auch er Angela lieben. War es das, was Samuel so erschütterte? Das Geständnis ihrer Liebe zu ihm. Samuel weinte noch immer. Er saß jetzt vornübergebeugt auf dem Stein, das Gesicht in beide Hände vergraben. Der Anblick seines Schmerzes tat ihr weh.
Tränenblind tastete sie nach Steinen für die Feuerstelle. Dabei merkte sie nicht, daß Thomas mit einem Bündel trockener Äste und angeschwemmter Holzstücke neben sie trat. Sie schrak auf, als sie ihn leise fragen hörte:
»Ist es eine so böse Nachricht?«
Gleichfalls mit Brennholz beladen, kam von der anderen Seite Tobija. Auch er wagte kein lautes Wort:
»Was ist passiert?«
Debora wischte sich mit dem Saum ihrer wadenlangen Tunika Augen und Wangen trocken und flüsterte:
»Ihr seht ja, wie weh es ihm tut. Er sagte: Sie sei tot! Aber kann eine Tote einen Brief schicken? Es muß noch etwas anderes sein…«
»Soll ich zu ihm?« fragte Thomas.
»Er wollte allein sein. Er wird sich selber rühren. Legst du das Feuer, Thomas?«
»Erst wenn es dunkel wird. Es ist noch zu früh.«
»Wer ist tot?« fragte Tobija.
»Unsere Tante Angela, der Brief ist von ihr. Aber sie hat ihn dir doch gegeben, Thomas?«
»Ja, allerdings unter merkwürdigen Umständen, völlig anders als sonst.«
»Du warst schon öfter bei ihnen?«
»Ja, seit ich Kurier bin, nutze ich in Alexandria jede Gelegenheit, mich an der Katechetenschule zum Diakon ausbilden zu lassen. Mit Botengängen wie diesem verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und von Brüdern wie Samuel lernte ich mindestens so viel, wenn nicht mehr…«
»Ich hole noch Holz«, sagte Tobija, der lieber etwas Handfestes tat, als die ungewisse Beklommenheit abwartend auszuhalten. »Soll ich auch einen Feuerstein suchen?«
»Nein, den trage ich immer bei mir.«, Thomas nestelte an einem der Ledersäckchen am Gürtel seiner kniekurzen Tunika. Als Tobija sie nicht mehr hören konnte, sagte Debora scheinbar nachdenklich:
»Da Tante Angela dir den Papyrus heimlich gab, sollte ihre Schwester Agatha nichts davon wissen. Also muß sie mit Samuel Geheimnisse haben, wenigstens ein Geheimnis. Und ihm tut es weh…«
Sie blickte erwartungsvoll auf Thomas, der im Sand kniete und umständlich mit seinem Feuerstein hantierte.
»Ist Samuel ihr besonderer Vertrauter?«
Thomas lächelte, als er antwortete:
»Ach, liebe Debora, was du wissen möchtest, ist die immer gleiche herrliche Geschichte zwischen zwei Menschen. Eure Tante Angela hatte vermutlich nicht so absolutes Vertrauen wie eure Mutter.«
»Vertrauen worauf?«
Thomas deutete mit dem Kopf vielsagend zu Samuel, dann nach oben in den Himmel.
»Woher willst du das wissen, Thomas?«
Er zuckte die Achseln, überlegte eine Weile und blickte das Mädchen offen an:
»Mein Dienst verläuft nicht so einsam, wie du vielleicht denkst. Man trifft andere Boten, nicht nur Auftraggeber und Empfänger. Da wird alles mögliche gesprochen und erzählt. Außerdem… still jetzt, Samuel steht auf. Du wirst ihn nicht mit Fragen durchbohren?«
»Bin ich ein Plappermäulchen, großer Redemeister? Kannst du nun Feuer schlagen oder nicht?«
Sie flüchteten sich in scheinbare Geschäftigkeit, als Samuel endlich seinen Wanderstab aufhob, die verrutschten Tücher über seine Tunika ordnete und zu ihnen herüberkam. Einem Mann wie Samuel, der sein Leben damit zubrachte, sich stets und ganz seinen Mitmenschen zuzuwenden, entging ihre Verlegenheit nicht. Mit beiden Händen umklammerte er seinen stabilen Wanderstab und lehnte sich gegen den großen Felsbrocken, von dem aus Tobija ihn vorhin erspäht hatte.
»Ruft den Jungen zurück«, bat er, »für ein erstes Feuer reicht das Gesammelte. Ich kann nicht die ganze Nacht bleiben. Auf dem schnellsten Weg muß ich nach Alexandria.«
»Und wir?« fragte Debora erschrocken.
»Ach ja, ihr! Das muß in Ruhe bedacht werden, ob ich euch jetzt schon mitnehmen soll…«
»Du wirst doch nicht diese Kinder nach Alexandria mitnehmen wollen?«
»Bist du vielleicht ein Greis?« ereiferte sich Debora, »ich werde dreizehn! Außerdem hat Samuel über uns zu entscheiden. Steht in dem Brief, daß du uns nach Alexandria mitnehmen sollst?«
»Und wenn, so dürfen wir nichts überstürzen. Wir haben alle einen langen Tag hinter uns. Bevor ich aufbreche, muß ich ein paar Stunden schlafen.«
»Wir lassen dich nicht allein aufbrechen, bis Askalon begleiten wir dich.«
Sie packten Brot, Käse, getrockneten Fisch und Fleisch, Eier und verschiedene Früchte aus und lagerten im noch warmen Sand. Bevor Samuel, der kaum etwas aß, irgendeine Erklärung gab, wollte er von Thomas mehr wissen:
»Bitte berichte mir ganz genau, wie es war, als sie dir den Brief gab. Jede scheinbare Nebensächlichkeit ist mir wichtig.«
»Ja, das war in der Tat höchst ungewöhnlich«, begann Thomas: »Ich war wie jedesmal im reichen Haus Eugenios eingekehrt, um Botschaften, Spenden, Briefe, Kollekten mit auf den Heimweg nach Judäa zu nehmen. Durch den Pförtner hatte ich den Damen Bescheid geben lassen. Er sagte, ich müsse mich gedulden, Agathas Einkäufe pflegen Stunden zu dauern! Und die andere der beiden Schwestern, die Dame Angela, könne mich kaum empfangen. Sie sei wieder einmal krank, ›das Übliche‹…«
Thomas unterbrach sich, blickte fragend auf Samuel, der noch immer am Felsbrocken lehnte, den Wanderstab so fest in beiden Fäusten, daß seine Fingerknöchel weiß hervorstachen. Mit leerem Blick nickte er schwer und sagte wie zu sich selbst:
»Das Übliche! Ihr empfindlicher Magen… die dunkle Schwermut ihres Herzens… und wie ging es weiter?«
»Der Pförtner schickte mich in die Gesindeküche, wo ich bei einer guten Mahlzeit Agathas Rückkehr vom Markt abwarten sollte. Noch auf dem Weg dorthin holte eine dunkle Sklavin mich ein…«
»Monika, Angelas Vertraute«, Samuel war ganz gespannte Aufmerksamkeit. »Und?«
»Schon daß sie nur flüsterte, fiel mir auf. Ich sollte ihr lautlos folgen, am besten unsichtbar! Sie führte mich in das abgedunkelte Zimmer ihrer Herrin Angela.«
»Angela lag auf dem Bett? Am hellichten Tag!«
»Ja, die Fenster waren verhangen, obendrein hielt sie sich verschleiert. Sie bestand darauf, daß ich mich dicht zu ihr setzte, auf den Bettrand. Dann zog sie unter den Decken und Kissen den Brief an dich hervor und aus einem Kästchen neben ihrem Lager eine Handvoll Münzen. Beides steckte sie hastig in meine Kuriertasche.«
»Sprach sie mit dir? Wart ihr allein?«
»Die Sklavin mußte an der Tür wachen, konnte aber alles sehen und hören.«
»Gut zu wissen«, sagte Samuel vor sich hin, »Angela kann sich also vollkommen auf Monika verlassen.«
»Mir schien«, fuhr Thomas fort, »als hätten die beiden das heimliche Treffen regelrecht geplant. Angela sprach nur wenig und ohne jede Kraft. Schon die paar Worte strengten sie an. ›Bring es nach Askalon zu Bruder Samuel, bitte gleich! Nimm notfalls eine Schiffspassage. Und Vorsicht! Von dem Brief und dem Geld – nichts davon meiner Schwester verraten: Verlaß am besten gleich wieder das Haus. Eine Ausrede für den Pförtner… bitte…‹ Sie konnte wirklich kaum noch reden. Ich versprach ihr, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, ich würde sofort weiterziehen. Sie muß wohl starke Schmerzen gehabt haben. Sie krümmte sich, preßte die flache Hand gegen den Leib und stöhnte. Samuel! Ist dir nicht gut?« Dem alten Mann schienen die Knie zu versagen, doch er blieb aufrecht und fragte heiser:
»Was dann?«
»Zurück ans Tor fand ich allein, war ja nicht zum ersten Mal in dem vornehmen Haus. Dem Pförtner sagte ich, ich hätte es mir anders überlegt, ich könne nicht so lange warten, bis die Dame Agatha vom Markt zurückkäme, ich hätte mich mit Schiffsleuten verabredet, die jede Stunde den Hafen verlassen würden.«
»War er mißtrauisch?«
Thomas schüttelte den Kopf:
»Kann ich nicht sagen. Es lenkte ihn gerade ein Lieferant vom Hafen ab, den Agatha geschickt hatte, mit angeblich frischen Meeresfrüchten: Krebstieren, Muscheln, Tintenfischen…«
Diesmal unterbrach Tobija den Erzähler:
»Warum nennst du sie ›angeblich frisch‹? Kannst du das beurteilen?«
»Man muß kein Fischer sein, mein Lieber, um zu erkennen, wie lange ein Fisch schon tot ist!«
»Angelas Lieblingsspeisen«, hörten sie Samuel sagen, »ihre Schwester Agatha meinte es gut mit ihr und verwöhnte die Ältere.«
»Also, ich hätte das Zeug nicht mehr gegessen!« gestand Thomas, »selbst der Pförtner rümpfte die Nase, aber er mußte die Ladung durchlassen, schickte den Lieferanten in die Küche.«
»Ist Tante Agatha geizig?« fragte Debora. Mit einem Blick auf Samuels aschfahles Gesicht entschuldigte sie sich: »Verzeih bitte, du hast jetzt wichtigere Sorgen.«
»Ja, Kind, wie ich nach Alexandria komme!«
Thomas schüttelte seine Botentasche, daß die Münzen darin klirrten und sagte:
»Damit bringen dich die Fischer von Askalon sogar bis ans Nildelta! Dort hat längst die Nilschwemme begonnen.«
»Reicht es auch für uns beide? Du wolltest doch nach Jerusalem, zu deinen Eltern?«
»Ich konnte mich seit Monaten nicht mehr um sie kümmern!«
Samuel nickte. Er schlug vor, erst einige Stunden zu schlafen.
»Dann werden wir weitersehen.«
Die Nacht kam rasch und kühl.
Verschiedene Wege
Die drei Männer teilten sich die Nachtwache. Debora und die beiden jeweils Schlafenden lagen dicht beieinander in hastig gegrabenen Sandwannen zwischen dem großen Lagerstein und dem klein gehaltenen Feuer, das Raubtiere auf Distanz halten sollte: Schakal und Hyäne, aber auch Skorpione.
Über die Judäischen Berge stieg der fast volle Mond mit seinem bleichen Licht unter dem wolkenlosen Sternenmeer auf, das Nacht und Erde färbte.
Die vier Menschen hatten sich beim bereits schwindenden Tageslicht zur Ruhe gelegt. Debora war als erste eingeschlafen, tief und traumlos wie schon während der Mittagsrast. Plötzlich, als legte sich in ihr eine Spannung auf die Lauer, wurde sie durch irgendwas geweckt. Blinzelnd lauschte sie in die Stille. Sie hörte Samuel aufstehen und Thomas, der sich in seine Sandkuhle legte, bald darauf tief und gleichmäßig atmen. Hellwach richtete sie sich halb auf. Seinen Stab in der Hand stand Samuel auf der anderen Seite des Feuers, mit dem Rücken zu ihr. Debora wartete, bis Samuel sich auf einen flachen Stein niederließ, dann reckte und schüttelte sie sich, fuhr sich mit den gespreizten Fingern mehrmals durch ihr dunkles Haar und ging vorsichtig um das Feuer herum.
»Darf ich mich zu dir setzen, Samuel?« flüsterte sie.
»Gern, Debora, gern.«