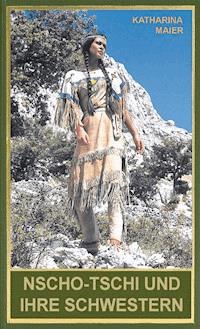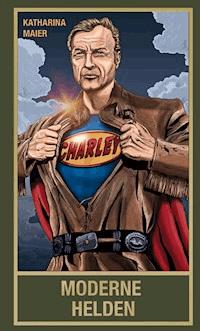Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Erste Tochter
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen erkennt, dass sie fliegen möchte und nicht darf: Myn wächst auf einem Planeten auf, über dem Raumschiffe fliegen und auf dem Väter das letzte Wort haben. Sie kann immer nur das, was Mädchen nicht können sollen. Trotzdem verlebt die Adelstochter eine unbeschwerte Kindheit mit einer eigenwilligen Mutter, einem schöngeistigen Vater und einem großen Bruder, der sie anspornt, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen. Ihre scheinbar heile Welt erhält Risse, als der aufwieglerische Asnuor zum Obersten Priester ernannt wird. Weshalb fällt das ganze Volk vor einem solchen Ehrgeizling auf die Knie? Warum schmiedet Myns Mutter Pläne hinter verschlossenen Türen? Und was hat das alles mit Myn und ihrem Bruder Vairrynn zu tun? In 7 Bänden erzählt "Die Erste Tochter" von Intrige, Leidenschaft, Liebe, Freundschaft, Hass, einer fremden Welt und von einer Frau und drei Männern, die diese Welt für immer verändern. Doch eigentlich will Myn vor allem eins: ihre eigene Freiheit, von der sie in "Adelsspross" gerade erst begreift, dass sie sie gar nicht hat. Ein Planet. Eine Frau. Ein Kampf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE ERSTE TOCHTER
Zukunftsepos von Katharina Maier
INHALT
Widmung
Prolog
Familie
Sturmzeit
Abweichler
Übertritt
Splitter
Kaffee
Verquickungen
Rauch
Vipern
Katastrophe
Wer ist wer
Was ist Was
DIE ERSTE TOCHTER
Impressum
WIDMUNG
Für Mama, mit den Sternen in ihrem Geist
Für Lisa, mit den Drachen in ihrem Herzen
Für Oma, die Myn ihre Stärke gab
Diese Welt wäre nicht, was sie ist, ohne euch
PROLOG
Es heißt, ich bin das unausweichliche Ende einer jeden Geschichte, doch diese eine begann mit mir. Sie hat mich hierhergeführt, in diese vielgestaltige Stadt, recht unerwartet, möchte man meinen. Natürlich bin ich immer hier, überall, auch jetzt. Ich streife durch die Stadt, und der whiskeyselige Mann unter der Turmbrücke geht wie zufällig mit mir. Im Operationssaal, wo die Ärzte mit mir ringen wie Jakob einst mit seinem Herrn, ein alter Kampf, den ich mit weit weniger Leidenschaft zu führen pflege als sie, hält mich der Patient unter ihren Messern für einen Tunnel aus Licht. Das tun sie oft. Das großäugige Kind auf dem Rücksitz der Flugmaschine winkt einem Gerippe im schwarzen Mantel zu, das ein wenig aussieht wie sein Großvater. Das Kind lacht mich an. Das tun sie selten.
Ich bin hier. Doch schon lange kam ich nicht mehr als die Alte, die Dunkle, die Mutter. Bis jetzt, da eine Frage gestellt wurde, die mich gerufen hat. Draußen vor den verspiegelten Fenstern zerteilt der Fluss gezeitenatmend die Stadt, und drinnen steht die Frage breit und schwer zwischen einem Mann und einer Frau und verlangt nach Antwort.
»Sie wollen es wirklich wissen?«, fragt die Frau nach. Schon jetzt sieht sie müde aus. Vielleicht weiß er sogar, was er da von ihr verlangt. Doch gegen die erste Sünde der Menschheit ist auch er nicht gefeit. Die Angst vor den Worten sitzt ihr im Nacken, aber sie kann sich dem Drängen in den fremdartigen Augen nicht verschließen. Draußen singt der große Glockenturm sein immer wiederkehrendes Loblied auf die Zeit. Die beiden hören es nicht.
»Bitte«, sagt er, als ihr Schweigen die Überhand zu gewinnen droht. »Erzählen Sie es mir.«
Aber wie kann sie das? Sie weiß nicht, wie es begann. Denn am Anfang war der Tod – der Tod und eine plötzliche Anwandlung von Selbstsucht, wie sie mir zugegebenermaßen nicht gebührt. Aber da stand ich, am Anfang, und hielt ein kleines Seelenlicht in meinen Händen. Es war ein junges, unbekümmertes Lichtchen, kaum dem Mutterschoß entsprungen. Manche gehen, bevor sie richtig angekommen sind. Es liegt nicht an mir, dies zu entscheiden, ich lasse es nur geschehen. Doch das Seelenlicht strahlte mich an, warm und silberhell, und ich formte fest und klar das Nein. Ich konnte es nicht gehen lassen. Ich wollte es nicht gehen lassen. Und so schloss ich die Hände um das silberhelle Seelenlicht und beanspruchte es für mich. Dieser hier war mein. Einen Lidschlag nur stockte die Zeit in ihrem Fluss, und das Gewebe dehnte sich, ohne zu reißen. Ohne Chaos keine Ordnung. Jede Regel hat ihre Ausnahme. Selbst diese. Und so hauchte ich mein Seelenlicht zurück, und ein helles graues Augenpaar ging auf und blickte verwundert in die Welt.
FAMILIE
An dem Abend, da die Alte in mein Leben trat, las ich ein Buch, obwohl ich eigentlich hätte sticken sollen. Wie so oft im Herbst auf Singis, in der Sturmzeit, wie wir sagen, heulte der Wind um das Haus und ließ die Fensterschilde knistern. Meine Mutter und ich saßen am prasselnden Kamin und gaben ein Tableau gut-singisischer Häuslichkeit, zumindest bis zu dem Moment, da ich kapitulierte und meinen Stickrahmen gegen ein zerlesenes Buch austauschte, voller Legenden über Götter und Geistwesen und solche, die beides waren.
Meine Mutter webte gerade an einem Teppich, auf dem in einem Tanz von Licht und Schatten der Triumph des allmächtigen Wy über den Göttlichen Gegner Form annahm, und tat so, als würde sie meinen kleinen Akt des Ungehorsams nicht bemerken. Auch von meinem Vater drohte mir im Moment keine Rüge. Er saß bei meinen beiden Brüdern an dem schweren, dunklen Holzsteintisch gegenüber dem Kamin und legte gerade letzte Hand an eine zierliche Figurine. Um ihn herum hätte also gerade das Singisische Reich untergehen können, ohne dass er mit der Wimper gezuckt hätte. Die Weigerung seiner Tochter, ihr Geschick in Handarbeiten zu vervollkommnen, wie es sich für ein Mädchen aus gutem Hause gehörte (ganz besonders, wenn es um dieses Geschick derart düster bestellt war wie um das meine), war sicher nicht dazu geeignet, die Aufmerksamkeit meines Vaters von seinem kleinen Kunstwerk abzulenken.
Mein Vater, Eftnek Neoly, war Holzsteinschnitzer, und er war einer der besten. Davon zeugten die kleinen Statuen in den Winkeln des Zimmers, in jeder der acht Ecken zwei, je eine aus hellem und eine aus dunklem Holzstein. Unschwer war zu erkennen, dass die Liebe zu Legenden und Märchen in der Familie lag. An unseren Wänden wachten nicht hochgereckte Statuen von Gründervätern, sondern die sagenumwobenen Chyndrai: Neckische Wassergeister und flackernde Feuerfrauen verschlangen sich ineinander, Himmelstöchter hoben ihre ätherischen Arme gegen die Decke, als wollten sie nach den Sternen greifen, und Erdgeister formten sich selbst aus den Gebeinen der Welt. Zusammen mit Mutters zartgewebten Seidenteppichen verliehen die Figuren unserem kleinen Familienzimmer einen Hauch von Anderweltlichkeit, ganz so, als hätten die Chyndrai selbst es berührt – so zumindest sagte ich, wenn meine Fantasie einmal wieder Kapriolen schlug. Mein kleiner Bruder Mudmal pflegte dann die Augen zu verdrehen wegen seiner albernen Schwester, was er sehr oft tat und sehr theatralisch, damit auch ja niemand auf die Idee kam, er könnte mit meiner Torheit irgendetwas gemein haben. Aber damit konnte ich umgehen. Das war normal. Nicht normal war, dass mein großer Bruder mich bei solchen Gelegenheiten mit glitzernden Augen ansah, mich eine kleine Poetin nannte und mir heimlich eine Memofeder und Speicherpapier in die Hand drückte, damit ich aufschreiben konnte, was mir durch den wirren Kopf ging. Natürlich überforderte er mich damit heillos, aber das schien er nicht einzusehen.
Vairrynn. Ich zählte damals neun Jahre, mehr als genug, um zu verstehen, dass mein großer Bruder … anders war. Da diese Andersartigkeit aber dazu führte, dass er mich behandelte, als wäre ich so viel wert wie er, akzeptierte ich sie dankbar, ohne mir allzu sehr den Kopf darüber zu zerbrechen. Immerhin waren wir eine Künstlerfamilie, und da war für jemanden wie Vairrynn allemal der richtige Platz. Das glaubte ich.
An jenem Sturmzeitabend las ich also von den Irrungen und der Glorie der Chyndrai, als die Türglocke durchdringend durch das Haus hallte. Wir alle zuckten zusammen wie ertappte Missetäter. Selten kam jemand unangemeldet zu dem Holzsteinschnitzer Neoly, und schon gar nicht zu so später Stunde, es sei denn, dieser Jemand war mein Großvater. Und die Besuche des alten Patriarchen bei seinem Erstgeborenen waren selten friedvoll.
»Würdest du wohl in nächster Zeit an die Tür gehen?«, fragte mein Vater nach einem Moment und beugte sich wieder über seine Figurine. Die Frage war an mich gerichtet; da Dlindgy, unser Mädchen für alles, heute ihren freien Abend hatte, war es meine Aufgabe, die Tür zu öffnen. Seufzend legte ich mein Buch aus der Hand und machte mich auf den Weg. Ich meine das, wie ich es sage, denn um vom Familienzimmer, das auf den Garten hinauszeigte, zur Vordertür zu gelangen, musste ich fast durch das ganze Haus, und es war ein großes Haus.
Als sein Ältester es sich in den Kopf gesetzt hatte, nach seiner Heirat nicht im Stammsitz der Familie wohnen zu bleiben, hatte der alte Neoly getobt, zumindest den stetig wiederholten Berichten meiner zahlreichen Großtanten zufolge; aber er hatte sich nicht lumpen lassen wollen und seinem Sprössling eines seiner spatiösen Küstenhäuser als Hochzeitsgeschenk verpasst. Schließlich sollte der Erste Sohn einer Großen Alten Familie wenigstens standesgerecht leben, wenn er es schon nicht unter dem Dach seiner Vorväter tat. Und so hallte die Glocke noch mehrmals durch die weiten Räume, ehe ich, leise vor mich hin schimpfend, die Tür erreicht hatte und endlich unserem späten Besuch öffnen konnte. Der Besuch war nicht mein Großvater.
Vor unserer Tür stand eine kleine, rundliche Frau in einem reichbestickten, dunkelblauen Kleid und einem grauen Kapuzenumhang. Mir, dem neunjährigen Kind, kam sie uralt vor. So viele Runzeln und Falten durchzogen das breite Gesicht, dass keine Charaktereigenschaft es besonders gezeichnet zu haben schien. Ihr Haar, zu einer komplizierten Hochfrisur aus unzähligen Zöpfen aufgesteckt, war schneeweiß. In ihrer knochigen Hand hielt die Alte einen knorrigen Stab. Er war aus Holz, noch dazu aus dunklem Lkholz. Nichts auf Singis ist heiliger. In dem breiten Knauf, auf den die Fremde fast liebevoll ihre Hand gelegt hatte, war das Antlitz einer Frau eingeschnitzt, die eine Ährenkrone im geflochtenen Haar trug.
Es hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre vor der Alten auf die Knie gefallen. Ich wusste sehr wohl, wer und was sie war; zu oft hatte ich sie auf der Holographischen Wand gesehen und mir von meinem großen Bruder ihre Position erklären lassen müssen. Aber ich verstand beim besten Willen nicht, was sie hier vor unserer Haustür tat.
Ich wäre wohl bis ans Ende der Zeit dagestanden, hätte die Alte nicht ihre dunklen Augen zusammengekniffen und mit krächziger Stimme gefragt: »Hast du nun genug gesehen, Mynrichwy Neoly? Darf ich eintreten?«
Mein Name aus dem Mund der Alten holte mich aus meiner Erstarrung. Eilig murmelte ich eine Begrüßung, wobei mir siedendheiß einfiel, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich sie anzureden hatte; wahrscheinlich blamierte ich meine Familie gerade bis auf die Knochen. Doch die Alte lachte nur gackernd und rauschte an mir vorbei. Restlos verwirrt eilte ich ihr hinterher, um wieder zu ihr aufzuschließen und sie in die Empfangshalle zu führen. Dann huschte ich, so schnell ich konnte, zurück ins Familienzimmer.
»Nun, wer ist es?«, fragte mein Vater, als ich den Kopf zur Tür hineinstreckte. Ich schluckte, weil ich plötzlich befürchtete, er würde mir nicht glauben.
»Die … die Erste Dienerin der Lchnadra, Vater.«
Meinem kleinen Bruder fiel die Kinnlade herunter, aber sonst wirkte niemand auch nur im Entferntesten befremdet, dass das Oberhaupt des Ordens der Großen Göttin unserer kleinen Familie einen abendlichen Besuch abstattete. Vater legte bedächtig sein Werkzeug aus der Hand und tauschte einen Blick mit Mutter, der Bände sprach, auch wenn die in einer Sprache geschrieben waren, die ich nicht verstand. Vairrynn lächelte, und ein seltsames Glänzen war in seinen hellen Augen. Raubtieraugen haben wir Singisen laut den Terranern, und wann immer sich dieser Ausdruck in das Gesicht meines Bruders stahl, verstand ich ein wenig, warum sie das behaupteten.
»Dann wollen wir die Ehrwürdige nicht warten lassen«, meinte mein Vater mit schwerer Ironie in der Stimme, die ich heraushörte, aber nicht deuten konnte. Ich sehnte mich danach, mit Vairrynn zu reden, damit er mir erklären konnte, was das alles sollte, aber er folgte Vater und Mutter wie ein Schatten, und Mudmal und ich zuckelten hinterher, in nagender Neugier vereint.
Es dauerte eine Weile, bis wir die Erste Dienerin in dem Wald von Statuen fanden, die unsere Empfangshalle bevölkerten. Der weite Saal mit der hohen Decke, den filigran gravierten Säulen und geschliffenen Fenstern war eines Patriarchensohns durchaus würdig, ließ aber gleichzeitig keinen Zweifel an Eftnek Neolys Künstlertum. Die Erste Dienerin der Lchnadra stand vor einer Statue, die die Frau eines von Vaters Freunden darstellte, die kurze Zeit zuvor an dem Biss einer Kachta gestorben war. Ich hielt sie für eine von Vaters wehmütigsten Schöpfungen, eine durchscheinend zierliche Frau, die zusammengekauert auf einem bizarr geformten Felsen saß, das lange, aufgelöste Haar wie ein Schleier über dem Gesicht, mit bloßen Füßen und gekrümmten Zehen. Die Erste Dienerin betrachtete die Statue mit wiegendem Kopf.
»Wirklich, Eftnek«, sagte sie und schnalzte mit der Zunge. »Du wirst immer besser.«
Mein Vater verschränkte die Arme vor der Brust. »Was willst du?«
Die Alte kniff ein Auge zusammen und schielte zu ihm hinauf. Dann hob sie blitzschnell den Stab mit dem eingravierten Göttinnengesicht und rammte ihn meinem Vater auf den Fuß.
»Eftnek Neoly!«, krächzte sie. »Freu’ dich gefälligst, dass ich da bin!«
Ich weiß nicht, was mich mehr schockierte: der Umgang der Alten mit einer der kostbarsten Reliquien des Reiches oder mit meinem Vater. Frauen, die so mit einem Mann umsprangen, existierten in meinem Weltbild nicht.
»Also, was ist jetzt?«, fragte die Alte. »Wollen wir hier weiter rumstehen oder bietet ihr mir endlich eure Gastfreundschaft an? Wenigstens von dir hätte ich bessere Manieren erwartet, Lys. Du könntest mir zumindest meinen Mantel abnehmen, während dein Gatte hier dabei ist, seinen Fuß zu bedauern. Der soll froh sein, dass er den Stab nicht ganz woanders hingekriegt hat. So was von einer Unhöflichkeit! Hast du vergessen, wer ich bin, Junge?«
Und so kam Jorngiss, die Erste Dienerin der Lchnadra, über uns wie eine Naturgewalt. Nachdem mein Vater sich zähneknirschend entschuldigt, Mutter die Alte in aller Form in unserem Haus willkommen geheißen und wir Kinder eine ausgiebige Inspektion aus den kleinen, dunklen Augen über uns hatten ergehen lassen, wurde das Ordensoberhaupt ins Familienzimmer geführt, und der Abend nahm seinen Verlauf, als wäre nur eine meiner Großtanten zu Besuch gekommen. Mutter zauberte aus dem Nirgendwo ein paar Delikatessen, und die Alte ließ sich abwechselnd darüber aus, wie wunderbar wir Kinder geraten seien und wie stolz sie auf Vater sei, der mit seiner Kunstfertigkeit, wie sie bestimmt behauptete, völlig aus der Neoly-Art geschlagen sei.
Irgendwann schaffte ich es schließlich, meinen großen Bruder an den Kamin zu zerren, und zischte flüsternd: »Also, Vai, raus mit der Sprache! Warum besucht uns bitte schön die Erste Dienerin der Lchnadra und benimmt sich wie eine alte Tante?«
Die grauen Augen sahen mich erstaunt an. »Na, weil sie genau das ist, Myn. Jorngiss ist Großvaters Schwester. Sag bloß, das wusstest du nicht!«
Nein, das hatte ich tatsächlich nicht gewusst. Mit offenem Mund starrte ich ihn an. Das Oberhaupt des Lchnadra-Ordens, die einzige Frau in der Runde der Berufenen, war eine Neoly?
»Warum habe ich sie dann nie zuvor in der Familie gesehen?«, fragte ich, als wollte ich ihn einer Lüge überführen. Es wäre nicht typisch für ihn, aber vielleicht machte er sich ja lustig über mich.
»Nun ja, weil die Dienerinnen der Lchnadra im Grunde, wenn sie in den Orden eintreten, sämtliche Familienbande lösen und von da an ganz der Göttin angehören. Aber anscheinend nimmt sich ihr Oberhaupt einige Freiheiten heraus.«
»Warum weißt du solche Sachen nur immer?«
»Ich frage. Und ich höre zu.«
Ich seufzte. Es stimmte; Vairrynn stellte viele Fragen und die richtigen. Fakt war aber auch, dass sie seine Fragen bereitwillig beantworteten, erfreut über seine unstillbare Wissbegierde, während sie mir die meinen als unziemliche Neugier untersagten. Nachdenklich beobachtete ich die Erwachsenen, die sich endgültig in einem Gespräch über die Feinheiten der Holzsteinkunst verloren hatten.
»Wenn die Lchnadra-Dienerinnen alle Familienbande lösen«, sagte ich langsam, »bricht die Erste Dienerin diese Regel doch bestimmt nicht nur für einen Höflichkeitsbesuch.«
»Ja«, meinte Vairrynn. »Das denke ich allerdings auch.«
Der nächste Tag fand uns in unserem weitläufigen Garten. Die Stürme der Nacht hatten sich gelegt; der Himmel war wie leergefegt und von einem so dunklen Blau, dass man darin hätte ertrinken können. Die zwei Bänder der Wylchnatta, des dünnen Rings, der sich um den Planeten Singis schlingt, glänzten matt darin wie geschmiedetes Eisen. Der Rhythmus der Wellen, die unterhalb unseres Anwesens an die Steilklippen brandeten, wiegte mich in eine tiefe Zufriedenheit, wie er das eben so zu tun pflegt. Wir, meine Mutter, die Erste Dienerin und ich, saßen auf der Holzbank an der südöstlichen Außenwand des Familienzimmers. Mutter und ich stickten; sie hatte mir recht unerbittlich das missratene Gebilde vom Vorabend in die Hand gedrückt, und so versuchte ich, zu retten, was noch zu retten war. Jorngiss hatte beim Anblick meines Machwerks gackernd gelacht und dann zu meiner Mutter gemeint, sie solle in Erwägung ziehen, doch lieber die anderen Talente ihrer Tochter zu fördern anstatt diese nutzlose Stickerei. Ich fand diese Bemerkung sehr nett von der Alten, auch wenn ich, so wie ich das sah, das Potenzial hatte, auf allen Gebieten, die Frauen offenstanden, gründlichst zu versagen. Meine Talente lagen anderswo, aber davon schwieg ich lieber; es war ja auch nicht Mutter, die beschlossen hatte, diese zu fördern. Sie reagierte auf Jorngiss’ Bemerkung lediglich mit einem Seitenblick, den ich lieber nicht versuchte zu deuten. Ich zog es vor, meine Brüder zu beobachten, die zwischen den niedrigen, verwachsenen Bäumen mit den Tygdulai spielten.
Die Tygdulai. Wie soll ich sie jemandem beschreiben, der sie noch nie gesehen hat, ihre wilde Grazie, ihre kraftstrotzende Eleganz? Die Tygdulai sind die traditionellen Reittiere der Singisen, aber damit ist nichts gesagt. Sie kamen aus dem Norden, ursprünglich, und das bedeutet: aus einer anderen Welt. Die Gründerväter hielten sie für übernatürliche Geschöpfe, ob Dämonen oder Gefährten der Chyndrai, wussten sie selbst nicht zu sagen. Es dauerte lange, bis sich die Tiere einen Platz in einer Gesellschaft erobert hatten, aus der sie heute nicht mehr wegzudenken sind, als Reittiere, als Statussymbole, als Gefährten; doch ihre Heimat ist der Norden geblieben. Mit stahlharten Hufen, zwei sichelförmigen Hörnern wie geschliffener Kristall und den scharfen Hauern eines Allesfressers sind sie alles andere als ungefährlich, aber ihre Tödlichkeit mehrt nur die Schönheit ihrer geschmeidigen Glieder, weiß und schwärzlich-grün gemustert … Hör sich das einer an! Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich habe wohl doch zu viel Zeit mit Vairrynn verbracht. Es war gar keine Frage, dass wir als Mitglieder einer Großen Alten Familie Tygdulai besaßen, und jeder von uns mochte die graziösen Tiere, doch mein großer Bruder vergötterte sie. Und die Tygdulai liebten ihn. »Sohn des Vair« bedeutet der Name meines großen Bruders, und Vair ist derjenige der Luftgeister, über den es die meisten Legenden gibt: Windzähmer, Schattenkämpfer, Himmelsreiter. Manchmal fragte ich mich, ob sein Name meinen Bruder geformt hatte.
Auch die alte Jorngiss beobachtete meine Brüder und die Tygdulai.
»Wie macht sich der Junge?«, fragte sie plötzlich. Mutter hob den Kopf. Das milde Sonnenlicht glänzte auf ihrem dunklen, rotbraunen Haar, das zum Zopf der Verheirateten Frau hochgebunden war, und umspielte die Konturen ihres Gesichts wie mit einem Weichzeichner. Ihre Hände stickten weiter, ohne dass der Blick der Nadel zu folgen brauchte.
»Welchen der beiden meinst du?«, fragte sie zurück.
»Was glaubst du wohl?«, entgegnete Jorngiss mit einer Stimme, die sagte »Weich mir nicht aus.« Mir gefiel das Ganze nicht.
»Vairrynn ist etwas Besonderes«, erklärte ich bestimmt, vielleicht auch trotzig. Die Alte warf mir einen blitzschnellen Blick zu.
»Mir scheint, das gilt auch für dich, mein Gottesgeschenk.«
Meine Ohren zuckten unbehaglich; Mynrichwy bedeutet zwar »die geschenkt wurde von Wy« in der Alten Sprache, doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir das nie bewusst gemacht. Wy, der Ersterschaffer, war in meinem kindlichen Kopf immer viel zu groß gewesen. Lchnadra mochte unser aller Mutter sein und am Ende unseres Lebens auf uns warten, aber Wy war es, der vor Allem und Allem gewesen war. Unwillkürlich schlug ich das Zeichen der Göttlichen Einheit. Mir war, als wollte die Erste Dienerin etwas Bestimmtes damit sagen, dass sie mich so nannte, aber ich konnte mir nicht denken, was. Das ungute Gefühl, das die Alte durch ihr großtantiges Getue am Abend zuvor schon fast zerstreut hatte, war wieder da.
»Mynrichwy hat recht, weißt du«, meinte Mutter; ich konnte die Anspannung aus ihrer Stimme heraushören. »Und wenn du etwas über meine Kinder erfahren willst, solltest du vielleicht einfach ein wenig mit ihnen reden. Sie sind durchaus fähig, für sich selbst zu sprechen. Alle drei.«
Halb erwartete ich einen ähnlichen Ausbruch der Ersten Dienerin wie am Abend zuvor, doch die Alte seufzte nur und nickte vor sich hin.
»Was ist passiert?«, fragte meine Mutter vorsichtig. Jorngiss rieb sich mit ihren knorrigen Händen das Gesicht.
»Das größte aller möglichen Übel«, antwortete sie. »Ktorram Asnuor wurde zum Obersten Priester des Wy gewählt.«
Ungläubig sah und hörte ich, wie meine Mutter sich die Sticknadel in den Finger rammte und ein Wort ausstieß, das keine vornehme Dame im Mund führen sollte. Verwirrt blickte ich von einer Frau zur anderen. Mutter war leichenblass, und Jorngiss sah aus, als hätte sie gerade das Ende der Zeit verkündet.
»Allgütige Lchnadra, beschütze uns«, flüsterte meine Mutter. »Oh, Große Göttin! Das …« Sie schlug die Hände vors Gesicht, dann blickte sie hinüber zu meinen Brüdern. »Allmächtiger Wy!«
Ich hatte meine Mutter noch nie so aufgelöst erlebt, und es erschreckte mich. Ich verstand nicht, was los war, aber zum allerersten Mal in meinem Leben hatte ich wirkliche Angst.
»Ich wollte nicht, dass du es aus den Nachrichten erfährst, Lys«, sagte die Erste Dienerin. »Und ich wollte … ach, ich weiß es auch nicht. Hier nach dem Rechten sehen, denke ich.«
Mutter schüttelte nur stumm den Kopf.
»Lys?«
»Jorngiss, Ktorram Asnuor ist eine Ausgeburt des Nichtseins, nichts weniger! Vielleicht gibt es im Reich bald keinen Ort mehr, an dem es sich noch lohnt, nach dem Rechten zu sehen.«
Die Erste Dienerin wiegte den Kopf. »Asnuor mag jetzt an der Spitze der Priesterschaft stehen, meine Liebe, aber die alte Jorngiss spielt dieses Spiel schon eine geraume Weile länger als dieser Emporkömmling. Noch ist nichts zu spät.«
Meine Mutter allerdings sah nicht so aus, als hätte sie die Worte der Ersten Dienerin überhaupt gehört.
Mein Bruder wartete auf mich bei den Tygdulai. Mutter war so verstört von der Nachricht der Ersten Dienerin, dass es nicht weiter schwer für mich gewesen war, mich davonzustehlen, obwohl ich die verflixte Stickerei noch lange nicht beendet hatte. Schygag-Dah, meine alte, dunkeläugige Stute, begrüßte mich gurrend, während sich Vairrynn auf seinen feurigen Dreijährigen schwang.
»Kommst du?«, fragte er einfach. »Wir sollten die letzten sonnigen Tage wirklich nutzen.«
Plötzlich musste ich lachen, trotz des Schreckgespensts der Angst, das sich so unvermittelt in meinen Nacken gesetzt hatte. In Gegenwart meines großen Bruders konnte es nicht bestehen. Ich blickte zu ihm auf, wie er da auf dem Tygdul saß wie der Chyndr, nach dem er benannt worden war.
»Was ist?«, fragte er, ein wenig irritiert. Ich schüttelte nur den Kopf und kletterte auf meine Schygag-Dah. Ich hätte es ihm niemals erzählt, aber manchmal kam er mir so fremdartig vor, dass es wehtat. Für gewöhnlich redete ich mir dann ein, dieses Gefühl rühre daher, dass er so gar nichts von einem Neoly an sich hatte. Schon allein die hellen grauen Augen waren ganz anders als die dunklen Neoly-Augen. Bodenlose Augen. Vater hatte sie, Großvater, Mudmal und auch die alte Jorngiss. Ich wiederum hatte Mutters rotbraune Augen abbekommen, wie ich auch sonst so ziemlich alles von ihr geerbt hatte. Bis auf den bodenlosen Neoly-Blick galt für Mudmal das Gleiche; wir waren einander so aus dem Gesicht geschnitten, dass Fremde uns oft für Zwillinge hielten, was meinen kleinen Bruder immer maßlos ärgerte. Ich für meinen Teil hätte auch lieber Vairrynn ähnlich gesehen, so geheimnisvoll und exotisch, mit seiner blassen Haut und dem hellschwarzen Haar (vielleicht war es auch dunkelgrau, ich wusste das nie so genau zu sagen), großgewachsen und mit einer eigentümlichen Eleganz, die der eines Tygdul nicht unähnlich war. Ich dagegen war frustrierend klein und zierlich geraten; ohne Frage war ich die Tochter meiner Mutter, während Vairrynn wohl ganz einfach und unverwechselbar er selber war.
Unser Haus lag am nordöstlichen Stadtrand von Naharmbra, der alten Adelshochburg an den Ufern des Inneren Ozeans. Deswegen dauerte es nicht lange, bis wir das bebaute Gebiet hinter uns gelassen hatten und auf unseren Tygdulai über eine weite Ebene jagten, die nach einer ungewöhnlich langen Trockenzeit braun und rissig war. Stellenweise, wo die Trockenzeitfeuer gewütet hatten, war die Erde zu grau-schwarzer Asche verbrannt, die feiner als Staub in der Luft lag und in der Sonne flirrte. Sie kitzelte in Nase und Ohren, während wir so dahinbrausten. Ich liebte es und stellte mir vor, dass sich so ein Raumschiff fühlen musste, das durch einen Sternennebel flog.
Schließlich erhob sich das flache Land zu einer sanften Anhöhe, durch die sich eine tiefe Spalte zog, sodass das Plateau auseinanderklaffte, als hätte Wy während seines Kampfes mit dem Göttlichen Gegner sein doppelschneidiges Schwert in den Boden geschlagen. In diese Schlucht lenkten wir die Tiere und betraten damit unsere eigene Welt. Vairrynn, der oft ganze Tage auf seinem Tygdul unterwegs war und die Gegend um Naharmbra kannte wie seinen Handrücken, hatte diesen Ort gefunden und nur mir gezeigt. Der Eingang der Schlucht sah wenig vielversprechend aus; nur etwas Kness, ein zähes, unverwüstliches, wenn auch leicht brennbares Pilzgewächs, schlang sich in Ranken um die Klumpen von Sandstein, die den Boden bedeckten. Doch dort, wo die Schlucht in einem fast kreisrunden Kessel ihr Ende fand, lag ein Ort wie ein vergessener Winkel der Anderwelt: Sprudelnd ergoss sich eine Quelle in einen seichten Bach, der sich fast in der Mitte des Talkessels zu einem zeittiefen Teich erweiterte, um sich dann wieder zu verengen und allmählich in den rissigen Boden der Schlucht zu versickern. Dichtes Gras bedeckte den lehmigen Untergrund des Kessels, den Teich säumten schlanke Bäume, hochgewachsen für singisische Verhältnisse, zu deren Wurzeln Stauden später Kaymteh-Blumen wuchsen, unverschämt bunt für die Jahreszeit. Ich war fest davon überzeugt, dass in alter Zeit die Chyndrai hier verehrt worden waren, und tatsächlich hatten wir schon Bruchstücke blauen Marmors zwischen den Sandsteinen gefunden. Gonn-Memnáh hatte ich diesen Ort genannt, eben »Anderwelt«, denn genau das war er für mich; hier galten andere Regeln als in der Welt draußen, Regeln, die für mich einem Bruch der Naturgesetze gleichkamen.
Nahe bei der Quelle stand eine Gruppe von Sandsteinfelsen, fast wie absichtlich angeordnet und bequem genug, um eine Weile dort zu sitzen. Dort stieg Vairrynn von seinem Tygdul und begann, in den Satteltaschen zu kramen.
»Also, womit fangen wir heute an?«, fragte er dabei.
»Mathematik«, sagte ich, während ich von meiner Schygag-Dah sprang und sie laufen ließ. Mein Bruder verdrehte die Augen.
»Schon wieder? Nicht mehr lange, und du bist besser als ich. Dann gibt es nichts mehr, was ich dir beibringen könnte, und das wäre dann allein deine Schuld!«
Es war eine der typischen netten Bemerkungen, die er immer für mich übrig hatte, auch wenn ich genau wusste, dass nicht mehr dahintersteckte. Vairrynn war fast vier Jahre älter als ich und ging auf eine Schule, die diesen Namen auch verdiente. Allein deswegen war er mir schon um Längen voraus. Und außerdem war er ein Mann, oder würde zumindest bald einer sein; mein Sinn für Zahlen, den ich als eine abnorme Laune der Natur anzuerkennen bereit war, änderte nichts daran, dass meine geistigen Kapazitäten nie an seine heranreichen würden. Ich sagte ihm das nicht, weil er es lautstark bestritten hätte, aber selbst Vairrynn konnte nichts tun gegen den Lauf der Welt.
»Na gut, dann will ich dich für heute verschonen mit den ganzen Zahlen«, entgegnete ich auf seine gespielte Beschwerde. »Wie wär’s stattdessen mit ein wenig Religionsgeschichte?«
Vairrynn ließ von seiner Suche in den Satteltaschen ab und warf mir einen scharfen Blick zu. »Wieso das?«
Ich zuckte mit den Schultern und setzte mich auf einen der Sandsteinfelsen. »Jorngiss hat Mutter vorhin erzählt, dass jemand namens Ktorram Asnuor zum Obersten Priester des Wy gewählt wurde. Und Mutter war … sehr beunruhigt.«
Vairrynn starrte mich an, unbehaglich intensiv. Dann stieß er schaudernd den Atem aus und lehnte sich mit verschränkten Armen gegen sein Tygdul. Der Hengst wedelte nur kurz mit den Ohren, ansonsten rührte er sich nicht.
»Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.«
»Warum nicht? Wer ist dieser Kerl?«
»Hast du schon mal was von den Monowyisten gehört?«
»Diese Typen, die behaupten, Lchnadra hätte keinen Anteil an der Schöpfung gehabt?« Es war schwer, in jenen Tagen nichts von den Monowyisten zu hören; ihre Prediger standen an allen Ecken und beschrien die Verderbtheit unserer Zeit, selbst in Naharmbra, wo derartiges Gelichter normalerweise nicht geduldet wurde. Dennoch hatte ich diesen Eiferern wenig Beachtung geschenkt. Ihre Tiraden über die Dekadenz des Singisischen Reiches unterschieden sich höchstens in ihrer Intensität von den Beschwerden meines Großvaters und anderer alter Onkel. Auch ihr Dogma die Göttin betreffend erschien mir nach allem, was ich von theologischen Streitfragen wusste (und als guterzogene Singisin war das nicht wenig), höchstens etwas radikaler als andere. Welche Rolle Lchnadra bei der Erschaffung des Seins genau gespielt hatte, war ein Born steter Uneinigkeit unter der Priesterschaft. Ich hatte das nie ganz nachvollziehen können. Aber ich war ja auch erst neun.
Vairrynn wiegte den Kopf. »Ja, so was haben sie bisher immer behauptet. Sie nennen Wy den Einen Erschaffer statt den Ersten, als würde das keinen Unterschied machen. Dabei reduziert man Lchnadra zu einem bloßen Werkzeug im Schöpfungsprozess, wenn man das tut. ›Am Anfang war Wy und nichts als Wy, und ER war die Fülle und die Leere und das All und der Geist.‹ – Diese Monowyisten tun so, als bestünde die Schöpfungsgeschichte aus nur einem Satz!«
»›Und da wollte ER Leben schaffen, und da schuf ER Leben, doch es blieb sich immer gleich‹«, griff ich den Faden auf. »›Und dann war da Lchnaachdra, DIE das Naach trug in IHREM Schoß, und da kam das Leben in Fluss, und es blieb in Fluss, und es fand sein Ende und seinen Neubeginn. Und es war gut.‹ – Was ist denn daran so schwer zu verstehen?«
Vairrynn schmunzelte, als hätte ich etwas Lustiges gesagt, nur irgendwie auch nicht; es war vielleicht das erste Mal, dass ich ein Lächeln sah, das keines war. »Wenn das nur alles wäre«, meinte er. »In letzter Zeit habe ich diese Straßenprediger immer wieder sagen hören, Lchnadra sei zusammen mit Dechal gefallen und eine Kreatur des Nichtseins, ganz wie der Göttliche Gegner.«
Ich riss die Augen auf und schlug das Zeichen der Göttlichen Einheit, schon zum zweiten Mal an diesem Tag. »Aber das ist blanke Blasphemie!«
Vairrynn kaute auf seiner Unterlippe. »Das habe ich bisher auch gedacht. Ich verstehe nicht, wieso, aber die Wypriester sehen das offenbar anders, wenn sie diesen Asnuor zu ihrem Ordensoberhaupt ernennen. Er ist einer der führenden Köpfe der Monowyistenbewegung. Und mit ihm als Obersten Priester werden die Monowyisten bald mehr sein als geifernde Straßenprediger.«
Ich nickte langsam vor mich hin. Nur der Vorsteher des Reiches und das Parlament, die Runde der Berufenen, standen über dem Obersten Priester des Wy. Trotzdem …
»Ich verstehe aber immer noch nicht, warum dieser Asnuor Mutter solche Angst macht, selbst wenn er will, dass alle Lchnadra für eine Kreatur des Bösen halten.«
Mein Bruder schüttelte ernst den Kopf. »Nicht nur Lchnadra. Wenn sie das Böse in sich trägt, dann gilt das auch für alle ihre Töchter. Für alle Frauen, Myn.«
Wir kamen spät nach Hause an diesem Abend. Zu spät. Hauptsächlich war das meine Schuld; ich tat immer mein Möglichstes, die Zeit im Gonn-Memnáh hinauszuziehen, und Vairrynn ließ sich meist nur zu leicht überreden. Diesmal jedoch hatten wir es zu weit getrieben, und es gab Ärger – allerdings nicht für mich, die ich mich wieder vor dem Sticken gedrückt hatte, sondern für Vairrynn. Er war der große Bruder, er trug die Verantwortung für mich. Unruhig trat ich von einem Fuß auf den anderen, während Vater Vai vor versammelter Mannschaft einen Vortrag über Pflichtbewusstsein hielt und seine dunklen Augen ärgerlich funkelten. Ich hasste es, wenn mein großer Bruder wegen mir in Schwierigkeiten geriet, aber wenn ich vorgetreten wäre und die Schuld auf mich genommen hätte, hätte ich alles nur noch schlimmer gemacht. Singisen haben nicht auf ihre kleinen Schwestern zu hören. Und so ließ Vairrynn Vaters Vortrag mit ein paar in passenden Momenten eingebrachten Gesten der Zustimmung über sich ergehen. Dass Vai mich unterrichtete, war unser wohlgehütetes Geheimnis; wir wollten uns beide gar nicht ausmalen, was Vater tun würde, würde er je herausfinden, was vor sich ging, wenn sein Erstgeborener mit seiner Tochter verschwand. Es geziemte sich für eine singisische Frau nicht, zu viel zu wissen. Ich glaube, weder ich noch mein großer Bruder machten uns damals bewusst, wie gefährlich dieses zu große Wissen tatsächlich werden konnte.
Endlich wurde Vai mit der Versicherung, er würde sich bemühen, seiner Verantwortung in Zukunft gerecht zu werden, entlassen. Gleich darauf belegte ihn die Erste Dienerin mit Beschlag, und den Rest des Abends steckten die beiden die Köpfe zusammen; anscheinend hatte sich Jorngiss Mutters schnippischen Ratschlag zu Herzen genommen. Leider bekam ich keine Gelegenheit, herauszufinden, was es nun eigentlich war, das sie von Vairrynn wollte. Mutter schickte mich nämlich sofort in die Küche, um Dlindgy beim Kochen zu helfen. Da ich später auch zusammen mit unserem Mädchen für alles beim Abendessen auftragen musste, hatte ich den starken Verdacht, dass sich Mutters Ansicht darüber, wen die Schuld für unser Zuspätkommen traf, ein wenig von Vaters unterschied.
»Na, was hast du jetzt wieder angestellt?«, fragte mich mein kleiner Bruder leise und mehr als ein wenig schadenfroh, als ich den Tisch abräumte. Er kannte seine Geschwister gut genug, um sich denken zu können, dass ich meinen Anteil an unserer Verfehlung gehabt hatte. Als Antwort streckte ich ihm die Zunge raus; der kleine Störenfried brauchte sich nichts darauf einzubilden, dass es heute mal Vairrynn und mich erwischt hatte. Mudmal lachte und überließ mich mit einem durchaus boshaften Glitzern in den Augen meiner Arbeit. Ich spielte einen Moment mit dem Gedanken, ihm meinen feuchten Abwischlappen in den Nacken zu werfen, ließ es dann aber bleiben. Mutter hatte mir so oder so schon so viele Aufgaben aufgetragen, dass ich gerade noch rechtzeitig zur großen Abschiedsszene der Ersten Dienerin damit fertig wurde.
Jorngiss wirkte fast ein wenig sentimental, als sie uns Kinder segnete. Sie strich Mudmal mit ihrer knorrigen Hand über die Wange und nannte ihn einen echten Neoly, mir tätschelte sie den Kopf und meinte, ich solle nur so weitermachen wie bisher. Bei Vairrynn, der die Alte bereits um ein Weniges überragte, verzichtete sie auf ihre Großtantengesten, legte ihm stattdessen die Hand auf die Schulter und sagte ausgesprochen kryptisch: »Vergiss nie, dass du stärker bist als sie alle, ja? Aber sei vorsichtig. Und pass auf deine kleine Schwester auf, versprich mir das.«
Vairrynn nickte ernst, während mir ziemlich respektlos durch den Kopf fuhr, dass sich unsere alte Tante Jorngiss wahrscheinlich ganz einfach einen Spaß daraus machte, ihr Umfeld gründlichst zu verwirren. Für ihre Verhältnisse war das »Achte gut auf deine kleine Familie, mein Junge«, mit dem sie meinen Vater bedachte, mehr als harmlos. Von meiner Mutter verabschiedete sie sich mit einer festen Umarmung. Für einen Moment sah es so aus, als würden sich die beiden Frauen aneinander festhalten. Dann verschwand Jorngiss, Erste Dienerin der Lchnadra, wie sie gekommen war: des Nachts, bei Wind und Wetter und unter einem Mantel der Heimlichkeit. Ich war nicht die Einzige, der das merkwürdig vorkam.
Bald nach dem Aufbruch der Ersten Dienerin schickten die Eltern uns ins Bett. Verfressen wie ich bin, konnte ich es nicht lassen, mir einen kleinen Mitternachtsimbiss aus der Küche zu stibitzen, und ich schwöre, dass bei meiner Rückkehr die Tür zum Familienzimmer nur aus reinem Zufall einen Spalt offen stand. Ich hätte auch nicht gelauscht, hätte ich nicht Vater meinen Namen aussprechen hören, und da gewann meine ungeliebte Neugier die Überhand.
»Wieso hätte uns Jorngiss wegen Mynrichwy besuchen sollen?«, fragte Mutter gerade.
»Sag du es mir«, entgegnete Vater griesgrämig. Seine Begeisterung war beim Auftauchen der Ersten Dienerin schon alles andere als gewaltig gewesen und hatte sich im Laufe des Tages lediglich ins Negative gesteigert. Diese seine schlechte Laune war wohl auch der eigentliche Grund gewesen, warum er Vairrynn gar so zusammengestaucht hatte.
»Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, Eftnek.«
Ich konnte Vaters Stirnrunzeln geradezu hören. »Sie hat sich doch den ganzen Abend lang regelrecht überschlagen, was für ein besonderes Mädchen deine Tochter ist – zumindest, wenn sie nicht gerade dabei war, meinem Sohn Flausen in den Kopf zu setzen.«
»Und weiter? Freut es dich nicht, wenn jemand gut von deiner Tochter spricht?« Mutters Stimme klang eher müde als aufsässig, aber ich wusste, sie hätte solche Worte nicht gebraucht, wenn sie nicht ernstlich verärgert gewesen wäre. Einen Moment lang war es still im Familienzimmer.
»Denkst du, sie will Mynrichwy für den Orden?«, fragte mein Vater dann. Ich bekam vor Schreck einen Schluckauf und presste die Hände vor den Mund. Mein Leben wurde von einem Moment auf den anderen bitterernst.
»Ich weiß es nicht«, meinte Mutter, und ich hörte ihr das Erstaunen über diesen Gedanken an. »Das Kind ist erst neun. Aber selbst wenn – sollten wir uns nicht geehrt fühlen? Die Dienerinnen der Lchnadra sind hoch angesehen.«
Mein Vater brummelte etwas in seinen Bart.
»Was war das, Schatz?«
»Ich habe nichts gegen den Lchnadra-Orden, Lys. Aber Jorngiss denkt, sie kann von der Familie verlangen, was sie will. Und meistens verlangt sie zu viel. Dabei ist sie technisch gesehen gar keine Neoly mehr.«
»Der Fluss spricht immer von der Quelle«, entgegnete Mutter. »Und das bedeutet auch, dass Mynrichwy innerhalb des Lchnadra-Ordens so gut wie keine Grenzen gesetzt wären. Sie könnte alles erreichen, und Jorngiss hat recht, weißt du: Deine Tochter ist nicht gerade dumm.«
Vaters Gebrumm klang nur um Nuancen besänftigter. »Mir gefällt der Gedanke einfach nicht, meine Tochter dieser alten Unruhestifterin zu überlassen.«
»Es könnte die einzige Möglichkeit sein, sie vor der Heiratspolitik zu schützen, die dein Vater so leidenschaftlich betreibt«, entgegnete Mutter ernst. Langsam wurde mir aufrichtig schlecht.
»Die Entscheidung über das Leben meiner Tochter liegt bei mir«, knurrte Vater. »Der Alte wird sich nicht einmischen, ganz im Gegensatz zu Ihrer Hochwürden, der Ersten Dienerin.«
Mutter seufzte vernehmlich. »Natürlich ist es deine Entscheidung. Aber wir haben doch noch Zeit. Mynrichwy hat noch Zeit. Wir sollten ihr ihre Kindheit nicht nehmen, und ich glaube auch nicht, dass Jorngiss das vorhat.«
»Sie hat also nichts zu dir über Mynrichwys Zukunft gesagt?«, meinte Vater nach einem Moment. Er klang ehrlich erleichtert. »Was, bei Wy, wollte sie denn dann hier?«
»Ich weiß es nicht, mein Schatz«, sagte meine Mutter mit einer Fröhlichkeit, die unglaublich falsch klang in meinen Ohren, und das trieb mich endgültig weg von der Tür und in mein Zimmer, das mir schon oft wie eine kleine, sichere Höhle vorgekommen war. In dieser Nacht versagte es jedoch. Dass ich zum ersten Mal mit angehört hatte, wie meine Mutter ihren Mann belog, mit locker-leichter Stimme und ohne zu zögern, war nur der krönende Abschluss dieses Tages. Es war, als hätte sich meine Welt um eine Winzigkeit verschoben und dadurch Risse bekommen. Die Erste Dienerin, Ktorram Asnuor, die Monowyisten, eine lügende Mutter – nichts davon hatte noch am Tag zuvor einen Platz in meinem Leben gehabt. Und als sei das nicht genug, fingen meine Eltern an, sich Gedanken um meine Zukunft zu machen, als sei ich kein kleines Kind mehr, sondern …
Die Zukunftsbilder, die meine Eltern für mich gezeichnet hatten, verstörten mich. Mir war, als könnte ich plötzlich mein Leben wie eine Straße vor mir ausgebreitet sehen, eine Straße, die sich in nicht allzu großer Entfernung in zwei Richtungen zweigte. Entweder den einen oder den anderen Weg würde ich gehen müssen. Doch während ich weitäugig in meinem Bett lag und mich von einer Seite auf die andere warf, ging mir auf, dass ich gar nicht gehen wollte. Ich wollte fliegen.
STURMZEIT
Wenige Tage später war die Nachricht, die die Erste Dienerin meiner Mutter gebracht hatte, in aller Munde: Ktorram Asnuor war zum Obersten Priester gewählt. Das gesamte Reich summte vor Aufregung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Asnuor außerhalb des Tempels kaum von sich reden gemacht. Dass er ein Monowyist war, löste milde Konsternierung aus, aber hauptsächlich waren die Leute einfach zum Platzen neugierig auf ihr neues geistliches Oberhaupt. Von keiner Seite, weder aus den Reihen meiner Familie noch aus den Medien, hörte ich ein Echo des Entsetzens, das der Name Asnuor bei Mutter ausgelöst hatte, oder wenigstes von Vairrynns stirnrunzelnder Besorgnis. Was man jedoch sehr bald hören konnte, war Unmut, ja, Ärger. Ktorram Asnuor ließ sich denkbar viel Zeit mit der Terminbekanntgabe für seine Einführungszeremonie, und wir Nchrynnai – wie wir Singisen uns selbst nennen – tun nichts ohne eine Zeremonie. Die Leute, vom Freudenmädchen bis zum Parlamentsmitglied, fühlten sich durch Asnuors Zögern mehr als vor den Kopf gestoßen.
»Worauf wartet dieser Asnuor eigentlich?«, empörte sich mein Onkel Zernteyb, der jüngste Sohn des alten Neoly, einmal meinem Vater gegenüber. »Was glaubt er denn, wer er ist? Die Manifestation Wys, die ungeweihte Augen nicht schauen dürfen? Der soll sich nicht so aufführen, dieser eingebildete Monowyist! Wie konnten sie nur auf die hirnverbrannte Idee kommen, diesen Kerl zum Obersten Priester zu wählen? Ich glaube, diesem selbstgerechten Überflieger gehören die Flügel gestutzt! Was meinst du, Eftnek, wie lange Vater sich das Ganze noch anschaut?«
»So lange, wie es dauert«, entgegnete mein Vater. »Die Großen Alten haben sich noch nie in die Angelegenheiten der Geistlichkeit eingemischt, und Vater hält nichts davon, fremde Schlachten zu schlagen, das weißt du doch ganz genau.«
»Du glaubst also tatsächlich, dass der alte Ränkeschmied diesem Möchtegern-Priester das Feld überlassen wird?«, fragte Zernteyb.
»Sein Feld, ja«, meinte Vater, und so verloren die beiden sich in einer Diskussion über den Jemand, der sich allemal noch besser für die Lästereien der Neoly-Brüder eignete als der leutscheue Oberste Priester.
»Was hältst du von der ganzen Sache?«, fragte Vairrynn wenige Tage später Mutter. »Was hat dieser Asnuor vor?« Vairrynn kam mit solchen Fragen immer zu Mutter.
»Er will, dass man über ihn redet«, antwortete sie.
»Aber es bringt ihm doch nichts, wenn die Leute schon wütend auf ihn sind, bevor er sein Amt überhaupt angetreten hat.«
»Oh, er wird sich schon etwas einfallen lassen, um sie zu versöhnen. Wichtig ist, dass sein Name jetzt in aller Munde ist. Er heizt die Stimmung immer mehr an, ohne einen Finger zu rühren, und bereitet so die Bühne für seinen großen Auftritt.« Sie sagte das mit einem zynischen, fast bitteren Unterton. Vairrynn musterte sie mit schiefgelegtem Kopf.
»Woher weißt du eigentlich so viel über Ktorram Asnuor?«
Mutter zuckte zusammen, sagte dann aber leichthin: »Um diesen Mann zu durchschauen, muss man nicht viel über ihn wissen; das kann man sich an vier Fingern ausrechnen.«
Sogar mir war klar, dass das keine Antwort auf Vairrynns Frage war. Mein Bruder starrte Mutter einen Moment lang an, durchdringend, intensiv. Ich kannte diesen Ausdruck; Vairrynn trug ihn immer, wenn er spürte, dass jemand etwas verheimlichte. Der graue Blick wurde dann scharf und irgendwie hart, heller vielleicht, tiefer. Nicht immer angenehm. Selten angenehm.
Mutter wich diesem Blick jetzt aus. Vairrynn sagte nichts. Ich vergrub die Nase in einem meiner Bücher. Schon jetzt begann ich, eine intensive Abneigung gegen den Obersten Priester des Wy zu entwickeln. Alles brachte er durcheinander!
Es dauerte insgesamt eine ganze Lchnatta – eine ganze viertel Jahreszeit also – ehe der Termin für Asnuors Einführungszeremonie feststand. Heiligtümer im ganzen Reich, so ließ der Sprecher des Wytempels dann schließlich verlauten, würden überbordende Feste für die Kinder des Ersterschaffers ausrichten, damit dieser besondere Tag dem Reich lange in Erinnerung blieb. Diese Aussicht allein versöhnte bereits viele, aber es gab immer noch genug, die dem ersten Auftritt Ktorram Asnuors ziemlich skeptisch entgegenblickten. Entgehen lassen wollten sich das Spektakel jedoch die wenigsten. Vater beschloss kurzerhand, der Aufforderung des alten Neoly zu folgen und an dem großen Tag mit seiner Familie nach Murraptaam zu kommen, der altehrwürdigen Hauptstadt des Reiches, wo die Einführungszeremonie stattfinden würde. Mutter weigerte sich rundheraus, ihren Mann zu begleiten. Vater ließ ihr schließlich ihren Willen, und Mutter und ich blieben an dem Tag, an dem die gesamte singisische Bevölkerung auf den Beinen schien, zu Hause. Ein kleines Mädchen wie ich gehöre ohnehin nicht in eine Stadt wie Murraptaam, hatte Vater als offizielle Begründung erklärt, und damit war ein weiteres Mal verhindert, dass ich einen Fuß aus dem geruhsamen Naharmbra setzte.
Ich war mehr als nur ein wenig neidisch auf meine Brüder, die Vater begleiten durften, während es mir beschieden war, das Geschehen auf der Holographischen Wand zu verfolgen. Dagegen wenigstens hatte Mutter nichts. Wir sahen uns die Übertragung der Zeremonie gemeinsam an, Mutter mit zusammengekniffenem Mund und ich genauso gespannt wie der Rest des Reiches auf Ktorram Asnuor, Oberster Priester des Wy und Erster Streiter der Nchrynnai.
Und gespannt waren sie alle. Die Kamera flog über die engen Straßen der Hauptstadt, in denen sich Singisen aus allen Landstrichen und von allen Planeten des Reiches drängten. Die Stadt, geprägt durch hellbraunen Farkenn-Stein, glimmende Glasbauten und himmelstrebende Architektur, ertrank in einem wahren Farbenmeer. Es schien gegen die hohen Häuser zu branden, von denen bunte Banner wallten. Wie von den Winden der Sturmzeit getragen, wirbelte die Kamera über die Türme der Innenstadt, bis sie schließlich auf den Großen Platz hinabtauchte, das Zentrum Murraptaams, das Zentrum von Singis, das Zentrum unseres Reiches, des glorreichen und immerwährenden Memnáh. Ich glaube, wir alle hielten diesen Ort damals für das Zentrum des Universums.
In der Form eines riesigen Oktogons wird der Große Platz eingerahmt von dem vieltürmigen Palast der Berufenen, in dem das Parlament tagt und der Vorsteher des Reiches residiert, von dem Tempel der Göttlichen Einheit mit seinen unzähligen Nischen und Innenhöfen, dem Museum Glorreicher Geschichte und der gewaltigen Bibliothek der Planeten, die, so sagte man, das gesamte Wissen des Memnáh in ihren Mauern barg (und in ihren Datenbanken, aber das klang so unromantisch). Die Kamera ließ sich viel Zeit, die prunkvollen Fassaden abzufahren; wir Nchrynnai kosten jeden Moment ruhmgedenkender Selbstbespiegelung voll aus. Schließlich schwenkte sie über die wartenden Massen hin zum Gründerväterdenkmal vor dem Palast der Berufenen, neben dem eine hohe Tribüne errichtet worden war. Fanfaren begleiteten den Kameraschwenk, »Perfekte Regie«, kommentierte meine Mutter, und die gigantischen Flügeltüren des Palastes öffneten sich.