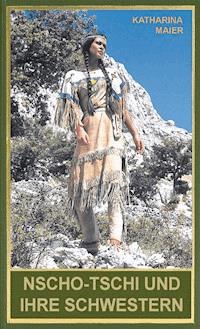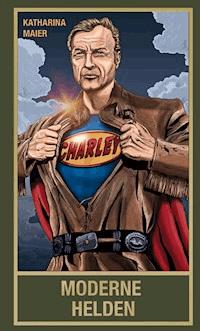3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Erste Tochter
- Sprache: Deutsch
Ein Planet. Eine Frau. Ein Kampf. Myn steckt fest. Zu spät erkennt sie, dass sie sich zu leicht und zu schnell in ein Schicksal gefügt hat, für das sie nicht gemacht ist. Warum nur kann sie sich nicht in das Leben einer Ehefrau pressen wie jede andere gute Singisin auch? Während der Planet Singis unter der Regentschaft seines neuen Alleinherrschers scheinbar zur Ruhe kommt, sucht Myn, die Tochter einer verurteilten Ketzerin, verzweifelt nach einer Überlebenstaktik. Doch als der frischgekrönte Feldherr des Wy ihren geliebten Bruder zwangsweise für seine Weltraumarmee rekrutiert, zerbricht etwas in ihr. Die Angst vor dem Tod hat sie in eine ungewollte Ehe getrieben. Doch jetzt? Myn scheint, dass es Schlimmeres gibt als den Tod. Die Mutter ermordet, sie selbst verschachert, ihre Familie zerrüttet ... Ihre Fügsamkeit hat nichts davon verhindert. In Myn beginnt sich ein Drache zu regen, der nach Freiheit brüllt. Und dann gibt es da auch noch die Liebe ... In 7 Bänden erzählt "Die Erste Tochter" von einer fremden Welt und von einer Frau und drei Männern, die diese Welt für immer verändern. Teil 3: Eine Frevlerin findet sich wieder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DIE ERSTE TOCHTER
Zukunftsepos von Katharina Maier
Inhalt
Widmung
Morgen
Wechselspiel
Verlust
Allianzen
Kniefall
Engel
Erkennen
Silberlicht
Lebensgabe
Kontrolle
Tanz
Wertschätzung
Plan B
DIE ERSTE TOCHTER
Hallo, Leser-Du!
Wer ist wer
Was ist was
Lesetipps
Impressum
Katharina Maier
Widmung
Für Mama, mit den Sternen in ihrem Geist
Für Lisa, mit den Drachen in ihrem Herzen
Für Oma, die Myn ihre Stärke gab
Diese Welt wäre nicht, was sie ist, ohne euch
Dechal, der Erstgeborene Wys und Lchnadras, war der Herrlichste unter den Chyndrai, denen es gegeben war, niemals zu schwinden bis ans Ende der Zeit. Er war wahrhaft der Strahlendste von ihnen, auch wenn sein Herz schon zu jener Zeit aus dunklem Feuer gemacht war. Die Dunkelheit jedoch war damals noch unbedeutet und so schön und rein wie das Licht. Da begab es sich, dass Dechal in die Welt zog, die den Nchrynnai gegeben war, den Späten und Liebsten Kindern des Höchsten. Und wohin auch immer er kam, liebten und fürchteten ihn alle, die ihn erblickten. Das Herz der Großen Mutter Lchnadra aber schmerzte ob der Abwesenheit ihres Ersten Sohnes. Zwecklos war der Hohe Gatte bemüht, die Tränen der Mutter zu trocknen, die die Schöpfung zu ertränken drohten. Sie versiegten erst, als die Göttin Dechal aufs Neue erblickte, dessen Feuer die Kälte aus ihren Knochen brannte und ihr das Herz warmmachte in der blutvollen Brust. Und Dechal erblickte Lchnadra in all ihrer furchtbaren Schönheit, und er erkannte nicht länger die Mutter in ihr. Er hob ihr die Hand entgegen, der Machtvolle, der Empörer, der Verführer, und bot ihr das Feuer, nach dem sie hungerte. Und die Göttin, der Kälte leid und des Lichts, ergriff sie mit ihren bleichen Fingern und erschloss dem Sohn das Herz, das allein des Vaters gewesen war. Dechal nahm sich, was ihm dargeboten wurde, und vereinte sich mit der Mutter in einer Eruption von Feuer und Schatten, die sich über die Schöpfung ergoss und seine Dunkelheit in alle Herzen pflanzte.
Die Geschichte Dechals und Lchnadras, oder: Der Große Frevel
Morgen
Der Blick der Frau ruhte auf dem halb entblößten Körper des schlafenden Mannes. Er lag auf dem Bauch, das Gesicht ihr abgewandt. Die dünnen, cremefarbenen Decken waren bis fast unter seine Hüfte gerutscht und malten so ein beinahe klischeehaftes Tableau. Die Frau saß nackt auf dem Bett, den Zipfel einer der Decken über ihren Schoß gelegt. Ihr wildes Feuerhaar mischte sich mit dem cremigen Weiß, eine Farbkombination, die ihr Freude gemacht hätte, hätte sie ihren Blick lange genug von der Rückenlinie ihres Bettgefährten abgewandt. Vor den Fenstern überzog eine dicke Wolkenschicht den Himmel, die das Sonnenlicht silbern auf die Welt sickern ließ. Es war ein gedämpfter Tag, und der Frau erschien das passend. Sie wusste, sie hätte abgestoßen sein sollen, angewidert sogar, und sie sollte sich beschmutzt fühlen. Für den Bruchteil eines Augenblicks letzte Nacht hatte sie das auch getan. Doch der junge Mann in ihrem Bett hatte etwas an sich, das ihr das Herz weitgemacht hatte, so wenig sie es rational nachvollziehen konnte. Und sie war eine rationale Frau, Pektay Fno, immer schon gewesen. Dass sie auch leidenschaftlich war, änderte nichts daran. Deswegen saß sie jetzt nackt auf ihrem Bett und versuchte zu analysieren, was letzte Nacht passiert war. Sie war ausgezogen, einen Jüngling zu verführen, und jetzt war ihr etwas in die ausgebreiteten Hände gefallen, von dem sie nicht wusste, ob sie es haben wollte.
Ein Teil von ihr wünschte, sie hätte auf den jungen Sar gehört, der sie vielleicht warnen hatte wollen. Oder auch nicht. Ein wenig hatte sie das Gefühl, dass sie nicht so recht wusste, wem sie da gestern Abend begegnet war, doch gewiss nicht dem leichtherzigen, blitzeäugigen Glanzjungen, als den sie Ftonim Sar kennen und ein klein wenig lieben gelernt hatte. Genug jedenfalls, um ihn mehr als einmal in ihr Bett zu lassen. Und was sollte sie nun mit dem jungen Nordler anfangen, den Ftonim so krallenbewehrt gehütet hatte wie ein Frn-Weibchen ein Nest voller Neugeborener? Wusste Ftonim es, dieses Geheimnis, das sie alle verbrennen konnte?
Pektay schürzte die Lippen. Das Herz hämmerte ihr zwischen den Rippen, und sie mochte das Gefühl nicht. Es bedeutete nie etwas Gutes. Ihr Blick glitt langsam von der Wurffalte der cremefarbenen Decke aus empor und wurde eingefangen von schläfrig geöffneten Augen, die dieselbe Farbe hatten wie das silbrige Halblicht vor ihrem Fenster. Pektay spürte, wie sie rot wurde. Sie hatte noch nie ein Problem mit Nacktheit gehabt, aber unter diesem Blick fühlte sie sich auf eine völlig ungekannte Art und Weise entblößt.
»Habe ich dir tatsächlich erzählt, was ich glaube, dass ich dir erzählt habe?«, fragte er. Seine Stimme war rau, aber ansonsten machte er nicht den Eindruck eines Mannes, der die Mengen an Alkohol konsumiert hatte, wie er es letzte Nacht getan hatte. Wie ungerecht.
»Mhm«, antwortete sie unverbindlich.
Er richtete sich ein wenig auf und stützte den Kopf in die rechte Hand. Die Decke rutschte noch ein Stückchen weiter. Pektay hatte ein wenig Schwierigkeiten, den Augenkontakt aufrechtzuerhalten, von dem sie wusste, dass sie ihn nicht brechen durfte.
»Warum bist du dann noch hier?«, fragte er ruhig.
»Das hier ist mein Haus«, wandte sie sachlich ein. Ihre Wohnung, genauer gesagt, die über ihrer Buchhandlung im Herzen der singisischen Hauptstadt lag. Ihre Stadt, ihre Wohnung, ihr Bett. Er war ein Fremder hier – in so vieler Hinsicht.
Der junge Nordler zuckte mit den Schultern, viel zu gelassen. »Gut, also: Warum bin ich noch hier?«
»Ich weiß es nicht.«
»Hm«, machte er.
»Hm«, machte sie.
Eine Weile sahen sich die beiden einfach nur an.
»Du hättest längst die Wystreiter rufen können«, meinte er schließlich nüchtern. Pektay schnaubte.
»Und zusehen, wie sie einen weiteren Neoly den Flammen und der Menge zum Fraß vorwerfen? Durch meine Schuld? Nur über meine Leiche!«
Er sah sie immer noch so an, als läge nicht sein Leben in ihren Händen. Als wäre sie lediglich ein interessantes Rätselspiel, das es zu entschlüsseln galt. Sie seufzte unter diesem Blick.
»Du bist Lys’ Sohn«, sagte sie leise. »Zumindest hat sie dich großgezogen, und ich weiß, dass sie dich über alles geliebt hat. Das hätte sie nicht getan, wäre etwas Schlechtes in dir.«
»Ich liebe meine Schwester.«
Es klang jetzt, im silbrigen Licht des gedämpften Tages, nicht weniger welterschütternd als in der Dunkelheit der letzten Nacht. Pektay verzog keine Miene.
»Na und? Das tun viele.«
»Pektay«, sagte er, halb bittend, halb vorwurfsvoll. Bis dahin war sie sich durchaus nicht sicher gewesen, ob er sich an ihren Namen überhaupt erinnerte.
»Was?«, fragte sie und es schlich sich ein wenig von der Hysterie in ihre Stimme, von der sie nicht gewusst hatte, dass sie sie empfand. »Willst du, dass ich dich aus meinem Haus werfe? Willst du, dass ich dich verfluche und voller Abscheu vor deiner Berührung zurückweiche? Willst du, dass ich die Streiter rufe und den Wyorden, damit sie dich aus dieser Welt brennen?«
Endlich senkte er den Blick. Auf einmal sah er so jung aus, wie er war.
»Natürlich nicht.«
Pektay machte ein Geräusch, das irgendwo zwischen einem Schnauben und einem Seufzen lag, und strich ihm vorsichtig das Haar aus dem Gesicht. »Warum kannst du dann nicht einfach akzeptieren, dass ich nichts davon tun werde?«
Er blickte auf, und seine Verletzlichkeit traf sie mitten ins Herz. Sie wollte es nicht, aber es war schon zu spät, und sie wollte es doch. Verdammt, dachte sie. Wenn sie sich schon vergaffte, warum dann nicht in einen der vielen Männer, die ihr ihr Herz schenkten, weil es frei war? Pektay beugte sich vor. Ihr Haar fiel um ihre bloßen Brüste, und sie lächelte ihn an.
»Warum bleibst du nicht und wir frühstücken zusammen? Ich werde dir nichts kochen, das sage ich dir gleich, aber wir können uns etwas kommen lassen. Und danach kann ich dir zeigen, dass mir ganz egal ist, wen du liebst.«
In jeder anderen Situation hätte dieser Satz furchtbar geklungen, und vielleicht tat er das sogar jetzt, doch er zauberte ein strahlendes Lächeln auf die Züge des jungen Nordlers. Oh Göttin, dachte Pektay. Vairrynn lehnte sich ihr zu und gab ihr einen Kuss auf die Stirn.
»Danke«, sagte er, und Pektay hatte das Gefühl noch nie ein ehrlicheres Wort aus dem Mund eines Mannes gehört zu haben.
»Bitte«, entgegnete sie mit einem sinnlichen Lächeln, das er erwiderte.
»Ich kann nicht bleiben«, meinte er, noch mit diesem Lächeln auf den Lippen.
Sie runzelte verwirrt die Stirn, ein wenig gekränkt auch.
»Da gibt es jemanden, bei dem ich sein muss«, erklärte er.
»Ah, ich verstehe. Die Schwester.«
»Ja. Die Schwester«, entgegnete Vairrynn und schlug die Decke zurück.
Pektay beobachtete ihn sinnend, während er seine Kleider zusammensuchte. Plötzlich war sie kein Abstraktum mehr, diese Liebe zu seiner Schwester, und auch kein verdammenswerter Frevel, den sie zu übersehen bereit war, weil sie eine aufgeklärte und großmütige Singisin war; vielmehr spürte sie auf einmal die Gegenwart der anderen Frau wie eine dritte Person im Zimmer, und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Sie überlegte, ob er letzte Nacht überhaupt an sie, Pektay, gedacht hatte, während er in ihren Körper eindrang, und die Frage weckte ein ehrgeiziges Feuer in ihr.
»Kommst du wieder?«, fragte sie schnurrend.
Vairrynn, der gerade dabei war, sein Hemd von ihrem kleinen, mit Nachtfaltern besetzten Lüster zu klauben, blickte überrascht zu ihr herüber. »Wenn du das möchtest …«
Pektay, die sich dekorativ auf die cremeweißen Decken drapiert hatte, lächelte hintersinnig. »Ich werde hier auf dich warten.«
Vairrynns Augenbrauen rutschten nach oben.
In meiner Hochzeitsnacht tat ich kein Auge zu. Sobald der Morgen zu dämmern und Licht durch die Fenster zu sickern begann, erhob ich mich und ließ meinen schwer atmenden Ehemann in dem Bett zurück, von dem ich mehr als je zuvor hoffte, er würde nicht erwarten, dass ich es Nacht für Nacht mit ihm teilte. Mynrichwy Nuggr. Das war jetzt mein Name. Nicht länger Neoly, vielleicht auch nicht mehr Myn. Mir war, als bestände ich aus Glas, und ich bewegte mich äußerst behutsam. Was würde wohl passieren, wenn ich zerbrach?
Unbehaglich fuhr ich mir über die Arme und bereute es sogleich; ich hatte vergessen, dass ich nackt war, und jetzt hatte ich das Gefühl, meinen Ehemann auf meiner bloßen Haut zu spüren. Es schüttelte mich. Eilig griff ich nach dem braun-gold melierten Seidenkleid, das Ftonim mir geschenkt hatte, und zog es über. Sofort fühlte ich mich besser, als würde es mich zusammenhalten und verhindern, dass ich in tausend Stücke zersprang. Ich musste unbedingt daran denken, dem jungen Sar zu danken, sobald es mir wieder gestattet sein würde, ihn zu sehen. Einen Augenblick lang erlaubte ich mir den Luxus, ihn zu vermissen. Es fühlte sich so vertraut an, dass es tröstlich war. Dann holte ich tief Atem und machte mich bereit, mein neues Leben zu beginnen.
Ich hatte einige Kleider für mich in Juffgams Schrank gefunden – eine Geste, die vielleicht nichts anderes bedeutete als Rücksichtnahme von Seiten meines Ehemannes, mich jedoch nichts Gutes ahnen ließ. Alle waren sie Hauptstadtmode und, mehr noch, in der eigenartig schweren Schlichtheit gehalten, die typisch für meine neue Familie war. Für die Großen Alten Nuggrs schien selbst Prunk funktional zu sein – ein Mittel, um ihren Reichtum und ihren Status als Aristokraten deutlich zu machen, nichts sonst. Ich stand eine ganze Weile vor dem Kleiderschrank und blinzelte dümmlich hinein – dass ich keine Neoly mehr war, hatte ich akzeptiert; dass ich nicht mehr ich sein konnte, befürchtete ich stark; aber dass ich auch keine Naharmbranerin mehr sein würde, hatte ich keinen Moment lang bedacht. Ich hatte keine besondere Beziehung zu der singisischen Hauptstadt und nur eine sehr schlechte Assoziation – den Tod meiner Mutter auf dem Scheiterhaufen. Benommen strich ich über die schweren Stoffe; vielleicht würde mir mein Ehemann erlauben, die vornehmeren meiner Naharmbraner Kleider zu behalten, aber das hier war es, was ich in Zukunft hauptsächlich tragen würde. Ich konnte mich nicht darin sehen, aber das spielte wohl keine Rolle.
Schließlich wählte ich ein hochgeschlossenes Kleid aus einem silbergrauen Kunstfaserstoff, der nicht atmete. Es hatte lange, enganliegende Ärmel, deren Spitzen bis zu meinen Fingern liefen, und anthrazitfarbene Stickereien an den Säumen. So etwas innerhalb der eigenen vier Wände zu tragen, kam mir albern und affektiert vor. Die silbrige Farbe ließ meine Haut wahrscheinlich wächsern aussehen, aber das war mir herzlich gleichgültig. Der hochgeschlossene Kragen verdeckte das diamantene Kropfband mit dem Nuggr’schen Wappen – Doppelaxt und Berge vor einem langweilig beigen Hintergrund – ein wenig, zumindest wenn ich ihn hochzog; das war sehr viel wichtiger. Ohne das Neoly-Wappen um meinen Hals fühlte ich mich ungenügend und kam mir deswegen dumm vor; ich hatte es getragen, solange ich denken konnte, aber es wäre doch recht albern, drei Sternen auf wellendurchwirktem dunkelroten Grund nachzutrauern.
Ich verließ das Schlafzimmer. Die Wohnung war totenstill, als wäre sie hermetisch vom Rest des Nuggr’schen Turms abgeschlossen. Der Familiensitz der Neolys war niemals so ohne Laut, und selbst in dem recht einsam gewordenen Küstenhaus meines Vaters hörte man immer die Stadtgeräusche Naharmbras und natürlich das Meer. Das fehlende Wellengeräusch des Inneren Ozeans war wie eine schmerzende leere Stelle in meinem Innern, und ich setzte mich verloren auf ein nagelneu wirkendes Sofa in einem Raum, der entweder das Empfangs- oder das Familienzimmer sein konnte. Die makellose Schlichtheit um mich herum gab mir keinen Hinweis auf die Funktion der verschiedenen Räume. Ich fühlte mich wie in einer Gruft. Ich wusste, das lag an mir, aber es änderte nichts.
Mir musste es gelungen sein, mein bewusstes Denken völlig auszuschalten, denn als ich wieder zu mir kam, war es deutlich heller in dem charakterlosen Raum. Ich war ein wenig verwirrt, nicht wissend, was mich aus meinem seligen Zustand des Nicht-Denkens gerissen hatte, bis ich ein zweites Mal die Wohnungsklingel hörte. Mit einem tiefen Seufzer erhob ich mich. Es hatte begonnen.
Vor der Wohnungstür stand ein neunjähriger Junge mit kohlschwarzem Haar, riesigen dunkelgrauen Augen und den delikaten Gesichtszügen eines kindlichen Chyndren. Ich kannte ihn gut, denn er war der Sohn meines Ehemannes, auch wenn er nicht so aussah. Kaldsdan war das sanftmütigste Kind, das ich jemals kennengelernt habe, und wann immer er zusammen mit seinem Vater unser Küstenhaus in Naharmbra besucht und dort still und mit großen Augen unseren Garten bewundert hatte, hatte ich Angst gehabt, eine starke Meeresbrise könnte ihn davonwehen wie eine Feder. Kaldsdan Nuggr war nicht gemacht für diese Welt.
»Myn! Du bist da!«, rief er aus, sobald ich ihm die Tür geöffnet hatte, und fiel mir in die Arme.
Er nannte mich bei diesem Namen, seit er ihn ein-, zweimal von meinen Brüdern gehört hatte. Juffgam hatte ihn eine Zeitlang dazu bringen wollen, dass er mich Mutter nannte, aber ich glaube, mein Vater hatte ihm das schließlich ausgeredet; es war zu bizarr, viel zu bizarr. Ich schloss meine Arme um meinen kleinen Stiefsohn (er war neun, er war nicht mehr klein, aber er sah so aus) und drückte ihn an mich. Die ungetrübte und bedingungslose Liebe, die das Kind völlig grundlos für mich hegte, schien mich wieder ein wenig in mir selbst zu verankern. Wenigstens gab es in diesem riesigen, chromkalten Turm eine Person, der ich etwas war.
»Kaldsdan!«, rief da eine junge, aufgebrachte Frauenstimme von der anderen Seite des Korridors, und einen Moment später kam ein Wirbelwind von geschürzten Röcken und wogendem Mieder den Korridor heruntergerannt. Die junge Frau kam so abrupt vor uns zu stehen, dass ich glaubte, die Sohlen ihrer Schuhe über den blanken Marmorboden quietschen zu hören.
»Oh, Herrin, es tut mir so leid!«, rief sie aus. Ich dachte einen Moment lang, ihr aufgelöster Ausruf sei ein an die Göttin gerichtetes Stoßgebet, bis ich begriff, dass sie mit mir redete.
»Äh …«, machte ich recht unherrinnenhaft, aber die junge Frau hatte ihre Aufmerksamkeit bereits von mir ab- und Kaldsdan zugewandt, dem sie beide Hände auf die Schultern legte.
»Du weißt ganz genau, dass du den Herrn und die Herrin heute Morgen nicht stören sollst! Wir haben doch darüber geredet, aber hörst du mir zu? Nein!« Sie schickte einen flehenden Blick zu mir herauf; ihre Augen waren fast dunkel genug, um als Neoly-Augen durchzugehen. Zusammen mit ihrem honigbraunen Teint und den hellen, blonden Locken, die sich um ihr dralles Gesicht ringelten, gaben sie ihr ein südliches Aussehen.
»Es tut mir wirklich leid«, flüsterte sie. »Er ist mir einfach entwischt.«
Ich hatte immer noch nicht ganz begriffen, wofür sie sich eigentlich entschuldigte und warum sie es flüsternd tat, da ging die Wohnungstür gegenüber auf und eine strenggesichtige, mittelalterliche Frau in einem dunklen, violett-roten Gewand, das ein wenig aussah wie ein Trauerkleid, streckte ihre spitze Nuggr-Nase heraus. Sowohl Kaldsdan als auch seine dunkeläugige Hüterin erstarrten.
»Dirne, was soll das?«, zischte meine Nachbarin.
Ich blinzelte. Hatte sie Kaldsdans Kindermädchen – denn das musste die junge Südländerin sein – gerade tatsächlich »Dirne« genannt? Wo waren wir denn? In dunkelsten, voroligarchischen Zeiten? Meine Nachbarin wiederum verlor keine Zeit, dem zerknirschten Mädchen einen Vortrag über die Unverletzlichkeit des Hochzeitsmorgens zu halten. Ah. Also darum ging es hier. Das hatte ich fast vergessen.
Die junge Südländerin war mittlerweile merklich blasser geworden, während sich Kaldsdan offenbar nicht entscheiden konnte, ob er sich hinter ihr oder hinter mir verstecken sollte. Ich räusperte mich.
»Ich danke Ihnen, Nachbarin«, sagte ich mit einer seltsamen Sanftheit in der Stimme. »Aber mein Gemahl wollte ohnehin früh nach seinem Sohn schicken. Es ist also kein großer Schaden entstanden.«
Der alte Angelhaken sah mich einen Moment lang mit verengten Augen an, dann hmpfte die Nachbarin und zog ihre Spitznase in ihre eigene Wohnung zurück.
»Göttin!«, murmelte ich, kaum unterdrückt. »Ich hoffe, die sind nicht alle so!«
Kaldsdan und die Südländerin starrten mich beide mit identischem, großäugigen Gesichtsausdruck an. Ich hmpfte meinerseits.
»Nun kommt schon rein, ihr beiden.«
Kaum hatte ich die Tür hinter uns geschlossen, begann die Südländerin die Hände zu ringen. »Es tut mir wirklich, wirklich leid, Herrin! Der Kleine wollte Sie nur so unbedingt sehen …«
»Könntest du mich nicht einfach Mynrichwy nennen?«, unterbrach ich sie. Herrin, das war meine Großmutter, wenn sie einen schlechten Tag hatte.
Die dunklen Augen der Südländerin wurden noch größer. »Ich … ich glaube nicht, dass das geht.«
»Aha«, machte ich und dachte: »Oh, meine Göttin!«
Die Südländerin biss sich auf die Lippen (sie waren so prall wie der Rest des Mädchens) und sah aus, als wäre alles nur ihre Schuld, während Kaldsdan hin und her wippte, als hörte er einen dringenden Ruf der Natur. Ich beugte mich ein wenig zu ihm herunter.
»Hey, Kals? Würdest du mir einen Gefallen tun?«
Er nickte mit großen Augen. Bei der Einheit, dieses Kind war einfach allerliebst!
»Kannst du mir den Namen deiner Freundin verraten?«
Es mochte ja noch angehen, dass sie mich Herrin nannte, aber ich wollte verdammt sein, ehe ich sie mit Dirne ansprach.
Kaldsdan kicherte. »Sie ist doch nicht meine Freundin. Sie ist Bschi!«
Ich nickte ernsthaft, als würde das alles erklären. Und wahrscheinlich tat es das sogar.
»Ich verstehe. Was meinst du, hast du Lust ein wenig zu spielen, während Bschi und ich Frühstück machen? Dann können wir alle zusammen auf deinen Vater warten, in Ordnung?«
Kaldsdan nickte und sprang davon, wohl in Richtung seines Zimmers. Ich richtete mich wieder auf und begegnete Bschis unsicherem Blick.
»Wollen wir?«
»Herrin, das … das ist wirklich nicht nötig! Ich kümmere mich doch auch sonst immer um alles, was der Herr braucht!«
Kaum waren die Worte aus ihrem Mund, schlug sich Bschi die Hand vor denselben. Hätte sie es nicht getan, mir wäre wahrscheinlich gar nichts an dieser Bemerkung aufgefallen. So verschränkte ich die Arme vor der Brust und hob eine Augenbraue, eine Geste, die ich mir von meinem großen Bruder abgeschaut hatte. Bschi gelang das Kunststück, innerhalb von einer Xa erst grabesblass und dann feuerrot zu werden.
»Ich meine … ich meine …«
»Ich denke, ich weiß, was du meinst«, entgegnete ich und hätte gern hinzugefügt, dass sie von mir aus ruhig alles weiterhin so handhaben konnte wie bisher auch, wenn das bedeutete, dass ich meine Ruhe hatte. Aber das wäre unfair gewesen. »Na komm, das Frühstück macht sich nicht von selbst.«
Diese meine Behauptung sollte einmal mehr zeigen, dass ich keine Ahnung hatte, wie die Dinge hier im Nuggr’schen Familienturm gehandhabt wurden. Tatsächlich bestanden die Frühstücksvorbereitungen in nichts anderem, als der Großküche Bescheid zu geben, was wir haben wollten und wann, und das prompt Gelieferte auf dem von Bschi gedeckten Tisch zu drapieren. Ich fragte mich, was um Lchnadras willen ich den ganzen Tag über tun sollte. Vielleicht konnte ich Juffgam dazu überreden, mich das Essen für uns vier selbst zubereiten zu lassen; wenigstens waren wir nicht so rückständig, dass Bschi nicht mit uns am Tisch sitzen durfte. Ich glaube nicht, dass ich es hätte ertragen können, wenn die Frau, die Kaldsdan mehr Mutter war, als ich es je sein würde, alleine hätte essen müssen.
Ich war gerade dabei, eine Platte mit aufgeschnittenen Slai-Früchten auf den Tisch zu stellen, als mein Ehemann in das Speisezimmer trat. Bei seinem alleinigen Anblick zuckte ich so zusammen, dass ich fast die Obstplatte hätte fallen lassen. Etwas in mir registrierte das mit Verachtung und bellte mir »Rückgrat!« zu. Juffgam schien meine Reaktion nicht zu bemerken, oder vielleicht deutete er sie falsch. Jeden
falls erhellte ein breites Lächeln sein Gesicht.
»Einen wunderschönen, guten Morgen, meine Liebste«, meinte er und war mit zwei großen Schritten bei mir, um mir einen Kuss auf den Mund zu drücken.
Ich glaube, ich hielt mich an der Obstplatte fest. Es ist nicht leicht, von einem Mann geküsst zu werden, dem man die Nacht zuvor noch die Kehle herausreißen hat wollen. Mein Gemahl lächelte nah an meinem Gesicht.
»Bschi«, sagte ich, ohne den Blick abzuwenden, »bitte hol Kaldsdan zum Frühstück.«
Ich hörte das Rauschen der Röcke der Südländerin, die in der Tür gestanden war, und wusste, mein Mann war ein Idiot. Der fuhr derweilen mit seiner unbeholfenen Hand über meinen mühsam aufgesteckten Zopf der Verheirateten Frau.
»Guten Morgen, Mynrichwy Nuggr«, sagte er mit einer belegten Stimme, die ich nicht leiden konnte.
»Guten Morgen, mein Gemahl«, antwortete ich beherrscht.
Weitere eheliche Konversation (oder Ähnliches) blieb mir durch Kaldsdans Auftauchen erspart. Der kleine Junge umarmte erst seinen Vater und dann, nochmals, mich. Ich unterdrückte einen Seufzer, während ich mich fragte, ob die Tatsache, dass mein Mann ein netter Idiot war, das Ganze besser machte oder schlimmer. Juffgam jedenfalls strahlte wie ein Wertstein, während wir uns um den Frühstückstisch versammelten. Er klatschte die Hände zusammen.
»So«, meinte er in einem Tonfall, als wäre er bereit, voller Tatendrang ein schweres Tagwerk anzupacken. »Ab heute sind wir eine richtige Familie. Und bestimmt wird es keinerlei Schwierigkeiten geben, wenn sich alle an ein paar einfache Regeln halten.«
Während mein Gatte begann, den Benimmkatalog herunterzubeten, den er sich höchstwahrscheinlich, vermutlich ganz alleine ausgedacht hatte, warf ich einen hilflosen Blick in die Runde. Bschi und Kaldsdan erwiderten ihn mit runden Unschuldsaugen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte irgendetwas in mir, das voller Bitterkeit und Selbstmitleid war, stets gedacht, mein Leben wäre eine Tragödie. Spätestens jetzt jedoch wusste ich es besser: Es war eine Farce.
Vairrynns Finger strichen über das rot-weiße Fell der Katze; es beruhigte ihn ein wenig, obwohl es eigentlich zur Besänftigung des ungehaltenen Tierchens gedacht gewesen war, das gar nichts davon hielt, aus dem Schlaf aufgestört zu werden, nur um nach Murrap-zum-Nichtsein-damit-taam verschleppt zu werden. Aber das mochte auch bloße Projektion sein. Eigentlich schien sich Mi recht wohl auf seinem Arm zu fühlen, zumindest ihrem lauten Schnurren nach zu urteilen.
Er sollte wirklich hineingehen. Hier auf ihrer Türschwelle zu stehen mit einer Katze auf dem Arm, die an den Fingern seiner linken Hand kaute, half niemandem weiter. Wahrscheinlich sollte er dankbar sein, dass er ein Familienmitglied der Frischverheirateten war, sonst hätte er sie für ganze zwei Nysdau nicht sehen können; er war nicht sicher, ob er es sechzehn Tage lang ausgehalten hätte. Aber Vairrynn hatte schon zu lange ihre Verwandtschaftsbande verflucht, und außerdem graute ihm vor dem, was er hinter dieser Tür vorfinden würde. Ein kleiner Teil seiner selbst, auf den er nicht stolz war, wünschte sich, er hätte einfach in Pektays Bett bleiben können. Der weitaus größere Teil wünschte sich, er könnte den kalten Monsterturm der Nuggrs von seinen Grundfesten reißen. Gegen diesen Teil hatte er nichts.
Vairrynn schloss kurz die Augen und dachte an Pektay. Er konnte weder fassen, wie dumm er gewesen war, noch, welch unverschämtes Glück er gehabt hatte. Was hatte ihn nur dazu gebracht, sich sinnlos zu betrinken, mit einer völlig Fremden ins Bett zu steigen und dann auch noch eben dieser Fremden sein dunkelstes Herzensgeheimnis zu enthüllen? Hatte er vergangene Nacht mit seinem tiefen Blick etwas in Pektay gesehen, das ihn ihr vertrauen ließ? Vielleicht, vielleicht nicht. Fakt war: Er hatte sich einfach vergessen wollen, für eine Nacht nur. Und dann hatte er genau das getan, sich im Alkohol vergessen und in der Frau, und dann einen Teil seiner selbst bloßgelegt, den er so sorgsam vor allen verborgen hatte, die sein Vertrauen so viel mehr verdient hätten als diese Fremde.
Und jetzt? Jetzt hatte er das Gefühl, an Pektay gebunden zu sein, wenn er auch nicht genau wusste, wie und warum. Ihm war klar, dass er ihr unendlich dankbar sein sollte, aber aus irgendeinem Grund war er das nicht. Vairrynn drückte Mi unwillkürlich enger an sich. Es war einer von diesen Tagen – jener Tage, da er sich selbst nicht leiden konnte und sich wünschte, irgendjemand anderer zu sein. Er tat einen letzten, tiefen Atemzug und drückte die Türklingel. Es war an der Zeit, etwas Rückgrat zu zeigen, wenn er auch nicht ganz so genau wusste, wo er es hernehmen sollte.
Eine dralle Südländerin mit hellblonden Ringellocken öffnete ihm die Tür. Sie war ein Wirbel aus dunklen Braun- und hellen Gelbtönen, die ihn ein wenig schwindlig machten, aber nett anzusehen waren. Sie lächelte ihm halb schüchtern, halb keck zu (und wie brachten Frauen so etwas eigentlich fertig?). Dann senkte sie artig den Blick, während sie darauf wartete, dass er sich vorstellte und sein Begehr kundtat. Er versuchte standhaft, nicht auf ihre Brüste zu starren, die fast aus ihrem Mieder fielen, während er seinen Namen und den vorgeblichen Zweck seines Besuches nannte: den Frischvermählten die traditionelle Aufwartung am Hochzeitsmorgen zu machen. Die Südländerin antwortete mit einer Reverenz, die noch artiger war als ihr gesenkter Blick, und verkündete, der Herr sei nicht zugegen, da er den Vater der Herrin holen gegangen sei (oh Freude!, dachte Vairrynn). Aber die Herrin würde sich sicher freuen, ihren Bruder zu sehen. Vairrynn kam sich vor wie in einem gut einstudierten, schlecht geschriebenen Puppenstück. Eigentlich wollte er nichts als weg von hier, in die weiten, nordischen Steppen, wo man die Erde mit Händen greifen und den warmen, lebendigen Leib eines Tygduls zwischen den Schenkeln spüren konnte – wo die Dinge echt waren und sein eigen. Aber er konnte Myn nicht im Stich lassen.
Die Südländerin trabte vor ihm her, und er folgte ihr in ein schlichtes, nicht allzu großes Zimmer, das wie ein Halbmond geformt war, dessen Bogen ganz aus Glas bestand – die deckenhohe Fensterfront der Wohnung, die einen zugegebenermaßen beeindruckenden Blick auf die glitzernden Familientürme des Murraptaamer Adelsviertels freigab. Mit einer letzten Reverenz wirbelte das Mädchen herum und ließ ihn allein. Vairrynn starrte ihrem wippenden Hinterteil konsterniert hinterher; eine so eigenartige Mischung aus korrekter Sittsamkeit und Koketterie war ihm noch nie zuvor untergekommen.
»Weißt du, es macht wenig Sinn, auf ihren Hintern zu starren, wenn sie gar nicht mehr da ist«, riss ihn eine sehr sardonische, dunkle Stimme aus seinen Betrachtungen.
Vairrynn fuhr der Schreck in alle Glieder und er hätte um ein Haar die arme Mi fallen lassen – nicht so sehr wegen der etwas ungerechten impliziten Anschuldigung, sondern weil er nicht, aber auch gar nicht, bemerkt hatte, dass sie überhaupt im Raum war. Er fuhr herum, und da saß sie auf der anthrazitfarbenen Ledercouch, die mit dem Rücken gegen die halbrunde Fensterfront stand und von der Vairrynn einen Moment zuvor noch hätte schwören können, dass sie leer war. Es schockierte ihn zutiefst, und er weigerte sich instinktiv, darüber nachzudenken, was es bedeutete. Lieber redete er sich damit heraus, dass Myn ein silbergraues Kleid trug, das sie vom Nacken bis zu den Knöcheln einhüllte und mit der Couch verschwimmen ließ.
Sie sah blass aus, irgendwie kalt und kleiner als sie war, ein bleicher Schatten der goldstrahlenden Kriegerin vom Tag zuvor. Langsam stand sie auf und schritt gemessen auf ihn zu; mit jedem Schritt schien sie etwas mehr an Substanz zu gewinnen. Vairrynn war nicht ganz sicher, was er da sah, ein Flattern von etwas wie ein dünner Gazeschleier, spinnwebengleich, ein feuerrotes Aufflackern und etwas Knochenweißes, das ihm die Nackenhaare aufstellte. Es gefiel ihm nicht, aber es war besser als nichts.
Als sie ihn schließlich erreicht hatte, war sie fast wieder Myn, sodass er sich beinah einreden konnte, er hätte sich eingebildet, was er gesehen und was er nicht gesehen hatte. Vairrynn unterdrückte einen Seufzer. Ohne Ftonim hatte er seine Nohsaga-Übungen sträflich vernachlässigt. Die Finger in Mis Fell vergraben, versuchte er, auf jenen Kern von Kraft zuzugreifen, von dem sein Freund so überzeugt war, dass er ihn besaß. Er würde jeden Schluckvoll davon brauchen. Niemandem war geholfen, wenn er auch noch begann, Geister zu sehen. Er tat ein paar tiefe Atemzüge und fühlte sich tatsächlich ein wenig besser.
Myn stand derweilen vor ihm und fuhr mit den Fingern durch Mis weiß-rotes Fell. Manchmal streiften die ihren die seinen.
»Wo hast du sie her?«, fragte sie schließlich und blickte auf.
Bildete er es sich ein, oder hatte sie tatsächlich mehr Farbe im Gesicht? Irgendetwas vibrierte in seinem Innern. Es fühlte sich recht eigenartig an. Er hatte den Drang, ein Netz aus dem Gefühl zu flechten. Seltsam.
»Vairrynn?«
»Wie bitte? Was? … Oh! Ich habe sie aus deines Vaters Haus geholt, was denkst du denn?«
Ihre Augenbraue hob sich. Moment mal! War das nicht seine Geste?
»Ich dachte, er hätte dir verboten, jemals wieder einen Fuß in sein Haus zu setzen.«
Vairrynn schnaubte. »Na und? Meinetwegen kann er sagen, was er will, das ist mir mittlerweile nun wirklich egal. Ich hatte den Verdacht, du würdest deinen kleinen Seelenwärmer hier brauchen.« – So hatte Myn die Katze Mi einmal genannt, ihren Seelenwärmer, und die Freude, die Vairrynn dabei durchströmt hatte, war so ein reines, ungetrübtes Gefühl gewesen, wie er es nur selten empfand.
Myn lächelte ein wenig und neigte ihren Kopf über das Tierchen auf seinem Arm. Ihr Haar roch wie nordisches Gras und Erde, und Vairrynn schloss für einen Moment die Augen. Er fragte sich, ob man jemanden zu sehr lieben konnte.
»Nimm sie mit in den Norden«, sagte Myn, den Kopf noch über Mi gebeugt.
»W… was?« Vairrynn glaubte, nicht recht gehört zu haben.
Seine Myn blickte auf, Ernst und Schmerz in den Augen, die so tief waren wie der Schlund eines Vulkans. Vairrynn musste hastig das Netz ausbreiten, das er sich gesponnen hatte, um zu verhindern, dass er hineinstürzte. Sie waren sich viel zu nahe.
»Sie ist eine Freiheitskatze, Vai«, sagte Myn derweilen. »Sie ist es gewohnt, halbe Tage lang in unserem Garten herumzustreunen. In diese Wohnung eingeschlossen, würde sie wahrscheinlich durchdrehen. Also nimm sie mit in den Norden. Wenigstens sie.«
»Myn …« Er würgte ihren Namen zwischen zwei oder drei Tränen hervor, die er nicht hatte vergießen wollen.
Sie lächelte traurig und enigmatisch zugleich. Vairrynn hätte sie mit einer Sphinx verglichen, hätte er gewusst, was das war.
»Nicht, Vairrynn. Es ist, was es ist. Je eher wir das akzeptieren, umso besser.«
Vorsichtig setzte er Mi ab, während diese Worte sein Innerstes verätzten, und wollte Myn in die Arme schließen. Doch sie hatte sich schon von ihm abgewandt und schritt in Richtung der abgerundeten Fensterwand. Vairrynn folgte ihr und stellte sich neben sie. Er kam sich ausgeliefert vor, fast nur von Glas umgeben, und vermied es, nach unten zu sehen. Sie waren nicht sehr hoch oben im Nuggr’schen Familienturm, den er beschloss, »das Monster« zu taufen, so wie er einst den Stammsitz der Neolys »die Trutzburg« genannt hatte. Schräg gegenüber schraubte sich das aus traditionellem Murraptaamer Sandstein bestehende Schneckenhaus der Familie Gertorrn in den Himmel (manche behaupteten, der Mörtel sei mit Halbedelsteinen versetzt, aber Vairrynn hielt das persönlich für ein Gerücht), während man hinter dem hellblauen, verspiegelten Kuppelbau der Fóm-Familie das obere Drittel der bombastischen Zytt-Pyramide ausmachen konnte, die selbst im gedämpften Licht dieses Tages in Dutzenden Türkis- und Grüntönen schimmerte. Es war fast blasphemisch, aber die Tatsache, dass aus dem Schoße der Zytts zu Zeiten der Oligarchie eine ganze Dynastie Oberster Priester entsprungen war, sanktionierte offenbar diese Profanisierung der heiligsten aller Farben. Vairrynns Finger, die er hinter seinem Rücken verschränkt hatte, zuckten, während er seinen Blick über die Wohnstätten der Murraptaamer Hocharistokratie schweifen ließ. Er war sich nicht ganz sicher, wonach sie sich sehnten – eine brennende Fackel, so wenig sie ihm gegen diese Ansammlung aus Stein, Stahl und Glas geholfen hätte, sein Tygdul, auch wenn Reywinn, all seiner Schnelligkeit zum Trotz, ihn nicht von sich selbst wegtragen konnte, Myn. Immer Myn.
»Was hältst du davon?«, fragte sie.
»Aristokratisch«, entgegnete er.
»Ich meinte das Zimmer«, sagte sie trocken. »Es ist nämlich meins.«
Er wandte sich um. Karg. Beengt.
»Ich kann es selbst einrichten«, meinte sie, als er stumm blieb. »Wie ich es möchte.«
Die Ironie in ihrer Stimme machte seine nächste Frage eigentlich überflüssig. Er sprach sie trotzdem aus: »Darfst du auch ein Bett aufstellen?«
Sie klackte mit der Zunge. »Dummchen! Das ist ein Boudoir und kein Schlafzimmer! Für ein solches, allein für mich, haben wir keinen Platz.«
Vairrynn wandte sich wieder ab und richtete den Blick auf die grün glitzernde Spitze der Zytt-Pyramide. Es war wirklich geschmacklos.
»Kein Bett.«
»Kein Bett«, echote sie. »Aber keine Sorge, seine Mätresse hat im Gegensatz zu mir ihr eigenes Zimmer.«
Vairrynn wandte sich ihr halb zu, eine Augenbraue erhoben. »Die Südländerin?«
»Die Südländerin. Nicht dass er sie bisher eines Blickes gewürdigt hätte, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr?«
Vairrynn schloss die Augen. »Hat er …«
»Ich will nicht mit dir darüber reden. Nicht jetzt. Nicht irgendwann sonst.«
Er hielt die Augen geschlossen, während er nickte.
»Er hat mir nicht wehgetan«, flüsterte sie neben ihm, kaum hörbar, aber es war immerhin etwas.
Vairrynn legte seine Hand flach auf die Fensterscheibe. Myn legte die ihre darüber. Irgendwo hinter ihnen, vielleicht auf der Couch oder auf einem der anthrazitfarbenen Lederstühle, schnurrte Mi. Wenn es seine Seele wärmen sollte, dann war es verschwendete Liebesmüh.
Das Bett war warm, und das war alles, was ihn momentan interessierte. Es ging doch nichts darüber, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und Musik gab es auch noch! … Moment, Musik? Mühsam versuchte Ftonim, sich aus seinem warmen Kokon aus Satin und Schlaf zu wühlen, während ihn ein Zeigefinger beharrlich in die Rippen piekste.
»Deine Hose singt.«
»Was? Wie bitte?«
»Deine Hose singt, und sie hört nicht auf. Also geh endlich ran!«
Ftonim stöhnte. »Es ist eindeutig zu früh am Tag für eine solche Konversation!«
»Beschwer dich bei dem, der so verzweifelt versucht, dich zu erreichen, Herzblatt.«
Ftonim stöhnte nochmals und schaffte es, sich so weit aus den dunkelblauen Satindecken zu wühlen, dass er unter dem Bett nach seiner Hose und dem in der Seitentasche verstauten Alleskönner suchen konnte. Vorhersehbarerweise hörte das Gesinge genau in dem Moment auf, da er das Kleidungsstück unter dem Bett hervorgezogen hatte. Mit einem letzten Aufstöhnen ließ er sich auf die Kissen zurücksinken.
»Übrigens rede ich nicht mehr mit dir«, sagte er zu seinem Bettpartner, während er zu der dunklen Zimmerdecke emporstarrte. Die Balken waren natürlich nur Holzimitat, aber trotzdem ansprechend. Doch er konnte Wottnompek ja auch nicht guten Gewissens einen erlesenen Geschmack absprechen. Ftonim selbst war schließlich der beste Beweis für denselben, um einen halben Wimpernschlag mal unbescheiden zu sein.
Das Rascheln der Bettdecken verriet Ftonim, dass der Musiker sich aufrichtete, um ihn anzusehen. »Warum nicht?«
Ftonim war mittlerweile versiert genug in gewissen Dingen, um die unterschwellige Sorge aus Wottnompeks Worten herauszuhören. Gut.
»Ich rede nicht mit hinterhältigen Verführern.«
Wottnompek lachte sein ansteckendes Lachen. »Das hat sich aber letzte Nacht ganz anders angehört.«
Ftonim wandte seinen Blick von der Balkendecke und fiel fast in Wottnompeks schwarzgesprenkelte Goldaugen. »Ich meine das fast ernst, weißt du.«
Wotts Gesicht verdunkelte sich. »Du warst neugierig, Herzblatt. Wenn das alles gewesen ist, dann ist das auch gut, aber bitte belüge dich nicht selbst.«
»Das gilt auch für dich«, entgegnete Ftonim, nahm jedoch seinen Worten ihre Schärfe mit einem kleinen, koketten Lächeln.
Wottnompek schmunzelte, und seine Augen wurden dunkler, und dann begann Ftonims Alleskönner wieder zu singen. Diesmal war es Wottnompek, der sich mit einem Aufstöhnen zurücksinken ließ, während Ftonim nach seiner Hose angelte, um dem beharrlichen Anrufer endlich die Befriedigung zu geben, ranzugehen. Was bei der Einheit konnte so wichtig sein, um deswegen jemanden am Tag nach der Rückkehr der Lchnadra zu einer so unheiligen Zeit aus dem Bett zu rufen?
Recht ungehalten ließ Ftom mit einem leichten Druck seiner Fingerkuppen einen schmalen, handgroßen Zylinder aus dem ovalen Alleskönner entstehen und hielt sich den kleinen Lautsprecher ans Ohr. Er konnte Headsets nicht leiden; er hatte immer den Eindruck, sie verstopften ihm die Ohren.
»Was?!«
»Wo immer du bist, gibt es da einen Äther-Zugang?«, drang die Stimme seines Vaters aus den kleinen Kopfhörern. Sie klang wie an dem Tag, da sich die Nachricht der Verhaftung und Verurteilung der Nembdr Lys Neoly wie ein Lauffeuer im ganzen Reich verbreitet hatte.
Ftonim richtete sich auf. Ihm war eiskalt. Innerlich.
»Was ist passiert?«
»Geh in den Äther. Ich kann es nicht in Worte fassen. Errodd, das ist der Anfang vom Ende.«
Was? Ftonims Hand, die nicht gerade den Alleskönner an sein Ohr hielt, vergrub sich in Wottnompeks dunkle Satindecken. Was um der Einheit willen …? Er spürte die warmen Hände seines Bettgenossen auf seinen Schultern. Unwillkürlich lehnte er sich in die Umarmung, während er sich halb zu Wottnompek umdrehte und das Wort »Holographer« mit den Lippen formte.
»Welche Sphäre?«, formte Wottnompek zurück und Ftonim gab die Frage weiter.
»Völlig egal«, war die Antwort seines Vaters.
Oh Wy. Das verhieß nichts Gutes. Wenn sich ein Thema über alle prominenten Äther-Sphären zog, dann war es entweder ein ausgewachsener Skandal oder etwas Welterschütterndes. Ftonim machte eine scheuchende Geste in Wottnompeks Richtung, der mit den Schultern zuckte und hinter sich an das Kopfende des Bettes griff (es war aus demselben dunklen Holzimitat wie die Balken an der Decke, aber das war jetzt nicht wichtig). Direkt dem Bett gegenüber aktivierte sich eine Holographische Wand, die Ftonim zu jeder anderen Zeit mit einem bewundernden Zähnepfeifen kommentiert hätte. Jetzt sah er nur das, was sie zeigte. Wottnompeks Hand krampfte sich um Ftonims rechte Schulter, die Ftonims um das Bettlaken.
»Allgütige Einheit«, hauchte er.
Wottnompek sagte gar nichts, aber er atmete schwer, als befände er sich am Rande einer Panikattacke. Auf der Holographischen Wand tummelten sich Gestalten, die das Schattenreich aus seinen dunkelsten Tiefen gespien zu haben schien, und töteten Singisen. Ftonim starrte auf die unfassbaren Szenen, die Augen weit wie ein erschrecktes Beutetier, die Ohren voll mit den panischen Atemzügen Wottnompeks und den zitternden seines Vaters.
»Was … was …« Er brachte nicht mehr über die Lippen, beim besten Willen nicht.
»Errodd, du hast die Geschichten gehört«, drang die Stimme seines Vaters gepresst an sein Ohr. »Mehr noch, du warst da draußen. Du weißt, was sie sind.«
»Drachenfrauen«, hauchte Ftonim. Er spürte, wie ein Schaudern durch Wottnompeks Körper lief, das sich vertraut anfühlte, es aber nicht war.
Gütige Einheit, was war da nur passiert? Die Frauenkreaturen vor ihm auf der Wand waren furchterregend, ja, aber Ftonim war Raumfahrer und Geschäftsmann, und er wusste, dass man Anderweltliche nicht mit singisischen Maßstäben messen durfte. Es musste einen Grund dafür geben, warum die Drachenfrauen singisische Soldaten massakrierten, und Ftonim fragte sich, was beim Mech-Memnáh da nur so kolossal schiefgegangen war.
Vielleicht hatte er seine Gedanken laut ausgesprochen, denn sein Vater auf der anderen Seite der Leitung sagte: »Es kommt noch schlimmer.«
Túnn Sar musste sich die Übertragung bereits einige Male zu Gemüte geführt haben, überlegte irgendein Teil von Ftonim, denn genau in diesem Moment wechselte das Bild von tötenden Drachenfrauen zu einem ernstgesichtigen Nachrichtensprecher, der in knappen Sätzen das Schicksal der von allen so heiß bewunderten Mirnwy schilderte, deren Crew in die Fänge der dämonischen Drachenfrauen geraten war. Ftonim nahm die Worte kaum auf; er wartete auf das, was sein Vater als den Anfang vom Ende bezeichnet hatte. Und dann kam es.
»Als Reaktion auf diese noch nie dagewesene Bedrohung für das Memnáh«, sagte der Nachrichtensprecher, »hat die Runde der Berufenen auf Antrag des Kommandanten der Reichsstreitkräfte, genannt Lo Krynwell, den Reichsvorsteher und Obersten Priester Ktorram Asnuor als Feldherr des Wy eingesetzt.«
Der Alleskönner-Zylinder entglitt Ftonims Fingern und fiel auf dunklen Satin. Irgendwo klackte ein Zeitzähler, das merkte er jetzt erst, was seltsam war, denn er hasste dieses Geräusch. Er hatte immer das Gefühl, es ließe sein Herz schneller schlagen.
»Errodd? Errodd!«, tönte die Stimme seines Vaters klein und fern aus den dunkelblauen Falten der Bettdecke, und Ftonim hatte vergessen, was er tun musste, um ihm zu antworten. Die Holographische Wand deaktivierte sich und Ftonim starrte auf die weißverputzte Zimmerwand. Sie hatte Risse, und das erschien ihm seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam, seltsam, seltsam, seltsam, seltsam, seltsam, seltsam, seltsam, selt…
»Túnn? Er ruft dich zurück«, sagte jemand.
Seltsam. Seltsam. Seltsam.
»Was soll das heißen? … Nein, natürlich nicht! … Wy, seit wann bist du unter die Kleingeister gegangen? … Hör zu, wir haben jetzt wirklich andere Probleme. … Das glaube ich dir, aber … Nein. … Nein! … Nein, du hörst mir zu, er ist in Schock, Túnn! … Nein. … Ja, natürlich. … … Nein, Túnn, du musst nicht kommen und ihn holen. … Túnn! Túnn! … Bastard. … … Ftonim?«
Ftom blinzelte einmal, ganz langsam. Ktorram Asnuor. Er blinzelte noch einmal. Feldherr des Wy. Augen zu, Augen auf. Immer noch wahr. Vairrynn!
»Gib mir den Alleskönner«, sagte Ftonim heiser.
Der kleine Zylinder wurde ihm in die Hand gedrückt. Es brauchte nur einen weiteren Druck seiner Fingerkuppen.
»Ftom?«, sagte die Stimme am anderen Ende. Für einen Moment erlaubte sich Ftonim, sich daran festzuhalten.
»Errodd, ich muss dir etwas sagen.«
Stille. Dann: »Ja, ich höre.«
Ftonim holte einen tiefen, tiefen Atemzug, dachte an Asnuor und an Vairrynn und hatte Angst. Er wusste, er sollte Angst um das gesamte Reich haben, aber jetzt, im Moment, hatte er nur Angst um seinen Freund.
»Ftom?«
»Es ist besser, du setzt dich, Errodd.«
»Du solltest wirklich ein Stück von dem Kuchen versuchen, den dir deine neue Tante … wie heißt sie? Nusnum? … vorbeigebracht hat.«
»Sumnu. Ich wusste nicht, dass du ein so schlechtes Namensgedächtnis hast. Und, nein, Vairrynn, ich werde nicht wieder damit anfangen, keine Nahrung mehr zu mir zu nehmen, selbst wenn du mir nicht jeden Bissen in den Mund hineinzählst. Und hör auf, mich so anzusehen. Der Blick passt nicht zu dir.«
Mein Bruder versuchte tapfer, mich nicht länger mit einer Miene zu betrachten, wie man sie sonst nur bei einem bettelnden Wchlach sieht, und steckte sich eine Gabel von Tante Sumnus Kuchen in den Mund, wahrscheinlich um nicht irgendetwas auf meine Worte zu antworten.
Es war … schwer. Ich wusste, dass Vairrynn den Drang verspürte, irgendetwas für mich zu tun, auf mich aufzupassen, so wie er es immer getan hatte, aber er musste begreifen, dass nichts mehr so war wie vorher. Wir mussten uns eine neue Beziehung um die Umstände herumbauen und konnten nicht einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört hatten – obwohl ich zugeben musste, dass ich nicht sicher war, wo genau das eigentlich war.
Der gestrige Tag war ein einziger, verschwommener Albtraum in meinem Kopf bis auf einige Momente, die mir vorkamen wie winzige, isolierte Zeitkristalle, die nichts mit dem Rest zu tun hatten – Vairrynn und ich in enger Umarmung im Schatten des Spiegelsaals, ein stummes »Ich liebe dich« und jener Augenblick, in dem wir als ein einziges Wesen geatmet hatten. Kleine, in sich abgeschlossene Zeiträume, in denen etwas passiert war, das jenseits der Grenzen dieser Welt lag.
Ich schüttelte den Kopf; er schmerzte, und ich dachte Unsinn.
»Was ist?«, fragte mein Bruder sofort.
Behutsam legte er seine Hand auf meine, die auf der makellosen weißen Tischdecke im makellosen Esszimmer in der makellosen Wohnung meines Gatten ruhte. Seine Handfläche war warm und ein wenig rau, und irgendwo in meinen Kopf schrillten Alarmglocken, aber ich war zu erschöpft, um darüber nachzudenken.
»Müde«, murmelte ich und schloss die Augen. Viel zu müde.
Den ganzen Vormittag über hatte ich die traditionellen Hochzeitsbesuche meiner nächsten Verwandten über mich ergehen lassen, bis endlich der vor der Tür gestanden hatte, auf den ich die ganze Zeit gewartet hatte, und jetzt, da er hier war, hatte ich zum ersten Mal seit einer Ewigkeit das Gefühl, lockerlassen zu können. Er war ja da, um mich aufzufangen.
»Vairrynn«, flüsterte ich. Mir war, als hätte ich nie zuvor seinen Namen ausgesprochen. Es musste an der Übermüdung liegen.
Ich wusste, dass mir Tränen über die Wangen liefen, aber ich konnte sie nicht zurückhalten. Oh Göttin, ich hatte keine Ahnung, wie ich es ertragen sollte! Ich versuchte es ja, ich wollte es ja, mutig sein und stark und ergeben, aber ich wusste nicht, wie! Da war etwas in mir, was mich all das nicht sein lassen wollte, das etwas anderes wollte, und es war hungrig und gierig, und es war wild. Ein Schluchzer würgte sich aus meiner Kehle, und einen Moment später hatte mich mein Bruder auf die Füße gezogen und umschloss mich mit seinen starken Armen. Ich hatte den absurden Drang, in ihn hineinzukriechen und dort zu bleiben, sodass sie mich aus ihm herausschneiden hätten müssen, wollten sie uns trennen. Kannsa und Farrn. Die Chyndrai-Geschwister, die sich so sehr liebten, dass sie zu einem einzigen Wesen verschmolzen, bis Machúnn Dahn, der größte Held aller singisischen Zeiten, sie mit einem Hieb seines göttlichen Schwertes wieder voneinander trennte. Beinah hätte ich hysterisch gelacht, doch stattdessen klammerte ich mich an meinem Bruder fest mit all der Kraft, die ich besaß. Er gab ein kleines, ersticktes Geräusch von sich, als drückte ich ihn zu fest.
»Vairrynn«, flüsterte ich wieder, und er beugte sich ein Stück von mir weg, um mich anzusehen.
Das silbrige Licht hinter seinen Augen war sehr hell. Vielleicht würde ich darin finden, was ich suchte, wenn ich ihm nur nahe genug kommen konnte und tief genug …
»Myn, bist du traurig?«
Ich riss mich von dem Licht in Vairrynns Augen los und blickte zur Tür, wo Kaldsdan stand und uns sorgenvoll beobachtete. Ngdra. Ich zwang mir ein Lächeln auf die Lippen.
»Ein wenig, Kals. Aber Vairrynn hat mich getröstet, und jetzt ist alles wieder gut.«
Mein Bruder drückte mich ganz leicht an sich bei diesen Worten. Es macht keinen Sinn, Kinder zu belügen, aber zu viel Wahrheit ist auch nicht gut. Kaldsdan strahlte und sprang zur Begrüßung auf Vairrynn zu, der ihn auffing und einmal im Kreis wirbelte. Ich musste schmunzeln; der Kleine liebte mich aus irgendeinem Grund, aber meinen großen Bruder vergötterte er.
»Hey, Großer«, sagte Vairrynn, nachdem er meinen kichernden Stiefsohn wieder abgesetzt hatte. »Wo kommst du denn so plötzlich her?«
»Ich war mit Vater unterwegs! Wir haben Onkel Eftnek abgeholt, weil er Myn ganz doll vermisst, weil er sie doch jetzt nicht mehr jeden Tag sieht, weil sie doch jetzt bei uns wohnt, und er ist mit uns mitgekommen, obwohl er ganz wütend ist wegen dem bösen Mann.«
Vairrynn und ich wechselten einen verwirrten Blick.
»Welcher böse Mann?«, fragte mein Bruder, doch ehe Kaldsdan antworten konnte, schrillte Vairrynns Alleskönner.
Ich zuckte zusammen; er sollte sich wirklich einen anderen Alarmton aussuchen. An dem Lächeln, das sich auf das Gesicht meines Bruders stahl, erkannte ich, wer der Anrufer sein musste, noch ehe er ihn mit »Ftom?« begrüßte. Wahrscheinlich lächelte ich genauso, wenn auch nicht für lange.
»Ja, ich höre«, sagte mein Bruder, und dann wieder: »Ftom?«
Ich runzelte die Stirn. War etwas nicht in Ordnung?
»Jetzt mach’s nicht so spannend! Was bitte kann so schlimm … Ja, ich höre dir doch zu!«
Und das tat er dann, zuhören, und während er es tat, wich mehr und mehr Farbe aus seinem Gesicht. Kraftlos sank er auf seinen Stuhl zurück.
»W… was?«, hauchte er.
Ftonim schien noch mehr zu sagen, aber ich glaube nicht, dass mein Bruder es hörte. Mit leerem Blick starrte er auf etwas, das nicht da war, und ich hatte nie, nie zuvor diesen Gesichtsausdruck bei ihm gesehen. Ohne nachzudenken, riss ich ihm den Alleskönner aus der Hand.
»Was hast du zu ihm gesagt?«
»Feuerfee?«
»WAS HAST DU GESAGT?«
»Oh Einheit, Myn … Sie haben Ktorram Asnuor zum Feldherrn des Wy gemacht.«
Vor meinen Augen züngelte der Scheiterhaufen meiner Mutter.
»Nein!«
»Doch, Myn. Sie … was weiß ich, sie sagen, es ist eine Krisensituation, und dass wir Einigkeit und Stärke brauchen, dass das Reich feste Führung braucht …«
»Ktorram Asnuor!«, zischte ich.
»Ich weiß, Kleines.«
»Du weißt gar nichts!«, fauchte es aus mir heraus. Vage war ich mir bewusst, dass Kaldsdan mich erschrocken ansah, aber das hätte mir in diesem Moment nicht gleichgültiger sein können.
Ktorram Asnuor. Irgendetwas passierte in mir. Ich hatte in den vergangenen Jahren die Existenz dieses Mannes und das Unrecht, das er getan hatte, so gut verdrängt, wie ich konnte. Doch auf einmal ballte sich in mir eine Wolke von Hass zusammen gegen diesen unscheinbaren Mann, in dem sich ein Dämon verbarg, und das Ding in mir, das Drache und Tiger war und Hauer hatte und Krallen, entrollte sich und brüllte nach Nahrung.
»Ich töte ihn«, fauchte es, lautlos fast, doch nicht ganz.
»Was?«
»Nichts, Ftom, gar nichts. Danke für die Warnung.«
Ich legte auf, ohne auf ein weiteres Wort von ihm zu warten, dachte an meinen Drachentraum, an Asnuor, der auf einem Thron aus Drachenschuppen saß wie der absolute Herrscher, der er jetzt war. Woher hatte ich das gewusst? Weil ich ihn durchschaute, den Obersten Priester, den Feldherrn des Wy, auf eine fundamentale Art und Weise, weil ich den Anderen gesehen hatte, der hinter seinen Augen wohnte, als ich nicht älter gewesen war als Kaldsdan jetzt, und weil ich ihn hatte lächeln sehen?
Weil ich ihn kannte. Ich wusste nicht, warum, aber ich kannte ihn. Der Tigerdrache in mir fletschte die Zähne. Warte nur. Warte. Mein Vater und mein Ehemann traten in das Esszimmer. Der Tigerdrache rollte sich zusammen, irgendwo in einer Ecke meines Herzens. Warte.
Die dunklen Augen meines Vaters glitten über Vairrynn und mich. Sie flackerten nicht.
»Ihr wisst es schon«, stellte er fest.
Juffgam seufzte. »Wirklich, Eftnek, ich glaube, du überreagierst ein wenig. Wer weiß, vielleicht ist der Oberste Priester genau der Richtige, um das Reich in dieser dunklen Zeit zu führen.«
Drei Paare von Neoly-Augen bohrten sich in meinen Ehemann.
»Juffgam, unser neuer Feldherr ist der Mörder meiner Frau«, meinte mein Vater trocken.
Darauf wusste mein Gemahl nichts zu sagen.
»Und nun, Alte? Was jetzt?«, fragte ich in die hallende Kuppel des Tempels hinein, doch die Erste Dienerin der Lchnadra hörte mich nicht, obwohl sie inbrünstig zu mir betete. Zu mir, der Gevatterin, der letzten Kraft, die sie nicht einmal als solche anzuerkennen bereit war. Jorngiss Neoly hatte diesen Aspekt der Göttin noch nie verehrt. Wie sie es trotzdem an die Spitze des Ordens geschafft hatte, war mir ein kleines Rätsel, aber Sterbliche sind mir das oft. Ich mag die eine große Konstante dieses Universums sein, doch mehr bin ich auch nicht.
Ungehalten tippte ich die Fingerspitzen gegeneinander und Knochen klackte auf Knochen. Die greise Frau lag auf den Knien im Herzen ihrer Tempelstadt. Das zentrale Heiligtum des Lchnadra-Ordens war eine kleine, außen wie innen mit Gold überzogene Kuppel, von der es vermutlich gut war, dass sie schon seit Zeitaltern kein Mann mehr betreten hatte. In den Überlieferungen des Ordens heißt es »nie«, aber das ist ein zu großes Wort für Sterbliche. Hätte ein Außenstehender diesen Ort zu Gesicht bekommen, sie hätten ihn bis auf die Grundmauern geschleift. Zu blasphemisch war, was zwischen den abgerundeten Wänden abgebildet war, und die Singisen verabscheuen Blasphemie wie nichts sonst auf der Welt, als fürchteten sie, ihr Wy könnte jederzeit, endlich, vom Himmel steigen und seine Späten Kinder aus der Schöpfung brennen. Dass sie den Himmel leer gefunden haben vor so vielen Jahren, als sie dazu ansetzten, ihn zu erobern, hat sie in ihrem Glauben nicht irrewerden lassen wie so viele andere. Doch ihre Angst, die ist gestiegen, umso mehr, seit sie wissen, dass der Himmel nicht so leer ist, wie es zuerst erschien.
»Oh, Lchnadra, Große Mutter, erbarme Dich Deiner Kinder und schließe sie in Dein gütiges Herz«, flehte die alte Frau, die vor einer der vier Göttinnenstatuen unter der goldenen Kuppel kauerte.
Es war das Abbild der Gebärerin. Aus ihrem Unterleib brach die Schöpfung hervor und ergoss sich zwischen ihre weit gespreizten Beine. Es sah unerquicklich aus. Die wimmernde Alte mochte das jedoch anders empfinden. Immerhin sandte sie ihre Gebete ja zu der Gebärenden, wenn sie sich eigentlich, wäre sie ehrlich gewesen, an die Inkarnation der Göttin hätte wenden sollen, die in ihrem Rücken stand. Schließlich wünschte sie einem Mann den Untergang. Doch Jorngiss, einst eine Neoly, jetzt Erste Dienerin der Lchnadra, betete nie zu der Bezwingerin.
Ich wandte mich um und betrachtete die Statue, die dem Abbild der mit einem huldreichen Lächeln in den Wehen liegenden Göttin gegenüberstand. Eine ausgezehrte Frau erwiderte mit hungrigem Blick den meinen, eine Lanze in der hocherhobenen knochigen Hand, die andere wie eine Klaue um ein rohes Herz geschlossen, das so aussah, als würde es noch schlagen. Blasse Haut spannte sich über spitze Wangenknochen, und es war nicht schwer, den Schädel hinter dem ausgemergelten Gesicht zu erahnen, in dem nur die gierigen Augen lebendig schienen. Wildes, dunkelrotes Haar fiel um den nackten Körper der Frau, der, ihrer Magerkeit zum Trotz, eine schreckliche Kraft verriet. Eine schwarze und eine goldene Schlange ringelten sich um ihre Beine, und unter ihren Füßen wurden ausgebleichte Schädel zermahlen. Ich legte den Kopf schief. Das ganze Gebilde war zugleich grauenvoll und ästhetisch, und ich fragte mich, ob sie Baudelaire gefallen hätte, diese Blume des Bösen. Ich für meinen Teil konnte mich nie entscheiden, ob ich mich hiermit verstanden fühlte.
Die Alte in meinem Rücken greinte weiter, und ich schritt zur nächsten Statue, links von mir. Das Abbild zu meiner Rechten, von Wy und Lchnadra Seite an Seite auf ihrem Herrscherthron, ignorierte ich. Es hatte seinen ganz eigenen Reiz, voller Ruhe und Würde. Aber danach war mir heute nicht, und selbst wenn, hätte es mir das Gejammere der Alten doch nur verdorben. Also glitt ich zu dem letzten der vier Kunstwerke unter der goldüberzogenen Kuppel. Auch vor diesem hatte die Erste Dienerin der Lchnadra noch nie gebetet. Vielleicht fürchtete sie, ihre Bitten könnten aus Versehen an die falsche Adresse geraten. Ich hielt es für die schönste Plastik im Herzen des Tempels, und natürlich war es auch die blasphemischste. So häretisch es auch sein mochte, die Göttin als Gebärerin der Schöpfung und als Wy gleichgestellt abzubilden, so war das doch nichts gegen diese Darstellung von Lchnadra in engster Umarmung mit ihrem abtrünnigen Sohn.
Beide waren sie nackt, und die Künstlerin hatte nichts der Vorstellungskraft überlassen (Sinnéh hatte nie etwas für Zurückhaltung übriggehabt). Lchnadra saß in Dechals Schoß, den Kopf zurückgeworfen, den Rücken in einem ekstatischen Bogen zurückgewölbt, die Augen geschlossen, den Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Es war ein Triumphschrei. Ich wusste es, denn ich hörte ihn. Dechals starker Arm stützte Lchnadras Rücken. Seine Lippen schwebten eine Fingerbreite über ihrer Haut, und auch seine Augen waren geschlossen. Sein Gesichtsausdruck war eine eigenartige, anrührende Mischung aus Ekstase und Leid. Die Hand, die nicht die Mutter-Geliebte stützte, war auf seinem Oberschenkel zu einer verzweifelten Faust geballt, und schwarze Ornamente zogen sich wie groteske Adern seinen Arm empor. Nur wer genau hinsah, entdeckte, dass das Muster, das sie bildeten, sein Spiegelbild in einer Blumenranke fand, die sich Lchnadras linken Arm emporwand. Ich seufzte. Sinnéh, die doch nichts anderes hatte erreichen wollen, als zu provozieren, war es damals gelungen, eine uralte Wahrheit in Stein zu bannen. Diese Wahrheit hatte nichts mit mir zu tun, aber ich liebte das Abbild trotzdem. Ich fragte mich, ob es Vairrynn, meinem auserwählten Seelenlicht, meinem jungen, jungen Himmelsreiter, das Herz erleichtern würde, diese Interpretation des Großen Frevels zu sehen. Doch die Frage war müßig, und für so etwas bin ich eigentlich zu alt.
»Große Göttin, erbarme Dich unser!«, rief die Greisin aus, und ich seufzte erneut, tiefer diesmal und entnervt.
Langsam schritt ich zu dem knienden Koboldweiblein hinüber und ging neben ihr in die Hocke. »Was willst du denn, dass ich tue, Jorngiss Neoly, hm? Soll ich Ktorram Asnuor aus der Welt tilgen? Du solltest wissen, dass mir so etwas nicht gebührt.«
Mühsam richtete sich die Alte auf und hievte sich mithilfe des Heiligen Stabs der Lchnadra auf die Beine. Ein letztes Mal neigte sie den Kopf vor der Statue der Gebärerin und verließ dann langsam das Herz ihres Tempels. Gemessenen Schrittes, der die Tatsache verbarg, dass ihre morschen Knochen sie nicht mehr schneller trugen, bahnte sie sich ihren Weg durch die Äußeren Anbetungshallen und die Reihen von knieenden Lchnadra-Dienerinnen. Der Anblick der vielen gebeugten Häupter und das sanfte Summen, das wie eine Decke von Gebeten über den Köpfen der Frauen hing, beruhigte Jorngiss ein wenig. Die Erste Dienerin hatte einen allgemeinen Fürbittentag in der Heiligen Stadt ausgerufen, und es schien, dass alle ihrem Geheiß gefolgt waren.
Gut, dachte die Alte; sie würden die Kraft eines jeden einzelnen Gebets brauchen.
Jorngiss fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, um sich den mit Kräutern verdünnten Kness-Rauch aus den Augen zu reiben, der in Schwaden durch die Anbetungshallen waberte. Das Reich stand am Rande des Abgrunds. Die Ernennung Ktorram Asnuors zum Feldherrn des Wy hatte sie, die Erste Dienerin, völlig überrumpelt. Was nur hatte Lo Krynwell dazu gebracht, einen so absurden Vorschlag zu machen? Hatte der alte Haudegen den letzten Rest seines Verstandes verloren? Oder war es dem Obersten Priester gelungen, den integren Kommandanten auf seine Seite zu ziehen? Jorngiss hatte Lo Krynwell immer für einen Ehrenmann gehalten, aber die Netze Dechals waren eng geknüpft, und ihre Fäden fast unsichtbar. Warum sollte sich nicht sogar ein Mann wie Krynwell in den Fangstricken des Feindes verheddern?
Jorngiss’ Hand krampfte sich um den Heiligen Stab, die Insignie ihrer Macht, während sie durch das äußere Tor des Tempels trat. Vor ihr breiteten sich die niedrigen Lehmziegelhäuser der Heiligen Stadt aus, rechts erstreckten sich die immergrünen Tempelgärten, und links schmiegte sich ein kleineres Gebetshaus zwischen den ausgedehnten Komplex des Haupttempels und die dicke Festungsmauer, die die gesamte Stadt einschloss. Die Alte blieb kurz stehen. Der immer präsente Wind der Östlichen Steppen wehte ihr die paar weißen Strähnen ums Gesicht, die sich aus ihrer kronenförmigen Hochfrisur gelöst hatten. Er trug den Geruch von Regen mit sich, und die dicken Wolken, die den Himmel überzogen, sahen so aus, als gingen sie schwanger. Nicht mehr lange, und die Regenzeit würde über das Land hereinbrechen. Doch Jorngiss bezweifelte, dass sie diesmal die Welt reinigen würde; dafür würde es mehr brauchen als ein bisschen Wasser vom Himmel.
Die Erste Dienerin der Lchnadra holte tief Atem. Natürlich hatte sie gegen die Ernennung Asnuors zum Feldherrn gestimmt wie auch einige andere tapfere Seelen, die noch nicht ganz dem Wahn verfallen waren, von dem der Rest des Reiches besessen schien. Aber es waren bei Weitem nicht genug gewesen, und jetzt hielt Asnuor die alleinige Macht in seinen Händen. Der Feldherr des Wy war ein Autokrat, der von niemandem abgesetzt werden konnte außer vom Obersten Priester des Wy. Und Ktorram Asnuor war nun beides.
Jorngiss stieß ein bitteres Lachen aus. Hatte denn keiner dieser Wahnsinnigen das bedacht? Es war eine Katastrophe. Jorngiss hatte diesen Mann sträflich unterschätzt, diesen Schattengeist, der sich neuerdings hinter der Maske des klugen Politikers versteckte und seine Häresie in glatte Worte verpackte. Er hatte das gesamte Reich seine wenig reputablen Wurzeln vergessen lassen, dieser Emporkömmling, dieser Fanatiker, dieser Demagoge! Im Rampenlicht hatte er sich verborgen, dieser Gotteslästerer, der Lchnadra einst offen den Krieg erklärt hatte, und hatte sich vor aller Augen an die Spitze des Memnáh geschlichen! Was sollte ihn jetzt noch daran hindern, seine Schergen in die Schlacht gegen die Göttin und ihre Töchter zu führen?