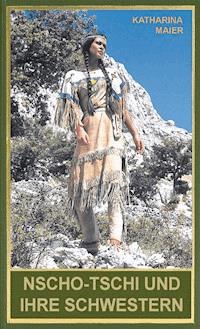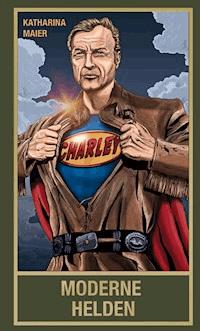Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marix Verlag ein Imprint von Verlagshaus Römerweg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: marixwissen
- Sprache: Deutsch
Osten und Westen haben den Europäer seit jeher gleichermaßen fasziniert. Und wodurch lässt sich eine Kultur besser verstehen als durch die Werke ihrer großen Dichter und Schriftsteller? Das vorliegende Buch möchte schlaglichtartig sowohl die amerikanische als auch die uns bei weitem ferner liegende asiatische Literatur be- leuchten, indem es deren berühmteste Vertreter vorstellt – von dem großen Inder Kâlidâsa aus dem 4. Jahrhundert bis zum ersten türkischen Nobelpreisträger Orhan Pamuk im Jahr 2006, von Chinas Dichtergott Du Fu bis zur US-Ikone Mark Twain, von der überragenden kanadischen Gegenwartsautorin Margaret Atwood bis zur chilenischen Geisterhaus-Verfasserin Isabel Allende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M.A. phil. Katharina Maier, geb. 1980, hat Vergleichende Literaturwissenschaften studiert und arbeitet inzwischen als freie Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre Spezialgebiete sind der populäre historische Roman der letzten 25 Jahre, die Literatur der Aufklärung und der Goethezeit, europäische und amerikanische Literatur des 19. Jahrhunderts, das neuere irische Drama, die Lyrik des frühen 20. Jahrhunderts und der englische Roman der Postmoderne. Sie ist seit 2005 als Redaktionsassistentin für Anglia. Zeitschrift für Englische Philologie tätig.
Zum Buch
Die großen Literaten der WeltAmerika und Asien
Osten und Westen haben den Europäer seit jeher gleichermaßen fasziniert. Und wodurch lässt sich eine Kultur besser verstehen als durch die Werke ihrer großen Dichter und Schriftsteller? Das vorliegende Buch möchte schlaglichtartig sowohl die amerikanische als auch die uns bei Weitem ferner liegende asiatische Literatur beleuchten, indem es deren berühmteste Vertreter vorstellt – von dem großen Inder Kãlidãsa aus dem 4. Jahrhundert bis zum ersten türkischen Nobelpreisträger Orhan Pamuk im Jahr 2006, von Chinas Dichtergott Du Fu bis zu den US-Ikonen Mark Twain und Ernest Hemingway, von der überragenden kanadischen Gegenwartsautorin Margaret Atwood bis zur chilenischen »Geisterhaus«-Verfasserin Isabel Allende.
Katharina MaierDie großen Literaten der Welt
Katharina Maier
Die großen Literatender Welt
Amerika und Asien
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Es ist nicht gestattet, Abbildungen und Texte dieses Buches zu scannen, in PCs oder auf CDs zu speichern oder mit Computern zu verändern oder einzeln oder zusammen mit anderen Bildvorlagen zu manipulieren, es sei denn mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © by marixverlag GmbH, Wiesbaden 2012Korrekturen: Ortrun Cramer, WiesbadenCovergestaltung: Thomas Jarzina, KölnBildnachweis: akg-images GmbH, BerlineBook-Bearbeitung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
ISBN: 978-3-8438-0236-9
www.marixverlag.de
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT: LITERARISCHE SCHLAGLICHTER AUF OST UND WEST
KĀLIDĀSA (4./5. Jhd.)
DU FU (712–770)
ONO NO KOMACHI (9 Jhd.)
(ABŪ ‘ABDOLLĀH DJA’FAR BEN MOHAMMAD) RŪDAKĪ (UM 859–941)
MURASAKI SHIKIBU (UM 948–1016)
(ABŪ MUHAMMAD AL-QĀSIM) AL-HARĪRĪ (1054–1122)
LI QINGZHAO (UM 1084–1150)
HĀFEZ (CHÂDĒ SHANSÒ D-DĪN MOHAMMAD) (1326–1390)
YUN SEONDO (1587–1617)
WU CHENG’EN (UM 1500–1582)
MATSUO (MUNEFUSA) BASHŌ (1644–1694)
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (JUANA INÉS DE ASBAJE Y RAMÍREZ DE SANTILLANA) (1651–1695)
EDGAR ALLAN POE (1809–1849)
HERMAN MELVILLE (1819–1891)
WALT WHITMAN (1819–1892)
EMILY DICKINSON (1830–1886)
MARK TWAIN (SAMUEL LANGHORNE CLEMENS) (1835–1910)
JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS (1839–1908)
HENRY JAMES (1843–1916)
RABĪNDRANĀTH TAGORE (RABĪNDRANĀTH THĀKUR) (1861–1941)
E(MILY) PAULINE JOHNSON (TEKAHIONWAKE) (1862–1913)
RUBÉN DARÍO (FÉLIX RUBÉN GARCÍA SARMIENTO) (1867–1916)
NATSUME SŌSEKI (NATSUME KINNOSUKE) (1867–1916)
GERTRUDE STEIN (1874–1946)
MUHAMMAD IQBAL (1877–1938)
LU XUN (ZHOU SHUREN) (1881–1936)
KHALIL GIBRAN (ĞIBRĀN HALĪL ĞIBRĀN) (1883–1931)
EZRA POUND (1885–1972)
SAMUEL JOSEF AGNON (SCHMUEL JOSEF HALEVI CZACZKES) (1888–1970)
T(HOMAS) S(TEARNS) ELIOT (1888–1965)
GABRIELA MISTRAL (LUCILA GODOY Y ALCAYAGA) (1889–1957)
OSWALD DE ANDRADE (JOSÉ OSWALD DE SOUSA ANDRADE) (1890–1954)
PEARL S(YDENSTRICKER) BUCK (1892–1973)
CÉSAR VALLEJO (1892–1938)
WILLIAM FAULKNER (1897–1962)
THORNTON WILDER (1897–1975)
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS (1899–1974)
JORGE LUIS BORGES (1899–1986)
ERNEST HEMINGWAY (1899–1961)
KAWABATA YASUNARI (1899–1972)
JOHN STEINBECK (1902–1968)
ALEJO CARPENTIER (1904–1980)
DING LING (JIANG BINGZHI) (1904–1986)
PABLO NERUDA (NEFTALÍ RICARDO ELIECER REYES Y BASOALTO) (1904–1973)
PARVIN E’TESAMI (1906/7–1941)
TENNESSEE WILLIAMS (THOMAS LANIER WILLIAMS II.) (1911–1983)
JULIO CORTÁZAR (1914–1984)
OCTAVIO PAZ (1914–1998)
ANNE HÉBERT (1916–2000)
ISAAC ASIMOV (1920–1992)
CLARICE LISPECTOR (1920/25–1977)
EPHRAIM KISHON (FERENC HOFFMANN) (1924 -2005)
ALLEN GINSBERG (1926–1997)
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1927/28)
TONI MORRISON (CHLOE ANTHONY WOFFORD MORRISON) (1931)
KO UN (KO UN-T’AE) (1933)
LEONARD COHEN (1934)
ŌE KENZABURŌ (1935)
ANITA DESAI (1937)
MARGARET ATWOOD (1939)
GAO XINGJIAN (1940)
MAHMOUD DARWISH (1941/42)
ISABEL ALLENDE (1942)
SALMAN RUSHDIE (1947)
ORHAN PAMUK (1952)
LITERATUR
ALPHABETISCHE LISTE DER VORGESTELLTEN LITERATEN
VORWORT:LITERARISCHE SCHLAGLICHTER AUF OST UND WEST
Wer sich selbst und andre kennt,Wird auch hier erkennen:Orient und OkzidentSind nicht mehr zu trennen.Sinnig zwischen beiden WeltenSich zu wiegen lass ich gelten;Also zwischen Ost und WestenSich bewegen, sei’s zum Besten.JOHANN WOLFGANG GOETHE
Zwar wagten die Europäer den Blick über den literarischen Tellerrand, wie dieses Gedicht von Goethe zeigt, schon vor 200 Jahren, doch sind wir auch heutzutage nach wie vor gut beraten, den Rat des Dichterfürsten aus Weimar anzunehmen. Denn wer vermag schon, nach außereuropäischen Literaten gefragt, aus dem Stegreif mehr als eine Handvoll – zumeist US-amerikanischer – Namen zu nennen? Gleichwohl haben der ›Osten‹ wie der ›Westen‹ den europäischen Betrachter schon immer fasziniert als das vage ›Andere‹, das Exotische, das Ferne. Das vorliegende Buch möchte sich als Beitrag verstehen, dem Leser einen Zugang zu eröffnen zu den bestrickenden Welten der amerikanischen und der asiatischen Literatur, wo berückende Fremdartigkeit genauso auf ihn warten wie unerwartete Vertrautheit. Dabei kann es allerdings nur einen ersten Eindruck liefern, sowohl von der jahrtausendealten, vielschichtigen und vielfältigen literarischen Tradition Asiens als auch von der ungeheuer reichen Literatur des gesamten amerikanischen Kontinents.
Dieses Buch wirft Schlaglichter und beleuchtet so Leben und Werk von 65 der bedeutendsten und größten Dichter und Schriftsteller der Kulturkreise östlich und westlich von Europa. ›Amerika‹ und ›Asien‹ dienen dabei als rein geographische Sammelbegriffe, unter die im letzteren Fall etwa auch Vorderasien und der Nahe Osten fallen, um dem Leser einen möglichst breiten Einblick zu gewähren. Zugleich entstehen dadurch sowohl räumlich als auch zeitlich geradezu unermessliche literarische Kontinente, die durch die geworfenen Schlaglichter nur partiell erhellt werden können. Das Buch deckt eine Zeitspanne vom 4. Jahrhundert n. Chr. bis zur Gegenwart ab, doch wirkte das Gros der hier vorgestellten Literaten im 20. Jahrhundert. Dies liegt im Falle Amerikas schlicht daran, dass sich erst im Laufe der letzten 200 Jahre allmählich eine eigenständige Literatur zu entwickeln begann, die gerade in der literarischen Moderne mit all ihrer imaginativen, umwälzenden Kraft über die Welt hereinbrach. Die asiatische Welt wiederum hat zwar immer wieder das Auge des Westens angezogen, ist aber erst seit dem 20. Jahrhundert dabei, mit immer unüberhörbarer werdenden Stimmen so wortgewaltig auf sich aufmerksam zu machen, dass ihre Literaten nicht mehr vom eurozentristischen Blick ignoriert werden können. Dabei erregen die alten Dichter und Schriftsteller (aufs Neue) das Interesse des Europäers, vielleicht noch mehr jedoch faszinieren die neuen Stimmen, die, zusammen mit den lateinamerikanischen Poeten, besonders in der Postmoderne ihre ganz eigenen Lieder singen.
Das Fremde uns anzueignen und das Selbst im Anderen zu erkennen – dazu fordert uns Goethes Gedicht letztendlich auf. Dieser sein Appell zu geistiger Flexibilität und Aufgeschlossenheit erscheint heute dringlicher als jemals zuvor. Gleichzeitig lädt uns der Dichterweise ein, uns auf eine Reise zwischen den Welten zu begeben und uns auf das große Abenteuer des literarischen Weltbürgertums einzulassen. Das vorliegende Buch versteht sich als kleiner Reiseführer auf dieser geistigen Entdeckungsfahrt und will zugleich zur Erforschung abgelegenerer literarischer Gebiete Lust machen, die jenseits der hier schlaglichtartig beleuchteten Bereiche liegen.
Katharina Maier
KĀLIDĀSA
(4./5. JAHRHUNDERT)
Wolkenbote – Der Dichterßirst des alten Indien
Die Blüte der altindischen Kunstdichtung (kāvya) fällt in den Zeitraum zwischen dem 4. und dem 6. Jahrhundert nach Christus und findet ihren unbestrittenen Höhepunkt in der Gestalt des legendenumrankten Epikers, Dramatikers und Lyrikers Kālidāsa, der bis heute als der größte Poet Indiens gilt.
Wenig ist vom Leben des großen Sanskrit-Dichters Kālidāsa bekannt. Selbst seine Lebenszeit lässt sich aller Bemühungen der Forschung zum Trotz nur vage bestimmen; eine Inschrift aus dem Jahr 634 zeugt zum ersten Mal von der großen Berühmtheit Kālidāsas, und es erscheint am wahrscheinlichsten, dass Indiens überragender Poet um die Wende vom 4. auf das 5. Jahrhundert gelebt und gewirkt hat. Die ausführlichen, besonders blumigen Beschreibungen der Reichshauptstadt Ujjayinī in Kālidāsas Werken – allen voran in dem berühmten Gedicht Meghadūta (Der Wolkenbote)1 – legen nahe, dass diese Stadt die Heimat des Poeten war; möglicherweise war er Dichter am Hofe von Chandragupta II. Vikrmādrya, des dritten der Gupta-Kaiser, unter denen das alte Indien zum Großreich gedieh und die kāvya, die klassische indische Kunstdichtung, volle Blüte trieb. Kālidāsa gehörte höchstwahrscheinlich zu der Kaste der Brahmanen2 und verehrte sowohl Śiva als auch die Göttin Kali, auf die sein Name zurückgeht und die ihm der Legende nach sein ›übermenschliches‹ dichterisches Talent verlieh; die Symbolik seiner Werke, die, wie für die kāvya-Dichtung typisch, mythische und epische Stoffe aufgreifen und in denen die Welt der Menschen und die der Götter und Dämonen ineinanderfließen, spricht deutlich vom starken Einfluss der hinduistischen Lehre. Dennoch fehlt in den Texten des Brahmanen Kālidāsa auch das stark diesseitige Element nicht, das die oft sehr erotische kāvya-Literatur kennzeichnet und unter anderem auf deren Natur als ›Hofdichtung‹ zurückzuführen ist.
Die kāvya-Dichtung, als deren erstes Werk das zentrale Sanskrit-Epos Rāmāyana (Epos von Rāmās Lebenslauf)1 gilt, entwickelte sich in Indien über Jahrhunderte hinweg; zur Zeit der Gupta-Kaiser hatte sich ein systematisiertes Regelwerk gebildet, an dem die vor allem in den städtischen Zentren und im Umfeld des Hofes wirkenden Dichter sich messen lassen mussten. Von einem Literaten wurde eine umfassende Allgemeinbildung erwartet, die sowohl die breite Mythologie umfassen sollte als auch alle Arten von weltlichen Belangen; vor allem jedoch wurde eine genau Kenntnis der kāvya-Poetik vorausgesetzt, die in den Alamkāraśātras, Lehrbüchern der Kunst, niedergeschrieben war. Das Sanskrit-Wort alamkāra bedeutet ›Schmuck‹, und verweist somit auf den formalen Schwerpunkt, den die kāvya-Dichtung setzte. Diese wurde »als sprachliche Komposition, die ästhetisches Wohlgefallen hervorruft« definiert2; das heißt, die ästhetische Form dominiert hier über den Inhalt. In der kāvya-Dichtung geht es darum, alten überlieferten Stoffen aus Legende, Mythos und Epos eine möglichst kunstvolle, gefällige und ›schmuckvolle‹ neue Gestalt zu geben. Metaphern, Wortspiele, farbenreiche Schilderungen, ungewöhnliche Ausdrücke und Wortkombinationen charakterisieren folglich die – gerade für das westliche Auge – oft überwältigende Bildlichkeit dieser Literatur, die, vor allem in ihrer späten, ›dekadenten‹ Form, Gefahr läuft, im sprachlichen Schmuckwerk zu ersticken3. Nicht so bei Kālidāsa; der große Dichter beherrschte das ästhetische Sprachspiel in Perfektion und wusste den Reichtum der kāvya-Dichtung einzusetzen, um Kompositionen größter Harmonie zu kreieren – jene Harmonie, die den dhvani (den Grundton, die Seele) seiner Poesie konstituiert.
Die kāvya-Dichtung umfasst die Gattung des Epos, des Dramas und der Lyrik, und in allen dreien war Kālidāsa unangefochtener Meister. Von den zahlreichen Werken, die ihm ob seiner Berühmtheit zugeschrieben werden, stammen mit Sicherheit das vielgelobte Langgedicht Meghadūta (Der Wolkenbote), die beiden höfischen Epen Kumārasambha (Die Geburt des Kriegsgottes) und Raghumvamśa (Das Raghu-Geschlecht) und die Dramen Mālavikāgnimitra (Das Schauspiel von Malavika und Agnimitra), Vikramorvaśīya bzw. Urvaśī (Das Schauspiel von Vikrama und Urvshi) und die weltberühmte Śakuntalā von Kālidāsas Hand. Vor allem die Śakuntalā und der Meghadūta, die beide zu den größten und wichtigsten Schöpfungen der Weltliteratur gehören, machten Kālidāsa weit über Indien hinaus berühmt, und das von Anfang an; Meghadūta existierte schon bald nach seiner Entstehung in tibetischen, mongolischen und singhalisischen Übersetzungen, und das Langedicht über den Wolkenboten war eines der ersten (alt)indischen Werke, die in Europa bekannt wurden. Unter anderem Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) und Alexander von Humboldt (1769–1859) gehörten zu den Bewunderern des Wolkenboten, der voller intensiver wie zarter Natur- und Gefühlsschilderungen ist und in dem sich die starke Sehnsucht ›getrennter Liebe‹ (virhara) manifestiert1. Die Berühmtheit, Bedeutung und dichterische Meisterschaft des Meghadūta werden nur noch von der Śakuntalā übertroffen, die in Indien und darüber hinaus als das bedeutendste Sanskrit-Drama überhaupt gilt. Sie wird als die Krönung der hochentwickelten kāvya-Dramenkunst angesehen2, die eine in mythologische Stoffe gekleidete Nachahmung des Lebens sein will und daher – im Gegensatz zum höfischen Epos – eine lebensnahe Volkskunst konstituierte. Das Stück – das wie die beiden anderen Dramen Kālidāsas eine Liebe zum Thema hat, die allerlei himmlische wie irdische Hindernisse zu bewältigen hat, bevor sie Erfüllung findet – erzählt die Geschichte von König Dusyanta und Śakuntalā, der Tochter eines Einsiedlers und einer Aspara (himmlische Nymphe). Das Paar wird durch einen Fluch, der den König seine Geliebte vergessen lässt, getrennt. Erst als der Zufall Dusyanta einen Ring in die Hand fallen lässt, den er Śakuntalā einst geschenkt hat, erinnert sich der König und wird – nach einem Kampf gegen die Dämonen an der Seite des Götterkönigs Indra – mit seiner Geliebten und dem gemeinsamen Sohn vereint. Wie mit den meisten seiner Texte greift Kālisāda auch mit der Śakuntalā altbekannte epische und mythologische Stoffe auf, fügt jedoch eigene Ideen hinzu (etwa den verlorenen und wiedergewonnenen Ring) und treibt ein meisterhaftes Spiel mit überlieferten Motiven. Das Werk ist von einer lyrischen Eindringlichkeit und fesselt sowohl durch seine intensive Sprache als auch durch die Lebensechtheit seiner Charaktere; vor allem Śakuntalā selbst beweist eine Gefühlstiefe, wie sie angesichts der altindischen Auffassung von der Unterlegenheit der Frau überraschen muss. Die Bedeutung der Śakuntalā für die indische Literatur, ja, für die Weltliteratur, kann kaum überschätzt werden; Goethe, der Elemente des altindischen Dramas in seinen Faust (1808/1828-29) integrierte, schrieb mit berechtigter Begeisterung über das Meisterwerk Kālidāsas:
Willst du die Blüte der frühen, die Früchte der späten Jahre,
Willst du, was reizt und entzückt, willst du, was sättigt und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde mit Einem Namen begreifen,
Nenn’ ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt.
Wichtige Werke:
Kumārasambha (Die Geburt des Kriegsgottes)
Mālavikāgnimitra (Das Schauspiel von Malavika und Agnimitra)
Meghadūta (Der Wolkenbote)
Raghumvamśa (Das Raghu-Geschlecht)
Śakuntalā (Śakuntalā oder Das Erkennungszeichen)
Vikramorvaśīya/Urvaśī (Das Schauspiel von Vikrama und Urvshi)
1 Kālidāsas Werke sind in ersten Linie unter ihren Sanskrit-Originaltiteln bekannt.
2 oberste Kaste der Hindus (Priester, Dichter, Gelehrte, Politiker)
1 Das Rāmāyana ist eines der indischen Nationalepen und wurde vermutlich von dem Dichter Valmiki in der Zeit zwischen dem 4. Jahrhundert vor und dem 2. Jahrhundert nach Christus verfasst.
2 vergl. Klaus Mylius. Geschichte der altindischen Literatur. Die 3000-jährige Entwicklung der religiös-philosophischen, belletristischen und wissenschaftlichen Literatur Indiens von den Veden bis zur Etablierung des Islams. Scherz 1988. S. 157.
3 Ein Beispiel ist die Dominanz der nominalen über die verbale Ausdrucksform, was im Sanskrit schließlich zu immer unüberschaubarer werdenden Kompositionen und regelrechten Wortungetümen führte.
1 Der Meghadūta besteht hauptsächlich aus dem Monolog eines verbannten Yaksa (eines halbgöttlichen Wesens), der sich in Sehnsucht nach seiner Frau verzehrt und einer Regenwolke – vergessend, dass diese kein lebendiges Wesen ist – eine Botschaft an die Geliebte mitgibt.
2 Das Drama gilt in der kāvya als höchste Gattung, da es Epik und Lyrik in sich vereint (es enthält sowohl Passagen in Prosa als auch in Lyrik), verschiedene Sprachen gebraucht (je nach Stand und Geschlecht der auftretenden Personen) und ein komplexes Gesamtkunstwerk aus Wort, Geste und Klang bilden muss.
DU FU
(712–770)
Vollkommene Symphonie – Der Dichterheilige
Du Fu, der Dichterheilige (Shisheng), ist zusammen mit seinem Zeitgenossen Li Bai oder Li Bo (701–762)1 der bedeutendste Poet der chinesischen Literatur. Er brachte die klassische Dichtung der Tang-Dynastie zu ihrem Höhepunkt und überschritt sie zugleich mit seinen kühnen sprachlichen und thematischen Innovationen, die ihrer Zeit oft Jahrhunderte voraus waren. Er brachte den Alltag in die chinesische Poesie und besticht doch durch seine ungeheure Gelehrsamkeit. Teilnahmsvoll dokumentiert Du Fu das Leiden seines vom Krieg gebeutelten Landes und der eigenen Familie, während er gleichzeitig in den meisten seiner Gedichte den melancholischen Gestus eines ewig Heimatlosen beibehält.
Die Zeit der Tang-Dynastie (618–907) sah die Blüte der klassischen chinesischen Kunst in all ihren Formen, und ihr Höhepunkt fiel in die Lebenszeit von Du Fu und seinem elf Jahre älteren Zeitgenossen Li Bai. Beide großen Dichter müssen fast in einem Atemzug genannt werden, erscheinen sie doch oft wie die zwei Seiten einer Münze: Während Li Bai für seine anarchische Weinseligkeit und seine überbordende Lebensfreude bekannt ist, verkörpert Du Fu den melancholischen Mahner und formstrengen Gelehrten. Diese beliebte (und vereinfachende) Kontrastierung2 darf aber nicht über die tiefe Verbundenheit dieser beiden bedeutendsten chinesischen Dichter hinwegtäuschen, die sich auf persönlicher Ebene durch eine, trotz nur einmaliger Begegnung3 ausgesprochen tiefe, Freundschaft niederschlug und auf künstlerischer Ebene durch eine allen Unterschieden zum Trotz sehr ähnliche poetologische Grundeinstellung. Diese äußerte sich bei Du Fu, wie Reinhard Emmerich anmerkt, etwa durch »eine in die höchste Überheblichkeit gesteigerte Auffassung über seine frühe literarische Reife und sein poetisches Schaffen, die sich mit einer Geringschätzung älterer Poeten paart oder ihn sagen ließ, wenn man (wie er) zehntausend Buchrollen zerlesen habe, führe einen gleichsam ein Geist den Schreibpinsel«1. Mit einer solchen, offensichtlich nicht unberechtigten, genialischen Einstellung brachten Li Bai und Du Fu die ausgesprochen regelstrenge klassische Poetik der Tang-Dichtung an ihre Grenzen – und darüber hinaus.
Während die weingetränkte Lebenslust des Li Bai im Westen lange Zeit größeren Anklang fand als Du Fus herb-alltägliche Schwermut – unter anderem ersichtlich an der Vertonung von sechs Li-Bai-Gedichten durch Gustav Mahler (1860–1911) in dessen Lied von der Erde (ca. 1908–1909) –, wird Du Fu in China selbst als der bedeutendste Poet überhaupt angesehen. Sein Einfluss auf die spätere chinesische, und ab dem 17. Jahrhundert auch auf die japanische2, Literatur und Kultur war derart groß, dass Du Fu als der chinesische Shakespeare bezeichnet werden kann; seit der Song-Dynastie (960–1279) – die Zeit der Wiederbelebung der Werke des bis dahin ob seiner innovativen Radikalität fast vergessenen Du Fu – kann sich kein chinesischer Literat dem Einfluss des Dichterheiligen ganz entziehen. Mehr noch als Li Bai bereicherte Du Fu die chinesische Literatur um sprachliche, formale und thematische Neuerungen, die selbst heute noch oft unkonventionell erscheinen.
Trotz oder gerade wegen seines Innovationsgeistes war Du Fu ein Meister jeglicher Spielart und Gattung der klassischen chinesischen Poesie. Deren Schwerpunkt lag von jeher auf der Harmonie der Form, die der Dichterheilige durch seine poetische Virtuosität zur Vollendung brachte. Seine Lyrik wird in China deswegen als jidacheng, als ›vollkommene Symphonie‹ bezeichnet, ein Begriff, mit dem auch das Werk des Konfuzius beschrieben wird. Sein Beiname Shisheng bringt Du Fu ebenfalls mit dem ›Philosophenheiligen‹ Konfuzius in Verbindung, dessen Lehre eine wichtige Rolle für die Weltsicht des großen Lyrikers spielte. Du Fus (dichterische) ›Heiligkeit‹ meint jedoch nicht eine weltabgewandte Jenseitigkeit, wie sie viele seiner vom Wunderglauben und dem Wunsch nach der Unsterblichkeit erfüllten Zeitgenossen charakterisiert, sondern vielmehr eine Hinwendung zum Hier und Jetzt, zu den kleinen und unscheinbaren Dingen und zum Alltag des Lebens und Leidens. So schreibt Du Fu in dem Gedicht Am reinen Strom:
Großmutter malt ein Schachbrett auf Papier,
Ein Kind klopft eine Nadel sich zur Angel.
Für Krankheit gibt’s Tinktur und Elixier.
Woran ist für den armen Leib noch Mangel?1
Somit nennt Wolfgang Kubin Du Fu zu Recht den ersten »weltlichen« Dichter Chinas2, der über das tägliche Leben schreibt, über die eigene Familie3 und, oft klagend, über seine eigene Befindlichkeit, welche er jedoch meist in einen größeren Kontext stellt: eingebunden in die sich immer gleichbleibende Natur, verortet im zeitgeschichtlichen Geschehen oder über die Evokation historischer Gestalten in einen übergeordneten Zusammenhang gebracht. Dabei porträtiert sich Du Fu selbst sowohl als den körperlich wie seelisch Leidenden, der sozusagen das Elend seines von Bürgerkrieg, Hunger und Krankheit zerrissenen Volkes in sich aufnimmt, als auch als den rastlos Wandernden in der Fremde, der nie heimkommt:
Fremde
Nie war der Fluss so grün, das Weiß der Vögel weißer,
So blau der Berg, das Rot der Blüten heißer.
Und doch vergehts, das Jahr, gleich allen, wies auch brennt,
Und niemand ist, der mir den Tag der Heimkehr nennt.4
So ist dem ausgesprochen biographischen Werk des Du Fu1 aller vollendeten Symphonie in der poetischen Form zum Trotz eine gewisse melancholische Spannung zu eigen, die die vollständige Vereinigung von Mensch und Natur zu einen harmonischen Ganzen unmöglich macht. Dieser ›Riss in der Welt‹, der sich durch Du Fus Poesie zieht, spiegelt sich in seinem Leben sowie in dem historischen Hintergrund seiner Epoche. Es ist die Zeit des An-Lushan-Aufstandes2, der von 755 bis 764 andauerte und zusammen mit verheerenden Hungersnöten, Naturkatastrophen und außenpolitischen Gebietsverlusten die Bevölkerung Chinas von über 50 Millionen auf weniger als 20 Millionen reduzierte. In seiner Position als niederer Beamter am kaiserlichen Hof in Chang’an (dem heutigen Xi’an), die er von 755 bis 759 innehatte und die der Sohn einer verarmten adligen Familie sein ganzes unstetes Leben lang zu erreichen bestrebt gewesen war3, versuchte Du Fu, sich mit Rat und Tat am Widerstand gegen die Rebellion zu beteiligen. Aus Enttäuschung über die Zurückweisung seiner Bemühungen und die allgegenwärtige Korruption machte sich Du Fu im Jahr 759 auf in die Stadt Chengdu, wohin er seine Familie zu deren Sicherheit geschickt hatte. Während seiner Reise durch das Land wurde er Zeuge und Opfer des Elends, das im Reich herrschte und sich zum Hauptthema seiner Gedichte entwickelte. Du Fu wurde so zum ›Dichter-Historiographen‹ seiner Zeit, der den historischen Ereignissen sowie der Vergangenheit poetische Gestalt gab. Seine Verse über den Krieg – etwa Die müde Nacht, Die Wäscheklopferin, In einer Mondnacht an die Brüder denkend und Reise in den Norden – wurden zu den berühmtesten Werken des Dichterheiligen. Die nächsten Jahre verbrachte Du Fu in Chengdun, zwei davon in seiner berühmten Grashütte, in der er eine Art Eremitenexistenz führte. Deren Nachbildung neben einem Ehrentempel, der zur Zeit der Song-Dynastie in Erinnerung an den Dichterheiligen errichtet wurde, ist heute noch zu besuchen. Du Fus Familie lebte in Chengdun in Armut und der Abhängigkeit von Gönnern; dennoch entstanden die meisten der über 14.000 Gedichte des großen Poeten in dieser Zeit und während seiner letzten Lebensjahre, die der große Wanderer – wie die Jahre seiner Jugend und der Kriegszeit – in steter Unrast verbringen musste.
Wichtige Werke:
Ba ai shi (›Acht Klagen‹)
Beizheng (Reise in den Norden)
Quinixing bu shou (›Acht Gedichte über die Herbststimmung‹)
Yonghuaigujo (›Ausdruck von Gefühlen angesichts alter Stätten‹)
Yueye (Mondnacht)
1 Li Bai ist in Europa besser bekannt unter dem Namen Li Taibai oder Li Taibo.
2 Du Fu teilte durchaus Li Bais Liebe zum Wein und schrieb lebensfrohe Gedichte über denselben, während Li Bai wie sein jüngerer Freund die Kriegswirren seiner Zeit in Verse fasste.
3 Diese Begegnung fand wahrscheinlich im Jahr 744 während der ausgedehnten Reisen des jungen Du Fu durch das Chinesische Reich statt und war vor allem durch die tiefe Bewunderung geprägt, die der noch unbekannte Jüngere dem ›Dichtergott‹ Li Bai entgegenbrachte.
1 Reinhard Emmerich. »Östliche Han bis Tang«. in: Reinhard Emmerich (Hg.): Chinesische Literaturgeschichte. Stuttgart/Weimar: Metzler 2004. S. 88–186, hier: S. 154.
2 Die formstarke Lyrik Du Fus beeinflusste vor allem auch Matsuo Bashō (1644–1694), den Erfinders des japanischen Haiku.
1 Übersetzung von Günter Eich
2 Wolfgang Kubin. »Du Fu«. in: Axel Ruckaberle (Hg.): Metzler Lexikon der Weltliteratur. Band 1. Stuttgart/Weimar: Metzler 2006. S. 400–401. hier: S. 400.
3 Etwa verfasste Du Fu Liebesgedichte an seine Ehefrau, wie es damals nur an Konkubinen üblich war, oder gab der Trauer über den Hungertod seine jüngsten Kindes lyrische Gestalt.
4 Übersetzung von Günter Eich
1 Du Fu war einer der ersten chinesischen Dichter, der sein Gesamtwerk nach biographischen Aspekten gliederte.
2 An Lushan, ein einflussreicher General aus dem Nordosten des damals extensiven Chinesischen Reiches, führte die Rebellion gegen die Tang-Kaiser an, die bürgerkriegsähnliche Zustände im ganzen Reich mit sich brachte.
3 Du Fu scheiterte, vermutlich aus politischen Gründen, mehrmals an dem Examen, dem sich kaiserliche Beamte zu unterziehen hatten, und war deswegen für den Unterhalt seiner selbst, seiner Frau und seiner fünf Kinder lange auf die Unterstützung von Gönnern angewiesen, die manchmal recht, manchmal schlecht für die Grundlagen zum Leben sorgten.
ONO NO KOMACHI
(9. JAHRHUNDERT)
Tasten nach der Spur – Das Symbol der Schönheit
Ono no Komachi, der ›Stern‹ der klassischen japanischen Literatur, ist die wohl geheimnisvollste und faszinierendste Gestalt unter den Rokkasen, den sechs bis heute hochverehrten ›Dichtergenien‹ der künstlerisch so ausgesprochen fruchtbaren Heian-Periode. Die erotisch aufgeladene Liebesdichtung der Frau Ono no Komachi überbrückt mühelos eine Zeitspanne von über 1000 Jahren, um sich in Herz und Blut ihrer Leser einzubrennen, und die legendäre Schönheit der Poetin selbst inspiriert Dichter und Künstler bis zum heutigen Tag.
Ono no Komachi war eine Meisterin des klassischen japanisches Kurzgedichts, dem tanka, der Hauptgattung der waka-Dichtung der Heian-Periode1 (797–1185), aus der sich später das haiku entwickeln sollte. Wie die Gattung des tanka im Allgemeinen sind die Schöpfungen Ono no Komachis zum Großteil Liebesdichtungen; dabei zeichnen sich ihre Texte durch eine besondere Erotik bei gleichzeitiger müheloser Berührung existentieller Thematiken aus:
Seit ich im leichten
Schlummer mir den Ersehnten
ersehnen konnte,
fange ich an, den Träumen,
wie man sie nennt, zu trauen.
Die tanka-Dichtung – wie das haiku ein Silbengedicht, bestehend aus fünf Teilen zu 5, 7, 5, 7, 7 Silben – war Bestandteil des höfischen Spiels im künstlerisch-kulturell ausgerichteten Heian Kyo und Medium der (erotischen) Kommunikation. Liebende und solche, die es werden wollten, schrieben sich gegenseitig tanka; zuweilen wurden auch die letzten beiden Siebensilber vom jeweils anderen Partner erst ergänzt. Jedes Mitglied des Hofs praktizierte diese Art der Dichtung als eine Selbstverständlichkeit. Sechs Dichter jedoch taten sich besonders in dieser Kunst hervor: die sogenannten Rokkasen, die in der ersten Gedichtanthologie der japanischen Literatur – der Kokin-wakashū, die im Jahr 905 auf kaiserlichen Befehl erstellt wurde – als die großen Poeten der jüngeren Vergangenheit gefeiert werden. 18 tanka von Ono no Komachi enthält diese Anthologie – die einzigen erhaltenen Texte, die mit Sicherheit von dieser großen Dichterin stammen.
Wir wissen heute so gut wie nichts vom Leben der Ono no Komachi. Nicht einmal ihre Lebensdaten sind gesichert; der Herausgeber der Kokin-wakashū erwähnt nur, dass sie »vor Kurzem« gelebt hätte. Vermutlich aber entstanden die erhaltenen tanka um 850. Die Stadt Ogachi in Akati nennt sich selbst die Geburtsstadt der Liebeslyrikerin; dort steht der Komachi-Schrein, jedes Jahr findet das Komachi-Festival statt und eine Reisart aus der Gegend von Akati trägt den Namen der großen Dichterin. Vermutlich war Ono no Komachi eine niederrangige Hofdame oder möglicherweise Konkubine am Hof von Kaiser Nimmyō (Regierungszeit von 833–850). Um die Jahrhundertmitte stand sie wohl in regem persönlichen Kontakt mit anderen führenden Dichtern der Zeit, mit denen ihr auch das ein oder andere Liebesverhältnis nachgesagt wird – und, liest man ihre spielerischen Gedichte, scheint eine solche Annahme gar nicht so weit hergeholt:
Im wachen Leben
mag es ja wohl so gelten.
Aber noch im Traum
meinen, anderer Blicke
scheuen zu müssen: trostlos!
Und genau an diesem Punkt beginnen die Legenden und Fiktionen, die Ono no Komachi bis zum heutigen Tag umgeben. Sie soll eine außergewöhnliche Schönheit gewesen sein, eine Meisterin des höfischen Liebesspiels und eine (sexuell) selbstbewusste femme fatale – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Wie die Legende erzählt, erlegte sie einem Verehrer auf, 100 Nächte vor ihrer Tür zu verharren, ehe sie ihn erhören würde; als der Verliebte eine Nacht aufgrund des Todes seines Vaters nicht vor dem Zimmer seiner Angebeteten verbringen konnte, starb er aus Verzweiflung, sein begehrtes Ziel nun nie erreichen zu können. Ono no Komachi wiederum zerbrach fast an der Trauer um den Tod ihres Verehrers. Eine andere Version der Geschichte lässt den Liebenden vor der Tür der kaltherzigen Dichterin erfrieren und Ono no Komachi zur Strafe als alte und hässliche Frau allein durchs Land ziehen und vereinsamt sterben. Eine wieder andere Tradition spricht der alten, wandernden Weisen Frau die magische Fähigkeit zu, die überirdische Schönheit ihrer Jugend wieder annehmen zu können, um junge Männer in ihren Bann zu ziehen. Solche Gestalt gibt Ono no Komachi etwa das Schauspiel Sotoba Komachi von Yukio Mishima (1925-1970) aus dem Jahr 1960. Doch bereits im auf die Heian-Periode folgenden japanischen Mittelalter wurde das Leben oder besser: die Legende Ono no Komachis gerne fiktional bearbeitet, etwa in Kurzgeschichten und den damals zu voller Blüte kommende noh-Dramen. Über die Jahrhunderte ist sowohl die schöne, kapriziöse als auch die gebrochene alte Dichterin ein beliebtes Motiv der japanischen Malerei in all ihren Formen geblieben. Der jüngste ›fiktionale Gastauftritt‹ der großen Poetin geschah 2003 in Form eines australischen Ein-Personen-Stücks von Christie Niemann mit dem Titel Call me Komachi (›Nennt mich Komachi‹)1. Bis heute ist Ono no Komachi in Japan ein Symbol sowohl der Schönheit als auch deren irdischer Vergänglichkeit. So verliert sich die historische Gestalt der Dichterin in den Legenden und Fiktionen, die sie umranken, so dass das folgende klagende Liebesgedicht fast als ein Kommentar des posthumen Schicksals der Poetin gelesen werden kann:
Bin ich selbst denn
nicht zu finden? O blindes
Tasten nach der Spur,
seit der Erwartete mich
aus seinem Herzen verlor.
Doch die Spur Ono no Komachis verliert sich nicht wirklich, denn sie lässt sich entdecken in ihren unsterblichen Gedichten, den spielerischen wie den wehmütigen, die in ihrer kurzen Einfachheit ein ganzes Leben fassen:
Farbiges Blühen,
wehe, es ist verblichen,
da ich leeren Blicks
nachtlang in ewigem Regen
mein Leben verrauschen sah.
Wichtige Werke:
18 tanka aus der Anthologie Kokin-wakashū (905)
1 Die Heian-Periode ist benannt nach der damaligen imperialen Hauptstadt Heian Kyo, dem heutigen Kyōtō, Sitz des kaiserlichen Hofes und kulturelles Zentrum.
1 Der Titel des Dramas spielt auf den ersten Satz von Herman Melvilles (1819-1891) berühmten Roman Moby Dick (1851) an: »Call me Ishmael – Nennen Sie mich Ismael.«
(ABŪ ‘ABDOLL H DJA’FAR BEN MOHAMMAD) RŪDAKĪ
(UM 859–941)
Eine Million und Dreihunderttausend Verse – Der König der Dichter
Abū ‘Abdollāh Dja’far ben Mohammad Rūdakī wird im Allgemeinen als der Begründer der Dichtung im Neupersischen (Dari, Parsi, Farsi) betrachtet. Obwohl von seinem legendenumwobenen Diwan1 nur ein Bruchteil überliefert ist, wurde der Poet, Sänger und Musiker in verschiedenen Epochen der persischen Literaturgeschichte als ›König der Dichter‹ verehrt, und sein Meisterwerk Kalīla wa Dimna (›Kalila und Dimna‹) gilt als einer der wichtigsten Texte in Farsi.
Unter den Samaniden-Herrschern im 9. und 10. Jahrhundert kam es im persischen Kulturkreis zu einer Art Zeitenwende und zur Entwicklung einer neuen Art von Dichtkunst, die versuchte, die neue islamische Poesie mit der alten, vorislamischen Tradition zu verbinden. Außerdem etablierte sich mit Farsi (von Fārsī-e Darbārī, d. i. ›Sprache des königlichen Hofes‹) eine neue Schriftsprache, die auf einem arabisch-persischen Alphabet basierte. Zum ersten hervorragenden Dichter dieser Sprache, die sich im Mittelalter zur bedeutendsten Literatur- und Gelehrtensprache der islamischen Welt entwickeln sollte, wurde Abū ‘Abdollāh Dja’far ben Mohammad Rūdakī, der somit die poetologischen Regeln des Farsi entscheidend mitdefinierte. So etwa geht die Farsi-Reimordnung auf den Diwan Rudakis zurück.
Es existieren vergleichsweise viele Überlieferungen das Leben Abū ‘Abdollāh Dja’far ben Mohammad Rūdakīs betreffend (der Beiname verweist auf seinen Geburtsort Rūdak bei Samarkand); dennoch oder gerade deswegen sind Fakt und Legende unauflöslich miteinander verwoben. Sicher ist, dass Rūdakī Hofdichter des Samanidenkönigs Nasr II. (Regierungszeit 914–933) in Bukhara (Bochara) war. Berichte über die Jugend des Farsi-Poeten sind weniger verbürgt; dem Chronisten ‘Awfi, einem Zeitgenossen des Dichters, zufolge, zeigte Rūdakī seine ungewöhnliche Begabung schon früh: Als Achtjähriger soll er den gesamten Koran auswendig gewusst und bald darauf erste Gedichte verfasst haben. Seine ausgesprochen schöne Singstimme verhalf Rūdakī zur Bekanntschaft mit dem berühmten und hochgeehrten Flötisten Bakhtiar, dessen Schüler er wurde und dessen Erbe er schließlich antrat. Rūdakīs ungeheure Gelehrsamkeit, sein immenses musikalisches wie poetisches Talent und nicht zuletzt seine charismatische Persönlichkeit sollen schließlich König Nasr II. dazu veranlasst haben, den Künstler an seinen Hof zu bitten und ihn dort mit Ehren und Reichtümern zu überschütten. Tatsächlich jedoch war es wohl die Bekanntschaft und das Mäzenat des wichtigsten und einflussreichsten Wesirs (Hofminister) der Zeit, Abul Fadl Bal’ami, die dem Dichter den initialen Zugang zum königlichen Hof ermöglichten und ihn aller Anfeindungen zum Trotz die Position des Hofpoeten verschafften und erhielten (ein Mäzenat, das nicht nur der unbestreitbare poetische Geist Rūdakīs an sich inspirierte, sondern auch die Gelegenheit, eben jenen Geist als ›Propagandadichter‹ – in Form von Lobpreisgedichten auf den Gönner – einsetzen zu können). Wie dem auch sei: Die Position des Hofdichters und seine poetische Potenz1 verhalfen Rūdakī jedenfalls zu einem Reichtum, der in der islamischen Welt sprichwörtlich geworden ist; er soll 200 Sklaven besessen haben und seine Besitztümer sollen 400 Kamele nicht haben tragen können. Doch mit dem Sturz oder dem Tod Bal’amis endete auch Rūdakīs große Zeit. Im Jahr 937 wurde er vom Hof verbannt und starb altersschwach und ver-armt in seinem Heimatdorf.
Zu Kontroversen regte die Gelehrten seit jeher die legendäre Blindheit des großen Dichters Rūdakī an. Erblindete der Poet nach und nach oder wurde er vielleicht sogar geblendet, da er sich weigerte, weiterhin den Lobpreis der Herrschenden zu singen? Oder berichtet uns der Chronist ‘Awfi die Wahrheit, wenn er von Rūdakīs angeborener Blindheit spricht? Wie aber könnte ein von Geburt an Blinder Verse von der Einduckskraft eines Rūdakī verfassen – Verse, die die Schönheit der Natur in unsterbliche Worte fassen und in denen nicht zuletzt Farben eine zentrale Rolle spielen? Könnte die an der Musik geschulte Imagination Rūdakīs tatsächlich von einer derartigen übermenschlichen Kraft gewesen sein? – Was auch immer die Antwort auf diese Fragen sein mag, Abū ‘Abdollāh Dja’far ben Mohammad Rūdakī ist als der große blind-sehende Dichter in die Literaturgeschichte eingegangen.
Legendär ist auch der angebliche Umfang des poetischen Werkes Rūdakīs, das 1.300.000 bayts (Doppelverse) umfasst haben soll. Tatsächlich überliefert sind vom Diwan Rūdakīs, dessen tatsächlicher Umfang im Dunkeln liegt, nur an die 1.000 verschiedenen Genres zugehörige Verse. Auch von der Romanze Sindbād-Nāmē (›Das Buch des Sindbad‹) und der Fabelsammlung Kalīla wa Dimna sind nur Fragmente übriggeblieben. Letztere ist das unbestrittene Meisterwerk Rūdakīs, das trotz fehlender Überlieferung eine wichtige Rolle für die persische Literatur spielt. Kalīla wa Dimna ist die persische Übertragung einer wohl 2000 Jahre alten Sammlung von Tierfabeln aus dem Sanskrit und wurde von Rūdakī im Auftrag von Wesir Bal’ami angefertigt. Der Poet übersetzte jedoch die alten indischen Fabeln nicht einfach, sondern dichtete sie nach und setzte sie in Versform. Sie sind ein Musterbeispiel der ausgesprochen schlichten1 und dabei ungeheuer melodiösen Sprache des großen Farsi-Dichters, wie sie sich auch in dem folgenden berühmten Gedicht an den Fluss Amu-Daria (Oxus) zeigt:
Ich rieche gern den Duft des Molian-Bachs.
Er erinnert mich an die liebliche Geliebte.
Der Armur und sein rauer Sand
scheint mir wie Federn unter meinen Füßen.
Neben den lehrreich-amüsanten Tierfabeln und den Lobpreisliedern auf den König, den Hof und die Hauptstadt verfasste der Gelehrte Rūdakī Gedichte über zentrale Themen der menschlichen Existenz: das Verstreichen der Zeit, die Unabwendbarkeit des Todes, die Wichtigkeit der Liebe und das Verlangen nach Glück sowie die große Bedeutung von Wissen, Bildung, Erfahrung und Kunst. Dabei reicht sein Ton von Hedonimus bis Pessimismus, und Rūdakī erweist sich genauso als Meister der Erotik wie als weiser Denker.
Wichtige Werke:
Sindbād-Nāmē
Kalīla wa Dimna
1 Persisch für ›Schreibzimmer, Sammlung beschriebenen Papiers‹; Bezeichnung für Gedichtsammlung oder auch das lyrische Gesamtwerk eines Dichters in alpabetischer Ordnung; manche halten Rūdakī für den Begründer der literarischen Form des Diwan.
1 Die Kraft von Rūdakīs Poesie soll so groß gewesen sein, dass während eines Kriegszuges nach Herat in Afghanistan die Emire Nasr II. den Dichter baten, ein Loblied auf das heimatliche Bukhara zu verfassen, um den König zur Umkehr zu bewegen. Die Macht der Verse, die Rūdakī daraufhin auf die Schönheit Bukharas schrieb, ließ dann auch, so die Überlieferung, den König prompt Hals über Kopf gen Heimat aufbrechen.
1 Rūdakīs poetische Schlichtheit wurde allerdings nicht in allen Epochen der persischen/islamischen Literaturgeschichte geschätzt; je verkünstelter die Poetik der jeweiligen Epoche, desto geringer wurde die augenscheinlich so einfache Diktion Rūdakīs geachtet.
MURASAKI SHIKIBU
(UM 978–1016)
Der strahlende Prinz und die Dame Blauregen – Japans klassischer Roman
Die Geschichte des Prinzen Genji (Genji Monogatari, um 1003–1010), verfasst von der Kaiserlichen Hofdame Murasaki Shikibu, gilt vielen als der erste vollständige Roman Asiens, wenn nicht sogar der Welt. Ohne Zweifel ist, dass die monumentale Geschichte des ›strahlenden Prinzen‹ das herausragendste Werk der klassischen japanischen Literatur konstituiert und zu den großen Texten der Weltliteratur gehört.
Die Frage, ob einer der ersten, wenn nicht sogar der erste, Roman der Welt tatsächlich von einer Frau geschrieben wurde, beschäftigt die Fachleute bis zum heutigen Tag. Schon zu Murasaki Shikibus Lebzeiten kam das Gerücht auf, die Erzählung stamme eigentlich aus der Feder ihres Vaters, eine Vermutung, die sich bis heute hält. Auch andere bedeutende Zeitgenossen Murasaki Shikibus stehen ›in Verdacht‹ der möglichen Mitautorschaft an einem der komplexesten und ausladendsten Texte der Weltliteratur. Ähnlich wie im Falle des Œuvres William Shakespeares (1564–1616) erscheint Die Geschichte des Prinzen Genji als ein (fast) zu großes Werk, um es mit der historischen Gestalt seiner Verfasserin zu vereinbaren. Und konnte eine Frau in einer Zeit, in der Damen im Allgemeinen nur in der sogenannten ›Frauenschrift‹ schrieben, eine begrenzte Ausbildung erhielten und sich akzeptierterweise ausschließlich mit Poesie beschäftigten1, tatsächlich ein Erzählwerk von der Bandbreite der Geschichte des Prinzen Genji verfassen?
Murasaki Shikibus biographischer Hintergrund, auch wenn er nur in Fragmenten und zu einem Großteil über das Tagebuch der Murasaki Shikibu (Murasaki Shikibu nikki, 1008–1010) bekannt ist, deutet allerdings durchaus darauf hin, dass die Schriftstellerin die nötigen Voraussetzungen mitgebracht haben kann, um den monumentalen Roman zu verfassen, der unter ihrem Namen in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Murasaki Shikibu, deren Geburtsname nicht bekannt ist – ›Shikibu‹ bezieht sich auf das Amt ihres Vaters im Ministerium für Zeremonien, ›Murasaki‹, d. i. Glyzinie bzw. Blauregen, stammt vermutlich von dem Namen der weiblichen Hauptfigur der Geschichte des Prinzen Genji, Murasaki no Ue –, entstammte der Fujiwara-Familie, einer der wichtigsten Familien in der japanischen Geschichte, und zwar entsprang die künftige Schriftstellerin einem literarisch ausgesprochen fruchtbaren Zweig derselben. Sowohl Murasaki Shikibus Großvater als auch ihr Vater und ihre Mutter waren poetisch tätig. Da die Mutter früh verstarb, wuchs Murasaki Shikibu, anders als zu dieser Zeit in der Adelsschicht üblich, nicht im mütterlichen, sondern im Haushalt des Vaters auf, wo sie – wieder völlig entgegen den Konventionen – zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Nobunori unterrichtet wurde, also eine ›männliche‹ Bildung erhielt; unter anderem lernte sie Chinesisch, die ›männliche‹ Schriftsprache. Ihr Vater soll von der Intelligenz und schnellen Auffassungsgabe seiner Tochter so beeindruckt gewesen sein, dass er wortreich ihr weibliches Geschlecht beklagte, das ihr einen adäquaten Einsatz ihrer Talente zu verwehren drohte. Als Murasaki Shikibus Vater im Jahr 996 zum Provinzverwalter ernannt wurde, begleitete ihn seine Tochter, womit sich ihr eine weitere für eine Frau ungewöhnliche Gelegenheit eröffnete: die zu reisen. Zwei Jahre später, nach ihrer Rückkehr in die heimatliche Reichshauptstadt Heian Kyo (das heutige Kyōtō), heiratet Murasaki Shikibu mit Fujiwara Nobutaka einen entfernten, um viele Jahre älteren Verwandten. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, die unter dem Namen Daini no Sanmi (999–1077) später selbst zu einer bekannten Dichterin wurde. Sie schrieb vermutlich nach dem Tod ihrer Mutter die letzten zehn der 54 Bücher der Geschichte des Prinzen Genji und brachte somit das große Werk Murasaki Shikibus zum Abschluss. Mit dessen Abfassung begann die Schriftstellerin vermutlich nach dem Tod ihres Mannes; den Großteil der Erzählung schuf sie wohl während ihrer Zeit als Hofdame der jungen Kaiserin Fujiwara no Aikiko bzw. Jōtō mon’in. Diese Zeit am Kaiserlichen Hof hielt die Schriftstellerin in ihrem Tagebuch fest, welches eine scharfe Beobachtungsgabe auszeichnet, wie sie auch die psychologische Tiefe und Dichte der Geschichte des Prinzen Genji verrät. Das Tagebuch dokumentiert unter anderem Murasaki Shikibus Rivalität mit der zweiten großen Dichterin der Zeit: Sei Shōnagon (um 966–1025), ebenfalls des Chinesischen mächtig, war Verfasserin des Kopfkissenbuchs (Makura no sōshi, 1001–1010), ein komisches, ja, satirisches Werk in Tagebuchform, das die Welt des Kaiserlichen Hofes ähnlich dicht und lebendig einfängt wie die Texte der großen Rivalin. Nach dem Abschluss des Tagebuchs im Jahr 1010 verlieren sich die Spuren Murasaki Shikibus. Es wird jedoch angenommen, dass sie im Jahr 1014 oder 1016 verstarb, wenn auch manche Quellen erst 1025 als das Todesjahr der Schriftstellerin nennen.
Der große Roman der Murasaki Shikibu erzählt, wie sein Titel schon sagt, die Abenteuer des fiktiven ›strahlenden Prinzen‹ Genji, welche in erster Linie Liebesabenteuer sind. Die letzten 12 Bücher handeln allerdings von seinen Nachkommen: seinem angeblichen Sohn Kaoru und seinem ihm so ähnlichen Enkel Niou und ihrer Rivalität in persönlichen wie in Liebesangelegenheiten. Der Kern des Romans ist die Begegnung Genjis mit Murasaki no Ue, die er sich zur idealen Gattin formt und deren Tod ihn, wenn nicht gebrochen, so doch jeden ›Strahlens‹ beraubt, zurücklässt. Der Roman entwickelt sich von einem märchenhaften, leichtherzigen Anfang über den melancholischen Ausklang von Genjis Leben und dem unglücklichen Dreiecksverhältnis zwischen Kaoru, Niou und dem Mädchen Ukifune hin zu einem dunkel-schwermütigen Ende. Das monumentale Werk wird so von einem in idealisierendem Realismus gehaltenen Gemälde der frivolen wie kultivierten Adelsschicht zu einem komplexen Seelenporträt dreier unglücklicher Menschen. Er zeichnet sich durch emotionale Sensibilität, durch eine einfühlsame Wahrnehmung der sozialen Umwelt und nicht zuletzt durch gefühlstiefe Naturschilderungen aus. Die Handlung erstreckt sich über fast ein Jahrhundert, umfasst mehr als 400 Charaktere, von denen jeder mit kluger psychologischer Genauigkeit gezeichnet ist, und verzweigt sich in vielschichtige plot-Stränge. Zusammengehalten wird das epochale Werk durch Murasaki Shikibus sprachliche Präzision und ihren ausgesprochen flüssigen Stil. Die Geschichte des Prinzen Genji begeistert ihre Leser bis heute, auch wenn sie im Westen erst in neuerer Zeit Anklang fand. Sie ist ohne Zweifel der bedeutendste der monogatari, der klassischen japanischen Romane, und machte Murasaki Shikibu zu einer der ganz Großen der Erzählliteratur.
Wichtige Werke:
Genji monogatari (Die Geschichte vom Prinzen Genji, um 1003–1010)
Murasaki Shikibu nikki (Tagebuch der Murasaki Shikibu, 1008–1010)
1 Auch Murasaki Shikibu verfasste Gedichte, von denen 128 in der Sammlung Murasaki Shikibu shū zu finden sind.
(ABŪ MUHAMMAD AL-QĀSIM) AL-HARĪRĪ
(1054–1122)
Wie ein Regenguss – Der sprachgewandte Schelm
Die Makāmen (al-Maqāmāt, 1101–1107) von Abū Muhammad al-Qāsim al-Harīrī gelten heute wie vor 900 Jahren als das Meisterwerk der arabischsprachigen Literatur. Und auch der Einfluss dieser sprachgewaltigen Schelmengeschichten auf die Weltliteratur kann kaum zu hoch eingeschätzt werden, wenn er auch ein eher indirekter, vermittelter gewesen sein mag.
Abū Muhammad al-Qāsim, der unter dem Beinamen al-Harīrī, ›der Seidenhändler‹, bekannt ist, war ein arabischer Dichter und Sprachgelehrter. Er verfasste philologische Werke, unter anderem ein grammatikalisches Lehrgedicht und die Abhandlung Die Perle des Tauchers über die Sprachfehler der Gebildeten (Durrat al-gawwās fī auhām al-hawāss), in der er seinen schneidenden Witz und seine messerscharfe Sprachpräzision einsetzte, um die ›Sprachdummheiten‹ bloßzulegen, mit denen die angeblich Gebildeten in Wort und Schrift – seiner Meinung nach – die klassische arabische Literatursprache verunreinigten1. Während der Sprachgelehrte al-Harīrī die Annäherung der arabischen Umgangs- und Hochsprachen nicht aufhalten konnte, machte der Dichter al-Harīrī seine ›reine Diktion‹ mit seinen Makāmen unvergänglich.
Über das Leben al-Harīrīs ist wenig überliefert. Es scheint jedenfalls nicht sonderlich ereignisreich gewesen zu sein. Der große Sprachmeister wurde geboren und starb auf der Dattelpalmenplantage seiner Familie nahe der Hafenstadt Basra, wo er vermutlich studierte. Später wurde er Vorsteher des Post- und Nachrichtendienstes von Basra, eine Aufgabe, die ihn des Öfteren nach Bagdad geführt haben dürfte. Ansonsten führte der Sohn einer reichen Familie das Leben eines freien Gelehrten. Seine Makāmen, die aus 50 Einzelgeschichten bestehen und zwischen 1101 und 1107 als geschlossenes Gesamtwerk entstanden, verfasste der Dichter wohl im Auftrag eines Wesirs (Minister); die Überlieferung erzählt allerdings, al-Harīrī sei eines Tages in einer basrischen Moschee einem zerlumpten, aber ungeheuer sprachgewandten und gebildeten alten Mann namens Abū Zaid aus der Stadt Sarūğ in Nordsyrien begegnet – den der Dichter dann zu dem pikaresken Helden seiner Makāmen machte.
Makāmen bzw. Maqāmāt sind ein spezifisch arabisches Genre, das auf die mittelalterliche Straßenunterhaltung zurückgeht (der Begriff maqāmāt wird üblicherweise mit ›Bettleransprachen‹ oder ›Straßenpredigten‹ übersetzt). Es handelt sich um Geschichten in Reimprosa und/oder lyrischem Vers, vorgetragen von einem Erzähler, der jede Makāme traditionellerweise mit der Formel »Mir berichtete …« einleitet und die Schelmereien und Gaunereien einer eulenspiegelhaften Figur wiedergibt. Der schelmische Held der Maqāmāt – zumeist Bettler, Gelehrter und Galgenvogel in einer Person1 – schwindelt sich üblicherweise durch alle Fährnisse hindurch. Nichtsdestotrotz konstituieren die Geschichten in der Regel realistische Erzählungen, die den Alltag des Volkes und vor allem auch dessen Schattenseiten thematisieren. Begründet wurde das literarische Genre der Maqāmāt von dem ›Wunder der Zeit‹ Badī as Samān al-Hamadhāni (968–1008), der neben al-Harīrī der berühmteste und bedeutendste Vertreter dieses Genres ist; üblicherweise wird al-Hamadhāni die größere Originalität und Kreativität im Umgang mit den der mündlichen Überlieferung entnommenen Stoffe zugesagt, dem ›Seidenhändler‹ dagegen die überlegene Sprachvirtuosität. Al-Harīrī kann seine Inspiration durch den großen Vorgänger nicht verleugnen (gelegentlich übernimmt er den Inhalt gewisser Episoden kurzerhand von al-Hamadhāni), doch vergleicht er selbstbewusst den ersten Maqāmāt-Dichter mit einem Tröpfeln, sich selbst dagegen mit einem Regenguss2. – Diese wenig bescheidene Analogie ist durchaus berechtigt; al-Haīrīs Makāmen sind – um den Metaphernbereich zu wechseln – ein Feuerwerk von Sprachwitz und Bildgewalt, von lyrischen Kunststücken und geistreichen Gedankenspielen. Die in eleganter, komplexer Reimprosa verfassten Erzählungen sind durchsetzt mit Gedichten, ausgeklügelten Rätseln, religiösen und sprachphilosophischen Reflexionen, einer Vielzahl von Anspielungen auf die arabische Literatur, Kultur und Geschichte und nicht zuletzt mit Formspielen und -witzen, wie sie nur in der arabischen Schrift möglich sind1. Berühmt ist etwa die sogenannte ›krebsgängerische‹ Makāme2, in der al-Harīrī 100 gereimte arabische Sprichwörter so aneinanderreiht, dass sie rückwärts gelesen genau die gegenteilige Aussage ergeben wie vorwärts; oder das Streitgespräch zwischen einer Rechnung und einem literarischen Essay, das zynisch zugunsten der Rechnung entschieden wird. Außerdem handelt es sich bei den Makāmen al-Harīrīs um ein strukturell konsequent durchkomponiertes Gesamtkunstwerk. Die in sich geschlossenen Episoden (also die einzelnen Makāmen) werden zusammengehalten durch die Figuren des schelmenhaften Helden Abū Zaid, der sich mit Sprach- und Mutterwitz durchs Leben gaukelt und gaunert, und des Erzählers al-Hārit Ibn Hammām, der als moralisch-kritische Instanz fungiert und Abū Zaid am Ende jeder Makāme von der Unlauterkeit seines Lebensweges überzeugt. Diese Bekehrung ist natürlich, wie die Gesamtheit der Makāmen zeigt, nie von sonderlicher Tiefe und Dauer. Erst die letzte Geschichte präsentiert uns einen hochbetagten Abū Zaid, der als Asket in seine von den Arabern befreite Heimatstadt, aus der er von den Kreuzrittern vertrieben worden war, zurückkehrt und somit dem Erzählwerk einen abgerundeten Abschluss gibt.
Der Einfluss der Makāmen al-Harīrīs auf die arabische Literatur ist enorm. Bis heute werden seine Reimerzählungen mit ihrer stilisierten, blumigen und teilweise durchaus abenteuerlichen Sprache als Stilideal und rhetorisches Meisterwerk angesehen. Al-Harīrī beeinflusste mit seinem Werk außerdem die hebräische und persische Literatur, und auch in Europa sind die Makāmen wohlbekannt, dank zahlreicher Übersetzungsversuche (wobei der Bildreichtum des Arabischen im Allgemeinen und al-Harīrīs Sprachwitz im Besonderen eine ganz eigene Herausforderung darstellt). Besonders hervorzuheben ist dabei die kongeniale Übertragung der Makāmen