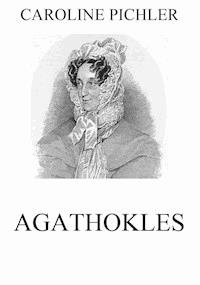
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman in Briefform, welcher die Zeit des aufdämmernden Christentums zum Hintergrund hat, entwirft ein großes Kulturgemälde und verherrlicht die Segnungen der christlichen Religion. Die Tendenz der Erzählung ist gegen den Historiker Gibbon und seine unchristliche Weltanschauung gerichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agathokles
Karoline Pichler
Inhalt:
Karoline Pichler – Biografie und Bibliografie
Agathokles
1. Calpurnia an Sulpicien.
2. Sulpicia an Calpurnien.
3. Calpurnia an Sulpicien.
4. Agathokles an Phocion.
5. Derselbe an Denselben.
6. Calpurnia an Sulpicien.
7. Sulpicia an Calpurnien.
8. Calpurnia an Sulpicien.
9. Agathokles an Phocion.
10. Sulpicia an Calpurnien.
11. Agathokles an Phocion.
12. Calpurnia an Sulpicien.
13. Sulpicia an Tiridates.
14. Agathokles an Phocion.
15. Calpurnia an Sulpicien.
16. Tiridates an Sulpicien.
17. Agathokles an Phocion.
18. Larissa an Junia Marcella.
19. Agathokles an Phocion.
20. Larissa an Junia Marcella.
21. Agathokles an Phocion.
22. Larissa an Junia Marcella.
23. Larissa an Junia Marcella.
24. Agathokles an Phocion.
25. Calpurnia an Agathokles.
26. Sulpicia an Calpurnien.
27. Agathokles an Calpurnien.
28. Larissa an Junia Marcella.
29. Agathokles an Phocion.
30. Calpurnia an Agathokles.
31. Sulpicia an Calpurnien.
32. Junia Marcella an Larissa.
33. Larissa an Junia Marcella.
34. Agathokles an Phocion.
35. Apelles an Junia Marcella.
36. Sulpicia an Calpurnien.
37. Agathokles an Phocion.
38. Calpurnia an Sulpicien.
39. Sulpicia an Calpurnien.
40. Agathokles an Phocion.
41. Eneus Florianus, Centurio der Leibwache des Cäsars Constantius, an Constantin.
42. Constantin an Eneus Florianus.
43. Calpurnia an ihren Bruder Lucius Piso in Rom.
44. Agathokles an Phocion.
45. Constantin an Eneus Florianus.
46. Agathokles an Phocion.
47. Calpurnia an Sulpicien.
48. Theophania an Junia Marcella.
49. Theophania an Junia Marcella.
50. Agathokles an Phocion.
51. Valeria an Eneus Florianus.
52. Agathokles an Phocion.
53. Theophania an Sulpicien.
54. Sulpicia an Theophania.
55. Junia Marcella an Theophania.
56. Florianus an Valerien.
57. Theophania an Junia Marcella.
58. Constantin an Eneus Florianus.
59. Agathokles an Phocion.
60. Marcius Alpinus an Lucius Scribonianus.
61. Calpurnia an ihren Bruder Lucius Piso.
62. Theophania an Sulpicien.
63. Sulpicia an Theophania.
64. Marcius Alpinus an Lucius Scribonianus.
65. Agathokles an Phocion.
66. Theophania an Junia Marcella.
67. Agathokles an Phocion.
68. Theophania an Junia Marcella.
69. Constantin an Eneus Florianus.
70. Theophania an Junia Marcella.
71. Calpurnia an Sulpicien.
72. Theophania an Junia Marcella.
73. Calpurnia an Sulpicien.
74. Theophania an Junia Marcella.
75. Sulpicia an Calpurnien.
76. Marcius Alpinus an Lucius Scribonianus.
77. Calpurnia an Sulpicien.
78. Agathokles an Phocion.
79. Agathokles an Phocion.
80. Calpurnia an ihren Bruder Lucius.
81. Marcius Alpinus an Lucius Scribonianus.
82. Theophania an Junia Marcella.
83. Calpurnia an ihren Bruder Lucius.
84. Agathokles an Constantin.
85. Theophania an Junia Marcella.
86. Calpurnia an Lucius Piso.
87. Agathokles an Phocion.
88. Theophania an Junia Marcella.
89. Calpurnia an ihren Bruder Lucius in Rom.
90. Constantin an Agathokles.
91. Theophania an Junia Marcella.
92. Agathokles an Constantin.
93. Theophania an Junia Marcella.
94. Agathokles an Phocion.
95. Valeria an Theophanien.
96. Constantin an Agathokles.
97. Tiridates an Constantin.
98. Agathokles an Constantin.
99. Constantin an Agathokles.
100. Theophania an Junia Marcella.
101. Marcius Alpinus an Lucius Scribonianus.
102. Calpurnia an ihren Bruder Lucius.
103. Agathokles an Phocion.
104. Marcius Alpinus an Lucius Scribonianus.
105. Theophania an Phocion.
106. Calpurnia an ihren Bruder Lucius.
107. Agathokles an Phocion.
108. Agathokles an Theophanien.
109. Calpurnia an ihren Bruder Lucius.
110. Theophania an Junia Marcella.
111. Theophania an Agathokles.
112. Valeria an Theophanien.
113. Apelles an Junia Marcella.
114. Agathokles an Phocion.
115. Calpurnia an ihren Bruder Lucius.
116. Apelles an Junia Marcella.
Agathokles, K. Pichler
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849633264
www.jazzybee-verlag.de
Karoline Pichler – Biografie und Bibliografie
Romanschriftstellerin, geb. 7. Sept. 1769 in Wien, gest. daselbst 9. Juli 1843, erhielt im Haus ihres Vaters, des Hofrats v. Greiner, eine sehr sorgfältige Erziehung, verheiratete sich 1796 mit dem nachherigen Regierungsrat Andreas Pichler und trat seit 1800 als Schriftstellerin mit zahlreichen Romanen und einzelnen dramatischen Versuchen auf. Von ihren Romanen fanden »Agathokles« (Wien 1808, 3 Bde.), »Frauenwürde« (das. 1808, 4 Bde.), »Die Belagerung Wiens« (das. 1824, 3 Bde.), von ihren kleineren Erzählungen »Das Schloß im Gebirge«, »Der schwarze Fritz« den meisten Beifall. Nicht ohne Erzählertalent und eine gewisse Würde, konnte P. als Schriftstellerin weder tiefere Konflikte und Charaktere darstellen, noch überall die redselige Breite der alten Belletristik vermeiden. Ihre »Sämtlichen Werke« erschienen Wien 1820–45, 60 Bde. An sie schlossen sich ihre »Denkwürdigkeiten«, herausgegeben von F. Wolf (Wien 1844, 4 Bde.). Briefe Karoline Pichlers an Therese Huber erschienen im 3., solche an Hormayr im 12. Bande des »Jahrbuchs der Grillparzer-Gesellschaft« (Wien 1893 u. 1902).
Wichtige Werke:
Idyllen, 1803Ruth, 1805Agathocles, 1808Die Belagerung Wiens, 1824Die Schweden in Prag, 1827Die Wiedereroberung Wiens, 1829Henriette von England, 1831Zeitbilder, 1840Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, 1844Agathokles
1. Calpurnia an Sulpicien.
Rom, im December 300.
Welcher Einfall von Sulpicien, in diesen Tagen auf's Land zu gehen, und den Zeitpunkt, worin die Hauptstadt der Welt in ihrem glänzendsten Lichte erscheint, auf einer einsamen Villa am Ufer der See zuzubringen, die in dieser Jahreszeit von Stürmen gepeitscht und mit Nebeln bedeckt ist! Was, um aller Götter willen, kann sie dort halten? Wie ist es möglich, allen Freuden und Herrlichkeiten der Saturnalien1 zu entsagen, um in der abgeschiedensten Einsamkeit sich selbst zu leben?
Sich selbst! nicht doch. Wer das nicht besser wüßte! Laß immerhin die Welt ist jene Ausrufungen ausbrechen, und vergebens rathen, was dich jetzt in jene Stille lockt: sie soll und darf die heimlichen Reize nicht kennen, die deine Verborgenheit verschönern. Das ist recht und in der Ordnung. Aber daß du auch mir ein Geheimniß daraus machen willst, das kann ich dir nicht verzeihen. Ich darf ja nur Einen Namen nennen, um dein Gesicht mit dem schönsten Purpur zu überziehen, und dich, falls du den Brief in Gegenwart einer gewissen Person liefest, noch reizender zu machen! Aber da würde dir ja ein Dienst damit geschehen, und das will ich in diesem Augenblicke nicht. Es sey dir genug, zu wissen, daß ich von Allem unterrichtet bin, und deine Zurückhaltung dir nichts nützt. Wahrlich, du machst deine Sachen schlau und gut! Unter dem Verwande der Sorgfalt für deine Landwirthschaft erhältst du von deinem Manne die Erlaubniß, und einen großen Dank obendrein, jetzt auf deine Villa zu gehen, um den nachlässigen Verwalter zu überraschen, und – während der gute Ehemann in Rom die Emsigkeit seiner Frau nicht genug rühmen kann, hat sie sich nur Gelegenheit verschafft, ihren Liebling ganz ungestört und nach Gefallen zu sehen.
Doch Scherz bei Seite, liebe Freundin! Die Sache hat eine viel zu ernste Seite, als daß ich länger in jenem Tone fortfahren könnte. Wie war es dir möglich, diesen Schritt zu wagen, und die Augen ganz vor den Folgen, die er wahrscheinlich haben wird, zu verschließen? Tiridates ist liebenswürdig, tapfer, edel, seine königliche Abkunft, sein und seiner Familie Unglück macht ihn anziehend, und ich begreife wohl, daß er einem feinfühlenden gebildeten Weibe, besonders einem, das leider in seinem Hause nichts solches aufzuweisen hat, gefährlich werden kann; ich begreife, daß du ihn liebst: und daß er dich, die schöne geistreiche Frau, dafür anbetet, ist nicht mehr als seine Schuldigkeit. Aber muß man darum so halsbrechende Dinge wagen? Du konntest ja den armenischen Prinzen täglich in deinem Hause sehen. Dein Mann, ich weiß es, schätzt sich's zur Ehre, den Liebling des Cäsar Galerius2 seinen Freund nennen zu können. Er prahlt damit, er gibt sich das Ansehen, die Absichten des Prinzen durch sich und seine Freunde an den Höfen von Mailand und Nikomedien zu unterstützen, und wenn einst Tiridates den Thron seiner Väter besteigt – gib Acht – dein Serranus läßt dann nicht undeutlich merken, daß ohne ihn das Alles wohl nicht geschehen wäre. Was trieb dich denn also fort? Was bewog dich, jetzt nach Bajä zu gehen, wo dein Umgang mit Tiridates weit mehr auffallen muß, als in Rom, und deine häusliche Ruhe, deinen Ruf vor der Welt auf's Spiel zu setzen? Wenn dein Mann, der, wie alle eitle Menschen, eifersüchtig ist, erfährt, was auf seiner Villa vorgeht, (und wie leicht ist das nicht, da deine Leute darum wissen müssen?) wird er nicht toben, rasen und ein Aufsehen machen, das dich dem boshaftesten Gelächter der Stadt Preis geben, dir die Herrschaft über ihn, die allein deine häusliche Ruhe sichert, entreißen, und dir den Aufenthalt bei ihm vollends unerträglich machen wird? Willst du dich dann von ihm trennen? Wird das dein Vater zugeben, der in die Verbindung mit der Anicischen Familie seinen Stolz setzt? Und was steht dir dann für ein Leben bevor?
Es ist wahr, du kannst in Nom deinen Tiridates weder so oft noch so ungestört sehen, als dein Herz wünschen mag. Dein Mann, die Freunde deines Mannes, deine Verwandten, die dich besuchen, sind öfters zugegen. Das ist aber auch das Einzige, was du zu ertragen hast, und – aufrichtig gesprochen – liegt nicht selbst in dieser Störung, in diesen Entbehrungen ganz eigentlich die Würze der Liebe, die wohl ohne sie gewiß nicht halb so warm und reizend seyn würde?
Du nennst mich immer die Leichtsinnige, die Epikuräerin; aber du kennst entweder die Lehren dieses Weisen nicht in ihrem ganzen Umfange, oder du schließest die Augen absichtlich vor ihrem Werth. Kluges Maaß, sparsamer Genuß der Freude, Kraft zur Entbehrung des Liebsten, wenn es die Vernunft fordert, das ist es, was man in seiner Schule lernt, die bei weitem nicht so leicht, so locker ist, als du glaubst. Ich an deinem Platze, zum Beispiel, würde nicht nach Bajä3 gegangen seyn, ich würde mir den Genuß der Freuden, die mich dort erwarteten, aus Grundsätzen versagt haben, und meinen Geliebten lieber seltner, und mit minderer Freiheit sehen, um ihn immer sehen zu können; den großen Vortheil abgerechnet, daß unsre gegenseitige Liebe dann viel länger neu und anziehend geblieben, und mit dem großen Reize der Heimlichkeit gewürzt gewesen wäre.
Du siehst, meine Sulpicia, daß ich besonnener und klüger bin, als du glaubst, und jener Leichtsinn, jene Kälte, die du mir so oft vorwirfst, ist nichts als Ausübung wohl überdachter Grundsätze. Sogar die Lehren der strengen Stoa, die du einst so warm behauptet, und jetzt so arg verlassen hast, verwerfe ich nicht. Ich erkenne z.B. ganz die tiefe Wahrheit des Satzes, daß man alle Güter der Erde an einen solchen Ort stellen soll, woher sie das Schicksal nehmen kann, ohne das Gebäude unserer Ruhe zu erschüttern4. An diesen Platz nun würde ich, wenn ich je liebte (und das könnte sich denn wohl ereignen), auch meinen Geliebten stellen; denn der gehört ja, wie dein Beispiel mich lehrt, ganz vorzüglich zu den edelsten Gütern des Lebens.
Doch was helfen alle diese Vorstellungen! Was hälfe die Beredtsamkeit eines Cicero, gegen die Macht einer Leidenschaft, deren zerstörende Wirkungen ich mit Bedauern an meinen Freunden erfahre, und vor denen mich die gütigen Götter bewahren mögen! Ohne also nur im Geringsten zu hoffen, daß mein Brief dich bekehren werde, will ich blos hiemit die Pflicht der Freundschaft erfüllt und dich gewarnt haben, zugleich aber dich versichern, daß, was auch der Ausgang der Begebenheiten seyn möge, mein Herz, meine Liebe zu dir unverändert bleiben wird, und daß ich meinen Stolz darein setzen werde, wenn – was die Götter verhüten – die Sache schlimm abläuft, dich nie zu verlassen, und aus allen meinen Kräften dein böses Schicksal entweder abzuwehren, oder redlich mit dir zu tragen. Leb' wohl.
Fußnoten
1 Die Saturnalien waren eines der glänzendsten und allgemeinsten Feste in Rom, beinahe das, was jetzt der Carneval ist, und wurden im December gefeiert. Zum Andenken des goldenen Zeitalters, unter Saturns Herrschaft, schien Alles während jener Tage in den Zustand ursprünglicher Gleichheit zurückzutreten; die Sclaven aßen mit ihren Gebietern, und aller Unterschied der Stände hörte auf.
2 Zu der Zeit, in welcher dieser Roman spielt, hatte Rom bereits aufgehört, der Sitz der römischen Kaiser zu seyn. Diocletian, der sich aus dem Sclavenstande zur Würde eines der vornehmst n Offiziers, zum Befehlshaber der k. Leibwache, und nach dem Tode des Kaisers Numerius auf den Thron desselben geschwungen hatte, hatte sich in seinem ehemaligen Waffengenossen und Landsmann Maximian einen Gefährten der Regierung erwählt, und das römische Reich so zwischen ihm und sich getheilt, daß Maximian die Abendländer von Mailand aus, wo er residirte, Diocletian hingegen den östlichen Theil des Reichs in Nikomedien, wohin er seinen Sitz verlegte, beherrschte. Bald darauf fand er nöthig, noch zwei Mitregenten zu erwählen. Maximian gesellte sich den Constantius Chlorus als Cäsar zu, und Diocletian nahm den Galerius in dieser Würde zu sich. Beide Cäsaren standen zu ihren Augusten in dem Verhältniß von Söhnen zu ihren Vätern, auch mußten beide sich von ihren vorigen Gemahlinnen trennen. Maximian gab dem Constantius seine Tochter zur Ehe, und Diocletian vermählte dem Galerius die seinige, Valeria.
Diese vier Beherrscher theilten sich in den weiten Umfang des römischen Reichs. Constantius besaß Gallien, Spanien, Brittannien; Galerius die Ufer der Donau und die illyrischen Provinzen; Maximian Italien und einen Theil von Afrika; Diocletian selbst, Aegypten, Thrazien, und die asiatischen Provinzen. Jeder dieser vier Monarchen war unumschränkt in seinem Bezirke, aber ihr vereinigtes Ansehen erstreckte sich über die ganze Monarchie.
Man sehe Gibbons Geschichte des Verfalls des römischen Reichs, 2ter Theil, woraus überhaupt fast alle geschichtlichen Notizen und Züge in diesem Buche genommen sind.
3 In Bajä, einer der reizendsten Gegenden von Italien, auf dem Wege zwischen Rom und Neapel, hatten die meisten römischen Großen ihre Landhäuser, die sie Villa nannten.
4Seneca de consolatione.
2. Sulpicia an Calpurnien.
Bajä, im December 300.
Du liebst nicht, Calpurnia, du wirst nie lieben. – In diesen Worten liegt der Aufschluß zu deinem ganzen Betragen, und zugleich die Antwort auf Alles, was mir deine Freundschaft, die ich mit innigstem Danke erkenne, so wohlmeinend, so vernünftig vorstellt. Glaube nicht, meine geliebte Jugendgespielin, meine warme treue Freundin, daß ich den Werth deiner Grundsätze mißkenne, oder deinem schönen Gemüth auch nur um einen Grad weniger Wärme und Eifer für's Gute zutraue. Du hast Recht – vollkommen – unbestreitbar; aber ich, meine Freundin, obwohl ich das Widerspiel von dir scheine, ich habe auch nicht Unrecht. Und warum? Wir sehen Beide uns selbst, die Welt um uns, und unsere Verhältnisse zu ihr aus einem andern Gesichtspunkte an; wir handeln nach den Regeln, die dieser uns an die Hand gibt; kurz – wir thun Beide, nicht was wir wollen, sondern was wir eben nicht lassen können. Last uns doch, liebe Calpurnia, den eiteln Stolz auf Grundsätze und Systeme aufgeben, in welchen wir ohne Verdienst, blos dem Antriebe der Natur folgen! Wir sind nichts, als was die Umstände aus uns machen wollen. Dich haben sie mit einem leichten Blute, mit vielem Verstande, und einer so glücklichen Proportion deiner Leibes- und Seelenkräfte ausgestattet, daß das Gleichgewicht unter ihnen selten gestört, und gestört, leicht wieder hergestellt wird. Zudem hat dich das Glück in einer großen reichen Familie geboren werden lassen. Die Pisonen bedürfen keiner fremden Unterstützung. Dein Vater hat außer zwei hoffnungsvollen Söhnen – dem Stolz, und den Stützen seines edeln Hauses – nur dich, das Ebenbild einer geliebten längst entschlafenen Gattin. In dir lebt ihm seine Sempronia wieder auf, in dir liebt er Tochter und Weib zugleich, dich wird er nie zu einem Eheband zwingen, das dein Herz verwirft, und ob er gleich wünscht, durch dich einen dritten Sohn zu erhalten, drängt er dich doch nie zu diesem Schritt, und wendet nicht einmal die Waffen der Ueberredung gegen dich an. Du bist also von Natur und Glück zur Epikuräerin bestimmt, ja du bist die geborne Schülerin dieses Weisen.
Mich leitete ein düsteres Temperament, das Unglück eines herabgekommenen Hauses, der Kummer einer geliebten Mutter, die ihr häusliches Leiden standhaft trug, der harte Zwang, unter welchem mein Vater nach alt römischer Sitte das ganze Haus hielt, zu einer ernsteren Schule. Ich glaubte in den Lehren der Stoa die Kraft zu finden, die mich mein Loos ertragen machen sollte. Ich suchte meinen Stolz darin, den Göttern das Schauspiel eines starken, mit seinem feindlichen Schicksal ringenden Gemüthes zu geben1, und so folgte ich mit keinem besondern Widerwillen dem Befehle meines Vaters, als er, ohne mich zu fragen, laus Rücksichten für seine übrigen Kinder, meine Hand einem Sohne des Anicischen Hauses verhieß. Serranus Anicius wurde mein Gemahl, und ich glaube, ich hatte ihn vorher kaum dreimal, und nie anders als in Gegenwart unserer Verwandten gesehen. Ich fühlte keine besondere Abneigung gegen ihn, aber eine große Neigung, meine Pflichten auf's strengste zu erfüllen. Die Matronen des alten Roms, jene würdigen großen Gestalten der Vorwelt, waren meine Vorbilder: ihnen suchte ich zu gleichen. Wie sie, lebte ich nun in meinem Gynecäum2, versammelte meine Sclavinnen um mich, arbeitete mit ihnen, und ich kann mit Wahrheit behaupten, daß in den drei Jahren unserer Ehe mein Mann und ich kein anderes Gewand trugen, als was durch meine Hände, oder unter meiner Aufsicht gesponnen, gewoben, genäht oder gestickt wurde. Die volle Zufriedenheit meines Vaters, die unbegränzte Achtung des Serranus war der Lohn meiner Anstrengungen. Die Eitelkeit, seine einzige Leidenschaft, war durch den Gedanken geschmeichelt, eine Frau von ächt römischer Sitte zu besitzen, die sich vor den Meisten ihrer Zeitgenossinnen auszeichnete. Ich war zufrieden – aber bei weitem nicht glücklich.
Da kam Tiridates in unser Haus. Laß mich von dem Eindrucke schweigen, den seine Gestalt, sein Schicksal auf mich gemacht haben. Du weißt es ohne dies, du warst größtentheils Zeugin jener Begebenheiten. Nur das laß mich sagen, daß seit jenem Augenblicke mein ganzes Wesen verändert und umgestaltet war. Laß mich das Gleichniß brauchen, das meine Empfindungen am besten erklärt. In mir war es, wie in einer düstern Nachtgegend, wenn auf einmal Aurora die Pforten des Tages öffnet, und Licht und Wärme durch die kalte Dunkelheit sich ergießt. In mir ward es Licht. Ich wußte, was ich wollte, was mir so lange gefehlt hatte, wozu ich eigentlich auf der Welt war. Diese Leidenschaft hat das Räthsel meines bis dahin zwecklosen Daseyns gelöset – und was hindert mich, mit frommem Glauben der Meinung des göttlichen Plato beizupflichten, und überzeugt zu seyn, daß ich jetzt die zweite Hälfte meines Ichs gefunden habe? Was thut's zur Sache, daß Tiridates an den Ufern des Arares und ich in Rom geboren wurde? Die Seelen, die sich vor ihrer Herabkunft auf die Erde kannten und liebten, haben sich wieder gefunden, und nichts als der Tod kann sie scheiden.
In diesem festen – Glauben? – nein, in dieser unumstößlichen Ueberzeugung wird und kann mich nichts irre machen, und nichts bewegen, auch nur um einen Grad kälter, oder besonnener, wie du es nennst, zu handeln. Tiridates oder den Tod! Es gibt kein Glück, kein Leben, keine Tugend ohne ihn. Mag die Welt sagen, was sie will – mag Serranus durch Argwohn oder Verrath mein Geheimniß entdecken, mag er und mein Vater dann über mich verhängen, was sie wollen – es gilt mir gleich. Achtet der Taucher, der sich in's Meer stürzt, um eine köstliche Perle zu holen, achtet er der Wogen, die über ihn zusammenschlagen? Muß er sie nicht über sich ergehen lassen, wenn er seinen Zweck erreichen will?
Und dann endlich – was kann Serranus von mir fordern, das ich nicht bereit wäre, ihm immer fort so zu leisten, wie bisher? Sein Hauswesen will ich fortan mit pünktlicher Treue besorgen, seine Sclaven und Sclavinnen zur Arbeit anhalten, auf die Wirthschaft, auf seinen Nutzen sehen, wo und wie ich's vermag. Mehr fordert er nicht – mehr bedarf er nicht. Liebe hat er nie verlangt – ich nie gegeben – ihm nie geben können. Sein Herz hat keine Bedürfnisse. Worin wäre er also verkürzt? Ich verletze keine Pflicht gegen ihn, und bin sicher, nie eine zu verletzen; denn dafür, daß mein Umgang mit Tiridates in den Schranken der Tugend bleiben soll – bürgt mir meine Denkart. Uebrigens glaube nicht, daß ich so tief herabsinken würde, ihn zu betrügen. Die Reise nach Bajä war weder mein Vorwand, noch mein Plan. Sie war sein Wunsch – er ersuchte mich darum, weil die Anwesenheit eines von uns jetzt schlechterdings auf der Villa nothwendig war, und er sich nicht entschließen konnte, Rom während der Saturnalien zu verlassen. Er schickt mich – ich gehe gern – denn Tiridates hält sich seiner Geschäfte wegen in Puteoli auf. Ich mache mir kein Verdienst aus dieser Reise, ich will nicht, daß Serranus sie dafür ansehe – es bleibt Alles klar und würdig zwischen ihm und mir.
Doch genug von mir. Jetzt auch ein Weilchen von dir, meine Freundin. Wir haben noch eine kleine Rechnung mit einander abzuthun. Ist es wohl recht von dir, während ich, die Aeltere von uns Beiden, die Matrone, dir, dem Mädchen, meine Geheimnisse aufdecke, so verschlossen gegen mich zu seyn? Woher weißt du meine Zusammenkünfte mit Tiridates? Woher kömmt dir diese Allwissenheit? Soll ich glauben, du könntest wie eine thessalische Zauberin das Verborgene errathen? O halte mich nicht für leichtgläubig, weil ich so offenherzig bin. Soll auch ich dir einen Namen nennen, um dein Gesicht mit Purpur zu überziehen? Agathokles? – Nicht? Er, der Freund des armenischen Prinzen, der Sohn des Hegesippus, der Gastfreund deines Hauses, ist jetzt in Rom, täglich in eurem Hause, ja ich glaube, er wohnt bei euch. Er ist edel, verständig, und ein düster glühender Schwärmer für Alles, was ihm Größe und Tugend scheint. Wie könnte es anders seyn, als daß die schöne blühende Römerin, mit allen Vorzügen, die Natur und Fleiß einem weiblichen Wesen geben können, geschmückt, den Beifall des feinen Kenners alles Schönen und Guten erhalten mußte, daß der liebenswürdige Sonderling zuerst Achtung, und dann vielleicht auch eine wärmere Empfindung für diese seltne Erscheinung fühlte. Erröthe nicht, Calpurnia! Agathokles ist deiner würdig. Wenn ich wieder in Rom seyn werde, werde ich dir viel Schönes und Schätzbares von ihm erzählen, das ich durch Tiridates von ihm erfuhr, das aber für einen Brief viel zu lang wäre. Leb' wohl, liebe Calpurnia, und zürne mir nicht, daß ich nicht wollen kann, weise und besonnen seyn. Bald hoffe ich bei dir in Rom zu seyn, denn ich denke mit meinen Geschäften hier nicht sehr lange zu thun zu haben. Ich habe die Villa in einem sehr zerrütteten Zustande angetroffen – wie es denn bei der gänzlichen Abwesenheit der Gebieter, wo Alles dem Gesinde überlassen wurde, nicht anders zu vermuthen war. Indessen habe ich mancherlei Anstalten und Einrichtungen getroffen, mit denen Serranus, wie ich glaube, zufrieden seyn wird, und die künftigen Unordnungen vorbeugen sollen. Sobald Alles in gehörigem Gange ist, eile ich in deine Arme.
Fußnoten
1Seneca de Providentia.
2 So hieß der Ort des Hauses, in welchem die Frauen abgesondert wohnten.
3. Calpurnia an Sulpicien.
Rom, im Jänner 301.
Bald hätte mich dein Brief böse gemacht, wenn ich dir überhaupt jemals zürnen könnte, und wenn mich nicht die feinen Schmeicheleien am Ende wieder besänftiget hätten. Von dir sage ich also nichts mehr. Du scheinst es nicht zu wollen – und kannst auch jetzt nicht hören. Dir darzuthun, daß die Leidenschaft, die dich beherrscht, deine gesunde Vernunft gefangen halt, und dich Alles durch das gefärbte Glas ihrer Eingebungen ansehen läßt, würde eben so vergeblich seyn, als wenn ich mich jetzt an's Ufer des Meeres hinstellte, um den Fischen den Homer vorzulesen. Alles, was ich hinzufügen will, ist der fromme und gewiß herzliche Wunsch, daß die Bezauberung, in der ich dich zu meiner Betrübniß sehe, eher aufhören möge, als es für deine Ruhe zu spät ist.
Nun also von mir und unserm Gastfreunde. Wie kannst du glauben, daß ich dir etwas verschweigen wollte? Gewiß, der Gedanke kam nicht in meine Seele. Ich schrieb dir nicht von ihm, weil – weil ich nicht an ihn dachte, weil deine Angelegenheit mich zu sehr beschäftigte, um andern Gedanken Raum zu lassen. Du nennst ihn einen Sonderling, darin hast du vollkommen Recht – aber auch einen liebenswürdigen ? O da fehlt noch viel! Erstlich ist seine Gestalt, obwohl edel und bedeutend, doch nichts weniger als schön. Zweitens ist seine Art, sich zu kleiden, viel zu einfach, ja beinahe nachlässig, und er wird nie zwischen allen den schöngelockten, geschmückten, von Salben duftenden Jünglingen, die uns umschwärmen, einen vortheilhaften Eindruck machen. Drittens ist mir seine Tugend und Philosophie zu rauh, zu düster. Er kömmt auch mit Niemand besser aus, als mit deinem Vater. Ich wünschte, du wärst einmal gegenwärtig, wenn diese zwei glühenden Republikaner, diese geschwornen Feinde der Tyrannei, mit einander eifrig reden. Der Contrast der Wirklichkeit mit ihren Ideen erhitzt ihre Einbildungskraft noch mehr, sie ergießen sich in bittern Tadel der jetzigen Zeit und Sitte, und erheben die Vergangenheits mit den ungemessensten Lobsprüchen. Dann bekömmt die Haltung unsers Gastfreundes etwas so hohes, edeltrotztges, sein dunkles Aug' sprüht Funken, sein sonst bleiches Gesicht überzieht eine so feine Röthe, und um seinen Mund, der überhaupt nicht unangenehm ist, bildet sich ein so lieblicher Zug, daß man in solchen Augenblicken versucht wäre, den begeisterten Redner für hübsch, und das, was er sagt, für nicht ganz so abenteuerlich und überspannt zu halten, als sonst. Aber das sind nur Augenblicke, und so, wie er schweigt, und man Zeit hat, über seine Behauptungen nachzudenken, sieht man ihre Unstatthaftigkeit ein. Ich weiß übrigens wenig – beinahe nichts von ihm; denn mit mir spricht er nicht viel. Ich stehe viel zu tief unter den hohen Idealen der Lucretien, Portien u.s.w., die seinem Geiste vorschweben. Schon der erste Eindruck, den ich auf ihn machte, muß höchst ungünstig für mich gewesen seyn. Mein Vater führte ihn zu mir, als ich eben – ich muß gestehen – ziemlich nachlässig gekleidet, und ein milesisches Mährchen1 in der Hand, auf meinem Ruhebette lag. Welch ein Abstand von jenen Matronen! Welche Versündigung an seinen Grundsätzen! Wie könnte ein so leichtfertiges Ding vor so strengen Augen Gnade finden! Du wirst dein Glück bei ihm machen – und ich – werde dich sicher nicht beneiden.
Eins habe ich an ihm bemerkt, und es sollte mir leid thun, wenn ich richtig gesehen hätte; denn bei allen seinen Sonderbarkeiten halte ich ihn für einen achtungswürdigen Mann. Er scheint einen geheimen Kummer zu haben. Diese trübe Ansicht des Lebens, diese strenge Abneigung von allen Freuden der Welt und der Jugend ist bei einem geistvollen, im Schooße des Glückes gebornen jungen Manne sonst nicht zu erklären. Auch bestätigen manche seiner Aeußerungen diese Vermuthung. Wenn sie gegründet wäre – wie gesagt – es würde mir sehr leid thun. Erkundige dich doch darüber bei Tiridates, und schreibe mir noch, ehe du Bajä verlässest. Leb' wohl.
Fußnoten
1 Milesische Mährchen hießen die kleineren Erzählungen und Romane jener Zeiten, deren Gegenstand die Liebe, und nicht immer die platonische war.
4. Agathokles an Phocion.
Rom, im Jänner 301.
Ich bin in Rom. Daß ich dir seit meinem Aufenthalte von vierzehn Tagen noch nicht geschrieben, mag die Neuheit der Dinge, die mich umgibt, und ihre Einwirkung auf mich entschuldigen. Daß ich aber hier jene Heiterkeit und Fröhlichkeit nicht gefunden habe, und nicht finden werde, die man sich in Nikomedien für mich versprach – das fühle ich. Auch ist Rom vielleicht unter allen Orten der Welt gerade derjenige, wo ich am wenigsten genesen werde. – Bin ich denn aber krank? Man bildet es sich ein, weil ich nicht leben kann, wie die Uebrigen um mich herum. Ihre Verkehrtheit macht mich seltsam – ihre Thorheiten mich streng und unverträglich erscheinen. Nicht, daß ich das Ungeheure, das Unmögliche fordere; aber daß Wahrheit und Tugend, Zucht und Sitte ihnen unmöglich scheint, das ist der eigentliche Grund unseres Streites. Das Jahrhundert ist krank, nicht der, der kühn genug ist, mit voller Kenntniß der bessern Vergangenheit es so zu nennen. Wie soll ich es unter diesen Menschen aushalten!
Mit der Beschreibung meiner Reise zu Wasser und zu Land will ich dich, aus Achtung für deine Zeit, verschonen. Dir genügt zu wissen, daß ich gesund und mit recht heitern offenen Sinnen in der Hauptstadt der Welt ankam. Der Genuß der unbeschränkten Natur, die Unendlichkeit des Meeres, die Freiheit meiner Muße hatte mich froh und für jeden guten Eindruck empfänglich gestimmt. Dir, dem Lehrer meiner Jugend, dem keine meiner Empfindungen fremd ist, darf ich gestehen, daß ein seltsames Gefühl mich ergriff, als unser Schiff in die Mündung der Tiber einlief, und nun bald der Schauplatz jener großen würdigen Scenen, die mein Gemüth von Kindheit an ergriffen hatten, vor mir erscheinen sollte. Es glühte in mir, meine Brust schlug stärker. So kam ich in Rom an. Von der Höhe des Kapitols schienen die Manen der großen Vorfahren herabzuschweben. Rund umher war heiliger Boden. Ueberall Erinnerung, – Würde, – Hoheit. Durch die menschenvollen Straßen führte mich mein Wegweiser in das Haus unsers Gastfreundes Lucius Piso. An manchem Denkmal ehrwürdiger Vergangenheit, an manchem Weiser auf einen hellen Punkt der Geschichte, ging ich mit hochschlagendem Herzen vorüber, mit dem festen Vorsatz, sie alle nächstens zu besuchen. Am Vorhofe empfing uns eine Schaar reich gekleideter Sclaven. Man führte mich in's Atrium1. Die Bildsäulen des Pisonischen Hauses, viel merkwürdige Gestalten, dem Geschichtskundigen wohlbekannt, standen hier. Ihre erhebende Gegenwart hatte die Länge der Zeit getäuscht. Ich sah erst am Sonnenzeiger im Hofraume, daß man mich eine ziemliche Weile hatte warten lassen. Jetzt erschien ein zierlicher Sclave, der vorzüglich schön griechisch sprach – und führte mich durch viele kostbar geschmückte Gemächer, voll Vasen, Gemälden, Bildsäulen – zum Lucius Piso. Er ist ein würdiger Mann – an der Gränze des Greisenalters, kräftig, verständig, edel – weit edler aber ohne den Prunk, der ihn umgibt, und seinen innern Werth verhüllend mindert. Der Vater gefiel mir – minder die Söhne. Es sind Jünglinge, nicht ganz so von allen Vorzügen entblößt, wie die übrigen, die ich hier und zu Hause kennen gelernt habe; aber die Farbe des Zeitalters hat sich ihnen zu stark mitgetheilt, um sie wahrhaft achtungswerth zu lassen. Vor dem Abendessen stellte mich Piso seiner Tochter vor. Bei den Göttern, ein reizendes Geschöpf! Das Gerücht hatte mich bereits auf sie aufmerksam gemacht – ich fand dennoch in jedem Sinne mehr, als ich erwartet hatte. So viel Schönheit, so viel unaussprechliche Anmuth des Körpers und Umgangs, und so viel Leichtsinn und Verkehrtheit der Gesinnungen! Die Tochter eines der ersten römischen Häuser – die Abkömmlingin so edler Matronen, im Anzug und den Umgebungen einer griechischen Hetäre2, und dennoch in Reden und Handlungen vollkommener Anstand und edle Weiblichkeit!
Besser als alle übrigen Menschen, die ich in Rom kennen gelernt habe, würde mir Sectus Sulpicius, ein Römer aus einem altadeligen Geschlechte, gefallen, wenn nicht ein Zug von Härte, und ich fürchte zu sagen, Eigennutz, diesen Charakter befleckte. Eine liebenswürdige Tochter hat er, ohne auf ihr Glück Rücksicht zu nehmen, seinen Planen geopfert. Sulpicia soll schön, tugendhaft, und in der Verbindung mit einem armseligen Weichling aus dem Anicischen Hause sehr unglücklich seyn. Ich freue mich, sie bald kennen zu lernen. Unser Freund Tiridates ist auch der ihrige. – Ob er ihr noch mehr ist, mag ich nicht erforschen, weil ich mir die Achtung für sie gern rein erhalten möchte.
Meinem Vater habe ich bereits zweimal – einmal aus Corinth mit einem zurückgehenden Schiffe, und vor mehreren Tagen aus Rom geschrieben. Die Ehrfurcht, die ich ihm als Sohn schuldig bin, will ich wissentlich nie verletzen. Uebrigens kann ich leider von dem, was er wünscht, nichts thun. Ich kann nicht leben und handeln wie er; denn ich kann nicht denken und fühlen wie er, und eines festen Gemüthes gänzliche Umstimmung ist nicht das Werk der Ueberredung oder des Zwanges. Umstände, Zeit, Verlockung könnten etwas thun; aber wo die Ueberzeugung des Rechts so unerschütterlich gegründet ist, wie in mir, ist auch von dieser nichts für mich zu fürchten, für ihn nichts zu hoffen. Er hat mich aus Nikomedien fortgeschickt, um in andern Ländern durch Erfahrung zu lernen, daß meine Denkart abenteuerlich, meine Forderungen an die Menschheit überspannt, meine Begriffe von öffentlichem Wohl thöricht seyen. Ich habe ihm gehorcht. Laß mich gestehn, daß mich dieser Gehorsam nichts kostete; denn in meinem Innern war eine Stimme, die mir sagte, daß Vater und Sohn nicht so von einander denken, und wenn sie so denken, nicht beisammen leben sollten. Meine Ansicht aber wird ewig dieselbe bleiben. Rom wenigstens wird nichts daran ändern. Wie widerlich mir diese Stadt mit ihren Einwohnern ist, kann ich dir nicht sagen. Auch glaube ich gern, was schon Tiridates (mit dem ich allein hier in diesem Sammelplatze von Lastern und Thorheiten leben und reden mag) gegen mich behauptete, daß gerade der scharfe Gegensatz des Einst und Jetzt, der in diesen verächtlichen Nachkommen würdiger Väter so grell in die Augen springt, meine Abneigung gegen sie noch vergrößert. Nein, wahrlich, Phocion! mein Vater hätte mich nicht nach Rom schicken sollen!
Indeß bin ich, im Ganzen genommen, doch nicht ungern hier. Ich lerne viel, sammle Erfahrungen, sehe manches Denkmal der Kunst und bessern Zeit, und gehe mit vielen unterrichteten Männern um. Meine Stunden sind regelmäßig unter Geistes- und Körperübungen, Genuß und Anstrengung getheilt. Du weißt, ich brauche nur Muße, und Freiheit, um zufrieden zu seyn. Zufrieden! Mehr kann und soll ja der Mensch nicht verlangen. Und ist nicht jeder nur so glücklich, als er sich selbst dafür hält? Wenn auch manchmal trübe Gedanken in meiner Seele aufsteigen, so ist es Uebung der innern Kraft, sie zu bekämpfen. Der Mensch ist nicht zum Glück geboren, seine Bestimmung ist, gut zu seyn. Zur Güte führt die Weisheit, zur Weisheit Freiheit von Bedürfnissen. Das laß uns nie vergessen, daran laß uns festhalten, und was dann über uns ergehen mag, mit muthigem Sinn und heiterer Stirn erwarten.
Fußnoten
1 Atrium war eine Art Vorhaus oder Vorsaal, in welchem bei den adeligen Familien die Bildnisse der Vorfahren aufgestellt waren.
2 Hetäre, ein griechisches Wort, das so viel als Freundin oder Gefährtin bedeutet, und eine anständige Benennung für eine unanständige Lebensart war.
5. Derselbe an Denselben.
Rom, im Februar 301.
Mein Vater war krank, schreibst du mir, aber er ist wieder auf dem Wege der Besserung. Dank den himmlischen Mächten, die unser Schicksal leiten! Es würde Mich sehr geschmerzt haben, ihn in den letzten Augenblicken nicht gesehen, und seinen Segen, seine volle Verzeihung nicht erhalten zu haben. Er ist doch mein Vater, und was auch zwischen uns obwaltet, so behauptet die Natur in ernsten Momenten ihre vollen Rechte, und ich fühle an der Freude, welche mir seine Genesung verursacht, was für Bitterkeit sein entfernter einsamer Tod durch mein Leben gegossen haben würde.
Sein Betragen während der Krankheit ist dir so sehr aufgefallen? Mir nicht. Seine Philosophie ist, wie bei vielen Menschen unsrer Zeit, nie Wirkung von Grundsätzen, sondern Folge der Bequemlichkeit gewesen. Er hat dem Tempel zu Delphi einen Dreifuß gelobt, und dem Aesculap einen Hahn geopfert1, er, der sonst Götter und Götterdienst als leere Schattenbilder verachtete, hingestellt, um einen blinden Pöbel in Hoffnung und Furcht zu erhalten? Was er gethan hat, werden Tausende thun. Das ist das Verderben der Zeit, daß sie in den Staub tritt, was der Vorwelt heilig war, und nichts hat, den ungeheuren Verlust zu ersetzen. Was auch die Meinung des Pöbels von seinen Göttern ist – laß sie ihm, wenn du ihm nichts Besseres zu geben hast. Und wer hat das? Das Licht, das uns in den eleusinischen Geheimnissen leuchtete, ist Etwas; aber immer wenig für den dürstenden Geist, der hier an der Quelle zu trinken sich sehnt und ängstet. Es ist kein kleiner Theil des Kummers, der oft meine einsamen Stunden verdunkelt, hier so ganz in Nacht zu tappen. Ich sinne und strebe und kämpfe meinen Geist müde; und versinke ich in eine Art von Betäubung, dann ist der Gedanke, daß so viele große Männer der Vorzeit nicht mehr wußten, dem ermatteten Sinn Beruhigung, bis eine neue Anregung meine Zweifel auf's Neue stürmisch emportreibt, und die Stille meiner Seele stört.
Wenn nur irgend eine Leidenschaft, ein würdiger Gegenstand des Ehrgeizes, der Liebe oder Freundschaft meinem unstäten Willen eine bestimmte Richtung, meinen Kräften einen angemessenen Zweck darböte! Du bist entfernt, du, der allein mich versteht. Hier bin ich ganz einsam. Tiridates ist unstreitig liebenswürdig, und ich glaube – hätten wir uns jünger gekannt – wir wären vielleicht Freunde geworden. Das, was uns jetzt trennt, und unsre vollkommene Vereinigung hindert, liegt nicht sowohl in unserm Innern, als es von Außen angebildet worden ist. Denn über Alles, was dem Menschen, als solchem werth, unschätzbar, heilig ist, denken wir ganz gleich. Aber der frohmüthige Königssohn, am orientalisch-prächtigen Hof Diocletians, in der Gunst des Cäsar Galerius, in Hoffnungen auf den Thron seiner Väter erzogen, kann niemals mit dem unberühmten Sohn des Privatmannes, den Erziehung und Umstände auf einen ganz andern Standpunkt gestellt haben, die Dinge der Welt in einem gleichen Lichte sehen. Wir lieben uns, das ist viel, aber nicht genug für mein Herz, nicht genug für seines, das außer mir noch Manches bedarf, und auch gesucht und gefunden hat. Er liebt Sulpicien, das unglückliche – aber bis dahin tugendhafte Weib eines Andern.
Calpurnien lerne ich täglich näher kennen, und täglich entfaltet sich ihr Charakter mehr der ersten Ansicht gemäß, unter der er mir sogleich erschienen war. Sie ist nicht ohne Verdienst, aber sie ist unbeschreiblich leichtsinnig, und das Größte und Würdigste muß, wenn sie die Laune anwandelt, ihrem Witze eben sowohl zum Spielwerk dienen, als das Gemeine und Lächerliche. Wir sind in ewigem Streite mit einander, wir scheinen uns zu hassen, doch weiß ich wohl, daß wir uns im Grunde Beide achten, aber nie – nie nähern werden.
Ehrenstellen zu suchen, bei dieser Entartung des Gemeinwesens, bei dieser Auflösung aller heiligen Bande, kann nur Eigennutz oder Ruhmsucht anreizen. Vaterlandsliebe ist ein leerer Schall, und Wirken zum Besten des Ganzen, ein kindischer Traum geworden, seit ein Einziger mit unausweichbarer Gewalt alle Macht in Händen hat, und Senat, Patricier und Volk eine folgsame Heerde Sclaven ist, dieser Senat, der mit derselben Bereitwilligkeit die Mörder des Caligula belohnt, und die Vergötterung eines Caracalla2 unterzeichnet! – O Tiber hat ihn wohl gekannt und verachtet! Und wie tief unter jenem steht noch der jetzige, dieses willenlose Spielwerk der Laune eines Einzigen, oder des rohen Uebermuths der Prätorianer!
Ich hasse die Tyrannei, ich fühle mit Schmerz, daß mich das Schicksal um vier oder fünf Jahrhunderte zu spät geboren werden ließ. Dennoch muß ich Diocletian bewundern, dessen Riesengeist und vorzügliche Herrschergaben nicht allein den ganzen Erdkreis, so weit ihn gebildete Nationen bewohnen, sondern, was noch mehr ist, die Leidenschaften derjenigen im Zaum hält, denen Nähe des Throns und oft wiederholtes Beispiel eine ewige Anreizung zu kühnen Versuchen seyn könnte. Doch scheint mir, die Würde der römischen Macht, die der außerordentliche Geist dieses Mannes aus zerfallenden Trümmern herrschend hervorrief, wird wohl mit diesem Geiste stehen und sinken. Nicht Maximians rohe Kraft, nicht Galerius düsteres Gemüth, nicht der weiche Constantius sind der ungeheuren Last gewachsen. Jetzt behauptet Jeder, von des Herrschers Klugheit wohl gewählt, den angewiesenen Platz mit Ehre, und benagt sich leicht und kräftig in seinem Kreis. Doch das ist Täuschung. Es sind nicht sowohl zwei Auguste und zwei Cäsaren, die die römische Welt theilend regieren: es ist ein gewaltiges Genie, das durch die Andern, wie die Seele durch Organe, wirkt. Was entstehen wird, wenn einst diese Seele entweicht, liegt im Dunkel der Zukunft verborgen. Erfreulich kann es auf keinen Fall seyn.
Sieh, das ist unser Unglück, daß wir – Bewohner eines Freistaates – so weit gekommen sind, den Tod eines Alleinherrschers fürchten zu müssen; daß an Einem Geiste das Schicksal der Welt hängt, und in dem von Grund aus verderbten Volke, das einst den ganzen Erdkreis durch seine Helden eroberte, durch seine Staatsmänner regierte, ein solcher Verlust unersetzlich ist. Sein Tod wird das künstliche Band zerreißen, womit er die zerfallenden Glieder des Riesenkörpers wider den Geist der Zeit und der Umstände gewaltsam zusammenhielt, und den Barbaren, die neidisch und gierig unsere Grenzen umlauern, scheue Ehrfurcht gebot. Trüb und düster liegt die Zukunft vor mir, die Gegenwart ist schaal, die Vergangenheit ohne Freuden; denn meine Kindheit und erste Jugend schwand unter feindlichen Umgebungen hin. Wo soll mein Geist sich hinwenden?
Phocion! Ich bin nicht glücklich, und mit unendlichem Schmerze fühle ich, daß die Quelle meines Unglücks nicht sowohl in der Welt um mich, sondern in nur selbst liegt. Tausende an meinem Platze würden vergnügt seyn, sind es wirklich. Ich trage Begriffe, Forderungen, Gestalten in meiner Brust, die nimmermehr zu dem passen, was um mich vorgeht. Ich bin in ewigem Kampfe mit der Wirklichkeit, und sie rächt sich nur zu bitter an dem, der ihre Freuden verschmäht. Und wie soll ich's ändern? Kann ich mich umgestalten? O warum ward mir nicht ein kleiner Theil des holden Leichtsinns zum Loose, der die reizende Calpurnia so sanft über alle Unannehmlichkeiten des Lebens hinwegführt?
Dem trüben Geist, in quälenden Gedanken versunken, erscheint nur zuweilen ein einziges Bild aus der Nacht der Vergangenheit, das ihn sanft und freundlich anlächelt, dann schnell verschwindet, und den brennenden Schmerz in süße Wehmuth löset.
Als ich ein Kind war – lange ehe mein Vater mich deiner Leitung übergab – wohnte dicht an unserm Hause Timantias, ein edler Nikomedier, der eine der ersten Würden im Staate bekleidete. Mein Vater und er waren Freunde, wenigstens was man gewöhnlich so nennt, seine Kinder unsre Spielgefährten. Mich hielt ein schwächlicher Körperbau, das Erbtheil einer früh verblichenen Mutter, und meine Gemüthsstimmung von wildern Spielen ab, in denen meine früh verstorbenen Brüder mit Timantias Söhnen die Jugendkräfte freudig übten. Larissa, Timantias Tochter, blieb dann bei mir, ihr sanftes Gemüth fand Vergnügen darin, mich nicht zu verlassen. Wir spielten zusammen, oder sie beredete mit der unwiderstehlichen Macht der Güte die Uebrigen, ein Spiel ruhigerer Art zu wählen. So sorgte sie für mich, liebte mich, und erfüllte mein Herz mit süßen Empfindungen. Wir wuchsen heran, unsere Neigungen wuchsen mit uns. Da trat das Schicksal kalt und feindlich zwischen uns. Timantias wurde eines Verbrechens wegen angeklagt. Ob wirkliches Vergehen, oder feine großen Reichthümer (eine mächtige Versuchung für den habsüchtigen Proconsul Sisenna Statilius) daran Ursache waren, ist nie bekannt worden. Er wurde in's Gefängniß geworfen. Mein Vater brach allen Umgang mit der geächteten Familie ab. Ich und Larissa sahen uns nur verstohlen, und mit desto größerer Sehnsucht an den Hecken, die unsre Gärten schieden. Endlich nach vierzehn Monden gefänglicher Haft wurde Timantias – aus Schonung, wie es hieß, indem er des Todes schuldig befunden worden – mit seiner Familie verbannt, seine großen Güter eingezogen. Sisenna Statilius brachte sein Haus, das neben dem unsern lag, um einen geringen Preis an sich, und mein Vater unterhielt dieselbe Freundlichen mit ihm, die er mit Timantias gepflogen hatte. Ich war nicht zu bereden, das Haus wieder zu betreten, wo mir die Geister der Vertriebenen Rache fordernd zu schweben schienen. Dieser Eigensinn des achtzehnjährigen Jünglings war eine von den Hauptquellen des ewigen Zwistes zwischen meinem Vater und mir. Acht Jahre sind verstrichen, keine Spur von Timantias Schicksal ist mehr zu erforschen gewesen. Ob Larissa glücklich, ob sie vermählt, ob sie überhaupt noch am Leben sey – so wichtig mir diese Fragen oft erscheinen, – Niemand weiß sie zu beantworten. Alle Nachforschungen, die ich anstellte, waren fruchtlos. Doch lebt ihr Andenken in meiner Brust, als der einzige helle Punkt in meinem Schicksale. Und auch der mußte verschwinden? – Leb' wohl.
Fußnoten
1 In Delphi war der berühmteste Tempel des Apoll, und ein Orakel. Die Dreifüße waren eine Art von Gefäß oder Schaale, welche auf drei Füßen stand, und dazu diente, um Rauchwerk darin anzuzünden. Es war eines der gewöhnlichsten Opfer, das die Frömmigkeit, die Furcht oder die Prachtliebe den Göttern brachte. Dem Aesculap, dem Gott der Aerzte, pflegte man bei der Genesung einen Hahn zu opfern.
2 Valerius Asiaticus, dessen Werk vorzüglich der Tod des Caligula war, rühmte sich seiner That im Senat, und forderte eine Belohnung dafür Caracalla wurde von Macrin getödtet, und die Soldaten, welche unter seiner grausamen Regierung sich alle Ausschweifungen erlauben durften, und seinen Verlust betrauerten, trotzten dem Senat seine Vergötterung ab Ueberhaupt war die Macht des Reiches in jenen Zeiten in der Hand der Armee, oder vielmehr der Prätorianer, der k. Leibwache, welche von dem Zelte des Imperators, Prätorium genannt, das sie zu bewachen bestimmt waren, ihren Namen hatten. Wer ihre ungeheuren Forderungen an Ausgelassenheit und Geld zu stillen versprach, oder ihnen geneigt schien, wurde von ihnen auf den römischen Thron gesetzt, und durch sie ermordet oder herabgestoßen, wenn er jene Versprechungen nicht erfüllen konnte oder wollte. Der Senat, diese einst so ehrwürdige und mächtige Versammlung, war zu einem bloßen Schattenbild und Werkzeug der Tyrannei und Anmaßung herabgesunken. Der Präfekt Prätorianer, ihr Anführer oder Kapitän, war die wichtigste Person im Staate, und sehr oft der Cand dar zur Kaiserwürde, wie denn auch Diocletian von diesem Posten auf den Thron stieg.
6. Calpurnia an Sulpicien.
Rom, im Februar 301.
Nach gerade wird mir dein Aufenthalt in Bajä und deine lange Abwesenheit unerträglich. Ich hätte dir so viel zu sagen, so viel zu erzählen, und muß mich mit Schreiben, diesem armseligen Behelf für ein volles Herz, begnügen. Auch Serranus fängt an, über dein Außenbleiben unmuthig zu werden. Zwar weiß er wohl, daß du weit mehr Geschäfte gefunden hast, und der Zustand eurer Villa weit zerrütteter ist, als ihr anfänglich glaubtet: dennoch, meint er, könntest du jetzt fertig seyn, oder was allenfalls noch zu thun übrig ist, auf ein andermal lassen. Es ist doch ein gutes Wesen, dieser Serranus, und dir von Herzen zugethan. Er weiß, daß du den Prinzen oft in Bajä gesehen hast, und – es scheint, er freuet sich darüber, daß du doch in deiner Einsamkeit nicht ohne Umgang warst. Auch schätzt er dich viel zu sehr, um nicht den Gedanken, dein Verhältniß zu Tiridates könnte etwas mehr als Freundschaft seyn, für Hochverrath an dir zu halten. Wir haben gestern, als er zu mir kam um sich mit mir über deine Abwesenheit zu berathen und zu beklagen, recht viel mit einander von dir gesprochen. Er wird dir nächstens schreiben, und dich recht dringend bitten, nach Hause zu kommen; denn seine Sulpiciola, wie er dich nennt, mangelt ihm überall.
Auch mir mangelst du recht sehr. In mir ist eine Art von Veränderung vorgegangen, über die ich gern mit dir sprechen möchte. Es ist nicht mehr Alles, wie es war. Ich ärgere mich darüber, und kann doch nicht wünschen, daß es nicht geschehen seyn möchte. Ich bin jetzt manchmal sehr ernst, ich kann stundenlang über tiefsinnige Dinge recht tiefsinnig sprechen. Ich lache seltener, und finde sogar Vergnügen an manchen Ideen, die ich sonst, als ich noch ganz Calpurnia war, als excentrisch und überspannt verspottete. Das macht blos der Umgang. Man achte ja diese leise und langsame Gewalt, eben weil sie unbemerkt wirkt, nicht für gering; man glaube nur ja nicht, sich vor ihrem stillen Einflusse bewahren zu können. Wie der Bewohner der einen Provinz, in eine andere verpflanzt, nach und nach, ohne es selbst zu wissen, seine Sitte, seine Tracht, sogar seine Sprache nach dem Gebrauche und Dialect dieses Landes modelt, und so unvermerkt mit den Eingebornen sich verschmelzt, so nehmen wir auch leicht und unmerklich die Gedankenreihe, die Ansichten, ja bis auf die Redensarten unserer Freunde an, und sehen erst nach einiger Zeit mit Erstaunen die Aenderung, die mit uns vorgegangen ist.
Agathokles – wie komme ich eben jetzt auf ihn? – ist recht viel bei mir. Wir plaudern recht oft – recht lange – recht anziehend mit einander, und meine Eitelkeit müßte mich ganz schrecklich irre führen, wenn ich nicht glauben sollte, er finde wenigstens eben so viel Vergnügen an meinem Umgang, als ich an dem seinen. Vielleicht eben des grellen Abstandes wegen, der im Anfange zwischen unsern Charakteren zu seyn schien? Schien! sage ich mit Vorbedacht; denn es zeigt sich immer deutlicher, daß wir im Grunde über die meisten und wichtigsten Dinge, ziemlich gleich denken. Zuweilen entsteht wohl ein kleiner Streit, aber das dient nur, den Umtausch der Gedanken zu befördern, und die Unterhaltung zu beleben. Uebrigens schadet es unserer Einigkeit nicht. Agathokles ist, wenn er bei genauerer Bekanntschaft die spröde Außenseite ablegt, ein sehr angenehmer Gesellschafter. Unter andern lieset und declamirt er vortrefflich, und es ist einer meiner köstlichsten Genüsse, mir von ihm die besten Stellen, aus unsern Dichtern, die er fast alle auswendig weiß, vorsagen zu lassen. Zuweilen löse ich ihn auch wohl ab. Du weißt, es war von jeher eine Lieblingsübung von mir. Und dann, liebe Sulpicia, unter uns gesagt, geht meine Eitelkeit nicht leer aus. Ich sehe, oder eigentlich, ich fühle wohl, daß die Leserin ihn weit mehr anzieht, als der Dichter selbst: und je strenger der Mann gewöhnlich ist, je süßer, schmeichelt es, dieses. Eis am Strahle der Freundschaft schmelzen zu sehen. Freundschaft! Merke das Wort wohl, liebe Sulpicia! keine Liebe; denn ich bin seine Vertraute, und weiß, daß sein Herz, wie es einem ächten Schwärmer geziemt, theils der ganzen Menschheit angehört, theils mit seinen, feineren Neigungen einem schönen Schattenbilds zugewandt ist, das noch aus den rosigen Tagen der Kindheit in himmlischem Lichte vor seiner Seele schwebt, und ihn für alle irdischen Reize unempfindlich macht. Du siehst, ich weiß schon Manches, und habe damit nicht auf deine Ankunft warten dürfen. Nein, ich habe ihm einen Theil seiner Geheimnisse mit freundlicher Herzlichkeit abgefragt, ich habe den Kummer bemerkt, der dies edle Herz drückt, und ihn zu erforschen gesucht, und er hat sich der ungeheuchelten Theilnahme wahrer Freundschaft nicht verschlossen. Seine Unzufriedenheit mit dem Zeitalter, seine Besorgnisse für die Zukunft, seine Trauer um die bessere Vergangenheit – ist jetzt nicht mehr Gegenstand unsers Streites, und die Zielscheibe meines Scherzes. Seit ich weiß, wie tiefen Antheil mein Freund an ihnen nimmt, wird über diese Materien ernst und würdig gesprochen, und mit Vergnügen sehe ich denn am Ende eines solchen Gesprächs die Gewitterwolken, die im Anfange seine Stirn umzogen, verschwunden, und seinen Blick mir freundlich und dankbar strahlen. Sogar sein gespanntes Verhältniß zu seinem Vater hat er – freilich nur leise – berührt, und ich achte seine Zurückhaltung in diesem Punkte, und dringe nicht weiter in ihn. Scheint es doch, er hätte willig Alles, worüber er Herr war, der Freundin mitgetheilt, und halte nur mit dem zurück, was er nicht ganz sein nennen kann!
Gekannt möchte ich das Mädchen wohl haben, das seine Kindheit und erste Jugend verschönerte. Schön ist sie nicht gewesen, das sagt er selbst, aber gut und höchst liebenswürdig. Nun das versteht sich von selbst, wenn ein Liebhaber, sie schildert. Bis in sein achtzehntes Jahr ist er mit ihr umgegangen, seitdem hat er sie nicht wieder gesehen. Ob nun gleich die folgenden acht Jahre für seine Entwickelung sicher die bedeutendsten waren, so ist doch ein Jüngling, wie Agathokles, mit achtzehn Jahren reif genug, um einen solchen Eindruck auf Zeitlebens fest zu halten. Das kann ihm bei der Wahl seiner künftigen Gattin immer schaden, oder auch nützen – wie du willst; denn es wird ihn behutsam und ekel machen. Ich finde es nicht übel, wenn ein Jüngling ein idealisches Bild von Würde, Größe, Tugend in seiner Brust trägt, und die Welt um ihn her an diesem großen Maaßstabe mißt. Er und sie gewinnen dabei, denn er wird nichts Gemeines und nichts gemein thun. Mag das Ideal nun die Gestalt irgend eines berühmten Mannes, eines großen Helden, wie Miltiades dem Themistokles1 war, oder eines holden Weibes tragen; das ist in Rücksicht der Wirkung einerlei.
Du siehst, Liebe, wie gelassen, wie wahrhaft philosophisch ich die Sache betrachte. Hörst du wohl? Philosophisch! Du mußt mir das Wort gelten lassen. Es bezeichnet ganz eigentlich das, was ich andeuten will. Philosophie ist Liebe zur Weisheit. Und ist der nicht weise zu nennen, der sich bemüht, mit klarer ruhiger Ueberlegung alle Dinge auf der Welt in den gehörigen Beziehungen und Abständen von sich zu stellen – und zu erhalten? Das allein führt zur Gemuthsruhe, und nur bei Gemüthsruhe kann Weisheit wohnen. Nach dieser Definition, die mir ziemlich richtig scheint, käme es nun darauf an, zu bestimmen, wer eher Anspruch auf den Titel eines Philosophen machen kann – Ihr leidenschaftlichen Seelen, die ihr Alles mit düsterem Ernst betrachtet, die Welt als einen ewigen Kampfplatz der Tugend mit dem Unglück oder Laster anseht, und Alles schwer ertraget, weil ihr eben Alles recht schwer nehmt – oder wir andern frohmüthigen Geschöpfe, die wir uns von keiner Sache tiefer bewegen lassen, als sie es verdient, vor allen Dingen den Erscheinungen in dieser Welt die trügerische Maske abziehn, die ihnen Vorurtheil, Leidenschaft, Phantasie anlegen, und dann, wenn wir den schrecklichen Riesen auf seine wahre Zwerggestalt herabgebracht haben, zusehen, wie wir mit ihm fertig werden wollen. Jetzt will ich dir auch eine Stelle aus deinem ersten Briefe, die mich damals fast ein wenig verdroß, parodirend zurückgeben. »Laß uns den eiteln Stolz auf Systeme aufgeben,« schreibst du. »Wir sind nicht, was wir wollen, sondern was wir können.« Laß uns, sage ich dir, nicht hinter Entschuldigungen des Unvermögens flüchten, wo wir thätig seyn, und handeln sollen! Wie oft – ich gebrauche mich der Waffen deines großen stoischen Lehrers – wie oft ist Nichtwollen die Ursache, Nichtkönnen der Vorwand!2
Sieh, Sulpicia, ich fühle, daß Agathokles mehr Bedeutung für mich bekommen könnte, als nach der Kenntniß, die ich von seinem Herzen und unsern gegenseitigen Verhältnissen habe, mit meiner Ruhe bestehen kann. Ich sage es aufrichtig; denn warum sollte ich mich der Neigung zu einem der edelsten Sterblichen schämen? Aber eben darum werde ich mich und ihn strenge bewachen – und nie soll Leidenschaft und ausschließende Liebe die schöne Stille stören, in der allein mir so wohl ist. Freundschaft, Achtung, zwangloser gebildeter Umgang, das ist Alles, wessen ich bedarf, um glücklich zu. bleiben. Das wollte ich suchen, das habe ich gefunden, und will es mir erhalten. Leb' wohl!
Fußnoten
1 Themistokles hat bei der Statue des Miltiades, der die Perser überwand, als Jüngling Thränen des Ehrgeizes geweint, und dann später die Perser, wie jener, geschlagen.
2Seneca in seinen Episteln: Nolle in causa est, non posse praetenditur.
7. Sulpicia an Calpurnien.
Bajä, im Februar 301.
Was soll ich sagen, Calpurnia? Soll ich mehr das Glück deines frohen Sinnes bewundern, oder deine ungeheure Anmaßung bedauernd anstaunen? Du fängst an zu lieben, ja du liebst bereits, du bleibst in der Gegenwart des geliebten Gegenstandes, und darfst es wagen, deinen Gefühlen so nahe, oder überhaupt nur einige Grenzen setzen wollen? Entweder du irrest schrecklich, und wirst nur zu früh aus deinem sorglosen Schlummer erwachen, oder – du bist die glücklichste Sterbliche, die jemals gelebt hat, und leben wird. Aber du, die du unsre Tragiker auswendig weißt, kennst du die Stelle nicht: Ich fürchte die Götter, wenn sie allzugünstig sind?1
Daß du und Agathokles einander näher kommen, daß ihr euch, trotz des Contrastes, oder eben um des Contrastes eurer Gemüther wegen, wechselseitig anziehen würdet, das habe ich vorgesehen, als Tiridates mir nebst der Schilderung seines Freundes, die Nachricht brachte, daß er als Gastfreund in eurem Hause lebe. Daß du aber auch mit dieser Empfindung, mit der Neigung zu einem Agathokles, wie bisher mit allen übrigen, nach Gefallen zu spielen, sie zu' lenken und zu drehen hoffen kannst – das hatte ich nicht erwartet. Was denkst du denn von der Liebe? Welche Begriffe machst du dir von ihr? O daß die Stimme einer unglücklichen Freundin die Kraft hätte, dich zu warnen, da es noch Zeit ist! Ja, die Liebe ist die schönste, die seligste Empfindung, deren das menschliche Herz fähig ist; sie ist es, die den armen Sterblichen auf Augenblicke seiner dürftigen Existenz vergessen läßt, und ihn in den Aufenthalt der seligen Götter zu ihren Freuden entzückt. Aber – diese Freuden sind nicht für den Sohn der harten Erde, für das zu Mühe und Sorgen bestimmte Geschlecht des Deucalion2 gemacht! Die Götter strafen den Eingriff in ihre Rechte, und stoßen den Frevler, der in dieser sterblichen Hülle sich an ihren Tisch drängen wollte, in den Tartarus hinab. Sieh hier den wahren Sinn der Fabel des Tantalus, oder Prometheus, der den himmlischen Funken stahl, um die Gebilde seiner Hand damit zu beleben! Nicht das stolze, kalte Vorrecht der Vernunft, die Seligkeit der Liebe, die ganz eigentlich das Glück des denkenden Wesens ausmacht, war es, womit er seine Geschöpfe weit glücklicher zu machen dachte; aber die Himmlischen straften den Raub, und Prometheus büßte durch unendliche Martern, was er in einem schönen Augenblick verbrach.
Ja, unendliche Martern liegen unter den reizenden Blumen der Liebe verborgen! Das fühle ich, das wirst auch du fühlen, und darum möchte ich warnen, rufen, flehen: Ziehe dich zurück, so lange es noch Zeit ist, wenn du nicht die größte, Wahrscheinlichkeit eines glücklichen. Erfolges hast; siehst du aber den, liebt dich Agathokles, wie du ihn, stellt sich eurer Verbindung kein anderes Hinderniß in den Weg – o dann gehe hin, du Liebling der Götter, genieße deines Glückes, unbeneidet von der trauernden Freundin, der kein so schönes Loos fiel, die aber an deiner Freude sich mit freuen wird! Genieße es, aber gedenke der Nemesis3, und laß die heilige Scheue, die Furcht, es zu verlieren, dir seine Dauer versöhnend sichern!
O meine Calpurnia! Wie will ich mich freuen, wenn ich dich glücklich weiß! Du bist edel, gut, schön, liebenswürdig: vielleicht haben die Götter dich zu dem höchsten Glück bestimmt, das ihre Huld dem Menschen geben kann. Sein Abglanz soll meine Nacht erhellen. Tiridates ist seit vorgestern von hier fort, um nach Rom zu gehen, und sich auf eine lange Reise zu bereiten. Cäsar Galerius hat ihn nach Nikomedien beschieden. Es sollen neue Versuche gemacht werden, vom Kaiser und Senat seine Einsetzung auf den Thron seiner Väter zu bewirken4. Es soll ein Heer gerüstet werden, den Persern ist der Krieg angekündigt, in Armenien sind wichtige Dinge vorgefallen, Verschwörungen für und wider das Geschlecht der Arsaciden. Welche Blitze aus den Wolken brechen werden, die sich von allen Seiten an unserm Horizont herauf ziehen, wissen nur die Götter. Wir müssen in geduldiger Ergebung zitternd erwarten, wen und wie der Schlag treffen soll. O welches traurige Loos, wenn die Liebe eines unglücklichen Paares, in das Schicksal der Reiche und Nationen verwebt, von ihm stürmisch fortgerissen wird, und nichts thun kann, als sich blind dem unwiderstehlichen Zuge hingeben! Calpurnia! Wie bist du auch in diesem Stücke glücklich! Eure Liebe wird kein Monarch stören, euer Bündniß wird nicht auf der beweglichen Welle der Volksgunst getragen! Kein ernster Wille einer Nation entscheidet über euer Loos! Ihr dürft euch im stillen Schatten des Privatlebens lieben, und mit einander leben, bis der Tod diese Bande sanft löset, und eines nach dem andern in das dunkle Reich der Nacht führet. O wie gern würde ich der schimmernden Aussicht auf den Thron der Arsaciden entsagen, wie gern – wenn nur einmal die welken Bande, die mich an Serranus binden, durch das Machtwort des Augustus gelöset wären – mich mit Tiridates in irgend einem stillen Winkel der Wett verbergen! Aber darf ich wohl diese Wünsche laut werden lassen? Darf ich den zum Thron gebornen, den der heiße Wunsch der bessern Mehrheit seines Volkes, den die Stimme der Weisen unter den Römern, den endlich sein hohes Gemüth mehr als Alles das zum Herrschen ruft, von seiner erhabenen Bestimmung ablenken, und ihn um meinetwillen in niedriges Dunkel begraben? Könnte ich diesen Verrath an der Welt, an seinem Volke verantworten, und endlich, könnte ich hoffen, daß ein Herz, wie Tiridates, in dieser stillen Beschränktheit, dieser ruhmlosen Abgeschiedenheit, glücklich seyn würde?
Und so muß ich schweigen, dulden, tragen, das, was das Aergste für liebende Herzen ist, Trennung, und Ungewißheit der Zukunft. Seit gestern – wie stille, wie unendlich einsam ist es um mich her! Nirgends höre ich mehr die Stimme des Geliebten, nirgends begegnet mir mehr die hohe theure Gestalt in der kalten, beziehungslosen Umgebung. Von Allem, was uns bevorsteht, kenne ich nur die Gefahren, die Hindernisse, die Schrecken mit Gewißheit. O meine Liebe! Das sind Schmerzen, von denen du keinen Begriff hast. Mögen die Götter dich vor ihrer Kenntniß bewahren! Was ist der Tod im Arm des Geliebten gegen diese Qual? Mit jedem Augenblicke sterbe ich einmal, denn jeder Augenblick rückt die lange, gefahrvolle Trennung näher, und so habe ich tausendmal den Tod gefühlt, ehe er kommen wird, sich meiner wirklich zu erbarmen.





























