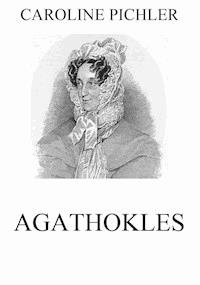Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autobiografie der österreichischen Schriftstellerin, Lyrikerin und Kritikerin.
Das E-Book Denkwürdigkeiten aus meinem Leben wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1037
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Denkwürdigkeiten aus meinem Leben
Karoline Pichler
Inhalt:
Karoline Pichler – Biografie und Bibliografie
Denkwürdigkeiten aus meinem Leben
Erstes Buch - 1769–1798
Zweites Buch - 1798–1813
Drittes Buch - 1814–1822
Viertes Buch - 1823–1843
Nachwort
Überblick meines Lebens
Denkwürdigkeiten, K. Pichler
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849633271
www.jazzybee-verlag.de
Karoline Pichler – Biografie und Bibliografie
Romanschriftstellerin, geb. 7. Sept. 1769 in Wien, gest. daselbst 9. Juli 1843, erhielt im Haus ihres Vaters, des Hofrats v. Greiner, eine sehr sorgfältige Erziehung, verheiratete sich 1796 mit dem nachherigen Regierungsrat Andreas Pichler und trat seit 1800 als Schriftstellerin mit zahlreichen Romanen und einzelnen dramatischen Versuchen auf. Von ihren Romanen fanden »Agathokles« (Wien 1808, 3 Bde.), »Frauenwürde« (das. 1808, 4 Bde.), »Die Belagerung Wiens« (das. 1824, 3 Bde.), von ihren kleineren Erzählungen »Das Schloß im Gebirge«, »Der schwarze Fritz« den meisten Beifall. Nicht ohne Erzählertalent und eine gewisse Würde, konnte P. als Schriftstellerin weder tiefere Konflikte und Charaktere darstellen, noch überall die redselige Breite der alten Belletristik vermeiden. Ihre »Sämtlichen Werke« erschienen Wien 1820–45, 60 Bde. An sie schlossen sich ihre »Denkwürdigkeiten«, herausgegeben von F. Wolf (Wien 1844, 4 Bde.). Briefe Karoline Pichlers an Therese Huber erschienen im 3., solche an Hormayr im 12. Bande des »Jahrbuchs der Grillparzer-Gesellschaft« (Wien 1893 u. 1902).
Wichtige Werke:
Idyllen, 1803Ruth, 1805Agathocles, 1808Die Belagerung Wiens, 1824Die Schweden in Prag, 1827Die Wiedereroberung Wiens, 1829Henriette von England, 1831Zeitbilder, 1840Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, 1844Denkwürdigkeiten aus meinem Leben
Erstes Buch - 1769–1798
Dem Ende einer langen Reise nahe, deren letztes Ziel undurchdringliche Wolkenschleier noch vor dem Blicke verbergen, steht der Wanderer atemholend still, überdenkt den weiten Raum, welchen er schon zurückgelegt, den kleinen Rest, welcher noch zu durchlaufen ist, erwartet diesen, er mag nun länger oder kürzer sein, vertrauensvoll aus Gottes Hand, und erlaubt sich, die einzelnen Punkte jener langen Bahn, vom Anfange her, so getreu es sein Gedächtnis gestattet, sich zurückzurufen. Manche Erinnerung wird ihn beschämen, einige werden ihn erfreuen, alle aber sollen dazu dienen, ihn zum Danke gegen die Vorsicht, die ihn mit väterlicher Huld geleitet, anzuregen, und dann den nächsten Lieben, welche er noch in Mitte ihrer Bahn zurückläßt, ein Andenken an den vorausgegangenen Waller zu werden.
Erwarte ja niemand in diesen Blättern merkwürdige Vorfälle, sonderbare Schicksale, oder hervorragende Punkte der allgemeinen Geschichte des Vaterlandes zu finden, an welche das Leben der einzelnen sich oft kettet und, von jenen mächtigen Fittichen getragen, der Erinnerung ferner Zeiten zueilt. Mein Leben war höchst einfach, und Gellerts Vers:
– er ward geboren,
Er lebte, nahm ein Weib, und starb;
umschreibt im eigentlichsten Sinne den ganzen Kreislauf meiner Schicksale. Diese Armut an jedem hochwichtigen Ereignisse, an jeder bedeutenden äußeren Bewegung ist mir nie lästig oder als eine Ungunst des Schicksals vorgekommen, vielmehr habe ich von jeher mein wahrstes Glück in der Stetigkeit und Gleichförmigkeit meiner Verhältnisse gefunden.
Darum auch können diese Blätter nicht leicht durch den Druck bekannt gemacht werden, denn erstens würde die Lesewelt, welche Unterhaltung und Aufregung sucht, von der Einfachheit der Erzählung ermüdet werden, und zweitens ist es der eigentliche Zweck dieser Schrift, wahr zu sein und meinen nächsten Geliebten zu zeigen, wie ich das geworden, was ich war, durch welche Einwirkungen, Umgebungen, Belehrungen, Irrtümer und Hindernisse mein Geist und Gemüt die Richtung erhalten haben, die ihnen jetzt eigen ist. Bei diesen Auseinandersetzungen müssen Personen, Bücher, Zeitumstände und vor allem Zeitgeister geschildert und deutlich gemacht werden, von denen aufrichtig und nach gerechter Würdigung zu reden, jetzt nicht mehr erlaubt ist. Ein Büchelchen, das die Zeiten Kaiser Josefs II. und der Begriffe, welche in jenem merkwürdigen Dezennium in Österreich gang und gäbe geworden sind, mit Wahrheit, wenn auch nicht mit durchgängiger Billigung erwähnen und die Wirkung schildern will, die jene Zeit auf ein junges, lebhaftes Gemüt ausübte, dessen geistige Entwicklung von 10 bis 20 Jahren gerade in jene Periode fiel, ein solches Buch darf keine Hoffnung nähren, wie harmlos es übrigens sein möge, jetzt in Österreich gedruckt zu werden. Auch ist mein Selbstbekenntnis zunächst nur für meine Familie bestimmt. Sollten bis zu meinem Tode die Umstände im Vaterlande sich ändern und wieder einige Gedanken und Preßfreiheit bis dahin in Österreich möglich sein, so steht es der Willkür meiner hinterlassenen Lieben frei, welchen Gebrauch sie von dieser Arbeit machen wollen, die ihnen gewidmet ist.
Noch eine Absicht habe ich mit dieser Wiederholung meines Lebens. Sie soll mir, und wenn sie andere lesen, auch diesen dienen, den Gang zu beobachten, welchen die göttliche Gnade mit einem irrenden Geschöpf genommen, um es durch unmerkliche und unzuberechnende Einwirkungen und Erleuchtungen allmählich von den Pfaden der Welt und des beginnenden Unglaubens zum Heil zurückzuführen. Je mehr ich diesen Fügungen nachsinne, je mehr erfüllen sie mich mit Dank gegen Gott und mit Verwunderung, wie ein schwacher Glaubensfunke sich inmitten einer ganz irreligiösen Zeit und Umgebung in mir erhalten, nach und nach an geringen und scheinbar zufälligen Ereignissen verstärken, entzünden, und allmählich zu einem wohltätigen Lichte erweitern konnte, welches nicht allein mein Inneres jetzt beglückend erleuchtet, sondern mit Gottes Hilfe auch den Rest meines Lebensweges erhellen und mir das dunkle Tal des Todes minder furchtbar machen soll.
*
Wenn je eine Art von Ahnenstolz nicht bloß erlaubt, sondern geziemend ist, so ist es der auf die Tugenden, die Rechtlichkeit und nützlichen Leistungen seiner Voreltern und Eltern, und in dieser Hinsicht wird man es mir zugute halten, wenn ich am Eingange meines eigenen Lebenslaufes etwas weitläufiger von meinen Eltern spreche. Da es ohnehin die Bestimmung dieser Blätter hauptsächlich ist, zu zeigen, wie ich durch Umgebung, Umstände und eigene Anlagen die Bildung erhalten, die jetzt meine Persönlichkeit ausmacht, so stehen hier wie überall die Eltern billig obenan; denn ihre Denk- und Handlungsweise hat ja den ersten und bleibendsten Einfluß auf alles, was Kinder sind und werden.
Meines Vaters Eltern waren wohlhabende Personen des Mittelstandes. Der Großvater, der ein kräftiger, kluger Mann gewesen sein muß, liebte die Kunst, und verwendete den Überschuß seiner Einkünfte und seiner Muße (er war Beamter des Stadtmagistrats) auf eine Sammlung von gar nicht unbedeutenden Gemälden, der er in seinem eigenen Hause ein geziemendes Lokal baute und einrichtete, und die ich noch wohl gekannt habe. Einige der besten Stücke wurden später in die k.k. Bildergallerie verkauft, wo sie noch zu sehen sind. Dieser Großvater starb aber in der Blüte seiner Jahre, als mein Vater ein halberwachsener Knabe war, und die Witwe, eine rasche, tätige Frau, erzog den Sohn nun allein. Sie verstand Latein, und war überhaupt für jene Zeit gebildet genug, so daß auch des Sohnes vorzüglicher Geist sich unter ihrer Leitung glücklich entfalten konnte. Die Liebhaberei des Großvaters war in gewisser Hinsicht auf seinen Sohn übergegangen, nur daß sie bei dem lebhaften Gefühle meines Vaters sich noch reger und als ausübende Kunst entfaltete; denn er zeichnete und malte fast ohne alle Anleitung sehr artig. Zugleich erwachte der Geist der Poesie in ihm, und die Musik ward seine Lieblingsunterhaltung. So von allen schönen Künsten angezogen, mit ihren damaligen Leistungen vertraut, zeichnete er sich ebenfalls in seinen Studien aus, und gern hätten die Patres der Jesuiten, unter denen er, wie damals alle jungen Leute, studierte, und welche ihre Zöglinge sehr wohl zu würdigen verstanden, ihn beredet, in ihren Orden zu treten. Dazu aber bezeigte mein Vater keine Lust, das Leben lächelte ihm zu freundlich im Geleite der Musen, und im Besitz eines unabhängigen, wenn auch nicht großen Vermögens. Er studierte die Rechte, und wurde bei der Böhmischen Hofstelle angestellt, deren Chef, der damalige Oberstkanzler Graf Rudolf von Chotek, den eben so geschickten als sittlichen jungen Mann, den heitern, gebildeten Gesellschafter bald auszeichnete und mit vorzüglicher Achtung behandelte.
Von meiner Mutter Eltern weiß ich nur wenig. Ihr Vater war aus dem Hannoveranischen gebürtig und Offizier im k.k. Regiment Wolfenbüttel. Wahrscheinlich war seine Frau bei der Geburt dieses Kindes oder bald darnach gestorben. Meine Mutter hatte sie nie gesehen und erinnerte sich auch keines andern Geschwisters. Der Vater hatte das kleine, kaum fünfjährige Mädchen bei sich, zog mit ihm und dem Regimente – mühsam genug, wie man denken kann – auf ungarischen Dörfern umher, und kam zuletzt, da das Regiment in Wien Garnisonsdienste tun sollte, mit demselben nach Wien. Hier erkrankte er schwer und starb nach kurzer Zeit, das unmündige Kind unter lauter fremden Menschen, fremden Glaubens (denn mein Großvater war protestantisch), im fremden Lande zurücklassend. »Du armes Kind, was wird aus dir werden!« waren seine letzten schmerzlichen Worte zu der kleinen Charlotte (so hieß meine Mutter) gewesen, die sich ihrem kindischen Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt hatten. Aber die Vatersorge und des Vaters Gebet hatte seinen Weg zu Gottes Thron gefunden, und der allgemeine Vater unser aller bewies sich auch als solcher an der verlassenen Waise. Er bereitete ihr auf wunderbare Weise ein Los, wie sie es bei Lebzeiten ihrer Eltern kaum hätte hoffen dürfen.
Eine Kammerdienerin oder Kammerfrau der verstorbenen, hochseligen Kaiserin Maria Theresia – Tochter Karls VI. – befand sich abends in einer Gesellschaft zu Wien, in welcher auch einer oder einige Offiziere des kürzlich eingerückten Infanterieregiments waren. Zufälligerweise kam die Rede auf dasselbe, und der eine Offizier sagte, daß sie bereits das Unglück gehabt, einen aus ihrer Zahl – den Oberleutnant Hieronymus – zu verlieren, und daß er nichts als ein fünfjähriges, ganz hilfloses Mädchen hinterlassen habe, für das einstweilen seine Kameraden Sorge tragen müßten.
Als die Kammerfrau abends ihre Gebieterin auskleiden half, und die gütige Monarchin sich herablassend nach den Tagesbegebenheiten ihrer Frauen erkundigte, erzählte jene das Gespräch mit dem Offizier von Wolfenbüttel1. Die Kaiserin hörte aufmerksam zu, ihr menschenfreundliches Herz wurde in Mitleid für das verlassene Kind gerührt: Ich will das Mädchen holen lassen, sagte sie, – sorgt dafür, daß sie mir gebracht werde.
Meine Mutter war im protestantischen Glauben geboren worden, dem auch die meisten Offiziere des Regiments zugetan waren. Der Befehl der Kaiserin ließ sie nichts anders erwarten, als daß das Kind, dessen sie sich annehmen wollte, in der katholischen Religion erzogen werden würde. Trotz der gerühmten Toleranz ihrer Konfession suchten sie aus allen Kräften dies zu verhindern, und verbargen das Mädchen mehrere Tage lang vor den Nachsuchungen, welche die Leute der Monarchin nach demselben anstellten. Endlich fand man es auf, in einem Hause einer Vorstadt Wiens; es wurde nach Hof gebracht, dort unter Aufsicht eines alten, aber sehr würdigen Fräuleins von spanischer Herkunft, Isabellas Düplessis, in den wenigen Fertigkeiten unterrichtet, die man dazumal von einem Mädchen forderte, und mit noch einigen Fräulein zum persönlichen Dienst bei der Kaiserin bestimmt.
Meiner Mutter ungewöhnlich lebhafter und durchdringender Geist fühlte bald die Schranken, welche die Beschränktheit ihrer Umgebungen demselben anlegte. Sie dürstete nach Kenntnissen, nach gründlichen Erklärungen der Dinge oder Begebenheiten, die sie um sich sah, und sie benutzte die Besuche einiger älterer, gebildeter Männer, welche in das Haus ihrer Erzieherin kamen, um von ihnen Antwort auf die Fragen zu erhalten, welche sich ihr während der Zeit aufgedrängt, und die sie sich deshalb aufzuschreiben pflegte. So strebte ihr Geist weit über ihre Lage, über ihre Gefährtinnen hinaus, und bildete sich meist aus sich selbst.
In diesem Alter war sie auch oft die Spielgefährtin der kaiserlichen Prinzessinnen und lernte in diesem ungezwungenen Beisammensein jene nahe und genau kennen, welche einst die ersten Throne Europas einzunehmen bestimmt waren. Etwas später, da man die ungewöhnlichen Fähigkeiten dieses Kindes beurteilen lernte, wurde sie zur künftigen Vorleserin der Kaiserin bestimmt, und zu dem Ende der Obersthofmeisterin Gräfin Fuchs (nach dem Brauch jener Zeit Gräfin Füchsin genannt) übergeben, bei welcher sie sich im Lesen von Druck- sowohl als Handschriften üben mußte.
Als sie ihr dreizehntes Jahr erreicht hatte, fand man sie geschickt und klug genug, um ihren nicht leichten Dienst anzutreten, und schon dies bürgt für ihre hohe Geisteskraft und Fähigkeit. Sie hatte in dieser Stelle teils mit andern Fräulein ihres Ranges, welche insgesamt den Titel kaiserlicher Kammerdienerinnen trugen, die Toilette und persönliche Bedienung ihrer Gebieterin zu besorgen, teils allein das Amt, der Regentin vorzulesen. Diese Lektüre bestand aber nicht in Romanen oder Unterhaltungsbüchern; es waren Geschäftsschriften, Berichte, Depeschen, kurz Staatsangelegenheiten, über welche die Monarchin selbst entschied, und in denen sie mit unermüdlicher Anstrengung täglich viele Stunden arbeitete, wobei meine Mutter ihr vorlas und überhaupt oft Sekretärsdienste verrichtete.
Natürlich waren wichtige Geheimnisse in den Händen des jungen Mädchens, aber ein frühreifer Geist, bei dem vielleicht die einsame Stellung, ohne Blutsverwandte, ohne Freunde, auf einer Höhe, die von vielen beneidet ward, noch die angeborne Urteilskraft vermehrte und den Beobachtungssinn schärfte, dieser wahrhaft männliche Geist gab meiner Mutter die Kraft, die Verschwiegenheit, die ganze würdige Haltung, welche ihr Platz forderte, und welche ihr das Vertrauen der Fürstin bis an deren Tod sicherte.
Maria Theresia führte ein äußerst tätiges und sehr regelmäßiges Leben. Um fünf Uhr im Sommer, im Winter wahrscheinlich später, stand sie täglich auf, und eine Klingel rief ihren Zofen. Es war Etikette, daß keine anders als frisiert, im seidenen Kleide (man kannte damals unsere Perkals, englische Leinwand usw. nicht), ja selbst im Reifrocke, der aber zum Negligée nur von kleinem Umfang war und Hanserl genannt wurde, vor der Fürstin erscheinen durfte. Dies machte sehr frühes Aufstehen auch den Kammerdienerinnen, wenigstens denen, welche für diesen Tag im Dienste waren, notwendig. Die Toilette der Kaiserin war der mühsamste, wie der unbelohnendste Teil des Dienstes, den meine Mutter zu versehen hatte. Da sie ihn aber mit ebensoviel Geschmack als Schnelle und Geschicklichkeit versah, so ward ihr die Pflicht, ihre Monarchin täglich zu frisieren, dahingegen die andern Fräulein im Dienste abwechselten und manchen Tag ganz frei hatten. Diese ganz freien Tage wurden auch meiner Mutter nach ihrer Tour, nur daß das Frisieren am Morgen und das Vorlesen auf die Nacht jeden Tag ihr ausschließendes Geschäft blieb, in welchem keine andere sie ablösen konnte, weil keine es so zu verrichten verstand wie sie.
Dieses Frisieren und die Verfertigung des Kopfputzes war denn aber auch für meine Mutter eine nur zu ergiebige Quelle von Verdruß und Kränkungen. Man kennt das Wort, welches über Elisabeth von England gesprochen wurde: »Selbst die größte Königin ist doch eine Frau.« Dieses Wort, obgleich Maria Theresia, ihren moralischen Eigenschaften nach, als Frau weit über Elisabeth stand, traf sie doch auch, und sie unterlag dem allgemeinen Los unsers Geschlechtes. Ihre Gestalt, die aber wirklich von höchster Schönheit war, und die Ausschmückung derselben durch vorteilhaften Putz beschäftigte sie etwas mehr, als man gemeinhin von einer Frau, die mit so vielem Geist, mit so viel männlichem Starkmut so weite Länderstrecken zu beherrschen verstand, hätte vermuten sollen. Nur muß man zur Steuer der Wahrheit hinzusetzen, daß diese Freude an ihrer Schönheit, und die Zeit, die sie ihr widmete, nie ihren wichtigeren Pflichten Eintrag tat; noch viel weniger aber Gefallsucht oder eine größere Aufmerksamkeit für das andere Geschlecht zur Quelle hatte. Maria Theresia stand in dieser Rücksicht fleckenlos vor ihrem Zeitalter, und, was noch weit mehr sagen will, auch vor ihrer Umgebung, ihren dienenden Frauen, im höchsten Glanz frommsittlicher Würde und ehelicher Treue da. Wie ein Mädchen aus den mittleren Ständen, bei denen mehr das Herz als eigennützige Rücksichten die Wahl des Gatten bestimmt, und man für sich und nicht für seine Väter liebt (wie Haller sagt), hatte sie den Gemahl gewählt, den schönen, liebenswürdigen Jüngling, der mit ihr erzogen worden oder sich doch während seiner Jugend am Hofe ihres Vaters aufgehalten hatte. Weder Landesmacht noch große Vorteile brachte ihr in politischer Hinsicht die Ehe mit dem Prinzen Franz von Lothringen, der später das Großherzogtum Toskana erhielt. Aber er und sein Bruder Karl lebten am Hofe Kaiser Karls VI., und seine zwei Töchter, Maria Theresia und Marianna, neigten sich in Liebe zu den beiden Brüdern. Theresia teilte den Thron ihrer reichen Erbstaaten mit Franz von Lothringen, und Marianna brachte ihrem Gemahl das Gouvernement der Niederlande. Nie hat Maria Theresia je einen andern Mann schön oder anziehend gefunden, und meine Mutter, eine Frau von so vielem Geiste, daß ich keine in dieser Rücksicht mit ihr zu vergleichen weiß, eine Frau, die in ihrer ganzen Denkart so weit von blindem Enthusiasmus als Schmeichelei und Schranzenwesen entfernt war, die die Fehler und Schwächen ihrer Gebieterin wohl sah und sehen mußte, weil sie dreizehn Jahre um sie lebte, hat in Rücksicht weiblicher Würde und ehelicher Treue Marien Theresien immer als das Vorbild ihres Geschlechtes gepriesen.
Ihre trübsten Stunden hatte meine Mutter also bei der Toilette der Kaiserin oder bei der Verfertigung ihres Putzes, denn dazumal wußte man nicht so viel von Marchandes de mode, und die Fräulein, welche die Monarchin bedienten, waren auch größtenteils ihre Putzmacherinnen. Oft – sehr oft mußte eine Haube vier- bis fünfmal anders gesteckt werden, bis sie nach dem Geschmacke der Gebieterin war, und wer diese Art von Arbeit zu beurteilen versteht, wird wissen, daß ein öfteres Auf- und Andersmachen der Sache gar nicht förderlich ist, ja meistens die Schönheit der Stoffe und des Zubehörs ganz zerstört. Ebenso ging es mit der Frisur. Auch an dieser zupfte, rupfte, änderte die hohe Frau so viel und so lange, bis sie verdorben war und neu gemacht werden mußte, was denn bei der damaligen Art des Haarputzes gemeiniglich dahin führte, daß der ganze Bau zerstört, die Haare ausgekämmt und nicht selten neu in Papilloten gewickelt und gekräuselt werden mußten. Daß die Gebieterin dabei übellaunig wurde, daß die Zofen das entgelten mußten, ist ebenso natürlich – und die Erinnerung an alle die trüben Stunden, welche Putz und Toilette ihr gemacht hatten, mag wohl schuld gewesen sein, daß meine Mutter selbst in den Jahren, wo sie noch wohl Freude daran hätte haben können, sich vorteilhaft und ihrer sehr niedlichen Figur gemäß anzuziehen, sich schon ganz matronenhaft, und, wie ich mich aus den Bildern meiner Kindheit wohl entsinne, beinahe altfränkisch kleidete. Auch auf mich hatten jene Erinnerungen Einfluß, denn ich mußte wie in allem, so besonders bei meiner Toilette sehr hurtig zu sein lernen, und es wurde mir für die damalige mühsame Art des Anzuges und der Frisur ungemein wenig Zeit gegönnt, um beides an mir zu bewerkstelligen.
*
Eine viel minder verdrießliche, wenn gleich auch anstrengende Art des Dienstes, war das Vorlesen der Geschäftsschriften in den verschiedenen Sprachen, welche in den weiten Provinzen der Erbstaaten geredet wurden; deutsch, italienisch, französisch (in den Niederlanden) und lateinisch (in Ungarn). Da Französisch damals noch viel mehr als jetzt die Sprache der höhern Stände, ja der gebildeten Welt überhaupt war, so war sie denn auch an Maria Theresias Hof die herrschende, zumal da ihr Gemahl, Kaiser Franz I., als geborner Lothringer kaum Deutsch verstand und es nie sprach, auch seinetwegen viele Personen in den Hofdiensten Lothringer oder Niederländer waren. Meine Mutter hatte das Französische daher von ihrer Kindheit an wie eine zweite Muttersprache, ja wie ihre eigentliche gelernt und sprach und schrieb es mit gleicher Fertigkeit. Auch das Italienische war ihr geläufig. Damals wurde es überhaupt viel am Hofe und in Wien gesprochen, und der Dichter des Hofes war stets ein Italiener; früher unter Kaiser Leopold, Apostolo Zeno, später der hochberühmte Metastasio, eigentlich Trapassi genannt, den ich noch persönlich gekannt habe. Alle Schauspiele, welche dem Hofe zu Ehren oder bei feierlichen Gelegenheiten gegeben wurden, waren italienische Opern, an deren Schlusse jedesmal in einer kleinen Strophe, welche den Namen Licenza führte, ein Kompliment angebracht war, welches den Inhalt der Oper mit einer schmeichelhaften Anwendung auf die gegenwärtige Feierlichkeit verband.
Diese beiden Sprachen waren meiner Mutter also sehr geläufig, und sie redete sie wahrscheinlich zierlicher und korrekter als ihre Muttersprache; denn damals galt noch von den meisten Einwohnern Wiens in den höheren Ständen, was ein Dichter von sich sagt:
Ich spreche Wälsch wie Dante,
Wie Cicero Lateinisch,
Wie Pope und Thomson Englisch,
Wie Demosthenes Griechisch,
Wie Diderot Französisch
Und Deutsch – wie meine Amme.
Selbst die Kaiserin bediente sich des ganz gemeinen österreichischen Jargons, und folgende zwei Anekdoten, die ich oft aus dem Mund meiner seligen Mutter hörte, werden dienen, jene Zeit zu charakterisieren, von der ich spreche. Ein Fräulein aus Sachsen wurde als Kammerdienerin bei der Kaiserin angestellt, und meine Mutter, welche ihr damals schon mehrere Jahre gedient hatte, bekam den Auftrag, die Neue, so hieß jede Letzteingetretene unter den Fräulein, zum Dienst abzurichten. Das sächsische Fräulein nahm also in zweifelhaften Fällen immer ihre Zuflucht zu meiner Mutter, als ihrer Lehrerin. Eines Tages kam sie ganz verlegen und ängstlich zu ihr, und bat sie, ihr zu sagen, was sie zu tun habe. Ihre Majestät die Kaiserin habe das Blabe Buich verlangt. – Meine Mutter mußte lächeln, sie gab der Sächsin ein blaues Buch, in welchem die Kaiserin eben zu lesen pflegte, mit dem Bedeuten, es der Monarchin zu überreichen. Lange wollte die andere es nicht glauben, daß mit jener Bezeichnung ein blaues Buch gemeint sein sollte; – indes meine Mutter beharrte darauf, Fräulein M** übergab das Buch, und sieh! – es war das rechte. Diese Anekdote erklärt hinreichend, warum in den glänzenden Zirkeln Französisch oder Italienisch und nie Deutsch gesprochen wurde.
Kurz vor der Geburt einer ihrer jüngsten Prinzessinnen stritt die hochselige Kaiserin mit einem Grafen Dietrichstein scherzhaft darüber, ob das zu erwartende Kind ein Prinz oder eine Prinzessin sein würde. Der Graf behauptete das erste, die Kaiserin das zweite. Es wurde eine Wette eingegangen; – die Kaiserin behielt recht, das Kind war eine Erzherzogin, und Graf Dietrichstein mußte bezahlen. Da half er nun, im Geschmacke jener Zeit, sich mit einer sehr artigen Galanterie. Er ließ sein Bild in kniender Stellung von Porzellan verfertigen, und diese Gestalt reicht mit der einen Hand der Kaiserin ein Blatt, worauf folgende Verse Metastasios standen:
Perdo, è ver, l'augusta figlia
A pagar m'ha condannato,
Ma s'è ver che a te somiglia,
Tutto il mondo ha guadagnato.
Die ganze Idee, welche vermutlich von Metastasio herrührte, ist ebenso zart als schmeichelhaft, und macht seiner Erfindungskraft Ehre; dennoch kann man nicht umhin, wenn man sich jenes Geschenk lebhaft vergegenwärtigt, das porzellanene Figürchen, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil es Porträt war, mit Staatskleid, Perücke und Degen, welches da kniend ein beschriebenes Blatt überreicht, komisch zu finden. Doch das Ganze zeigt den Geschmack und Ton jener Zeit, wo die schöne deutsche Literatur sich kaum mit ihren ersten Strahlen in Norddeutschland zu zeigen anfing, bis zu uns aber noch nicht gedrungen war, und alles, was las und Sinn für Bildung hatte, bloß französische oder italienische Literatur kannte.
Latein war die vierte Sprache, welche in den Geschäftspapieren, die meine Mutter ihrer Monarchin vorlesen mußte, vorkam. Die Kaiserin verstand sie vollkommen, redete sie vielleicht auch mit ihren ungarischen Magnaten und rief ihnen in diesen Akzenten jenen unvergeßlichen Tag zurück, an dem sie, von den Mächten von halb Europa bekriegt und mit dem Verlust aller ihrer, von eben jenen Mächten garantierten Staaten bedroht, die schöne, junge, unglückliche Fürstin, den königlichen Säugling auf dem Arm, auf dem Reichstag ihrer treuen Ungarn erschien, sie zum Beistand aufforderte, und solchen Enthusiasmus in ihnen erregte, daß Greise und Helden begeistert und gerührt die Säbel zogen, und einstimmig, alle für ihren König Maria Theresia zu sterben, schwuren. Gar gern erinnerte sich die große Frau jenes Tages, wo sie den dreifachen Triumph: der verfolgten Tugend, des rechtmäßigen Königtums und der Schönheit gefeiert hatte. Immer blieb sie der ungarischen Nation vorzüglich gewogen, und jener Anstrengungen, die sie damals machte, um ihr den Thron ihrer Väter zu erhalten, dankbar eingedenk.
In dieser Sprache nun (im Latein) gab die Kaiserin selbst meiner Mutter die notdürftigste Anleitung, damit diese ihr verständlich vorlesen konnte. Vieles begriff meine Mutter durch das verwandte Französisch und Italienisch, das übrige erklärte ihr, soweit es nötig war, ihre Gebieterin. So las sie denn derselben viele Stunden und Stunden, besonders abends und nach dem sehr mäßigen Nachtessen, welches die Kaiserin in ihren Zimmern allein zu sich nahm, die Geschäftspapiere ihrer verschiedenen Staaten vor. Diese Lektüre dauerte fort, nachdem die Monarchin sich schon entkleiden lassen und zu Bette gelegt hatte, und selbst dann noch, bis der Schlaf sie überwältigte. Dann erst bekam meine Mutter die Erlaubnis, sich zu entfernen.
Wohl umgaben Glanz und Herrlichkeiten meine Mutter in ihrer Jugend, aber ihr Dienst war, wie man aus dem obigen sieht, nichts weniger als leicht, und manche Angewöhnungen der Monarchin machten ihn noch beschwerlicher. So z.B. konnte diese, als eine große, starkgebaute Frau, gar keine Wärme vertragen, wie sie denn überhaupt, trotz ihrer hohen Geburt und des königlichen Glanzes, der schon ihre Wiege umgab, in Rücksicht ihres Körpers nichts weniger als weichlich oder in ihren Gelüsten fordernd war. Geheizt durfte bei ihr fast gar nicht werden, die Furcht vor Zugluft kannte sie nicht, sie wußte nicht, was ein Rheumatismus sei, und selbst im Winter stand oft ein Fenster neben ihrem Schreibtisch offen, durch das der Wind meiner Mutter den Schnee auf das Papier warf, aus welchem sie vorlas. Eine Anekdote mag zum Belege des hier Gesagten dienen. Die Kaiserin, welche wirklich fromm und eine Christin im edelsten Sinne des Wortes war, ging, solange es ihr körperliches Befinden erlaubte, jährlich mit der Frohnleichnamsprozession. An einem solchen Tage, als sie zu dem Ende von Schönbrunn nach der Stadt gefahren war, kam sie gegen Mittag, furchtbar erhitzt und ermüdet von dem heißen Juniustage, von der Schwere und Größe ihrer Person und dem langen, meist der Sonne ausgesetzten Gange durch die halbe Stadt, nach Schönbrunn zurück. Sie ließ sich sogleich ganz entkleiden – und setzte sich dann in der Mitte eines Kabinetts nieder, in welchem Fenster und Türen geöffnet werden mußten, mit nichts als einem Mieder, Rock und Pudermantel bekleidet, trank Limonade, aß Erdbeeren in Eis gekühlt und ließ sich von meiner Mutter die Haare auskämmen, die so naß waren, daß meine Mutter mehr als einmal ihre Hände trocknen mußte. Das alles schadete der kräftigen, noch immer blühenden Frau nicht im geringsten, aber es machte auch, daß sie sehr wenig Rücksicht auf Bedürfnisse oder Wünsche solcher Art bei ihrer dienenden Umgebung nahm, und Abhärtung, Nichtachtung seiner selbst und Unempfindlichkeit gegen schädliche Einwirkungen, welche sie, die kaiserliche Frau, besaß, bei dem dienenden Personale teils voraussetzte, teils forderte. Und so wie sie, hart gegen sich selbst, jede körperliche Verweichlichung oder Schwächlichkeit haßte, war ihr auch jede sittliche Schwäche und übergroße Weichheit zuwider. Ihrer eigenen Kraft und so mancher Gelegenheit sich bewußt, wo sie durch diese und durch ihren Mut sich aus gefährlichen Lagen gerissen und schwere Leiden mit Selbstverleugnung getragen hatte, forderte sie Ähnliches von ihren Umgebungen und mochte kein weinerliches Wesen und keine zu große Empfindlichkeit um sich leiden.
So bildete sich im steten Umgang mit dieser wahrhaft großen Frau, von ihrer Zufriedenheit oder ihrem Tadel geleitet, von ihrem Beispiele ermutigt, meiner Mutter von Natur kräftiger Geist und gesunder Körper auf eine Weise aus, der sie noch in ihren hohen Jahren zum Gegenstand der allgemeinen Achtung und des Erstaunens für viele machte. Bei einem schlanken, zierlichen Körperbau, von mittelmäßiger Größe, besaß meine Mutter eine ungewöhnliche Fülle von Lebenskraft und Gesundheit, welche wohl das Erzeugnis einer unverdorbenen Natur, einer abhärtenden Erziehung und ihrer eigenen Behutsamkeit und strengen Mäßigkeit war, so daß sie für den Einfluß der Witterung, der Zugluft, veränderter oder unverdaulicher Speise ganz und gar unempfindlich war, und bis in ein sehr hohes Alter, ihre Sehkraft ausgenommen, welche gegen das Ende ihres Lebens sehr schwach wurde, alle ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten unvermindert erhielt.
*
Maria Theresia forderte viel von ihren Dienerinnen; doch umgab sie sie dafür auch mit Glanz, Wohlstand und Ansehen, wodurch die einzelnen sich nicht bloß geehrt und nach Maßgabe ihrer Denkart auch beglückt fühlten, sondern wodurch ihnen auch ein Begriff ihrer eigenen Würde eingeflößt wurde, der vielleicht besser als die strengsten Verhaltungsbefehle dazu diente, sie vor fremder Zudringlichkeit und eigener Vernachlässigung zu bewahren. Sie standen unter einer Art von häuslicher, ja mütterlicher Aufsicht, mußten es melden, wenn sie ausgehen wollten und bemerken, wohin; dann wurde ihnen eine Hofequipage zu diesem Behuf angespannt oder irgendeine angesehene Frau, die aber dazu eigens bei der Monarchin die Erlaubnis nachsuchen mußte, durfte das Fräulein in ihrer eigenen Equipage abholen und mußte sie auch wieder ebenso zurückführen. Auf andere Art oder in einem Fiaker war durchaus den Kammerdienerinnen nicht erlaubt, auf den Straßen zu erscheinen. In früherer Zeit wurden sie sogar mit sechs Pferden geführt, späterhin nur mit zweien. In Gesellschaften gebührte ihnen der Rang einer Hofrätin, und wenn keine solche gegenwärtig war, nahm das Fräulein vom Hofe vor den übrigen verheirateten Damen den Ehrenplatz auf dem Kanapee ein.
Ihren Tisch hatten sie vom Hofe, ihre Besoldungen waren mäßig, aber die Freigebigkeit der Monarchin, die vielen Teilungen ihrer Garderobe ersetzten ihnen das reichlich, und sie fanden bei Ordnungsliebe und Sparsamkeit stets die Mittel, sehr geschmackvoll und glänzend angezogen zu sein und doch etwas zurückzulegen. An den Tagen, an welchen sie den Dienst nicht hatten, war es ihnen auch vergönnt, auf ihren Zimmern Bekannte, selbst Männer, nicht bloß vom Hofe, sondern auch aus der Stadt, zu sehen, nur mußte die Kaiserin davon benachrichtigt und dies Personen von unbescholtenem Rufe sein.
Auf diese Art entspannen sich denn manche Bekanntschaften, und auch die mit meinem Vater. Es war in der traurigen Zeit des Siebenjährigen Krieges, als Schrecken, Angst und Siegesruhm so oft in Wien und in der kaiserlichen Burg wechselten. Wohl erinnere ich mich noch an ein paar Züge, welche meine Mutter mir aus jener Zeit erzählt hat. Als König Friedrich mit seinen glücklichen Waffen immer weiter vorwärts drang, bereits in Mähren stand und Olmütz zu belagern anfing, da war am kaiserlichen Hofe eben die Zeit gekommen, auf eines der Lustschlösser zu ziehen. Es wurde also in den Kammern gepackt und zur Landfahrt zugerüstet. Meine Mutter war an den Koffern beschäftigt, um die Garderobe und täglichen Bedürfnisse ihrer Gebieterin einzupacken. Eben vorher war die Schreckensnachricht von jener Belagerung gekommen. Ohne zu klagen, ohne sich weiter zu äußern, sagte die Monarchin, indem sie, durchs Zimmer gehend, die Reiseanstalten betrachtete, zu meiner Mutter: »Nimm etwas mehr mit, vielleicht gehen wir weiter«.
Der Kurier von der Schlacht bei Hochkirch traf am Theresiatage, den 15. Oktober, hier ein, abends ziemlich spät, als schon die Prinzen und Prinzessinnen des kaiserlichen Hofes sich nach der Cour und Assemblée bei der Monarchin in ihre Zimmer zurückgezogen und angefangen hatten, sich auszukleiden. Die frohe Siegesbotschaft wurde schnell von der Kaiserin in alle Kammern ihrer Kinder gesendet und wunderlich geputzt, – – jene Erzherzogin mit den Edelsteinen im Haare, aber im Nachtkleide, diese im Reifrocke und Galakleide mit zerstörter Frisur; Prinzen halb in Uniform, halb im Hausrocke, kamen sie eiligst wieder in den Zimmern ihrer erlauchten Mutter zusammen, um ihr, nach der Feier des Namenstages, noch zu der Feier des Sieges Glück zu wünschen.
*
Während dieser und ähnlicher abwechselnden Szenen entspann sich das zärtliche Verhältnis meiner Eltern. Mein Vater hatte unterdes die Stelle eines Sekretärs bei der böhmisch-österreichischen Kanzlei erlangt, er durfte allerdings als Freier auftreten, aber ans Ziel seiner Wünsche zu gelangen, wollte ihm noch immer nicht gelingen. Schon sehr oft war die Hand meiner Mutter von glänzenden und auch von minder bedeutenden Freiern gesucht worden. Außer den persönlichen Annehmlichkeiten einer sehr zierlichen Gestalt, anmutiger Gebärden und eines ausgezeichneten Geistes, war auch die Aussicht auf besondere Gunst und Unterstützung von Seite der Monarchin, welche ihrer geschätzten Dienerin und Vorleserin, und um ihretwillen auch dem künftigen Gemahl nicht wohl fehlen konnte, ein Hauptreiz, welche Freier lockte. Aber sie alle, welche bei der Monarchin selbst, die in so vielem und würdigem Sinn Mutterstelle bei ihren Untergebenen vertrat, ihr Gesuch anbringen mußten, sahen sich bisher abgewiesen. Bei den meisten, ja fast bei allen, war meiner Mutter Herz gleichgültig geblieben. Nur einer, ein geborner Ungar, dessen Porträt sie noch lange Jahre nachher besaß, und dessen in Rousseaus Konfessionen als eines höchst interessanten und liebenswürdigen jungen Mannes erwähnt wird – hatte ihr Herz tiefer gerührt. Nicht bloß der Wille der Monarchin, auch ungünstige Verhältnisse in der Familie des jungen Ungars zerrissen das Bündnis. – Er starb bald darauf; meine Mutter gedachte seiner nie ohne Rührung. Bei meinem Vater, der ihre ganze Achtung und innige Neigung erworben hatte, fürchtete sie ebenfalls, die Einwilligung der Kaiserin nicht zu erhalten. Diese hatte gegen jede Verbindung, welche meine Mutter eingehen sollte, etwas einzuwenden. Freilich ist wohl kein Bündnis, kein Verhältnis in der Welt jedem Wunsche und jeder Forderung so ganz gemäß, daß sich nicht mit mehr oder minderem Anschein etwas dagegen aufbringen ließe. Bei der Monarchin aber mag wohl die Abneigung, sich von der so geschickten, so verschwiegenen und verständigen Dienerin zu trennen, deren Stelle nur schwer zu ersetzen gewesen sein würde, jenen abschlägigen Antworten zu Grunde gelegen haben. Meine Eltern mußten sich in Geduld fassen.
Im Jahre 1765 reiste der Hof nach Innsbruck, um die Vermählung des zweiten Prinzen, des nachmaligen Kaisers Leopold II., mit einer spanischen Prinzessin zu feiern. Für meine Mutter war diese Reise in ein gebirgiges Land eine ganz neue und sehr willkommene Begebenheit. Sie freute sich der ihr fremden, wilden Natur, und manches romantische Plätzchen, manche schöne Einsamkeit regte in ihrer, allmählich des Hoflebens müden Seele, den Wunsch auf, an einer solchen Stelle sich selbst und ihren geheimen Neigungen leben zu können. – Der Kaiser Franz, ein noch kräftiger, blühender Mann, fand für seine Wißbegierde und Liebe zur Altertumskunde viel interessanten Stoff an so vielen geschichtlichen und archäologischen Schätzen, welche Innsbruck, noch mehr aber das Bergschloß Ambras enthielt, woselbst sich damals noch die ganze merkwürdige Sammlung befand, welche dem Erzherzoge Ferdinand, dem Gemahl der schönen Welserin, ihr Entstehen verdankt und welche später, als Tirol auf kurze Zeit einer fremden Macht geräumt werden mußte (1805, hierher nach Wien transportiert und seitdem im k.k. Belvedere aufgestellt wurde.
Vorzüglich erfreute das Münz- und Antikenkabinett sich der Vorsorge und Aufmerksamkeit des Monarchen, der einen sehr tüchtigen und der ganzen Welt rühmlich bekannten Gelehrten, Herrn Duval, zum Vorsteher desselben ernannt hatte. Duval habe ich noch gekannt und erinnere mich des langen, hagern, alten Franzosen recht wohl, der meine Eltern öfters besuchte, von ihnen mit großer Achtung und Liebe behandelt wurde und gegen uns Kinder so freundlich war. Er war aber selbst im hohen Alter noch eine kindliche Natur, und er, der arme Hirtenknabe, der hinter seinen Schafen einhergehend und Bücher lesend, die er sich von seinem sauer ersparten Lohn kaufte, so von Kaiser Franzens Vater, dem Herzog von Lothringen, auf der Jagd gefunden, befragt und aufgenommen wurde, den der Herzog dann studieren ließ, weil er dessen ungemeine Fähigkeiten erkannte – behielt noch bis ins späte Alter die ungetrübte Heiterkeit des Geistes, die unerschöpfliche Gutmütigkeit seiner Kindheit und Jugend bei. Meine Mutter liebte er väterlich, nannte sie seine »Bibi« und unterzeichnete seine Briefe an sie immer mit dem, auf ein französisches Sprichwort (que 99 moutons et un Champagnard font 100 bêtes) gegründeten Ausdruck: le suplément des 99 moutons. – Er war aus der Champagne gebürtig.
Um diesem, seinem lieben Duval, nun auch eine Ausbeute von seiner Reise mitzubringen und das Wiener Münzkabinett zu bereichern, ließ sich Kaiser Franz die Schätze des Innsbrucker zeigen, und beschloß, die Dubletten desselben mitzunehmen und dafür von Wien zu senden, was dem Innsbrucker fehlte. Aber damit war der damalige Direktor des Kabinettes in Innsbruck nicht zufrieden (seinen Namen zu nennen, wäre unbescheiden, aber die Anekdoten sind zu hübsch, um vergessen zu werden). – Mit nichten, antwortete er dem Kaiser, ich habe die Münzen auf meinem Inventar, ich muß dafür haften. Vergebens suchte ihn der Kaiser auf den wissenschaftlichen Standpunkt zu stellen, von dem aus er einen solchen Tausch zu betrachten hätte – der gute Direktor hielt sich an sein Inventarium, bis endlich der Monarch, der merkte, mit welchem Manne er es zu tun habe, ihm vorschlug, die auszutauschenden Münzen zu wägen und dem Innsbrucker Münzkabinette indes so viele (neugeprägte) Dukaten dazulassen, als jene Goldgewicht hätten, bis sie durch die aus Wien zu sendenden ausgelöst werden würden. Das beruhigte den Direktor; er gab Goldgewicht für Goldgewicht und war nun überzeugt, seine Pflicht gegen die ihm anvertrauten Schätze vollkommen erfüllt zu haben. Eine zweite Antwort, die derselbe gelehrte Mann meiner Mutter gab, dient zum Beleg jener ersten. Im Antikenkabinett, welches die Fräulein der Kaiserin auch zu besehen gekommen waren, fiel meiner Mutter ein Stück auf, das ihr nicht echt, keine wirkliche Antike zu sein schien. Sie äußerte diesen Zweifel gegen den gelehrten Herrn Direktor. O, mein Fräulein! erwiderte dieser, dies Stück ist gewiß antik – ich bin nun schon vierzig Jahre in diesem Kabinett angestellt und habe es bereits vorgefunden.
*
Das Beilager wurde gehalten, die Feierlichkeiten waren vorüber, der Hof dachte an seine Rückreise nach Wien, da ging am 18. August der Kaiser, von seinem ältesten Sohne, dem Erzherzog Josef, damals schon römischem König, abends aus seiner Loge im Theater, um in seine Gemächer zurückzukehren. Auf dem Gange hinter den Logen rührte ihn plötzlich ein Schlagfluß. Er sank in die Arme seines Sohnes und gab auf der Stelle seinen Geist auf. Dieser Sohn mußte der Überbringer der schrecklichen Nachricht an seine Mutter, an seinen Bruder sein, der einer Unpäßlichkeit wegen sich in seinen Zimmern gehalten hatte. Hier zeigte sich's, wie meine Mutter sagte, welche tiefe, innige Liebe Maria Theresia für ihren Gemahl hatte. Sie war ganz vernichtet, sie fand keine Tränen und ein krampfhaftes, gewaltsames Schluchzen, welches die ganze Nacht durch währte, erfüllte ihre Umgebung mit der lebhaftesten Sorge für die Gesundheit und das Leben der hohen Frau. Erst gegen Morgen, nach einer Aderlaß, welche der Arzt verordnete, brach ihr tiefer, großer Schmerz in erleichternde Tränen aus. – Eine ihrer ersten Handlungen aber war, meiner Mutter zu befehlen, daß sie ihr die Haare abschneide. – Von diesem Augenblicke an, als ihr Gemahl sich ihrer, trotz ihres reiferen Alters, noch immer großen Schönheit nicht mehr erfreuen konnte, freute auch sie sich ihrer Gestalt nicht mehr. Sie legte allen bunten Putz und alles Geschmeide ab, teilte ihre Garderobe unter ihre Frauen, ließ ihr Schlafzimmer mit grauer Seide ausschlagen, ihr einsames Lager mit grauen Vorhängen umgeben und zeigte so auch in ihrem Äußern, daß das Leben und die Welt für sie ihren Reiz verloren haben. An jedem 18. des Augusts, dem Todestage ihres Gatten, besuchte sie seine Grabstätte, schloß sich dann in ihr Zimmer ein, beichtete, fastete und brachte den Tag in schmerzlichen Erinnerungen und frommen Gebeten zu. Rührend ist das Grabmal, welches sie ihrem Gemahl nach seinem Tode und sich selbst im voraus in der kaiserlichen Gruft bei den Kapuzinern errichten ließ, und wo sie mit dem ersten und einzigen Gegenstand ihrer Liebe, auf einer Art von Paradebette ruhend, vorgestellt ist. Die Wahrheit solcher Gefühle, welche allein ihren Wert ausmacht, zeigt sich am siegreichsten und überzeugendsten vor den nächsten und beständigen Umgebungen. Sind diese von der Wirklichkeit und Tiefe des Schmerzes überzeugt, so ist wohl kaum mehr daran zu zweifeln.
So steht Maria Theresia, welche als Regentin einen der ersten Plätze in der Reihe der großen Monarchen einnimmt, als Frau nicht minder groß und erhaben vor uns. Schön, wie wenige ihres Geschlechts, Erbin großer Staaten, liebenswürdige Frau, mit tausend Talenten, unter andern auch mit einer wunderlieblichen Stimme begabt, die sie im Gesange oft zur Freude des Hofes hören ließ – und dem ersten und einzigen Gegenstand ihrer jugendlichen Zärtlichkeit treu bis in den Tod. – Es war mir auch eine sehr werte und erfreuliche Erscheinung, diese Regentin von der Feder einer weiblichen und liebevollen Hand, der Mistreß Jameson in ihrem Buche: The Female Sovereigns, ganz nach ihrem wahren Wert erkannt und geschildert zu sehen, so daß sich ihr Bild weit über Katharina II. und sogar über Elisabeth von England erhebt.
Diese Treue und Liebe wird noch herrlicher, wenn man weiß, daß die erste bei weitem nicht in dem Maß vergolten wurde, in welchem sie es verdient hätte. Kaiser Franz hatte verschiedene Liebschaften, die man teils kannte, teils nicht. – Seine Gemahlin wußte wohl darum, sie zog die eine davon an ihren Spieltisch; – sie litt dadurch, aber sie liebte den Wankelmütigen nichtsdestoweniger mit gleicher Glut bis an seinen Tod. Ein Wort, das sie einst zu meiner Mutter sprach, mag wohl aus der tiefen, innern Überzeugung entstanden sein, daß ihres Gemahls Standpunkt und Verhältnis zu ihr und seinen Staaten nicht das eigentlich rechte und vielleicht die Quelle manches Mißtones zwischen ihnen war. »Laß dich warnen,« sagte sie einst, »und heirate ja nie einen Mann, der nichts zu tun hat«.
War es, daß die Haare der Monarchin den Manen ihres Gemahls und ihrem Schmerz zum Opfer gefallen waren und ihre Toilette nicht mehr so viel Sorgfalt erforderte; war es die eigene Vereinsamung, die ihr Herz für das Traurige eines solchen Geschickes bei andern empfindlicher machte – kurz, noch während des Trauerjahres erhielt meine Mutter die Erlaubnis, mit ihrer Hand zu schalten, und mein Vater erreichte das Ziel seiner heißen und lange genährten Wünsche. Als meine Mutter ihren Bräutigam der Monarchin vorstellte, war diese erstaunt, in meinem Vater einen zwar noch jungen (er zählte 35 Jahre, meine Mutter 26), aber sehr gesetzten, einfachen und wahrhaft deutschen Mann zu finden. Ich glaubte immer, äußerte sie hernach zu meiner Mutter, du würdest dir so einen galanten Herrn, einen Chevalier aussuchen. – Demnach gewann dieser einfache Mann späterhin durch seine erkannte Rechtlichkeit, seinen Diensteifer und seine vorzüglichen Geistesgaben die ausgezeichnete Huld seiner Monarchin, wovon diese Blätter unzweifelhafte Proben aufzeigen werden.
Die Heirat meiner Mutter war also beschlossen und wurde mit aller, damals am Hofe üblichen Feierlichkeit vollzogen. Die Verlöbnisse bestanden damals noch; – jenes meiner Mutter wurde acht Tage vor der Trauung gehalten. – Während dieser Zeit legte sie die Trauer ab, welche sie mit dem ganzen Hof noch um den verstorbenen Kaiser trug, und ging bunt. Am Tage der Hochzeit mußte sie sich in ihrem Brautstaat vor der Kaiserin zeigen, welche zu dem eigenen, nicht unbedeutenden Geschmeide, womit meine Mutter geschmückt war, einige Geschenke fügte und ihr dann noch eine Perlenschnur von unschätzbarem Werte um den Hals band, die jedoch die Braut nach der Feierlichkeit der Trauung wieder zurückgeben mußte, da sie unter das Geschmeide der k.k. Schatzkammer gehörte und nur bei solchen Gelegenheiten gebraucht wurde. In der sogenannten Kammerkapelle wurde die Zeremonie vollzogen, die Obersthofmeisterin der Kaiserin führte als Brautmutter die Braut an den Altar und nahm während der Trauung in einem Betstuhl Platz. Als der Geistliche an die Stelle kam, wo er die Braut auffordert, das ja auszusprechen, mußte diese (so gebot es die Etikette), ehe sie antwortete, sich mit einer Verneigung gegen die Obersthofmeisterin wenden, sie gleichsam um die Erlaubnis dazu ersuchen. – Die Obersthofmeisterin erhob sich, drehte sich gegen das Oratorium, in welchem sich die Monarchin befand, und wiederholte die Verbeugung und die stumme Anfrage. Hierauf nickte die Kaiserin bejahend, die Obersthofmeisterin überlieferte durch ein ebensolches Zeichen die Einwilligung der, Mutterstelle vertretenden, hohen Frau, die Braut verbeugte sich dankbar, wendete sich dann gegen den Priester und sprach ihr Ja aus.
Nach der Trauung folgte meine Mutter ihrem Gemahl in sein Haus, wo indes seine Mutter, bei welcher er wohnte, alle Anstalten zur Mittagstafel und Bewirtung der Hochzeitsgäste getroffen hatte; – und dann ihrer Schnur die Führung des ganzen Hauswesens übergab.
*
Hier begann nun für meine Mutter eine ganz neue Lebensweise, ja, sie fand sich eigentlich in einer neuen Welt, nicht bloß durch den bedeutenden Unterschied, den die Verheiratung in das Leben jedes Mädchens bringt, sondern hauptsächlich dadurch, daß sie sich plötzlich aus den glänzenden, geräuschvollen Räumen eines der ersten Höfe Europas und aus der unmittelbaren Nähe einer regierenden Monarchin in die Stille und Dunkelheit einer wohlhabenden, aber im Vergleich mit ihren frühern Gewohnheiten doch sehr beschränkten Haushaltung versetzt sah. Dennoch scheint dies so sehr mit den geheimen und lange genährten Wünschen ihres Herzens übereingestimmt zu haben, daß ich sie nicht allein dieser Epoche nie mit Trauer oder düsterer Erinnerung erwähnen hörte, wie man sonst wohl später sich an trübverlebte Stunden erinnert, sondern sie vielmehr mit Freude von dem Zeitpunkte sprach, wo sie endlich einer glänzenden und von vielen beneideten Sklaverei los ward und sich selbst angehören durfte. Es scheint, habe ich oben gesagt, denn ich war natürlicherweise keine Zeugin jener ersten Jahre der Verheiratung meiner Eltern, indem ich nicht einmal ihr erstes Kind war, und wie ich in die Jahre trat, wo Kinder etwas bemerken und beurteilen können, umgab meine Eltern schon wieder ein großer Glanz und eine Bemerktheit, welche meiner Mutter, wenn sie unmittelbar auf ihre Vermählung gefolgt wären, den Unterschied zwischen ihrem Hof-und häuslichen Leben weniger hätten fühlen lassen müssen.
Ich erblickte das Licht der Welt in einem Jahre mit dem merkwürdigsten Manne unserer Zeit, mit Napoleon, und um drei Wochen später als er. Oft hatte mir meine Mutter in frühern Jahren erzählt, daß damals (1769 ein sehr heißer Sommer gewesen und ein Komet am Himmel gestanden habe, den sie in den warmen Sommernächten, wo ihr beschwerlicher Zustand (sie trug Zwillinge) ihr wenig zu schlafen erlaubte, oft betrachtete. Späterhin erinnerte ich mich dieses Umstandes, und daß dieser Komet, wenn man ja zwischen der Erscheinung dieser himmlischen Körper und unsern irdischen Angelegenheiten einen Zusammenhang annehmen will, gar wohl auf die Geburt jenes furchtbaren Helden gedeutet werden könne. – Meine Mutter hatte, ganz gegen die damalige Sitte der Frauen in ansehnlicheren Familien, beschlossen, ihre Kinder selbst zu nähren und in jedem Sinne ihre Mutterpflichten zu erfüllen. Den ältesten Sohn hatte sie bereits gestillt und sich sehr wohl dabei befunden. Jetzt, wo sie und jedermann glaubte, daß sie zwei Kinder auf einmal haben würde, hatte sie Lust und fühlte sich stark genug, beide zu nähren. Sie kam stets viel nach Hofe und sah oft ihre kaiserliche Gebieterin, diese aber, die ihre ehemalige Dienerin noch immer mit huldreicher Sorgfalt betrachtete, verbot ihr ausdrücklich, mehr als ein Kind zugleich zu stillen, und so überließ meine Mutter die Wahl, welche ihr schwer gewesen sein würde, der Vorsicht, indem sie beschloß, das Erstgeborne selbst zu tränken. Das war nun zu meinem Glücke ich, und obwohl ich, wie man mir später erzählte, so klein und schwach auf die Welt kam, daß man, an meinem Leben verzweifelnd, mir die Nottaufe gab, so gedieh ich doch an meiner Mutter Brust zu einer solchen Fülle von Kraft und Gesundheit, daß ich noch bis jetzt, bereits eine Siebzigerin, von keiner eigentlichen Krankheit weiß und nie, selbst nicht im Wochenbette, länger als 6–7 Tage hintereinander im Bette bleiben mußte. Kein chirurgisches Instrument, nicht einmal eine Lanzette zum Aderlassen, hat meinen Leib berührt, und ich kann, kleine Unpäßlichkeiten und eine außerordentliche Reizbarkeit der Nerven und der Organisation überhaupt ausgenommen, welche sich in spätern Jahren offenbarte und mir große Behutsamkeit und Mäßigkeit zur Pflicht macht, sagen, daß ich stets vollkommen gesund war.
Mein Zwillingsbruder, ein starker, schöner Knabe, bekam eine Amme und starb noch vor dem ersten Jahre; denn die Amme wurde krank und verschwieg es. Auch mein älterer Bruder muß nicht lange nach meinem Erscheinen im elterlichen Hause gestorben sein, denn ich erinnere mich seiner durchaus nicht, obwohl mein Bewußtsein in einzelnen Bildern bis an mein drittes Lebensjahr reicht. Damals lebten jene zwei Kinder nicht mehr, aber ein viertes, auch ein Knabe, Franz Xav. mit Namen, wuchs neben mir empor. Ich wußte später, daß er um drei Jahre jünger sei als ich, und ich erinnere mich wohl, ihn noch auf dem Arm der Wärterin gesehen zu haben. Zwei Szenen aus jener frühen Zeit stehen auch noch einzeln vor mir und haben sich wie dämmernde Punkte in einer dunkeln Vergangenheit erhalten. Eines Morgens, es war ein Sonnabend, saß ich in meiner Eltern Schlafzimmer auf einem Schemelchen zu meiner Mutter Füßen, als mein Vater eintrat und ihr seine Erhebung zur Hofratsstelle ankündigte. Gewiß war dies Ereignis meinen Eltern sehr wichtig, und die Bewegungen, welche es im Hause verursacht haben mag, werden die Ursache sein, warum eine Veränderung unserer Lage, mit der ich damals, im 3. bis 4. Lebensjahre, gar keinen Begriff verbinden konnte, so bleibenden Eindruck auf mich gemacht hat. Das zweite Ereignis war verschiedener Art. – Ich stand im Zimmer meiner Großmutter, welche das Haus bewohnte, das an das unsrige stieß, und deren Wohnung, weil beide Häuser ihr eigentümlich gehörten, durch eine Kommunikationstüre mit der unsrigen zusammenhing; – da trat der Bediente mit erschrockener Miene in das Zimmer der alten Frau (ich sehe sein Gesicht noch, er diente meinem Vater noch viele Jahre darnach) und erzählte, daß er eben von den »obern Jesuiten« käme: Da sieht es aus! rief der alte Jakob, die Aufhebung ist da, die kaiserlichen Kommissarien sind eben gekommen. Diese Nachricht war nun freilich für meine Großmutter, wie für sehr viele Menschen in jener Zeit, ein Donnerschlag; sie hatte einen Jesuiten zum Beichtvater, war überhaupt eine sehr fromme Frau und nach den Begriffen jener Zeit der Geistlichkeit sehr ergeben. Auch bei dieser Begebenheit muß das Betragen der Umstehenden den Eindruck auf mich gemacht haben, den eine Nachricht an sich nicht hätte hervorbringen können, von deren Wichtigkeit ich nichts verstand – und diese Szene wie die vorhergehende meinem Gedächtnis eingeprägt haben.
*
Ich war ein sehr lebhaftes, munteres Kind – oft wurde mir gesagt, daß ich besser zum Knaben getaugt hätte, und ich erinnere mich mancher Ermahnungen, mancher beschämenden Auftritte, wo diese unbesorgte Lebhaftigkeit mich zu Übereilungen hingerissen oder zu einem Betragen getrieben hatte, das für ein Mädchen viel zu wild und entschieden war. Drei Jahre voraus und jene natürliche Unstetigkeit und Heftigkeit gaben mir lange Zeit ein großes Übergewicht über den jüngern und sanftern Bruder. Ich lernte leicht, faßte schnell, hatte ein vortreffliches Gedächtnis, lauter Naturgaben, um die ich kein Verdienst hatte – an welchen ich aber meinen Bruder übertraf, der mit einem, wie es sich später wohl zeigte, viel richtigerm Verstande eine etwas langsamere Fassungskraft verband. Mir ward jene Leichtigkeit oft schädlich. – Ich lernte höchst ungern. – Auf einem Stuhle sitzen, acht geben und mit einerlei Gegenstand mich beschäftigen, das alles waren mir unerträgliche Dinge. So benützte ich jene Fassungskraft und mein gutes Gedächtnis, nahm mein Spielzeug oder ein Märchenbuch mit zur Lektion, hörte, während ich spielte oder las, mit halbem Ohr auf das, was der Lehrer erklärte und fertigte ihn, wenn er mir meine sehr ungehörige Spiellust verweisen oder die Gerätschaften derselben wegnehmen wollte, damit ab, daß ich ihm genau wiederholte, was er soeben gesprochen und auf diese Art meine Lektion doch zu wissen schien. – Freilich war es nur ein Schein und kein rechtes Erkennen, ich hatte es aber einmal dahin gebracht, beim Lernen spielen zu dürfen und ließ mir dies Vorrecht nicht nehmen. Noch erinnere ich mich eines Verses – des ersten, den ich in meinem Leben gemacht, den meine Ungeduld bei der Lehrstunde mir eingegeben. – – Die Stunde war von 12–1 Uhr, und meine Sehnsucht und Aufmerksamkeit viel mehr auf die Uhr als auf das Lernen gerichtet. – In dieser Stimmung setzte ich mir folgende Reime im Geiste zusammen:
Ührchen, Ührchen, geh' geschwind,
Mach', daß bald der Sand verrinnt,
Laß den Sand verrinnen,
Laß Ein Uhr beginnen,
Ührchen, Ührchen, geh' geschwind.
Doch nicht bei jedem meiner Lehrer ging dies mutwillige Spiel an. Ich hatte deren einige, welche auch sonst noch in der Welt, besonders der literarischen, ausgezeichnet waren, und ich freue mich jetzt, nach mehr als einem halben Jahrhundert ungefähr, von diesen Männern sprechen und ihnen meinen Dank bezeigen zu können. Als ich mein sechstes Jahr erreicht hatte, wurde ich, zum Unterricht in der Religion, der Leitung des damaligen Katecheten an der Normalschule, Josef Gall2, übergeben, der späterhin Pfarrer, dann Domherr, Oberaufseher der Schulen und endlich im Jahre 1788 Bischof in Linz wurde. Noch jetzt lebt das Andenken dieses, als Mensch, Priester, Pädagog und Kirchenoberhaupt gleich würdigen Mannes, in vielen Herzen, besonders der Oberösterreicher, welche unter seinem Hirtenamte ihre Schulen ungemein verbessert, die Pfarreien mit würdigen Männern besetzt und im ganzen Lande, dessen einzelne Teile der wahrhaft apostolische Bischof abwechselnd jährlich in den Visitationen durchreiste, echte Gottesfurcht und Sittlichkeit verbreitet sahen. Dieser vortreffliche Mann war mein Lehrer in der Religion, zu welchem Unterrichte er späterhin den in der Naturgeschichte und Naturlehre fügte, zwei Zweige der Belehrung, die für ein gottesfürchtiges wie für ein kindliches Gemüt sich gar wohl und erbauend an den Religionsunterricht schließen lassen, was denn Gall auch tat. Bei seinen Lektionen war keine Rede von Spielerei, und doch war er nichts weniger als streng, vielmehr heiter, gelassen und überaus gütig gegen seine Untergebenen, denen er bald mit Erzählung interessanter Geschichten oder natürlicher Erscheinungen oder mit dem Geschenke eines nützlichen Buches Freude zu machen und überhaupt ihre Liebe und Ehrfurcht in gleichem Grade zu erwerben wußte.
Ein zweiter, ebenfalls nicht unberühmter Mann war mein Klaviermeister Steffann, ein Böhme von Geburt, der ebenfalls in dieser Eigenschaft als Klavierlehrer früher die kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen unterrichtet hatte. Steffann komponierte mit Glück, seine drei Sammlungen von deutschen Liedern machten damals (vor 50–52 Jahren) Epoche und brachen dem einfachen deutschen Gesange so zusagen eine neue Bahn. Steffann war ein humoristischer, ganz eigener Mensch, der zu den Wunderlichkeiten, welche bei Künstlern und besonders Musikern gewöhnlich sind, noch einige besondere fügte. Aber er verstand seine Kunst gründlich und hatte einen unerschöpflichen Fond von guter Laune. So imponierte er mir nicht durch sittliche Würde wie Gall, aber er flößte mir Achtung ein und wußte durch Güte und Ernst, durch Späße und Verweise meine Aufmerksamkeit zu fesseln. Mir fiel es nicht ein, zu spielen oder etwas anderes zu sinnen, solange die Lektion dauerte, und ich galt auch bald für eine seiner besten Schülerinnen, obgleich Musik eigentlich meinem Geiste nicht zusagte, der sich mehr in klaren Vorstellungen als in unbestimmten Anregungen gefiel und dessen Anlagen und Natur mich von jeher die Malerei der Musik hatten vorziehen lassen.
Ich bekam auch Unterricht im Zeichnen, aber hier war die Wahl meines Lehrers nicht glücklich. Der Mann war unstreitig sehr geschickt in seinem Fache, welches Baukunst und Blumenzeichnung war, beides aber, besonders das erste, sprach mich ganz und gar nicht an. Dieses Handhaben des Zirkels und Lineals, diese Unausweichbarkeit der Formen, diese Beschränkung aller Phantasie und Willkür war meinem überaus unsteten, lebhaften Wesen entgegen. Besser freuten mich die Blumen; hier war der Erfindung, der Freiheit zu ändern, doch einiger Raum gegönnt; aber mich hätte die Landschaftszeichnung am meisten angezogen, und diese verstand mein Lehrer nicht, und die Anleitung, welche er mir nach Büchern geben wollte, schlug nicht an; denn sie war nicht lebendig und wahr.
Späterhin wurde es mir klar, warum dieser Unterricht und dieser Meister gewählt worden waren. – Meine Eltern und einige verständige Freunde derselben, denen meine zweckmäßige Ausbildung am Herzen lag, fanden, daß mein allzu lebhafter und unsteter Geist, sowie meine Phantasie, welche schon die Schwingen zu regen begann, des Zaums und Gegengewichts einer ernsten, zu gründlichem Denken und anhaltender Aufmerksamkeit führenden Beschäftigung bedürfe. Jener Lehrer war zugleich auch Professor der Mathematik. Er sollte mich nebst dem Zeichnen nach seiner Art auch Geometrie lehren; – nicht damit ich einst Mathematik verstehen und damit prunken könne, sondern damit ich richtig denken, schließen und die schwärmende Einbildungskraft zügeln lerne. Daß dieser Unterricht nicht nach meinem Geschmacke war, wird man nach dem Vorhergehenden wohl leicht ermessen; indessen war er mir doch heilsam, und erleichterte mir späterhin das Begreifen, sowie das Durchdringen und Ordnen manches schwerer verständlichen Buches oder Vortrags.
Es wird hier passend sein, etwas von den Freunden, welche das Haus meiner Eltern besuchten, sowie von der innern Einrichtung dieses Hauses und seinen äußeren Verhältnissen zu sagen, weil alles dies unmerklichen, aber steten und daher bedeutenden Einfluß auf die Bildung und Richtung meines Innern hatte.
Meines Vaters ausgezeichnete Geistesgaben, seine strenge Redlichkeit, sein Eifer, sein unermüdeter Fleiß hatten bald nach seiner Verheiratung die Aufmerksamkeit der Monarchin auf den Gemahl ihrer Vorleserin, der zugleich einer der tüchtigsten Beamten war, gelenkt. Sie erhob ihn zur Stelle eines Hofrates und geheimen Referendars, schenkte ihm viel Vertrauen, sah ihn oft, ließ sich von ihm in Privataudienzen wichtige Dinge vortragen und hörte seine Meinung, seinen Rat, zuweilen auch, wenn es die Umstände geboten, seinen Widerspruch mit Zutrauen und Geduld. Noch besitzen wir in unserer Familie einen Schatz von einzelnen Blättern, auf welchen von meines Vaters Hand Vorträge, Anfragen, Gutachten geschrieben sind, wie er sie der Monarchin vorlegen mußte und auf welche sie dann eigenhändig eine Antwort, Entscheidung, Entschließung usw. schrieb. Sie stellen ein Verhältnis des Staatsbeamten zu seiner Monarchin, und zugleich des innigstergebenen Dieners und Freundes zu seiner huldreichen Fürstin dar, das ebenso würdig als zart, ebenso rührend als erhebend ist und wovon ich im Verlauf einige Proben geben werde, welche gewiß dazu beitragen, den Charakter der großen Maria Theresia in seinem schönsten Lichte zu zeigen.
Diese Gunst der Monarchin verbreitete einen bedeutenden Glanz über unser Haus, welches durch die (für jene Zeit) beträchtliche Besoldung eines kaiserlichen Hofrates und das eigene Vermögen meines Vaters auf einem sehr hübschen Fuß eingerichtet war. Damals genossen die kaiserlichen Beamten, welche bei Hofstellen dienten, noch der sehr wichtigen Wohltat der freien oder Hofquartiere. So wie mein Vater also Hofrat ward, konnte er auch Anspruch auf eine freie Wohnung machen, da ihm ohnedies die in seinem eigenen oder seiner Mutter Haus »im tiefen Graben« zu klein geworden war. Es war wahrscheinlich 1775 oder 1776, daß wir die Wohnung, in der meine Geschwister und ich geboren worden, gegen eine stattlichere und viel geräumigere im Hause zum großen Christoph vertauschten, welches jetzt freilich ein ganz anderes Ansehen hat als damals, wo es, nur einen Stock hoch, mit eisernen Gittern vor allen Fenstern, einem hölzernen Kommunikationsgang im Hofe, einer freien, unbedeckten Treppe usw. im Äußern und Innern einer alten Schloßruine ähnlicher sah als einem Wohnhause in Wien. Doch der Zimmer waren viel, sie waren hoch, groß und stattlich, und damals hatte man von vielen Bequemlichkeiten und Bedürfnissen, die jetzt in jeder Wohnung gefordert werden, keinen Begriff. Auch waren die Menschen stärker und gesünder. Luftzug, kalte Gänge, die zu passieren waren, Fenster oder Türen, die nicht allzu wohl schlossen, hier und da eine feuchte Wand usw. wurden nicht geachtet und, weil sie keinen schädlichen Einfluß hatten, kaum bemerkt. Ich weiß, daß meine Eltern ganz zufrieden mit ihrer Wohnung waren. Die großen Zimmer, welche Sälen glichen, boten ihnen ein gewünschtes Lokal für die Bildersammlung meines Großvaters und für die zahlreichen Gesellschaften, welche sich in unserm Hause zu versammeln anfingen. Hier wurde ein Theater errichtet, worauf wir Kinder kleine französische Stücke: Zeneïde ou la fée und L'isle déserte, nebst einer kleinen deutschen Idylle aufführten, welche Herr von Ratschky (wenn ich nicht irre) nach dem Programm des niedlichen Noverreschen Ballettes: Blanc et rose geschrieben. In allen diesen Stücken wurden mir die muntern, mutwilligen Rollen zugeteilt; – es war mir damals nicht möglich, tiefe oder warme Empfindung zu zeigen, so wenig als später, als wir dreizehn, vierzehn Jahre darauf ebenfalls diese Art geselliger Unterhaltung versuchten.
Auch große Musiken wurden gegeben, und obwohl ich ein ganz winziges Geschöpf von etwa 7–8 Jahren war, ließ mein Vater mich doch kleine Konzerte, die mein Klaviermeister Steffann eigens für mich komponierte, mit vollem Orchester produzieren. Natürlich wurde das Kind, die Tochter vom Hause, beklatscht, belobt, bewundert, und ich hielt mich bald für eine bedeutende Künstlerin.
Um diese Zeit erregte eine Erscheinung, welche sich auch später, und in unsern Tagen oft wiederholt hat, das erstemal ungeheures Aufsehen in Wien. Es war dies der Magnetismus oder eigentlich Mesmerismus; denn Dr. Mesmer war es, der, damals ein schöner, kräftiger, junger Mann (die meisten Magnetiseure, die ich kennen gelernt, vereinten diese Eigenschaften) seine Kunst durch die Wiederherstellung des Augenlichts bei dem blinden Fräulein von Paradis zeigen wollte. Fräulein Therese von Paradis war damals ein Mädchen von 17–18 Jahren, nicht hübsch, aber voll Geist, Herzensgüte und Talent, besonders für Musik, was denn, mit ihrem Unglück zusammengenommen, ihr eine sehr anziehende Persönlichkeit gab, und ihr auch noch in späteren Jahren die Achtung und Liebe aller derjenigen erwarb, welche zu dem engeren Kreise ihrer Freunde gehörten, und unter welche auch ich mich zählen durfte.