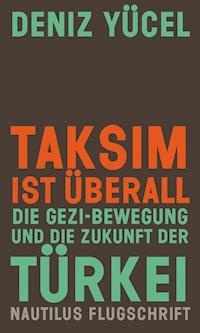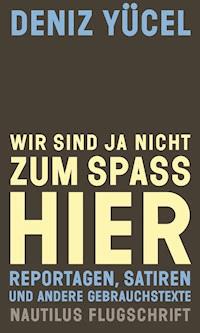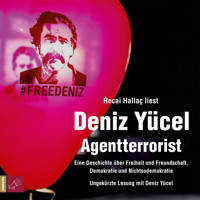9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Jahr Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9. »Niemals« werde man Deniz Yücel nach Deutschland ausliefern, erklärte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan im Frühjahr 2017, jedenfalls nicht, solange er im Amt sei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der deutsch-türkische Journalist seit zwei Monaten im Hochsicherheitsgefängnis bei Istanbul. Zehn Monate später wurde er unter abenteuerlichen Umständen endlich freigelassen. Die Inhaftierung des Türkei-Korrespondenten führte zu einer riesigen Solidaritätsbewegung und sorgte für die größte Belastung der deutsch-türkischen Beziehung seit dem Zweiten Weltkrieg. In seinem Buch erzählt Yücel, wie er dieses Jahr in Einzelhaft verbrachte, welchen Schikanen er ausgesetzt war, wie es ihm gelang, die Überwachung zu überlisten, was ihm die Unterstützung seiner Frau Dilek Mayatürk und die »Free Deniz«-Kampagne bedeutete und warum der Kühlschrank das sicherste Versteck in der Gefängniszelle ist. Zugleich zeichnet er die Entwicklung der Türkei in den vergangenen Jahren nach, vom Aufbruch der Gezi-Revolte über den Kurdenkonflikt, die Flüchtlingskrise und den Putschversuch bis zum vorläufigen Ende: Erdoğans erneutem Wahlsieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Deniz Yücel
Agentterrorist
Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Deniz Yücel
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Deniz Yücel
Deniz Yücel wurde 1973 als Kind türkischer Einwanderer in Flörsheim am Main geboren und studierte an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft. Er arbeitete als Redakteur bei der Wochenzeitung Jungle World und der tageszeitung. 2015 ging er als Korrespondent der Welt in die Türkei. Für seine Arbeit wurde Yücel mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik. Nach Taksim ist überall (2014/17) und Wir sind ja nicht zum Spaß hier (2018) ist Agentterrorist sein drittes Buch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Niemals« werde man Deniz Yücel ausliefern, erklärte der türkische Staatspräsident Erdogan im Frühjahr 2017, jedenfalls nicht, solange er im Amt sei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Journalist bereits im Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9. Zehn Monate später erhielt er ein Angebot zu seiner Freilassung – und lehnte ab. Die Inhaftierung des Korrespondenten der Welt führte in Deutschland zu einer beispiellosen Solidaritätsbewegung und sorgte für eine schwere diplomatische Krise. Yücel erzählt von seinem Jahr im Gefängnis, von Einzelhaft und Folter. Und davon, wie er durch die Liebe seiner Frau und dank der Unterstützung seiner Anwälte, seiner Zeitung und der »Free Deniz«-Kampagne noch unter widrigsten Umständen um Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen konnte – und dabei die Bundesregierung, seine Vertrauten und schließlich sogar seine Geiselnehmer an den Rand der Verzweiflung trieb. Deniz Yücel schreibt sehr persönlich, kämpferisch und humorvoll darüber, wie man ins Geschehen eingreifen kann, wenn man zum Spielball der internationalen Politik geworden ist.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Ein Angebot, das ich nicht ablehnen soll
Traumjob mit Handicaps
Ein paar E-Mails
Bei Tayyip um die Hecke
»Wir haben Sie schon erwartet«
Kennst du den, Herr Staatsanwalt?
Sittich in Gangsterhand
Block B, Reihe 6, Zelle 54
Beste Kampagne wo gibt (und mieseste)
So von Erpresser zu Erpresser
Von schweren Tagen und wie wir sie leichter machen
Für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung
Unter Folter
Unter Freunden
Danach
Und danach
Dank
Chronologie
Abkürzungsverzeichnis
Für meinen Vater
Ziya Yücel
Ein Angebot, das ich nicht ablehnen soll
»Nein, ich kann das nicht machen. Ich kann diese Bedingungen nicht akzeptieren. Ich hoffe, du verstehst das«, sage ich zu meiner Frau, Dilek Mayatürk.
Es ist Donnerstag, der 15. Februar 2018, gegen 19 Uhr. Wir sitzen in einer Besucherkabine, zwischen uns eine fingerdicke Glasscheibe. Reden können wir nur über die Sprechanlage. Es ist wie telefonieren, nur dass man sich dabei sieht, ohne sich berühren zu können.
Dilek hat für dieses Gespräch eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Das ist ihr zweiter Besuch in dieser Woche, eigentlich ist unsere feste Besuchszeit montags zwischen neun und zehn Uhr vormittags. Zwei Besuche innerhalb einer Woche sind sonst unvorstellbar. Und um diese Uhrzeit finden normalerweise gar keine Besuche statt. Aber normal ist an diesem Abend im Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9 so manches nicht.
Dabei hat dieser im Jahr 2008 eröffnete Knastkomplex in seiner recht kurzen Geschichte schon einiges erlebt. Während der Prozesse gegen die angebliche Putschistenorganisation Ergenekon und den Folgeverfahren saßen hier führende Militärs, von 2012 bis 2014 auch der vormalige Generalstabschef Ilker Başbuğ. Und erst vor ein paar Tagen sah ich beim Gespräch mit meinem Rechtsanwalt Veysel Ok in der Kabine nebenan Hüseyin Avni Mutlu. Während der Gezi-Proteste im Frühjahr 2013 war er Gouverneur von Istanbul und damit Dienstherr der Polizei und des hiesigen Wachpersonals. Nun ist er Insasse dieses Gefängnisses.
Nach dem Putschversuch vom Juli 2016 wurde Mutlu, so wie Tausende andere Beamte, unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der Organisation des islamischen Predigers Fethullah Gülen verhaftet. Außerdem sind oder waren bis vor Kurzem hier eingesperrt: Politikerinnen und Politiker der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP), liberale Intellektuelle wie Ahmet Altan oder Şahin Alpay, linke Journalisten wie Ahmet Şık, Murat Sabuncu und andere Mitarbeiter der Tageszeitung Cumhuriyet. »In Silivri sitzt heute das Istanbul, das es nicht mehr gibt. Dort triffst du mehr Journalisten und Intellektuelle als in Beyoğlu«, sagen Oppositionelle. »Wir sind ein VIP-Gefängnis«, sagen die Aufseher mit hörbarem Stolz. »VIP-Knast« bedeutet irgendwie auch: »VIP-Aufseher«.
Am Tag vor Dileks überraschendem Besuch, am Mittwoch, dem 14. Februar, haben wir das einjährige Jubiläum meiner Festnahme gefeiert. Ich still in Silivri, der Freundeskreis FreeDeniz laut mit einem Autokorso in Berlin, mit roten Ballonherzen, welche die Teilnehmer an ihre Autos und Fahrräder banden. Eine Idee meiner Berliner Freundin Maria Triandafillidu. War ja Valentinstag. Abends wurde im Festsaal Kreuzberg mein Buch Wir sind ja nicht zum Spaß hier vorgestellt, eine Sammlung aus überarbeiteten alten und einigen neuen Texten. Der Herausgeberin, meiner besten Freundin Doris Akrap, und mir war es gelungen, die Briefzensur auszutricksen und an den Texten zu arbeiten. Nun erwiesen mir Hanna Schygulla, Herbert Grönemeyer, Anne Will und viele andere die Ehre, aus dem Buch zu lesen, dazu spielten Künstler wie Igor Levit oder Aynur.
Zur selben Stunde sendete die ARD ein Interview, das die Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım geführt hatte. Gleich zum Einstieg fragte Atalay: »Seit genau einem Jahr ist Deniz Yücel im Gefängnis. Wann kommt er frei?« Atalay begann mit dieser Frage, obwohl sie vermutete, was Yıldırım antworten würde: dass die Ermittlungen andauerten, dass die Regierung die Entscheidungen der Gerichte nicht beeinflussen könne, dass die türkische Justiz unabhängig sei, solche Sachen halt. Ungefähr so klang es zuvor bei Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und anderen Regierungspolitikern. Nur Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte sich gleich selber zum Ankläger aufgeschwungen und mich mehrfach als »Agentterrorist« beschimpft. Im türkischen Original ajan terörist, mit zischender Betonung auf der letzten Silbe.
Yıldırım aber griff nicht auf die gewohnten Phrasen zurück. Stattdessen sagte er: »Ich hoffe, dass er in kurzer Zeit freigelassen wird. Ich bin der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird.« Auf die Nachfrage der sichtlich überraschten Journalistin, wie er zu dieser Einschätzung komme, fügte der Ministerpräsident hinzu: »Zumindest wird er vor Gericht kommen. Und jede Verhandlung ist eine Chance, damit er freikommt.«
»Mir schien, als habe Yıldırım auf diese Frage nur gewartet«, erzählte mir später Cemal Taşdan, ein langjähriger Mitarbeiter des ARD-Studios Istanbul, der bei dem Interview in Yıldırıms Heimatstadt Erzincan dabei war. Yıldırıms Sprecher hingegen meinte danach zu Pinar Atalay: »Jetzt haben Sie schon wieder die Hälfte der Zeit mit diesem Jungen verbracht.«
Diese Kommentare bestätigen einen Eindruck, der bei mir in den vorangegangenen Wochen und Monaten entstanden war: Die türkische Regierung wollte ihre Beziehungen zu Deutschland wieder verbessern. Das aber war nicht möglich, solange ich in Haft saß. So mehrten sich seit Mitte Oktober 2017 Anzeichen dafür, dass ich in absehbarer Zeit freikommen würde; erst zaghaft und unbestimmt, dann immer deutlicher. Das schönste dieser Anzeichen: Anfang Dezember wurde nach neun Monaten die Einzelhaft aufgehoben. In meiner neuen Zelle saß ich weiterhin allein, teilte mir nun aber tagsüber einen Hof mit dem Fernsehjournalisten Oğuz Usluer.
Von den Gesprächen, die der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in meiner Angelegenheit mit Staatspräsident Erdoğan geführt hatte, sollte ich erst viel später erfahren. Doch auch so war es offensichtlich, dass man sich dazu entschlossen hatte, am Tag vor Yıldırıms Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel eine baldige Lösung in Aussicht zu stellen. Dieses Interview gab mir die letzte Gewissheit: Das hier ist bald vorbei.
»Für den Verkauf deines Buches wäre es besser, wenn sie dich noch ein bisschen hierbehalten würden«, witzelte Oğuz, als am Mittwochnachmittag das Yıldırım-Zitat als Vorabmeldung im türkischen Fernsehen lief. Und am Donnerstagmorgen, bei der Zustellung meiner Tageszeitungen, war der zuständige Wärter mit den stahlblauen Augen, einer der freundlichsten unter den Wachleuten, noch fröhlicher als sonst: »Sie kommen bald frei, ganz sicher«, rief er, als er mir den Zeitungsstapel durch die Klappe in der Zellentür reichte.
Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern, bis die Staatsanwaltschaft endlich ihre Anklageschrift vorlegte. Vermutlich würde das Gericht die Anklageschrift zügig annehmen und mich mit der Annahme der Anklageschrift auf freien Fuß setzen. Und wahrscheinlich würde man den Verhandlungstermin möglichst weit in die Zukunft legen, vielleicht in vier, fünf Monaten, in der Hoffnung, dass das Verfahren dann weniger Aufmerksamkeit erregen würde. Ganz sicher würde man, so wie bei der deutsch-türkischen Journalistin Meşale Tolu und fast allen entlassenen politischen Gefangenen, zunächst ein Ausreiseverbot erlassen.
Und man würde, jede Wette, ein, zwei Wochen warten. Aber was waren schon zwei Wochen? Zweimal Bestellungen im Knastladen. Zweimal Wäschetag. Oder einmal mit Dilek telefonieren. »Nachdem ich 27 Jahre gewartet hätte, könne ich ohne Weiteres noch einmal sieben Tage warten«, erinnert sich Nelson Mandela in seiner Autobiografie Der lange Weg zur Freiheit an das Gespräch, in dem er das Angebot der südafrikanischen Apartheidregierung zu seiner sofortigen Freilassung abgelehnt hatte. Nun ist Zeit absitzen in Silivri nicht das Gleiche wie Steine klopfen auf Robben Island und ein halbes Leben im Gefängnis zu verbringen nicht das Gleiche wie gerade einmal ein Jahr eingesperrt zu sein. Doch das genügt bereits, um zu lernen, dass zwei Wochen ein Wimpernschlag sein können. Die Karenzzeit, die sich die türkischen Machthaber nehmen würden, um den Schein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren, würde jedenfalls im Nu vergehen.
Am Donnerstagvormittag wurde ich zum Anwaltsgespräch gerufen. Donnerstag war Refik-Tag. Refik Türkoğlu war ein adretter Rechtsanwalt von 64 Jahren, der beinah sein ganzes Berufsleben lang das deutsche Konsulat in Istanbul vertreten hatte. Mit seinen perfekt sitzenden Anzügen und den stets passenden Krawatten, Hosenträgern und Brillengestellen wirkte er bei seinen Besuchen so, als hätte er auf dem Weg zum Dinner mit einer russischen Fürstin die falsche Ausfahrt genommen und wäre aus Versehen an der Frittenbude am Schrottplatz gelandet. Doch Refik war nicht nur Gentleman, er hatte auch eine Mischung aus Lausbübischem und Altväterlichem, was ihm half, diese Situation zu meistern. Trotz der langen Fahrt aus der Stadtmitte und der vielen Sicherheitskontrollen schaffte er es stets, um zehn Uhr in der Gesprächskabine zu sitzen. Danach konnte man die Uhr stellen. Und wenn es donnerstags mal später wurde, dann nur, weil er sich durch eine seiner jungen Mitarbeiterinnen vertreten ließ, die sehr nett, aber nicht ganz so perfekt organisiert waren.
Die Treffen mit den Anwälten fanden in rundherum verglasten Kabinen von jeweils fünf Quadratmetern statt. Das Interieur: zwei Gartenstühle aus Plastik auf der Seite der Anwälte, einer auf der Seite der Gefangenen. Dazwischen keine Trennschreibe, sondern nur ein bauchhohes Pult aus Sperrholz. So einladend wie eine Raucherzelle im Flughafen, in der man nicht mal rauchen darf. Für mich aber das Tor zur Welt.
Doch an diesem Donnerstag wurde ich erst mittags zum Anwaltsgespräch gebracht. Und auf der anderen Seite des Pults wartete nicht Refik oder jemand aus seinem Team, sondern Veysel Ok, mein Hauptverteidiger.
Veysel war 34 Jahre alt und stammte aus dem kurdischen Diyarbakır, was man seinem Akzent anhörte. Ein schlaksiger, gut aussehender Lederjacken-Typ, der sich trotz seiner jungen Jahre einen Namen als Medienanwalt gemacht hatte. Gleich an mehreren Verfahren gegen bekannte Journalisten war er beteiligt; die Klagen der Brüder Ahmet und Mehmet Altan und einige weitere Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in denen es um Meinungs- und Pressefreiheit ging, trugen seine Handschrift.
Neben seiner fachlichen Qualifikation zeichnete Veysel noch etwas aus: eine unglaubliche Gelassenheit. Bei allen Konflikten, die ich mit den engsten Menschen um mich herum gelegentlich hatte – am häufigsten mit Dilek, manchmal mit meinem Chefredakteur Ulf Poschardt und dem Welt-Kollegen Daniel-Dylan Böhmer, seltener mit meiner Schwester Ilkay Yücel oder Doris Akrap und Imran Ayata vom Freundeskreis –, versuchte Veysel stets, Druck von mir fernzuhalten und zu vermitteln.
Derlei Konflikte sind in einer solchen Extremsituation fast unausweichlich; soweit ich die Geschichten der türkischen Kollegen besser kenne, die in derselben Zeit inhaftiert waren, stritten sich alle immer wieder mit ihren Leuten, manche auch mit ihren Anwälten: über die Verteidigungsstrategie, über das Leben danach, über irgendwelchen Kram.
Natürlich hatte Veysel es auch leichter. Dilek sah ich nur eine Stunde in der Woche, die anderen gar nicht. Mit Veysel hingegen saßen wir manchmal vier, fünf Stunden am Stück auf engstem Raum zusammen. Er wusste am besten, was ich dachte und wie es mir ging, und wir mussten nicht befürchten, dass wir abgehört werden. Selbst die schlimmsten Neuigkeiten erzählte er in Ruhe, oft mit Witz und stets mit Blick auf den nächsten und übernächsten Schritt. Kurz: Auf Veysel konnte ich mich immer verlassen.
Doch an diesem Donnerstag war er so aufgewühlt, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. »Da läuft etwas«, erzählte er. »Das deutsche Konsulat hat gestern Nacht Dilek angerufen und ihr gesagt, dass sie sich heute früh bereit machen soll. Sie sollte sogar ihren Reisepass mitnehmen.« Dilek sei schon am frühen Morgen mit dem stellvertretenden Generalkonsul Stefan Graf nach Silivri aufgebrochen. Ihn hätten sie erst verständigt, nachdem Dilek mit Außenminister Gabriel gesprochen habe. Dilek und Graf würden draußen warten, vielleicht würde später noch Generalkonsul Georg Birgelen kommen. Der hatte mich bei dieser Geschichte von Anfang begleitet und mich regelmäßig in Silivri besucht. Derzeit befinde sich Birgelen mit seiner Frau Sibylle im Skiurlaub in Österreich, sei aber von Gabriel angewiesen worden, sofort nach Istanbul zu fliegen.
Die Prognosen, zu denen ich nach dem Yıldırım-Interview vom Vortag gelangt war, waren also obsolet. Als Journalist ist man darin geübt, politische Voraussagen abzugeben. Mal liegt man richtig, mal nicht. Im vergangenen Jahr musste ich mich daran gewöhnen, Prognosen in eigener Sache abzugeben. Da war jeder Irrtum schmerzlicher. Jetzt hatte ich mich wieder geirrt, wenngleich zu meinen Gunsten. So viel hatte ich verstanden. Aber was genau war los?
Veysel wusste es auch nicht. »Es könnte sein, dass du heute noch vor Gericht erscheinen musst«, sagte er. »Und wie es aussieht, könnten sie dich freilassen. Aber vielleicht musst du dann sofort ausreisen. Gleich kommt Graf, der weiß mehr.«
Der stellvertretende Generalkonsul hatte kurzfristig eine Besuchserlaubnis erhalten. Das allein genügte, um zu begreifen, dass die türkische Staatsführung eingeschaltet war. Denn ich wusste, dass Birgelen unmittelbar nach jedem Treffen mit mir seinen nächsten Besuch beantragte – für einen Termin in vier Wochen. Manchmal ließ das Justizministerium diese Frist verstreichen. Nun hatte man über Nacht eine Genehmigung erteilt.
Mit Stefan Graf hatte ich vorher einige Male zu tun gehabt, kannte ihn aber nicht so gut. Ein freundlicher Mann Anfang 60, der zuvor als deutscher Botschafter in Gabun gedient hatte und sich, so schien es mir, erst daran gewöhnen musste, dass das bilaterale Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei um einiges mehr im öffentlichen Licht stand.
Meine Treffen mit den Diplomaten fanden in einem kleinen Büroraum gleich neben der stählernen Drehtür statt, durch die Besucher und Anwälte das Gefängnis betreten – ein Bereich, der Gefangenen sonst verschlossen ist. Ein schwerer Schreibtisch, ein Bürosessel, zwei einfache Metallstühle. Auch dieser Raum hatte eine große Glasscheibe, aber immerhin war diese abgedunkelt. Für andere Zwecke schien dieser Raum nicht genutzt zu werden. Wenn ich mit dem Generalkonsul, einige Male auch mit dem aus Ankara angereisten deutschen Botschafter Martin Erdmann, hier saß, kam uns der Gedanke, dass wir abgehört werden könnten. Vielleicht war das Paranoia. Doch wenn wir sehr vertrauliche Informationen austauschten, schrieben wir diese sicherheitshalber auf einen Zettel oder sprachen nur in Andeutungen.
Vom Treffen mit Veysel brachte mich ein Aufseher in diesen Raum. Die Übersetzerin, die die Diplomaten sonst begleitete, war diesmal draußen geblieben. Drinnen saß nur Stefan Graf. Er war nervös. »Sie können sofort raus«, sagte er. »Aber es könnte sein, dass Sie sofort das Land verlassen müssen. Die Bundesregierung steht mit der türkischen Seite in Kontakt. Und sie wird Ihnen ein Flugzeug schicken.«
Ich verstand immer noch nicht. Wer forderte, dass ich sofort ausreise? Die Bundesregierung? »Nein.« Die türkische Regierung? »Auch nicht.« Aber wer dann? Und warum? Und war das eine Bedingung für meine Freilassung? »Es könnten Umstände entstehen, dass Sie das Land verlassen müssen.« Hä, bitte was?
So ging das vielleicht 20 Minuten lang. War Graf selber nur halb im Bilde oder versuchte er – wenngleich etwas ungeschickt – mich langsam an eine Wahrheit zu gewöhnen, von der er vermutete, dass sie mir unangenehm sein musste?
Inzwischen war es gegen 15 Uhr nachmittags, in wenigen Stunden würden Yıldırım und Merkel in Berlin ihre Pressekonferenz abgeben. »Es könnte sein, dass die türkische Seite auf Ihrer sofortigen Ausreise besteht«, sagte Graf schließlich. So war das also: meine Freilassung als Gastgeschenk. Tolle Idee. »Ich habe die Anweisung, Sie hier rauszuholen und zum Flughafen zu bringen«, fuhr Graf fort. Es war sein erster eindeutiger Satz – und der Moment, an dem die ganze Aufregung aus mir herausplatzte: »Der Außenminister ist nicht mein Dienstherr!«, rief ich.
In den letzten Jahren war es in der Türkei zu einer Art Volkssport geworden, Botschafter anderer Länder einzubestellen – ein Zeichen dafür, wie sehr sich diese Regierung international isoliert hatte, und zugleich, wie sehr sie auf Krawall gebürstet war. Unangefochtener Spitzenreiter auf der Liste der Einbestellungen war die deutsche Botschaft in Ankara. Zwischen März 2016 und Oktober 2017 wurden der Botschafter Martin Erdmann bzw. sein Stellvertreter Robert Dölger ganze 18 Mal ins türkische Außenministerium bestellt, im Schnitt fast einmal im Monat. Manchmal trank man dabei freundlich einen Tee und übermittelte die Protestnote quasi nebenbei, manchmal wurde es richtig laut.
An diesem Februarnachmittag in Silivri war es nun ich, der sich im neuen türkischen Volkssport Diplomaten-Anpflaumen übte. Nach meinem ersten Ausfall hielt ich inne: »Herr Graf, Sie haben mir in schwierigen Situationen geholfen, darum tut mir das hier sehr leid. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich«, sagte ich leiser, aber mit immer noch bebender Stimme. »Aber Sie können gerne nicht nur den Wortlaut, sondern auch die Tonlage nach Berlin übermitteln.«
Und dann brach aus mir der ganze Ärger heraus, der sich in den vergangenen Monaten angestaut hatte: »Außenminister Gabriel, der mal darüber sinniert, dass man meinetwegen ja nicht in die Türkei einmarschieren könne, und ein andermal irgendwelche Rüstungsgeschäfte in einem Satz mit meinem Namen nennt; das Justizministerium, das man dazu tragen muss, mir diese eine konkrete Hilfe zu gewähren und meine Klage in Straßburg zu unterstützen. Der Vertrauensmann der Kanzlerin, der der Gegenseite für mich extrem brisante Interna ausplaudert, die Erdoğan bei der erstbesten Gelegenheit in die Welt hinausposaunt … und, und, und. Ich bin diesen Quatsch leid.« Das war weit mehr als der kalkulierte Wutanfall, den ich beabsichtigt hatte.
Atemlos fuhr ich fort: »Die Bundesregierung hat mir keine Anweisungen zu erteilen. Und wenn sie mir jetzt ihre Unterstützung entzieht, dann ist es halt so. Dann kann Steffen Seibert demnächst auf der Bundespressekonferenz erklären, warum die deutsche Regierung mich fallen gelassen hat. Viel Spaß dabei!« Der letzte Satz klang nach einem Erpressungsversuch im Stile des türkischen Staatspräsidenten. Und ich muss gestehen: Es war nicht das erste Mal, dass ich einen solchen Satz formulierte. Zu viel Umgang mit solchen Leuten färbt ab.
Graf, ganz Diplomat, hörte zu, ohne mich zu unterbrechen. Erst als ich ausgepoltert und Luft geholt hatte, sagte er im sanften, aber auch leicht verunsicherten Ton: »Wissen Sie, ich bin Praktiker. Und für mich lautet die Frage: Wie kommen wir hier weiter?«
Mir wäre es lieber gewesen, er hätte zurückgebrüllt. So aber schämte ich mich. Ich war unfair zur Bundesregierung. Wenn man über eine so lange Zeit für eine gemeinsame Sache kämpft, kann man sich zuweilen streiten, es kann auch etwas schieflaufen. Aber die Bundesregierung hatte sich zweifelsohne für mich eingesetzt. Und ich war, das merkte ich, auch ungerecht zu diesem Menschen, der mir helfen wollte, auf dem offensichtlich der Druck seiner Vorgesetzten lastete und der in eine Situation hineingeraten war, in der er vor allem eines machen wollte: nichts falsch.
Also setzte ich noch einmal an: »Herr Graf, ich will ja auch nach Hause, so wie Peter Steudtner nach Hause wollte«, begann ich in Anspielung auf den deutschen Menschenrechtsaktivisten, der im Juli vorigen Jahres unter haarsträubenden Vorwürfen verhaftet worden war, drei Monate hier in Silivri verbrachte, ehe er – nach Protesten in der Türkei und der Vermittlung des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder – freigelassen wurde. Peter flog sofort nach Deutschland. »Aber schauen Sie, ich lebe seit zwei Jahren in Istanbul«, sagte ich. »Ich habe meine Wohnung hier, meine Arbeit, meine Katze, meine Freunde. Aus diesem Leben wurde ich mit Gewalt herausgerissen. Auch ich will mein Leben zurück. Aber anders als bei Peter ist mein Leben hier.« Ich dachte, eine solche persönliche Argumentation würde Graf besser verstehen – oder seinen Vorgesetzten im Auswärtigen Amt leichter erläutern können.
»Ich kann das nachvollziehen«, antwortete Graf. »Aber ich weiß nicht, ob das so möglich ist.« Seinen Einwand ignorierend, nahm ich meinen Faden wieder auf: »Das Einzige, das mich zweifeln lässt, ist, dass sich die Stadt ändert«, sagte ich. »Ich hatte Istanbul mit den Gezi-Protesten für mich neu entdeckt. Jetzt wird die Stadt zerstört. Waren Sie schon einmal in Kıyıköy? Das liegt am Schwarzen Meer, etwas westlich von Istanbul. Dorthin haben Dilek und ich unseren ersten Wochenendausflug gemacht. Jetzt soll da ein Kohlekraftwerk gebaut werden. Oder kennen Sie den Maçka-Park? Der liegt zwischen dem deutschen Konsulat und meinem Viertel Beşiktaş. Dort saß ich im Sommer gerne mit Freunden und trank Dosenbier. In diesem Sommer wurden im Maçka-Park Frauen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung attackiert, weil man sie für zu freizügig angezogen hielt. Jeden Tag wird ein Stück meines Istanbul zerstört. Und mehr und mehr Menschen verlassen das Land, auch viele meiner Freunde. Ich frage mich also: Kann ich überhaupt in mein voriges Leben zurück, wenn mein Istanbul aufhört zu existieren?«
Der Dialog hatte sich in ein Selbstgespräch gewandelt. Hier konnte der stellvertretende Generalkonsul nicht mehr folgen; jedenfalls schien er nicht zu verstehen, was das mit unserem aktuellen Problem zu tun hatte. Und er hatte ja recht, das führte wirklich zu weit weg.
So kehrte ich zum Thema zurück: »Abgesehen von alledem – ich lasse mich unter keinen Umständen mit einem Regierungsflugzeug ausfliegen. Dann könnten die nämlich sagen: ›Jetzt haben die Deutschen ihren Agenten abgeholt.‹«
Üblicherweise durfte ich mit den Diplomaten eine Stunde lang sprechen. Nun waren anderthalb Stunden vergangen, ohne dass uns jemand unterbrochen hatte. Aber die Argumente waren ausgetauscht.
Zum Abschluss las ich noch einmal die Notiz, die Dilek Graf mitgegeben hatte: »Liebster, es ist bald vorbei. Ich habe meine Arme geöffnet und warte auf dich. Ich liebe dich sehr und umarme dich.« Ich kritzelte auf die Rückseite: »Liebste, wir werden das gemeinsam durchstehen. Und dann werden wir nach Neuseeland fahren. Ich liebe dich auch sehr.«
Ich fasste mich kurz, weil ich wusste: Das würde das Schwierigste werden. Die Bundesregierung, meine Zeitung, meine Freunde und meine Familie abzuweisen, war nicht einfach, aber machbar. Ungleich schwieriger war es, mich Dilek zu erklären. Ihre Notiz klang so, als hätte sie diesem Plan – Freilassung gegen sofortige Ausreise – zugestimmt. Ich würde ihr darlegen müssen, warum ich dieses Angebot ablehnte. Vielleicht konnte Veysel helfen. Wie oft war er als Familientherapeut eingesprungen, selbst wenn wir über Dinge stritten, die nichts mit der Haft zu tun hatten und unter anderen Umständen gewöhnlicher Beziehungsknatsch gewesen wären.
Gleich nach dem Gespräch mit Graf wurde ich erneut in die Anwaltskabine gebracht. Veysel war noch aufgewühlter als vorher. Und er brachte wichtige Neuigkeiten mit: Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Anklageschrift fertiggestellt, die Sache lag nun bei der 32. Istanbuler Strafkammer. Er selber habe die Anklageschrift noch nicht gesehen, aber Refik – jener Anwalt, dessen Besuchstag heute eigentlich gewesen wäre – sei zum Gericht gefahren und versuche, dem Richter Informationen zu entlocken. »Ich warte auf Anweisungen«, habe der Richter gesagt.
»Es liegt jetzt an dir«, sagte Veysel aufgeregt. »Aber die Deutschen sagen: Das ist die letzte Gelegenheit. Wenn du das nicht akzeptierst, dann war’s das.«
Bei unseren Treffen sprachen wir nicht allein über meinen Fall. Ich erzählte oft von meiner Arbeit als Korrespondent, Veysel von seiner Arbeit als Anwalt. Und oft diskutierten wir die aktuelle politische Situation der Türkei, gerne mit Bezug auf meine Lage. Dass wir an diesem Tag aufgebracht waren, war kein Grund, es anders zu halten. »Ich glaube, die halten es für eine freundliche Geste an Deutschland, pünktlich zum Yıldırım-Besuch meine Freilassung zu verkünden«, sagte ich. »Weißt du, woran mich das erinnert? An den G-20-Gipfel Ende 2015 in Antalya, als sie für jeden Staatsgast einen Bademantel herstellen ließen, mit dem jeweiligen Namensschriftzug und der Nationalfahne auf der Brust. Ausgerechnet den für Angela Merkel haben sie vorab der Presse gezeigt. Die hielten das wirklich für eine freundliche Geste. Und jetzt bin ich eben der Bademantel.«
»Mag sein«, antwortete Veysel. »Jedenfalls ist das ein Punkt, an dem ich als Jurist nichts mehr machen kann. Das ist Politik. Und es ist deine Entscheidung. Ich muss los, wenn alles klappt, kommt Dilek, später vielleicht Birgelen. Aber sprich mit niemandem darüber.« Dass Veysel mit solcher Bestimmtheit eine Empfehlung erteilte, war ungewöhnlich – ebenso die Bestimmtheit, mit der ich sie ablehnte. »Tut mir leid, ich muss nachdenken. Und wenn ich nicht mit dir ausführlich darüber reden kann, dann werde ich das mit meinem Nachbarn Oğuz besprechen.« Veysel nickte. Ungläubig fragte ich noch mal: »Und Dilek wird wirklich heute kommen?« »Wir versuchen es«, sagte Veysel.
Am Ende dieses Gespräches schrieb ich einen längeren Brief an Dilek: »Wenn die türkische Staatsführung sich etwas davon verspricht, mich zu verhaften, werde ich verhaftet. Und wenn sie sich etwas davon verspricht, mich freizulassen, komme ich raus. Und dazu soll ich nichts sagen? So lasse ich nicht mit mir umspringen. Ich will nichts tun, wofür ich mich einmal schämen werde. Was können sie denn machen? Mich einsperren? Das haben sie schon. Weißt du, nach einem Jahr im Gefängnis macht mir die Aussicht auf ein paar Monate Knast mehr keine Angst. Wenn ich heute nicht rauskomme, dann morgen durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wir stehen auch das zusammen durch. Aber versteh bitte, dass ich mich auf so etwas nicht einlassen kann. Sonst wäre ich nicht der Mann, den du liebst.«
Ich ahnte, was Dilek antworten würde: dass ich unsere gemeinsame Zukunft zerstöre; dass ich nur an mich selber und weder an sie noch an die vielen Menschen denke, die sich für mich den Hintern aufreißen; dass meine Einwände sinnloser Radikalismus sind. Enttäuschung, Wut, das ganze Programm. Wenn sogar Veysel mich nicht verstand, bestand keine Hoffnung, dass Dilek dies tun würde.
Nach gut fünf Stunden, die ich mit Veysel, Graf und abermals Veysel verbracht hatte, wurde ich zurückgebracht. Oğuz hatte wie immer, wenn ich bei der Essensausgabe nicht in meiner Zelle war, mein Abendessen entgegengenommen. Ich nahm die Blechtöpfe nicht einmal in die Hand. Essen konnte ich nicht. Aber reden musste ich. Draußen war es schon dunkel, die Tür zum Hof wurde in dieser Jahreszeit gegen 17.30 Uhr verschlossen.
Ich öffnete das Fenster zu unserem gemeinsamen Hof, klammerte mich an die Stahlgitter und bat Oğuz, an sein Fenster zu kommen. Ketterauchend fasste ich die letzten Stunden zusammen. »Mache ich gerade Unsinn?«, fragte ich zwischendurch. »Du machst das alles richtig«, antwortete Oğuz.
Im Laufe dieses Gesprächs kam mir folgender Gedanke: Das muss alles mit Erdoğan abgestimmt sein, er hat nur Yıldırım vorgeschickt, weil er, wie man im Türkischen so schön sagt, nicht auflecken möchte, was er ausgespuckt hat. Dass das Regime mich jetzt freilassen will, steht in einem großen Zusammenhang: die außenpolitische Isolierung der Türkei, der Krach mit den USA, die schlechte Wirtschaftslage … im Verhältnis zu alledem ist es nur eine Winzigkeit, ob ich ausreise oder nicht. Und selbst wenn die türkische Seite eine solche Bedingung aufgestellt hat, ist das nur ein Bluff. Daran wird es nicht scheitern. »Klingt vernünftig«, sagte Oğuz. »Und wenn nicht, dann bleiben wir halt noch ein paar Monate zusammen«, rief ich.
Durch das offene Fenster kroch Kälte in die Zelle. Doch nur so konnten wir uns unterhalten. Zugleich war ich mit halbem Ohr an meinem Fernseher. Die Nachrichtensender würden die Pressekonferenz von Merkel und Yıldırım übertragen. Und die wollte ich auf keinen Fall verpassen.
Kurz bevor die beiden Regierungschefs vor die Presse traten, erschienen zwei Aufseher an meiner Zellentür. »Familienbesuch! Bist du fertig?« »Gleich«, rief ich und schrieb hastig den Vornamen eines AKP-Politikers auf einen Zettel. Soweit es in seiner Macht stand, hatte er uns einige Male geholfen. Aber was sollte diese Notiz? Sollte Dilek den Mann fragen, ob die Regierung meine Freilassung tatsächlich mit einer solchen Bedingung verknüpft? Abgesehen davon, ob der Mann einer solchen Bitte nachkommen würde, und abgesehen davon, ob man ihm die Wahrheit sagen würde – den Namen auf einen Zettel zu schreiben, war eine reine Übersprunghandlung.
»Haben Sie irgendwelche Notizen in der Tasche?«, fragte mich bei der obligatorischen Leibesvisitation einer der Beamten. Eine solche Frage hatte man mir nie zuvor gestellt. Und ich hatte zwar oft Notizen aus meiner Zelle geschmuggelt. Aber nie tat ich das heimlich, sondern immer so, dass die Aufseher die Dinge sahen, aber nicht verstanden. Das beste Versteck ist immer das offensichtliche. »Nein«, antwortete ich flüchtig. Doch der Beamte zog den Papierfetzen mit dem Namen aus meiner Tasche. »Wer ist das?«, fragte er und nahm mir den Zettel ab. »Keine Ahnung, muss ich in meiner Tasche vergessen haben«, murmelte ich.
Unter normalen Umständen hätte ein solcher Vorfall mindestens eine Anhörung und einen Aktenvermerk nach sich gezogen. Und ich hätte mich furchtbar über einen so unnötigen Fehler geärgert. Stattdessen musste ich grinsen: Was für eine sinnlose Aktion! Aber das war jetzt egal.
Zwei Beamte begleiteten mich. Ich hätte erwartet, dass sie einen Besuch um diese Uhrzeit kommentieren würden. Doch sie schwiegen. Sie wussten vermutlich besser als ich, wie ungewöhnlich das Ganze war – und was das bedeutete: Das kam von oben, ganz weit oben. Also taten sie, als sei alles ganz normal, und hatten dabei dieselbe Sorge wie der stellvertretende Generalkonsul: bloß nichts falsch machen.
Schweigend liefen wir den Gefängniskorridor entlang, der wie immer um diese Zeit fast leer gefegt war. Keine Gefangenen, die auf den Korridoren telefonierten oder zu Treffen mit Anwälten oder Angehörigen gingen, kaum Aufseher, nur das Surren der Leuchtstoffröhren. Und in mir ein Gedanke. Ich muss mir diese bescheuerte Sache mit dem Zettel als Warnung nehmen: Du musst cool bleiben, unbedingt cool bleiben, auch wenn Ruhe zu bewahren nicht gerade zu deinen Stärken gehört.
»Wir lassen Sie bis kurz vor der Abendzählung hier, danach müssen Sie zurück«, sagte der Aufseher, bevor er hinter mir die Tür zum Besucherraum abschloss. So außergewöhnlich die Situation war, die Zählung, wohl in jedem Gefängnis der Welt ein heiliger Akt, sollte also unberührt bleiben. Absurd, aber irgendwie beruhigend.
Dilek saß schon hinter der Trennscheibe. Ich nahm den Hörer ab und gab meine PIN-Zahl ein. Aber es funktionierte nicht, auch nach mehrmaligen Versuchen. Wir setzten uns in die Nachbarkabine – in einem Raum waren drei Kabinen nebeneinander. Wieder kein Ton. Schließlich rief ich die Wärter. »Wir kümmern uns darum«, sagte einer. Kurz darauf kam ein anderer, ein Mann mit gewellten Haaren und Hornbrille, ich hatte ihn nie zuvor gesehen. »Jede PIN-Zahl ist nur einmal in der Woche für eine Stunde freigeschaltet«, erläuterte er. »Sie hatten diese Woche schon Familienbesuch, darum funktioniert Ihre Zahl nicht. Ich gebe Ihnen eine neue.«
Wir hatten weniger als eine Stunde. Und zehn Minuten dieser knappen Zeit hatten wir mit diesem Quatsch verplempert. Während des Durcheinanders um die Freischaltung hatten Dilek und ich uns zwar immer wieder angelächelt. Aber das war aus Verlegenheit, wie bei einem Candle-Light-Dinner, für das man alles genau geplant hat und dann merkt, dass die Streichhölzer feucht sind.
Als die Verbindung endlich funktioniert, sage ich: »Nein, ich kann das nicht machen. Ich kann diese Bedingungen nicht akzeptieren. Ich hoffe, du verstehst das.«
Und Dilek? Sie sagt gar nichts. Schweigend legt sie die Hand auf die mit Fingerabdrücken verschmierte Trennscheibe. »Diejenigen, die ihre Liebsten im Gefängnis besuchen, werden das kennen«, hatte sie einmal im Interview mit der Cumhuriyet erzählt. »Sie wissen, wie viele Fingerabdrücke auf den Glasscheiben sind, die uns von unseren Liebsten trennen. Diese Fingerabdrücke, das sind wir.«
Daran musste ich oft denken, wenn wir in der Besucherkabine saßen – und daran, dass Dileks elegante, lange Finger mir gleich bei unserer ersten Begegnung aufgefallen waren. Schon damals wollte ich sie berühren. Jetzt will ich das noch viel mehr. Aber zwischen uns ist diese verfluchte Trennscheibe. Also drücke ich meine Hand gegen die Stelle, an der ihre Hand liegt, als könnten wir uns durch das Glas berühren. Wir blicken uns eine Weile in die Augen. Dann unterbricht Dilek das Schweigen. »Ich verstehe, mein Herz«, sagt sie. »Ich verstehe dich.«
Traumjob mit Handicaps
Begonnen hat diese Geschichte drei Jahre zuvor. Anfang 2015 fragt mich Ulf Poschardt, damals stellvertretender Chefredakteur der Welt, ob ich als Korrespondent nach Istanbul gehen möchte. Ich möchte ihm am liebsten um den Hals fallen und in Jürgen-Klopp-Manier »Geil, Wahnsinn, supergeil!« brüllen. Doch ich versuche, Contenance zu wahren: hier ein bisschen Bedenkzeit, dort ein paar Forderungen, bloß nicht anmerken lassen, dass das für mich weit mehr ist als ein reizvolles berufliches Angebot. Es ist ein Traum, der wahr wird!
Istanbul ist ein Sehnsuchtsort, gerade für viele Deutschtürken, die nie dort gelebt haben. Eine aufregende und schöne Stadt – und die einzige der Welt, durch die das Meer fließt. Zudem habe ich eine schmerzhafte Trennung hinter mir, auch in privater Hinsicht kommt dieses Angebot wie bestellt.
Und natürlich ist die Türkei journalistisch hochinteressant – eng mit Deutschland verwoben, mal brutal, mal rührend, oft verrückt und immer für eine Überraschung gut. Der einstige demokratische Hoffnungsträger Erdoğan ist dabei, sich zum Autokraten zu verwandeln. Doch der Gezi-Aufstand zwei Jahre zuvor hat gezeigt, dass es noch eine andere Türkei gibt: eine pluralistische und freiheitliche, aufgeklärte und fröhliche. Eine Türkei, die das Potenzial besitzt, die seit der Gründung der Republik im Jahr 1923 lückenhaft gebliebene Demokratisierung zu vollenden. Über eine gefestigte Diktatur zu berichten, also Chronist von hoffnungslosem Leid und ständigem Frust zu werden, würde mich weniger reizen. Doch Anfang 2015 ist der Ausgang der Sache offen.
Mit dem Gezi-Aufstand war ich zum Beobachter dieser Auseinandersetzung geworden – erst mit den Texten, die ich in jenen bewegten Tagen aus Istanbul und Ankara für die taz schrieb, dann mit einer sechsmonatigen Recherche für mein Reportagenbuch Taksim ist überall. Diese Aufgabe kann ich nun als Korrespondent der Welt fortführen.
Mit Chefredakteur Jan-Eric Peters sind wir uns schnell einig – ausgenommen in einer Frage: Er empfiehlt mir dringend, aus der türkischen Staatsbürgerschaft auszutreten. Würde ich als deutsch-französischer Doppelstaatler eine Stelle in Paris antreten, würde er mir nicht nahelegen, den französischen Pass abzugeben. Derlei Sicherheitsbedenken sind Ländern wie der Türkei vorbehalten.
Mit der türkischen Staatsbürgerschaft kam ich 1973 im hessischen Flörsheim zur Welt, die deutsche habe ich 1992, im Alter von 19 Jahren, erworben. Allerdings verweigerte die Türkei damals jungen Männern, die keinen Wehrdienst abgeleistet hatten, die Ausbürgerung. So wurde ich unter »Hinnahme der Mehrfachstaatsangehörigkeit« eingebürgert, wie mir ein Beamter namens Papadimitris aus dem Regierungspräsidium Darmstadt im schönsten Amtsdeutsch schrieb.
Nur den Militärdienst habe ich weiterhin am Hals. Eine Altersgrenze gibt es in der Türkei nämlich nicht, einen Freikauf habe ich aus politischen Gründen abgelehnt und ausgebürgert werde ich nicht, solange diese »vaterländische Pflicht« nicht erfüllt ist. So habe ich es bei Reisen in die Türkei jahrelang riskiert, geschnappt zu werden. Wenn ich mich dauerhaft in Istanbul niederlassen möchte, geht das nicht mehr.
Ich bezahle also die 6000 Euro Freikaufgebühr. Jetzt könnte ich Peters’ Rat folgen und mich ausbürgern lassen. Zugleich könnte ich die »Blaue Karte« beantragen, eine Art Staatsbürgerschaft zweiter Klasse, die unter anderem die Niederlassungsfreiheit gewährleistet. Ich entscheide mich dagegen. Der »Blauen Karte« traue ich nicht, nur als türkischer Staatsbürger wäre ich vor einer Abschiebung sicher. Zwar hätte ich im Fall einer Festnahme keinen Anspruch auf konsularische Betreuung. Aber die bedeutet ja bloß, dass mir das Konsulat einen Anwalt vermitteln und die Diplomaten mich im schlimmsten Fall im Gefängnis besuchen können. Doch einen Anwalt könnte ich selber finden. Und die Bundesregierung würde sich auch so für mich einsetzen.
Die damaligen Verhältnisse in der Türkei erscheinen nur aus heutiger Perspektive als halbwegs erträglich. Anfang 2015 wirken sie nicht so. Entsprechend reagieren meine Istanbuler Freunde: »Bist du verrückt? Du kommst freiwillig in ein Land, aus dem alle abhauen wollen?«, fragt eine Freundin im Spaß, aber nicht grundlos. »Genau darum komme ich ja«, antworte ich.
In Deutschland verabschieden mich derweil alle mit demselben Satz: »Pass auf dich auf!« Meistens erwidere ich: »Klar, mach ich.« Nur einmal, bei meiner Abschiedsfeier in der taz, rutscht mir im Gespräch mit einer Kollegin eine andere Antwort heraus: »Ich weiß gar nicht, wie das geht: auf mich aufpassen.« Dieser Befund ist treffender, als es mir lieb ist, sodass ich ihn schnell vergesse.
Nicht erst seit Erdoğan droht in der Türkei jedem Journalisten, der seine Sache gut macht, Verhaftung oder gar Schlimmeres. So wurde im Januar 2007 der türkisch-armenische Publizist Hrant Dink von einem Rechtsextremisten erschossen, im Januar 1996 der Evrensel-Reporter Metin Göktepe auf einer Polizeiwache totgeprügelt, im Januar 1993 der Cumhuriyet-Journalist Uğur Mumcu mit einer Autobombe getötet, im September 1992 der kurdische Autor Musa Anter erschossen. In viele dieser – hier beileibe nicht vollständig aufgelisteten – Morde war der »Tiefe Staat« verwickelt, der sich oft rechtsextremer oder islamistischer Killerkommandos bediente. Kaum eines dieser Verbrechen wurde je aufgeklärt.
Andererseits scheinen die düstersten Zeiten mit Attentaten und »Verschwindenlassen« von Oppositionellen vorbei. Und ich komme als Korrespondent einer großen deutschen Zeitung. Das Schlimmste, womit ich rechne, ist eine Diffamierungskampagne der Regierung und ihrer Medien. Nach den Gezi-Protesten vom Frühjahr 2013 widerfuhr dies der BBC-Reporterin Selin Girit, im Jahr darauf, nach dem schweren Grubenunglück im westtürkischen Soma, bei dem 301 Arbeiter starben, dem Spiegel-Korrespondenten Hasnain Kazim.
Größeres Kopfzerbrechen bereiten mir andere Fragen: Bislang habe ich für linke Medien – die taz und zuvor die Jungle World – gearbeitet. Werde ich mit einem traditionell konservativen Haus wie Springer zurechtkommen? Und, da ich in meinen Redakteursstellen immer als Generalist und in den letzten Jahren vor allem als Kolumnist tätig war: Werde ich den Korrespondentenjob schaffen?
Zum Glück bin ich nicht allein. Ebenfalls im Frühjahr 2015 kommt Zeit-Redakteurin Özlem Topçu. Sie hat ein Stipendium und will eine Auszeit vom Journalismus nehmen. Stattdessen wird sie faktisch zur Türkeikorrespondentin der Zeit, die niemanden mehr in Istanbul hat. Wir sind befreundet, doch jetzt reden wir fast jeden Tag miteinander, beraten uns über Themen und machen oft zusammen Recherchereisen. Später wird sie, nur geringfügig übertreibend, diese Phase so beschreiben: »Wenn ich vormittags anrief und ›Hey, wie geht’s?‹ sagte, rollte eine Flut an Information, Geschichten und Aktivitäten auf mich zu, die ich gar nicht so schnell verarbeiten konnte: ›Ich habe schon zwei Texte für Online geschrieben!‹ ›Weißt du, mit wem ich grad gesprochen habe?‹ ›Hast du morgen was vor? Nein? Dann fliegen wir nach Diyarbakır, komm schon!‹«
Wenige Wochen nachdem ich die Korrespondentenstelle angetreten habe, und kurz nach der Parlamentswahl vom 7. Juni, bei der die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) erstmals seit 2002 die absolute Mehrheit verloren hat, gerate ich zum ersten Mal in Konflikt mit der Staatsmacht.
Die YPG, der syrische Ableger der militanten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), hat gerade mit Unterstützung der US-Luftwaffe die Grenzstadt Tell Abyad aus der Hand der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) befreit. Die Kurden beschuldigen die türkische Regierung, sie habe es geduldet, dass der IS den Grenzübergang für den Nachschub an Kämpfern und Material genutzt habe; die türkische Regierung wirft der YPG vor, sie betreibe in der mehrheitlich von Arabern bewohnten Region ethnische Säuberungen. Tausende Menschen fliehen unterdessen nach Akçakale auf der türkischen Seite der Grenze.
Mit Özlem, Pınar Öğünç von der Cumhuriyet und einer weiteren Kollegin fahren wir dorthin. Wir schauen uns an, wie die Flüchtlinge untergebracht sind, und kommen mit einigen ins Gespräch. Unvergessen ist mir die 15-Jährige, die mit ihrer Familie unter einem Verschlag Unterschlupf gefunden hat. Freiheit bedeutet für sie, sich die Fingernägel zu lackieren. Unter dem IS war das verboten. Nun zeigt sie uns glücklich ihren türkisfarbenen Nagellack.
Dann hält Izzettin Küçük, Gouverneur der Provinz Urfa, am Grenzübergang eine improvisierte Pressekonferenz. Irgendwann ergreift Özlem das Wort. Sie sagt nicht wie die türkischen Reporter vor ihr »Mein verehrter Gouverneur«. Sie fragt: »Wovor genau flüchten diese Menschen, vor dem IS?« »Nein«, antwortet Küçük. »Sie fliehen vor der PKK und der YPG. Und vor den amerikanischen Bombardements.« Ich hake nach: »Die Flüchtlinge, mit denen wir gesprochen haben, haben uns das nicht so erzählt. Woher haben Sie diese Information?«
Es wäre ein Leichtes, dieser Frage auszuweichen. Stattdessen bricht Küçük die Pressekonferenz ab. »Das war’s, es gibt hier nichts zu debattieren«, ruft er und wirft mir einen hasserfüllten Blick zu. Auf den Fernsehbildern wird später zu hören sein, wie er auf mich zeigend einem Polizisten in Anzug und bespiegelter Sonnenbrille zuflüstert: »Das Freundchen da.« Hasan Akbaş, Reporter der linken Tageszeitung Evrensel, wirft eine Frage ein: »Stellt der IS eine Gefährdung für Akçakale dar?« Auch er ist fällig.
Hasan, Pınar und ich werden auf das örtliche Polizeirevier geführt. Abteilung für Terrorbekämpfung, drunter machen sie es nicht. Özlem und die andere Kollegin werden ebenfalls festgehalten, aber dann laufen gelassen. Auf dem Polizeirevier heißt es mal, wir seien festgenommen, dann wieder, man wolle nur unsere Personalien aufnehmen.
Währenddessen sind wir in den türkischen Medien zum Hauptnachrichtenthema geworden – dass Journalisten nur deshalb festgenommen werden, weil sie Fragen gestellt haben, überrascht damals noch. Cumhuriyet-Chefredakteur Can Dündar twittert den ironischen Hashtag #NeSoriyimValime, etwa: »Mein Gouverneur, was soll ich fragen?«, der zu den trending topics, also zu einem der am meisten genutzten Hashtags, avanciert. Uns hilft die Aufmerksamkeit. Nach ihrer Wahlniederlage ist bei der AKP die Arroganz der Macht angekratzt. Vermutlich erhält der Gouverneur einen Anruf aus Ankara, nach nur einer Dreiviertelstunde sind wir frei.
Ein paar Wochen nach diesem Vorfall, am 20. Juli 2015, sprengt sich in der Grenzstadt Suruç, 50 Kilometer westlich von Akçakale, ein IS-Selbstmordattentäter inmitten einer Gruppe junger linker Aktivisten in die Luft, die als Aufbauhelfer ins syrische Kobanê wollten – nicht der erste, aber der bislang blutigste in einer langen Reihe von IS-Anschlägen in der Türkei, die sich zunächst gegen linke und kurdische Oppositionelle, dann gegen deutsche Urlauber und schließlich wahllos gegen jeden richten.
Als tags darauf in Ceylanpınar, 110 Kilometer östlich von Akçakale, zwei Polizisten in ihrer Wohnung im Schlaf ermordet werden und eine PKK-nahe Quelle die Verantwortung dafür übernimmt, beschließt die Regierung, nicht allein mit polizeilichen, sondern auch mit militärischen Mitteln zu reagieren.
Der Hintergrund: Im Gegensatz zu AKP-Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu will Erdoğan eine Neuwahl. Doch die verspricht nur unter veränderten Bedingungen ein anderes Ergebnis. Den im März 2013 verkündeten Waffenstillstand mit der PKK aufzukündigen, schafft neue Bedingungen.
Später wird die PKK die Verantwortung für diesen Doppelmord zurückweisen. Der anschließende Strafprozess wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet, und endet im März 2018 mit Freisprüchen für alle Angeklagten. Da ist es längst zu spät. Der seit 1984 andauernde Konflikt, dem bis dahin mindestens 40000 Menschen zum Opfer gefallen waren, ist mit aller Brutalität zurückgekehrt. Doch die Rechnung geht auf: Bei der Neuwahl am 1. November 2015 gewinnt die AKP die absolute Mehrheit zurück. Frieden und Dialog haben sich für Erdoğan nicht rentiert, Terror und Krieg schon.
Im August 2015 beginnt offiziell meine Entsendung als Korrespondent. Nun beantrage ich die Akkreditierung, also einen türkischen Presseausweis. In Deutschland sind dafür Berufsverbände zuständig, in der Türkei das Presse- und Informationsamt, eine dem Ministerpräsidenten unterstellte Behörde. Längst nicht jeder türkische Journalist besitzt einen amtlichen Presseausweis. Freie Autoren werden grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso Mitarbeiter von Internetmedien. Zudem gibt es sozialversicherungsrechtliche Auflagen, die sich kleinere Häuser oft nicht leisten können und größere zuweilen nicht leisten wollen. Und Mitarbeiter mancher Medien, allen voran der prokurdischen, erhalten aus politischen Gründen keinen.
Allerdings ist eine Akkreditierung selbst für ausländische Journalisten nicht zwingend – anders als etwa im Iran, wo jeder ausländische Reporter, der ohne Akkreditierung auch nur für eine einzelne Recherche ins Land reist, eine Anklage wegen Spionage riskiert. So erging es dem Reporter Marcus Hellwig von der Bild am Sonntag und dem Fotografen Jens Koch, die im Oktober 2010 verhaftet wurden und gut fünf Monate unter extrem harten und teils brutalen Bedingungen in einem Sondergefängnis verbrachten. In der Türkei ist die Akkreditierung für ausländische Journalisten nur aus einem Grund unverzichtbar: als Voraussetzung für die Aufenthaltsgenehmigung.
Anfang September 2015 besuchen Özlem und ich den Istanbuler Büroleiter des Presseamtes. Er empfängt uns freundlich, kann aber nur unsere Anträge an die Zentrale weiterleiten. Wir brauchen die Akkreditierung nicht für unseren Aufenthalt. Doch der deutsche Presseausweis wird immer seltener akzeptiert – weder bei offiziellen Anlässen noch an Polizeiabsperrungen bei Demonstrationen. Gerade bei Recherchen in den kurdischen Gebieten wäre es nicht verkehrt, einen türkischen Presseausweis vorzeigen zu können.
Denn nach dem Ende des Waffenstillstands hat die PKK erstmals in ihrer Geschichte den Krieg in die Städte verlagert. In Sur, der historischen Altstadt von Diyarbakır, in der Kleinstadt Cizre und in anderen Orten haben sich Militante hinter Barrikaden und Sprengfallen verschanzt. In einer irrwitzigen Weise glaubt die PKK, die Schlacht um Kobanê wiederholen zu können, als fast die ganze Welt ihre Sympathien für die vom IS bedrängten kurdischen Kämpfer erklärte und in der Türkei Hunderttausende auf die Straße gingen.
Bis zum Jahreswechsel 2015/16 tut sich bei Özlem und mir nichts. Auch die meisten anderen deutschen Journalisten in Istanbul – bis zu 50 Leute, das größte Kontingent an ausländischer Presse im Land – warten vergeblich auf die Erneuerung ihrer Akkreditierungen. Die Kollegen werden nervös. Im Januar 2016 setzen wir auf Initiative des Spiegel-Korrespondenten Hasnain Kazim ein Schreiben an den deutschen Botschafter Martin Erdmann auf. Zugleich bitten wir unsere Chefredaktionen, sich in dieser Angelegenheit mit der Bundesregierung in Verbindung zu setzen.
Mitte Januar fliegt Davutoğlu nach Berlin. Angela Merkel spricht das Thema an, kurz darauf erhalten die meisten Kollegen ihre Presseausweise. Anfang Februar kommt die Bundeskanzlerin nach Ankara. Es ist die Zeit, in der sie im Zusammenhang mit dem sogenannten Flüchtlingsabkommen so oft in die Türkei reist, dass ich in einem launigen Kommentar bemerke, es wäre für den deutschen Steuerzahler billiger, wenn Merkel eine Zweitwohnung in Ankara mieten würde.
Natürlich muss man sich auch für diesen Besuch akkreditieren, aber für uns ist die deutsche Botschaft zuständig. Während wir vor der Villa Çankaya, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten, in klirrender Kälte darauf warten, dass Merkel und Davutoğlu die Militärformation abschreiten, erhält ein Kollege eine Nachricht: Sein Antrag ist angenommen. Ein Begrüßungsgeschenk. Zwei weitere Anträge werden bewilligt, jetzt sind nur noch Özlem und ich übrig – und Hasnain, dessen Familie ursprünglich aus Pakistan stammt. »Ich habe mehrfach von türkischen Oppositionspolitikern gehört, die Regierung traue sich nur deshalb, so mit uns umzugehen, weil sie denke, wir wären keine ›richtigen Deutschen‹, und daher spekuliere, die Bundesregierung werde sich letztlich nicht konsequent für uns einsetzen«, wird er später in seinem Buch Krisenstaat Türkei schreiben.
Allerdings kommt bei Hasnain etwas hinzu: Seit einer Titelseite in deutscher und türkischer Sprache zum Höhepunkt der Gezi-Proteste ist der Spiegel bei der türkischen Regierung verhasst. Özlem und ich dürfen hingegen annehmen, dass das Ausbleiben der Akkreditierung nichts mit unseren Zeitungen zu tun hat. Das ist persönlich. Für den Vorwurf des »Vaterlandsverrats« genügen unsere Namen, ganz gleich, welchen Pass wir besitzen.
Auf der Pressekonferenz der Regierungschefs dürfen, wie bei solchen Anlässen üblich, Journalisten aus beiden Ländern jeweils zwei Fragen stellen. Auf türkischer Seite entscheidet der Pressestab des Ministerpräsidenten, wer was fragen darf, auf deutscher Seite sprechen wir Journalisten uns untereinander ab und informieren die Zuständigen. Heute werde ich als vierter und letzter eine Frage stellen.
Ich erinnere Merkel an die deutliche Kritik, die der damalige Bundespräsident Joachim Gauck bei seinem Besuch im April 2014 am Zustand der Gewaltenteilung und der Pressefreiheit formuliert hatte. Und ich erinnere daran, dass auch sie selber, etwa nach der Niederschlagung der Gezi-Proteste, klare Worte gefunden hatte. Dann komme ich auf zwei zu diesem Zeitpunkt aktuelle Themen: auf Can Dündar und Erdem Gül, Chefredakteur bzw. Ankara-Bürochef der Cumhuriyet, die im Gefängnis Silivri Nr. 9 eingesperrt sind. Und auf die Vorgänge in Cizre, wo zum Ende des von der PKK angezettelten Häuserkrieges mindestens 130 Menschen – Militante und Zivilisten – in Kellern Zuflucht gefunden haben und Menschenrechtsorganisationen eine humanitäre Katastrophe befürchten.
»Zu alldem hört man von Ihnen, von der Bundesregierung, nichts«, beende ich meine etwas lang geratene Frage. »Bei vielen türkischen Oppositionellen ist der Eindruck entstanden, dass dieses Schweigen der Bundesrepublik der Preis für die Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage ist. Was sagen Sie zu diesem Eindruck, dass Europa, dass Deutschland europäische Werte verrät?«
»Ich glaube, dass wir ein Gesprächsformat haben, in dem wir über alle Themen sprechen. Wir haben zum Beispiel über die Frage der Arbeitsbedingungen von Journalisten gesprochen; vielleicht wird der Premierminister auch selber noch etwas dazu sagen«, antwortet Merkel. Ähnlich knapp geht sie auf den Kurdenkonflikt ein – die Bundesregierung habe sich »sehr große Hoffnungen auf den Versöhnungsprozess mit der PKK« gemacht, allerdings habe jeder Staat auch »das Recht, gegen Terrorismus vorzugehen«.
Der Rest klingt, als wollte Merkel besagte Kritik bestätigen: »Natürlich hat sich auch die Problemlage gegenüber vor zwei oder drei Jahren verändert; denn vor zwei oder drei Jahren gab es weder diese schrecklichen Auswirkungen des Syrienkrieges, noch gab es in einem solchen Maße illegale Migration.«
Dann ergreift Davutoğlu das Wort. 42:11 Minuten beträgt der Mitschnitt der Pressekonferenz, 8:20 Minuten, also ein Fünftel, verbringt der Ministerpräsident mit der Antwort auf eine Frage, die ich gar nicht an ihn gerichtet hatte. Ich hätte ein »politisches Statement« abgegeben, behauptet er. »Aber dass man dem türkischen Ministerpräsidenten solche Beschuldigungen hier ins Gesicht sagen kann, ist auch ein Zeichen für die Pressefreiheit in der Türkei.« Im Übrigen sei in seinem Land niemand wegen Journalismus im Gefängnis.
Seine Pointe hebt er sich für den Schluss auf: Ich hatte auf die Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen verwiesen. Damals belegt die Türkei Platz 149, ich habe versehentlich 159 gesagt, der Simultandolmetscher hat daraus jedoch Platz 195 gemacht. »Außerdem bin ich neugierig«, endet Davutoğlu triumphierend, »wie die Türkei auf Platz 195 einer Liste sein kann, wo es auf der Welt nur 193 Länder gibt.«
Dieser Disput bleibt nicht in dem mit dunklem Holz vertäfelten Konferenzsaal der Villa Çankaya. Da in der Türkei, wie in jeder Demokratie mit zweifelhaftem Leumund, sämtliche öffentlichen Auftritte führender Politiker von mindestens einem halben Dutzend Fernsehsendern live übertragen werden, hört ein großes Publikum mit. Dass bei diesen Gelegenheiten kritische Fragen gestellt werden, sind die türkischen Zuschauer nicht mehr gewohnt. Viel später werden mir Erdem Gül und Can Dündar erzählen, wie sehr sie sich in ihrer Gefängniszelle gefreut hätten, als sie im Fernsehen meine Frage hörten – und wie sie Merkels Antwort empfanden: als »ungeheure Enttäuschung«, wie Can auch in seinem Buch Verräter schreibt.
Umso wütender ist man im Regierungslager. Noch während ich im Presseraum meinen Bericht für die Welt schreibe, erscheinen in den Onlineausgaben regierungsnaher Medien erste Berichte. Zum zweiten Mal bin ich vom Berichterstatter zum Gegenstand von Berichterstattung geworden. Ich bleibe vorerst in Ankara und besuche meine alte Freundin Mehtap. Das scheint mir sicherer als das Hotel. Mehtap war lange Zeit Pressefotografin und arbeitet inzwischen als Anwältin. Vielleicht werde ich ihren Beistand brauchen.
Am nächsten Tag finde ich mein Gesicht auf den Titelseiten der Regierungszeitungen, verbunden mit Etiketten wie »Provokateur« und »PKK-Anwalt«. »Der Agent Provocateur Deniz Yücel ist bekannt für seine antitürkischen Berichte in der Zeitung Die Welt«, schreibt etwa Star. Zugleich berichten die Regierungsmedien genüsslich von meinem vermeintlichen Fehler. Davutoğlu habe mich »blamiert« und mir »eine Lektion« erteilt.
Wie lebensgefährlich derlei Diffamierungen werden können, hat kurz zuvor der Fall Tahir Elçi gezeigt: Der prominente Menschenrechtsanwalt und Präsident der Anwaltskammer Diyarbakır wurde nach einem Auftritt in einer Talkshow ebenfalls als »PKK-Anwalt« verleumdet. Ende November 2015 wurde er auf offener Straße erschossen; seine Mörder konnten nie ermittelt werden.
Diese Angriffe beunruhigen mich. Doch mehr ärgert mich die Häme. Ich erzähle Kollegen aus oppositionellen Medien von diesem Übersetzungsfehler, einige schreiben darüber. Eine Ehrenrettung, für die ich sehr dankbar bin. Nur Mehtap findet das lustig – und ermutigend: »In deren Erzählung hat Davutoğlu dich zurechtgewiesen. Er hat gewonnen, damit ist die Sache für sie erledigt. Vergiss deinen Stolz.«
Sie hat recht. Am folgenden Tag kommt Davutoğlu erneut auf das Thema zu sprechen: »Gestern wurden wir von einem Journalisten angesprochen, von dem wir später in Erfahrung gebracht haben, dass es sich um einen Türken handelte. Gut, jeder kann fragen, was er will. Aber er bekommt auch die Antwort, die er verdient.« Doch tags darauf legen nur wenige Regierungsblätter nach. Wichtiger: Erdoğan sagt dazu nichts. Die größtmögliche Eskalation bleibt aus.
Trotzdem erhalte ich gegen Mitternacht einen Anruf von Botschafter Erdmann, der mir empfiehlt, das Land »auf unbestimmte Zeit« zu verlassen. Nein, er habe keine Informationen, die ich nicht kenne. Es handle sich lediglich um die Einschätzung der Botschaft, eine Empfehlung aus Fürsorge um deutsche Staatsbürger. Sorgen bereiten ihm weniger die Behörden als Fanatiker, die auf die Idee kommen könnten, mir ebenfalls eine »Lektion« zu erteilen.
Ich unterrichte die Verantwortlichen bei der Welt. Die Antwort des neuen Chefredakteurs Stefan Aust: »Bitte sofort nach Berlin kommen. Das ist eine dienstliche Anordnung« – die erste Dienstanweisung seines 50-jährigen Berufslebens. Wenige Tage später verlässt Hasnain die Türkei. Mit seiner Geschichte wird publik, dass die Welt mich vorläufig abgezogen hat.
In Cizre kommt es in den folgenden Tagen zur befürchteten Katastrophe. Unter den Toten ist Rohat Aktaş, Reporter der kurdischsprachigen Zeitung Azadiya Welat. »Aus den verfügbaren Informationen geht hervor, dass die Sicherheitskräfte vorsätzlich und auf nicht zu rechtfertigende Weise etwa 130 Menschen getötet haben«, wird später Human Rights Watch in einem Bericht schreiben. Auch Seid al-Hussein, der UN-Kommissar für Menschenrechte, wird Anhaltspunkte für ein Massaker erkennen und die türkische Regierung auffordern, die Vorgänge von einer internationalen Kommission untersuchen zu lassen. Vergeblich.
Bald darauf sprengen sich Selbstmordattentäter der »Freiheitsfalken Kurdistans« (TAK) in die Luft – im Februar im Regierungsviertel von Ankara, im März auf dem Kızılay-Platz, dem zentralen Platz der türkischen Hauptstadt. 67 Menschen werden dabei insgesamt getötet, die meisten sind Zivilisten. Dem eigenen Bekunden nach handelt es sich bei der TAK um eine radikale Abspaltung von der PKK. Doch für diese Darstellung spricht nichts – aber umso mehr dafür, dass es sich um eine von der PKK-Führung oder einem Teil derselben gesteuerte Pseudoorganisation handelt, mit der die PKK ihre Verantwortung für Terroranschläge im Westen des Landes zu kaschieren versucht.
Am 18. März wird in Brüssel das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU unterzeichnet. Ich sitze in Berlin und fühle mich unnütz.
Sosehr alle mit den Gezi-Protesten und dem Friedensprozess verbundenen Hoffnungen sich zu verflüchtigen beginnen und die Lage im Land mehr und mehr eskaliert, bin ich überzeugt: Ich habe dort einen Job zu erledigen. Nach einigen Wochen frage ich den Botschafter, ob er Entwarnung geben könne. »Entwarnung ja, aber keine Garantie«, meint Erdmann und erteilt mir ein paar Ratschläge: »Immer auf der Hut sein, Wohnungstür verbarrikadieren und stets wechselnde Routen wählen.« Kein Wunder, dass Stefan Aust diese Entwarnung für keine hält. Ich darf vorerst nicht zurück.
Dann setzt mir Özlem einen Floh ins Ohr: »Ich glaube ja, dass die Bundesregierung sich wirklich um dich sorgt. Aber vielleicht ist es ihnen so kurz vor der Unterzeichnung des Flüchtlingsabkommens auch recht, dich so aus dem Verkehr zu ziehen. Du bist doch auch für die ein pain in the ass.« Bei meinem nächsten Gespräch mit Aust deute ich Özlems Überlegung an, Aust führt den Gedanken zu Ende. Es klappt. Am 28. März sitze ich im Flugzeug nach Istanbul, wenige Tage später bin ich im internationalen Pressetross, der im Küstenort Dikili den ersten Rücktransport von Flüchtlingen aus Griechenland verfolgt.
Ende April besuchen Angela Merkel und EU-Ratspräsident Donald Tusk mit Ahmet Davutoğlu das Flüchtlingslager Nizip in der Südosttürkei. Diesmal erteilt nicht die Botschaft die Akkreditierungen an deutsche Journalisten, sondern sammelt die Anträge nur ein. Die Entscheidung liegt plötzlich beim Presseamt.
Den Kollegen wird am Tag vor dem Besuch mitgeteilt, dass ihre Anträge bewilligt seien und sie im Pressebüro des Gouverneurs von Gaziantep ihre Ausweise abholen könnten. Nur ich erhalte keine Nachricht. Ich berate mich mit Stefan Aust, Ulf Poschardt und Sascha Lehnartz, ob wir das Ganze öffentlich machen. Auch Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner schaltet sich ein. Kann jetzt die türkische Regierung entscheiden, welcher deutsche Journalist den Besuch der Bundeskanzlerin beobachten darf? Die Welt und die Bild würden das als Skandal behandeln, andere deutsche Medien vermutlich auch. Aber da mein Antrag noch nicht offiziell abgelehnt ist, entscheiden wir, zunächst still zu bleiben. Meine Chefredaktion macht dem Bundeskanzleramt deutlich, wie inakzeptabel wir diesen Vorgang finden, während ich auf gut Glück nach Gaziantep fliege.
Ich checke im selben Hotel ein, in dem alle deutschen Journalisten abgestiegen sind, und bitte meinen dpa-Kollegen Can Merey, mich zum Gouverneursamt zu begleiten – als Freund, aber, falls ich abgewiesen werde, auch als Berichterstatter. Vor dem kleinen Büro der Presseabteilung hat sich eine Schlange gebildet, auch die türkischen Kollegen müssen hier ihre Akkreditierungen abholen. Kaum haben wir uns eingereiht, kommt ein Beamter auf uns zu: »Oh, Deniz Bey«, ruft er, die traditionelle türkische Höflichkeitsform benutzend. »Wir haben Sie schon erwartet!«. Dann ein zweiter: »Deniz Bey, es gab da offenbar ein Missverständnis, Ihr Ausweis liegt bereit.« Er schleust mich an der Schlange vorbei. Dann kommt ein dritter Beamter: »Ich bin vom Presse- und Informationsamt in Ankara. Ich lese alle Ihre Texte und übersetze sie.«
Von diesem Empfang bin ich so überrumpelt – es fehlt nur das Schulmädchen, das mit Schleifen im Haar und Blumenstrauß in der Hand ein Gedicht vorträgt –, dass ich es versäume, diesen Beamten um seine Visitenkarte zu bitten. Dabei hat mir noch nie jemand gesagt, dass er alle, wirklich alle meine Texte lese. Das muss keine Drohung sein. Kann aber.
Mein Problem hat sich derweil unter den deutschen Kollegen herumgesprochen. Als ich mit der Akkreditierungskarte um den Hals ins Hotel zurückkehre, begrüßen sie mich am Frühstückstisch mit großem Hallo. Sie albern herum, wirken aber auch enttäuscht: Sie hätten wohl lieber über einen neuen Eklat in den deutsch-türkischen Beziehungen berichtet als über Schulunterricht für syrische Kinder. Wäre ich nicht selber betroffen, würde es mir genauso gehen.
Auch wenn ich nach der Nummer in Ankara jede Hoffnung auf einen Presseausweis aufgegeben habe, spricht Merkel das Thema erneut an. Im Gespräch mit Davutoğlu nennt sie Özlem und mich namentlich. Doch es sind Davutoğlus letzte Tage als Ministerpräsident.
Im Regierungslager kreidet man ihm die neoosmanische Außenpolitik an, die für die Türkei in Syrien in einem Fiasko geendet hat – als ob Erdoğan diese Politik nicht mitgetragen hätte. Davutoğlus eigentliches Vergehen lautet: Er hatte angefangen zu glauben, dass er tatsächlich als Ministerpräsident die Richtlinien der Politik bestimmen würde. Das entspricht zwar der damals gültigen Verfassung, nicht aber einer Realität namens Recep Tayyip Erdoğan. Binnen weniger Tage wird Davutoğlu öffentlich demontiert. Am 5. Mai erklärt er seinen Rücktritt. Es sei nicht seine Entscheidung, betont er.
Gleich am nächsten Tag erhalte ich einen Anruf vom Presseamt: Mein Antrag sei bewilligt, der Presseausweis werde mir bald zugeschickt. Auf die mündliche Bestätigung folgt eine schriftliche. Mir gefällt die Vorstellung, wie Davutoğlu nach seiner Rücktrittserklärung am Schreibtisch sitzt und alles unterschreibt, was sich dort angehäuft hat. »Mir doch egal, macht doch euren Mist allein«, murmelt er vielleicht.
Als Nachfolger wird, wie es ein Erdoğan-Berater formuliert, »ein Ministerpräsident mit niedrigem Profil« gesucht und in Binali Yıldırım gefunden. Bei mir ist nach zwei Wochen immer noch kein Presseausweis eingetroffen. Nach einigen Telefonaten wird mir schließlich folgende Geschichte erzählt: Der für die Auslandspresse zuständige Abteilungsleiter habe meinen Antrag bewilligt. Doch der für den Druck der Ausweise zuständige Abteilungsleiter habe ein Veto eingelegt. Meine Akkreditierung sei nicht abgelehnt, müsse aber weiter geprüft werden. Dass jemand ein Veto eingelegt hat, glaube ich gerne – aber nicht, dass irgendein Abteilungsleiter es wagt, sich in eine Sache einzumischen, die zwischen Regierungschefs verhandelt wird.
Ich habe schon bald andere Sorgen. Und nicht nur ich. Der blutige Putschversuch vom 15. Juli 2016, dem mindestens 250 Menschen, davon 182 Zivilisten, zum Opfer fallen, wird zwar, nicht zuletzt durch gewaltfreien Widerstand Zehntausender Menschen, niedergeschlagen. Doch danach beginnt eine Hexenjagd gegen echte und vermeintliche Anhänger der Gülen-Bewegung – und zwar unabhängig davon, ob sie etwas mit dem Putschversuch zu tun hatten. Darüber hinaus nutzt Erdoğan den nun ausgerufenen Ausnahmezustand, um kurdische, linke, liberale und – in geringerem Maß – kemalistische Oppositionelle mundtot zu machen und die letzten Reste von Gewaltenteilung abzuschaffen.
Die Bilanz: 36 Notstandsdekrete, 130000 Entlassungen an Universitäten, in der Justiz und dem gesamten Staatsdienst, rund 200 geschlossene Medien, Ermittlungsverfahren gegen knapp 170000 Personen, rund 50000 Verhaftungen, darunter 16 Abgeordnete und etwa 300 Journalisten, Zwangsverwaltung für fast alle von der prokurdischen HDP geführten Städte und Gemeinden. Wäre der Putsch erfolgreich gewesen, hätte es zum Teil andere Leute getroffen, das Ergebnis aber wäre ungefähr das Gleiche gewesen. Eben eine »Gunst Allahs«, wie Erdoğan den Putschversuch noch in jener Julinacht bezeichnet hat.
Erstmals beschleicht mich ernsthafte Sorge, dass auch ich unter die Räder geraten könnte. Die Türkei zu verlassen, kommt mir dennoch nicht in den Sinn. Denn dieses Land, das gerade mit voller Wucht gegen die Wand fährt, liegt mir am Herzen. Und schwierige Bedingungen erfordern erst recht Journalismus. Ich sage nicht »kritischen« oder »unabhängigen«, weil unkritischer oder abhängiger Journalismus keiner ist. Und dieser braucht keine amtliche Beglaubigung.