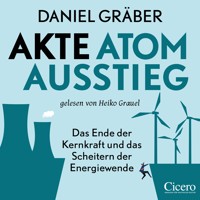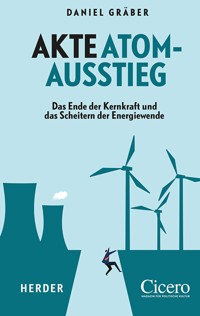
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschlands energiepolitischer Sonderweg könnte zur Sackgasse werden. Kurz vor Abschluss des Atomausstiegs fiel mit Russlands Angriff auf die Ukraine die wichtigste Stütze der Energiewende weg: das Erdgas aus dem Osten. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ließ eine Verschiebung des Atomausstiegs prüfen. Sechs Kernkraftwerke hätten gerettet werden können. Doch es kam nur zu einer minimalen Laufzeitverlängerung. In den durch »Cicero« freigeklagten Akten des Wirtschafts- und des Umweltministeriums zeigt sich: Während alle europäischen Nachbarn ihre Ausstiegsbeschlüsse nach Russlands Überfall revidierten, fehlte Habeck die Kraft dazu, sich gegen die Energiewende-Lobby in seiner Partei durchzusetzen. Parteipolitische Ziele werden bei der Energiepolitik oft wichtiger genommen als das Wohl des Landes. Wie es dazu kommen konnte und welche Gefahren das für Deutschlands Zukunft bergen könnte, zeigt Daniel Gräber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Ein CICERO-Buch
Daniel Gräber
Akte Atomausstieg
Das Ende der Kernkraft und das Scheitern der Energiewende
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller Buchgestaltung
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timișoara
ISBN (Print): 978-3-451-07341-0
ISBN (EPUB): 978-3-451-83619-0
Inhalt
KAPITEL 1: Die Drachentöter
KAPITEL 2: Das Märchen von Wind und Sonne
KAPITEL 3: Die grüne Lobby
KAPITEL 4: Ein obskurer „Prüfvermerk“
KAPITEL 5: Einsames Deutschland
KAPITEL 6: Der Stresstest
KAPITEL 7: Vorwärts in die Vergangenheit
Anmerkungen
Über den Autor
KAPITEL 1: Die Drachentöter
Jahrzehntelang hatten sie gegen die friedliche Nutzung der Nuklearenergie gekämpft. Erst auf der Straße, dann in den Parlamenten und schließlich in den Ministerien. Mit lautstarkem, teils gewalttätigem Protest, mit Hartnäckigkeit, List und Tücke. Doch nachdem sie es geschafft hatten, die Technologie zu einem Tabu zu machen, an das sich weder die deutschen Energiekonzerne noch einst kernkraftfreundliche Parteien herantrauten, beschlich so manchen Grünen heimlich Zweifel. Der Grund dafür: Die „Energiewende“, ein Abermilliarden verschlingender Umbau des Stromsystems, droht Deutschland wirtschaftlich zu ruinieren und hält nicht, was ihre Verfechter versprechen. Der Kohlendioxidausstoß des deutschen Stromsystems ist nach wie vor deutlich höher als der vieler anderer europäischer Länder.
Ein noch größeres Tabu als in der deutschen Öffentlichkeit ist das Thema Kernkraft innerhalb der Partei selbst. Das erste prominentere Parteimitglied, das sich traute, es zu brechen, war Ralf Fücks. Der 73-Jährige kam wie einige Grüne seiner Generation in den 1980er Jahren über maoistische K-Gruppen zur „Atomkraft? Nein danke“-Bewegung und von dort zu der damals neu entstehenden linksalternativen Partei. Die Anti-AKW-Bewegung, die für die K-Gruppen „nur ein Durchlauferhitzer im Kampf gegen den Kapitalismus“ gewesen sei, gehöre zur DNA der deutschen Grünen, sagte Fücks in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Er war knapp zwei Jahre Bundessprecher der Ökopartei, in den 1990er Jahren Senator und Bürgermeister in Bremen und leitete dann lange die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung. „Das ist ein historisches Erbe, das die Partei nicht einfach ablegen kann. Dennoch irritiert mich diese Verfestigung zu einem Glaubenssatz, zu einem Dogma, das nicht zur Disposition gestellt werden darf. Wir sind Gefangene unserer Überzeugungen von gestern, obwohl wir uns in einer neuen Realität befinden.“1
Dieses Interview mit Fücks, der stets als Vordenker der Grünen galt, erschien im Februar 2022. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bereits seine Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, aber die Welt rätselte noch, was er vorhabe. Fücks begründete seinen Tabubruch daher nicht nur mit dem CO2-Argument: „Wir hätten die Reihenfolge des Ausstiegs aus Kohle und Atomenergie ändern sollen. Oder wenigstens eine offene Debatte führen, ob wir nicht die falschen Prioritäten gesetzt haben angesichts der globalen Bedrohung durch den Klimawandel.“ Sondern er warnte auch vor den „geopolitischen Konsequenzen unserer Energiepolitik, die uns jetzt auf die Füße fallen“ und sagte: „Wir wollten uns lange nicht eingestehen, dass der forcierte Ausstieg aus der Atomenergie in eine verstärkte Abhängigkeit von Erdgas führt.“
Er traf damit den Kern des Problems. Der deutsche Atomausstieg war von Anfang an ein Gaseinstieg. Denn was die Verfechter der Energiewende bis heute nicht wahrhaben wollen: Mit schwankenden Erzeugern wie Windkraft- und Solaranlagen lässt sich keine stabile Stromversorgung aufrechterhalten. Man braucht zuverlässige Kraftwerke, um die unzuverlässigen „Erneuerbaren“ auszugleichen. Da Gaskraftwerke flexibel sind und weniger CO2 als Kohlekraftwerke ausstoßen, schien Russland mit seinen schier endlosen Erdgasvorräten der ideale Partner der deutschen Energiewende zu sein. Der Bau der beiden Nordseepipelines Nordstream 1 und 2 wurde mit dieser Begründung vorangetrieben und von verschiedenen Bundesregierungen gegen alle Bedenken anderer Europäer und des wichtigsten Bündnispartners USA unterstützt. Selbst die rot-grün-gelbe Ampelkoalition verfolgte noch den Plan, Dutzende neue Gaskraftwerke zu bauen – für windstille und sonnenarme Zeiten. Den Brennstoff sollte Putin liefern.
Wenige Tage nachdem das Interview mit Fücks erschienen war, marschierten russische Soldaten in die Ukraine ein. Es war der 24. Februar 2022 und in Deutschland war sofort klar, dass dieser Überfall nicht nur eine sicherheitspolitische „Zeitenwende“ sein würde, sondern auch eine energiepolitische. Ohne russisches Erdgas, die Stütze des Atomausstiegs, drohte das ohnehin schon stark bröckelnde Gebäude der deutschen Energiewende endgültig einzustürzen.
Noch am selben Tag traf sich Robert Habeck, neuer Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, mit dem Vorstandsvorsitzenden des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, zu einem vertraulichen Gespräch im Wirtschaftsministerium. Mit dabei war Habecks Staatssekretär Patrick Graichen. RWE ist einer der größten Strom- und Gasversorger Deutschlands. Sein historischer Schwerpunkt liegt auf der Braunkohle. Allerdings gehören dem Unternehmen aus Essen auch fünf deutsche Kernkraftwerke. Vier davon waren Anfang 2022 bereits stillgelegt, eines lief noch: das Kernkraftwerk Emsland im niedersächsischen Lingen. Ein zweites, Grundremmingen im schwäbischen Teil Bayerns, war erst zum Jahreswechsel vom Netz genommen worden.
Der Termin mit Habeck und Graichen sei bereits lange vorher „eigentlich zu anderen Themen“ geplant gewesen, sagte Krebber mehr als zweieinhalb Jahre später als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags, der die Reaktion der Bundesregierung auf die sich damals abzeichnende Energiekrise aufklären sollte. In dem Gespräch sei die Frage aufgekommen, „inwieweit der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, die planmäßig Ende 2022 abgeschaltet werden sollten, helfen könnte“. Zwei Tage später schickte Krebber eine E-Mail an den Minister und seinen für Energiethemen zuständigen Spitzenbeamten. „Wie erbeten füge ich ein Papier bei, das die komplexen Aspekte beschreibt, die bei etwaigen Überlegungen zum Weiterbetrieb von Kernkraftwerken zu berücksichtigen wären“, schrieb der RWE-Chef und betonte: Wie man das Thema beurteile, „kann nur politisch entschieden werden“.
Mindestens sechs Kernkraftwerke hätte die Bundesregierung im Frühjahr 2022 retten können: die drei noch laufenden, darunter Emsland, deren endgültige Abschaltung für Ende des Jahres geplant war, und drei weitere, die wie Grundremmingen zwei Monate zuvor stillgelegt worden waren. Sie hätten ohne unüberwindbare Schwierigkeiten reaktiviert werden können.
Doch dazu kam es nicht. Mit Ach und Krach konnten sich die Grünen zu einer minimalen Laufzeitverlängerung dreier Reaktoren durchringen – für dreieinhalb Monate und ohne neue Brennelemente. Und selbst zu dieser Entscheidung standen die Partei und ihr Wirtschaftsminister nicht offen. Sie versteckten sich hinter einem „Machtwort“ des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Vorangegangen war ein monatelanges Ringen inner- und außerhalb der Koalition, bei dem in von Grünen geführten Ministerien mit Manipulationen und Täuschungsmanövern gearbeitet wurde, um den politischen Lebenstraum der Gründungsgeneration nicht zu gefährden. Es galt, den Atomausstieg durchzusetzen. Koste es, was es wolle.
Als die letzten deutschen Kernkraftwerke im April 2023 abgeschaltet wurden, gaben in Meinungsumfragen von ARD und ZDF fast 60 Prozent der Befragten an, dass sie den Ausstieg für falsch hielten. Sogar 18 Prozent der befragten Grünen-Wähler schlossen sich diesem Urteil an. Noch verständnisloser blickte man im Ausland auf diese Entscheidung.
Der historische Sieg der Anti-Atom-Partei war daher in Wahrheit gar keiner. Denn er zeigte aller Welt, dass das Land der nüchternen Ingenieure energiepolitisch von starrköpfigen Ideologen gelenkt wird, die weder Klimawandel noch Krieg und Krise zum Umdenken bewegen. Und er ließ immer mehr Bürger daran zweifeln, ob diejenigen, die Deutschlands Energiepolitik seit Jahrzehnten machtbewusst prägen, die richtigen dafür sind.
Dabei hätte es auch anders laufen können. Am Sonntagabend, 27. Februar 2022, begrüßte die Fernsehjournalistin Tina Hassel ihre Zuschauer mit dramatischen Worten: „Willkommen zu diesen ‚Bericht aus Berlin‘ an einem bemerkenswerten Tag, an dem sich die Grundfesten deutscher Politik in einem atemberaubenden Tempo verschieben.“ Es war der Tag, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Bundestags die „Zeitenwende“ verkündet hatte. Rund 400 Meter entfernt, im ARD-Hauptstadtstudio an der Spree, war nun der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck zu Gast. Von ihm wollte die Moderatorin wissen, was der russische Angriffskrieg für die deutsche Energiesicherheit bedeute: „Im Koalitionsvertrag steht wörtlich drin, man brauche Gas für eine Übergangszeit von circa zehn bis 15 Jahren, sozusagen als Brücke, bis man auch wirklich sauber und neutral produzieren kann. Diese Brücke ist jetzt zusammengebrochen. Was heißt das jetzt? Muss dann doch Kohle länger gebraucht werden oder Atomkraft länger am Netz bleiben?“, fragte Hassel.
Die ARD-Journalistin sprach den letzten Teil ihrer Frage so selbstverständlich und fast beiläufig aus, als hätten die Öffentlich-Rechtlichen nichts mit dem Atomausstieg zu tun. Dabei haben sie diesen durch ihre extrem einseitige Berichterstattung über Kernkraft mit herbeigesendet. Habeck wich der heiklen Frage zunächst aus, indem er nur über Gas und Kohle sprach, sagte dann aber auf Nachfrage etwas, was für ihn noch fatale Folgen haben sollte. Denn der damals frisch ins Amt gekommene Minister, dessen große Pläne vom Umbau der Industrie durch russische Panzer überrollt wurden, versprach etwas, was er nicht halten konnte: die Atomkraftfrage ohne Tabus zu prüfen.
„Es gehört zur Prüfungsaufgabe auch meines Ministeriums, auch diese Frage zu beantworten“, begann Habeck und fuhr dann so fort, wie man es von einem Grünen erwarten würde. Eine Laufzeitverlängerung würde für den kommenden Winter nicht helfen, behauptete er, „weil die Vorbereitungen der Abschaltung schon so weit fortgeschritten sind, dass die Atomkraftwerke nur unter höchsten Sicherheitsbedenken und möglicherweise mit noch nicht gesicherten Brennstoffzulieferungen weiterbetrieben werden könnten“. Die „höchsten Sicherheitsbedenken“ betonte der Minister mit eindringlicher Stimme und verbreitete damit – ob mit Absicht oder weil er es nicht besser wusste – zu bester Sendezeit Falschinformationen. Dann folgte Habecks Schlüsselsatz, der aufhorchen ließ: „Insofern ist die Frage eine relevante. Ich würde sie nicht ideologisch abwehren.“ – „Noch eine der vielen Kühe, die an diesem Wochenende oder in dieser Krise geschlachtet werden“, stellte Tina Hassel verdutzt fest und wollte zum nächsten Thema überleiten. Doch Habeck, dem beim Schlachten der heiligsten Kuh seiner Partei vermutlich nicht ganz wohl war, fiel ihr ins Wort und wiederholte: „Für den Winter 2022/23 wird uns die Atomkraft nicht helfen.“ Dass diese Aussage falsch war, zeigt der weitere Verlauf der Geschehens: Im Winter blieben die Kernkraftwerke am Netz, weil sie halfen.
Wie ernst auch immer Habeck seinen Schlüsselsatz meinte, ob er ihn sich vorher zurechtgelegt hatte oder ob er ihm vor laufender Kamera herausgerutscht ist: Das Versprechen, eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke unideologisch zu prüfen, war in der Welt. Ausgesprochen vom wichtigsten Minister einer Partei, deren Aufstieg in höchste Staatsämter eng mit dem Kampf gegen die Atomkraft verbunden ist. Die Grünen haben dieses Ziel seit ihrer Gründung in den 1980er Jahren mit einer solchen Ausdauer und einem solchen strategischen Geschick verfolgt, dass ihnen selbst Kernkraftbefürworter dafür Respekt zollen. Sollte es Robert Habeck, der 1969 geboren wurde und nicht zur Generation Gorleben zählt, tatsächlich in Erwägung gezogen haben, kurz vor Erreichen des Ziels am Atomausstieg zu rütteln: Er hätte sich mit mächtigen Gegnern anlegen müssen – innerhalb seiner Partei.
Wenn es jemanden gibt, der den erfolgreichen Kampf gegen die Kernkraft verkörpert, der dem Atomausstieg ein Gesicht gibt, dann ist es Jürgen Trittin. Der Urgrüne stammt aus Bremen, wuchs dort in bürgerlichen Verhältnissen auf und schloss sich während seines Studiums in Göttingen dem Kommunistischen Bund an. Von dort kam er 1980 zu den neu gegründeten Grünen und machte sich auf den langen Marsch durch die Institutionen. Erst war er Kommunalpolitiker, dann Landesminister in Niedersachsen. Schließlich wechselte Trittin in die Bundespolitik und wurde, als seine Partei dort 1998 erstmals an die Macht kam, Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im rot-grünen Kabinett des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder. Er war damit Chef der obersten Atomaufsichtsbehörde Deutschlands.
Am 15. April 2023, dem Tag, an dem die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet wurden, erschien in der linksalternativen taz ein großes Interview mit Jürgen Trittin. Er zog darin selbstzufrieden Bilanz und schilderte rückblickend, wie er und seine Mitstreiter vorgegangen waren: „Man hat zuerst versucht, durch die Besetzung von Bauplätzen den Neubau zu verhindern. Diese Strategie ist nicht komplett gescheitert. Es gab Planungsstopps. Aber die Nutzung der Atomenergie an sich wurde nicht beendet“, beschrieb er die militante Phase und schwärmte davon, dass sich konservative Landwirte an den Protestaktionen beteiligten. Auch das ist eine Erklärung dafür, weshalb älteren Grünen der Anti-Atom-Glaube so heilig ist: Es gelang ihnen mit diesem Thema zum ersten Mal, politische Zustimmung weit über das eigene Milieu hinaus zu erhalten. „Der Kampf gegen die Atomkraft war konstituierend für die Partei“, sagte Trittin. „Er brachte Kräfte aus sehr unterschiedlichen Ecken zusammen, vom CDU-Abgeordneten Herbert Gruhl über FDPler und SPD-Mitglieder bis zu Linksradikalen wie mir. Damit die alle zusammenkommen konnten, war eine Frage nötig, in der sie sich einig waren – und das war die Ablehnung der Atomenergie.“2
Weil die Blockaden und Besetzungen nicht zum Ziel führten, „wollten wir Grünen diesen Protest in die Parlamente tragen“, so Trittin. „Später haben wir versucht, in den Bundesländern, in denen wir regiert haben, über eine sehr konsequente Auslegung der Sicherheitsstandards die Anlagen stillzulegen. Das ist gescheitert, weil sie zu diesem Zeitpunkt so rentabel waren, dass sich die Betreiber jede Nachrüstung leisten konnten.“ Was der Vater des Atomausstiegs hier nebenbei erwähnte, ist die Bestätigung eines Vorwurfs, den Fachleute aus der Branche schon lange erheben: Den Grünen-Politikern und ihnen nahestehenden Beamten in den Aufsichtsbehörden sei es weniger darum gegangen, die Sicherheit der Kernkraftwerke zu erhöhen, sondern in erster Linie darum, den Betreibern möglichst viele Schwierigkeiten zu bereiten – bis diese aufgeben.
Wer sich bei der Umsetzung dieser Strategie besonders hervorgetan hatte, war Trittins späterer Kabinettskollege Joschka Fischer. Bevor Fischer 1998 Bundesaußenminister wurde, war er Landesumweltminister der rot-grünen Regierung in Hessen. Dort setzte er sich mit aller politischen Raffinesse dafür ein, dem Energieversorger RWE den Betrieb des Kernkraftwerks im südhessischen Biblis so schwer und so teuer wie möglich zu machen. Umweltminister Fischer und sein für die Atomaufsicht zuständiger Abteilungsleiter Wolfgang Renneberg führten wegen Biblis einen genehmigungsrechtlichen Dauerstreit mit dem Bundesumweltministerium unter CDU-Minister Klaus Töpfer. Der Streit eskalierte, als Töpfer 1994 eine förmliche Weisung an Fischer erteilte, den abgeschalteten Block A des Kraftwerks Biblis wieder anfahren zu lassen. Offiziell sträubte sich Fischer dagegen. Angeblich wegen Sicherheitsbedenken. Er pochte auf Nachrüstungen, die sein Ministerium allerdings durch eine restriktive Genehmigungspraxis erschwerte. Doch in einem Strategiepapier seines Abteilungsleiters Renneberg, aus dem das Nachrichtenmagazin Focus zitierte, wird deutlich, dass die Sicherheitsbedenken nur vorgeschoben waren – als Mittel zum Zweck im politischen Machtkampf.
Denn Renneberg schrieb in dem Papier bereits Monate bevor es zu der Eskalation kam, dass für die Grünen ein Einschreiten aus Bonn vorteilhaft wäre: „Eine Weisung wäre […] keinesfalls eine politische Niederlage des HMUB [Hessisches Umweltministerium], da sich die Risiken des weiteren Betriebs in der Öffentlichkeit vermitteln lassen.“ Eine Weisung führe „deshalb eher zu einem Legitimationsverlust Töpfers. Zudem wäre das HMUB hierdurch jeglicher Verantwortung enthoben.“ Dass man dem Betreiber eine Fristverlängerung für die Beseitigung der Sicherheitsmängel gewährt, käme hingegen nicht infrage. Denn: „Das Bild Hessens, insbesondere das Fischers, in der Öffentlichkeit als Symbol für öffentlichen Widerstand gegen die Kernenergie könnte geschwächt werden“, schrieb Renneberg laut Focus in dem internen Papier.3
Der Fall Biblis zeigt: Den Grünen war in ihrem Kampf gegen Atomkraft jedes Machtmittel recht. Systematisch instrumentalisierten sie Aufsichtsbehörden und nutzten deren vom Steuerzahler finanzierten Beamtenapparat, dessen eigentliche Aufgabe es ist, eine sichere Stromerzeugung zu gewährleisten, um ihr parteipolitisches Ziel durchzusetzen. Ein Muster, das sich im Energiekrisenjahr 2022 wiederholte. Wobei man in diesem jüngsten und vorläufig letzten Kapitel der Heldensage vom tapferen Widerstand gegen den „Atomstaat“ nicht einmal mehr genau sagen kann, wer hier wen für seine Zwecke instrumentalisiert hat: der grüne Minister seinen Beamtenapparat – oder umgekehrt. Denn in den fast vier Jahrzehnten seit ihrer ersten Regierungsbeteiligung in Hessen haben die Grünen eine Anti-Atomkraft-Nomenklatura aufgebaut, die, bestens vernetzt und munter zwischen Ministerien und Lobbyorganisationen hin und her wechselnd, die immer komplizierter werdenden Verästelungen der deutschen Energiepolitik beherrscht. Es sind einflussreiche Strippenzieher, denen jeder im Weg steht, der die Entscheidung zum Atomausstieg infrage stellt. Und sei es ein Robert Habeck.
Als Jürgen Trittin 1998 Bundesumweltminister und damit oberster Atomaufseher wurde, holte er nicht nur Joschka Fischers früheren Abteilungsleiter Wolfgang Renneberg aus Wiesbaden nach Bonn und vertraute ihm die Abteilung für Reaktorsicherheit seines Ministeriums an, sondern auch Rennebergs Chef, den durchsetzungsstarken Grünen-Politiker Rainer Baake. Der war Staatssekretär im hessischen Umweltministerium und entwickelte dort ein Konzept zur entschädigungsfreien Beendigung der Atomenergie in Deutschland. Nun sollte er es als Staatssekretär im Bundesumweltministerium in die Tat umsetzen. Baake ist eine der Schlüsselfiguren, wenn es darum geht, die Genese der deutschen Energiewende-Politik zu verstehen. Rennebergs Abteilung war ihm direkt unterstellt. Und dort wiederum wurde ein gewisser Gerrit Niehaus Leiter der Arbeitsgruppe „Bundesaufsicht bei Atomkraftwerken, Grundsatzangelegenheiten der nuklearen Sicherheit“. Niehaus spielte gut zwei Jahrzehnte später bei zweifelhaften Vorgängen im Jahr 2022 eine wichtige Rolle (siehe Kapitel 4).
Mit dem Antritt der Regierung Schröder/Fischer war den Betreibern der Kernkraftwerke klar, dass sie es fortan schwer haben würden. Denn was zuvor nur in einzelnen rot-grün regierten Bundesländern geschehen war, drohte ihnen jetzt in ganz Deutschland: Dass die Aufsichtsbehörden blockieren, verzögern und gängeln, wo sie nur können, um den Anti-AKW-Kampf mit bürokratischen Mitteln fortzuführen. Wohl auch deshalb ließen sich die Energieversorger auf Verhandlungen mit der Bundesregierung ein und stimmten am 14. Juni 2000 einer Vereinbarung zu, die als „Atomkonsens“ bezeichnet wurde. Sie erkauften sich dadurch einige Jahre Ruhe. Doch der Preis dafür war hoch: Sie stimmten dem schrittweisen Ende der Kernkraft in Deutschland zu. Statt von einem Konsens könnte man allerdings auch von Erpressung sprechen. Denn als die Verhandlungen stockten, drohte die rot-grüne Koalition damit, den Atomausstieg per Gesetz durchzusetzen.
Die Einigung sah folgendes Ausstiegsmodell vor: Jeder der 19 damals noch laufenden, kommerziell genutzten Atomreaktoren bekam eine „Reststrommenge“ zugewiesen. Sie war so bemessen, dass nach 32 Jahren Betriebszeit Schluss ist. Die Energieversorger konnten Reststrommengen von einer Anlage zu anderen übertragen, sodass manche Kraftwerke länger laufen konnten. Ein genaues Enddatum wurde also nicht festgelegt. Der Plan war, dass spätestens im Jahr 2021 das letzte Kernkraftwerk stillgelegt würde. SPD und Grüne sicherten die Vereinbarung mit den Energieversorgern zusätzlich durch einen Bundestagsbeschluss ab. Seitdem ist gesetzlich festgelegt, dass die deutschen Kernkraftwerke Auslaufmodelle sind und keine neuen gebaut werden dürfen. Spätestens damit war der Atomausstieg besiegelt. Alles, was danach kam, das Hin und Her unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel (siehe Kapitel 3), war nur noch ein Streit um das Tempo. Also um die Frage, wie lange man den Weg zum Ziel macht. Das Ziel selbst stellte lange Jahre kaum jemand mehr infrage.
Als nach der Eskalation des Ukrainekriegs im Jahr 2022 die Diskussion, ob man den Atomausstieg angesichts hoher Energiepreise und unsicherer Versorgung noch einmal verschieben sollte, nicht enden wollte, setzte Jürgen Trittin erneut sein ganzes machtpolitisches Talent dazu ein, um sie zu beenden. Er war zu dieser Zeit noch Mitglied des Bundestags. Sein Mandat legte er erst, nachdem die letzten Kernkraftwerke stillgelegt waren, Anfang 2024 im Alter von 69 Jahren nieder. „Letzten Herbst schien der Atomausstieg zu wackeln. Robert Habeck war in der Energiekrise offen für eine Laufzeitverlängerung, Sie und andere in der Grünen-Fraktion waren dagegen. Wie tief ging der Riss?“, fragte ihn die taz im großen Interview zu seinem Lebenswerk. Trittins Antwort: „In der Regierung wollte man sich nicht dem Vorwurf aussetzen lassen, dass im Winter irgendwas schiefgehen könnte. Daher gab es aus dem Wirtschaftsministerium die Überlegung, eine Laufzeitverlängerung zu machen. Ich und die meisten in der Fraktion haben die Diskussion nicht verstanden. Wir haben uns sehr beharrlich und störrisch dagegengestellt. Am Ende stand dann das Machtwort des Kanzlers, über dessen Zustandekommen ich hier nicht philosophieren will, und man hat symbolisch, um Versorgungssicherheit zu simulieren, die Dinger drei Monate länger laufen lassen.“ Aus diesen Worten wird deutlich: Es war Trittins auch ganz persönlicher Triumph, dass „die Dinger“ mitten in einer Energiekrise, die Wohlstand und Sicherheit des ganzen Kontinents bedrohte, abgeschaltet wurden.
Den Tag seines Triumphs feierte Trittin vor dem Brandenburger Tor. Dort hatte die Umweltorganisation Greenpeace zwei Figuren aufgebaut. Ein gelber Tyrannosaurus lag mit offenem Maul und zugekniffenen Augen auf dem Rücken, alle viere von sich gestreckt, umringt von rostigen Fässern mit dem Warnzeichen für Radioaktivität. Auf seinem Bauch reckte ein rotes Männlein sein Schwert in die Luft. Das Gesicht des Männleins war die rote Sonne des „Atomkraft? Nein danke“-Emblems. Auf dem Dinosaurier stand, damit es wirklich jeder versteht: „Deutsche Atomkraft – Besiegt am 15. April 2023!“ Es war der Tag, an dem die drei letzten deutschen Reaktoren vom Netz gingen. Trittin, der Drachentöter, lächelte zufrieden in die Kameras. Doch er stand dort ziemlich allein. Weder das vom Joch des „Atomstaats“ befreite Volk jubelte ihm zu, noch ließen sich prominente, jüngere Unterstützer aus seiner Partei blicken. So wirkte der siegreiche Bezwinger der angeblichen Dinosauriertechnologie selbst wie aus der Zeit gefallen.
KAPITEL 2: Das Märchen von Wind und Sonne
Die Erfindung der Dampfmaschine war für die Menschheit bedeutender als die Mondlandung. Jahrtausendelang war der Mensch auf die Kraft seiner Muskeln, die seiner Tiere und auf die wechselhaften Launen der Natur angewiesen gewesen. Als die Engländer Thomas Savery und Thomas Newcomen zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine mit Wasserdampf angetriebene Pumpe erfanden, war das der Beginn der industriellen Revolution – einer fundamentalen Umwälzung der Arbeits- und Lebenswelt des Menschen, die den Planeten veränderte und seinen intelligentesten Bewohner auf eine neue Entwicklungsstufe hob.
Mit der Dampfmaschine, die von James Watt noch verbessert wurde, gelang etwas, wovon der Mensch seit der Antike träumte: Mechanische Energie, Arbeitskraft, stand plötzlich schier unbegrenzt zur Verfügung – zumindest, solange die Holz- und Kohlevorräte reichten – und das zuverlässig und steuerbar. Die Dampfmaschine eroberte Branche für Branche und schuf ganz neue Industriezweige. Bis ihr der Verbrennungsmotor und die Elektrizität den Rang abliefen.
Die Politisierung der Energieversorgung
Die Geschichte der Nutzung von Energie kennt eigentlich nur eine Richtung: hin zu mehr Effizienz, höherer Ausbeute, besserer Verfügbarkeit. Es gibt gute Gründe dafür, dass Windmühlen und Segelschiffe nur noch von Nostalgikern gepflegt werden. Doch mit der „Energiewende“ kam in Deutschland die Idee auf, diese Entwicklungsrichtung umzukehren. Die Bundesrepublik will den Beweis antreten, dass sich ein Industrieland mit elektrischem Strom aus Wind und Sonne versorgen lässt – und begibt sich damit aus freien Stücken in die mühsam überwundene Abhängigkeit von den Launen der Natur. Dass dies ein Fortschritt sein soll, ist die politisch erfolgreichste Märchenerzählung seit „Des Kaisers neue Kleider“.
Die utopisch anmutende Idee hat ihren Ursprung in den USA. Sie stammt von Amory Lovins, einem amerikanischen Physiker, der es in der Wissenschaft nicht weit brachte, aber als radikaler Umweltaktivist weltweit Gehör fand. Nach der Ölkrise der 1970er Jahre stießen seine Vorstellungen vom Umbau des Energiesystems, verbunden mit der Abkehr vom Streben nach Wohlstand und wirtschaftlichem Wachstum, in kapitalismuskritischen Milieus des Westens auf fruchtbaren Boden. Ganz besonders in der Bundesrepublik, wo die junge Anti-Atomkraft-Bewegung nach ideologischem Rüstzeug suchte.