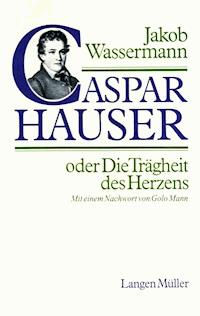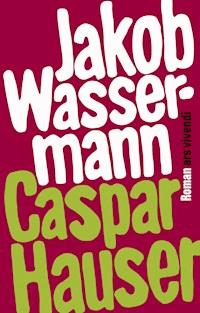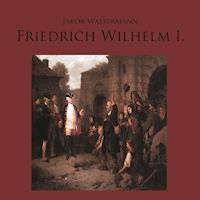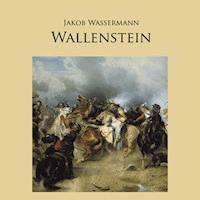1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alexander von Makedonien, genannt „der Große“ erfüllte alle Voraussetzungen, um in den Augen seiner Zeitgenossen und der nachfolgenden Geschlechter zum Mythos zu werden: ein fähiger Kopf und eine schöne Gestalt, die Gunst der Stunde und das Erfordernis der Zeit. Siegreich zieht er mit seinen Heerscharen durch Persien und Baktrien nach Osten, bis an den Indus. Kein Feldherr vor ihm hat solche Fernen durchmessen, hat so ausgedehnte Gebiete in so kurzer Zeit unterworfen. Der Erfolg macht ihn einsam und trägt ihn in die Nähe der unsterblichen Götter empor. Aber plötzlich ist alles zu Ende. Als eine Krankheit ihn befällt, bietet der endlos Siegreiche ihr keinen Trotz. Sein Reich ist nicht von Bestand, es zerfällt in den Kämpfen seiner Nachfolger. Der Roman von Jakob Wassermann setzt ein beim Todesmarsch durch die Wüste. Über dessen glücklichen Ausgang freuen sich zwar die Soldaten, aber Alexander bleibt distanziert und nüchtern. Von der anschließenden Ankunft in Susa bis zu Alexanders Tod in Babylon wird dessen Leben dargestellt - begleitet von schwarzen mystischen Vorzeichen, an die Alexander nicht glauben will, aber die er nicht ignorieren kann. Die sind auch ein wichtiges Element der Handlung und dienen recht gut dazu den Verfall Alexanders darzustellen - seine Hybris wird auch dadurch bestraft. Neben dem Tod eines engen Vertrauten und die immer wieder auftauchenden Warnungen gerade in mystischer Hinsicht, seinem unberechtigt schwindenden Vertrauen auf seine makedonischen Soldaten sind das die Kernelemente die ihn zum Ende führen. Besonders interessant ist die Figur seines Halbbruders, der träumend es doch schafft sich immer mehr und mehr Alexander anzunähern und ihm die Drohung seines Endes darzustellen durch sein seltsames Verhalten. Schlussendlich stirbt Alexander - im Tod alleine und von Allen vor allem um eine Nachfolgeregelung bedrängt, die er nicht trifft. Weil er, in seiner Hybris, sich den Tod nicht vorzustellen vermag, aber dennoch nicht gegen den Eigenen ankämpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alexander in Babylon
Historic Adventures Band 4
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenAlexander in Babylon
Historic Adventures – Band 4
Jakob Wassermann – Alexander in Babylon
1. eBook-Auflage – April 2013
© vss-verlag Hermann Schladt
Titelbild: Armin Bappert
unter Verwendung eines Fotos von http://www.pixabay.com
Lektorat: Hermann Schladt
Jakob Wassermann
Alexander in Babylon
Historischer Roman
Vorspiel
Am neunten Tage des makedonischen Monats Lus begann die Not aufs höchste zu steigen.
Die Wachen bei den zusammengeschmolzenen Vorräten von Fischmehl und getrockneten Fischen rissen, vom Hunger überwältigt, die königlichen Siegel ab; als sie die erste Gier gestillt hatten, teilten sie auch andern aus, was sie bewahren sollten, von den gleichfalls hungernden Kamelen umdrängt, welche schrien. Der Thessaler Pasas war unter den Frevlern der erste gewesen.
Von unheilvoller Ahnung gefasst, standen in geringer Entfernung die Befehlshaber. Keiner wagte dazwischenzutreten oder den Vorfall zu melden.
Pasas' beide Hände waren mit der weißen, staubähnlichen Speise gefüllt, und er lachte; lachte wie jener Philistion, von dem man erzählt, dass er an unmäßigem Lachen gestorben sei.
Einige Makedonier der Edelscharen kamen hinzu. Sie wollten nicht an der Untat teilnehmen, obwohl der Hunger sie quälte, als ob glühende Eisenkugeln durch ihre Gedärme rollten. Ihre Blicke richteten sich stumpf nach Osten; es war, als sähen sie noch die reichen Städte, die sie dort verlassen hatten. Aber ringsum breitete sich die Wüste aus, dunkelgelb und regungslos.
Die Nacht brach an. Sie kam nicht allmählich, sondern plötzlich wie der Schrecken. Die Söldner, die sich gesättigt hatten, suchten mit brennender Kehle nach Wasser; die salzige Nahrung hatte ihren Durst ins Unerträgliche gesteigert. Sie scherten sich nicht um die hohläugig im heißen Sand keuchenden Kameraden und traten auf die dunklen Körper, die zu erschöpft waren, um Gegenwehr zu leisten. Kein Lagerfeuer flammte mehr; nur weit im Rücken des Heeres, bei den phönikischen Kaufleuten, stiegen einige Brände empor, genährt durch die wohlriechenden und kostbaren Nardenwurzeln.
Einer von den Suchenden stieß ein misstönendes Triumphgeschrei aus. Neben einer aufgewehten Düne hatte er eine Pfütze mit brackigem, stinkendem Wasser entdeckt; er lag schon bis zum Gürtel darin und trank nicht nur mit den Lippen, sondern mit dem ganzen Gesicht. Schwer atmend warfen sich andere neben ihn und tranken lautlos, bemüht, ihren Fund geheim zu halten. Ihre Körper erstarrten vor Wollust.
Aber als hätten sie das Wasser in der Luft gerochen, erfuhren es die nahe lagernden Scharen der Messenier. Mit kraftlos wankenden Beinen stürzten sie herbei und verloren unterwegs Helme und Mützen. Nach wenigen Augenblicken bezeichnete ein Haufen von Gliedmaßen, Rümpfen und Köpfen die Stelle, wo vorher das elende Rinnsal gewesen, und Hunderte von Zuspätkommenden scharrten heulend im Sand.
Keine Schlafesruhe herrschte im weithin verstreuten Lager, sondern die bleierne Stille vollständiger Ermattung. Die Sterne brannten groß und rot, die Milchstraße lief als weißglühendes Band von einem Saume des Himmels zum andern. Da und dort hockten Söldner aufrecht und lauschten mit fiebernder Angst auf das ferne Gebrüll wilder Tiere.
Spät nachts schlich ein Fußsoldat zu einem Gepäckwagen, wo Pferde angebunden waren. Mit dem kurzen Schwert durchschnitt er einem der Tiere den Hals; er sank zu gleicher Zeit mit ihm nieder, als es zusammenstürzte, und ließ das herausschießende Blut in seinen verdorrten Rachen strömen.
Als der Morgen kam, lief der Arkader Amissos zu seinem Rottenführer. Ohne zu sprechen, das hohlwangige Gesicht von Freude gebläht, deutete er in die Ferne.
Viele sahen hinüber: Zypressen hoben ihre grünen Leiber über den Rand der Wüste, und dahinter war etwas wie ein schimmerndes Dach, auf Säulen gestützt. Einige begannen schon zu jauchzen, da, als hätte ein Sturm es fortgeblasen, war das entzückende Gebilde hinweg.
Amissos fiel wie ein Erschlagener auf den Boden; man schaffte ihn auf einen der Transportwagen, auf denen sich Kranke und Verschmachtende befanden. »Mein lieber Amissos«, sagte dort ein weißbärtiger Hauptmann zu ihm, »ist es nicht ein Jammer, geboren zu werden, wenn man so sterben muss? Wo sind unsere Täler, unsere Weinberge, unsere süßen Plätzchen vor dem Stadttor, wo man plaudernd aufs Meer blickte?«
»Schweig, alter Hund!« stöhnte ein anderer, der durch den Genuss verdorbener Speisen eine Seuche bekommen hatte. »Siehst du nicht, dass wir in Ruhe sterben wollen? Was peinigst du uns noch mit deinem verdammten Plätzchen am Stadttor?«
Und Amissos blickte auf; alle blickten auf und sahen die Wüste, die zitronengelb, trocken und leer war. In unheimlicher Blässe wölbte sich der Himmel darüber, in der Tiefe von einem rötlichen Ring zitternder Luft eingesäumt. In dem übermäßig in die Länge und Breite gedehnten Zug des Heeres sah man Reiterscharen in unabsehbarer Kette, Ross auf Ross, Mann hinter Mann. Die Pferde ließen den Kopf mit dem schaumtriefenden Maul tief hängen. Bisweilen stürzte eines zusammen wie ein ausgebrannter Holzstoß; die Lücke, die sein Fall verursacht, blieb noch stundenlang sichtbar. Die verglasten Augen von Tier und Mensch fragten nach keinem Ziel mehr. Herz und Gehirn verbrannten ihnen.
Das Mittagsgespenst zog umher in der träumenden Öde. Langsam erhob sich Staub wie die Luftbläschen im Wasser; er legte sich in die Poren der Haut und versengte sie. O Konon, wo sind deine Verse, deine unverschämten Scherze, dein feiles Schmeichlerwesen?
Konon, der Literat, befand sich unter dem Tross des Heeres. Ein Dutzend goldene Becher, fünf Halsbänder und einen Purpurmantel brachte er aus Indien mit. Jetzt waren alle Gedichte klanglos und überflüssig, der Purpurmantel hing schmierig und zerfetzt von der Schulter, Gold war wertlos und lästig.
Auf den Wagen hockten stumpf in sich vergraben die Weiber. Manche hielt einen Säugling verzweiflungsvoll in den Schoß gepresst, als wollte sie ihn wieder zurückschieben in die Urnacht des Mutterleibes, wo ihm selbst aus dem erschöpftesten Blute noch Nahrung zufließt. Andere gingen zu Fuß und schleppten größere Kinder an der Hand; wenn sie endlich in den brennenden Sand niederstürzten, gellte ihr Hilferuf noch lange in die gleichgültigen Ohren der Weiterziehenden. Lesbische Mädchen, milesische Tänzerinnen, Buhlerinnen aus Ägypten, syrische Dirnen lagen im Sand umher und starben unter Qualen.
Als die Raststunde kam, hieß es auf einmal, Wasser sei im Lager. Wie ein Wurm, der langausgedehnt im Erdreich gekrochen, sich zur Nacht zusammenrollt, so kamen stundenlang noch die erschöpften Nachzügler durch die Finsternis. Ein Wasseräderlein, schmal wie eine Hand, floss über eine Felsrinne. Tausende, durch keinen Zuruf, keinen Befehl zu bändigen, hatten sich darüber hingestürzt und leckten winselnd den feuchten Stein. Eine Abteilung Rundschildner zerschlug mit ihren Äxten Gerät, Leitern, Sturmböcke, Wagendeichseln; sie machten Feuer damit und schlachteten einige Pferde und einen kranken Elefanten.
Indessen fiel weit im Norden, in den Gebirgen Gedrosiens, ein Wolkenbruch herab. Das Wasser raste durch die Felsentäler ins offenere Land, hinunter in die Wüste. Mitten in der Nacht kam die Flut; der armdicke Bach schwoll an, ehe die Schläfer an seinem Rand sich retten konnten. Männer, Frauen und Kinder, die Tiere, die verglimmenden Feuer, die Waffen, die Zelte, alles wurde fortgeschwemmt. Entsetzliche Schreie mischten sich in das hohle Brausen der Wässer, in ihr Zischen im Sand, Gebete, Verwünschungen, Todesröcheln, Gelächter des Wahnsinns erschallten. Und nach einer Stunde war alles wie vorher, die wilde Woge versickert, und die immer noch eintreffenden Nachzügler standen verschmachtend da. Sie warfen sich hin und befeuchteten Lippen und Zunge an den nassen Kleidern und Leibern der Toten, an den aufgelösten Haaren der Dirnen, am Purpurmantel Konons, der dalag und eine Manuskriptenrolle krampfhaft mit den erstarrten Händen umschloss; es war ein Lobgedicht auf Hephästion, den Führer der Edelscharen und Freund des Königs.
Es wurde verkündet, dass König Alexander den folgenden Tag zum Rasten bestimmt habe: von nun an solle nur in der Nacht marschiert werden.
Alexander lag auf einem niedrigen Ruhebett im Zelt, am Lagerende saß Hephästion, die Knie übereinandergeschlagen, den Rumpf weit vorgebeugt. Alexander flüsterte, seine weißen Zähne funkelten feucht durch die Halbdunkelheit bei jeder Bewegung der Lippen. Der Kopf begleitete fast jedes Wort mit einem leidenschaftlichen Nicken. Er richtete sich auf, die etwas schiefe linke Schulter schien wie von einer unsichtbaren Last beladen, er nahm beide Hände Hephästions in die seinen und sprach und sprach und flüsterte und flüsterte. Ein dunkler aufgeregter Singsang von Worten: Beteuerungen, Pläne, Ungeduld mit der Not der Stunde, es war, wie wenn ein Riese lästernd den Boden stampft und zugleich, wie wenn ein Kind stammelnd trotzt; dabei verriet das sprühende Auge Schmerz über den Ausbruch.
Hephästion schwieg. Doch sein still brennender Blick hatte Worte genug: Wogegen eiferst du, wogegen empörst du dich? Die Elemente sind dir nicht zu Willen, gedulde dich; fasse dich, unglückseliges Herz, lass dich nicht hinreißen!
Mit nackten Füßen schritt Alexander auf und ab; auf und ab, immer schneller, immer wilder. Das mantelartige Nachtgewand flatterte hinter ihm her. Er murmelte unverständliche Worte, seine Fäuste ballten sich, die Haut seines Gesichtes spannte sich, die nassen Haare bedeckten die Stirn und die eine Wange. Er ging hin und riss den Vorhang der Zelttür herab.
Fahl glänzte der Morgen aus dem tiefen Osten der Wüste herauf. Wie Urweltschatten standen aufgewehte Dünen links und rechts. Die Wachen waren hingesunken. Ein einziger Mann stand gegen einen Pfahl gelehnt, schwarz und still.
Unergründliche Einsamkeit!
Mit einem Blick des Außersichseins starrte Alexander hinein in die Ödnis. Es war, als fordere er die Wüste zum Zweikampf heraus.
Beim Aufbruch am Abend erhob sich ein Sturmwind, der die spärlichen Merkzeichen des Weges verwehte. Die von der Küste mitgenommenen Führer wussten nicht aus noch ein, sie blieben auf der Stelle und rührten sich nicht, eingeschüchtert durch die Verzweiflung der umstehenden Edelknaben Alexanders. Die Wahrsager suchten sich mit Hilfe der Sternbilder zurechtzufinden.
Charmides, einer der jüngsten Edelknaben, hockte auf seiner nysäischen Stute, die Knie wie im Krampf emporgezogen, die Augen geschlossen. Bisweilen tastete er wie ein Schlafender über den Hals des Tieres hinaus, als suche er seine Gefährten. Doch viele waren schon dahin: der blondgelockte Philippides, den eine indische Sklavin so verzaubert hatte, dass er ihretwegen die fremden Götter anbetete; Medon, von Alexander besonders geliebt wegen seiner Tapferkeit; Himeneus, der schönste Jüngling aus Pella, Amphinomos, der Liebling des Leibwächters Ptolemäos. Die Sonne hatte sie getötet, der Sand begraben.
In dumpfem Schmerz die Augen öffnend, sah sich Charmides plötzlich allein. Das ganze Heer schien vom Erdboden eingesogen zu sein. Rötlich-schwarze Luft zitterte um ihn, sein Kopf war weit in den Nacken gebeugt, wie nach rückwärts abgebrochen. Schon stockte ihm das Herz. Die Haut des ganzen Körpers war aufgequollen. Da ertönte eine Stimme, schauerlicher als die des Hierophanten bei den Mysterien. War es die eines Gottes, die eines Sterbenden? Das gänzlich erschöpfte Pferd wankte noch einmal nach vorwärts, dann blieb es, als seien die Sehnen seiner Knie zerschnitten, jäh an einen spitzen Felsen gelehnt stehen. Der blutige Schaum tropfte hörbar aus seinem Maul auf den Boden. Seine Haut erzitterte, dann rührte es sich nicht mehr. Im Stehen verendete es, erstarrte es.
Charmides ließ sich herabgleiten. Er wollte rufen. Indem er den Mund öffnete, bemerkte er mit namenlosem Entsetzen, dass die Luft auf seinen Lippen keinen Klang gab. Er warf seine Arme über den Rücken des Pferdes und legte die Stirn auf die noch dampfende Weiche. Ein letztes Bild sah sein innerlich brechendes Auge: die rosig goldenen Hügel am Strand von Ambrakia, dort, wo die Heimat war.
Die Dunkelheit der Nacht konnte nicht die qualvollen Verzerrungen der Gesichter verbergen. Jedem spiegelte sich das eigene Schicksal im Leiden des andern ungemildert. Das Auge der Tiere redete menschlich im Jammer des Untergangs, das der Menschen flackerte tierisch. Die Ordnung des Heeres war aufgelöst, alles taumelte durcheinander, ein wüster Haufe unzertrennlicher Schatten. Die Kräftigeren lechzten nach dem Blut derer, die sich schon mit dem Tod schleppten. Das Flehen der Niedergefallenen ertönte schauerlich; sie lockten die Hyänen an mit ihrem Geschrei. Überall lagen wahnsinnig Gewordene und wühlten die nackten Arme in den Sand. Trotz der vielfachen Sterbenslaute, des Ächzens, Röchelns, des Wehegestöhns der Weiber, Wimmerns der Kinder, des beständigen Schwirrens der Luft herrschte doch eine eigentümliche Stille. Es war, als ob alle diese Töne und Geräusche aus dem Innern der Erde kämen. Noch wurde der Weg für die Zurückgebliebenen, die sich wieder aufraffen konnten, deutlich bezeichnet. Aber einige Stunden, und der Flugsand begrub alles: die Leichname jeden Alters und Geschlechts, die Kadaver von Pferden, Hunden, Kamelen und Mauleseln. Da lagen fortgeworfene Helme, Schilde, Schwerter, Bogen und Speere. Da lagen goldene Becher, Perlen und Geschmeide; Ohrgehänge aus Elfenbein, zu wunderschönen Figuren geschnitzt; weiße Lederschuhe mit gefärbten Sohlen und hohen Absätzen; Tigerfelle, goldverzierte Kästchen und kleine Schränke, in denen Bartschminke und Salben aufbewahrt wurden; musselinene Unterkleider, Kleider aus Baumwolle, weiß wie Schnee, die den Namen des Besitzers mit Silberfäden eingestickt trugen; Münzen aller Art, silberne Rauchpfannen, kupfernes Kochgeschirr, Kämme aus Gold, goldene Ringe, goldene Statuetten und goldene Spiegel.
Unberührt von den zerstörenden Mächten der Wüste, ging der Inder Kondanyo mitten in einem Haufen von Söldnern. Ihre Gesichter waren fahl, ihre Augenlider fingerdick geschwollen, ihre Lippen schwarz. Doch wenn Kondanyo sprach, zuckten die Leiber, die erstorbenen Augen schimmerten ein wenig, und sie suchten die Schritte der blutenden Füße leiser zu machen, um kein Wort zu verlieren.
Nikokles, ein Kyprier, der durch seine Grausamkeit berühmt war und der mehr Menschen aus bloßer Lust am Mord umgebracht hatte als andere in der Schlacht, brach vor Kondanyos Augen zusammen. Einige Söldner schritten über ihn hinweg und wandten die Blicke ab, um ein Bild nicht sehen zu müssen, das ihnen ihr eigenes Los ausmalte.
Kondanyo blieb stehen, beugte sich nieder und suchte den Mann aufzurichten.
»Wasser, Wasser«, ächzte Nikokles.
»Helft mir doch, Freunde, verlasst ihn doch nicht so«, rief Kondanyo. »Du, Euius, du bist noch am kräftigsten, lauf doch voran, lauf doch zu den Wagen dorthin.«
Keiner drehte sich um. Euius zögerte, dann schüttelte er apathisch den Kopf und wankte mit den andern weiter. Sie fürchteten sich, zu verweilen, sie hatten Angst, dass ihre Beine den Dienst versagen würden, wenn sie stehenblieben. Lieber wollten sie die Gegenwart des Inders entbehren.
Bald war Kondanyo mit dem kyprischen Söldner allein. Weit drüben im Felsgelände wimmelten unkenntliche Menschenhaufen.
Nikokles lag mit offenen Augen da. Er röchelte schwer. Kondanyo kauerte neben ihm, hob den Kopf des Söldners ein wenig empor und legte ihn auf seinen Schoß. Lange blickte er gedankenvoll vor sich hin, der Schmerz füllte seinen Mund, so dass ihm die Worte versagten. In den erstarrenden Augen des Kypriers war etwas seltsam Verlangendes, als ob er nur einen einzigen Hauch des Trostes suchte, um leichter sterben zu können.
Kondanyo schüttelte den Kopf. Dann legte er die Hand auf Nikokles' Stirne, beugte sein Gesicht noch tiefer herab und begann zu erzählen. Er wusste, dass es nur der Schall sein sollte, nur der tröstliche Klang einer Menschenstimme zur Bekämpfung des Verlassenheitsgefühls. So begann er vom erhabenen Prinzen Siddhatto zu erzählen, dem Sohn der Königin Maya, der zum Fluss Anoma ging und mit dem Schwert sein schönes Haupthaar abschnitt und unter dem Baum der Ziegenhirten mit der Welt rang, und wie er erkannte, dass der Tod besser sei als das Leben.
Nikokles, diese grausame Geißel des Krieges, hörte mit langsam sich schließenden Augen zu. Er tastete nach der Hand des Greises, um sie zu küssen, und bevor er starb, verschönte ein Lächeln die wundgebissenen Lippen.
Schlaflose Rast im brennenden Tag. Quellen gab es nicht mehr, die Brunnen waren eingestürzt, die Pfützen versiegt.
Alexander ritt mit den Leibwächtern Seleukos und Leonnatos und dem Kanzler Eumenes gegen Süden, um die Küste des Meeres zu suchen. Fast nur durch das Erstaunen über Alexander aufrecht erhalten und mitgerissen, folgten ihm die drei auf ihren mühsam hinschleichenden Tieren. Gesicht, Gehör, Gefühl, alle Sinne waren ihnen erstorben. Sie würgten die eigene Zunge, die als schwarzer Klumpen im Gaumen lag, gegen den Rachen.
Eumenes redete irr. Der riesenhafte Seleukos zitterte an allen Gliedern in geheimnisvoller Furcht. Dem Leonnatos drangen fortwährend dicke Tränentropfen aus den gelblichentzündeten Augen, und er suchte sie mit den Lippen aufzufangen.
Alexander wandte den Kopf nicht nach ihnen zurück, als dürfe nichts sein Vorwärtsdringen hemmen. Unmenschlich litt er durch Durst. Seit zweieinhalb Tagen hatte er nichts mehr genossen. Aber: der Tod, den gibt es nicht! stand in den flammenden Augen geschrieben, die die Lüfte und die Erde zum Gehorsam zwingen wollten.
Es war hoffnungslos. Nach fünf Stunden mussten sie umkehren. Ein ausgetrockneter Wasserlauf diente als Richtungszeichen. Die Scharlachröte des Sonnenuntergangs bedeckte den Himmel, als sie wieder ins Lager kamen. Im Norden stand eine lange Wolke ganz in offener Glut. Nur Feuer schien die Erde, schien der Himmel zu atmen.
Langsam ritt Alexander zwischen den hingeworfenen Körpern der Edelscharen hindurch.
Als er vom Pferd stieg, sah er einen Söldner, der mit der letzten Gier seiner vergehenden Kräfte an der leeren Brust eines Weibes sog.
Dämonisch glotzende Augen waren auf ihn gerichtet. Nur allmählich erkannten sie ihn durch den Dunst ihres Fiebers hindurch. Sie krochen heran, mühselig krochen sie auf ihn zu, die Überwinder Asiens. Ihre Arme waren steif ausgestreckt, ihre Gewänder zerrissen, ihre Bärte von Blut verklebt; einige hatten Sand im Mund und lachten wirr, einige hatten sich in der Wahnsinnsqual Haut und Fleisch von den Händen gebissen. »Hilf uns, Alexander!« schrien sie mit wutverzerrten Gesichtern und ohnmächtig geballten Fäusten. »Rette uns doch, wenn du Gottes Sohn bist! Zeig doch jetzt, dass du Gottes Sohn bist! Hilf uns, rette uns!«
Alexander trat in die Mitte der Schreienden. Sein Haupt war gesenkt, die Augen waren geschlossen. Der Ansturm eines furchtbaren Zweifels war auf dem Gesicht zu lesen. Ein Seufzer entdrängte sich der Brust, und die Züge verzogen sich zu lautlosem Weinen. Bestürzt wichen die Makedonier zurück. Vor diesem Anblick schauderte ihnen noch mehr als vor der Wüste.
Als die Nacht kam, erhob sich von der Erde, wer noch Leben in sich fühlte. Strahlenlos, mattlohend, stand Stern bei Stern. Die Seelen der Hingegangenen schwirrten klagend zu ihnen empor und kehrten klagend wieder, zu ewiger Ruhelosigkeit verdammt, denn ihre unbegrabenen Leiber schützte kein Purpurtuch. Alexander vernahm ihre Not, sein Arm streckte sich den Schattengestalten abwehrend entgegen. Seine weitgeöffneten Augen durcheilten den Kreis des Fiebers und der Leiden.
Die rosige Finsternis bauscht auseinander, das Meer wird sichtbar, über das Wasser schreitet eine Frau. Um ihre Knie wallt ein sternengesticktes Tuch, sie schwingt die Fackel im Arm, sie heult und schluchzt wie das Meer selbst, und wenn sie aufhört zu heulen und zu schluchzen, kommt ein herzzerreißender Gesang, orphisch düster. Es ist die Mutter, ist Olympias, die Fürstin, die Geheimnisvolle, die Priesterin von Samothrake, die Feindin der Menschen. Wohin geht sie? Woher kommt sie? Ihrem geöffneten Mund entströmen Flammen, zwischen den Zähnen hält sie blutiges Opferfleisch, die Woge, die ihr Fuß betritt, prallt kreischend zurück wie ein geschlagener Hund, in ihren Augen ist Mord, Blut, Zerstörung, Verachtung des Schicksals. Sie stürmt auf Alexander zu; aufgewühlt von Schreckgesichten flieht sie vielleicht vor dem Tod, an den sie nicht mehr geglaubt hat, seit sie in den Armen des libyschen Gottes gelegen und Alexander mit ihm gezeugt hat.
Ihn hat stets der Schrecken von der Mutter ferngehalten. Er blickt in seine Jugend und Jünglingszeit zurück, als ob dreizehn Jahre nicht gewesen wären, er erlebt sie noch einmal, er sieht befremdet sich selbst, den schwermütigen Knaben am Hof zu Pella, ratlos vor den Mächten in der eigenen Brust, stets erstaunt und beklommen in diesem Brodem der Ausschweifungen, der Ränke, des Argwohns, der grausamen Übeltat. Vater und Mutter einander nach dem Leben trachtend; angeberische Schleichhunde hinüber und herüber; boshafte Diener, den Todesaugenblick des Königs erlauernd; Kriegslärm, Parteigezänk, erlogene und erborgte Prunkfeierlichkeiten, friedloses Vorüberhetzen der Tage, zernagende Ungewissheit der Zukunft. Und Alexander selbst, allen Ehrgeizigen ein Hemmnis, willkommene Beute der Verleumder, die Einsamkeit fürchtend, weil sie den Meuchelmörder verbergen konnte, und dann die grauenvollen Stunden bei der Mutter! Wie sie ihn liebkost, wie sie ihn züchtigt! Wie sie ihn nachts aus dem Bett reißt und hinausschleppt in das Unwetter und ihn an den Rand eines feindlichen Lagerfeuers trägt, um zu erproben, ob er sich fürchte, und wie sie triumphierend aufschreit, ihn an die Brust drückt und seinen ganzen Körper mit Küssen bedeckt, als er lächelnd in den Wald der aufgesteckten Lanzen weist!
Doch wenn er träumend, mit gesenktem Kopf umhergeht, zerrt sie ihn bei den Haaren über den Palasthof und schlägt ihn unter dem Geschrei und Gelächter der Mägde so lange, bis er sinnlos liegenbleibt.
Der Vater ist all diesem abgewandt, zwischen Krieg und Wollust teilt sich sein Leben; er hasst das verschlossene und beobachterische Wesen Alexanders, er fürchtet die Jugend, je mehr ihm vor dem Altwerden graut. Er ist so gottlos wie klug, so unmäßig wie tapfer; Blutschande und Knabenliebe, Verrat und Mord machen sein Lager und sein Haus zu einem verruchten Aufenthalt; mit den ekelsten Dirnen und den widerlichsten Schmarotzern entwirft er zwischen zwei Schlachten Anschläge auf das Leben seines Weibes und seines Sohnes. Alexander muss fliehen. Die winterliche Unwirtlichkeit der Gebirge lehrt ihn die Not kennen, er verzweifelt an sich und der Welt, der leidenschaftliche Brief der Mutter, worin sie ihn an seine göttliche Abkunft mahnt, lässt ihn gleichgültig, bitter ist ihm die Gegenwart, trostlos die Zukunft, der Vergangenheit will er nicht gedenken. Die Tage vergehen am Strand des illyrischen Meeres; die weitgeschwungene Linie zu sehen, in der sich Himmel und Meere vereinigen, kann ihn allein noch beruhigen, der Anblick der Dinge und Menschen ist ihm ein Greuel, sein Gang, sein Blick, seine Miene sind die eines Verstörten, Verstoßenen, eines Wahnsinnigen. Seine fünfzehn Jahre enthalten die Erfahrung von hundert.
Da kommt Hephästion. Schüchtern und unbemerkt hat er sich schon am königlichen Hof in Alexanders Nähe gehalten. Alexander hat ihn nie gesehen, seine meist gesenkten Augen sind den begegnenden Blicken stets ausgewichen. Hephästion ist in Athen gewesen; die Lehren und das Beispiel wahrhafter Philosophie haben seinen Geist gereinigt und geschärft. Er sieht das Vaterland, wenn auch ruhmvoll nach außen, im Innern von Schmach bedeckt. Auf Alexander richtet sich seine Hoffnung, und so tritt er zu dem Flüchtling am Meer. Unvergessliche Stunde! Unvergesslich ist die erste innige Frage Hephästions und seine tiefe Stimme, die ein wenig gebrochen klingt durch die Fülle des Herzens. Dann Alexanders Schweigen, sein Trotz, sein Weinen, seine endlosen Klagen - und Hephästion stumm, stumm sich niederbeugend; der sanfte brüderliche Kuss! Da erwacht Alexander, und der Himmel zeigt ein anderes Antlitz. Er erzittert, bis zum Abend zittert sein Leib, er wirft die Gewänder ab und stürzt sich ins Meer, seine Glieder verlangen nach Kampf, er tobt den schäumenden Wellen entgegen.
Im Gespräch teilen sich die Seelen einander mit. Die Zukunft gewinnt Gestalt. Hat Alexander sich bis jetzt wie ein Tier verkrochen, wie ein Tier, wie ein Sklave stumpf das Unvermeidliche ertragen, so drängt er jetzt den Göttern entgegen, zu Göttlichem scheint er sich auserlesen, und er glaubt an die göttliche Umarmung der Mutter.
Und es kommen Tage und Nächte, in denen Zweifel und Zuversicht wechseln, Beklommenheit und Raserei, Gottesgefühl und Menschenangst. Hephästion ist der Wärter der kranken, aufbrüllenden Seele. Alle andern fürchten Alexander; es geht die Sage, sein zorniger Geifer wirke wie Gift; er ist gemieden, seine Gegenwart verbreitet Entsetzen.
Die Freunde gehen nach Athen. Die lasterhafteste aller Städte flößt Alexander einen Abscheu ein, der ihm den Schlaf raubt. Auf ihn wirken die geringfügigsten Eindrücke mit erschreckender Maßlosigkeit. Maßlos ist sein Tun, sein Denken, sind seine Träume, seine Befürchtungen, seine Pläne. Seine Körperkraft ist unerschöpflich, Übungen ermüden ihn nicht, die wildesten Pferde bändigt er leicht; wer ihm zum Ringkampf gegenübertritt, den besiegt er fast schon durch seinen glänzenden Blick, in den Schulen der Philosophen erregt sein Geist Aufsehen, er verachtet das Herkommen und verficht alles Neue; wahrhafte Größe und Schönheit kann ihn so erschüttern, dass er tagelang wie besinnungslos bleibt, und selten sind die Stunden, in denen sein Gemüt zur Ruhe gelangt. Dann aber geht etwas Bezauberndes von ihm aus, und die ihn so sehen, sind ihm für immer verfallen, wer sein himmlisches Lächeln einmal gesehen hat, kann es nicht mehr vergessen.
Ohne Hephästion hätte alles einen andern Weg genommen. Jetzt erst, in der Wüste, wo das Lebendige vor seinem letzten Ende stand, jetzt fühlt Alexander, an welchen Abgründen der Natur er vorübergegangen ist. So ganz zurückdenkend, zurückschauend, zurücklebend, erkennt er in Hephästion den Retter, der an der Schwelle eines jeden Morgens der Sonne das Licht voranträgt. Und welch ein Tag war das, als die Nachricht vom Tod des Vaters eintraf; da kam Hephästion, in der Hand das nackte Schwert, das Gesicht durchflammt von großartiger Begierde, aus einem kühnen Traum schien er erwacht und warf sich vor Alexander nieder und gab ihm das Schwert und schwor, er wolle vergessen, dass sie Freunde gewesen, damit Alexander um so mehr der Herr sein könne.
Oh, Monate! Oh, Jahre! Wohin! Die Welt besteht nur noch aus Sterbenden und Todgeweihten. Kein anderes Geschäft mehr als das des Henkers. Statt Wasser fließt Blut in Bächen und Strömen, Blut wälzt sich zum Meer, Blut füllt seine Gestade, Blut regnet vom Himmel, Bluttau liegt auf den Gräsern, die Flammen der brennenden Dörfer und Städte sind von Blut röter gefärbt, Völker, die um ihre letzte Habe kämpfen, taumeln über die Schlachtfelder, mit Leichen statt mit Fruchtsamen werden die Äcker bestreut, das Bittflehen der Könige und Fürsten verhallt im allgemeinen Waffenlärm, die Unterwelt kann die Seelen der Erschlagenen nicht mehr fassen, die Erde hat keinen Platz mehr für die Gräber, Menschenleben werden so billig wie Feigen, und die Raben fangen an, die Aasspeise zu verschmähen. Alexander zieht einher im Dunst des Mordes und der Schlachten, vom Pontus bis zum Indischen Ozean krabbelt das Menschengewürm im Staub, jeder Widerstand gegen ihn wird unsinnig, sein Name erregt Schauder und Bestürzung, er nimmt die Länder in Besitz, unwiderstehlich wie die Pest, und Persiens Goßkönig flieht vor ihm bis an das äußerste Ende seines Reiches und empfängt den Tod von der Hand eines Rossknechtes.
Alexander spürt nicht das Vergehen der Zeit. Wenn sie nicht in Schlaf und Wachen geschieden wäre, in Licht und Finsternis, wenn nicht Sonne und Mond wechselten, so wäre ihm alles wie ein einziger Tag. Die Zeit rollt vor ihm her wie eine rasche Kugel, der er im rasenden Lauf folgen muss. Zum Nachdenken ist keine Frist. Es ist Flucht und Spiel, Flucht aus sich selbst, Spiel mit Dingen und Menschen, Spiel mit dem Zufall; jede Gunst des Augenblicks wird erschöpft und ausgeschöpft; er merkt nicht, dass die Augen um ihn die Freiheit verloren haben und sich mit unaufrichtiger Willfährigkeit füllen, warum darauf achten? Das Widerstrebende muss fallen. Alles hängt an seinem Mund, wenn er spricht, sein Wesen ist ihnen unfassbar, sie fühlen dumpf, dass sie nur noch durch ihn mit der Welt, mit dem Leben, mit der Gottheit, mit der Menschheit zusammenhängen, er ist das dunkle Element, das ihr Schicksal regiert. Darum spielen sie sein Spiel mit, nicht ohne beständig quellende Beängstigung, nicht ohne die Ahnung, dass eines Tages die Stundenglocke schlagen wird; so sind ihre Ergötzungen, ihre Orgien, ihre Späße, ihr Tun und Treiben nicht frei von einer wunderlichen Hast, einer verräterischen Unruhe; sie erschrecken bei jedem Gewitter, bei jedem Sonnenaufgang ist ihnen, als müssten sie sich überzeugen, ob das Gestirn denn wirklich noch aus dem Osten stiege. Halt- und bodenlos sind ihre Reden, ihre Hoffnungen, ihre Handlungen; das ungeheuerliche Glück überrascht sie nicht mehr, auch das Unglück überrascht sie nicht mehr, es sind freischwebende, blinde, zappelnde, nicht mehr sich selbst gehörende Geschöpfe.
Dies alles erkennt Alexander nun. Nicht mit ganzer Klarheit, nur düster und verschwommen. Er ruft Hephästions Namen. Hephästion reitet dicht hinter ihm und antwortet. »So lebst du also«, murmelt Alexander, und er tastet nach Hephästions Hand. »Wenn du nur lebst, Hephästion, wenn du nur lebst.«
Nersar, dem Babylonier, war die Führung eines Teiles der Kamele anvertraut. Von seinen achthundert Tieren waren noch neunzehn übrig. Diese hoben auf einmal alle zusammen die Köpfe und schnupperten mit den Nüstern hoch in der Luft. War es nur der Morgen, den sie rochen? Das vorderste der Tiere stieß einen durchdringenden, weitgellenden Schrei aus, ähnlich dem Schall einer tyrrhenischen Trompete. Die übrigen Tiere, aufs äußerste erregt, stießen einander und liefen endlich mit wilder Eile gegen Westen. Der Babylonier war außer sich. Er brach in die Knie, kreuzte die Arme über der Brust und schrie laut eine Beschwörungsformel, mit der man die bösen Geister vertreibt:
»Sieben sind sie, sieben sind sie,