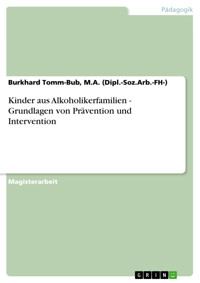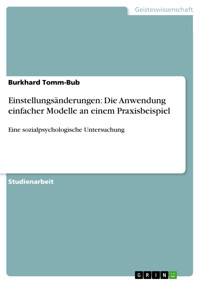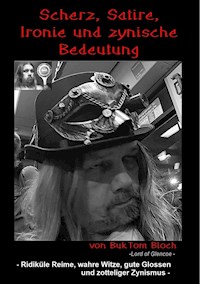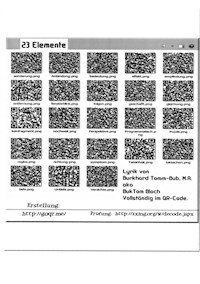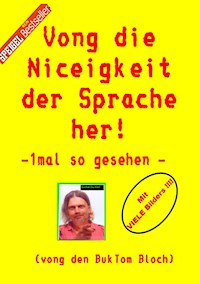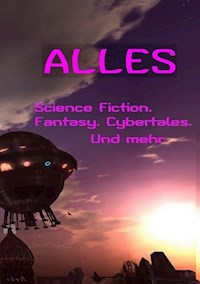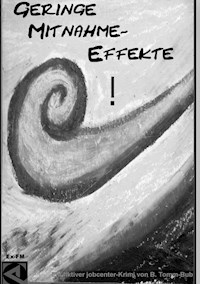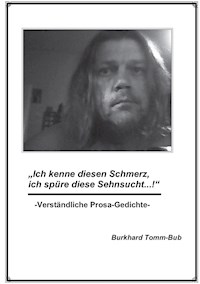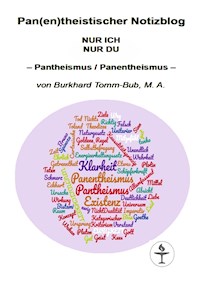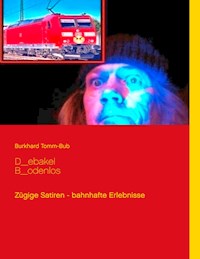Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Alt. Richtig, etliche der fachlichen / wissenschaftlichen Arbeiten hier sind zeitlich älterer Natur. Statistiken und Verbrauchszahlen werden sich also schwerlich für Zitate in eigenen Arbeiten eignen. Dennoch. Ich fürchte die Tendenzen und Mengen "von seinerzeit" haben sich auch heute nicht grundlegend geändert. Leider. Mehr noch gilt dies für vorgestellte Konzepte, Kategorisierungen und ähnliches. Zwar gab es auch da schon neueres. Aber ich bin nicht von einem hohen Mehrwert dieser Dinge überzeugt. Die klassischen Aggregatzustände von Materie sind: fest, flüssig und gasförmig. Das war vor Jahrhunderten richtig und das ist es noch heute. Dass in neuerer Zeit der vierte, seltene Zustand "Plasma" hinzu kam: ändert nichts daran. Erst recht gilt dies für philosophische Überlegungen sowie für soziologische und gesellschaftspsychologische Mechanismen und Abläufe, die vorzufinden waren und vorzufinden sind! Ein freundlicher Sachverständiger verglich die in diesem Buch enthaltene Arbeit "Gesellschaft - Sucht - Sozialarbeit" (Benotung 1.0) hinsichtlich solcher Aspekte gar mit Erich Fromms "Haben oder Sein". Vielen Dank! :-) Sehr persönliche Dinge fanden ebenfalls Eingang in das Buch. Der Verfasser ist selbst Polytoxikomane mit den Schwerpunkten Alkohol und Tranquilizer. Allerdings zufrieden abstinent und clean seit 1989. Die überwiegend wörtliche Schilderung dieses inneren und äußeren Erlebens kann exemplarisch nützlich sein, davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne. Es möge hilfreich und inspirierend sein! Burkhard Tomm-Bub, M. A.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
+ Gesellschaft Sucht Sozialarbeit - Die suchtkranke Gesellschaft: Ergebnis des Leistungs- und Konsumprinzips Mit Exkurs: Die Rolle der Medien Diplomarbeit
+ Kinder aus Alkoholikerfamilien aus (sonder-) pädagogischer Sicht -Grundlagen von Prävention und Intervention- Magisterarbeit
+ EINSTELLUNGSÄNDERUNGEN: Die Anwendung einfacher Modelle an einem Praxisbeispiel Facharbeit (Thema Alkoholismus)
+ Konzept Sendung Jugendalkoholismus (RNF “Regionalfenster” über RTL, der Autor B.Tomm-Bub war Studiogast)
+ THESENPAPIER “Suchtprävention in der Schule”
+ Externe FACHARBEIT ALKOHOLISMUS von J. S. - Auszüge (Bericht / Interview mit dem selbst betroffenen Autor)
+ LEBENSBERICHT (Therapie, 1989) Wörtlich so 1989 in der Fachklinik Fredeburg geschrieben, inklusive Rückmeldungen
+ DER OFFIZIELLE LEBENSLAUF
VORWORT des Autors
Alt.
Richtig, etliche der fachlichen / wissenschaftlichen Arbeiten hier sind zeitlich älterer Natur.
Statistiken und Verbrauchszahlen werden sich also schwerlich für Zitate in eigenen Arbeiten eignen.
Dennoch.
Ich fürchte die Tendenzen und Mengen “von seinerzeit” haben sich auch heute nicht grundlegend geändert. Leider.
Mehr noch gilt dies für vorgestellte Konzepte, Kategorisierungen und ähnliches.
Zwar gab es auch da schon neueres. Aber ich bin nicht von einem hohen Mehrwert dieser Dinge überzeugt.
Die klassischen Aggregatzustände von Materie sind: fest, flüssig und gasförmig. Das war vor Jahrhunderten richtig und das ist es noch heute. Dass in neuerer Zeit der vierte, seltene Zustand “Plasma” hinzu kam: ändert nichts daran.
Erst recht gilt dies für philosophische Überlegungen sowie für soziologische und gesellschaftspsychologische Mechanismen und Abläufe, die vorzufinden waren und vorzufinden sind!
Ein freundlicher Sachverständiger verglich die in diesem Buch enthaltene Arbeit “Gesellschaft - Sucht - Sozialarbeit” (Benotung 1.0) hinsichtlich solcher Aspekte gar mit Erich Fromms “Haben oder Sein”. Vielen Dank! :-)
Sehr persönliche Dinge fanden ebenfalls Eingang in das Buch. Der Verfasser ist selbst Polytoxikomane mit den Schwerpunkten Alkohol und Tranquilizer. Allerdings zufrieden abstinent und clean seit 1989.
Die überwiegend wörtliche Schilderung dieses inneren und äußeren Erlebens kann exemplarisch nützlich sein, davon bin ich überzeugt.
In diesem Sinne. Es möge hilfreich und inspirierend sein!
Burkhard Tomm-Bub, M. A.
2021
GLIEDERUNG (Inhalt)
TITEL
GLIEDERUNG (INHALT)
ÜBER DEN AUTOR
WIDMUNG
ZITATE
VORWORT
EINLEITUNG
1. SUCHT
1.1 SUCHT- ALLGEMEINES
1.1.1 Definitionen, Typen, usw.
1.1.2 Verbreitung (Epidemiologie)
1.2 ALKOHOLISMUS
1.2.1 Begriffsbestimmungen
1.2.2 Phasen und Typen
1.2.3 Alkoholwirkungen (Promille)
1.2.4 Alkoholverbrauch
1.2.5 Alkoholabbau
1.2.6 Der Preis
1.2.7 Gesundheitliche Schäden
1.2.8 Ursachen und fördernde Umstände / Ätiologie
1.2.9 ANHANG: Ein persönliches Referat
1.3 MEDIKAMENTENSUCHT
1.3.1 Allgemeines / Schwierigkeiten
1.3.2 Begriffsbestimmungen
1.3.3 Aufschlüsselung der Medikamentengruppen
1.3.4 Phasen und Typen
1.3.5 Medikamentenwirkungen
1.3.6 Medikamentenverbrauch
1.3.7 Medikamentenabbau
1.3.8 Der Preis (Gesundheitliche Schäden)
1.3.9 Ursachen / fördernde Umstände (Ätiologie)
1.4 MEHRFACH-SÜCHTE (POLYTOXIKOMANIE)
1.4.1 Allgemeines / Definitionen
1.4.2 Das Interview
1.4.3 Bemerkungen zum Interview
2. SUCHT UND GESELLSCHAFT
2.1 DER ZUSTAND DER GESELLSCHAFT: ANSICHTEN BESCHREIBUNGEN MEINUNGEN
2.2 ZAHLEN UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
2.3 LEISTUNG UND KONSUM: DIE “EDLEREN” FORMEN
2.4 „KLIMATISCHE“ BEDINGUNGEN IN DER GESELLSCHAFT
2.5 DIE GESELLSCHAFT: EIGENSCHAFTEN, EIGENARTEN
2.6 ZWISCHENBILANZ
2.7 WEM NÜTZEN SUCHTMITTEL ?
2.8 WERTE, NORMEN, SOZIALISATION: TRADIERUNG VON SUCHT
3. EXKURS: DIE ROLLE DER MEDIEN
3.1 DIE ROLLE DER MEDIEN
3.2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
3.3 EIN TAG IM LEBEN DES DIETMAR MICHEL
3.4 MEDIEN: INHALTE
3.5 MEDIEN UND SUCHT AM BEISPIEL ALKOHOL
3.6 MEDIEN ALS VORBILD
3.7 ALKOHOLWERBUNG IN ILLUSTRIERTEN
3.7.1 Die untersuchung: Alkohol in illustrierten
3.7.2 BEMERKUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG
4. THERAPIE
4.1 THERAPIE
4.2 THERAPIE AM BEISPIEL ALKOHOL-/MEDIKAMENTE:
4.3 THERAPIE: “INNERE STATIONEN”
4.4 „ÄUßERE “ THERAPEUTISCHE STATIONEN (EINRICHTUNGEN)
4.5 MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG DES ALKOHOLISMUS
4.6 PRÄVENTION
4.7 ALTERNATIVEN UND ERGÄNZUNGEN
4.8 THERAPIE: PERSÖNLICHES (EXKURS)
4.8.1 E.U.-G.A.M.E
5. SOZIALARBEIT
5.1 SUCHT, THERAPIE, SOZIALARBEIT: BEZÜGE
5.2 ANREGUNGEN, ERGÄNZUNGEN UND DEREN UMSETZUNG
5.3 GRÜNDE FÜR BISHERIGE UNTERLASSUNGEN.
NACHWORT
ANMERKUNGS-/LITERATURVERZEICHNIS
Über den Autor
Burkhard Tomm-Bub, geb. Tomm. Geboren am 25.12.1957 in Recklinghausen (nördliches Ruhrgebiet). Dort auch aufgewachsen. Besuch verschiedener Schulen. Fachhochschulreife. Ausbildung zum “staatlich anerkannten Erzieher”. Studium der Sozialarbeit in Mannheim. Freizeitinteressen: Viele. Zum Beispiel: Lyrik schreiben und veröffentlichen, Computer, Schwimmen, Wandern, Lesen, Musik hören, ehrenamtliche Tätigkeit als freiwilliger Vollzugshelfer in einer Strafanstalt.
Burkhard Tomm ist Mehrfachabhängig, Schwerpunkte: Alkohol und Tranquilizer. Tiefpunkt Ende 1987, rückfallfrei abstinent seit Anfang 1989. Lebt in Rheinland - Pfalz.
WIDMUNG
Meiner Mutter
Frau Marie - Luise Tomm
Meiner Partnerin Brigitte Bub
Allen Selbsthilfegruppen -insbesondere im Suchtbereich-
Speziell den Gruppen:
Blaues Kreuz (BKB) Marl- Brassert, Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. Ludwigshafen
„H.S.”
Den LeserInnen !
ZITATE
„Ich mißbillige das moderne erkünstelte Leben des Sinnesgenusses ,.. weil ich weiß, daß wir ohne vernünftige Besinnung auf die Einfachheit rettungslos in einen Zustand abstürzen müssen, der noch unter dem des wilden Tieres liegt.”(1)
Mahatma Gandhi
„Zum Höchsten ist gelangt, wer da weiß, worüber er sich freut, wer sein Glück nicht fremder Macht unterwirft.”(2)
Seneca
„Wir haben die Fähigkeit und die Energie verloren, aus unseren eigenen Handlungen zu lernen. Wir aber -nicht die Gesellschaft und schon gar nicht die Politiker- sind letztlich verantwortlich für unsere Handlungen und auch dafür, aus ihnen zu lernen. Und bei einem solchen Lernen entdecken wir unendlich viel . . ,”(3)
Jiddu Krishnamurti
„Meine Brüder, sucht Rat beieinander, denn darin liegt der Weg aus Irrtum und einsichtiger Reue. Die Weisheit vieler ist ein Schild gegen Tyrannei. Wer keinen Rat sucht, ist ein Narr. Seine Torheit macht ihn der Wahrheit gegenüber blind, böse und widerspenstig, und er wird zu einer Gefahr für seine Gefährten.”(4)
Khalil Gibran
„Wenn )Glücklichsein( überhaupt eine Bedeutung hat, dann doch wohl die, daß man ein Gefühl des Wohlbefindens, der Ausgeglichenheit, der Übereinstimmung mit dem Leben hat. Das hat man aber nur, wenn man sich frei fühlt.”(5)
A.S. Neill
Vorwort
“Die Gesellschaft ist an allem schuld !”, „Und natürlich die Erziehung!”
Daß dies so nicht stimmt ist offensichtlich. Durchaus bin ich für mich und mein Verhalten verantwortlich. Insbesondere wenn ich ein bestimmtes Verhalten bei mir als selbstschädigend erkannt habe. Kann ich dieses Verhalten nicht sofort und ohne weiteres „abstellen” so trage ich doch wenigstens die Verantwortung dafür, mir entsprechende Hilfen zu verschaffen!
Manches Mal ist es nicht einfach zu erkennen, daß ein bestimmtes Verhalten schädlich ist. Oft auch ist die Hilfe die ich finde zunächst eben nicht „entsprechend”. Ganz besonders gilt dieses sicher im Suchtbereich. Ein Anliegen, welches ich bei der Themenwahl hatte, war, hier Verbesserungen vorzuschlagen, Eine weitere Absicht bestand darin, weniger bekannte Fakten aus dem Suchtbereich möglichst verständlich darzustellen
Besonders wichtig war mir, bisher vernachlässigte Faktoren, die Sucht erzeugen und begünstigen, darzustellen - und hieraus praktische Folgerungen und Forderungen abzuleiten, Der letzte Grund ist meine eigene Betroffenheit. Eine Beschäftigung mit dem Thema ist eine Beschäftigung mit mir selbst. Ich lerne hierdurch. Und das tut gut! Alle folgenden Angaben beziehen sich -falls nicht anders angegeben-auf die BRD, bzw. auf Deutschland. Eine Übertragung auf den gesamten westlichen Kulturkreis liegt aber oft nahe. Selbst andere Kulturen können ggf. mit angesprochen sein, so sie zwar noch nicht gänzlich „verwestlicht” sind, eine Orientierung an westlichen Normen und Werten aber anstreben. Näheres geht aber aus den jeweiligen Textstellen hervor. Schwierigkeiten hatte ich anfangs mit der (geschlechtsneutralen) Schreibweise. üblicherweise tendiere ich dazu „man/frau” und „LeserInnen” zu schreiben. Ich habe dies hier nicht getan. Zwar maße ich mir nicht an zu entscheiden, ob die o.a. Schreibweise den Lesefluß des Lesers stört. Sie stört aber - insbesondere bei einer längeren Arbeit- meinen Schreibfluß! Lange überlegte ich alles grundsätzlich in der weiblichen Form auszudrücken. Hiervon kam ich aus einem, hoffentlich verständlichen, Grund wieder ab: ich schreibe hier nicht nur über ein Thema, ich schreibe auch über mich. Und ich bin nun einmal männlich (was immer dies auch heißen mag).
(Burkhard Tomm)
Einleitung
Sucht hat viele Gesichter. Die Sucht nach Drogen, Alkohol und Medikamenten ist nur eines dieser Gesichter. Es ist eines das wir - wenn auch ungern- kennen, Andere haben wir erfolgreicher verdrängt, wollen sie nicht sehen, nicht kennen. Und doch sind sie da, ja beherrschen einen Großteil von uns. Und doch haben alle diese Gesichter etwas miteinander zu tun. Der „offiziell Süchtige” ist kein Exot, kein Fremder, Fremde mögen wir nicht, sie sind anders als wir, irgendwie bedrohlich. Doch es ist jetzt an der Zeit sich zu stellen, zu sehen, was Sucht wirklich ist, weiche Anteile von uns süchtig sind, viel süchtiger vielleicht als der „besoffene Penner” auf der Parkbank, Es soll hier aber nicht darum gehen, Verständnis bei „weltoffenen Therapeuten” zu wecken etwa nach dem Motto: „Ja, ja wir haben ja alle unsere süchtigen Anteile, so schlimm ist es also doch gar nicht, suchtkrank zu sein” Nein, darum geht es nicht ! Vielmehr geht es um nicht weniger, als klarzumachen, daß die Mehrheit der Bevölkerung suchtkrank ist ! Suchtkrank -natürlich- in einer besonderen Definition. Anders ausgedrückt ließe sich auch sagen, daß die Gesellschaft als Ganzes ein Suchtkranker ist (wenn man bereit ist diese sinnbildliche Darstellung hinzunehmen,
Um es klar auszudrücken:
Die Gesellschaft, bzw. der größte Teil der Bevölkerung ist süchtig. Süchtig nach Konsumgütern, Waren, materiellen Dingen. Und er ist süchtig nach Leistung. In der Verkoppelung dieser beiden Eigenschaften ist er süchtig danach, Leistung zu konsumieren, zu verbrauchen. Genauer und ausführlicher ausgedrückt heißt dies folgendes:
Der Einzelne glaubt ernsthaft durch den Ver-brauch von Dingen seine Bedürfnisse zu befriedigen und sich die Gefühle zu verschaffen die er braucht. Weiter gibt es genügend Anzeichen für die fortschreitende süchtige Entartung dieser an sich schon unzutreffenden Einstellung.
Praktische Beispiele gibt es hier genug, etwa im Umweltbereich: zugunsten der sofortigen Befriedigung von “Komfortbedürfnissen”, werden lang- und mittelfristige Schäden der Umwelt in Kauf genommen. Tschernobyl, Ozonloch, Treibhauseffekt und anderes sind hier nur die Spitze des Eisbergs. Die Erde wird VERbraucht - nur: wenn sie nicht mehr ist wie sie war, werden auch WIR nicht mehr sein. Das weiß jeder. Doch wir machen weiter, immer weiter.... „Mangelnder Zeithorizont”, „Unfähigkeit zum
Bedürfnisaufschub”, „Unmäßigkeit”, „Unfähigkeit Belastungen und Probleme zu ertragen”, und „Realitätsverlust”: dies alles Stichworte aus dem „Katalog” typischer Persönlichkeitsmerkmale von Suchtkranken. Und das stimmt ja auch
Soviel zunächst zum Gesichtspunkt des Ver-brauchens.
In Bezug auf „Leistung” verhält es sich ähnlich. Der Wert eines Menschen wird daran gemessen, was er leistet- viel schlimmer noch: Überwiegend messen Menschen ihren eigenen Wert daran was sie leisten.
Ob der Einzelne diese Leistung nun für sich selbst oder Andere erbringt, ist hier zunächst einmal zweitrangig. Erbringt er sie für sich selbst, mögen oft Statusbedürfnisse hinter dieser Handlungsweise stehen. Dies heißt, dieser Mensch möchte etwas gelten, mochte Ansehen bei Anderen haben. Ob dies nun durch einen angesehenen Titel, ein hohes Einkommen oder andere Dinge geschieht ist natürlich von Fall zu Fall verschieden, Hiervon unterschieden werden kann die Erbringung von Leistung für andere Menschen. Es ist dies eine verfeinerte Art des Leistungsprinzips: man „opfert sich auf”, „inve- stiert in jemanden” und dergleichen mehr, Schon die Sprache mutet hier eigentlich unmenschlich an, „investieren” das beste Beispiel: „investieren” kann ich in ein Geschäft - nicht in einen Menschen,! Berufskrankheiten von im sozialen Bereich Tätigen, wie das sogenannte „Helfersyndrom” gehören hierher. Auch eine Krankheit die oft nahestehende Personen von Abhängigen entwickeln, die sogenannte „Co-abhängigkeit” hat einen starken Bezug zum Leistungsprinzip. „Dir werd! ich helfen - ich weiß was gut für Dich ist!” Geht es bei diesen und ähnlichen Einstellungen wirklich um Hilfe?
Die abschließende Bemerkung zum Bereich „auch Leistung wird konsumiert / ver-braucht”, ergibt sich fast von selbst: nur allzugern nehmen Süchtige (egal wie weit man diesen Begriff faßt) die Opfer anderer an! Enthebt dies doch eigener Verantwortung und vor allem mindert es doch den Druck sich (endlich) zu ändern'
Die dargestellten Prinzipien sind Grundlagen und Regeln der Gesellschaft, in der der Alkoholabhängige, der Medikamentenabhängige und andere Abhängige leben. Auch Abhängige die sich (endlich) auf den Weg machen zu einer Abstinenz, nein: einer zufriedenen ( ) Abstinenz, leben in dieser Gesellschaft. Daß die geschilderten gesellschaftlichen Zustände die Entstehung von „echten” Suchtkrankheiten (wie Alkoholismus) begünstigen und den Gesundungsprozeß erschweren, liegt eigentlich auf der
Hand Es wird hier noch einen Schritt weitergegangen und behauptet, daß diese Gesellschaftsstruktur die Entstehung von Suchtkrankheiten nicht nur begünstigt, sondern diese zwangsläufig hervorbringt! Denn der Suchtkranke ist genau wie der Durchschnittsbürger - und nur in einem Punkt ist er ein wenig konsequenter!
Die bisher aufgestellten Behauptungen sollen im Folgenden belegt und illustriert werden. Dies nicht allein, um diese Zustände zu kritisieren, sondern vor allem um Verständnis zu wecken. Verständnis für die Entstehung von Süchten und Verständnis für die Schwierigkeiten des Gesundungsprozesses. Neben der exemplarischen Vorstellung der Volksseuchen Alkoholismus und
Medikamentenabhängigkeit wird auch die Mehrfachabhängigkeit (Polytoxikomanie) erwähnt werden. Insbesondere sollen in diesem Zusammenhang auch eher weniger bekannte Tatsachen über die jeweiligen Krankheiten aufgeführt werden.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die nähere Betrachtung der bereits erwähnten gesellschaftlichen Zustände, die Sucht begünstigen.
Der Begriff „Sucht” wird hier auf Grund seiner größeren Ehrlichkeit verwand. Eigentlich ist er nicht mehr ganz korrekt, die WHO ersetzte ihn durch den freundlicheren Begriff der „Drogenabhängigkeit”.
„Sucht” - dieser Begriff klingt nach Suchen , „auf dem Weg zu etwas sein”, auch nach „Sehnsucht” -in Wirklichkeit entstammt er dem Wortstamm “siechen, krank sein”! Sucht soll in Bezug zur Erziehung und zu den Massenmedien gesetzt werden, mit einem besonderen Augenmerk auf die Übermittlung von gesellschaftlichen Normen und Werten, die Sucht begünstigen. Das politische Aspekte hierdurch dann ebenfalls einfließen, ist naheliegend. Anschließend wird der Versuch unternommen, Vorschläge zur Verbesserung des Verständnisses von Therapie zu machen. Um es ganz klar zu sagen: Andere als die hier untersuchten (möglichen) Ursachen für Sucht werden nicht geleugnet, im Gegenteil, sie werden ebenfalls Erwähnung finden!
Doch ist es mit Sicherheit an der Zeit, auch Faktoren aus dem (weiteren) Umfeld von Betroffenen mit einzubeziehen! Mit einzubeziehen in das Verständnis jedes Einzelnen von Sucht und auch mit einzubeziehen in therapeutische Prozesse.
Der Versuch Anregungen dafür zu geben wird hier unternommen.
1. SUCHT
1.1 Sucht- Allgemeines
1.1.1 Definitionen, Typen, usw.
„Drogenabhängigkeit wird als übergeordneter Begriff definiert. Er bezeichnet einen Zustand seelischer oder seelischer und körperlicher Abhängigkeit von einer Substanz mit psychoaktiver, bzw. zentralnervöser Wirkung, die zeitweise oder fortgesetzt eingenommen wird.”(6)
In Bezug auf den Teilbegriff ..... -abhängigkeit” findet hier natürlich eine Erklärung eines Begriffes durch sich selbst statt. Daher bleibt zur näheren Bestimmung des Begriffs “Abhängigkeit” folgendes nachzutragen:
„Abhängig ist jemand, der einen sog. )Kontrollverlust( erleidet, D.h. er hat entweder die Kontrolle darüber verloren, wieviel er von einer bestimmte Substanz zu sich nimmt und/oder er hat keine Kontrolle mehr darüber, wie oft er wirksame Mengen einer bestimmten Substanz zu sich nimmt. Weitere Anzeichen sind die Vorläufer oder das Vorhandensein körperlicher, seelisch -geistiger und sozialer Schäden. Immer haben die Betroffenen Schwierigkeiten mit dem Aufhören.” (7)
Im Wesentlichen werden heute 7 Typen von Drogenabhängigkeit unterschieden:
Zur dieser Liste bleibt nachzutragen, daß folgende (echte) SuchtTypen hier keine Aufnahme fanden:
a)Schnüffelstoffe, wie Benzin, Lösungsmittel
b)„leichtere” Süchte, wie Coffein, Nikotin
c)Prozeßgebundene Süchte, wie Spielsucht, Freßsucht
Eine andere Möglichkeit „Sucht” zu unterteilen, ist die nach dem Beschaffungsweg des jeweiligen „Stoffes”, Hier läßt sich einteilen in:
■ Legal beschaffte Drogen
(z.b. Alkohol im Supermarkt, Fachgeschäft)
■ Teils legal / teils illegal beschaffte Drogen
(Z.B. Medikamente (aus der Apotheke, auf Rezept, aber auch durch Tausch und Kauf „unter Freunden” und auf dem „grauen Markt”) ebenso durch Beschaffungskriminalität, z.b. Einbrüche)
■ Illegal beschaffte Drogen
(Z.B. Heroin -aber auch Haschisch- beim „Dealer” -zu deutsch: Händler)
Natürlich wird bei all diesen (und noch einigen anderen) Unterteilungsversuchen nach typisch „westlicher” Art und Weise erst einmal versucht alles „hübsch ordentlich” zu sortieren. Daß dies das Aufspüren gemeinsamer Ursachen nicht eben erleichtert ist klar. Aber es wäre ja auch „noch schöner” wenn etwa der (gesundheitsbewußte?) Tablettenkonsument oder der (genußfähige?) Kognaktrinker in einem Atemzuge mit diesen ,ekeligen Drogenfreaks” genannt würde...
Wie dem auch sei. Ganz sinnlos sind diese Aufteilungen sicher nicht, Die Einordnung nach Typen (also Kokain-Typ) Morphin -Typ) usw.) ist z.B. In Bezug auf die Entzugserscheinungen wichtig. Diese -und auch die typischen Vergiftungserscheinungen- sind ziemlich gut bekannt und können somit gezielter behandelt werden. Die medizinische Sicht ist hier angesprochen. Wichtig: Innerhalb eines Suchttyps ist der Betroffene automatisch von allen Substanzen abhängig! Beispiel: Ein Alkoholiker ist auch abhängig von Tranquilizern, oder wird es zumindest sehr leicht und sehr schnell!
Die Aufteilung nach dem Beschaffungsweg dagegen kann in therapeutischer Hinsicht interessant werden. Ob jemand Straftaten begehen mußte und / oder sich hoch verschulden, um seinen Stoff zu konsumieren, bzw. zu erwerben: diese Teilbereiche (von vornherein) mit einzubeziehen kann sicherlich von Vorteil sein.
1.1.2 Verbreitung (Epidemiologie)
Während einige Sucht-Typen in Deutschland so gut wie keine Verbreitung haben (z.B. Khat-Typ) sind andere als regelrechte „Volksseuchen” zu bezeichnen, So wird die Zahl der behandlungsbedürftigen Alkoholkranken in Deutschland von der „Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren” (DHS), für 1991, auf 2 ½ Millionen geschätzt.(9)
Grond schätzt) für 1990) die Zahl der Medikamentenabhängigen in der BRD auf 400 000(10). (Dies eine doch eher niedrige Schätzung !) Von illegalen/ harten Drogen (wie Heroin) sind hingegen „nur” einige Zehntausend Menschen abhängig.
Bedenkt man Dunkelziffern und mitbetroffene Angehörige u. ä. so ergibt sich ein erschreckendes Bild !
1.2 ALKOHOLISMUS
1.2.1 Begriffsbestimmungen
Zunächst sollen einige wichtige Begriffe erklärt, bzw. definiert werden.
Alkohol
Mit „Alkohol” ist meist der sog. Ethylalkohol (C2H5OH) gemeint. Alkohol entsteht durch die Gärung von Zucker und ist ein Stoffwechselprodukt lebender Mikroorganismen; er kann seit dem 20 Jahrhundert auch künstlich hergestellt werden. Alkohol ist leichter als Wasser und verdampft bei ca. 78 Grad Celsius. In reiner Form ist Alkohol eine wasserlösliche, farblose, brennend schmeckende Flüssigkeit, die mit blauer Farbe verbrennt und auf der Haut kühlend wirkt. Interessanterweise kommt Alkohol in der Natur höchstens in einer Konzentration von 14 % vor, bei höherer Konzentration sterben die Organismen, die Alkohol herstellen nämlich ab. Das Wort “Alkohol” stammt aus der arabischen Sprache und bedeutet „das Feinste”. Alkohol ist eine Droge und wirkt unmittelbar verändernd auf Funktionen des Zentralnervensystems. Er erzeugt eine Abhängigkeit vom Alkohol-/Barbiturattypus.(11)
Alkoholiker
„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der UNG hat 1952 bereits definiert: )Alkoholiker sind exzessive Trinker, deren Abhängigkeit vom Alkohol einen solchen Grad erreicht hat, daß sie deutlich Störungen und Konflikte in ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit, ihren mitmenschlichen Beziehungen, ihren sozialen und wirtschaftlichen Funktionen aufweisen; oder sie zeigen Prodrome (Vorläufer) einer solchen Entwicklung. Daher brauchen sie Behandlung.(“(12)
(Hervorhebung vom Verfasser.)
„Das Bundessozialgericht hat in einem Grundsatzurteil vom 18. Juni 1968 festgestellt: “Trunksucht ist eine Krankheit im Sinne der Reichsversicherungsordnung -PVO.(“(12) Und zwar im Sinne des § 182 der RVO (BSG 28, 114). Nach diesem Urteil ist jede Sucht eine solche Krankheit. Kennzeichen von Sucht ist hier der „Verlust der Selbstkontrolle” und das „nicht - mehr - aufhören -können”.(14)
Es wird für die Entwicklung der totalen Abhängigkeit, bzw. Sucht (bei Alkohol) ein Zeitraum von bis zu 12-15 Jahren angenommen. (Dies heißt also vom ersten Mißbrauch an gerechnet.)
Allerdings: Bei Frauen und Jugendlichen ist dieser Zeitraum meist wesentlich kürzer! Auch heißt dies nicht, daß vorher keine Schädigungen eintreten. Ebenso kann der
Betreffende durchaus schon vorher an den Mißbrauchsfolgen sterben (z.B. durch Unfälle in berauschtem Zustand, Folgeerkrankungen, oder auch an Suizid oder (versehentlichen) Überdosierungen.)(15)
Körperliche Abhängigkeit
Eine körperliche Abhängigkeit vorn Alkohol äußert sich vor allem in Bezug auf die Entzugserscheinungen. Hier können sehr schwerwiegende Erscheinungen auftreten, zum Beispiel Krampfanfälle und ein Delirium tremens.
Psychische (seelisch-geistige) Abhängigkeit
Diese äußert sich beispielsweise in Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen und Angst bei Entzug des Alkohols, in der Praxis sind körperliche und seelisch-geistige Entzugserscheinungen nicht unbedingt leicht auseinander zu halten, sie treten natürlich auch oft gemeinsam auf. Es kann aber durchaus eine der beiden Erscheinungsformen stark im Vordergrund stehen. D.h. das „Fehlen” des einen oder anderen Entzugsanzeichens bedeutet nicht, daß der Betreffende kein Alkoholiker ist!
Krampfanfälle
„Krampfanfälle leiten relativ häufig (bis zu 40%) ein Delirium tremens ein und treten meist um den dritten Tag der Entzugsphase auf. Sie sind Ausdruck einer veränderten elektrischen Erregbarkeit des Gehirns in der Entzugssituation, da Alkohol ähnlich wie bestimmte Medikamente gegen Epilepsie wirkt, überdauern diese Krampfanfälle die Entzugsphase, dann spricht man von Alkohol-Epilepsie.
Delirium tremens
)Delirium tremens( ist die medizinische Bezeichnung für das nach 3 bis 5 Tagen eventuell auftretende klinische Vollbild der Alkoholentzugserscheinungen, das sich typischerweise durch Schlafstörungen, Händezittern, körperlicher Unruhe)
Schweißausbrüche, Angst, optische
Sinnestäuschungen (“weiße Mäuse”) und lebensbedrohliche
Herz-Kreislauf - Komplikationen äußert. Die Behandlung erfolgt heute unter intensiv -medizinischen Bedingungen,...”(16) (Hervorhebung vom Verfasser)
Zu den Grundkenntnissen bezüglich der Alkoholkrankheit gehört sicherlich auch die (schon ältere) Phasen- und Typenlehre von Jellinek.
Diese Einteilungen wurden in den letzten Jahren verschiedentlich kritisiert. Sie seien „nicht mehr aktuell” und zunehmend gäbe es „Mischtypen” und Abweichungen. Letzteres ist zweifellos richtig. Will man aber -bei allen Nachteilen- die Vorteile einer Einteilung beanspruchen, so gibt es bislang keine annehmbare Alternative zu Jellineks Modellen!
1.2.2 Phasen und Typen
PHASEN
In der Regel verläuft eine Suchterkrankung in mehreren Phasen. Deutlicher gesagt: Die Krankheit verschlimmert sich mit der Zeit und führt sehr häufig -wenn sie nicht zum Stillstand gebracht wird- zum Tode. Bestimmte Verhaltensweisen und Schäden sind hier typisch für die jeweilige Phase, Äußerst wichtig und unbedingt zu beachten ist hier aber folgendes: Keineswegs muß jede Verhaltensweise, jede Schädigung bei jedem Betroffenen auftreten! Gleiches gilt für die Abfolge der Anzeichen (Symptome): Diese treten nicht unbedingt „wohlgeordnet” auf, also nicht Punkt für Punkt, Phase nach Phase. Eher wird sich zeigen, daß die Anzeichen der ersten Phase (fast) alle auftreten, die meisten der Zweiten und einige der Dritten (beispielsweise). Dieses zu wissen und zu beachten ist wichtig für jede Selbst- und Fremddiagnose. Nur allzugern klammert sich der Süchtige (und teilweise auch seine Angehörigen) an jeden „Strohhalm”: „Trifft dieses und jenes auf mich ja gar nicht zu, wieso sollte ich dann einer von diesen „Alkis” sein „ Diese Falle (eine von fast unendlich vielen) gilt es zu umgehen'
Als Anhaltspunkt, um in etwa zu erfahren wo der Einzelne steht, kann die Phasenlehre also durchaus sehr nützlich sein. Dies bei (Selbst-) Diagnosen (= etwa “Zustandsbeurteilungen”) zum Beispiel mittels -ehrlich ausgefüllter- Fragebogen.
Die einzelnen Phasen mit ihren jeweiligen Anzeichen sollen nun im Weiteren dargestellt werden, Insgesamt werden drei, bzw. vier unterschiedliche Phasen angenommen.
Es sind dies:
1) Die voralkoholische Phase (auch: Vorphase)
Folgende Merkmale sind hier häufig anzutreffen:
■ Gelegentliches Erleichterungstrinken
Dies bedeutet, daß der spätere Alkoholiker den Alkohol in einer ganz bestimmten Absicht benutzt. Spannungen werden von ihm nicht in handelnder Art und Weise „angegangen”, sondern in konsumierender. Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein. So kann er es z.B. nie gelernt haben Unangenehmes aktiv zu bewältigen, oder aber das Trinken ist ganz einfach der (scheinbar) bequemere Weg. (Entspannung auf )Knopfdruck( !)
■ Erhöhte Alkoholtoleranz
Zunehmend wird nun mehr Alkohol benötigt, um das angestrebte Ziel (Entspanntheit, Lockerheit) zu erreichen. Ebenso wird aber auch (scheinbar) mehr Alkohol „vertragen”. „Vertragen” heißt hier in Wirklichkeit aber nur, daß gelernt wurde mit dem eigenen alkoholisierten Zustand „besser” umzugehen. Die Folge ist, daß Anderen der angetrunkene Zustand nicht oder kaum auffällt.(“Der kann einen )ordentlichen Stiefel( vertragen !”)
■ Dauerndes Erleichterungstrinken
Das Erleichterungstrinken wird langsam aber sicher zur Gewohnheit. Im Grunde eine sehr verständliche Entwicklung. Bis jetzt sind keine ernsthaften Schäden aufgetreten, auch die Umwelt reagiert nicht negativ, oft sogar mit einer Art „sportlicher” ~ Unbemerkt hat sich auch die geistig - seelische Belastbarkeit verringert. Auch dies eigentlich sehr logisch. Brauche ich keinerlei Spannungen mehr auszuhalten und/oder zu bewältigen, so komme ich „aus der Übung”. Es kommt zu einem anhaltenden und zunehmenden „Formtief”. Und warum auch nicht: „Das nächste Glas ist ja nicht weit!”
Wichtig ist hier, daß meist weder die Umwelt noch der Betroffene dies Verhalten als unnormal ansieht. Ein Bewußtsein dafür, daß der Alkohol hier regelrecht zu einem ganz bestimmten Zweck eingesetzt wird, ist in der Regel (noch) nicht vorhanden!
2) Die Prodromal-Phase
(auch: Anfangsphase, Frühphase)
Hier treten meist folgende Merkmale auf:
■ Heimliches Trinken
Ein unklares Gefühl, daß doch (etwas) mehr als üblich getrunken wird, kann sich nun einstellen. Dies kann dann dazu führen, daß Gelegenheiten gesucht werden auch mal „ein ) Schlückchen ( ohne Wissen der Anderen” zu trinken. Wichtig ist hier, daß dieses Merkmal oft auch nicht auftritt. Etwa wenn der Betreffende alleinstehend ist und wenig Kontakte zu anderen Menschen hat. Auch in einer sozialen Umgebung die stärkeres Trinken als normal, oder sogar erwünscht ansieht, entfällt die Notwendigkeit heimlich zu trinken,
■ Alkoholische Palimpseste
Nun kommt es -nicht immer, aber immer öfter- zu Räuschen mit anschließenden Erinnerungslücken (= Palimpseste). „Mensch, wie ich da gestern wieder nach Hause gekommen bin -das weiß ich ja )echt( nicht mehr !”.
■ Häufigeres Denken an Alkohol
Hierzu gehört auch, daß -bewußt oder unbewusst- „vorsorglich” ein paar Gläser getrunken werden, Falls nötig wird nun auch darauf geachtet, daß „immer genug Vorrat im Hause” ist.
■ Gieriges Trinken der ersten Gläser
Dies tritt besonders auf, wenn einige Stunden oder gar Tage nach dem letzten Glas vergangen sind. Manch einer mit „feiner Lebensart” schafft es allerdings sehr lange sich in dieser Hinsicht zu beherrschen, Für ihn der klare Beweis, daß er keinerlei Alkoholprobleme hat.....
■ Schuldgefühle
Langsam stellt sich jetzt doch so etwas wie ein schlechtes Gewissen wegen des Trinkens ein. Daher werden nun „Gründe” (d.h. Ausreden) für das Trinken gesucht und „gefunden”. Oft wird versucht den Alkoholkonsum einzuschränken, was auf Dauer natürlich nicht gelingt. Dies führt natürlich zu einem noch schlechteren Gewissen. Wie man diese innere Anspannung „am besten” beheben kann, weiß der Trinkende natürlich: „Schütt! Deine Sorgen in ein Gläschen Wein !” (Wie es schon der Rhein-Wein - Sänger Willy Schneider in einem Schlager der 50er Jahre verhieß.)
Einer der typischen Teufelskreise der Sucht beginnt !
■ Vermeidung von Anspielungen auf Alkohol
Natürlich werden nun in Gesprächen kritische(!) Anspielungen auf das Trinken möglichst vermieden. Allerdings: wer hier weiterhin bei seinen „Trinkkumpanen” prahlt, wieviel er verträgt, sollte nicht meinen dieses Merkmal träfe nicht auf ihn zu !
3) Die kritische Phase
Folgende Anzeichen sind hier sehr oft zu beobachten:
■ Kontrollverlust
Wenn auch nur geringe Mengen Alkohol in den Körper gelangen und dies vorn Trinker bemerkt wird, empfindet er ein geradezu körperlich spürbares Verlangen nach mehr Alkohol. Der Trinker muß diesem Verlangen nachgeben und in der Regel führt dies dann zu einem „Rausch”, also merklicher bis starker Trunkenheit. Der Kontrollverlust kann also bereits durch eine scheinbar harmlose Menge ausgelöst werden. Wichtig ist, daß der Kontrollverlust hier erst dann wirksam wird, wenn der Betreffende schon etwas getrunken hat. Vorher hat der Trinker noch die Kontrolle darüber, ob er überhaupt etwas trinkt oder nicht.
■ „Erklärungen” für das Trinken („Alkoholiker-Alibis”) Es wird begonnen, daß Trinkverhalten irgendwie zu erklären. Der Trinker will sich selbst und andere Überzeugen, daß er triftige Gründe hat zu trinken. Wenn diese Gründe nicht wären, könne er ohne weiteres mit dem Trinken aufhören, bzw. maßvoll trinken (was natürlich nicht stimmt). Diese Ausreden geben dem Trinker die nötige Gewissenserleichterung, um weiter zu trinken!
■ Soziale Belastungen/Widerstand gegen Vorhaltungen
Langsam entsteht ein regelrechtes „Erklärungssystem”, welches sich auch auf andere Lebensbereiche ausdehnt. Es hilft dem Trinker Vorhaltungen seiner Mitmenschen zu widerstehen. Sein Verhalten wird nämlich nun doch zunehmend kritisch gesehen, Menschen seiner Umgebung beginnen zu mahnen und zu warnen. Bald geht er diesen Menschen mehr und mehr aus dem Wege, trinkt mehr zu Hause oder in unbekannter Umgebung. Das Erklärungssystem soll alle Vorhaltungen als unberechtigt hinstellen.
■ Übertriebene äußerliche Selbstsicherheit
Trotz diese Erklärungsversuche verliert der Trinker deutlich an Selbstachtung. Häufig wird nun versucht dies durch überbetonte „Selbstsicherheit” nach außen „auszugleichen”. Großspurigkeit und verschwenderisches Gehabe sollen ihm und anderen zeigen, daß es doch gar nicht so schlecht um ihn steht.
Mancher wird auch zum „Einzelkämpfer”, „Steppenwolf”, oder „Philosoph”, der deutlich zeigt, daß er niemanden braucht und daß er „die Herde” verachtet.
■ Aggressives Benehmen
Es gehört zum Erklärungssystem, die Schuld am Trinken nicht sich selbst, sondern irgendjemand anderem zu geben. Das kann zu aggressivem Verhalten und zur Abkehr von allen Mitmenschen führen, bis hin zur Vereinsamung.
■ Anhaltendes Schuldgefühl
Die feindselige Haltung gegenüber der Umwelt läßt erneut Schuldgefühle entstehen. Während Gewissensbisse wegen des Trinkens am Anfang nur ab und zu auftraten, entsteht jetzt eine dauernde Zerknirschung mit großen Zweifeln am Selbstwert, Diese zusätzliche Belastung ist nun natürlich ein weiterer Anlaß zum Trinken und zur Aufgabe etwaiger Mäßigungsversuche.
■ Zeiten völliger Enthaltsamkeit
Auf Druck seiner Umgebung und eigener Einsicht versucht der Trinker nun meist, zeitweise ohne Alkohol zu leben. In diesen Zeiten fühlt er sich jedoch keineswegs wohl. Auf Dauer gelingen diese Versuche denn auch nicht. Je öfter dies mißlingt, desto verzweifelter oder resignierter wird er, denn er weiß nicht, was er falsch macht. Mancher glaubt nun, daß er „halt labil sei”. Damit stempelt er sich selbst als schwach ab und hat damit wieder einen Grund gefunden, ernsthafte Versuche abstinent zu leben, gar nicht erst zu machen.
Oft allerdings werden auch die ohne Alkohol verbrachten Zeiten noch als „Beweis” herangezogen, daß man ja doch kein „richtiger” Alkoholiker sei.
■ Änderung des Trinksystems
Das Scheitern der Abstinenzversuche läßt ihn andere Möglichkeiten ausprobieren, das Trinken -und damit seine Schwierigkeiten- unter Kontrolle zu bekommen. Er stellt Regeln auf, z.B.: “Ich trinke nicht vor einer bestimmten Uhrzeit”, „Ich trinke nur an bestimmten Orten”, „Ich trinke nur Bier, keinen Schnaps”, „Ich trinke nur so und so viel” und so fort. All dies sind “Selbstkontrolltechniken”, die in diesem Stadium des Alkoholismus nicht mehr zum Erfolg führen.
■ Fallenlassen von Freunden/Feindseligkeiten
Oft sind es auch andere, die zu seinen Rückfällen beitragen, in dem Glauben „dieses eine Gläschen” könne doch nichts schaden. Auch dies verstärkt die feindselige Haltung gegenüber der Umgebung; er beginnt, sich von früheren Freunden abzuwenden.
■ Einengung des Verhaltens auf Alkohol
Das Denken und Handeln kreist nun zunehmend um den Alkohol. Der Trinker beginnt nun eher zu überlegen, wie seine Arbeit sein Trinken stören könnte, statt zu bedenken, wie das Trinken seine Arbeit stört.
■ Arbeitsplatzverlust
„Krankfeiern” und Zuspätkommen nehmen nun zu. Er verliert den Arbeitsplatz. Oftmals kündigt der Betroffene aber selbst, um einer Entlassung zuvorzukommen.
■ Verlust an äußeren Interessen
Hobbys, Vereine und ähnliche Interessen verlieren auffallend an Bedeutung. Mancher vernachlässigt auch das eigene Äußere.
■ Veränderte Auslegung zwischenmenschlicher Beziehungen
Der Verlust an Interessen erstreckt sich auch auf andere Menschen. Auf die Meinung anderer wird kein Wert mehr gelegt: „Die kümmern sich ja auch nicht um mich
■ In Verbindung damit steht starkes Selbstmitleid
■ Gedankliche/tatsächliche Ortsflucht
Da er sich selbst anscheinend nicht ändern kann, ändert der Trinker den Ort seiner Umgebung. Er sucht also andere „Freunde” (?), zieht evtl. um, geht auf Reisen, etc, ist er hierzu schon nicht mehr fähig, träumt er zumindest davon („Fernweh”).
■ Änderungen im Familienleben
Ehepartner und andere Verwandte von dem Trinker zurück, oder sie ganz von dem Trinker zu lösen, ziehen sich nun oft versuchen sogar sich
■ Unwille
Alle diese Entwicklungen führen zu Unwilligkeit und launischem Verhalten.
■ Sichern des Alkoholvorrats
Die Angst plötzlich „ohne einen Tropfen” dazustehen, veranlassen den Trinker, sich seinen Vorrat zu sichern, zum Beispiel werden Flaschen versteckt oder einfallsreiche Täuschungsmanöver erprobt. Oft werden sogar Getränke an den ungewöhnlichsten Orten versteckt, obwohl dies eigentlich völlig unnötig wäre.
■ Vernachlässigung der Ernährung
Das Trinken stillt auch Hungergefühle. Zusätzlich führt der allgemeine Interessensverlust zur Vernachlässigung einer angemessenen Ernährung. Hierdurch wird die Alkoholwirkung auf den Körper natürlich wiederum verstärkt.
■ Erste körperlich Erkrankungen
Es zeigen sich körperliche Folgen des Alkoholmißbrauches, die teilweise auch zu Krankenhausaufenthalten führen.
■ Abnahme des Sexualtriebs
Interessensverflachung und der seelisch/geistige Zustand führen zu Impotenz” und mindern das sexuelle körperliche und zur „alkoholischen Verlangen.
■ Alkoholische Eifersucht
Eigentlich verständliches, ablehnendes Verhalten des Partners (z.B. bei Annäherungsversuche in betrunkenem Zustand) werden mit vermuteten “Nebenbuhlern” erklärt. („Ah, Du hast wohl 'nen Anderen!”). Der „alkoholische Eifersuchtswahn” entwickelt sich.
■ Morgendliches Trinken
Bis jetzt war ausgesprochene Trunkenheit zumeist auf den späten Nachmittag oder den Abend beschränkt. Bald kann nun aber der Trinker keinen neuen Tag mehr beginnen, ohne sich gleich nach dem Aufstehen mit ein paar Schlucken in einen normalen Zustand zu bringen.
4) Die chronische Phase
Häufige Merkmale sind hier:
Verlängerte/tagelange Räusche
Die völlige Einengung auf den Alkohol und das durch morgendliches Trinken geförderte Bedürfnis nach Alkohol lassen den Widerstand des Alkoholikers nun zusammenbrechen: erstmalig findet er sich mitten am Tag oder mitten in der Woche völlig betrunken, in diesem Zustand bleibt er dann mehrere Tage, bis er unfähig ist, noch irgendetwas zu unternehmen. Dies wiederholt sich jetzt häufiger.
Ethischer Abbau
Den tagelangen Rauschzuständen folgt die Aufgabe der früheren moralisch - ethischen Maßstäbe. Werte und Prinzipien werden umgestoßen, Mögliche Beispiele sind etwa: „Ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich will nicht angetrunken autofahren, ich prügele mich nicht!” Diese und/oder andere vorher bejahte Regeln werden nun nicht mehr eingehalten, bzw. können nicht mehr eingehalten werden,
Denkstörungen
Die giftige Wirkung des Alkohols äußert sich in einer Schädigung des Denkvermögens, die jetzt nur noch durch lange Abstinenz rückgängig gemacht werden kann.
Alkoholische Geisteskrankheiten
Allmählich können nun stärkere alkoholbedingte Geisteskrankheiten auftreten, Bei ca. 10% der Alkoholiker treten echte Alkoholpsychosen auf. Sie kündigen sich an durch starke Gefühlsschwankungen, Störungen des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit, eine allgemeine Verlangsamung der Bewegung und des Denkens und durch Auffassungs- und Aufmerksamkeitsstörungen. Die gesamte geistige Leistungsfähigkeit ist vermindert,
Trinken in anderen Kreisen
Ehemalige Wertmaßstäbe haben ihre Gültigkeit verloren, Selbstkritik „findet nicht mehr statt”. Neue, früher unbekannte Verhaltensweisen treten auf, z.B. Lügen, Stehlen, Bekanntschaften mit Menschen, denen es ähnlich schlecht geht wie dem Trinker, usw. Dies geht bis hin zu einem regelrechten Einfügen in eine neue, sozial schwache und schlechtere Umgebung,
Wegfall der Alkoholverträglichkeit
Viele Abhängige können jetzt allgemein weniger vertragen, Bereits nach wenigen Gläsern stellt sich eine starke Trunkenheit ein, Allerdings ändert sich dadurch die Menge die jeweils getrunken wird nicht!
Unbestimmte Ängste
Ängste ohne erkennbare Ursache können jetzt zur Dauererscheinung werden, Teils sind sie geistig -seelisch bedingt, etwa im Zusammenhang mit Eifersuchts- und Verfolgungsideen, teils körperlich bedingt durch die fortschreitende Schädigung des Zentralnervensystems. Derartige Zustände treten besonders zu Beginn freiwilliger oder erzwungener Zeiten der Abstinenz auf,
Zittern und psychomotorische Störungen
Zu den Ängsten kommen nun morgendliches Zittern und große Unsicherheit in der Steuerung einfacher Bewegungen als dauernde Entzugserscheinung hinzu, sobald der Alkoholspiegel sinkt, Der Trinker kann selbst einfache Handlungen -z.B. Schnürsenkel binden- nicht mehr ohne einen Schluck Alkohol ausführen,
Das Trinken wird zum Zwang
Der Süchtige bekämpft jetzt die Anzeichen des Trinkens - eigentlich die Entzugserscheinungen - mit erneutem Trinken. Durch diesen Teufelskreis wird das Trinken zum Zwang, zur „Besessenheit”.
Unklare religiöse Wünsche
Die Versuche den Alkoholkonsum vernunftgemäß zu begründen lassen langsam nach. Als Flucht aus der Wirklichkeit entwickeln sich bei vielen Trinkern nun religiöse Wahnvorstellungen,
Das Erklärungssystem versagt
Das zwanghafte Trinken und die tagelangen Exzesse machen es unmöglich das Scheingebäude vernünftiger Erklärungen noch länger aufrechtzuerhalten, Das Erklärungssystem bricht angesichts der nicht mehr zu leugnenden Realität zusammen, Der Alkoholiker muß erkennen, daß er am Ende ist,
Zusammenbruch
Meist folgt nun der totale Zusammenbruch, Selbstmorde (bzw. - versuche) sind in diesen Zeiten schwerster Niedergeschlagenheit nicht selten.
Alkoholdelirium
Das Delirium tremens tritt recht plötzlich auf, allerdings „nur” bei ca.
15 % der chronischen Alkoholiker.
Tod
Je weiter eine Suchtkrankheit fortschreitet desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Betreffende daran stirbt, Dies an direkten oder indirekten Folgen der Krankheit, Verschiedene Beispiele bei Alkoholismus sind hier: Tod durch Krankheiten, die durch den Alkoholismus verschlechtert / verschlimmert wurden, durch alkoholbedingte Krankheiten, wie Lebererkrankungen, Tod durch (Verkehrs-) Unfälle in berauschtem Zustand, durch Selbstmord, gelegentlich auch Tod durch direkte Überdosierung des Alkohols, usw.
TYPEN
Soviel zu den Phasen des Alkoholismus(17). Diese geschilderten Phasen treffen aber ursprünglich und insbesondere auf einen bestimmten Alkoholikertyp zu, nämlich den „Gamma - Typ”. Dieser ist im westlichen Kulturkreis allerdings auch am weitesten verbreitet. Auch auf die übrigen Typen ist die Phasenlehre übertragbar, wenn auch gelegentlich mit gewissen Abweichungen. So entfällt beispielsweise beim „Delta -Typ” oft das Merkmal sozialen Drucks, Süchtige diesen Typs sind nämlich meist nicht auffällig betrunken und oft sehr korrekt.
Die verschiedenen Typen sollen nun aber im Zusammenhang dargestellt werden,
Es sind dies der:
„Alpha -Typ:
Problem - und Erleichterungstrinker; kein Kontrollverlust; seelische Abhängigkeit, da diese Angstabwehr die Probleme vergrößert
Beta -Typ: Anpassungs - und Gewohnheitstrinker, um )mitzuhalten( mit den (Trink-) Sitten, an Situationen gekoppelt (Fernsehen, Wochenende, Arbeitswege, Hausarbeit); wenig seelische, aber später körperliche Abhängigkeit.
Gamma -Typ:
Eigentlicher Prozeß-Trinker mit seelisch - körperlicher Abhängigkeit, Toleranzsteigerung, Kontrollverlust, Abstinentzsymptome- auch wenn Abstinenz-zeiten möglich sind.
Delta -Typ:
Spiegel-Trinker; da über lange unauffällige, schleichende Gewöhnung der Alkohol-Spiegel sich langsam erhöht, bis er gebraucht wird, hat der Betroffene nie das Gefühl des Kontrollverlustes, und da er sozial überkorrekt ist, ist er bei dieser rauschlosen Dauerimprägnierung besonders schwer zu motivieren.
Epsilon-Typ:
Periodischer Trinker (früher Quartalssäufer, ,.); auch diese im Alltag überkorrekten Menschen brauchen den Ausbruch ins zerstörerische Sozial-Unerlaubte, um überbemüht sozial erlaubt leben zu können; maskiert sich lieber mit Hilfe von Ärzten mit der „feineren” Diagnose phasischer Depressionen,” (18)
Soweit die verschiedenen Typen. Wie bereits erwähnt, gibt es durchaus Abwandlungen, Insbesondere bei Abhängigen, die noch andere Suchtmittel verwenden, kann das Erscheinungsbild der Krankheit ganz unterschiedlich aussehen
Es ist noch festzustellen, daß Alpha- und Gamma- Typ Gemeinsamkeiten aufweisen, ebenso der Beta- und der Delta - Typ, So findet tatsächlich auch oft eine Entwicklung vom Alpha- zum Gamma- und ebenfalls eine vom Beta- zum Delta -Typ statt! Sicher wäre es nicht falsch jeweils den einen Typ als (wahrscheinlichen) Vorläufer des anderen zu sehen.
Die Unterscheidung zwischen Gamma- und Epsilon - Typ kann in der Praxis evtl. Schwierigkeiten bereiten, dies zumindest in einem eher frühen Krankheitsstadium. Es sind jedoch -in reiner Form- durchaus unterschiedliche Typen! Verblüffend am Epsilon - Typ ist seine Fähigkeit zeitweise kontrolliert zu trinken. Zur zeitweiligen (unzufriedenen/verzichtenden!) Abstinenz ist anfangs sowohl der Gamma-, als auch der Epsilon - Typ fähig, im Gegensatz zum Gamma - Typ ist aber der Epsilon - Typ oft und lange Zeit fähig auch kleinere Mengen Alkohol zu sich zu nehmen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Dies allerdings nur außerhalb seiner „Trinkperiode”,
Diese Zeiten exzessiven (=ausschweifenden) Alkoholkonsums können aber zu Beginn noch recht weit auseinander liegen, Das bedeutet, der Epsilon - Typ trinkt monatelang nichts) oder wenig, um dann einige Tage „durchzusaufen”, Trotzdem ist auch der Epsilon -Typ eindeutig krank! Einmal ist diese extreme Alkoholaufnahme -auch in Monatsabständen- körperlich sehr ungesund. Weiter zeigt sich, daß sich später die Trinkphasen verlängern und immer häufiger auftreten. Auch zeigt sich durch dieses Verhalten natürlich eine geistig - seelische Störung an, Sowohl in Hinsicht auf den Delta-, als auch in Hinsicht
auf den Epsilon - Typ ist hier die Gelegenheit noch einmal folgendes klarzustellen: Der Begriff )Kontrollverlust( wird oftmals nur auf die Menge des Alkohols bezogen. Das bedeutet, es wird nur von Kontrollverlust gesprochen, wenn jemand die Kontrolle über die Menge des getrunkenen Alkohols verliert, oder, noch anders ausgedrückt: wenn der Betreffende nach den ersten Schlucken weitertrinken muß. Diese Einengung des Begriffes ist nach Ansicht des Verfassers falsch! Richtiger erscheint, den Begriff auch anzuwenden, wenn die Kontrolle über die Häufigkeit des Trinkens wirksamer Mengen verloren ging !
1.2.3 Alkoholwirkungen (Promille)
Viel wurde nun schon über (krankhaftes) Trinken gesagt. Wie aber wirkt eigentlich der t1Stoff”, um den es hier geht? Dies soll jetzt im Überblick dargestellt werden:
0.2-0.3 Promille:
Wärmegefühl, Nachlassen von Müdigkeit und Mattigkeit. Die höheren geistigen, moralischen und seelischen Kräfte werden beeinträchtigt.
0.3-0.5 Promille:
Selbstzufriedenheit (oder Niedergeschlagenheit), Das Blickfeld (Gesichtsfeld) wird eingeschränkt, Aufmerksamkeit, Konzentration, Selbstkritik und Urteils-fähigkeit lassen nach. Die Leistungsfähigkeit wird eingeschränkt und die eigenen Kräfte überschätzt, insbesondere das Reaktionsvermögen (Auto!),
0.5-0.7 Promille:
Geistig - seelische Entkrampfung und Enthemmung. Das Triebhafte tritt stärker hervor,
0.8-1.2 Promille:
Größere Risikobereitschaft bis hin zum Angstverlust, Großartigkeitsgefühl, verminderte Fähigkeit zur Selbstkritik, Kritikvermögen auch allgemein vermindert, Euphorische Stimmung (Sorglosphase),
1,2-1,5 Promille:
Störung des Gleichgewichtssinns, ungenaue und ungeschickte Bewegungen verzögerte nervliche Reaktionen.
1.6-2.4 Promille:
Größere Störungen bis zu totalen Ausfällen körperlicher und seelischer Funktionen,
2.5-4.0 Promille:
Vergiftungserscheinungen, Volltrunkenheit, Sinnes- und
Orientierungsstörungen bis hin zur Ausschaltung des Großhirns im narkotischen Schlaf,
4.0-5.0 Promille:
Atemstillstand, fortschreitende Lähmung, unkontrollierte Ausscheidungen, Tod.
Natürlich gibt es hier -in gewissem Rahmen- individuelle Unterschiede.(19)
Weiter stellt sich nun die Frage, wieviel Alkohol -z.B. der Bundesbürger - jährlich verbraucht.
1.2.4 Alkoholverbrauch
Die „Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren ( DHS )” gibt in ihrer „Jahresstatistik '90” (Hamm / 1991 / S.7 ) hierzu folgende Zahlen an:
„Verbrauch alkoholischer ... Getränke pro Kopf
1950
1960
1970
1980
1988
1989
1990
Reiner Alkohol in Liter (
*
)
3,1
7,3
10,8
12,5
11,8
11,8
11,8
Spirituosen 38 Vol,-%”(20)
Es sei noch einmal betont: Es handelt sich hierbei um reinen Alkohol, also (rechnerisch) 100,00-prozentigen. Die konsumierten Getränke ergeben demnach, in Liter oder Flaschen ausgedrückt, eine deutlich höhere Zahl.
Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen:
11,8 Liter reinen Alkohols ergeben:
68,18 Liter Bier
98,33 Liter Wein
31,05 Liter Spirituosen
(Prozentumrechnung wie oben,)
Das sind:
536,36 Flaschen Bier (a 0,5 Liter)
oder 140,47 Flaschen Wein (a 0,7 Liter)
oder 44,36 Flaschen Spirituosen (a 0,7 Liter)
Soviel also wird jedes Jahr von jedem Bürger dieses Landes getrunken, Wohlgemerkt: von Jedem ! Das bedeutet, auch jedes Baby, jedes Kind und auch die vielleicht 5 Prozent Bundesbürger die (fast) keinen Alkohol trinken, sind in dieser Statistik enthalten ! in Wirklichkeit ist die durchschnittliche Trinkmenge (von Personen die tatsächlich überhaupt Alkohol trinken) also noch einmal höher anzusetzen. Zur Erinnerung: 4 Flaschen Bier a 5%, oder eine Literflasche Wein enthalten ca. 80 Gramm reinen Alkohol! Also eine Menge, die garantiert -bei täglichem „Genuß”- Gesundheitsschäden hervorruft und eine besonders deutliche Suchtgefährdung darstellt.
1.2.5 Alkoholabbau
Soviel Alkohol nimmt also der Bundesbürger zu sich,
Wie und wie schnell wird der Alkohol nun aber im menschlichen Körper abgebaut ?
„Der wesentliche Teil des Alkohols gelangt über den Dünndarm direkt in den Blutkreislauf. Dieser Vorgang zeigt auf, daß Alkohol nicht verdaut wird! ... Die gesunde Leber baut etwa 1 Gramm Alkohol pro zehn Kilogramm Körpergewicht pro Stunde ab. Trotz aller möglichen )Mittelchen( und Versuche, ist dieses Abbautempo nicht zu beschleunigen!”(21)
Soviel zum Abbau des Alkohols in Gramm. In Bezug auf die Alkoholpromille im Blut ist die Sachlage etwas komplizierter, Die tatsächlichen Promille, die jemand “hat”, sind nämlich von mehreren Umständen abhängig, Hier spielt nicht nur die Menge des konsumierten Alkohols eine Rolle, sondern auch das Geschlecht, das Körpergewicht, die Trinkgeschwindigkeit, die jeweilige körperliche (und geistig-seelische!) Verfassung, usw.!
Allgemein wird aber davon ausgegangen, daß etwa 4 Glas Bier durchaus schon 0,8 Promille erzeugen können (dies als Beispiel).
Pro Stunde werden etwa 0,1 - 0,2 Promille Alkohol im Blut abgebaut, d.h. also durchschnittlich 0,15 Promille! Es läßt sich dies durch Kaffeegenuß, körperliche Anstrengung, etc. objektiv nicht beschleunigen!(22)
Hierzu wieder ein Rechenbeispiel:
Hat jemand einen „Gehalt” von 1,5 Promille, so dauert es durchschnittlich 10 Stunden bis er wieder völlig nüchtern ist, ein Stand von 0,8 Promille wäre hier nach 4 Stunden und 40 Minuten erreicht -durchschnittlich. (Es kann nämlich auch wesentlich länger dauern!) Auch bei einer Promillegrenze von 0,8 im Straßenverkehr würde übrigens ein Unfallbeteiligter mit z.B. 0,7 Promille durchaus bestraft werden!
1.2.6 Der Preis
Das Vergnügen (?) hat seinen Preis:
(Alle Angaben für Deutschland im Jahre 1990)
Ausgaben für Alkoholika
Diese betrugen insgesamt 37,38 Milliarden DM.
Pro Kopf waren dies durchschnittlich 591,-DM
Steuerabgaben für alkoholische Getränke
Diese beliefen sich auf 6550 Millionen DM.
Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluß
32823 Unfälle dieser Art gab es.
Verletzte
44529 Menschen wurden bei diesen Unfällen verletzt.
Tote
1416 Menschen starben dabei.(23)
Sonstiges
Es sind hier weiterhin mit einzubeziehen:
Kosten die durch in alkoholisiertem Zustand ausgeführte Verbrechen entstehen, wie Sachbeschädigungen usw., aber auch die Kosten, die durch die Unterbringung, Bewachung und Verpflegung solcher „Rauschtäter” entstehen.
Kosten durch alkoholbedingte Betriebsunfälle.
Kosten durch die Behandlung Alkoholkranker, wie Entgiftung, Entwöhnung (ca. 10000,- DM pro Monat) und andere therapeutische / medizinische Behandlungen.
Von den direkten gesundheitlichen Schäden, die durch langen Alkoholmißbrauch, bzw. Im Laufe einer Alkoholabhängigkeit entstehen, wird im folgenden ausführlicher die Rede sein.(24)
1.2.7 Gesundheitliche Schäden
Hier nur die wichtigsten Schäden:
Einige Schäden werden aus der Graphik ja bereits ersichtlich. Der tägliche (oder fast tägliche) „Genuß” von umgerechnet 80 Gramm reinem Alkohol -oder mehr- erzeugt aber noch weitere Schäden.
Dies sind z.B.:
Entzündungen der Blutgefäße, Arterienverkalkung, Nierenschrumpfungen, Impotenz, Knochenmarkschäden, funktional eingeschränkte Gelenke, (bei schwangeren Frauen:)
Alkoholembryopathie (das sind schwere Schädigungen des ungeborenen Kindes), Fehlgeburten. Weitere Schädigungen sind denkbar. Wann und welche Schäden genau auftreten -dies ist natürlich von Fall zu Fall verschieden.
1.2.8 Ursachen und fördernde Umstände / Ätiologie
Einige wichtige Ursachen und Umstände, die Sucht hervorbringen (bzw. fördern), werden später im Kapitel „Sucht und Gesellschaft” näher untersucht.
Andere Faktoren, hier bezüglich des Alkoholismus, sind aber -zum Teil schon seit längerem- recht gut bekannt. Diese sollen jetzt dargestellt werden.
Es lassen sich Faktoren besonders in drei Bereichen erkennen:
■ Faktoren welche die jeweilige Droge betreffen (hier also Alkohol)
■ Faktoren die den jeweiligen Menschen betreffen
■ Faktoren, die sich auf das jeweilige soziale Umfeld beziehen (also die Gemeinschaft aus welcher der Betreffende stammt und in welcher er lebt)
Diese drei Bereiche werden nun etwas anschaulicher betrachtet:
Die Droge
Ein wichtiger Begriff ist hier das sog. “Suchtpotential” Dieser Begriff sagt etwas über den Wirkungsgrad einer Droge aus, bzw. über die Stärke der abhängigkeitserzeugenden Wirkung. Bei Heroin ist z.B. das Suchtpotential sehr hoch: fast jeder (der diese Droge ein- oder mehrmals “probiert”) wird auch von ihr abhängig. Aber auch bei Alkohol ist dieses Potential keineswegs niedrig. Genau meßbar ist ein Suchtpotential zwar nicht. Auch sprechen einige Schätzungen davon, daß „nur” etwa jeder fünfzehnte “Alkoholprobierer” später abhängig werde. Aber selbst dies wäre bei der besonders weiten Verbreitung von Alkohol schon ein sehr hoher Preis. (Die Schätzung erscheint im übrigen auch als sehr niedrig.) Und auch die Schäden die bei “Nicht - abhängigen durch Drogen wie Alkohol auftreten sind nicht eben harmlos.(25)
Ein weiterer wichtiger Begriff ist hier die Verfügbarkeit einer Droge. Dazu ist zu sagen, daß die Droge Alkohol in Deutschland legal, rezeptfrei und äußerst weit verbreitet ist. Weiterhin besteht auch keine nennenswerte gesellschaftliche Ächtung dieses Rauschmittels. Mithin ideale Bedingungen für Sucht
Weitere Begriffe, die Droge an sich betreffend, ließen sich anführen. Etwa die „chemische Struktur und Abbauwege”, „physiologische Wirkung”, „Art der Einverleibung” oder „Toleranzphänomen” und weitere. Die zuerst näher erläuterten Begriffe sind aber sicherlich die bedeutsamsten. Der Vollständigkeit halber soll nur noch erwähnt werden, daß Alkohol vom Drogentyp her -natürlich- zum „Alkohol- /Barbiturattyp” gehört.(26)
Der Mensch
Hier läßt sich gleich eine ganze Reihe verschiedener suchtmachender und -stützender (möglicher) Faktoren finden.
Beispiele:
■ besondere lebensgeschichtliche Faktoren, wie Lebens- und Sinnkrisen, Tod des Partners, “midlife- crisis”, Trennungen, etc.
■ geistig-seelische (psychische) Erkrankungen, wie Neurosen, Psychosen, u.ä.
■ geistig-seelische Schwächen, z.B. eine sogenannte “geringe
Frustrationstoleranz” (d.h. die Fähigkeit Enttäuschungen und
Niederlagen zu verkraften ist schwach ausgeprägt). Auch sind viele Menschen nicht (mehr) in der Lage ihre eigenen Gefühle angemessen wahrzunehmen und zu äußern. Dies ist ebenfalls ein Faktor der sehr anfällig für Süchte macht! (Gemeint sind übrigens sowohl gute als auch „schlechte” Gefühle !)
■ körperliche Anfälligkeit gegenüber Alkoholismus.
Das bedeutet der Betreffende hat eine diesbezüglich schwache Konstitution und / oder Kondition. “Konstitution” meint hier die Gesamtverfassung und Widerstandskraft, “Kondition” die derzeitige körperliche Verfassung und Leistungsfähigkeit.
■ Lebensalter
Hier läßt sich z.B. das Jugendalter anführen. Der Wunsch „erwachsen” zu sein (bzw. zu wirken), kann zu erhöhtem Alkoholkonsum und damit zur Suchtgefährdung beitragen. Bei männlichen Jugendlichen tritt oft noch ein falsch verstandener Begriff von „Männlichkeit” hinzu.
Auch das Alter ist aber ein diesbezüglich gefährdeter Lebensabschnitt. Vereinsamung, Hilflosigkeit, Unzufriedenheit mit dem geführten Leben, usw. können sicher Sucht begünstigen, (Diese Sichtweise wird übrigens oft vernachlässigt. Warum eigentlich, „Lohnt” sich's da nicht mehr?)
■ Falsche/täuschende Lernerfahrungen des Einzelnen in Bezug auf Alkoholkonsum. Hier gibt es natürlich wieder eine ganze Menge verschiedener möglicher Lernprozesse und Erfahrungen, Dazu einige Beispiele:
Es lassen sich hier grundsätzlich drei Bereiche unterscheiden, in denen derartige falsche Erfahrungen gemacht werden.
Der erste Bereich ist der positive, gute. Dies soll bedeuten, daß auf Grund des Alkoholkonsums etwas angenehmes erwartet wird und (scheinbar) auch eintritt. Beispiele hierfür wären die Steigerung einer romantischen Stimmung, die Verbesserung des Geschmacks beim Speisen) die Vertiefung des Empfindens beim hören von Musik, usw.
Die angenehme Stimmung, bzw. Stimmungssteigerung wird (bewußt oder unbewußt) in Verbindung mit dem Alkoholkonsum gebracht, Auf Alkoholgenuß folgen angenehme Gefühle! Dies ist es, was gelernt wird. Angenehmes wiederholt man gern. Am besten so oft wie nur möglich, Übersehen wird hierbei natürlich, daß diese Stimmungen einen entscheidenden Nachteil haben: Sie sind nicht echt! Vielmehr sind sie von außen, durch eine chemische Substanz hervorgerufen. Nicht „Herbert Meier” schwelgt in romantischen Gefühlen, sondern „Herbert Alkohol”. Ein weiterer Nachteil scheint schwerwiegender: Durch diese bequeme, billige Lösung angenehme Gefühle durch Alkoholkonsum zu steigern, fallen andere Ansätze von vornherein weg! Der Einzelne wird also zunehmend unfähiger seine Gefühle auf natürliche, aktive Art und Weise auszuloten. Wozu sollte man sich denn auch noch in neue, unbekannte Situationen begeben, warum sollte man mit Mühe und Geduld Wege und Umstände ausprobieren, um die eigene Erlebnisfähigkeit zu steigern? Das alles gibt es doch zu kaufen - im nächsten Spirituosengeschäft! Der zweite Bereich betrifft unangenehmes, Dieses Unangenehme soll gemildert oder ganz unterdrückt werden. Beispiele lassen sich hier zahlreich finden. Nervosität, Ängste, „Lampenfieber”, Prüfungsangst, Streß, Sorgen, usw.: all dies „schüttet man in ein Gläschen Wein”, bzw. „spült es runter”. Anlässe finden sich in allen Lebensbereichen, sei es im Berufs- oder Privatleben, bei Partnerschaftsproblemen, im Verein, in der Schule, bei Ärger mit der Verwandtschaft, oder sonstwo. Oft wird von wohlmeinender Seite mahnend gesagt: „Alkohol löst doch keine Probleme'“ Das stimmt nicht! Und gerade das ist ja das Schlimme. Durchaus löst Alkohol Probleme. Zwar nur kurzfristig, für wenige Stunden (eben beim „fröhlichen Zechen”), zwar nur scheinbar; zwar ergeben sich wegen des (zuviel) Trinkens bald neue Probleme, aber: Alkohol löst -von dem jeweiligen Menschen aus gesehen- erst einmal seine Probleme, Man kann vergessen, abschalten, an etwas anderes denken, den Wein oder das Bier genießen. „Ein Bier und ein Korn, bringt Dich wieder nach )vorn(~”, „Hast Du Ärger mit den Deinen: trink! Dir einen'“ und andere Sprüche spiegeln diesen Ablauf wieder, Dies gilt es also zu berücksichtigen~ Die hier eintretende Täuschung wurde ja schon ersichtlich, Die „Langzeitwirkung” ist auch hier tragischer und ähnlich wie im Bereich „Angenehmes”: Auf Dauer geht die Fähigkeit unangenehmes auch mal zu ertragen, oder aber es aktiv anzugehen, mehr und mehr verloren.
Der dritte Bereich schließlich stellt die Mischung aus dem ersten und zweiten dar7 wobei natürlich die eine oder andere Seite überwiegen kann, So erleichtert vorheriger Alkoholgenuß subjektiv sicher die (sexuelle) Annäherung an das andere Geschlecht. Hemmungen werden scheinbar bewältigt und -im Erfolgsfall- das Erlebnis (bei richtiger Dosierung) gesteigert. Das „Mut-antrinken” vor dem entscheidenden Gespräch mit dem Chef, wegen der Gehaltserhöhung und ähnliches, ließen sich hier ebenfalls zuordnen.
Bezüglich der Nachteile eines solchen Vorgehens gilt das bisher bereits gesagte.
Allgemein ist zu diesen ganzen Lernerfahrungen noch folgendes zu bemerken: Die Erziehungslehre (Pädagogik) fand im Laufe der Zeit einige sogenannte Lerngesetze heraus, nach denen in der Regel auch das menschliche Lernen abläuft. Eines dieser Gesetze lautet: Wenn auf ein bestimmtes Verhalten unmittelbar etwas angenehmes folgt, wird dieses Verhalten in der Zukunft häufiger auftreten. Und wenn dieses Verhalten in der weiteren Zukunft nur noch ab und zu durch das Angenehme belohnt wird, wird dieses Verhalten sogar noch beständiger, statt seltener.
Dies ist ein Ansatz zur Erklärung eigentlich unlogisch erscheinender Tatsachen: Selbst wenn bei längerem Alkoholmißbrauch zunehmend die Nachteile überwiegen, wird ja nicht damit aufgehört. Die Erklärung hierzu findet sich sicher zum Teil in obigem Lerngesetz.
Mit einer gewissen Brutalität ließe sich zu diesem Bereich der Lernvorgänge und -gesetze noch weiteres sagen: Der Einzelne behandelt sich selbst durch die willenlose Unterwerfung unter diese Vorgänge schlimmer als die ärmste Laborratte in einem Experimentierkäfig. (Denn diese hat -leider- keine Wahl.) Daß dies meist unwissentlich und unbewußt geschieht, macht die Sache nicht weniger schlimm,
Der Verfasser bezieht sich übrigens -in Bezug auf die Vergangenheit- in besonders hohem Maße in diesen Vorwurf ein.(27)
Ein weiterer Faktor, der Sucht erzeugen, bzw. stützen kann und der den jeweiligen Menschen betrifft, ist seine Erbanlage. Dies meint eine mögliche angeborene Anfälligkeit für Sucht. Wissenschaftlich kann man hier von einer ,genetischen Prädisposition! sprechen (man kann sich aber auch verständlich ausdrücken...)
Auch dieser Faktor soll wieder etwas ausführlicher dargestellt werden, -Erbanlage
Bei einzelnen Menschen des westlichen Kulturkreises, häufiger bei Völkern wie den Indianer und Japanern, findet sich eine Art Allergie gegen Alkohol. Das bedeutet, wenn ein solcher Mensch auch nur relativ geringe Mengen Alkohol trinkt) reagiert sein Körper mit Unwohlsein, Gesichtsrötung und ähnlichen Erscheinungen. (Dies kann man sicherlich auch als eine eigentlich gesunde Reaktion ansehen) immerhin ist Alkohol ein Gift.)
Der hier interessante Umkehrschluß ist der, den einige Wissenschaftler zogen. Die Überlegungen gingen dahin, daß Alkoholiker ein zuwenig von dieser „Allergie” besitzen, so daß schon der Körper eigentlich keine warnenden Hinweise mehr bei zu hohem und zu häufigem Alkoholkonsum geben kann. Interessant war in diesem Zusammenhang, daß vermutet wurde, diese Eigenschaft sei vererblich, Alkoholismus sei also in diesem Sinne angeboren. Belege für diese Auffassung liegen dem Verfasser aber nicht vor.
Ein ähnlicher Hinweis findet sich bezüglich der Enzyme und Metabolismen des menschlichen Körpers:
... nicht alle Menschen (scheinen) in gleichem Maße dazu zu neigen) alkoholabhängig zu sein. Entscheidend ist wohl die Tatsache, daß die den Alkohol im Organismus abbauenden Enzyme und Metabolisaten von Person zu Person verschieden sind ( „biologische Vulnerabilität”). Bestimmte ADH-Enzyme bei manchen Menschen können mehr Alkohol oxydieren als andere bei anderen Menschen. Zudem scheint durch Gewohnheit oder Erschöpfung eine Änderung des biologischen Systems möglich zu sein, so daß jemand, der Alkohol bis dahin vertragen hat, nunmehr auf seinen Genuß mit Krankheit reagiert !(28) Inwieweit diese Eigenschaften dann jeweils vererblich sind) wäre hier natürlich noch zu erkunden.
Zum besseren Verständnis ist wohl auch die Definition einiger Begriffe erforderlich:
„Enzyme... Gruppe von biologischen Katalysatoren, die die Unzahl der chemischen Reaktionen, die sich im ... menschlichen ... Organismus abspielen, katalysieren, steuern und regeln. Sie bestehen im wesentlichen aus hochmolekularen Eiweißstoffen. Charakteristika der E. sind, daß sie ... von den lebenden Zellen gebildet werden .. . u. daß jedes Enzym nur ganz bestimmte chemische Reaktionen) die sich im Organismus abspielen .. . steuern kann.”(29) Metabolismen, hier: Umwandler, Veränderer.
Soweit dieser Hinweis, Ganz besonders interessant sind Forschungen aus neuerer Zeit, die sich mit dem sog. „A 1-Allel des Dopamin D2 - Rezeptorgens” befassen, Diese und andere Begriffe sind in hohem Maße wissenschaftlich, trotzdem soll hier versucht werden, diese Forschungsrichtung verständlich zu machen - eben weil sie besonderes Interesse verdient. Die Wissenschaftler waren auf der Suche nach einem „Alkoholismusgen”. (Gene sind Erbanlagen, bzw. Erbfaktoren.) Ein Alkoholismusgen wäre demnach ein Gen, welches die Information: „Du wirst Alkoholiker werden” von einer Generation auf die andere vererbt. Alkoholiker und Nichtalkoholiker wurden also untersucht, ob sich in ihrem Körper bestimmte Gene befinden -oder eben nicht befinden.
Einer der Forscher, Kenneth Blum, fand nun in den Körpern von 77% der Alkoholiker das besagte „A 1-Allel des Dopamin D2 - Rezeptorgens”. Bei Nichtalkoholikern fand er dies hingegen nur in 28% der untersuchten Körper. Dies würde natürlich für eine relativ starke Vererbbarkeit des Alkoholismus sprechen.
Bedauerlicherweise (für K.Blum) bestätigten andere Untersuchungen dieses Ergebnis nicht, so etwa die Untersuchung von David Goldmann, der allerdings -im Gegensatz zu Blum- lebende Alkoholiker und Nichtalkoholiker untersuchte.
Es gibt aber auch noch andere Forschungsansätze, so etwa den von Pickens: „Aus einer bisher unveröffentlichten Studie an Zwillingen schloß Pickens vom Sucht-forschungszentrum in Rockville, daß Erbanlagen zu etwa 20 bis 30 Prozent zum Risiko, Alkoholiker zu werden, beitragen - bei bestimmten Untergruppen des Alkoholismus war dieser Einfluß allerdings größer.” (319)
Das Thema ist also alles andere als entschieden.
Es wäre jetzt möglich, bei der vorläufigen Feststellung „kann sein - kann nicht sein” stehenzubleiben und zunächst zur „Tagesordnung” überzugehen
Doch wurden bei dieser „Genjagd” einige Mechanismen im menschlichen Körper herausgefunden, die -nach Ansicht des Verfassers- einiges zum Verständnis von Sucht beitragen können. Auch könnten diese Ergebnisse in Hinsicht auf die Therapie wichtig werden.
Daher soll dieses Thema noch näher beleuchtet werden, wobei es allerdings nötig ist etwas weiter auszuholen. Zunächst ist der Begriff der sog. „Endorphine” zu erläutern, welcher im Zusammenhang mit dem A 1-Allel des Dopamin D2 - Rezeptorgens steht. Endorphine lassen sich auch als körpereigene endogene (d.h. von innen, von selbst kommende) Morphine bezeichnen. Das bedeutet nichts anderes, als daß der menschliche Körper eigene morphiumähnliche Stoffe herstellt und diese -bei gegebenem Anlaß- freisetzt. Diese Stoffe bewirken u.a. Euphorie, Streß- und Angstabbau und können in hohen Dosen sogar Schmerzen betäuben. Einer dieser Stoffe ist z.B. das sog. Beta - Endorphin.
Der Mechanismus dieser Endorphine bildet also sozusagen das „Belohnungssystem” des Gehirns und damit des Menschen, übrigens wäre es natürlich ein falscher und fataler Fehlschluß, hier anzunehmen „es sei doch egal, ob die Stoffe die gute Gefühle machen, nun von innen oder von außen kommen:”! (Etwa um damit Heroinkonsum zu rechtfertigen.)
Zur näheren Beschreibung bliebe noch zu erwähnen, daß die Endorphine insbesondere für die spontanen, kurzfristigen, guten Gefühle „zuständig” sind. Lang anhaltende positive Gefühle (beispielsweise der Stolz einer bestimmten Fußballmannschaft anzugehören, u.ä.) scheinen anderen Mechanismen zu unterliegen.
Nun aber zurück zum A 1-Allel des Dopamin D2 -Rezeptorgens. Es wurde gesagt, daß dieses Gen (bzw. Allel) eventuell / zum Teil die Information: „Du wirst Alkoholiker werden” weitergibt. Eigentlich ist dies aber eine recht grob vereinfachte Darstellung. Denn diese Information ist nicht etwa in das Gen / Allel „einprogrammiert” und wird später „übermittelt”. Vielmehr ist es so, daß dieses Gen bestimmte Eigenschaften hat. Ist nun jemand „Träger” des Gens, bewirken diese speziellen Eigenschaften, daß der Betreffende hierdurch besonders gefährdet sein kann z.B. Alkoholiker zu werden Was sind dies nun aber für spezielle Eigenschaften? Es sind Eigenschaften, die die Fähigkeiten von Zellen beeinflussen, den Botenstoff Dopamin im Verhalten zur Ausprägung kommen zu lassen. Dies klingt wieder kompliziert -und ist es auch. „Botenstoff Dopamin”: dies meint, daß im Gehirn Informationen von Zellen zu anderen Zellen übermittelt werden müssen, obwohl diese nicht miteinander verbunden sind. Man kann es sich sinnbildlich so vorstellen, daß kleine Kügelchen (die Informationen enthalten) von der einen Zelle zur anderen „hinübergeworfen” werden. Diese „Kügelchen” bestehen hier nun aus dem Botenstoff Dopamin. (Wissenschaftlich läßt sich dieses System übrigens als „Neurotrans- mittersystem” bezeichnen.)
Hier läßt sich nun endlich die Verbindung der Begriffe „Endorphine” und „A 1-Allel des Dopamin D2 Rezeptor-gens” herstellen. Denn die körpereigenen Endorphine, aber auch von außen zugeführte Suchtstoffe, wirken über den Neurotransmitter Dopamin euphorisierend. Das bedeutet: ist jemand Träger des besagten A l- Allels, so stimmt etwas mit seinem „Belohnungssystem” nicht. Anders ausgedrückt heißt das, seine Fähigkeit gute / angenehme Gefühle zu empfinden ist beeinträchtigt. Genauer gesagt, er empfindet nicht so häufig und nicht so stark wie andere Menschen positive Gefühle.
Wie bereits erwähnt, läßt sich dieser Mangel aber durch die Einnahme von Drogen wie Alkohol ausgleichen. Die Tatsache, daß dies tatsächlich so oft versucht wird (bewußt oder unbewußt), legt natürlich die fast philosophisch klingende Vermutung nahe, es gäbe ein allgemeingültiges Mindestmaß an Freude welches Jeder lebensnotwendig braucht