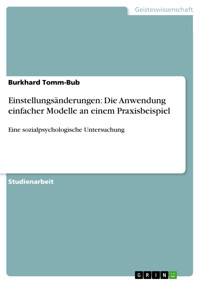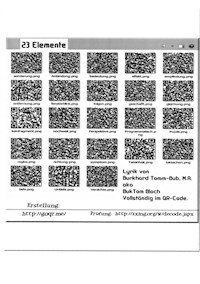Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
DAS BUCH Spätestens als er selbst grundlos sein Auto in Flammen aufgehen lässt, weiß Thomas Bloch, dass etwas geschehen muss. Die Auseinandersetzung mit seiner Suchtkrankheit bleibt aber nicht der einzige Stolperstein für ihn. Als "kleiner Bruder der 68er-Generation" führt sein beruflicher Weg als Sozialarbeiter ihn in die Position eines Fallmanagers im Jobcenter. Die Erkenntnis, dass er dort Menschen nicht wirklich beraten und helfen, sondern diese kontrollieren und strafen soll, ruft nach nur wenigen Jahren ein erfolgreiches Mobbing durch seine Vorgesetzten hervor. Schließlich stehen noch eine Krebserkrankung und zuvor das Ende seiner Ehe auf dem Programm. Letzteres aber nicht aus den "üblichen Gründen", wie ihm klar wird. Sein Arbeitgeber zwingt ihn letztendlich in die Rolle des faulsten Sozialarbeiters Deutschlands. Und noch weitere Kämpfe ganz anderer Art schließen sich dem an. Aber ist er deswegen wirklich am Ende? Oder wird die Saat der Niederlagen aufgehen und Früchte tragen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Freundlich gewidmet allen Menschen die nach der „Goldenen Regel“ handeln!
Zur Mahnung all denen, die sie missachten.
INHALT
VORWORT
TIEFPUNKT SUCHT
Krise
Angst und Aufbruch
Text: Traum ohne Ziel?
Zweifel
Die Gruppe
Rückfall
Stationär
Lebensbericht
Rückmeldungen
Lyrik aus der Therapie
ERWÄRMUNG
UMBRUCH
GEHEN
ALTERNATIVE
MOVEMENT
ERWEITERUNG
Erkenntnisse und Erlebnisse
Britta
ENDE EINER EHE
Gemeinsamer Aufbruch
In die Pfalz
Entwicklungen
Todesfälle und Immobilien
Der Vater
Die Mutter
Tapetenwechsel
Die 70er Jahre – Erinnerungen
Reise in die Vergangenheit
Abschließende Reminiszenzen
Bernd das Brot, Lesungen, Waldspaziergänge
Krisen nach ICD-10 / Showdown
Gespräch mit der Angst
KREBS UND ANDERE KRANKHEITEN
Hepatitis C
RAUSGEBOSST – DER FAULSTE SOZIALARBEITER DEUTSCHLANDS
Im Jobcenter
Flipperkugel
Völlig losgelöst
Es sind Menschen. #refugees
HARTZ IV - DIE ETHISCHE KATASTROPHE
Jobcenter-Krimi (Roman im Roman)
Aktionen und Kampagnen
LIEBE UND ANDERE (ZWISCHEN-)BILANZEN
Zoom!
Sex!
Schuld und Reue
Freunde, Familien und ein Todesfall
Politik und Religion
In die weite Welt hinein?
Lesen, Schreiben, Literatur
Internet, Cyberspace, VR und Second Life
Der diffuse Drang zum Sozialen
Romantische Liebe
Kein Ende ohne Anfang
ANFÜGUNGEN
A) Foto-Galerie
B) Illustrationen, Belege und Beweise
C) Über den Autor / Bibliographie
D) Nachwort / Disclaimer - Epilog / Adressen
E) Impressum und Quellen
VORWORT
Niederlagen sind etwas Gutes. Wenn man sie überlebt. Etliche überlebt man – irgendwie – fast immer. Andere seltener. Mir ist das gelungen. Mit Glück, mit der Hilfe anderer Menschen, mit einigen richtigen Entscheidungen.
Ich habe aus manchen dieser Erfahrungen wichtiges und gutes gelernt. Es gibt Menschen, denen ich dankbar sein muss – und ich bin es tatsächlich! Man könnte denken, dass ich dieses Buch auch aus Rache geschrieben habe. Und hätte recht damit. Rache ist ein garstiges Wort. So was sagt man heutzutage nicht mehr. Nennen wir es „individuelle Psychohygiene“. Es wäre billig, mich selbst als nahezu makellos zu schildern und dabei andere Menschen als böse und ungerecht hinzustellen. Billig möchte ich aber nicht werden. Obwohl ich einige Geschehnisse in meinem Leben tatsächlich als extrem unlogisch erlebt habe, als motiviert von trotziger Emotionalität – und insbesondere bewirkt durch völlige Gleichgültigkeit und Ignoranz Anderer.
Doch genug davon. Ich hadere nicht. Wäre das alles nicht so passiert: wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Und den mag ich. Meistens jedenfalls. Langeweile ist mir fremd. Ich bin zufrieden, aber nicht satt-zufrieden. Genau so soll es sein.
Ich war mehrere male am Ende. Oder fühlte mich zumindest intensiv so. Suchtkrankheit, Krebs, Hepatitis C, flankiert von „kleineren gesundheitlichen Problemen“, das sind hierzu einige der Stichworte. Aber auch die Erkrankungen anderer, nahestehender Menschen machten mir zu schaffen. Eine Ehe zerbrach de facto, jedoch nicht aus den „üblichen Gründen“. Meine berufliche Laufbahn begann schwierig, besserte sich sehr deutlich und brachte mich dann wieder einmal an einen Tiefpunkt. Dies durch ein erfolgreiches Mobbing von Vorgesetzten, auch Bossing genannt.
Das Thema „Hartz IV“ / SGB II beschäftigte mich anschließend für lange Zeit. Nein, ich selbst musste diese unzureichenden „Almosen des Staates“ nicht in Anspruch nehmen.
Aber es gab mehr als genug gute Gründe, die mich als Mensch und Sozialarbeiter – und eben auch als ehemaligen Fallmanager in einem Jobcenter – dazu zwangen, mich zu einem Aktivisten gegen dieses ungerechte System zu entwickeln. Was Folgen hatte …
Der negative Höhepunkt dessen wurde erreicht, als ich von meinem Arbeitgeber zum „faulsten Sozialarbeiter Deutschlands“ gemacht wurde. Wider Willen. Und doch schäme ich mich dafür!
Das alles waren Niederlagen. Aber ich lebe noch.
Und im Nachhinein habe ich sie alle auch als eine Saat empfunden.
Eine Saat in mein Herz und in meinen Verstand.
Eine Saat kann verdorren, kann schlechte Früchte hervorbringen, oder nur sehr wenige. Ich versuche mit meinen Erfahrungen, meinem Wissen und meinem guten Willen, dies zu verhindern.
Das gelingt nicht immer. Ich mache Fehler, es gibt Rückschläge und manches läuft schlicht ins Leere.
Aber ich werde nicht aufhören. Was ich tun kann, werde ich tun.
Auch davon berichtet dieses Buch.
Einige Details in diesem autobiografischen Roman musste ich dabei weglassen, weil es sonst zu viel wäre. Manche Details habe ich aber auch bewusst weggelassen. Es gibt einige, wenige Menschen, die ich schützen muss und schützen will. Umbenannt habe ich fast alle Städte und Personen. Einige werden sich dennoch erkennen. Das ist Absicht.
Dieses Buch transportiert vor allem Erfahrungen und Erlebnisse.
Aber auch Informationen über arbeitsrechtliche, gesetzliche und andere Missstände. Vielleicht wird ja darüber diskutiert. Vielleicht wird das Buch zum Beispiel gar in der ADD, der rheinlandpfälzischen Kommunalaufsicht gelesen? Ich werde mein Bestes dafür tun …
Ich wünsche also allen Leserinnen und Lesern eine spannende, informative und hoffentlich auch ermutigende Lektüre!
Abschließend jedoch noch einige technische Hinweise:
* Einige der Ratschläge aus der Fibel „Wie schreibe ich einen Bestseller?“ habe ich bewusst nicht beachtet. Mehr als zwei, drei Themenbereiche würden die Lesenden überfordern, so heißt es.
Ich traue Ihnen und Euch da aber mehr zu! So sind es hier also vier oder fünf und es kommen sogar noch einige kleinere hinzu. Sie alle sind wichtig und ergeben erst ein umfassendes Gesamtbild.
* Es gibt teilweise Überschneidungen in den thematisch unterschiedlichen Kapiteln. Das betrifft zeitliche Abläufe und die Erwähnung von Lebensstationen. Diese werden dann relativ kurz und am Rande erwähnt, um eine bessere (zeitliche) Einordnung zu ermöglichen.
* In einigen Teilen des Buches wechselt scheinbar die Erzählperspektive! Das soll man tunlichst unterlassen, sagt hier das Handbuch. Das würde die Lesenden nur verwirren! Nun ja. Was passiert da? Ich möchte es erklären. Die Theorie beschreibt es so:
„Man unterscheidet zwischen vier verschiedenen Erzählperspektiven. Die auktoriale (allwissende), personale (Er/Sie-Perspektive), neutrale (ohne klare Erzählsituation) und den Ich-Erzähler.“
Im Buch wechsle ich nun an manchen Stellen von der personalen Erzählung in die „Ich-Form“.
Es heißt also manchmal nicht erzählend: „Thomas wusste, dass er etwas unternehmen musste!“, sondern: „Ich wusste, dass ich etwas unternehmen musste!“ Dieser Wechsel geschieht nicht oft und nicht willkürlich. Er passiert dann, wenn Thomas etwas liest, was er zuvor geschrieben hat. Und da hat er natürlich von sich selbst in der Ich-Form geschrieben! Das ist nachvollziehbar denke ich.
Mir wurde vorgeschlagen doch einfach alles in der „Ich-Form“ zu schreiben. Das kann ich nicht. Einige Erlebnisse und Erfahrungen gehen mir schon in erzählender Form sehr nahe. Noch näher kann ich das nicht an mich heranlassen. Ich bitte um Verständnis.
Burkhard Tomm-Bub, M. A.
Staatlich anerkannter Erzieher-
Diplom-Sozialarbeiter (FH)-
Erziehungswissenschaftler-
TIEFPUNKT SUCHT
Krise
Thomas Bloch war am Ende. Im Dezember würde er dreißig Jahre alt werden. Wenn er es denn erleben würde.
Jetzt aber stand er vor seinem brennenden Auto. Offiziell gehörte es zwar seinem Vater, war ihm aber schon seit Jahren „zur alleinigen Nutzung“ überlassen worden. In Brand gesetzt worden war es soeben von ihm selbst. Das interessante daran war der Grund, warum er das getan hatte. Es gab keinen. Die Erkenntnis, dass an seinem Handeln der letzten zehn Minuten so einiges ganz und gar nicht in Ordnung war, drang aber nur langsam in sein Gehirn vor. Ursächlich dafür war das auch als Schlafmittel eingesetzte Neuroleptikum, dass er „zur Nacht“ eingenommen hatte, sowie etliche Mini-Fläschchen Schnaps, die er tagsüber gegen seinen leichten Zahnschmerz „eingesetzt“ hatte. Ein befreundetes Paar hatte ihn mit sanfter Gewalt genötigt in deren Fernsehzimmer zu übernachten. Sie meinten, nach dieser Art "Zahnbehandlung" solle er eindeutig nicht mehr autofahren. Beide waren dann zu Bett gegangen. Zum Glück handelte es sich um ein ländlich gelegenes Anwesen, direkte Nachbarn gab es nicht.
Er hatte nicht mit dieser Entscheidung seiner Bekannten gehadert, sie war nachvollziehbar. Zwar gab es nicht mehr viel zu trinken, doch seine besondere Schlafpille hatte er auf einem Löffel zerfallen lassen und dann geschluckt. Auch das Fernsehprogramm hatte etwas aus dem von ihm bevorzugten Science Fiction-Genre zu bieten. Das Ende einer Odyssee - Galactica III. Die Zylonen griffen die lange gesuchte Erde an, Strahlgeschütze feuerten auf Gebäude und Autos, die explodierten oder in Flammen aufgingen.
Seine Sinne hatten sich immer mehr eingetrübt – aber seltsamerweise wurde er nicht wirklich müde, eher ein wenig unternehmungslustig. Eine noch halbwegs klare Erinnerung war dann die, dass er in sich hinein kicherte, weil ihm ein Buchtitel von Heinrich Böll eingefallen war. „Das Ende einer Dienstfahrt". Auch an das Hauptmotiv der Handlung hatte er sich erinnert. Am Ende seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr erhält ein Soldat den Befehl, durch ziellose Fahrten mit einem Geländewagen den für die routinemäßige Inspektion erforderlichen Kilometerstand zu erzeugen, fährt aber stattdessen nach Hause. Gemeinsam präparieren Vater und Sohn den Wagen und verbrennen ihn unter Absingen von Litaneien auf offener Straße. Die anfänglich als politisch motiviert eingestufte Straftat wird aber im Laufe der späteren Gerichts-Verhandlung und nach der Anhörung des Kunstprofessors Büren als eine Form der Anti-Kunst, als „Happening“ neu bewertet und nur milde bestraft.
Was danach geschah, erlebte Thomas wie in einer Art Traum. Er beobachtete quasi sich selbst und auch dies mit einem nur relativ mildem Interesse. Sein traumwandlerisches Ich realisierte durchaus, dass der Weg durch die Küche zur Haustür – die vermutlich auch abgeschlossen war – zu auffällig war. Die beiden im Schlafzimmer würden ihn hören, ihn bemerken. Das Öffnen des Fensters in seinem Zimmer aber nicht. Das tat er und hangelte sich hinab in den Garten. Obwohl im Erdgeschoss war der Abstand zum Boden etwas höher als gedacht. Doch auch das gelang. In einer sehr versteckten Ecke seines Bewusstseins fragte sich sein beobachtendes Bewusstsein mittlerweile mit einer halb hochgezogenen Augenbraue, was der Kerl eigentlich vorhatte, döste dann aber weiter. Nun hatte er erstaunlich zielgerichtet gehandelt. Der Autoschlüssel war noch in seiner Hosentasche. Er öffnete den Wagen und sortierte einige der Dinge die er in ihm fand aus, deponierte diese einige Meter entfernt auf dem Erdboden. Etliche Zeit später würde er lange darüber nachgrübeln, nach welchen Kriterien dies geschehen war, nach welchen Prioritäten. Allerdings vergeblich. Nun öffnete er den Tankdeckel, nahm einen langen Schal der im Wagen lag heraus und drehte diesen ein deutliches Stück in den Tank hinein. Er ließ ihn sich vollsaugen, zog ihn wieder heraus und warf den Schal dann in das Wageninnere. Den Tank ließ er geöffnet.
Streichhölzer fand er in einer seiner Hosentaschen.
Er riss eines der Hölzchen an, wartete einen kurzen Moment und warf es dann ohne zu zögern durch die geöffnete Wagentür ins Innere. Der Erfolg trat sofort ein. Der stark benzingetränkte Schal fing augenblicklich Feuer und loderte beeindruckend auf, die Flammen griffen schnell auf das sonstige Wageninnere über. Einige Sekunden starrte er nun aus mittlerem Abstand auf den brennenden Wagen.
Versonnen, ruhig und fasziniert. Dann machte es, metaphorisch gesprochen "laut und vernehmlich", KLICK in seinem Kopf. Die handelnde Persönlichkeit der letzten fünfzehn Minuten hatte sich abgemeldet.
War weg. Warum? Weil sie sich nun doch erschrocken hatte? Oder eher weil jetzt alles was zu tun war, bestens erledigt war? Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass ER sich nun erschrak. Hastig lief er zur Eingangstür des Hauses, die Klingel funktionierte anscheinend nicht und so trommelte er mit den Fäusten dagegen und schrie mehrfach "Es brennt!
ES BRENNT!" Nur wenig später kamen Elke und Wolfgang heraus, in Nachtwäsche, aber die Situation sehr schnell richtig erfassend. Sie blieben angesichts der Lage erstaunlich ruhig. Beide waren absolut keine Spießer, so wie Thomas auch und hatten schon so einige Spielarten menschlichen Verhaltens erlebt. Sie traten neben Thomas, mit gebührendem Abstand zum lodernden Wagen. Nach kurzem Überlegen meinte Wolfgang: "Ok, ich fahr` mal schnell unser Auto noch ein paar Meter weiter weg, zur Sicherheit." Elke eilte derweil in Richtung Haus, um die Feuerwehr zu rufen. Ausgerechnet als Wolfgang den Punkt der größten Annäherung zum brennenden Wagen erreichte, schoss eine Stichflamme aus dem geöffneten Tankdeckel.
Er zuckte zusammen, zog ruckartig den Kopf ein und die Schultern hoch. Doch die Flamme war stark aufwärts gerichtet, verfehlte ihn deutlich. Äußerlich ungerührt ging "Wolfie" weiter und setzte den Wagen des Paares um. Danach verschwamm Thomas` Erinnerung ein wenig. Er saß im Wohnzimmer des Hauses, die Feuerwehr war gekommen. Viel war eigentlich nicht mehr zu tun, der Wagen war komplett ausgebrannt. Natürlich war vorsichtshalber nachgelöscht und gesichert worden. Ein Feuerwehrmann hatte versucht ihn zu befragen, allerdings mit relativ wenig Erfolg. Er war geschockt und verwirrt. Zweifelte ernsthaft an seinem Verstand.
Also an dem worauf er immer stolz gewesen war. Er war nicht groß, er war nicht stark, seine Eltern nicht arm, aber auch nicht überdurchschnittlich wohlhabend.
Aber sein Verstand, sein Intellekt? Da hatte er etwas zu bieten, das war ihm immer klar gewesen. Doch der hatte sich nun anscheinend verabschiedet, hatte gezeigt, dass es keine Garantie für seine Anwesenheit gab. Das ängstigte ihn ganz enorm, das war ein absoluter Tiefpunkt, ein ganz persönlicher Schrecken.
In seiner Gegenwart hatte man trotz der späten Stunde seinen Vater angerufen, ihn informiert und insbesondere gefragt, ob dieser Anzeige erstatten wolle. Er wollte nicht. Irgendwie war er damit nicht ganz zufrieden. Er wollte verhaftet, wollte mitgenommen werden. Zur Strafe, sicherlich. Aber vor allem, um andere Menschen und sich selbst vor ihm zu schützen. Die Feuerwehr erklärte sich jedoch klar für nicht zuständig. In einer tragikomischen Geste hatte er daraufhin unzufrieden und verwirrt auf dem Tisch umhergeschaut, dann aus der Obstschale in der Mitte nacheinander aber zügig einige Äpfel, Orangen und Bananen genommen und diese umhergeworfen.
Nicht weit und mit sehr mäßiger Wucht, immerhin.
Dabei rief er mehrfach: "Nehmt mich mit! Ich habe sie nicht mehr alle! Ich habe sie nicht mehr alle!" Es hatte nichts genutzt. Die Feuerwehr rückte ab, Elke und Wolfgang hatten ihn beruhigt und versichert, sie würden schon aufpassen und alles richtig machen.
Angst und Aufbruch
Die nächsten Tage oder gar Wochen nahm er ein wenig verschwommen wahr. Lethargisch, seelisch und geistig fast wie gelähmt.
Doch der Schrecken, der Schock blieb. Eine grundlegende Angst hatte sich seiner bemächtigt. Das war wirklich diese Sache, die man in der Arbeit mit Suchtkranken den „persönlichen Tiefpunkt“ nannte. Er wollte seinen Verstand nicht unkontrolliert verlieren, ganz sicher nicht. Es gab Möglichkeiten und Potentiale. Er konnte kreativ sein, sich für gute Dinge einsetzen, schreiben. Auch wenn das alles in den letzten Jahren zunehmend weniger und immer chaotischer geworden war. Das alles wollte er nicht endgültig verlieren. Langsam kämpfte Thomas sich aus seiner schuldbewußten Depression hervor. Seine Eltern hatte ihn in ihrem Gästezimmer aufgenommen, aber seine kleine Wohnung in der Nähe blieb ungekündigt. Sie hatten auch ein Gespräch mit dem Sprecher der örtlichen Selbsthilfe-Gruppe des Blauen Kreuzes arrangiert, der ihn besucht und einen guten Eindruck gemacht hatte. Er fasste einen Entschluß. Im nahe gelegenen Ort Herten gab es die Möglichkeit einer qualifizierten stationären Entgiftung. Drei Wochen statt zwei und mit der Möglichkeit zu Beratungsgesprächen. Anders also als in den üblichen Entzugsstationen in Krankenhäusern, die fast ausschließlich zwei Wochen anboten und stark auf den medizinischen und körperlichen Aspekt konzentriert waren.
Er meldete sich dort an und bekam einen Aufnahme-Termin. Als es soweit war aufzubrechen, wollten ihn seine Eltern dorthin fahren. Aber das wollte er nicht. Er wollte sich nicht „abliefern lassen“ und er wollte auch seinen selbst gefassten Entschluss symbolisch selbst und allein umsetzen. So bestellte er ein Taxi und begann seinen Weg.
Auch ein Buch hatte er dabei im Gepäck. Das war ein einziger, ein kleiner Lichtblick gewesen. Richtig freuen konnte er sich nicht, dazu war die Gesamtsituation zu bedrückend für ihn. Aber die Lieferung eines Kartons mit einem Dutzend Buchexemplaren der Anthologie „Träume & Arbeit“ war in sein seelisches Chaos hineingeworfen worden. Der Gauke-Verlag hatte tatsächlich einen seiner Texte dafür akzeptiert.
„Traum ohne Ziel?
Nun ist es dunkel Und er schleicht wieder einsam durch die Nacht Wo ist der Anfang, Wo das Ende seines Weges Trübe Flackern die Lichter Der Laternen.
So auch seine Gedanken Sie irren durch seinen Geist, Der keine Klarheit mehr hat Verheißungsvoll Tanzen die Lichter Aus den Fenstern umliegender Häuser Verspricht ihr magischer Schein Wärme und Geborgenheit? Oder sind es nur Wegweiser Am Rande Schon seit Ewigkeiten Ausgetretener Pfade? Die Reflexe Der nassen Straße Werfen auch seine Gedanken zurück: Undurchdringlich. Wie frisch und klar die Luft ist
Wenn auch das Dunkel Den Blick nicht weit dringen lässt Sein Weg kennt kein Ziel Und ist doch noch so weit. Erinnerungen
Treiben durch den Nebel. An Menschen Auf die er in dieser Stunde gewartet hat, Ohne ihnen jemals wirklich begegnet zu sein.
Schritt um Schritt Durch die Nacht. Ein Sehnen im Herzen. Verzweiflung in der Seele. AsphaIt, Nass, Ein paar Sträucher am Wegesrand
Und die Burgen aus Stein: Heruntergekommene Träume Von Schlössern und Glück. Ringsum die Nacht. Das Dunkel Iässt jede Richtung frei ..."
Zweifel
Es wurde nicht einfach. Aber er hielt die drei Wochen durch.
Körperliche Entzugserscheinungen hatte er eigentlich nicht wirklich. Sein Konsum war fast immer recht gemischt gewesen. Alkohol, verschiedene rezeptfreie Medikamente, rezeptpflichtige Pillen, mal weniger, mal etwas mehr Haschisch und Marihuana. Seelisch aber blieb er verwirrt und schuldbewusst. Unruhe und Nervosität kamen nun hinzu. Und Schlaflosigkeit. Oft saß er nachts im Aufenthaltsraum, meist allein. Noch öfter schritt er den längsten Gang der Station ab. Mit leisen Schritten. Hin.
Zurück. Wieder hin. Wieder zurück. Draußen war die Nacht.
Niemand war zu diesen Uhrzeiten zu sehen. Die Türen waren zu und die Außentüren waren abgeschlossen. Im Bereitschaftszimmer war immer jemand, klar. Und er war doch freiwillig hier! Was würde der Diensthabende tun, wenn er anklopfte und sagen würde: "Sorry. Aber ich kann nicht mehr. Ich möchte gehen! Schließen Sie bitte auf"? Hm. Er würde es wahrscheinlich mit guten Worten probieren.
Versuchen ihn zum Bleiben zu überreden. Eventuell sogar einen richtigen Psychologen herbei telefonieren. Der dasselbe versuchen würde. Aber wenn er eher wortkarg bliebe, höflich aber bestimmt auf seinem Verlangen bestehen würde – mussten sie ihn gehen lassen. Und würden das auch tun.
Die Andeutung eines Lächelns war in seinem Gesicht zu sehen. Er blieb.
Die Gruppe
Die Wochen danach waren aber weiterhin von Unsicherheit, Verlegenheit, Scham und Schuldbewusstsein geprägt.
Dennoch, nach und nach, langsam zunächst, ging es vorwärts. Er versuchte es tatsächlich mit der örtlichen Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes (BK). Mit dem Sprecher der Gruppe hatte er ja schon einmal Kontakt gehabt, das erleichterte es etwas.
Selbsthilfegruppen konnten in der konkreten Praxis ganz unterschiedlich aufgestellt sein, selbst wenn dasselbe "Label" darauf klebte, wie hier eben das "BK". Das würde er später noch ausführlicher erfahren und auch erleben.
Im Hier und Jetzt jedenfalls hatte er Glück. Es war eine relativ kleine Gruppe, es gab wenige ritualisierte Abläufe, Kaffeetrinken und Rauchen waren erlaubt. Zuweilen gab es sogar ein Stück Kuchen. Ein "Kaffeeklatsch" wurden die Treffen hierdurch allerdings nie. Besonders die Zusammensetzung, die regelmäßigen Teilnehmer fand er interessant, fast schon faszinierend. Eine noch jüngere Lehrerin, ein Redakteur der Regionalzeitung, eine etwas ältere, körperlich leicht eingeschränkte ehemalige Mitarbeiterin der Sozialverwaltung. Aber auch ein einfacher Arbeiter, der im Laufe seiner Trinkerkarriere bereits einmal entmündigt gewesen war, ein Vorarbeiter im Maurerbereich, ein noch jüngerer Mann, der zusätzliche psychiatrische Probleme hatte und ab und zu zwei oder drei weitere Menschen. So unterschiedliche Menschen. Die sich ohne äußeren Zwang einmal in der Woche zusammen fanden.
Sich zum Teil auch außerhalb dessen unterstützten. Alle mit letztlich demselben Problem: Sucht. Der Ablauf des Abends war meist sehr ähnlich. Wenn mutmaßlich alle anwesend waren, gab es ein sogenanntes "Blitzlicht". Das war eine einfache Methode aus der sozialen Gruppenarbeit. Alle Teilnehmenden formulieren dabei reihum einen Satz über ihre derzeitige Befindlichkeit oder berichten auch ob und was es seit dem letzten Treffen wichtiges neues gab. Die Äußerungen wurden von den anderen nicht kommentiert. Es war aber in keinem Fall ein Problem auszusetzen, einfach "weiter" zu sagen, oder auch nur einfach stumm auf den nächsten Nachbarn zu deuten. So wurde jeder psychische Druck vermieden. Derlei war nicht die Aufgabe einer Selbsthilfegruppe! Nach Abschluss der Runde ergab sich dann jedes mal mehr als genug Gesprächsstoff, um den Abend zu einem hilfreichen und oft auch nachdenklich machendem Ereignis werden zu lassen.
RÜCKFALL
Thomas Bloch las etliches zum Thema, ging weiterhin zur ambulanten Suchtberatung und in die Selbsthilfegruppe.
Schon nach wenigen Monaten fühlte er sich "obenauf". Er wusste nun viel mehr, tat das Richtige, hatte sogar schon einige Pannen erlebt und weggesteckt – was sollte da schon noch sein! Und es war auch nichts. Ein Dreivierteljahr lang.
Dann baute er einen Rückfall. Der eigentlich voraussehbar gewesen war. Er war am Ende. Wieder einmal. Er kam sich nun hochmütig vor. Wie konnte er nur? Und wider besseres Wissen! Zwei Bekannte hatten ihn bei dem Vorfall in einem Krankenhaus irgendwo im Nirgendwo "abgegeben". Er hatte bei der Rückfahrt von einem auswärtigen Seminar im Auto verstärkt angefangen zu nörgeln, weil sein letzter Flachmann leer war. Sie kannten sein Problem und handelten absolut richtig. Seine Selbsthilfegruppe wurde informiert -und tatsächlich besuchte und unterstützte man ihn. Sorgte auf seine Bitte hin sogar für eine Verlegung in die qualifizierte Entgiftung nach Herten, wo er schon einmal war. Doppelte Scham. Das Gefühl des Versagens. Niedergeschlagenheit, Depression ... das waren seine Begleiter in den kommenden Wochen. Am liebsten wäre er deutlich länger in Herten geblieben, als wieder nur drei Wochen. Das sagte er auch einer der Betreuerinnen dort. "Hm, nein. Wir haben eher überlegt, Sie früher gehen zu lassen. Körperlich kommt da nichts mehr. Und ansonsten? Sie wissen eigentlich schon alles. Sie müssen es nur noch machen!", erwiderte diese.
Thomas nahm danach seine ambulanten Gespräche in der städtischen Suchtberatung wieder auf. Und natürlich auch die Treffen in der Selbsthilfegruppe. Wobei er dem ersten Besuch "danach" mit sehr gemischten Gefühlen entgegensah. Er war der Gruppe sehr dankbar für die Unterstützung in der Krise. Aber natürlich schämte er sich auch sehr für seinen Rückfall. Etwas nervös und vor allem verlegen stotterte er dann herum, als er beim Blitzlicht "dran war". Die Runde wurde normal zu Ende geführt. Im folgenden Gruppengespräch wurde sein Thema aber natürlich auch nochmals angesprochen. Seine Beklommenheit blieb dabei noch einige Zeit bestehen. Sie ließ aber merklich nach, anhand der positiven Gruppenatmosphäre. Karl, der Maurermeister, brachte es dann auf den Punkt: "Tom. Du wirst von der Gruppe sicherlich weder eine Verurteilung, noch eine Absolution bekommen! Du weißt mittlerweile selbst, was du da gemacht hast. Du hast es überlebt. Ob und was du daraus lernst – wird bei dir liegen. Die Gruppe kann dabei helfen.
Nicht weniger. Aber auch nicht mehr."
Obwohl die Umstände seines Rückfalls ja eigentlich deutlich weniger dramatisch gewesen waren, als die bei seinem persönlichen Tiefpunkt, saß auch diesmal die Erschütterung tief. Er hatte zwischenzeitlich erlebt und erfahren, dass es durchaus auch "ohne" ging. Und: besser als "mit"! Bald stand sein Entschluss fest. Er würde eine mehrmonatige stationäre Therapie anstreben.
Die städtische Suchtberaterin unterstütze seine Absicht.
Zuvor hatte sie sich – mit seinem ausdrücklichen Einverständnis -mit dem Sprecher der Selbsthilfegruppe, Hans dem Lokalredakteur, in Verbindung gesetzt. Auch dieser hatte dazu geraten, wenn es denn sein Wille sei. Nun galt es eine Einrichtung auszuwählen -zumindest konnte man beim Kostenträger Vorschläge und Wünsche diesbezüglich äußern. Gemeinsam hatte man bereits einige Broschüren durchgesehen. Thomas legte einen kleinen Stapel davon zur Seite, auf ein Seitentischchen. Doch dabei fiel dieser zu Boden und er hob ihn sogleich wieder auf.
Dabei fand sein Blick ein Foto der Einrichtung "Federnburg in Bergschmallen". Er blätterte kurz in der Broschüre und las: "Wir sehen eine Suchtproblematik als eine Krankheit multifaktorieller Genese." Das war eine Formulierung und eine inhaltliche Aussage, die ihn sehr ansprach.
"Ich denke, ich weiß wohin ich möchte!", sagte er zu der Suchtberaterin. Und so geschah es auch.
Stationär
Einige Wochen später befand er sich bereits in der recht großen stationären Einrichtung. Federnburg war landschaftlich sehr schön gelegen, in einem Mittelgebirge mit viel Grün. Eine Umstellung war das schon, nun 24 Stunden am Tag außerhalb der gewohnten Umgebung zu leben. Und immer einfach war es auch nicht. Eine Arbeitstherapie wie in manchen anderen Fachkliniken gab es hier nicht. Aber Frühsport, verpflichtende Kunst-und Werkkurse, Einzelgespräche, regelmäßige Kleingruppen und Großgruppen, wöchentliche Vorträge und einiges mehr. Eine prägende Erfahrung wurde für ihn die Erstellung seines Lebensberichtes.
Diese Aufgabe hatte man schon nach recht kurzer Zeit zu bewältigen.
Und: der Bericht musste in der eigenen Kleingruppe und in einer Großgruppe mit ca. vierzig Patientinnen plus einiger Therapeutinnen und Therapeuten vorgetragen werden.
Keine leichte Sache, die hier überstanden werden musste.
Lebensbericht
Der handschriftliche Bericht war fertig und er las ihn noch einmal durch.
"LEBENSBERICHT begonnen am 11. März 1989
Ich wurde am 25.12.1957 geboren. Während der Schwangerschaft erhielt meine Mutter bei einem häuslichen Unfall für mehrere Minuten einen starken Stromschlag.
Meine Geburt war für meine Mutter, laut ihren Angaben, lebensbedrohlich, sie hat sehr viel Blut verloren. Etwa in meiner Grundschulzeit erzählte sie mir auch mehrmals hiervon. Mein Eindruck war, dass ich also schon durch meine Geburt fast zum Mörder meiner Mutter geworden sei.
Wie ich hörte, war ich als Baby in einer Kinderkrippe, oder ähnlich. Meine Mutter besuchte mich evtl. Mittags und holte mich Abends ab. Da meine Eltern berufstätig waren erzogen mich zunächst überwiegend die Eltern meiner Mutter, die in einem ans Haus meiner Eltern angebauten Haus wohnten.
An Kinderkrankheiten sind mir Keuchhusten (relativ langwierig) und Masern erinnerlich. An meine Großeltern habe ich hauptsächlich gute Erinnerungen. Ich erinnere mich allerdings, dass ich morgens eine „Schnitte“ essen musste, obwohl ich nicht mochte. Später in meiner Schulzeit war mein Opa relativ streng bei der Beaufsichtigung meiner Hausaufgaben.
An meinen einzigen Bruder habe ich aus der Kinderzeit kaum Erinnerungen. Er ist wesentlich älter als ich und verlies sehr früh das Elternhaus. Ich erinnere mich, dass ich, als ich zum ersten Mal in den Kindergarten musste, einen ziemlichen Trennungsschmerz verspürte. Auch im Kindergarten war mein Essensverhalten auffällig. (Meine Mutter berichtete schon als Baby habe ich Babynahrung mit Fleisch ausgespuckt.) Im Kindergarten aß` ich das dortige Essen nicht, musste aber, vor einem leeren Teller sitzend, an der Mahlzeit teilnehmen.
In der Grundschule hatte ich Schwierigkeiten mit einem strengen Lehrer, der mich auch vor der Klasse erniedrigte.
Meine Eltern sorgten dafür das ich in eine Parallelklasse umgeschult wurde.
Übrigens erinnere ich mich, dass meine Oma einen großen Kasten mit allerlei Medikamenten hatte mit dem sie sich oft beschäftigte. Ein Mittel für jederlei Krankheit war darin.
Mein Vater war eigentlich immer abwesend. Entweder tatsächlich, räumlich, also z. B. beruflich bedingt (Bundesbahn) oder später, nach seiner Pensionierung, oft monatelang im Ferienhaus meiner Eltern, in der Nähe von Trier. Aber auch wenn er körperlich anwesend war, innerlich, gefühlsmäßig schien er mir auch dann abwesend. Er war ruhig, sagte wenig, tat wenig. Allerdings fand ich ihn relativ schlau / clever. Auch wirkte er auf mich recht zuverlässig, konsequent, im Gegensatz zu meiner Mutter war er verlässlich und ein wenig nahm er mich auch ernst.
Meine Mutter erlebte ich dagegen als nahezu hysterisch, aufgedreht, aktiv, unzuverlässig, trinkend, mich entweder vernachlässigend (sie arbeitete als freiberufliche Reporterin, Fachbereich Gerichtsberichterstatterin) oder mich als unmündiges kleines Kind behandelnd, überbeschützend.
Ich bekam von ihr und auch meinem Vater den Eindruck, ALLES ließe sich übers Materielle regeln (Mutter:
Schokolade; Vater: gute Schulzensuren wurden -nach einem genauen System finanziell belohnt, schlechte Noten bestraft (finanziell) (dies als Beispiele).
1965 starb mein Großvater mütterlicherseits, die primäre Bezugsperson meiner Mutter. Hatte sie vorher wohl auch schon mal etwas getrunken, so soff sie anschließend lange Zeit, was auch nach Jahren noch häufig vorkam. Es war nicht schön für mich. Ich hasste Bier in diesen Zeiten.
1970 starb auch meine Großmutter mütterlicherseits. 1965 -1970 erzogen mich quasi meine Oma und meine Mutter, wobei meine Mutter noch arbeitete, trank und regelmäßig mit meiner Oma intensiv stritt. Ich versuchte zu vermitteln, meine Mutter anschließend immer zu beruhigen, meine Oma wieder ''aufzubauen'', nach jedem Streit. Ich war oft verzweifelt damals.
1970 etwa wurde dann mein Vater pensioniert (vorzeitig wg. Kriegsverletzung). Er war nun nicht mehr auf der Arbeit abwesend, sondern im Ferienhaus abwesend.
Etwa in diese Grund- und Hauptschulzeit fiel auch meine erste persönliche Begegnung mit Bier. Tapezierer arbeiteten im Hause und gaben mir einen Schluck. Nach dem Geschmack gefragt, machte ich eine lustige Bemerkung und alle lachten freundlich anerkennend. 1970 kam ich überredet von meiner Mutter, ins Gymnasium, in die Quarta. Da ich erst nicht wollte, versprach mir meine Mutter, nach dem Unterricht etwas mit mir zu unternehmen, jeweils. Ein Versprechen, das sie nicht einhielt.
In der Quarta war ich der Klassenkasper. (Vorher in der Grund- und Hauptschule hatten mich alle verhauen, dort hatte ich zeitweise eine bezahlte „Leibgarde''.) An die Untertertia habe ich wenig Erinnerung. Irgendwann war da der erste Kontakt mit einem Mädchen, rein platonisch, Delia M., das war ganz schön.
Die Obertertia habe ich zwei mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es beim ersten oder zweiten Mal war, als es anfing. In diese Zeit fiel nämlich meine zweite (bzw. erste richtige) Begegnung mit Alkohol. Ich war mit zwei, drei Schulkameraden in einer Kneipe schräg gegenüber des Recklinghäuser Hauptbahnhofes. Dort trank ich ein, zwei Glas Bier. In der Musikbox lief gute Musik, ''Back home'' von Golden Earring z. B. Da war Kameradschaft und als wir nach draußen gingen, war der schöne, warme Sommertag noch mal so schön. Wir gingen dann zum Marktplatz. Dort traf ich ein Mädchen, das ich flüchtig von den Jesus peopeln her kannte (dort hatte ich mit ca. 13 Jahren für ein Jahr mitgemacht, aber nie den richtigen Kontakt gefunden). Ich plauderte mit diesem Mädchen ein wenig, und irgendwann fragte sie mich, ob irgendwas mit mir los sei. Ich antwortete:
''Och, hab ein bisschen Bier getrunken....'' Darauf sie ganz lieb: ''Ach, du bist aber süß wenn du blau bist!“
Irgendwie war's das wohl schon; ich glaube später habe ich dann genau das alles immer wieder im Suchtmittel gesucht:
Freundschaft, Wärme, Kontakt und Beziehungen zu Frauen, Anerkennung, Gemeinschaft mit Gruppen von Leuten, lustig und originell sein, Verstärkung des Genusses beim Musikhören und Tanzen usw. Auch wollte ich Schmerz (seelisch), Enttäuschung, Leid, Zurückgewiesen fühlen, Angst, Unsicherheit betäuben.
Wir gingen dann bald des Öfteren nach der Schule auf den Marktplatz um dort Wein zu trinken. Meine Eltern merkten davon nichts. In meiner Klasse war ein Jürgen M., dem ich mich stark anschloss. Er war ein überlegener Typ, hatte die ''coole Ruhe'* einerseits, andrerseits war immer was Neues los. Mit ihm trank ich dann auch in den Pausen manchmal Wein. Auch Haschisch lernte ich durch ihn kennen.
Haschisch habe ich aber nie gut vertragen, jedenfalls nicht ohne ''Zugabe'' meist Alkohol. Wenn ich nüchtern etwas rauchte, hatte ich nahezu immer das Gefühl eines drohenden Unheils, unbestimmt, Angst jedenfalls. Trotzdem schaffte ich die Obertertia im zweiten Anlauf, nach der Untersekunda musste ich gehen, bekam aber - aufgrund eines Sondererlasses - noch die Fachoberschulreife.
Anschließend wurde ich von meiner Mutter überredet die Höhere Handelsschule zu besuchen. Dort schaffte ich es nicht, war ca. ein halbes Jahr dort, bis ich mich abmeldete, weil ich inzwischen volljährig war.
Etwa in diese Zeit fielen wohl Versuche mit LSD, insgesamt nicht mehr als zehn "Trips". Zwar hatte ich nicht den bekannten ''horror trip'', aber der dünne, SEHR dünne Faden, den ich in diesem Zustand noch zur Realität hatte, machte mir mit der Zeit Angst, so dass ich damit aufhörte.
In der Zeit Untersekunda / Höhere Handelsschule war ich mit einem Schulkameraden, Monir T., oft zusammen. Mit ihm nahm ich Ephedrin und trank gern Altbier in der Kneipe, aber auch auf dem Marktplatz waren wir öfter, mit mehreren Leuten zusammen. Als ich mich von der höheren Handelsschule abmeldete, hatten meine Eltern gerade das Haus verkauft. Sie zogen dann in eine Eigentumswohnung in Marl. Von daher schrieb mir mein Vater 1600 DM gut, von denen ich, nach und nach etwas abholte, bzw. bezahlte er ein paar meiner Zimmermieten im Voraus.
Ich war, nach dem Abbruch der Schule, mit einem Bekannten, Gernot T., in eine Wohnung über meine Stammkneipe („8-8“) gezogen. Mein Wirt war dort also auch mein Vermieter. Wir tranken viel, nahmen Ephedrin (fast immer: wenn Ephedrin dann auch Alkohol, umgekehrt nicht unbedingt) und rauchten ab und an. Drei Tage versuchte ich es als Hilfskraft bei C und A, das klappte natürlich nicht. Ich half aber dem Wirt, Heiko S., bei allem möglichen, z. B.
Keller entrümpeln usw. So hatte ich ''frei trinken'', während der Arbeit und jeden Tag ein paar Mark (30 - 40 DM) extra, ohne etwas von meinem Vater holen zu müssen.
Doch auch das Geld von meinem Vater war irgendwann restlos abgerufen, auch fühlte ich mich nicht so gut, so das ich nach circa einem 3/4 Jahr etwas anderes machen wollte.
(In diesem 3/4 Jahr versuchte ich übrigens schon einmal mit dem Alkohol Schluss zu machen, das klappte, verzichtend, knapp sechs Wochen.) Ich vereinbarte mit meinen Eltern, dass ich weiter ''Schule machen'' würde, wenn sie mir eine Wohnung und Taschengeld bezahlen würden. Damit waren sie einverstanden.
Ich besuchte dann zwei Jahre die FOS - Sozialarbeit / Sozialpädagogik in Dorsten und schloss auch erfolgreich (Durchschnittsnote 2,8) ab. Während des ersten Jahres, als ich in Oer-Erkenschwick wohnte (wo ich das Kindergartenpraktikum - vier Tage in der Woche - machte), wohnten gute Bekannte in der Nähe und es bildete sich eine Gemeinschaft von ''Freaks'' wobei harte Drogen keine Rolle spielten. Wir trafen uns sehr oft mit 20 - 30 Leuten im Stadtpark und tranken, rauchten wohl auch, ich nicht sehr viel. Bei mir kamen nun schwerpunktmäßig Brom Präparate hinzu (ABASIN und ADALIN, Mittel die zur Beruhigung und zum Einschlafen gedacht waren und einige Jahre später rezeptpflichtig wurden.)
Im zweiten Jahr zog ich nach Dorsten, da nun die ganze Woche Schule war. Ich lebte dort ziemlich isoliert, nahm meist während der Woche wenig oder keine Gifte, - soweit ich mich erinnere - zu mir. Am Wochenende allerdings schlug ich in der dortigen ''progressiven Kneipe'' ("de godde Stowwe'' oder ähnlich) alkoholmäßig mehr oder weniger stark zu. Gelegentlich kam es auch vor, dass ich während der Woche ein, zwei Tage "bläute" und zu Bekannten nach Recklinghausen fuhr, wo natürlich auch getrunken wurde.
Übrigens war ich circa seit meinem 16 Lebensjahr dann auch öfters in ''progressiven Discos'', wo ich dann auch öfters ''abgefüllt'' – allein – tanzte (Festivals: dito).
Nach Abschluss der FOS zog ich in die Nähe meiner Eltern, nach Marl und bemühte mich um einen Studienplatz für Sozialarbeit, den ich auch schnell bekam. Allerdings nicht, wie von mir gewünscht, in der Nähe, sondern in Mönchengladbach. Trotzdem behielt ich meine Wohnung in Marl und fuhr stundenlang mit dem Zug hin und her.
Allerdings zunehmend seltener. Ich kannte niemanden in Mönchengladbach und hielt mich lieber im Musikermilieu von Marl auf. Wir tranken viel und ich nahm mal diese mal jene Tabletten. Nach einem Semester war mir klar, das ich es nicht schaffen würde und bemühte mich dann um die Aufnahme in die Fachschule für Soz. Arb./ Soz. Päd.
(Abschluss: Staatlich anerkannter Erzieher). Ich wurde dort auch aufgenommen.
Im ersten Jahr schaffte ich es ganz gut, wenn ich auch oft verspätet und / oder verkatert zur Schule kam, oder auch mal fehlte. Im zweiten integrierten Praktikum (an der Gesamtschule) lernte ich Birgit H. kennen. Sie war in der Parallelklasse in die ich nach dem Praktikum überwechseln sollte. (Man suchte aktive Leute.) Im November 1980 entstand eine Beziehung. Um diese nicht zu gefährden, verzichtete ich ab Januar 1981 völlig auf Alkohol, teilweise auch auf Tabletten.
Wenn ich welche nahm dann wenig und selten. Ab und zu PERCOFFEDRINOL (=EPHEDRIN, ein eher aufputschendes Medikament) und abends rezeptfreie Schlafmittel. Bis zum Sommer 1982 dauerte dieser Zustand.
Zwei oder drei mal trank ich je einen Tag lang, weil es Streit (mit Trennungsabsichten ihrerseits) gab. Einmal zwischendurch zwei Wochen lang, als sie allein in Urlaub war. Im Sommer '82, am letzten Tag der Erzieherausbildung trennte sich Birgit H. endgültig von mir.
Ich trank dann einige Wochen verstärkt, nahm auch Tabletten. Als im September 1982 mein Zivildienst auf einem betreuten Spielplatz begann, hatte ich mich einigermaßen gefangen. Die Arbeit machte mir auch Spaß. Über den Tag kam ich mit relativ wenig rezeptfreien Beruhigungsmitteln.
Abends trank ich öfter oder nahm Tranquilizer. Der Zivildienst war Ende Dezember 1983 beendet. Bis August 1984 war ich nun arbeitslos. Etwa in diese Zeit fiel eine Erfahrung mit Heroin, wobei mir an einem Tag von jemandem etwas gespritzt wurde und ich am nächsten Tag eine Dosis schnupfte. Beides war von sehr angenehmer Wirkung, aber nicht so sagenhaft wie mir mancher berichtet hatte. Das Experiment war damit für mich abgeschlossen.
Von August bis November 1984 arbeitete ich in einem Erziehungsheim in Dorsten. Bei Nachtdienst trank ich, wie einige Kollegen ein, zwei Flaschen Bier, nach der Arbeit ca. eine Flasche Wein. Ich konnte mich dort gegenüber den Jugendlichen nicht durchsetzen und wurde nach vier Monaten entlassen.
Ich stieg anschließend in eine Arbeitsloseninitiative in Marl ein. Am ersten März 1986 bekam ich dort auch eine ABM-Stelle als Erzieher, wir wollten einen betreuten Spielplatz einrichten. Das Projekt scheiterte allerdings.
Im Herbst '86 lernte ich zwei Mädchen kennen, die am Tag bis zu sieben Flaschen Fleckenwasser der Sorte PERPLEX schnüffelten. Ich tat dies dann einige Wochen auch ab und zu in geringerem Maße, trank ansonsten Wein und nahm Tabletten, vorwiegend Tranquilizer, LEXOTANIL zum Beispiel.
Ende 1986 war ich sehr fertig und meldete mich für die psychiatrische Abteilung in Kirchhellen an. Einige Tage bevor ich mich ohnehin dort hatte einfinden sollen, fiel ich in einen deliriumsähnlichen Zustand und wurde dort eingeliefert. Mitte Januar hatte ich mich so weit erholt, dass ich das Krankenhaus gegen ärztlichen Rat verließ.
Ich wohnte dann, in schlechtem körperlichen und geistigen Zustand bei meinen Eltern und war in Behandlung eines Neurologen. Ca. Sommeranfang 1987 zog ich wieder in meine Wohnung. Schnell setzte ich die mir verordneten ANTABUS (diese verhindern das Trinken von Alkohol) ab, und begann zu trinken. Ich war ziemlich isoliert in diesem Jahr. Meine durchschnittliche Alkohol-und Tablettendosis betrug 7 Flaschen Bier a 0,5 Liter, 1 – 2 Miniflaschen Schnaps (a 0,04 l) plus eine Schlaftablette, meist eine HALBMOND.)
Meine Eltern merkten hiervon nichts und so stellte mir mein Vater ab Mitte '87 seinen Wagen zur Verfügung. Mittlerweile hatte ich einige Skrupel verloren, ich hatte keine Bedenken mehr auch noch zu fahren, wenn ich (zwei oder drei Flaschen Bier) getrunken hatte.
Im November 1987 passierte es dann. Auf dem Hof von Bekannten, bei denen ich zu Besuch war, setzte ich - unter Alkohol und Tabletten stehend - nachts den Wagen meines Vaters in Brand. Glücklicherweise geschah niemand etwas, lediglich der Wagen brannte völlig aus.
Im Dezember '87 ging ich dann zum ersten Mal bewusst in eine Entgiftung nach Herten. Anschließend ging ich regelmäßig zur Suchtberatung, zu einem Psychologen von Herten und zu einer Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes.
Anfang '88 brauchte ich noch einen Rückfall mit einer Dose LEXOTANIL (also 50 Stück) um zu begreifen, das ich über meine Tranquilizereinnahme ebenso wenig Kontrolle habe wie über meinen Alkoholkonsum. Was nur Jahre vorher einmal vorgekommen war, passierte in dieser Zeit noch einmal: Jemand drängte mir ein kleines Päckchen Heroin auf, welches ich auch benutzte. Als die Wirkung nachließ war mir allerdings sehr elend.
Anschließend an diese Vorfälle ging es allerdings dann doch bergauf. Ich legte mir einen Computer zu und lernte eine einfache Programmiersprache. Auch schrieb und veröffentlichte ich zunehmend Gedichte. Weiter wurde ich politisch aktiv bei den GRÜNEN, in der Redaktion der Parteizeitung. Dort lernte ich Birgit W. kennen. Es entstand bald eine Beziehung. Diese wurde ihrerseits allerdings so definiert, das sie keinerlei Verpflichtung mir gegenüber habe.
Leichtsinnigerweise erklärte ich mich damit einverstanden.
Als sie sich ihre Freiheit in sexueller Hinsicht nahm, und ich dies mitbekam, glaubte ich diesen gefühlsmäßigen Schmerz nicht ertragen zu können und baute einen Rückfall mit Alkohol. Dies war am 11 September 1988.
Seit der anschließenden Entgiftung bemühte ich mich um eine Langzeittherapie. Nun bin ich hier. ..."
Ja, damit war er zufrieden. Sprachlich war es nicht perfekt.
Aber er hatte es so umfassend und so genau wie möglich gemacht.
Und ehrlich.
Die erste Station würde das Vorlesen in der eigenen Therapiegruppe sein, in der Kleingruppe.
Natürlich war er nervös. Aber er wollte diese Therapie, er wollte vorwärtskommen. Da er recht gern schrieb und sich ja auch mit pädagogischen und psychologischen Abläufen ein wenig auskannte, sah er auch die positiven Effekte, die allein schon das Nachdenken und Niederschreiben bewirkten. Eine Klärung und Konkretisierung der Gedanken.
Und vielleicht noch viel wichtiger, seiner Gefühle.
Das Verlesen und die erfolgten Rückmeldungen der Gruppe waren dann durchaus anstrengend und aufwühlend.
Aber er überstand es und bekam neuen Stoff zum Nachdenken, zum nachfühlen.
Rückmeldungen
Die RÜCKMELDUNGEN DER KLEINGRUPPE
"Ich hatte Probleme deinen Lebensbericht nachzuvollziehen."
"Ich bin erschlagen von der Fülle deines Lebensberichtes."
"Mir ist aufgefallen, dass dir die Beziehung zu deiner Partnerin noch sehr nahe geht."
"Ich fand den Lebensbericht sehr typisch für dich, haargenau und bis ins kleinste Detail."
"Ich hatte das Gefühl, dass du es allen recht machen wolltest, so wie du es als Kind schon getan hast."
"Ich empfand deinen Lebensbericht sehr sachlich, nur zum Schluss kam Gefühl auf."
"Ich hatte das Gefühl, du wolltest dich mit deinem Lebensbericht hervorheben."
"Ich fühle mich wie erschlagen, ich kann im Moment nichts dazu sagen."
"Dein Lebensbericht spiegelt dich wider und passt zu dir, du bringst ihn nicht 100 %, sondern 150 %."
"Du selbst bist für mich in Deinem Lebensbericht nicht greifbar."
"Es macht mich betroffen, ja ich bin erschrocken, was für ein Chaos Sie hinter sich haben."
"Mir ist schwergefallen, Ihnen zu folgen, weil ich nicht weiß, wo Sie waren."
"Sie haben sich geschmückt mit Sachen, was Sie alles genommen haben."
"Ich kenne zwar Ihren Lebensbericht, aber nicht Sie selbst."
"Ihr Lebensbericht hatte für Sie einen gewissen Stellenwert in ihrem Leben."
"Du bist nicht greifbar in deinem Leben."
"Mir ist aufgefallen, dass du dich nie festlegst."
"Der letzte Teil deiner Geschichte ist dir sehr nahe gegangen."
"Ich hatte das Gefühl, du hast ein Buch über dich geschrieben."
"Ich find`s gut, dass Sie ihren Lebensbericht in diesem zeitlichen Rahmen geschafft haben."
Die Patienten-Patin, die ihm für die ersten Wochen zugeteilt war, hatte auftragsgemäß alles mitgeschrieben und händigte ihm die Mitschrift am nächsten Tage aus. Es war nun noch seine Aufgabe, drei ihm besonders interessant oder wichtig erscheinende Statements zu kennzeichnen.
Er wählte:
"Ich hatte das Gefühl, dass du es allen recht machen wolltest, so wie du es als Kind schon getan hast."
"Es macht mich betroffen, ja ich bin erschrocken, was für ein Chaos Sie hinter sich haben."
"Du bist nicht greifbar in Deinem Leben."
Ein wenig Zeit hatte er, über alles nachzudenken. Doch nicht sehr lange. Schon wenige Tage später stand der Vortrag in der Großgruppe, im Plenum an. In diesem waren längst nicht alle, aber mehrere Therapiegruppen der Fachklinik zusammen gefasst. Etwa 40 Patientinnen und Patienten, dazu die jeweiligen Gruppentherapeuten. Ansonsten waren die Abläufe sehr ähnlich, nahezu identisch.
Und auch diesmal erhielt er am Folgetag die Rückmeldungen schriftlich.
RÜCKMELDUNGEN AUS DEM PLENUM
"Du hast ganz schön Mut und Courage gehabt."
"Es klingt, als ob du dir durch verschiedene Drogenarten Zugang zu Menschen verschaffen wolltest."
"Ich denke, du hast versucht durch Übertreibung Selbständigkeit zu zeigen."
"Mir kommt das vor, als ob du irgendjemand bestrafen wolltest."
"Ich hatte Probleme, wie in der Kleingruppe, dir zu folgen, weil es unwahrscheinlich viel war."
"Ich finde, dass du bei den ganzen Suchtmitteln auf der Strecke geblieben bist."
"Ich glaube, du hast Suchtmittel als Integrationsmittel eingesetzt, um Integration zu ermöglichen."
"Ich denke auch, dass dir gar nicht klar war, was diese Gruppe von dir verlangte, als du das getan hast, was die anderen taten."
"Ich habe das Gefühl, dass du Anerkennung und Zuneigung gesucht hast und dein mangelndes Selbstbewusstsein stärken wolltest."
"Ich glaube, du hast unter dem Verhalten deiner Mutter sehr gelitten."
"Ich glaube auch, dass du Angst hattest nicht anerkannt zu werden."
"Dein Leben war eine Flucht aus der Realität."
"Deine Eltern haben trotz allem zu dir gehalten."
"Deine Eltern wollten etwas besseres aus dir machen."
"Deine Eltern haben dich in eine Rolle gezwängt, in die du nicht wolltest."
"Ich habe das Gefühl, dass du dich selbst als Versuchskaninchen gesehen hast."
"Dein Lebensbericht vermittelt mir den Eindruck großer Hilflosigkeit."
"Deine Wünsche und Sehnsüchte stehen in krassemWiderspruch zur Wirklichkeit."
"Du bist ohne Elternliebe groß geworden."
"Du fühltest dich nur in einer Gruppe wohl, allein hättest du versagt."
"Ich bin der Meinung, dass du dich hast ausnutzen lassen."
"Mir kommt es vor, als ob du anderen helfen wolltest und dabei selbst hineingeschlittert bist."
"Du vermisst den Kontakt zu deiner Familie."
"Ich glaube, deine Eltern waren schon zu alt, um dir zeigen zu können, wo es langgeht."
"Dir fehlt ein Ziel im Leben."
"Du hast kein richtiges Familienleben gehabt, deshalb die Suche nach anderen Menschen."
"Mir kommt das alles vor, wie ein schlechter Videoclip aus dem Drugstore."
* * *
Uff. Ein öffentlicher "Vortrag" ohne, nun, gewisse Hilfsmittel. Erst vor der kleineren, dann vor einer deutlich größeren Gruppe. Und nicht über irgendwelche Sachthemen, sondern über sich selbst als Mensch. Das hätte er sich früher sicherlich nicht zugetraut! Aber nun war er in gewissem Sinne stolz darauf, das ausgehalten und auch in ordentlicher Form quasi abgeleistet zu haben. Bei der Kennzeichnung der drei ihm besonders interessant oder wichtig erscheinende Statements wählte er diesmal:
"Mir kommt das vor, als ob du irgendjemand bestrafen wolltest."
"Ich glaube, du hast unter dem Verhalten Deiner Mutter sehr gelitten."
"Du bist ohne Elternliebe groß geworden."
Das waren Hinweise, Sätze, die schon längst einmal ausgesprochen werden mussten und Konkretisierungen, die ihn halb bewusst schon länger innerlich umgetrieben hatten.
Lyrik aus der Therapie
Im Laufe der nächsten Wochen gab es interessante Dinge und Begegnungen. Wechselbäder der Gefühle, Belastungen und Erkenntnisse.
Aber er begann auch wieder zu schreiben, Prosa-Gedichte zunächst. Es entstand ein kleiner Zyklus, den er später "E.U.-G.A.M.E" nennen würde. Eu - das war eine positive Vorsilbe aus dem griechischen, wie in Eu-Stress oder Eurythmie. Und Game - das war das Spiel, war das Leben.
Er war am Zug ...
E.U.-G.A.M.E. Lyrik aus der Therapie
ErwärmungUmbruch
GehenAlternativeMovementErweiterung
Alle Texte entstanden während der stationären Therapie.
ERWÄRMUNG
Abgewandt bis zur Neige abgeneigt Neigungswinkel abgrundtief Tod.
Zugewandt voll Zuneigung Neigungswinkel sonnenwärts Leben!
* * *
UMBRUCH
Solange wollte ich nicht hören auf die Stimme des Lebens, auf das verschüttete Raunen in mir nun muß ich fühlen Trauer, Scham und Schmerz für das Getane und das Unterlassene an mir. Doch das ich fühlen KANN, nun endlich, ist der Lohn da werden meine Sinne weit ich spüre Leben, spüre Liebe!
* * *
GEHEN
Im feuchten Tau des neuen, jungen Morgens bekomme ich kalte Füße - manchmal wenn ich, barfuß zu weit gehe auf frischen Wiesen doch solange Gras ist unter meinen Füßen solange ich spüren kann, gehe ich voran in der Wärme der aufgehenden Sonne.
* * *
ALTERNATIVE
Breche Dein Schweigen, ENDLICH -sonst wirst Du selbst zerbrechen vergiftet von geschlucktem Ärger, Wut und Zorn.
Ertrunken in einem Meer ungeweinter Tränen. Erstickt an Trauer und Schmerz. Verarmt an un-geteilter Freude ohne Lachen ohne Liebe, wirst Du sonst sterben, einsam. SPRICH!
* * *
MOVEMENT
Als Kugel geschleudert in den Strom der Zeit deformiert zum Querschläger halte ich inne versinke nicht - akzeptierend meine Form - wachse ich durch Vergangenheit hindurch in Zukünfte und in Höhen, Tiefen Breite und Vielfalt der Gegenwart
* * *
ERWEITERUNG
Ich bekenne mich zur Unmäßigkeit zur Grenzenlosigkeit noch immer will ich steigen in ungeahnte Höhen, bodenlose Tiefen und will eingehen ins Unendliche ozeanisch voller Wildheit mit brennendem Herzen.
Doch mehr noch will ich nun will nicht mehr wahllos sein will Richtungen bestimmen, daß die Trümmer eingerissener Grenzen mich nicht mehr erschlagen will atemholen und immer höher steigen, ohne zu erfrieren in zu dünner Luft will mich versinken lassen nicht stürzen im Abgründigen will mich lösen in zeitlosen Augenblicken auffindbar.
Denn um so echter um so öfter bin ich.
* * *
Erkenntnisse und Erlebnisse
Etwas prosaischer formuliert waren andere Notizen, die er sich zu förderlichen und eher hinderlichen Faktoren während der Therapie machte. Objektiv waren diese vielleicht nicht in jedem Falle, aber sie entsprachen seinem persönlichen Erleben in dieser Situation.
DIE NOTIZEN "Beispiele für hilfreiche und sinnvolle Aspekte:
Die Entfernung vom bisherigen Wohnort, bzw. vom vorher üblichen Lebensmittelpunkt.
Das Erlebnis, sich mit hunderten von anderen Patienten in einer Klinik aufzuhalten, die in jeder Hinsicht unterschiedlich waren (Alter, Geschlecht, Beruf, usw., usf.) – jedoch alle dasselbe Problem hatten.
Die informellen Gespräche mit mehreren dieser Mitpatienten.
Die medizinische Betreuung.
Der mehr oder weniger sanfte Druck, sich sportlich und kreativ zu betätigen.
Das schriftliche Informationsangebot über Suchtkrankheiten (obwohl dies noch ausbaufähiger wäre).
Die Begegnung mit selbst betroffenen, jetzt trockenen, Therapeuten und Ärzten die dort arbeiteten. Auch hier gibt es natürlich unterschiedlich sympathische Persönlichkeiten, jedoch war bei allen diesen Menschen eine große Ernsthaftigkeit, Menschlichkeit, in jedem Falle aber Glaubwürdigkeit vorhanden. Insbesondere Doktor Kleinert – eigentlich "nur" für medizinische Dinge zuständig – beeindruckt hier außerordentlich und dies durchaus auch im Vergleich mit einigen "richtigen" Therapeuten!
Das Vorhandensein einer strengen Hausordnung mit teils vollkommen unsinnigen Regeln. Es mag paradox klingen, dies in der Rubrik "Positiv" zu verbuchen. Tatsächlich führt diese Hausordnung aktuell manchmal zu diversen verbalen "Reibereien". Doch lässt sich, insbesondere durch die vollständig sinnlosen Regeln, sehr gut erlernen, auch einmal etwas Unangenehmes und nicht sofort Veränderbares zu ertragen. Was natürlich nicht immer einfach ist. Der Satz eines Therapeuten: "Sie sind nicht hier, damit es Ihnen gut geht, sondern damit es Ihnen hinterher gut geht!" illustriert das recht gut.
Im Sinne der Therapie eher hinderlich:
Die Gesprächsführung des Klinikleiters Doktor Tornando, welcher seine enormen rednerischen und argumentativen Fähigkeiten oftmals völlig unnachsichtig und ohne jegliche Beschönigung gegen Patienten einsetzte.
Die ewig lächelnde oder lachende Art und Welse des Gruppentherapeuten Herrn Reese, welche nicht immer wirklich "echt" wirkte. Das schafft nicht wirklich echtes Vertrauen ...
Der in Patientenkreisen unter der Bezeichnung "Federnburg-Koller" bekannte Zustand, welcher sich darin äußerte, dass man sich zeitweise ständig beobachtet fühlte (im Zweibettzimmer durch den Zimmergenossen, in der Klinik durch das Personal, im Wald und in der Ortschaft -mindestens-durch Mitpatienten).
Der unter Patienten als "Denunziationsparagraf" bekannten Punkt der Hausordnung. Dieser schreibt zwingend vor, bei Übertretungen beobachtete Patienten dem Personal zu melden, wollte man nicht selbst eine Strafe riskieren.
Natürlich stand von Seiten der Klinik ein "edles" Motiv hinter dieser Vorschrift: "Co – abhängiges Verhalten" sollte damit verhindert werden. Doch heiligt der Zweck hier wirklich die Mittel?“
Einige dieser Punkte beurteilte er später etwas milder, so etwa die Art und Weise des Professor Tornando. Auch im wahren Leben begegnete man ja unterschiedlichen Menschentypen – und musste mit ihnen klarkommen. Wären aber überwiegend oder nur Therapeuten dieser „Machart“ vertreten gewesen: hätte er das wohl auf Dauer nicht durchgehalten! Ein angenehmer, positiver Kontrapunkt war hier Dr. med. Kleinert, mit dem er mehrfach sprach. Das war auch ohne Weiteres möglich. Die Patienten hatten zwar allerlei Pflichten und etliche Regeln zu befolgen – aber sie hatten auch einige interessante Rechte!
Dazu gehörte, ausnahmslos alle in der Klinik arbeitenden Menschen um einen zeitnahen Gesprächstermin bitten zu können.
Und dieser Bitte mussten sie auch nachkommen. Das ging tatsächlich von der einfachen Pflegekraft bis hin zur Klinikleitung.
Auch auf den sogenannten Gelassenheitsspruch, den er schon von der Selbsthilfegruppe her kannte, traf er in der Klinik wieder.
„Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die sich ändern lassen und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden. (R. Niebuhr, frei nach Epiktet)“ Das einzige, was ihn an dieser Lebensweisheit störte, war die eher passiv wirkende Grundhaltung ("Gott gebe mir….").
Hatte er früher die Verantwortung für sich und sein Handeln an die Suchtmittel „abgegeben“, sollte es nun „Gott“ sein, der „alles für ihn richtet"?
Er ersetzte später die erste Zeile "Gott gebe mir...", für sich selbst durch die Formulierung "ich will mir erarbeiten / erleben ...".
Er mochte solche Merksätze. Zeilen die einen in kurzer, prägnanter Form an das erinnerten, was wichtig war.
Schon in seinen ersten Tagen in der Fachklinik hatte ihn ein Aushang im Aufenthaltsraum beeindruckt, der "Gefühlsspruch".
"Emotions-Spruch Wir wollen unsere Gefühle nicht mehr leugnen und verdrängen, denn sie existieren in uns.
Wir wollen uns aber auch nicht mehr besinnungslos von ihnen überrollen und fortreißen lassen, weil auch dies uns schaden kann.“
In den folgenden Wochen ergab sich fast so etwas wie eine Routine im positiven Sinne. Die Tagesabläufe waren strukturiert, vielfältig und abwechslungsreich. Das hieß nicht unbedingt unanstrengend. Mal im körperlichen Sinne, beim Frühsport und längeren (verpflichtenden) Waldspaziergängen, mal psychologisch bei den moderierten Gruppengesprächen und für manche waren wohl auch die Aufgaben im Bereich Kreativität und Werken eine Herausforderung. Als Städter und Kind des Ruhrgebiets wusste er die Waldspaziergänge durchaus zu schätzen. Da gab es in Recklinghausen und Umgebung nicht so viele Möglichkeiten. Wobei das eigentliche Problem natürlich ein anderes war. Um die Natur zu genießen, sich zu bewegen, in frischer Luft durchzuatmen: dazu musste man motiviert sein. Musste sich aufraffen, den ersten Schritt tun. Alkohol, Valium und Co. und immer mal wieder auch ein Joint – waren derlei natürlich nicht wirklich zuträglich, ganz im Gegenteil!
Auch die Kreativangebote waren durchaus sein Fall. In Abwandelung zweier anderer Techniken stellte er einen Anhänger für sich her, eine Friedensrune an einer Kette.
Diese sollte ihn in Zukunft begleiten. Als Symbol dafür, dass er auf dem Weg war mit sich selbst Frieden zu schließen. Und vielleicht auch mit einigen anderen Dingen in seiner Umwelt.
Britta
Die Spaziergänge im Wald wurden oft gruppenübergreifend durchgeführt. Das bedeutete, dass zwei oder sogar drei Kleingruppen gemeinsam auf Wanderschaft gingen. So ließen sich weitere Bekanntschaften schließen. Diese konnten ganz unterschiedlicher Natur und Intensität sein.
Und so lernte er Britta Meier, geborene Knab kennen ...
Ihre Geschichte war eine ganz andere als seine. Hatte sie allerdings im Ergebnis an denselben Ort geführt, an dem auch er sich nun aktuell befand. Zudem war sie gut sechs Jahre älter als er, obwohl man ihr das nicht unbedingt ansah. Und sie kam aus geordneteren Verhältnissen. Mit Ausnahme der letzten Monate allerdings.
Britta stammte aus einem Dorf an der Bergstraße, einer Mittelgebirgsregion in Südwestdeutschland. Auch zum Odenwald, zum Rhein und selbst zum bekannten Pfälzer Wald war es von dort aus nicht weit. Sie war ausgebildete Arzthelferin und hatte in jungen Jahren auch eine ganze Zeit lang als solche gearbeitet. Doch schon relativ früh hatte sie ihren späteren Ehemann kennengelernt, der in der Baubranche beschäftigt war. Recht schnell heiratete man und sie unterstütze und motivierte Erich Meier auch engagiert in dem Ehrgeiz sich in seinem Beruf höher zu qualifizieren. Ihren eigenen gab sie auf seinen Wunsch hin aber recht schnell auf. Er wünschte sich dringend einen männlichen Nachkommen, um den Familiennamen zu erhalten. Der sich dann auch ziemlich schnell tatsächlich einstellte.
Thomas schmunzelte innerlich ein wenig, als er diese Formulierung zum ersten Mal hörte. „Klar, der Name Meier durfte natürlich nicht aussterben!“, dachte er bei sich, äußerte das aber lieber nicht laut.
Die ersten Jahre und auch danach noch mehr als ein Jahrzehnt lang verlief das Leben der Familie Meier planmäßig. Der Ehrgeiz von Erich trug Früchte, er war erfolgreich, ein höheres Einkommen und ein wirklich stattlicher Hausbesitz stellten sich ein. Zumindest Erichs Eltern waren finanziell ohnehin nicht eben schlecht gestellt und so konnte man es sich unter anderem leisten, hinsichtlich des Mobiliars quasi ein wenig Antiquitäten zu sammeln. Sohn Lars war gesund und intelligent, auch wenn er sich in der Oberschule ein wenig als „Saisonarbeiter“ herausstellte. Und so schien alles in bester Ordnung.
Britta war eine ordentliche und pflichtbewusste Hausfrau und Mutter. Bei Partys und ähnlichen Zusammenkünften hielt sie sich mit Alkohol deutlich zurück. Mehr als Andere sogar, der Genuss des regional vielfach angebauten Pfälzer Weines war sehr beliebt und verbreitet. Allerdings hatte sie seit ein paar Jahren eine Art kleines Geheimnis, eine „diskrete Angewohnheit“.
Tagsüber benötigte sie ihren Verstand und ihre komplette Konzentration, um den alltäglichen Pflichten unterschiedlicher Art möglichst gut und korrekt nachkommen zu können. Das konnte sie und das wollte sie.
Aber jeder Tag hatte ein Ende, es gab fast immer einen Zeitpunkt, an dem alles getan war. Natürlich achtete sie auf eine angemessene Schlafdauer. Auch das gehörte zu einem verantwortungsvollen Leben dazu. Aber eine Art zeitliche Lücke gab es da dazwischen. Und man konnte auch so planen und agieren, dass diese möglichst oft gewahrt blieb.
Diesen zeitlichen Freiraum nutzte sie zunehmend häufig, um eine Literflasche des besagten guten Pfälzer Weines zu konsumieren. Schließlich täglich. Und zunehmend lebte sie in gewisser Weise in den Stunden zuvor auch schon darauf hin, auf diese Abendstunden.
Britta war etwa so groß und so schwer wie Thomas. Ein Meter siebzig und Durchschnittsgewicht also. Und sie war weiblich. Soviel wusste er: das war durchaus schädlich. Es hatte nichts mit Sexismus oder Diskriminierung zu tun – der weibliche Körper war schlicht anfälliger für Schäden durch Alkohol. Bei dauerhaftem Genuss in dieser Menge allemal!
Und soviel wusste er aus seiner Ausbildung und seinem Interesse an der Psychologie: dauerhaft auf eine Art „Erlösungspunkt“ am Abend hinzuleben, das zeugte nicht eben von einem wirklich wahrhaft zufriedenem und erfüllten Leben.
Brittas Ritual fiel nicht auf. Wer es mitbekam, maß dem keine sonderliche Bedeutung bei. In der Pfalz gab es ganz andere Eskapaden in dieser Hinsicht, die „noch durchgingen“. Selbst die Ärzte in der Gegend sprachen von Leberwerten und von „Pfälzer Leberwerten“ … So einige Jahre gingen ins Land. Ernstere körperliche Beschwerden hatten sich noch nicht wahrnehmbar eingestellt.
Kopfschmerzen am Morgen ließen sich durch ein oder zwei Aspirin vertreiben, leichte Unsicherheiten und Nervosität waren noch beherrschbar, oder notfalls – und natürlich nur im Einzelfall – auch mal mit einer Beruhigungstablette zu beheben.
Doch es kam der Tag, an dem auch Britta Meier am Ende war. Der Tag, an dem das Familiensystem schier zu zerbröseln begann und an dem jemand begann, sein wahres Gesicht zu zeigen.
Erich Meier war erfolgreich gewesen, hatte gutes Geld verdient als Selbstständiger. Ein hochwertiges Gefährt stand im soliden Carport vor dem eigenen und mit Besonderheiten aufgewertetem Haus. Und das Mobiliar bestand in nicht geringem Maße aus funktionellen Antiquitäten. Auch der Sohn war nun bereits vierzehn Jahre alt und machte sich, wenn es darauf ankam, in der Schule gut. Viel besser konnte es nicht sein.
War es der unbewusste Zweifel, ob Ansehen und Besitz wirklich alles waren im Leben? Oder die verbreitete Midlifecrisis? Im richtigen Alter dafür war er ja. Jedenfalls ließ er sich die Haare zumindest ein paar Zentimeter länger wachsen und begann ein Verhältnis mit der besten Freundin seiner Ehefrau.
Das war nicht immer leicht zu verbergen. Aber wirklich schwer war es auch nicht. Britta war nicht dumm aber arglos. Dies in ihrem Bewusstsein stets Ihre Pflichten korrekt und ordentlich zu erfüllen. Im Haushalt, die gesellschaftlichen, die ehelichen. Die Affäre hatte Bestand und gefiel Erich zunehmend. Häusliche Spannungen stellten sich ein und Britta schien nun doch etwas zu ahnen. Die seelischen Belastungen und die morgendlichen Kopfschmerzen beunruhigten sie und es wurde beschlossen, dass sie für sechs Wochen in eine Erholungskur gehen würde. Welche Hintergedanken ihr Gatte dabei hatte, wurde Britta leider allzu schnell klargemacht. Sie war kaum zwei Wochen in der Kureinrichtung als sie die Nachricht erreichte.
Ihr Ehemann teilte ihr mit, dass er in der Tat eine Affäre mit ihrer Freundin habe, dass er sich trennen wolle und dass ihre Anwesenheit nicht mehr erwünscht sei. Sie habe ja nun noch einige Wochen Zeit, sich Alternativen zu überlegen.
Solle sie es vorziehen, doch ins Haus zurückkommen zu wollen, könne sie sich die Folgen sicherlich denken. Sein Arbeitsplatz als Selbstständiger befände sich ja auch dort. Er würde dann sofort ausziehen und sicher nicht so schnell etwas wirklich geeignetes neues finden. Von daher könne er dann natürlich keinerlei Unterhalt zahlen. Wozu er ansonsten für eine angemessene Zeit bereit sei.
Das war ein eiskalter und in der Form dann doch völlig unerwarteter Schlag ins Gesicht für Britta Meier! Sie war erschüttert, geschockt, fühlte sich desorientiert und hilflos. Ihr Weißweinkonsum stiegt sehr deutlich an, wurde in der Kurklinik auffällig, sie selbst wurde auffällig.
Es folgten einige Gespräche und Beratungen mit den Ärzten und Therapeuten dort. Man wollte ihr helfen, wusste aber nicht recht wie. Sie war etliche Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Eigene Freunde, außerhalb des Freundeskreises ihres Mannes hatte sie nicht. Ihre nun von ihm erwählte beste Freundin war da die Ausnahme gewesen. Das hatte sie zumindest einmal geglaubt. Und ihre Eltern waren beide früh verstorben. Bei den vertraulichen Gesprächen in der Klinik war auch ihr schon vorher regelmäßiger abendlicher Alkoholkonsum zur Sprache gekommen. Wie sich dieser in Krisensituationen entwickeln konnte – hatten in den letzten Tage alle erleben müssen.
Was ihr natürlich zusätzlich peinlich war.