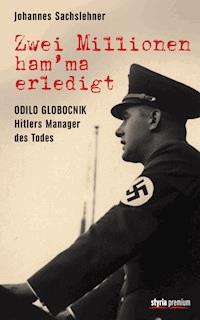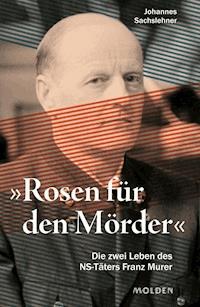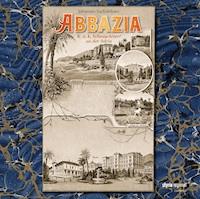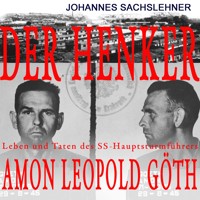Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Styria Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Toni, Fifi, Minni, Jenny, Dilly, Mizi I und Mizi II, Poldi – schon im zärtlichen Diminutiv liegt eine ganze Welt“: Leichtlebigkeit und Lebenslust schwingen mit, aber auch Respektlosigkeit und das beruhigende Wissen, dass der Trennungsschmerz sich in Grenzen halten wird. Arthur Schnitzler schätzt die Mädchen aus der Vorstadt und kann nicht genug von den „Wiener Weiberln“ bekommen. „Alle, alle will ich“, vermerkt er am 19. März 1896 in seinem Tagebuch. Es sind naiv-erotische Spiel- und Lustobjekte, austauschbar, wenn die Beziehung zu langweilig wird, gleichzeitig aber eifersüchtig gehütet. Der Schriftsteller tobt über ihre Untreue, ergeht sich in wilden Beschimpfungen – die Vorwürfe reichen von „Vorstadtflitscherl“ und „Komödiantenhure“ bis zur „verdorbensten Kreatur der Welt“ – und sogar sadistischen Anwandlungen. Johannes Sachslehner rückt in seiner detaillierten biografischen Studie das Schicksal dieser Frauen in den Mittelpunkt und zeigt, dass sich hinter der sanften literarischen Verklärung in Schnitzlers berühmten Texten eine oftmals erschreckende Realität offenbart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle,
alle will ich
Arthur Schnitzler um 1905. Foto von Hertwig Aura.
JOHANNES SACHSLEHNER
Alle, alle will ich
ARTHUR SCHNITZLER
UND SEINE SÜSSEN WIENER MÄDEL
„Wohl die Liebe selbst“: Marie „Mizi“ Chlum, mit Künstlernamen Marie Glümer, als junges Mädchen.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
DAS LIEBSTE WÄRE MIR EIN HAREM
Der Sex-Statistiker
Und die Weiber!
Das Theater um die Jungfräulichkeit
AUS DEM REIGEN EROTISCHER ABENTEUER
Venus
Marie Joppich
Gusti
Irma H.
Else von Kolschitzky
Anna Thoman
Antonie Faust
Gisela Freistadt
Charlotte Heit
Helene Kanitz
Lina
Jeanette Heeger
Adele Spitzer
Marie Rosner
Marie Glümer
Mizi Zach
Josefine Lydia Weißwasser
Camilla Theren
Eugenie B.
Marie Reinhard
Risa Strisower
Magda
Ida Falk
Hebe
Minna Hamon
Rosa Freudenthal
Irma Hoffmeister
Marie Elsinger
Leopoldine Müller
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Impressum
DAS LIEBSTE WÄRE MIR EIN HAREM
„Mein Blut tanzt Cancan.“
Tagebuch, 13. Mai 1880
„Es ist wahr, ich hab ein lebhaftes Bedürfnis, jedes Mädel, in unserem gesellschaftl. moralischen Sinn tief zu verderben“
Tagebuch, 15. März 1896
Die jungen Frauen, die in die Ordination des Herrn Dr.Arthur Schnitzler kommen, sind fasziniert: Der junge, rötlichblonde HNO-Arzt mit dem etwas verträumten Blick ist charmant und liebenswürdig, er kann zuhören und beeindruckt durch tadellose Umgangsformen und elegante Kleidung – da passt jedes Detail, bis hin zu den gepflegten Händen. Ein Mann zum Verlieben, noch dazu ledig, wie man weiß, aus angesehener, wohlhabender jüdischer Familie, sein Vater Johann eine anerkannte medizinische Autorität und erfolgreicher Universitätsprofessor, er selbst, so hört man, schreibt und das mit viel Talent, sein Durchbruch zum anerkannten Autor kann wohl nur mehr eine Frage der Zeit sein.
Eine ausgezeichnete Partie also. Zwar wird in der Wiener Gesellschaft einiges über seine Frauengeschichten gemunkelt, man hört, dass er sich mit etwas leichtfertigen Mädchen aus der Vorstadt, ja, der Demimonde abgibt, doch was soll’s: Der Reiz, es doch zu wagen, ist groß und der Dr.Schnitzler beherrscht die Rituale der Verführung wie kein anderer: Es beginnt mit einem harmlosen Kuss, meist noch in der Ordination, und setzt sich fort mit gemeinsamen Spaziergängen und Ausflügen oder einem Theaterbesuch, es folgt eine Einladung zum exquisiten Souper mit Champagner im Chambre separée des Riedhofs und endet mit glühenden Zärtlichkeiten in einem Hotelzimmer. Er ist ein Mann, der ungeheuer einfühlsam sein kann, der zusammen mit seinen Partnerinnen lacht und weint und sie nicht selten mit der Intensität seiner Tränen verblüfft – Schnitzler ist ein heftiger „Weiner“ und zugleich ein hervorragender „Küsser“, ein Mann mit „süßem Mund“, nach dessen Küssen, glaubt man den zahlreich erhaltenen Briefen an ihn, die „Mädel“ regelrecht süchtig werden. Er ist zärtlich und rücksichtsvoll und vor allem absolut diskret, ein ungemein kultivierter Genießer, der seine Eroberungen nicht an die große Glocke hängt. Wer könnte da widerstehen?
Die jungen Frauen ahnen noch nicht, dass sich hinter der Fassade des nach außen hin so perfekten Liebhabers ein komplizierter Charakter verbirgt: ein Spieler und Hasardeur, der sein seelisches Gleichgewicht nur über immer wieder neue sexuelle Abenteuer findet. Der sich die Zeit mit Pferdewetten, Billard, Domino und langen Pokerabenden vertreibt und im „Spiel mit der Liebe“ (Alfred Doppler) das Spiel seines Lebens schlechthin gefunden hat. Schnitzler braucht den Sex, die „Sinnlichkeit“, wie er es nennt, um sich nicht in schweren Depressionen und Angstattacken zu verlieren, die er in seinen Tagebucheintragungen „Hypochondrien“ nennt. Um sich in diesem Leben zu spüren und die „tödtlichen Angstzustände immer und immer“ (TB, 19. März 1896) zu besiegen, ist er stets auf der Suche nach neuen Frauen. Er weiß nur allzu gut um diese Bedeutung der Sexualität für die innere Ökonomie seiner Person: „Meine impertinente Sinnlichkeit. Wenn ich eine Reihe von Tagen keusch war, 6–9 sind so das Maximum, so bin ich einfach ein Thier.“ (TB, 10. August 1890) Treue im klassischen Sinn – der Verzicht auf andere sexuelle Kontakte zugunsten der einen Auserwählten – ist daher für ihn kein Kriterium, auch wenn er manchmal selbst über die „Unsauberkeit“ seiner „inneren Verhältnisse“ und seinen „Leichtsinn ohne Kraft“ klagt – er will sich um jeden Preis die Freiheit bewahren, keine der Frauen „abweisen“ zu müssen, die bei ihm ihr Glück suchen wollen, ja, „das Bewußtsein sie haben zu können genügt oft“. Die Konsequenz: Auch „die andern alle, alle will ich …“ (TB, 19. März 1896), am liebsten wäre ihm gleich der Status Polygamie, wie er während seines Aufenthalts in Paris im Mai 1897 im Diarium vermerkt: „Sag ich mir die Wahrheit: das liebste wär mir ein Harem; und ich möchte weiter gar nicht gestört sein. Es ist zu bezweifeln, dass ich zur Ehe geboren“ (TB, 6. Mai 1897); einen Tag später wird er noch deutlicher: „(…) der Gedanke an Ehe erfüllt mich mit Grausen“. (TB, 7. Mai 1897) – Äußerungen, die charakteristisch für Schnitzler sind; um sie besser verstehen zu können, sei noch auf den Kontext dieser Einträge verwiesen: Auf der Flucht vor einem Skandal in Wien ist Schnitzler gezwungen, etwa zwei Monate mit seiner schwangeren Freundin Marie Reinhard in einer Wohnung in der Rue Maubeuge 5 zu leben. Die „Kleinheit der Zimmer“ und auch seine „sanfte“ Mizi gehen ihm manchmal auf die Nerven, wie er sich im Tagebuch des Öfteren eingesteht: „Heut war mir Mz. eher langweilig und ich empfand es nicht angenehm an sie gebunden zu sein. Merkwürdig wechselt das. –“ (TB, 19. Mai 1897)
Ja, Schnitzler scheut „fixe“ Bindungen, denn er hat Angst, dass sie seine große „Kraftquelle“, eine vielfältig ausgelebte Sexualität, beschneiden und ersticken könnten. Notorische Untreue ist dem Lebenskonzept Schnitzlers immanent, in immer wieder neuen erotischen Abenteuern offenbart sich ihm, wie er meint, die Wahrhaftigkeit des Lebens. Die Regeln in diesem Spiel gibt er vor: Es sind die Regeln des gesellschaftlich überlegenen Mannes, des Bonvivants und Ästheten, denen sich seine Geliebten unterwerfen müssen. Es ist ein Spiel, das er mit der zynischen Sicherheit eines wahren erotischen Virtuosen beherrscht, das ihn in unglaubliche Situationen manövriert, aus denen er sich doch immer wieder befreien kann. Wollte man diesen Befund kritischer und aus Sicht der Frauen formulieren, so müsste man einfach sagen: Schnitzler betrügt und belügt sie und verlässt sie am Ende doch.
DER SEX-STATISTIKER
Schnitzler ist praktischer Polygamist und durchaus stolz darauf, ein Berserker der Liebe, der seine „Leistungen“ peinlich genau dokumentiert: Er vertraut sich seinem einzigen treuen Lebensbegleiter, dem Tagebuch, an und agiert darin als penibler Statistiker seiner sexuellen Potenz. Der Liebesakt ist für ihn etwas Besonderes, etwas, das in Erinnerung bleiben soll, etwas, das nicht dem Vergessen anheimfallen darf. Offenbar um sich immer wieder seiner sexuellen Lebendigkeit zu vergewissern, verzeichnet der junge Schnitzler im Diarium seine erotischen Siege mit buchhalterischer Akkuratesse – so sind wohl die immer wieder im Zusammenspiel mit den Namen der „Mädel“ auftauchenden Ziffern zu interpretieren, eine Gewohnheit, die er bis zum „Verrat“ und „schauerlichen Verlust“ von Marie Glümer 1893 beibehält. Die Zahlen, die er Tag für Tag und Monat für Monat notiert, sind beeindruckend: Bereits knapp vor Mizis verhängnisvoller Abreise ins Engagement nach Wiesbaden kann Schnitzler „400“ Liebesakte mit ihr, verteilt auf den Zeitraum Juli 1889 bis August 1892, verbuchen; ebenso imponierend die Gesamtzahl der mit Anna „Jeanette“ Heeger verbrachten Liebesstunden: „564“, verteilt auf den Zeitraum September 1887 bis Januar 1890.
Wenn in Schnitzler-Biografien sein Hang, in der fragmentarischen Autobiografie Jugend in Wien keines der Mädchen, mit dem er eine „Liebelei“ hatte, unerwähnt zu lassen, kritisiert wird – Tenor: Das sei nun doch wirklich nicht nötig –, so verkennt man die Tatsache, dass Schnitzler hier in absoluter Übereinstimmung mit seiner persönlichen inneren Verfasstheit agiert: Er arbeitet sein Leben auch in der Retrospektive so ab, wie er es einst Tag für Tag aufgeschrieben hat: anhand von Erlebnissen mit Mädchen und Frauen und niemand von ihnen soll vergessen sein. Nicht zufällig lässt er wenige Jahre vor seinem Tod eine Liste aller Frauennamen – heute im Schnitzler-Nachlass an der Universität Freiburg – anfertigen, die in seinem Tagebuch erwähnt werden und die entsprechenden Daten der Tagebucheinträge zuordnen, eine Konkordanz sozusagen zur Erschließung seiner erotischen Biografie. Wer die Liste genau studiert, bemerkt, dass Schnitzler bei ihrer Erstellung persönlich mitgewirkt haben muss – einzelne Daten sind mit Unterstreichung markiert und verweisen meist darauf, dass er eine Frau an diesem Tag erstmals „besass“.
An dieser Stelle noch eine Anmerkung: Zahlreiche Arbeiten zu Schnitzler haben ein Grundproblem: Sie unterschätzen in dramatischer Weise die elementare Bedeutung, die den Beziehungen zu Frauen im Leben und Schaffen des Dichters tatsächlich zukommt. Schnitzler, sein Tagebuch zeigt es eindrucksvoll, ist ein Narziss. Er braucht die Bewunderung und die „Liebe“ der Frauen, er lebt mit dem „Bedürfnis, immer was weibliches verlangendes“ um sich zu haben (TB, 13. Dezember 1892), und er schreibt auch darüber. Wenn man daher etwa im 2014 erschienenen Schnitzler-Handbuch die Namen zahlreicher Frauen, die seinen Weg gekreuzt haben und mit denen er zum Teil jahrelang zusammengelebt hat, vergeblich sucht und auch Marie „Mizi“ Glümer, jene junge Frau, die ihn wie keine andere Geliebte bewegt und erschüttert hat, auf 400 Seiten nur sechsmal erwähnt wird, so zeugt das von Ignoranz. Von einer Ignoranz, die kaschiert wird mit gespreizter, „wissenschaftlich“ klingender Metasprache. Nun soll hier keineswegs einer ausschließlich biografischen Deutung seiner Texte das Wort geredet werden, aber die Behauptung soll gelten: Wer sich nicht die Mühe macht, das biografische Umfeld eingehend zu studieren, wird Schnitzlers Werke nicht wirklich verstehen und nicht authentisch zu deuten wissen. Um an einem Beispiel zu zeigen, was gemeint ist, sei die 1894 erstmals veröffentlichte kleine Erzählung Blumen herangezogen, in der Schnitzler kunstvoll seine Erlebnisse mit zwei Frauen zusammenfließen lässt: die Untreue Marie Glümers und den vermeintlichen Tod von Helene Kanitz, der ihm von einem Onkel des Mädchens bekannt gegeben wird. Ignoriert man diese biografischen Ausgangspunkte, kommt man zu folgender Aussage: „In insgesamt 14, stockenden und zeitweise bewusstseinsstromartig mäandernden Einträgen berichtet ein biographisch nahezu konturloses, männliches Ich von einer ‚unerhörten Begebenheit‘ und der daraus resultierenden Zerrüttung seines Seelenlebens.“ (Peer Trilcke, Schnitzler-Handbuch) Schon ein kurzes Abgleichen mit der Biografie würde es erlauben, dieses „konturlose, männliche Ich“ und seine seelische „Zerrüttung“ authentisch zu interpretieren.
Ein perfekter Kavalier: Abschied von der Geliebten. Bleistiftzeichnung von Moritz Coschell zum „Anatol“-Einakter „Weihnachtseinkäufe“.
UND DIE WEIBER!
Schnitzlers Blick auf die Frauen ist nicht unproblematisch – wobei wir hier nicht von seinen literarisch „überformten“ Frauengestalten sprechen wollen. Die „Weiber“, so verrät die Sprache des Tagebuchs, sind anders: Sie sind „Geschöpfe“ oder auch „Wesen“, immer wieder deutlich zu spüren ist ein leicht verächtlicher, despektierlicher Ton, der an die zynische Sprache der k.k. Kasernen und an den Halbwelt-Jargon des Praters erinnert, an Milieus, die dem jungen Schnitzler nicht unbekannt sind und die auch sein Frauenbild prägen: Hier wurzelt seine Überzeugung von der grundsätzlichen „Lügenhaftigkeit“ der „Weiber“ und ihrer allzeit möglichen Untreue, von ihren „sonderbaren Launen“ und ihrer Dummheit – ja, der Medizinstudent Schnitzler macht die Erfahrung, dass die Mädchen, die er so kennenlernt, ihm an Bildung und Intellekt nicht das Wasser reichen können, eine Erfahrung, die auch seine späteren Beziehungen belastet, denn er wird diesen penetranten Gestus der Überlegenheit nicht mehr los – davon zeugt etwa in den Briefen an seine Geliebten die häufig verwendete Anrede-Formel „mein Kind“. Einen wohltuenden Kontrast dazu bilden Schnitzlers literarische Texte, denn hier setzt er diese Formel geschickt ein, um das gesellschaftliche Ungleichverhältnis zwischen Mann und „gefallener“ Frau zu illustrieren: So verrät etwa der Musiker Emil Lindbach, unverkennbar ein Alter Ego Schnitzlers, in der Erzählung Frau Berta Garlan seinen Dünkel genau mit dieser Wendung.
Glaubt man Schnitzler selbst, so ist es die überaus schmerzvolle Enttäuschung über den „Verrat“ Marie Glümers, die ihn dazu bewegt, im Umgang mit seinen Freunden aus Rache deren zynische Sprache in Bezug auf Frauen zu übernehmen: „Im Reden über die Weiber ist bei uns ein sehr roher Ton eingerissen“, wobei er mit „uns“ sich und seine Kumpel Richard Beer-Hofmann, Leo Van-Jung und Felix Salten meint (TB, 8. März 1896); bereits in den „Mizi I“ brieflich übermittelten Hasstiraden des Jahres 1893 schwelgt er in wüsten Beschimpfungen: Sie sei zu einem „gefälligen Schwein“ geworden, eine „Komödiantenhure“ voll „unsäglicher Gemeinheit, Geilheit und Verlogenheit“, deren Leib „vom Schweiß und Samen jenes Schauspielers, Gauners und Gecken befleckt“ sei. (Brief an Marie Glümer vom 2. Juni 1893) So wütend und gnadenlos Schnitzler hier in Momenten ehrlicher Wut über seine Mizi und ihren Liebhaber herfällt, so geschickt weiß er – wenn notwendig – Frauen über seine wahren Gedanken und Absichten zu täuschen – er spricht zu ihnen von „Liebe“, obwohl er nur allzu gut weiß, dass dieses Wort nicht dazu taugt, die Natur seiner Beziehungen tatsächlich richtig und wahrhaftig zu beschreiben. „Liebe“, so erkennt er auch im Tagebuch, ist ein Begriff, der für vieles stehen kann: Sie ist „Sinnlichkeit“, also Sex, ist „Leichtlebigkeit“ und „Behaglichkeit“, manchmal freilich auch – wie im Fall von Olga Waissnix – grande passion (TB, 4. Mai 1895), auf die jedoch unausweichlich Gleichgültigkeit und Kälte folgen.
Schnitzlers Bettgefährtinnen halten sich, bezaubert durch seine verführerische Sprache der „Liebe“, für auserwählt und sind doch nur Episode, manchmal „was Hübsches zum Erinnern“ oder nur ein willkommenes instrument de plaisir, manchmal auch rasch lästig, „ekelhaft“ und „zuwider“, werden als „Dirnen“, „geile Luder“ und „Canaillen“ abgestempelt, vor allem aber sind sie „Weiber“. Wenn es nun so ist, dass Schnitzler einen „hohen ethischen Anspruch“ an die Sprache stellt und einen „unerbittlichen Maßstab“ an seine Wortwahl im Tagebuch legt, wie es Peter Michael Braunwarth formuliert hat, wenn es so ist, dass er „im Gebrauch des Worts immer verantwortungsvoll und seriös“ ist, dann muss es gestattet sein, seine Sprache auch tatsächlich mit diesem Maßstab zu messen. Ja, Worte machen gesellschaftliche Realität spürbar, das ist Schnitzlers Überzeugung und das gilt auch für seine Tagebucheinträge: Sie führen uns ein „Ich“ vor Augen, das auch sprachlich gefangen ist in der letztlich Frauen verachtenden Welt des Fin de Siècle.
Es ist eine Welt des Scheins und der Lüge: In seiner Rolle als einfühlsamer Kavalier und „Frauenversteher“ fördert Schnitzler die Illusion von Liebe bei seinen Sexualpartnerinnen, solange es ihm opportun scheint, er spricht noch von großen Gefühlen, auch wenn ihm ein „Mädel“ schon längst wieder „gleichgiltig“ ist. Er verwendet den romantisch verklärten Begriff „Liebe“, obwohl er dessen armselige Brüchigkeit nur allzu deutlich durchschaut und weiß, dass sich dahinter verlogene bürgerliche Doppelmoral verbirgt.
Erklärtes Ziel einer jeden Affäre ist es, die betreffende Frau zu „besitzen“ – ja, es ist dieser Begriff der Aneignung, den Schnitzler bevorzugt für den Sexualakt wählt: Er „besitzt“ Frauen zum ersten und zum letzten Mal, „anstandshalber“ und – der Herr Doktor ist nicht zimperlich – „gegen ihren Willen“, in kalten Hotelzimmern und gemütlichen Vorstadtwohnungen, im sommerlichen Wienerwald und im Comfortable, dem speziellen Fiaker für alle Paare, die Grund haben, allzu viel Öffentlichkeit zu meiden, und über kein Absteigequartier in der Nähe verfügen. Sein bevorzugter Typus ist das junge „süße Mädel“, am besten ohne viel Herumgerede gleich „frisch und naiv genossen“ – so sind sie ihm am liebsten.
Das Wort vom „Besitzen“ der Frauen bildet zweifellos ein Erfolgserlebnis ab, einen gewissen Stolz und die Zufriedenheit des erfahrenen Liebesstrategen über die Eroberung: Als „Gefallene“ gehen sie ein in sein erotisches Imperium.
DAS THEATER UM DIE JUNGFRÄULICHKEIT
Das erwähnte Notieren der Beischlafhäufigkeit mag nun eine kleine harmlose Schrulle sein, sie fügt sich jedoch nahtlos in das sexuelle „Krankheitsbild“ Schnitzlers: Jene Frauen, denen es gelingt, die Beziehung zu ihm länger aufrechtzuerhalten, müssen erkennen, dass dieser Mann von zwei „fixen Ideen“ gepeinigt wird, die ursächlich miteinander zusammenhängen: Da ist einerseits der Kult der Jungfräulichkeit, der Wunsch, bei einer nächsten Geliebten auf eine Jungfrau zu treffen. Schnitzler weiß, dass dies in dem Milieu, in dem er Frauen sucht und verführt, sehr unwahrscheinlich ist, dennoch hängt er an dieser Vorstellung, würde ihn doch die Begegnung mit einem „reinen“ Mädchen, so seine Überzeugung, vor den Qualen bewahren, die ihm seine zweite fixe Idee verursacht: die zwanghafte Eifersucht auf das sexuelle Vorleben und die sexuelle Zukunft seiner Geliebten. Schnitzler rechtfertigt diesen Zwang vor sich selbst mit der Begründung, dass er doch die „Wahrheit“ wissen müsse, tatsächlich aber ist er krank. In immer neuen Fantasien stellt er sich das image physique vor, das Liebesspiel zwischen seiner Geliebten und ihrem Ex-Freund, immer wieder schafft er neue Verbindungen von Orten und Dingen zu den früheren Liebesbeziehungen seiner Geliebten und quält sie damit. Der immer wiederkehrende Versuch, aus den Frauen die vermeintliche Wahrheit herauszupressen und „herauszuzwingen“, wird zu einer „Form sadistischer Aggression“ – man kann dies durchaus so deutlich sagen, wie Peter Gay dies tut. Schnitzler, der sich selbst als „Gewohnheitsquäler“ (TB, 11. März 1894) beschreibt, verheimlicht nicht, dass er aus den ewigen „Sekkaturen“ eine seltsame Lust zieht. Mit Bezug auf Mizi Glümer, die mit unendlicher Geduld über Jahre hinweg seine Zumutungen erträgt, notiert er im Tagebuch: „Es macht mir zuweilen ein ausgesprochenes Vergnügen, sie ganz ausgesucht zu quälen. Warum? Manches sag ich ihr ganz überflüssigerweise.“ (TB, 9. Mai 1891)
Selbst Hypnose wird eingesetzt, um die „Wahrheit“ aus der Geliebten „herauszuzwingen“: Anatol und Max mit Cora. Bleistiftzeichnung von Moritz Coschell zum „Anatol“-Einakter „Die Frage an das Schicksal“.
So ist die Geschichte seiner Liebesbeziehung zu Mizi Glümer, das sei hier exemplarisch vorweggenommen, die Geschichte einer fortwährenden Aggression und Demütigung. Mizi, die jahrelang verzweifelt um ihn kämpft, ist das ideale Medium für ihn, um seine kranken Fantasien auszuleben. „Ich quäle sie viel und oft“, notiert er schon neun Monate zuvor, im August 1890. Schnitzler, 29 Jahre alt, hat eben in Würnitz im Weinviertel, im Wald und in ihrem angemieteten „Bauernzimmerl“, glückliche und sexuell erfüllte Tage mit Mizi verbracht. In einem langen Tagebucheintrag versucht er Klarheit über sein „Problem“ zu gewinnen: „Es ist sonderbar, daß ich absolut nicht darüber weg kann. Im Gegenteil, es wurde immer ärger. Ich erinnere mich, daß es mich im Sommer vor. J. noch wenig plagte. Im Winter hatte ich schon arge Anfälle – im Frühjahr wieder eine Verschlimmerung. Im Sommer jedoch einfach so, daß ich toll zu werden glaubte! Wie ich damals im Wald neben ihr lag und jammerte, schrie, weinte, als alle Gedanken wieder über mich kamen! Ihr thut es in der Seele weh. Und Briefe hat sie mir geschrieben, so tief, so wahr, so aus dem Herzen heraus, daß man das vergangene thatsächlich als verwischt denken könnte – wenn es sich eben verwischen ließe. Zuweilen, Augenblicke, Viertelstunden lang bin ich beinahe ganz darüber hinweg – es ist, wie wenn man weiß, daß man einen wehen Zahn hat – aber momentan keine Schmerzen. (…) Aber rasch kommt es wieder, und es packt mich wie einer jener Schmerzen, die nicht enden können. –“ (TB, 10. August 1890)
Schnitzler hat über seine Krankheit und speziell über sein seltsames sadistisches Spiel mit Marie Glümer ein ganzes Stück geschrieben, Das Märchen, das ursprünglich den wesentlich aussagekräftigeren Titel Das Märchen von den Gefallenen trug. Fedor Denner, der selbstquälerische Held des Stücks und Schnitzlers literarisches Alter Ego, missfiel schon den Zeitgenossen – das war nicht die Art von Liebhaber, die man auf der Bühne sehen wollte. Ein Mann, der seine fixe Idee mit quälender Zwanghaftigkeit bis in jedes kleine Detail zelebriert, der eifersüchtig ist auf alles, was nur irgendwie sich in eine Beziehung zum Ex-Freund seiner Geliebten bringen lässt, und von der Unmöglichkeit des Vergessens spricht: Es „gibt keinen Kuß, keusch genug – und keine Umarmung glühend genug, und keine Liebe ewig genug, um die alten Küsse und die alte Liebe auszulöschen. Was war, ist! – Das ist der tiefe Sinn des Geschehenen.“ Indem er seine Maxime zitiert – „Was war, ist!“ –, versucht Schnitzler eine letzte Rechtfertigung für seine Wahnvorstellungen zu finden, sie einzuordnen in seine vielfältigen Bestrebungen, die Ereignisse seines Lebens immer gegenwärtig zu halten, in jene stete Arbeit der Selbsthistorisierung, der wir nicht zuletzt auch sein Tagebuch verdanken. Auch wenn sich seine idée fixe in dieses Persönlichkeitsbild fügen mag – am Charakter einer Krankheit ändert das nichts.
Das Märchen, 1891 fertiggestellt, ist heute als Bühnenstück nicht zu Unrecht weitgehend vergessen, seine Lektüre als Schlüssel zur Persönlichkeit Schnitzlers lohnt sich jedoch noch immer – stellt doch darin der knapp 30-Jährige seine Obsession mit großer Offenheit zur Schau, so etwa, wenn er Fedor Denner zu Fanny Theren, hinter der sich Mizi verbirgt, sagen lässt: „Überall das Vergangene – in deinen Augen, auf deinen Lippen, aus allen Ecken grinst es mich an – unser ganzes Leben ist durchströmt davon. Ich bin nicht stark genug, es zu ertragen.“ Ja, selbst die glühende, leidenschaftliche Liebe Fannys, die glaubt, dadurch gleichsam wieder „jungfräulich“ und „rein“ zu werden, ist zu schwach, um gegen diesen Wahn zu bestehen. Fedor kann die „unabänderliche Schmach, die an eurer Vergangenheit klebt“, nicht vergessen und nicht verzeihen, von Ekel geschüttelt geht er ab, Fanny bricht verzweifelt zusammen. Ein radikaler, ehrlicher Schluss, der Schnitzlers von ihm selbst diagnostizierte „psych. Krankheit“ (TB, 27. August 1897) unmittelbar widerspiegelt. Schnitzler wollte sich mit diesem Stück in einer Art Selbsttherapie „befreien“ (TB, 30. November 1890) – es gelang ihm nicht, der literarische Text scheiterte an der Wirklichkeit …
AUS DEM REIGEN EROTISCHER ABENTEUER
So vieles hat zugleich Raum in uns –!
Liebe und Trug … Treue und Treulosigkeit …
Anbetung für die eine und Verlangen nach einer andern oder nach mehreren.
Wir versuchen wohl Ordnung in uns zu schaffen,
so gut es geht, aber diese Ordnung ist doch nur etwas Künstliches … Das Natürliche … ist das Chaos.
Arthur Schnitzler, Das weite Land
VENUS
Arthur Schnitzler besucht das Akademische Gymnasium am Beethovenplatz und ist ein guter Schüler – eine Gedenktafel erinnert heute daran, dass dieses traditionsreiche Institut acht Jahre lang, von 1871 bis 1879, das Zentrum seines Lebens gewesen ist. Seine Inspiration für das eigene Schreiben, das er von Beginn an selbstbewusst „Dichten“ nennt, gewinnt der heranwachsende Jugendliche jedoch abseits der Schule: auf den Logenplätzen des alten Burgtheaters am Michaelerplatz, durch umfangreiche Lektüre und die Beschäftigung mit Musik. Und seit dem September 1878, die Matura ist nicht mehr fern, ist er verliebt in Franziska Reich, die so wie er am 15. Mai 1862 geboren ist. Er kennt „Fanny“ oder „Fännchen“, wie er seine „Jugendliebe“ nennt, die Tochter eines jüdischen Kaufmanns, schon seit seinem 13. Lebensjahr, von „ihrem inneren und äußeren Wesen“ weiß er allerdings „kaum mehr“, als dass sie blond ist, später wird er in seiner Autobiografie Jugend in Wien von ihr sagen: „Sie war leidlich hübsch, nicht eben dumm, und besaß gerade so viel Bildung, als man in jener Zeit den Töchtern mittlerer jüdischer Hausstände zu geben für nötig fand.“
Gemeinsam mit Fanny besucht Schnitzler die Tanzschule von Madame Crombé, man trifft sich im Rathauspark oder Volksgarten, findet in leidenschaftlichen Küssen und Umarmungen zueinander, tauscht Billetts und Liebesbriefe aus, die „damals in unseren Kreisen noch üblichen Grenzen“ werden aber nicht überschritten.
Doch längst haben Schnitzler und seine Schulkameraden eine andere Welt entdeckt: den „Zauber der Weiblichkeit“ in „seiner allgemeineren Art“, wie er es in Jugend in Wien vornehm umschreibt. Da sind vor allem die Dirnen auf der Kärntner Straße, „geschminkte und vielsagend zwinkernde Damen“, die Fantasie und Neugier der Gymnasiasten herausfordern, manche der älteren Schulkollegen wie etwa Adolf Weizmann, der an Syphilis erkranken wird, wissen bereits von konkreten Erlebnissen mit den „Huldinnen“ zu berichten. Ganz im Banne der ihnen zuteil gewordenen klassischen Bildung vergeben die Jünglinge an die Mädchen von der Straße Namen griechischer Göttinnen – es sind nun Venus, Hebe und Juno, die sie locken und reizen.
Ein beliebtes Zubrot für die „Göttinnen“ der Straße: erotische Fotografie. Aus der Mappe „Die Erotik in der Kunst“ von Cary von Karwath.
Auch Schnitzler ist neugierig. Schließlich findet er auch einen moralisch einwandfreien Vorwand für einen „ersten Ausflug“ in das „bedenkliche Revier“: Seine Auserwählte ist die „strohblonde“ Venus, er folgt ihr „an einem schönen Sommertag“ in ihre Absteige am Stock-im-Eisen-Platz. Das „hübsche junge Geschöpf“ zieht sich ganz ungeniert aus und präsentiert ihre Reize „nackt auf dem Diwan“, der Schüler Schnitzler, im „noch ganz knabenhaft zugeschnittenen Anzug, Strohhut und Spazierstöckchen in der Hand“, wagt nicht wirklich hinzusehen – er bleibt am Fenster stehen und erklärt der „zugleich gelangweilten und belustigten Schönen“, dass sie sich doch einen anständigen Beruf suchen solle, zur Untermauerung seines Appells liest er ihr noch entsprechende Stellen aus einem „zu diesem Zweck mitgebrachten Buch“ vor.
Venus, ihrem Berufsethos verpflichtet, hält dagegen: Sie versucht ihn zu verführen, scheitert damit jedoch ebenso wie Schnitzler mit seiner Bekehrungsmission. Immerhin: Er hinterlässt dem Mädchen beim Abschied zwei Gulden – Geld, das ihm die Mutter zum Kauf von Anton Gindelys Buch Grundriß der Weltgeschichte mitgegeben hat: „Seither bekam der Name Gindely in der Unterhaltung zwischen uns verworfenen Jünglingen eine überaus pikante Nebenbedeutung.“ Schnitzler, offenbar von Venus doch inspiriert, wiederholt seine Mission auch bei anderen Göttinnen der Kärntner Straße, „auf lange hinaus“, so berichtet er in Jugend in Wien, sei es ihm allerdings gelungen, den „Sündenfall in seiner biblischen Bedeutung“ zu vermeiden.
Nach den Göttinnen folgen Besuche bei einer „gewissen Emilie“, sie ist das erste Mädchen, das dem Schüler der Maturaklasse „nicht nur körperlich, sondern auch seelisch gefährlich zu werden“ anfängt; als wohl damit im Zusammenhang die schulischen Leistungen ausgerechnet vor der Matura schlechter werden, entschließt sich Vater Johann Schnitzler zu einem drastischen Schritt: Er erbricht den Schreibtisch seines Sohnes und liest dessen Tagebuch – „große Scenen“ (TB, 19. März 1879) sind die Folge. Die Einträge über die intimen Begegnungen mit Emilie veranlassen Johann Schnitzler zu einer „furchtbaren Strafpredigt“, Sohn Arthur lässt sie schuldbewusst und „stumm“ über sich ergehen. „Zum Beschluß nahm mich der Vater mit sich ins Ordinationszimmer und gab mir die drei großen gelben Kaposischen Atlanten der Syphilis und der Hautkrankheiten zu durchblättern, um hier die möglichen Folgen eines lasterhaften Wandels in abschreckenden Bildern kennenzulernen.“ (Jugend in Wien)
Der Anblick der Kaposischen Tafeln wirkt in Schnitzler lange nach und bewirkt, dass er sich vor sexuellen „Unvorsichtigkeiten“ hütet, dennoch will er auch von Fanny Reich bald mehr als nur Küsse, ja, er macht sich, inzwischen schon Student der Medizin, „Hoffnung auf den Besitz des geliebten Gegenstands“ (TB, 12. März 1880), seine Überzeugung ist schon damals: „Wahre Liebe ist ohne Sinnlichkeit undenkbar.“ (TB, 14. April 1880) Und er entdeckt, dass ein Seitensprung seine Liebe zu Fanny „noch glühender“ macht, der Wunsch nach dem „Besitz Fannys“ beherrscht ihn völlig: „Mein Blut tanzt Cancan“, notiert er am 13. Mai 1880 im Tagebuch und: „All mein Blut pulst nur einer Stunde entgegen …“ (TB, 16. Mai 1880)
Doch Fanny, wohlbehütet von ihrer Familie, bleibt ihm versagt und Schnitzler findet die ersehnte sexuelle Erfüllung bei anderen Mädchen. Die Beziehung zu Fanny beginnt sich allmählich zu lockern und aufzulösen, nicht zuletzt auf Betreiben ihrer Eltern heiratet sie am 18. Juni 1888 Simon Lawner (1844–1896), den Generalrepräsentanten der französischen Lebensversicherungsanstalt „Le Phénix“, und übersiedelt mit ihm nach Bielitz (heute Bielsko-Biała). Ihr Mann stirbt im Sommer 1896, Fanny, inzwischen Mutter eines Sohnes namens Herbert, hat Schnitzler nicht vergessen und so schreibt sie ihm zu seinem 37. Geburtstag, der ja auch der ihre ist, einen Brief „mit Handarbeit“ (TB, 15. Mai 1899), in dem sie von der Möglichkeit eines Wiedersehens spricht. Schnitzler, der vor wenigen Wochen Marie Reinhard verloren hat, willigt ein – am Pfingstmontag 1899, es ist der 22. Mai, trifft er in der Secession mit ihr zusammen, ist „von ihrem jüdeln und plappern unangenehm berührt“, dennoch lädt er sie am Abend in den Riedhof ein. Fanny ist „sehr zärtlich“ und sagt, dass so „ein Wunsch“ erfüllt werde. (TB, 22. Mai 1899) Am nächsten Tag besucht ihn Fanny mit ihrem Sohn Herbert und am Abend des 24. Mai holen beide nach, was sie einst in ihren Jugendtagen versäumt haben: Schnitzler fährt mit ihr ohne weitere Umwege ins Hotel Victoria und schläft mit ihr. Im Tagebuch vermerkt er: „Anfangs ging sie mir auf die Nerven, dann siegte der Trieb! –“ (TB, 24. Mai 1899)
Ein nächstes Rendezvous wird vereinbart, doch zwei Tage später, inzwischen hat er die Angelegenheit durchdacht, schreibt er ihr ab, erklärt ihr, dass ein Wiedersehen nicht möglich sei. Fanny muss diese perfide Absage enttäuscht hinnehmen. Sie antwortet ihm am 31. Mai 1899 mit ehrlichen Worten: „Ich habe in Wien gesehen, daß du dich meiner schämst, ich begreife es ja vollkommen, weil ich doch eigentlich gar nichts bin, aber ein Herz habe ich doch, das läßt sich einmal nicht wegläugnen (sic!), als ich dich wiedersah brach die langverhaltene Liebe wieder hervor und das hast du mir so übel genommen.“ – Schnitzler gibt sich wieder einmal wenig beeindruckt, notiert „ganz netter Brief“; die Geschichte seines denkwürdigen Wiedersehens mit Fanny wird er wenig später in der Erzählung Frau Berta Garlan gestalten …
ISBN 978-3-990-40388-4
Wien – Graz – Klagenfurt
© 2015 by Styria Premium in der Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG
Alle Rechte vorbehalten
Bücher aus der Verlagsgruppe Styria gibt es in jeder Buchhandlung und im Online-Shop
Lektorat: Georg Loidolt
Covergestaltung: Bruno Wegscheider
Layout: Florian Zwickl
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015