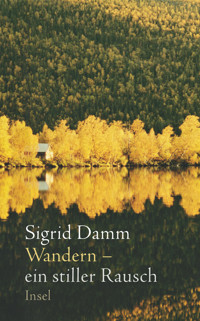16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band versammelt Sigrid Damms essayistische Arbeiten aus über vier Jahrzehnten und wird von einer Einleitung des Germanisten und Schriftstellers Heinrich Detering begleitet.
Enthalten sind neben den jüngst entstandenen Essays über Hermann Hesse, Ulrich Schacht, den Film »Leuchte, mein Stern, leuchte« die Arbeiten über den Totentanz-Zyklus des Malers Lutz Friedel und das Werk von Franz Fühmann, auch Miniaturen zum Leben von Caroline Schlegel-Schelling, Róẑa Domašcyna und Angela Krauß. Essayistische Arbeiten über Lenz und Goethe, die parallel zu Sigrid Damms großen biographischen Erzählungen wie Christiane und Goethe entstanden, und der Text »Der Kopierstift hinter dem Ohr des Soldaten« beleuchten die Arbeitsweise der Autorin und geben spannende Einblicke in ihre unbeirrte Spurensuche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Sigrid Damm
Alle Wege offen
Essays
Mit einem Vorwort von Heinrich Detering
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-458-77666-6
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Die erhoffte Schrift. Über die Essays von Sigrid Damm
I
. »Mein Herz ergeht sich in Ovationen«
Zu Alexander Mittas Film »Leuchte, mein Stern, leuchte«
Hermann Hesse: Anwalt des Individuums
Zu Ulrich Schacht: »Mein Herz ergeht sich in Ovationen«
Zum Zyklus »Totentanz« des Malers Lutz Friedel
»den rückzug vor uns alle wege offen«. Die Dichterin Róža Domašcyna
»Dreh dich nur beiläufig um«. Zu Angela Krauß
»Am liebsten tät ich auf die Straße gehn und brüllen«. Zu Franz Fühmanns »Im Berg«
II
. »daß handeln, handeln die Seele der Welt sei«
»Der Kopierstift hinter dem Ohr des Soldaten …«. Schriftsteller und Archiv
Lenz – eine geheime Lernfigur
»… daß handeln, handeln die Seele der Welt sei …«. Jakob Michael Reinhold Lenz
Eduard Mörike: »… und möchte mein Schicksal mit Füßen zertreten«
III
. »Geheimnißvoll offenbar«: Goethe
Das Ilmenauer Bergwerk: Goethe als gescheiterter Unternehmer
Zum 200. Hochzeitstag von Christiane und Goethe
Der Zeitverlust, das schöne Geschlecht und Goethes Werk
Christianes und Goethes Ehebriefe
IV
. »Die Kunst zu leben«
Caroline Schlegel-Schelling – Die Kunst zu leben. Begegnung mit Caroline
Textnachweise
Dank
Verzeichnis der Publikationen
Informationen zum Buch
Die erhoffte Schrift
Über die Essays von Sigrid Damm
Als ungefähr fünfzigjähriger Bürger der DDR, so erinnert sich Stephan Hermlin in seinem Prosaband Abendlicht, habe er das Kommunistische Manifest auf einmal mit neuen Augen gelesen. »Unter den Sätzen, die für mich seit langem selbstverständlich geworden waren, befand sich einer, der folgendermaßen lautete: ›An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung aller die Bedingung für die freie Entwicklung eines jeden ist.‹ […] Wie groß war mein Erstaunen, ja mein Entsetzen, als ich nach vielen Jahren fand, dass der Satz in Wirklichkeit gerade das Gegenteil besagt: ›…worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.‹« Hermlin fügt hinzu: »Plötzlich war eine Schrift vor meinem Auge erschienen, die ich lang erwartet, auf die ich gehofft hatte.«
Datiert ist dieses Erlebnis auf die Zeit um 1965. Es ist die Zeit, in der die noch unbekannte Sigrid Damm Geschichte und Germanistik in Jena studiert. Sie ist fünfundzwanzig Jahre alt; bis zu ihrer literaturwissenschaftlichen Dissertation sind es noch fünf, bis zu ihrem ersten literarischen Buch zwanzig Jahre. Die Erfahrung aber, die Hermlin beschreibt, könnte wie ein emblematisches Bild auch über ihrem künftigen Werk stehen. Zuerst weil es um eine Leseerfahrung geht, dann weil das Erlebnis nicht nur einen vermeintlich vertrauten, kanonischen Text in verändertem Licht zeigt, sondern von dort aus auch die Gegenwart der Lesenden schlagartig verwandelt, und schließlich weil es vom Verhältnis zwischen dem einen, einzelnen Menschen und den gesellschaftlichen Lebensbedingungen aller handelt. Für Hermlin wie dann für Damm (und, wie sich zeigt, schon für Marx und Engels) steht am Anfang das einzelne Leben in seiner Besonderheit und seinem unveräußerlichen Recht. Die sozialistische Gesellschaft ist nicht Selbstzweck, sondern soll als eine freie, eine frei machende und Freiheit ermöglichende Assoziation der Entfaltung dieses einzelnen, besonderen Lebens dienen. Und dieser Gedanke, der aus der Schrift hervortritt, ist nicht Feststellung einer schon bestehenden Wirklichkeit, sondern Gegenstand einer Hoffnung. Wie auf hoher See jene wunderbaren »Vögel, die verkünden Land«.
Sigrid Damms Schreiben ist stärker durch die Sozialisation in der DDR bestimmt, als es ihren westlichen Leserinnen und Lesern manchmal bewusst ist. Die Spannungen von gesellschaftlichen Strukturen und individuellen Freiheitserwartungen, das Vertrauen auf die Schrift, die über räumliche und zeitliche Abstände hinweg Gespräche und Einsichten ermöglicht, die lebensverändernd, vielleicht lebensrettend sein könnten, der Mut zu hoffnungsvollen neuen, eigenen Lektüren, die unstillbare Neugier auf die Literaturgeschichte als ein großes Archiv der Stimmen und Schriften, schließlich die Selbstverständlichkeit, mit der diese Stimmen auf ihre sozialen Ursprünge und Zusammenhänge hin befragt werden – dies alles gehört zu Sigrid Damms Lese- und Schreibpraxis, und es entspringt in Einverständnis und Widerstand, in Solidarität und Gegenrede dem Leben in der Deutschen Demokratischen Republik. Diesen Ursprüngen verdanken sich die Bücher, die bis in die Bestsellerlisten hinein im ganzen deutschen Sprachraum gewirkt haben.
Die Spuren der ausgesprochenen wie die nur zwischen den Zeilen zu lesenden Erfahrungen zeigen sich noch im Beiläufigen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Stichworte fallen wie »Frankfurt / Oder. Die Romantikerkonferenz« oder »Akademie der Künste der DDR. Gedenkveranstaltung für Franz Kafka«, stellt heutigen Lesenden schlagartig vor Augen, was es zum Beispiel bedeutete, in den Nachwehen des Sozialistischen Realismus von romantischen Träumen zu sprechen oder 1983 in Ostberlin über Kafka. Und welcher Schmerz ist noch immer spürbar in einer lakonischen Notiz wie »Sarah ging«.
In der DDR-Literatur der siebziger und achtziger Jahre – und mit Büchern von Peter Härtling, Adolf Muschg, Wolfgang Hildesheimer auch im Westen – rückt die Frage nach der freien Entwicklung eines jeden unter den Bedingungen einer daran wenig interessierten Gesellschaftsordnung ins Zentrum eines Interesses, das nicht nur historisch ist. Hier geht es um Lebensfragen. Biographische Erzählungen aus der Geschichte der Literatur werden zu Fallstudien über Möglichkeit und Grenzen eines selbstbestimmten Lebens. Christa Wolf vergegenwärtigt Kleist und Günderode in Kein Ort. Nirgends, Stephan Hermlin lässt gegen alle Funktionärswiderstände Kafka in der DDR zu Wort kommen und erinnert in Scardanelli an den armen Hölderlin im Tübinger Turm, Günter de Bruyn erzählt von Jean Paul und Franz Fühmann von Trakl. Es ist dieser Kontext, in dem die junge Sigrid Damm sieben Jahre lang die Lebens- und Leidensgeschichte von Jakob Michael Reinhold Lenz rekonstruiert, die sie dann 1985 in ihrem ersten Buch erzählen wird. Schreibend folgt sie seinem Blick hinauf zu den Vögeln, die verkünden Land. »Indem ich die bitteren Erfahrungen eines anderen teilte, konnte ich mir selbst Mut machen«, schreibt sie rückblickend; mit Caroline Schlegel-Schelling, Christiane Vulpius und Cornelia Goethe werden es die bitteren Erfahrungen auch und gerade von Frauen.
Ein eigener Mensch zu werden, die Entscheidung zwischen »Leben oder Gelebtwerden« ist das Thema ihrer Heldinnen und Helden, weil es ihr eigenes Lebensthema ist. Es gibt den historischen Gestalten ihrer Essays gerade in ihren Eigenheiten, über die nur die Archive Auskunft geben können, etwas Exemplarisches: die Einmaligkeit ihres besonderen Lebens. Sigrid Damms Essays sind nicht lediglich Ergebnisprotokolle, sondern sie sind Schauplätze von Begegnungen mit Menschen. Denn allein die Literatur macht es – wie der von Sigrid Damm zitierte Ulrich Schacht notiert – möglich, »Menschen wiederzuerkennen, denen man nie begegnet ist«.
Lenz und Caroline erscheinen in diesen Essays als die »geheimen Lernfiguren« (so die Überschrift zum ersten Lenz-Essay), weil sie beide Auf- und Ausbrechende sind. Lenz wird zu Sigrid Damms erstem Helden, weil er anstürmt gegen die Maschinerie der »Republik« als »die große Maschine, die wir Welt nennen«. Caroline folgt ihm, mit Sigrid Damms zuerst 1979 erschienener umfangreicher Auswahl aus ihren Briefen und dem längsten ihrer literarischen Essays, weil sie als Frau, als Intellektuelle und als Citoyenne ein Selbstbewusstsein entwickelt, das ihr Flügel wachsen lässt. Wenigstens zeitweise vermag sie sich schreibend zu erheben über Hohn und Verachtung einer feudalen, patriarchalen Mitwelt, gegen deren Zumutungen und Zurichtungsversuchen sie in ihrem turbulenten Ehe- und Familienleben aufbegehrt. Wenn Sigrid Damm resümiert: »Carolines Leben war die Kunst, in den ihr historisch aufgezwungenen engen Grenzen ihr Leben bewusst zu gestalten« – dann begreift sie dieses Leben selbst als Carolines Kunst. Aber erst im Briefwerk (die Briefe seien »eigentlich Tagebücher«, notiert Damm) kommt diese Kunst zu sich selbst, wird sie zum nachlesbaren und nachlebbaren Vor-Bild.
Zu den widerständig eigensinnigen Begleitern in Sigrid Damms Essays gehören auch Mitlebende wie Franz Fühmann, der »Glücksgott und Schmerzensmann«, vergessene, von der SED bedrängte und verjagte Schriftsteller wie Ulrich Schacht, neu zu Entdeckende wie die sorbische Dichterin Róžsa Domašcyna, Wiederzulesende (und im Westen nie richtig Angekommene) wie Horst Drescher oder Kurt Batt. Sie und andere lassen sich in diesen Essays wiederfinden. Mit Fühmanns zart-ungeschlachter »Arbeit an der Schuld der Selbstauslöschung« durchmisst Sigrid Damm die Abgründe von Faschismus und Stalinismus, die alptraumhaften Bergwerke des 20. Jahrhunderts, die »Denkmuster, denen wir so oder ähnlich ausgesetzt oder auch zeitweise erlegen oder verhaftet waren«. Ausgesetzt, erlegen, verhaftet: sehr genau gibt die Abfolge der drei Wörter wieder, auf welche Weise hier die Kindheitsmuster wirken und wie sie überwunden werden konnten.
Wie sie selbst ein Teil der »Maschine« gewesen sei und wie sie das Räderwerk verlassen habe, indem sie ausbrach, um als freie Schriftstellerin zu leben, das schildert Sigrid Damm in einem Essay, der auf etwas so Wundersames hinausläuft wie eine Liebeserklärung an das literarische Archiv. Dass dieser Ausbruch sich im Zeichen des rebellierenden Lenz vollzieht, ist eine denkbar sinnfällige Gründungsszene.
Das eigentliche Ziel der abenteuerlichen Reise, die sie auf Lenz' Spuren nach Estland ins eigentlich als Militärgebiet abgesperrte Tartu führt (wunderbar die Erinnerung an den »Kopierstift hinter dem Ohr des Soldaten«, der mit einer raschen Notiz das Verbotene möglich macht), ist nicht der Einlass in die Archive einer Zeit, in der Tartu noch Dorpat und das Land noch Livland hieß, sondern – so schreibt Sigrid Damm – eine »Rückgewinnung der Individualität durch Aufarbeiten der Geschichte«. Dazu aber braucht es die Arbeit mit den Archivalien, das Studium der Geschichtszeugnisse, zuerst der literarischen Texte, dann der unzähligen sozialen, ökonomischen, kulturellen Kontexte, schließlich der Relaisstationen zwischen beiden. Das sind, zumal im 18. und 19. Jahrhundert, Briefe und Briefwechsel; ihnen gilt darum immer wieder Sigrid Damms leidenschaftliches Interesse.
»Rückgewinnung der Individualität durch Aufarbeiten der Geschichte«: In diesem Motto meint die zurückzugewinnende Individualität natürlich zuerst diejenige der historischen Gestalten, deren Spuren die Biographin folgt. Aber es meint auch die Bestimmung ihres eigenen, gegenwärtigen Standorts, ein Verständnis der Wege, die sie dorthin geführt haben, und einen Ausblick auf die Wege, die von hier aus weiterführen könnten ins Freie. Im Umgang mit Lenz' Leben und Schreiben will Sigrid Damm, das sind die genau gesetzten Verben ihres programmatisch formulierten Vorsatzes: »spüren«, »sehen« und »wissen«. Die sinnliche Vergegenwärtigung braucht die Nähe zu Orten und Dokumenten, Berührungsreliquien des Vergangenen und Zeugnisse einer sozialgeschichtlichen Polyphonie. Darum setzen ihre biographischen Recherchen bei Reisen an, in Archiven und Bibliotheken. Die aber machen immer zugleich die Distanz spürbar, die sie als Gegenwärtige vom Vergangenen trennt. Nicht die Überwindung, sondern die Vermittlung dieser Distanz ist das Ziel von Sigrid Damms Schreiben.
Dazu gehören Kenntnisse nicht nur der Ideen-, sondern auch der ökonomischen Geschichte. Es ist wenig bekannt und lohnt deshalb das Nachlesen, wie Sigrid Damm, die Kennerin und kritische Liebhaberin Goethes, in einem der umfangreichsten Beiträge dieser Sammlung den Dichter und Denker als scheiternden Unternehmer wahrnimmt. Wie er, nach eigenem Bekunden, in Weimar die Iphigenie überarbeitet, als ob »kein Strumpfwirker in Apolda hungerte«, so erkennt er in Ilmenau das von ihm mitverschuldete Elend der entlassenen Bergleute, der »armen Maulwurfe«. Von hier aus, nicht aus innerliterarischen Interpretationen, öffnen sich in diesem Essay trittfeste Wege in die Bergwerksbilder der Harzreise im Winter, des Faust, der Wanderjahre. Das Ergebnis der Rekonstruktionsarbeit, in die der Essay uns Lesende mitnimmt, ist eine Modellstudie sozialgeschichtlich informierter Lektüre.
Zu dieser Suche nach anderen Zugängen als den ausgetretenen Wegen einer Goethe-Hagiographie gehört auch die feministische Perspektive. Nicht sentimental, sondern kritisch Verschüttetes freilegend, fragt sie, in ihren großen Büchern wie in den Essays dieses Bandes, nach Christiane Vulpius und anderen Frauen, die sich nicht nur, wie das in der älteren Germanistik gern hieß, »um Goethe« bewegen, sondern die Goethes Arbeit überhaupt erst ermöglichen (wie Christiane), sie anregen (wie die Kaiserin Maria Ludovica oder Ulrike von Levetzow), sie mitschreibend begleiten (wie Marianne von Willemer), sie herausfordern (wie Bettine von Arnim). Und sie macht Gegenstimmen hörbar wie in ihrer Lektüre von Christianes Briefen an Goethe oder in der Nachzeichnung des lyrischen Dialogs mit Marianne von Willemer.
Sigrid Damms Essays sind ein kontinuierlicher und »nicht nachlassender Versuch einer Zwiesprache; fragwürdige Annäherung«. Eben weil die Annäherung immer fragwürdig bleibt, weil sie in der Gefahr von Projektion, Vereindeutigung und Vereinnahmung steht, gehören zu diesem Schreiben auch die Pausen, das Innehalten, die Absätze. Manchmal, wie im Versuch über Goethes Ilmenauer Bergwerksarbeiten, folgt auf fast jeden Satz ein Absatz; manchmal wird, wie im Caroline-Essay, über Seiten hinweg kontinuierlich erzählt. Indem sie in Lenz, dem Gegner der allein auf Einzelpersonen bezogenen »Einfühlung«, den Vorgänger Brechts erkennbar macht, demonstriert sie selber die Möglichkeit einer reflektierenden Einfühlung in weitläufige kulturelle, soziale, politische Zusammenhänge. »Der ›Riß‹, der durch die Welt geht, spaltet Lenz selber.« Das heißt umgekehrt: In Lenz selber lässt sich zeigen, welche Risse durch die Welt gehen, in der er lebt.
»Als Heutige begegnen wir ihr«, bemerkt sie in ihrem langen Aufsatz über Caroline, »treten mit ihr ins vertraute Gespräch, sehen Eigenes im Fremden.« Das schließt Kritik und Widerrede ein; »Sympathie wurde nie zur Apologie«. Aber es verlangt auch eine Teilnahme, die Emotionen zulässt. Der »Wärmestrom«, den Sigrid Damm einmal, die Dichterin zitierend, der Prosa von Angela Krauß nachrühmt, gilt auch für ihre eigenen Texte – nicht auf Kosten der argumentativen Klarheit, sondern als deren Voraussetzung. So entsteht ein Dialog der Schreibenden mit ihren Protagonisten und mit ihren Archivaren, mit Freundinnen und Kolleginnen (Mörike liest sie mit Ruth Klüger; mit ihr lernt sie von ihm »weiter leben«), ein Dialog auch mit uns, den Lesenden.
Das setzt voraus, dass in der versuchten Nähe die Distanz, ausdrücklich oder implizit, immer mitläuft. Die kürzeste Form, in der das in Sigrid Damms Schreiben geschieht, sind die elliptischen Kurzsätze. Kein Stilzug ist für ihre Texte so charakteristisch wie dieser. Manchmal deuten sie nur, wie die pointillistischen Maler, ein Bild an, das nicht ausgemalt wird. Dann erscheint die sorbische Lausitz als »Schauplatz eines ökologischen Exzesses. Großbauten des Sozialismus. Braunkohlenförderung, Abbaggern. Verwüstung, Devastation.« Häufiger aber gliedern sie den Gedankengang wie Zwischentitel, Haltepunkte. Dann haben sie in ihrer abbreviaturhaften Konzentration etwas Meditatives: als werde der Fluss der Sätze für einen Moment angehalten, weil ein Hindernis sich bemerkbar macht, ein Stein in der Strömung. »Umgang mit Anderssein«. Oder: »Fühmann und Kinder«. Oder: »Hüllen. War Mörike ein Mann oder eine Frau?« Vieldeutig oder, mit Goethes schönem Wort, weitstrahlsinnig bleibt das unverbunden gesetzte »Hüllen«: Andeutung einer Serie von Geschlechterrollenspielen und Hinweis auf ein Ich, das sich auch der umsichtigsten Annäherung entzieht, das unerreichbar bleibt und doch gerade in der Verhüllung ganz es selbst zu sein scheint. »When asked to give your real name«, hat der junge Bob Dylan in einem Gedicht geschrieben, »never give it.« Sigrid Damms biographische Essays bezeugen den Respekt, den dieser Vers fordert. Sie fragt nach dem, was die Hüllen verbergen mögen, aber sie reißt sie nicht herunter. Denn sie begreift sie nicht als bloße Masken, die eine verborgene Wahrheit verhüllen, sondern als Teil jenes komplexen Geschehenszusammenhangs, der »ich« heißt.
Von ihren eigenen Briefen sagt Caroline Schlegel-Schelling, dass sie vielleicht »eine die Menschheit überhaupt interessirende Erfahrung« formulieren könnten. In der Buchausgabe von Sigrid Damms biographischem Essay (der in überarbeiteter Form jetzt diesen Band beschließt) stand es als Motto über dem Text. Aus dem Lesen der alten Texte, aus der Arbeit in den Archiven heraus schreiben und aus dem Schreiben heraus neu lesen: Für Sigrid Damm heißt das Erfahrungen sammeln. Erfahrungen, die womöglich »die Menschheit überhaupt interessiren« könnten.
Diese Zuversicht setzt ein Ethos der Wahrheitssuche voraus, das in der Zeit der prosperierenden Postmoderne ebenso anachronistisch wirkte wie in den Jahren des Sozialistischen Realismus. Gegen Lion Feuchtwangers Proklamation eines Rechts der »illusionsfördernden Lüge« gegen die »illusionsstörende Wahrheit« beharrt die Biographin wie die Romanschriftstellerin und Essayistin Sigrid Damm auf der Auffindbarkeit einer historischen Wahrheit – als eines Ziels, auf das sie sich zubewegt, in der vielleicht nie ans Ende kommenden Bewegung, von der die Romantiker träumten. Das Schreiben ist diese Bewegung. Für Sigrid Damm beginnt sie im Archiv. »Das Archivierte«, schreibt sie, sei »ein Rettungsanker, mit dem die Wahrheit festzumachen war.«
Als das Gegenteil des lebendigen Archivs, als das Sigrid Damm Literatur begreift, erscheint in diesen Essays einmal der Friedhof. Er sei gewiss »auch eine Art Archiv«, notiert sie in Tartu, aber eines, in dem »die Toten in Steine verwandelt« sind. Sigrid Damms Schreiben entspringt nicht nur – wie sie über ihre Vorbilder von Muschg bis de Bruyn bemerkt – einer »Art Liebesverhältnis zu den beschriebenen Autoren«, es ist selbst dieses Liebesverhältnis. Das »Dienen am Werk des anderen und die eigene Subjektivität gingen eine glückliche Verbindung ein«, bemerkt sie auf derselben Seite. Dieser Satz taugt als Beschreibung für jeden dieser Essays.
Heinrich Detering
I
»Mein Herz ergeht sich in Ovationen«
Zu Alexander Mittas Film »Leuchte, mein Stern, leuchte«
Im März 1972 war von einem sowjetischen Film die Rede, der im Kino »International« nach der Abendvorstellung nochmals gezeigt wurde, weil der Andrang so groß war. Ein für Berlin ungewöhnliches Ereignis. Ich wollte den Film unbedingt sehen. »Leuchte, mein Stern, leuchte« war sein Titel.
Aber im »International« war das Programm bereits geändert, und meine Suche in den kleineren Vorstadtkinos verlief zunächst ergebnislos. Dann aber war es das Union-Kino in der Bölschestraße in Friedrichshagen, das den Film überraschend ins Programm nahm. Ich machte mich sofort auf den Weg. Die Abendvorstellungen über den gesamten Zeitraum, den der Film laufen sollte, waren bereits ausverkauft, aber – mein Glück – für 17:00 Uhr erhielt ich eine der letzten Karten für diesen Tag. Ich war damals einunddreißig Jahre alt, mein Sohn Joachim war seit einem Dreivierteljahr ein Schulkind, Tobias war noch im Kindergarten. Ich rief meinen Mann an, ob er die Kinder versorgen könne. Es war nicht üblich, daß ich allein ins Kino ging, aber hier schien mir eine Ausnahme gerechtfertigt. Und dann saß ich im Saal, der Gong ertönte, es wurde dunkel, der Vorhang rauschte auf, der Film begann.
Atemlos verfolgte ich das Geschehen auf der Leinwand. Und als ich nach anderthalb Stunden das Kino verließ und wieder auf der Straße stand, schien alles um mich herum verändert, unter meinen Füßen war 20 cm Luft, ich lief nicht, ich schwebte, ich flog.
Neunundvierzig Jahre ist das her, daß ich Alexander Mittas »Leuchte, mein Stern, leuchte« gesehen habe, und doch sind mir einzelne Szenen, vor allem aber Gesichter unverrückbar im Gedächtnis. Da ist dieser junge Theatermann, glühender Anhänger der russischen Revolution, der dem Volk die hohe Kunst bringen will. Iskremas nennt er sich; ein Künstlername, gebildet aus den Anfangssilben der russischen Wörter Iskustvo revoljucii massam: »Die Kunst der Revolution für die Massen«. In den Wirren des Bügerkriegs trifft er 1920 in dem kleinen südrussischen Städtchen Kapriwnitzky ein und beginnt sofort, im Freien seinen Thespiskarren zur Bühne umzubauen und Shakespeares Julius Caesar zu spielen. Das Volk läuft ihm zu. Als aber der Kinovorführer Pascha eine Vorstellung ankündigt, strömen die Zuschauer dorthin. Iskremas folgt ihnen in den Saal. Und da ist sein unvergeßliches Gesicht. Kummer, Unglaube, Verachtung, Abscheu drückt es aus. Kann es wahr sein, sagt es, daß der billige Stummfilm, der auf der Leinwand flimmert und vom Vorführer kommentiert wird, den Zuschauern Spaß macht? Sie klatschen und kreischen, haben ihn gegen die höhere Theaterkunst, gegen Shakespeare getauscht? Unbegreiflich! Tiefe Enttäuschung spiegelt sich in Iskremas' Gesicht. Eine wunderbare große Szene.
Und wiederum sein Gesicht, nun erfüllt und beglückt, als er den Maler Fjodor die Äpfel, die an einem durch Granaten zerstörten Baum nicht mehr zur Reife kommen können, unter dem Gezeter seiner Frau rot anmalen sieht. Dann Iskremas im Haus des Malers, er geht durch die Räume, alle Wände sind bemalt. Auch hier das unablässige Gezänk der Frau; Schwachkopf, Esel, Verfluchter nennt sie ihn, spricht von Schande.
Ich aber sah nur die Gesichter der beiden Künstler. In dem von Iskremas das Staunen, die Tiefe der Berührung durch die Größe dieser naiven Kunst. In dem des Malers Genugtuung darüber, von einem fremden Betrachter – vielleicht erstmals – verstanden zu werden. Auch das eine große Szene.
Meine Beglückung über den Film. An dem Abend, über den nächsten und nächsten Tag. Merkwürdig erscheint es mir, daß das bittere Ende – der Tod der beiden – in meinen Gedanken damals kaum eine Rolle spielte. Der Maler wird von den Weißgardisten, die nach den Roten die Stadt einnehmen, erschossen. Iskremas, nachdem sich die Sowjetmacht wieder etabliert hat, vom Mitglied einer kriminellen Bande, die in der Stadt wütet. Das Lebendigbleiben der beiden in meinem Kopf. Liegt darin nicht das Geheimnis des Films, seine Menschlichkeit, Kraft, Tiefe? Er ist ein einziges großes Plädoyer für die Freiheit der Kunst.
Die zwanzig Zentimeter Luft unter meinen Füßen nahm ich mit in meinen Alltag. 1970 an der Jenaer Universität promoviert, hatte ich wegen meiner Kinder auf meine Stelle dort verzichtet und arbeitete seit Herbst 1970 in Berlin im Ministerium für Kultur. Eine kunstfeindliche Maschinerie, wie sich bald herausstellte. Funktionäre reglementierten, erteilten Zensuren oder setzten gedankenlos von »oben« kommende Beschlüsse der Parteiführung durch. Von Freiheit der Kunst keine Spur. Diejenigen, die Verwandtschaft mit Iskremas oder Jegor aufwiesen, hatten es schwer, nicht aber die Paschas. Der Filmvorführer ist in »Leuchte, mein Stern, leuchte« der Einzige, der überlebt. Er, mit seinem »ganz banalen primitiven verlogenen Zeug«, wie Iskremas ihm entgegenschleudert, entgegnet diesem: »Das Volk liebt mich. Ich gebe ihm Spiele und es gibt mir Brot.«
Wie wahr. Das alte Lied! Und arbeitet Pascha nicht unter Aufbietung all seiner körperlichen Kräfte? Mit dem Treten der Pedale erzeugt er den für die Vorführung erforderlichen Strom, mit der Hand kurbelt er den Projektor, damit das Bild auf der Leinwand erscheint und über den Trichter spricht er den Text. Beherrschen die Roten die Stadt, sind die Weißen die Bösen. Und umgekehrt. Mit fast gedankenloser Geschmeidigkeit und wie mir scheint auch mit Witz und einer gewissen Lust an seiner Wendigkeit, paßt er seine Texte den jeweiligen Machthabern an. Das sichert ihm sein Überleben. Begegnen wir nicht – damals wie heute – bei den Künstlern immer wieder diesen Paschas?
Im Jahr 2003 erschien Alexander Mittas Film auf DVD. Wann ich ihn geschenkt bekam, weiß ich nicht. Aber in den letzten Jahren habe ich ihn wieder und wieder gesehen. Die einstigen Empfindungen kehrten zurück, vergessene Szenen traten hervor, ich genoß »Leuchte, mein Stern, leuchte«, diese Tragikomödie, als Gesamtkunstwerk in Bild und Ton, Farbe und Licht. Das überbordend Komödiantische von Iskremas schob sich für mich in den Vordergrund. Etwa wenn er Shakespeare liest und dabei weint und lacht, wenn er mit dem Waisenmädchen Kryssja, die er zur Schauspielerin ausbildet, die Rolle der Jeanne d'Arc einübt, ihr zeigt, welches Temperament dazu notwendig ist, um die Zuschauer zu bewegen. Seine Gestik, Mimik: umwerfend. Oder die Slapsticknummer, als die Weißen von ihm eine kleine Soiree fordern und er mit den beiden ältlichen Soubretten übt, um schließlich zu kapitulieren und Pascha das Feld zu überlassen.
Oder die große Szene, in der Schauspieler, Maler und Filmvorführer nach dem Schwitzbad, in dem sie sich mit Birkenzweigen peitschen, in Fjodors Haus zu einem Festmahl mit Langusten, Kascha und Schnaps zusammenkommen. Pascha genießt, Iskremas debattiert über Kunst, Fjodor spricht, wie immer, kaum ein Wort. Sie feiern und lachen. Und da erscheint – die Weißen haben für kurze Zeit auf ihrem Weg auf die Krim zu Wrangel die Stadt erobert – deren Stabskapitän. Er betrachtet mit Wohlwollen die Arbeiten des Malers, will mitfeiern. Aber aus den Gesichtern ist das Lachen verschwunden, erstarrt verdecken sie mit ihren Körpern eines der Gemälde. Der Stabskapitän heißt sie beiseitetreten, und da wird das Symbol der Sowjetmacht, werden Hammer und Sichel sichtbar. Der Weißgardist gibt daraufhin seinem Burschen den Befehl, den Maler abzuführen und im entfernten Keller zu arretieren. Schon nach kurzer Zeit aber kehrt er zurück, er hat den Maler, um sich den Weg zu ersparen, erschossen. Iskremas hält nicht an sich, wütend attackiert er den Weißen, was das Kuckuckspiel und danach seine Auspeitschung zur Folge hat.
Schließlich das Ende des in fünf Akte und einen Epilog gegliederten Films. Die Bolschewiki beherrschen wieder das Städtchen. Iskremas läßt sich von einem zu den marodierenden Banden übergelaufenen Roten, der vorgibt Schauspieler werden zu wollen, verführen. Die Banditen haben einen teuflischen Plan. Am Spielort, einer alten zerstörten Kirche, postieren sie sich bewaffnet und mit einem Maschinengewehr auf der Bühne. Iskremas' Entsetzen. Und als der Vorhang aufgeht, auch das der Zuschauer. Doch Iskremas, mit seiner Theatertechnik vertraut, springt in den Vorhang, schwingt sich mit ihm hinab und bedeckt damit die Banditen, so daß die Zuschauer, unter ihnen auch der rote Kommissar, in diesem Moment der Verwirrung, Zeit zur Flucht haben. Und dann leistet sich der Schauspieler sein komödiantisches Bravourstück, indem er seinen eigenen Tod simuliert. Ein Schuß ins Herz. Kryssja kniet neben ihm nieder, um ihn zu beweinen. Da richtet er sich auf. Es ist Theaterblut, mit dem er die angebliche Wunde getränkt hat. Der rote Kommissar erscheint. Iskremas stellt sich augenblicklich wieder tot. Serdjuk verneigt sich, bezeugt dem Toten die Ehre, erklärt ihn, da er so vielen Menschen das Leben gerettet hat, zum Helden. Iskremas aber schämt sich seines Komödienspiels. Er beschließt, die Stadt zu verlassen, gen Moskau zu ziehen. Kryssja wird mit ihm gehen. Im Epilog dann der von Pegasus gezogene Thespiskarren, in dem das schlafende Mädchen liegt. Iskremas sieht im Gebüsch einen der Banditen, er weiß, was geschehen wird, er spornt mit mehrfachen Rufen das Pferd an, der Wagen zieht ohne ihn weiter. Kryssja ist gerettet. Er aber wird erschossen.
Alexander Mittas »Leuchte, mein Stern, leuchte« ist es nicht allein, der mich seit nunmehr einem halben Jahrhundert begleitet. Da ist bereits in der Oberschulzeit der Film »Die Kraniche ziehen«, der mich tief beeindruckte. Da sind Filme wie »Ein Menschenschicksal«, »Die Kommissarin«, da ist Tarkowskis wunderbarer »Andrej Rubljow« und sein »Stalker«, schließlich die großen Romanverfilmungen: Dostojewskis »Die Brüder Karamasow«, »Anna Karenina« und Bondartschuks großartiges siebenstündiges Epos »Krieg und Frieden« nach den Romanen von Tolstoi. Alle diese sowjetischen Filme haben mich geprägt und sind unvergessen.
(2022)
Hermann Hesse: Anwalt des Individuums
Im Sommer 2003 war ich Stipendiatin der Calwer Hermann-Hesse-Stiftung. Was hätte näher gelegen, als sich mit dem in Calw geborenen Hesse zu beschäftigen. Aber ich schrieb ein Buch über Schiller, war ganz auf Friedrich Schiller fixiert. Als ich in Calw das erste Mal im Haus meines Nachbarn Piet Schaber war, führte er mich in ein Zimmer: Hier sei Hesse am 2. Juli 1877 geboren. 25 000 Besucher hätten im Vorjahr zum 125-jährigen Jubiläum an diesem Ort geweilt. Ich hätte das Glück, hier allein zu stehen. Auch in der Stadt entkam man Hermann Hesse nicht. An einer Häuserwand standen seine Worte vom »Wasser« als »Stimme des Lebens«, als des »Seienden, des ewig Werdenden«, und aus einer Art Grotte an der Leseinsel ertönte seine Stimme; mit schweizerischem Anklang und schwäbischem Akzent trug er in getragenem Ton seine Gedichte vor. Und auf der Brücke über die Nagold stand er in Bronze gegossen; kein Denkmal auf hohem Sockel, sondern die Füße auf der Erde, die eine Hand lässig in der Hosentasche. Auch ein Museum war im Jubiläumsjahr für den Sohn der Stadt eröffnet worden. Vergeblich suchte ich darin nach einem Dokument über seinen Verleger Unseld.
Heute, 2021, weiß ich: Sechsundzwanzig Jahre ist Siegfried Unseld, als er sich im August 1951 auf den Weg zu dem zu diesem Zeitpunkt vierundsiebzigjährigen Hermann Hesse macht. Er hat über Hesse promoviert und arbeitet als Buchhändler in Heidenheim. In der Schweiz, in Montagnola angekommen, findet er am vergitterten Türfenster des Schriftstellers eine Nachricht: »Wenn einer alt geworden ist und das Seine getan hat, steht ihm zu, sich in der Stille mit dem Tod zu befreunden. Nicht bedarf er der Menschen. An der Pforte seiner Behausung ziemt es sich, vorbeizugehen, als wäre sie niemandes Wohnung.« Siegfried Unseld wagt nicht einzutreten, aber als er im Dorf erfährt, Hesse sei gar nicht zu Hause, sondern bei seinem Mäzen Max Wassmer auf Schloß Bremgarten, macht er sich auf den Weg. Und er hat Glück. Er wird empfangen.
Der »junge Fremde aus Ulm hieß Unseld, er war nett, er gefiel uns gut«, notiert Hermann Hesse. Er, der seine Bücher »Peter Camenzind«, »Unterm Rad« oder den »Steppenwolf« stets zwischen depressiven Abstürzen in kurzen Phasen des Schreibrausches schrieb, hat an seinem letzten Werk, dem »Glasperlenspiel«, zehn Jahre, von 1932 bis 1942 gearbeitet. In Nazideutschland durfte es nicht erscheinen. Erst 1946 kann Suhrkamp es verlegen. In kurzer Zeit erreicht es eine Auflage von zwei Millionen.
In mehr als 60 Sprachen sind Hermann Hesses Bücher übersetzt. 1946 wird ihm der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt und der Nobelpreis für Literatur verliehen. Er reist weder nach Frankfurt noch nach Stockholm. Dem Kulturbetrieb und der literarischen Öffentlichkeit steht er äußerst fern. Zurückgezogen lebt er in dritter Ehe mit seiner Frau Ninon, geborene Ausländer aus Czernowitz in der Casa Rossa in Montagnola. Er sei »in den letzten Jahren vollends in den Ruhestand getreten«, schreibt er 1944 an Peter Weiss. Und am 23. November 1945 heißt es an Peter Suhrkamp: »Neues schreibe ich kaum mehr, bin überhaupt des Treibens vollkommen müde, habe ja das Meine auch getan.« Kleinere Arbeiten entstehen, vor allem beantwortet er Briefe, von »täglicher Brieffron« spricht er, er malt seine Aquarelle, er arbeitet im Garten, er liebt es, vor einem brennenden Reisighaufen zu sitzen und Zweig um Zweig verglühen zu sehen.
Der sechsundzwanzigjährige Unseld erzählt in der Runde auf Schloß Bremgarten, daß er mit Freunden einen Verlag gründen wolle. Hesse verweist ihn hierauf an seinen Verleger Peter Suhrkamp; wenig später bewirbt sich Unseld bei ihm. Am 1. Januar 1952 tritt er in den Verlag ein, wird, wie er selbst sagt, »für Suhrkamp linke oder rechte Hand« oder wie Peter Suhrkamp sich ausdrückt: »der junge Hund«. Nicht einmal sieben Jahre nach der ersten Begegnung zwischen Hesse und Unseld, am 1. Januar 1958, teilt der Verleger Hesse mit, er habe Siegfried Unseld als seinen Nachfolger nominiert. Nach dem Tod von Suhrkamp am 31. März 1959 tritt er sein Amt an.
Unselds bewundernswertes Vermögen, mit seinen Autoren umzugehen. Wie später Peter Handke und Thomas Bernhard ist Hermann Hesse ein schwieriger Autor. Er beharrt auf Frakturschrift, findet die Typographie des Verlages scheußlich, lehnt Taschenbücher generell ab, sie bedeuten ihm unzumutbare Verramschung seines Werkes. Wutausbrüche. Streit. »Sie sind ein Mann von Heute, ich einer von Gestern«, hält Hesse Unseld entgegen. Schreibt empört, als dieser die Herausgabe des »Glasperlenspiels« im Deutschen Taschenbuchverlag plant, es sei ihm »schmerzlich, daß noch vor meinem Tode mein Lebenswerk verschleudert werden soll«; es täte ihm »weh«, es sei, »wie wenn man vor meinen Augen meinen Hausrat versteigern würde«. Unseld nimmt daraufhin selbstverständlich von seinem Vorhaben Abstand. Aber er läßt nicht locker. Erinnernd heißt es: »Ich trug bei meinem nächsten Besuch noch einmal die Taschenbuchfrage vor. Ich versuchte, Hesse von der Notwendigkeit solcher Ausgaben zu überzeugen. Damals sagte er mir, ich möchte doch eine Form finden, solche billigen Bände im eigenen Verlag herauszugeben. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Haltung Hesses entstand dann bei mir die Idee, selbst eine Art Taschenbuchreihe vorzulegen.« Damit war die »edition suhrkamp« geboren.
Am 2. Juli 1962 feiert Hermann Hesse seinen 85. Geburtstag. Er hat Leukämie, was man ihm verschweigt. An seinem letzten Lebenstag, dem 8. August 1962, macht er mit Ninon einen Spaziergang. Als sie an einer Robinie vorbeikommen, reißt er an einem trockenen Ast und sagt: »Er hält noch.« Am Abend entsteht sein letztes Gedicht »Knarren eines geknickten Astes«. Bis 23 Uhr hört er Mozarts Sonate C-Dur Nr. 7, KV 309. In der Nacht zum 9. August stirbt er im Schlaf an einem Hirnschlag. Siegfried Unseld eilt auf Bitten von Ninon Hesse herbei, steht mit ihr, den Söhnen und zwei Enkeln vor dem Toten: »Er lag entspannt und friedlich da, wie ein Mensch, der vollkommen ans Ziel gelangt ist«, bezeugt er. Er ist zugegen, als Hesse in den Sarg gelegt wird; ein Zinksarg, der anschließend zugelötet wird. »Vielleicht war es der erste und letzte Einbruch der Technik in dieses Zimmer«, bemerkt Unseld dazu.
Am 11. August wird Hermann Hesse auf dem Friedhof Sant'Abbondio in Gentilino zu Grabe getragen. Unseld spricht das Gedicht »Leb wohl Frau Welt«. Als Ironie der Geschichte erscheint es, daß dicht unter der letzten Ruhestätte dieses Technik-, Großstadt- und Autolärmhassers ein Tunnel der Gotthard-Autobahn nach Mailand verläuft.
Die Nachrufe sind alles andere als freundlich. Rudolf Walter Leonhardt schreibt am 17. August in der »Zeit«: »Mit Hesse, sagen wir's deutlich, ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen.« Schon 1957 maßt sich der Kritiker Karlheinz Deschner das Urteil an, die meisten Hesse-Werke seien noch nicht einmal zweitrangig. Die Gruppe 47 besteht aus lauter Hesse-Verächtern; er gilt als altmodisch, man will von seinen »Lebenssinnsucher-Epen« nichts mehr wissen.
Der Verleger Siegfried Unseld hält unbeirrbar zu »seinem« Autor. Bereits wenn man sein Haus in der Frankfurter Klettenbergstraße betrat, war das zu spüren. In den Räumen zu ebener Erde begegnete man den Aquarellen von Hermann Hesse. Vierzig Jahre, bis zu seinem Tod – Unseld starb am 26. Oktober 2002 mit achtundsiebzig Jahren –, hat er sich mit nicht nachlassender Beharrlichkeit um das Werk von Hesse bemüht. Es gelingt ihm, ihn zum weltweit meistgelesenen deutschen Autor zu machen. Sein verlegerischer Instinkt, sein Geschick. Ein Beispiel: Mitte der fünfziger Jahre kauft er für 2000 Dollar die Rechte für den – trotz Nobelpreis – in den USA weithin unbekannten Hesse. Wie konnte er ahnen, daß in den späten sechziger Jahren durch die Hippie-Bewegung dort und die 68er in Europa eine Hesse-Renaissance einsetzte? Er konnte es eben.
Unseld selbst ediert den Briefwechsel zwischen Hesse und Peter Suhrkamp. 1964 erscheint sein Buch »Begegnungen mit Hermann Hesse«. »Es möchte Erinnerungen sammeln und gleichzeitig ein Zeugnis der Dankbarkeit sein«, heißt es in der Vorbemerkung. 2000 legt er eine Auswahl von 25 Gedichten unter dem Titel »Hermann Hesse. Wege nach Innen« im Insel Verlag vor, mit Aquarellen und Hesses Handschriften der Gedichte. Ein besonders schönes Insel-Bändchen.
Mit Volker Michels bindet er sehr früh einen jungen Wissenschaftler an seinen Verlag, der sich lebenslang vorbildlich der Edition von Hesses Gesamtwerk, dem erzählerischen, essayistischen und den Briefen annimmt. Von 1973 bis 1986 erscheinen die »Gesammelten Briefe«, von 2001 bis 2007 »Sämtliche Werke in 20 Bänden«. Selbst die Werkausgabe ist als Taschenbuch erhältlich. Ebenso die Romane und Erzählungen in schön gestalteten Einzelausgaben. Und immer wieder publiziert Volker Michels Fundstücke aus dem Nachlaß Hesses. Und er stellt Bändchen unter thematischen Gesichtspunkten zusammen.
Eines davon bekomme ich zum Geburtstag 2020 von meinem Malerfreund Lutz Friedel geschenkt: »Hermann Hesse. Tessin. Betrachtungen, Gedichte und Aquarelle«. Ich beginne zu lesen. Es animiert mich, meine Lektüre der Studentenzeit wieder aufzunehmen, beglückt vertiefe ich mich erneut in Hesses »Unterm Rad«, seinen »Steppenwolf«. Hole mir aus der Bibliothek das »Glasperlenspiel«, finde keinen Zugang, lege das Buch beiseite und kehre zu dem Tessin-Büchlein zurück.
Seit 1919 lebt Hermann Hesse in der Schweiz. In seinem Text »Vierzig Jahre Montagnola« heißt es, er »habe in Montagnola viel Gutes, ja Wunderbares erlebt, von Klingsors flackerndem Sommer bis heute, und habe dem Dorf und seiner Landschaft viel zu danken«. Berührend wie der siebenundsiebzigjährige Hesse in den »Tagebuchblättern 1955« davon schreibt, wie er im Rundfunk, gelesen von einem Schauspieler, ein Kapitel aus seinem »Klingsor« hört. »Es zog mich … völlig in die Erzählung hinein, die ich nur sehr fragmentarisch im Gedächtnis hatte.« Er begegnet sich selbst »in dem brennende‹n› Sommer 1919, dem ersten nach dem Krieg, dem ersten meines Tessiner Lebens«. Während des ganzen Vorlesens sieht er sich »viel weniger wirklich als sein aus der Zeitentiefe zurückbeschworenes Selbstbild«.
Als sei die Zeit über ihn hinweggegangen, bezeichnet er sich als »erloschene‹n› Alte‹n›«. An anderer Stelle spricht er von sich als »eine‹m› von den gebrechlichen und etwas komischen Gemeinde-Greisen, der nicht daran denkt, mit irgend etwas von vorn zu beginnen, der sein Grundstück kaum mehr verläßt und drunten auf dem Friedhof von St. Abbondio einen hübschen kleinen Platz gekauft hat«.
Als Hesse 1919 nach Montagnola kommt, bezieht er eine kleine Wohnung in der Casa Camuzzi, sie ist nicht heizbar, so daß er im Herbst und über den Winter den Ort verlassen muß. Ein Jahrzehnt später schlägt ihm sein Freund und Mäzen H. C. Bodmer den Bau eines eigenen Hauses vor. Er erwirbt für Hesse ein 11 000 qm großes Südgrundstück mit Blick auf den Luganer See, baut nach dessen Vorstellungen darauf ein Haus. Als es 1931 fertig ist, will Bodmer es Hesse schenken. Aber dieser lehnt ab. So stellt ihm der Mäzen in »Anerkennung seines dichterischen Werkes« eine Urkunde aus, die ihm »Wohnrecht auf Lebenszeit« einräumt. Der »hübsche Platz«, das kleine Stück Erde im unteren Teil des Friedhofs an der Mauer mit dem dahinter aufragenden Turm von Sant'Abbondio bleibt Hesses einziger Grundbesitz.
Meine Lektüre des Tessin-Büchleins. Ich lese Hesses Schilderungen der Landschaft, seiner Menschen, er schreibt über die Dorfälteste, die Witwe Nina, über seinen Gärtner Lorenzo Cereghetti, über seinen Nachbarn Mario. Und bissig über die Zweischneidigkeit des Fortschritts, die Veränderung des einstigen einsamen Bergdorfes durch Touristenströme und Bodenspekulanten. Ich erlebe, wie Hermann Hesse im Garten seine »Köhlermeile« aufschichtet und am Feuer sitzt, wie er mit seinem Klappstühlchen und den Malutensilien zum Aquarellieren auszieht. Berührend sein Märchen »Vogel«, seine »Klage um einen alten Baum«, sein Gespräch mit einem ihm zugeflogenen kleinen Papagei, einem Sittich, seine feine Beobachtung eines entschwebenden Schmetterlings.
Am berührendsten aber ist für mich der Text: das »Kaminfegerchen«. Der fünfundsiebzigjährige Hesse schreibt: »Sehr selten noch raffe ich mich auf, den Weg bis in unser Dorf, oder auch nur bis ans Ende unsres Grundstücks, zurückzulegen.« Einmal aber fährt er mit seiner Frau Ninon nach Locarno. Es ist Karneval, und er findet sich inmitten der Zuschauer – da erblickt er einen kleinen Jungen im Kostüm eines Kaminfegers »mit schwarze‹m› Zylinderhütchen … den einen seiner Arme durch ein Leiterchen gesteckt, auch eine Kaminfegerbürste fehlte nicht, … und das kleine liebe Gesicht war ein wenig mit Ruß oder andrem Schwarz gefärbt«. Aber – so beobachtet Hesse – der Kleine hatte »keinerlei Bewußtsein davon, daß er ein Kostüm trage und einen Kaminfeger darstellte«, selbstvergessen steht er mit träumerisch entzückten Augen in der Menge. Mit einem Höchstmaß an Genauigkeit und Aufmerken beschreibt Hesse ihn. Dieser Text enthält alles, was für mich Hermann Hesse ausmacht, ihn, den »Anwalt des Individuums«, der den Einzelnen schützen und widerstandsfähig machen, seine seelischen Kräfte stärken will, ihn, dessen durchgängig großes Thema die Selbstverwirklichung des Menschen ist.
Mein Malerfreund hat in dem mir geschenkten Büchlein auf der Seite mit dem Gedicht »Regen im Herbst« ein handgeschriebenes Blatt eingelegt, darauf steht, bezogen auf die gegenwärtige Corona-Krise und den Lockdown: »Dieses augenblickliche Gejammer ringsum – und dann solche Zeilen!«
Ist in der ersten Strophe des Gedichts von Herbst, Absterben und Tod die Rede, so hebt die zweite an: »Du aber traure, Lieber, / Nicht dem begrabenen Nachbarn, / Nicht dem Sommerglück länger nach / Noch den Festen der Jugend!« Und dann folgt, was er bewundernd mit solche‹n› Zeilen apostrophiert: »Alles dauert in frommer Erinnerung, / Bleibt im Wort, im Bild, im Liede bewahrt, / Ewig bereit zur Feier der Rückkehr / Im erneuten, im edlern Gewand. / Hilf bewahren du, hilf verwandeln, / …«
Es ist nichts anderes als die Aufforderung – an ihn, an mich – zum Weitergehen, zur Produktivität, zum Bewahren im Wort, im Bild.
(2022)
Zu Ulrich Schacht: »Mein Herz ergeht sich in Ovationen«
Es war in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin, eine Feier der Zeitschrift »Sinn und Form«, als mich Sebastian Kleinschmidt mit Ulrich Schacht bekannt machte. Das Wort vom hohen Norden fiel von seiner Seite. Und dieser war dann auch Gegenstand meines ersten Gesprächs mit Ulrich Schacht. Ich wußte nichts über sein Leben, hatte keines seiner Bücher gelesen. Aber er war mir sofort sympathisch und unser Gesprächsgegenstand erschuf eine schöne Nähe zwischen uns. Heute denke ich, es war, wie Ulrich Schacht einmal über die »Magie der Literatur« schrieb: »Menschen wiedererkennen, denen man nie zuvor begegnet ist«.
Dann las ich sein 2011 im Aufbau-Verlag erschienenes Buch »Vereister Sommer. Auf der Suche nach meinem russischen Vater«. Wir begannen Briefe zu tauschen. Und Bücher. 2013 schickte er mir seinen Gedichtband »Bell Island im Eismeer« mit der Widmung »… vom Dichter, der sich am Eise wärmt …«.
Einzig über dieses Buch möchte ich hier sprechen. Ich fand darin Gedichte über Kulusuk in Ostgrönland, über Rejkjavik, einen Zyklus in sechs Tafeln über Svalbard (Spitzbergen), alles Orte, die ich von meinen Schiffsreisen kannte. Von 1991-95 hatte Ulrich Schacht Künstlerexpeditionen in die Arktisregionen Norwegens und Rußlands organisiert. Er wußte, wovon er sprach. Beeindruckende Gedichte von prosaischer Sprödigkeit, kurze rhythmische Zeilen von eindringlicher Genauigkeit und poetischer Schönheit.
Am meisten aber liebe ich die Verse, die den Dichter, den »Auswanderer«, in seinem Haus in Schweden zeigen, in dem ihn »Brot und Wein und das / noch ungeschriebene Wort« erwarten. Diese Gedichte sind »die Lust an nichts als der Gegenwart« (Peter Handke). Da ist von Morgen und Abend, von den Lustkoloraturen der Vögel, vom Mond unter den Sternen hoch über dem Meer, von Regentropfen und Schiffen am Horizont, von der Ankunft der Farben, dem Flug der Dohlen, den Geräuschen der Pappeln, dem Tanz der Insekten, dem windlosen Blätterfall die Rede.
Alles was der Dichter sieht, hört, erlebt, führt ihn zu sich: »Ein Tag an dem ich wußte wer / ich bin ein Tag an dem ich wußte wer / ich werde … / … Ich war allein. Ich war / bei mir. Ich war der, den ich traf.«
Verse von berückender Übereinstimmung von Ich und Universum: »… Haben wir / Augen, haben wir das / Geheimnis der Welt gesehen. … Welt ist nicht, wo die Welt / ist Welt ist grünes Element ist blaues / Atmen Rauschen Licht die Stille / hinterm Wind. Haus ohne Haus.«
Ich lese diese Verse beglückt wieder und wieder. Und wie es dem Dichter geschieht, überträgt es sich auf mich, die Leserin: »Mein Herz ergeht / sich in Ovationen«.
(2021)
Zum Zyklus »Totentanz« des Malers Lutz Friedel
»Der Tod betrifft uns nicht. Solange wir da sind, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr.« Diese provokativ lapidare Äußerung des 271 vor Christus verstorbenen griechischen Philosophen Epikur hat kaum Anklang und Nachhall gefunden, gibt sie doch vor, die Auseinandersetzung mit dem Tod sei überflüssig.
Seit Menschengedenken aber und über die Jahrhunderte ist die Endlichkeit des Lebens und die Angst vor dem Tod in allen Kulturen ein immerwährendes existentielles Thema. Davon zeugen nicht nur die uralten Bestattungsriten, sondern ebenso die Darstellungen des Todes in der Bildenden Kunst. Erinnert sei an die in Europa seit dem Mittelalter geschaffenen Totentänze, die bis ins 20. Jahrhundert ihre Nachfolge finden, in den Arbeiten von Horst Janssen, HAP Grieshaber und Alfred Hrdlicka, um nur drei aus der jüngsten Vergangenheit zu nennen.
Nun, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ein »Totentanz« im Werk des Holzbildhauers und Malers Lutz Friedel. Was drängt ihn zu diesem Thema? Das Gefühl der eigenen Endlichkeit, das Herannahen des Alters, der gegenwärtige Weltzustand? Das Ende des Kalten Krieges führte keineswegs zu der erhofften Befriedung, im Gegenteil, die Wende zum 21. Jahrhundert gab und gibt apokalyptischen Gedankengängen neue Nahrung, durch von Menschenhand herbeigeführte oder durch Naturgewalten ausgelöste Katastrophen.
Die Vergänglichkeit allen Lebens ist seit jeher das Motiv eines jeden Totentanzes. Ganz voraussetzungslos taucht der Tod nicht im Werk Lutz Friedels auf. Da war das Weltuntergangsszenario »Triumfo della Morte« eines unbekannten katalanischen Malers im Stadtmuseum von Palermo, das ihn faszinierte, da waren die 4000 Mumien in der dortigen Kapuzinergruft, die er während seines Sizilienaufenthaltes 1994 besuchte. Neben seinem großen Zyklus von Holzplastiken, die er »Walhall der Namenlosen, der Nichtse« nennt, sind es vor allem die Skulpturen der Ketzer, in denen er, angeregt durch ein Zeitungsfoto, auf dem ein chinesischer Abweichler mit einem Spotthut kurz vor seiner Hinrichtung zu sehen war, »das Verhältnis des Geschlagenen zum bevorstehenden Tod« gestaltet: »Furcht, Renitenz, Zorn, Angst, Gebrochensein, Sich-Ergeben, Unerschrockenheit: alles Mensch«, kommentiert er seine Skulpturen. In seinen beiden von 2003 bis 2008 entstandenen Selbstporträt-Serien (Übermalungen von Ausstellungsplakaten), von denen die erste den Titel »103 Möglichkeiten die Zeit totzuschlagen« trägt, ist der Tod gleich mehrfach anwesend. Zwei Porträts »Selbst als Tod«, zwei »Selbst als Kapuziner (Palermo)«, »Selbst als Strangulierter«, »Selbst am letzten Tag (Picasso)« und schließlich »Selbst verbrennend«.
Ist der Tod in den zurückliegenden beiden Zyklen punktuell anwesend, taucht auf und schwindet, so war sein Sog offenbar derart stark, daß er gegenwärtig zum ausschließlichen Motiv im Werk des Künstlers geworden ist. Ein Reigen des Todes, Variationen zum immer gleichen Thema. Gemälde, Öl auf Leinwand, in großem Format 130 × 100 cm, weit über ein Dutzend, und kleine Bilder, 40 × 20, 40 × 25, 40 × 30, ebenfalls Öl auf Leinwand oder Malkarton, über zweihundert.
Als mir Lutz Friedel am Tag des Frühlingsbeginns 2011 in seinem Atelier in Schönholz im Havelland seine Arbeiten zeigte, schien mir der Tod ein einziges Fest der Sinne: Verführung durch Farben. Warmwallend und zugleich den Keim eines Weltfeuers assoziierend die rote Übermalung im »Zeitgeist«. Dunkel erdene Farben, die der Maler zum Leuchten bringt: »Der Tod und der Bildhauer«. Die grüne Halluzination im »Der Tod und der Frühling«. Wahnsinn in Gelb und Orange, Zinnober und Violett. Schattenfahl. Ein Schamrot in »Der Tod kokelt«. Das Kreideblei, Kreideweiß der leeren Leinwand in dem mehrfach gemalten Bild »Der Tod und der Maler«; die Unausweichlichkeit, dem Künstler ist die Farbpalette entrissen; aber sein Widerstand geht selbst dem Tod über seine Kräfte, auf einem der Bilder sitzt der Knochenmann erschöpft und zusammengesunken auf einem Stuhl neben der Staffelei.
Und dann das wunderliche Blau in feinsten Spuren in dem großformatigen »Der Tod und der Autofahrer«, das man jenseits des Titels auch als ein reines Natur- oder Landschaftsbild wahrnehmen kann. Eine Landstraße bei Nacht, überwölbt mit uralten Bäumen, von einem unsichtbaren Scheinwerfer angestrahlt, in malerischer Finesse erscheint die schwarze Üppigkeit des Geästs, Details, einzelne Blätter werden in ihrer malerischen Schönheit sichtbar. Am Ende des Baumtunnels ein gleißendes Licht … Der Tod oder der Beginn von etwas Neuem? Das satte Schwarz und Weiß in seiner Metaphorik, deren mögliche Umkehr. Und im oberen Bildteil in kleinsten Spuren dieses wunderliche wunderbare Blau.
Der erste Eindruck des »Totentanz«-Zyklus: Die Farbe hat die Krüge voll ausgeschüttet, die Leinwand durchtränkt, die Pinselführung ist zielgelenkt, die Linienzeichnung energiegeladen.
Mir scheint, es geht dem Maler wie dem alten Goethe. Dieser negierte den Tod bis in sein hohes Alter, dann stellte er sich ihm und ging ein fast heiteres, produktives Verhältnis mit ihm ein. So auch Lutz Friedel. Der für alle seine Arbeiten charakteristische hintergründige Humor findet sich hier sogar verstärkt. Ebenso seine Ironie, die aber nie resignativ, sondern immer welterschließend ist. Das macht den Zyklus so reizvoll.
Die »Neugier« hat der Künstler einmal die »Freßlust der Sinne« genannt, sie sei »das immer Wiederkehrende, seit Urzeiten«. Diese Neugier, die Begier zu wissen ist der treibende Motor seines »Totentanzes«: Erkenntnisgewinn im Umgang mit dem Tod. Ist es ein Einlernen des Todes, ein Vorlaufen zu ihm oder ein Zurückgehen?
In meinen »Tage- und Nächtebüchern aus Lappland« begegnet der sechzigjährigen Frau auf ihrer einsamen Wanderung durch Lappland am Ende ihres Weges der Tod in der Gestalt eines fettleibigen Mannes, der vor einem Zelt sitzt und liest. Der Tod grüßt, sie erwidert seinen Gruß. Und geht an ihm vorüber. »Ich bin ganz ruhig«, sagt sie sich dann, »wir täuschen uns, wenn wir den Tod nur immer vor uns sehen, ein großer Teil von ihm liegt bereits hinter uns, hinter mir, es ist die Zeit, die ich bisher durchlebt habe, die hat der Tod schon.«
In diesem Sinn ist der »Totentanz«-Zyklus des Malers auch Selbstbefragung, Zurückgehen in die eigene Biographie, Reflexion von Illusionen, von Begegnungen und nahen Menschen, von Enttäuschungen, ist die summa summarum von Gewinn und Verlust, Höhen und Tiefen: die Gemälde ein grandioser Tanz der Gespenster, der aus den kleinen und großen Abschieden seiner Existenz, wie auch der Existenz eines jeden von uns, hervorgehen. Nicht als Bruder des Schlafes, als Jüngling mit der sich senkenden Fackel, in der seit der Aufklärung üblichen sanften Form, erscheint der Tod in Friedels Gemälden, sondern in der volkstümlich traditionellen Gestalt als Gerippe. Der Schnitter, der Schrecken verbreitet: »Tod sein Kind fressend«, »Der Tod und das Kind (das weiße Band)«, »Tod und die Schwangere«. Der Sensenmann, der zwischen Mann und Frau tritt: ihr leibliches Ende oder das ihrer Liebe? Werden und Vergehen, der Kreislauf des Lebens, der Tod mit dem Frühling, dem Winter. Der Knochenmann als Verführer, sein Weinglas hebend, als Musiker, wie der Rattenfänger mit seinen Melodien lockend. Seine Unerbittlichkeit: »Tod mit Pauke«. Und Gemälde, in denen der erzählende Gestus zurücktritt und die reinen Farbflächen sprechen: »Der Schrei«, »Tod als Skorpion«. Und der lächerliche Tod, der sich der ihn umschwirrenden Insekten erwehren muß.
In diesem grandiosen Tanz der Gespenster gibt es keine Mahnung zu Buße oder Umkehr wie in den mittelalterlichen Totentänzen. Keine vordergründige Religiosität, weder Verheißung noch Weltgericht, noch ein System von Belohnung und Bestrafung wie es jenes »Confutatis maledictis, flammisaribus a dictis …« (Wenn Empörung, Fluch und Rache wird gebüßt in heißen Flammen …) aus Mozarts »Requiem« nahelegt.
Himmel und Hölle sind allein vom Menschen geschaffen. Es ist der ewige Kreislauf der Natur, in den wir eingebunden sind. Dem begegnet der Mensch mit »Furcht, Renitenz, Zorn, Angst, Gebrochensein, Sich-Ergeben, Unerschrockenheit«. Die Diesseitigkeit dieses »Totentanz«-Zyklus. Immer – sagen die Bilder – steht der Tod uns über dem Scheitel, mitten im Leben sind wir von ihm umgeben. Er kann ein angebrochener Tag sein, er kann die Minuten zählen und sie auslöschen, aber in der malerischen Verführung ist der Tod auch derjenige, der die vollen Tage noch auf den Tischen stehen läßt und mich oder uns, die Betrachter, zur Empfindung unserer bemessenen Zeitlichkeit führt.
Als der Tod mit großen Schritten auf den Dichter Franz Fühmann zukam, umgab er sich in seinem Krankenzimmer in der Charité mit Blättern aus HAP Grieshabers Holzstichen »Totentanz von Basel«. Heute würden vielleicht Gemälde von Lutz Friedel hinzutreten, aus seinem »Totentanz«-Zyklus, diesem Fest der Farben, diesem Fest der Sinne.
(2011)
»den rückzug vor uns alle wege offen«
Die Dichterin Róža Domašcyna
Als ich, ermutigt von der schönen Geste der Stadt Fellbach, dem Mörike-Preis einen Förderpreis beizugesellen, auf die Suche nach einer Preisträgerin ging, fand ich Róža Domašcyna. Eine Dichterin, die etwas zu sagen hat: über die Liebe und den Leib, über das Absterben der Pflanzen und unserer Körper, über unsere Gier nach mehr, mit der wir die Natur und damit uns selbst zerstören. Sie sagt es ohne Anklage, ohne Koketterie: Selbstbefragung, Zweifel, eigenes Verschulden, den Dingen auf den Grund gehen.
Sorbin ist sie, gehört jenem kleinen Volk an, das seit 600 im Gebiet der Lausitz siedelt. Ein dörfliches Volk, das niemals einen eigenen Staat bildete. Als Slawen repräsentieren die Sorben den Osten des Westens. Heute leben etwa sechzigtausend Sorben dort, beheimatet nun im östlichsten Osten des Westens.
Zu DDR-Zeiten wurden die Sorben stark gefördert. Der Preis – freilich – war die Einordnung. Eine »übervorteilte Minderheit«? – »Zu Tode gefördert«, wie man jetzt hört? Ja und nein. Kultursimulation, gewiß, war vieles. Aber nicht alles war Maske, Schein. Es waren da Menschen.
Umgang mit Anderssein. »Ernstgenommen zu werden, auch wenn man klein ist, ist ein Menschenrecht«, sagt Róža Domašcyna.
Ihre Muttersprache, das Sorbische, verstehe ich nicht, aber ich habe ihren Klang im Ohr. Eine slawische Sprache, weicher, melodischer, von anderer Temperatur. Sie begegnete mir in den Stimmen, Gesängen der sorbischen Osterreiter. Dieses Osterreiten, in DDR-Zeiten ein magischer Vorgang. Jahr für Jahr zog es mich dorthin. Gesichter gab es da. Was für Gesichter! Und etwas, das über Jahrhunderte kaum Unterbrechung erfahren hatte. Im Frühjahr das Reiten über Fluren und Wege, ein heidnischer Brauch, von der Kirche übernommen, im Gebiet der katholischen Sorben um Hoyerswerda, Kamenz und Bautzen, bis heute lebendig. Am Ostersonntag nach dem Gottesdienst umkreisen die Männer in festlicher Kleidung auf dem Rücken ihrer Pferde mehrmals Kirch- und Friedhof, die alten Choräle singend. Dann reiten sie in die Nachbardörfer. Züge und Gegenzüge. Die Landschaft ist den ganzen Tag von den langen Prozessionen der Osterreiter erfüllt.
Dort, im Dorf Zerna, sorbisch Sernjany, wurde die Dichterin 1951 geboren. »Unter einem gewaltig mildtätigen horizont. Knapp über der hölle«; Nachkrieg, der Vater den »wandernden Granatsplitter« im Leib, der »kartoffelacker«, wo er seine »uniform verbrannte«. Die Mutter täglich in sorbischer Tracht. In »die sachen wachsen … die die truhe füllten: brautkranz und schleifen, das liederbuch / der rosenkranz«. Der Einbruch des »Neuen« in die festgefügte Welt: »ich ein Junger Pionier mit heiligenbild in der / hand SOISTESBESSERFALLSALLESANDERS / KOMMT sagte vater«. Pionierhalstuch, FDJ-Hemd, Fahnenappell. Karfreitagssingen, Walpurgis. Die sorbische Vogelhochzeit. Sorbische Tracht. Als Kind habe es ihr gefallen, als »exotischer Ziervogel« vorgeführt zu werden.
Legendäre Herkunft und auf sie einstürzende Gegenwart. »Das kind / in mir bewegte sich hochrot in seiner hülle, als / ob es den sarg vergessen hätte, der mit ihm / wuchs.« Die Lausitz, die Landschaft der Sorben, in der es noch »Reste stummen Einvernehmens von Mensch und Natur« gab, »Stille« noch »faßbar« war, wurde seit den zwanziger, gewalttätig dann in den fünfziger Jahren, Schauplatz eines ökologischen Exzesses. Großbauten des Sozialismus. Braunkohlenförderung. Abbaggern. Verwüstung. Devastation. Vom Siedlungsgebiet der Sorben wurden allein 78 Dörfer zerstört, der Kohle geopfert. Und es geht weiter, die nächsten sorbischen Dörfer werden Horno, Rogow, Rowno und Slepo sein. »Die heimat ist, wo wüste bleibt: na und?!« So in dem Gedicht »Isolationsgeschädigt«.
Der »exotische Ziervogel« kam aus den »jenseitigen dörfern« in die »schlafstädte«. Róža Domašcyna studierte, wurde Ingenieur-Ökonom im Bergbau, arbeitete lange Jahre im Senftenberger Braunkohlenrevier. Nicht Zuschauerin, Mitwirkende – »im roten kleid« – war sie. »Industriefest« schrieb sie sich ins »aderwerk«, sah, was sie »sehen wollte«, was verordnet war, zu sehen. Aber das verordnete, selbstverordnete Fest (wo ist die Grenze?) trug schon das Menetekel.
Wie wird man eine Dichterin? Indem man das Sosein und Anderssein aushält? Zwiespalt von Herkunft und Gegenwart?
Bereits mit neun Jahren wollte Róža Dichterin werden. Aber sie hat warten können.
1990 erschien – in Sorbisch – ihr erstes Buch, ein Jahr später – sie war vierzig – das erste in deutscher Sprache. Der Titel: »Zaungucker«, ediert in Gerhard Wolfs Verlag Janus press.
Jedes ihrer Gedichte scheint mir gewachsen zu sein, vielfache Veränderungen erfahren zu haben. Zunächst schrieb sie nur in Sorbisch, später, als sie das Literaturinstitut in Leipzig besuchte, übersetzte sie ihre Texte, heute schreibt sie zweisprachig, korrigiert von der einen in die andere Sprache.
Eine spröde, fast herbe Modellierung der Gedichte. Sorgsamster Umgang mit dem Wort, mit Lautfolgen, Klangfarben. Kein Formenspiel, keine Wortakrobatik. Da ist auch nichts gefühlig, ausufernd. Klare sinnstiftende semantische Felder, kompositorische Logik.
Da hat eine – im Warten-Können – ihr Handwerk gelernt. In keiner Tradition zu Hause, wie sie sagt, steht ihr die sorbische Bilder- und Mythenwelt zur Verfügung, ist ihr die Dichtung der Bachmann, der Achmatowa, die von García Lorca und Paul Fleming nah.
Ihre Verse sind Botschaften, Anrufungen, ja: Besprechungen. Immer wieder – durchgängig – zwei Themen. Das erste: Natur, die Folgen der Zerstörung. In ihren Gedichten jagt sie im Traum nackt an den Betonmauern der Hochhäuser entlang, von den Betonbalkonen flattern Papierbögen, bedecken ihren Körper. Bögen, »beschrieben mit fester blauer tinte die … in die haut ätzt. Es sind seiten aus flurbüchern, testamente von ausgesetzten Landtieren, irr vor Fremdheit«. Im »dreckgebirge« des Tagebaus begegnet ihr Marhata, seit Jahrhunderten Beschützerin der unberührten Natur. Marhata »griff nach ihren augen, … pflanzte sie in meine stirn«. Sie, nun mit dem Wissen Marhatas, schreit Zaubersprüche gegen das Kreischen der Bagger und Transportbänder, bis ihr die Stimme versagt: »Ich taumelte … zum grubenrand. Dort pumpten / motoren in filterbrunnen pausenlos mein blut aus / dem erdkörper.«
Eine poetische Formel, die sich ins Gedächtnis prägt. Es ist auch unser »blut«, das »pausenlos aus dem erdkörper« gepumpt wird. Die ökologischen Exzesse. »Überhebung; tilgung« ist »angesagt«. Aber die fatale Gier nach mehr wird sie nicht zulassen, nirgendwo in der Welt.
Ein zweites Thema: die Liebe. Diese Verse sind meist keine des Glücks, es sind Verse von Schmerzen und Unerfülltsein, männlichem Rückzug und aufstörenden weiblichen Ansprüchen.
Liebe, die der Dichterin »Religion und Erotik zugleich« ist, wird eingefordert, auf dringliche Art. Gegen die, die an Stelle ihrer Herzen »blechmarken« tragen, gegen »SICHLIEBENDE / ichsager die untergehakt ausschreiten / mit dem hufeisen in der tasche …«.
Die schönen starken Liebesgedichte der Róža Domašcyna legen Verwundungen von Leben und Schreiben bloß. Die Frau als Werbende, der Mann als Zögernder. Vergeblichkeit, Zurückweisung, Nichterkennen werden immer wieder thematisiert. Die bitterste Zeile wohl im Gedicht »Vom geteilten, dem doppelten leben«, wo Frau und Dichterin einander ausschließen: »und wenn ich schweig, klingt auch mein wort nicht fremd«.
Erkanntwerden als die, die man ist – die große Sehnsucht. »Zwiegesichtig sein … ein stück von mir? / Mein liebgesicht, mein schmerzgesicht … bis daß er sagt: komm jetzt, ich lad dich ein. / Dann will ich salbei tun und schachtelhalm / auf sein gesicht – den liebsten nur erkennen. / WIR: du und ich. SEIN: leben oder ruhn.« Das Gedicht trägt den Titel »Hingang«. Doppelsinn des Worts. Der Weg zum Geliebten. Hingang. Es könnte auch der Tod sein.
Liebe und Tod sind sich in vielen ihrer Verse nah. Auch in »Aufruf ins Paradies«, einer Hommage für Mato Kosyk, den sorbischen Dichter, der nach Amerika auswanderte, seine Liebesgedichte an eine Indianerin richtete. Eine Zeile von ihm ist vorangestellt: »cuzbnika smej ty a ja«, Fremdlinge sind du und ich.
Oft habe ich beim Lesen von Róža Domašcynas Versen mit ihrem sanften, entschiedenen Gestus an jenen Indianer gedacht, der sagte, erst, wenn ihr den letzten Fluß ausgetrocknet, den letzten Baum gerodet habt, werdet ihr feststellen, daß man Geld nicht essen kann.
Daß die sorbischen Mythen mit denen der Indianer verwandt seien, davon sprach Erwin Strittmatter, der Halbsorbe, der sich dazu bekannte, seine dichterische Identität den slawischen Urmüttern, den sorbischen Frauen zu verdanken.
Die Stärke der sorbischen Frauen. Nicht nur mit ihren Trachten – ausschließlich Frauen tragen sie – sind sie diejenigen, die überliefern, sie sind es auch hinsichtlich der Sprache, Kultur. Aber die weibliche Tradition ist eine mündliche. Kaum materialisiert, kaum in schwarzen Lettern auf Buchseiten.
Dichterinnen sind im Sorbischen rar. Mit Róža Domašcyna ist eine gekommen, eine, die feministischer Gebärden nicht bedarf. Selbstbewußt nimmt sie »die stimmen« der »mütter« auf, sie, »nachgeburt« ihrer »großmutter«.
Ist es die »Unfraglichkeit sorbischer Zukunftslosigkeit«, »die gestundete zeit« der Sorben, die ihr die Zunge löste, sie trieb, Gedächtnis zu sein? »Ein echo rief mit der stimme der totenfrau / ICHHÖREDICH und las mir hundert irdische / jahre aus der hand.«
Die Frage nach Untergang oder Überleben der Sorben ist so alt wie die Sorben selbst. Die Dichterin, befragt nach der Zukunft der Sorben, entgegnet: »Der einzelne muß sich zum Tun oder Nichttun entscheiden.« Sie sieht sich mit den Augen der Fremden. Verweist uns auf uns selbst. »Eine Enklave ist stets auch die Welt.«
Sensibilisiert durch die Geschicke ihres Volkes, bedrängt von der Zeit – Zeit kehrt als Motiv in ihren Gedichten immer wieder, oft als Gleichnis für den Tod –, läßt sie sich Zeit. Ihre Frage ist immer die nach dem Überleben. »Ich grab die hand mir in die tasche, grab mich ein / und schließ den mund, um stumm herauszuschrein.«
Sie faßt Geschichte nicht mit kleinen hastigen Atemzügen als kurzen Prozeß: »Zwischen der tat und dem grund ist weder atem / noch geist.« Sie verteidigt Eigenes, auch Eigensinniges, Sonderbares gegen das Uniforme, gegen gedankenlose Anpassung, gefügige Einordnung. »Das ist der freiheit weite: uniform.« Die Verse, die die jüngste Zeit reflektieren, werden bitterer, sarkastischer: »den rückzug vor uns alle wege offen«.